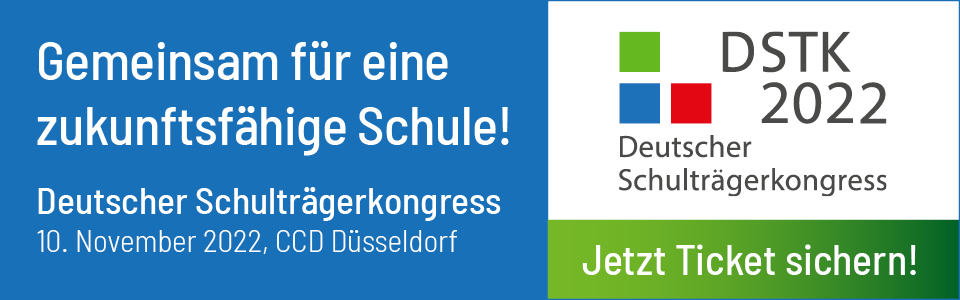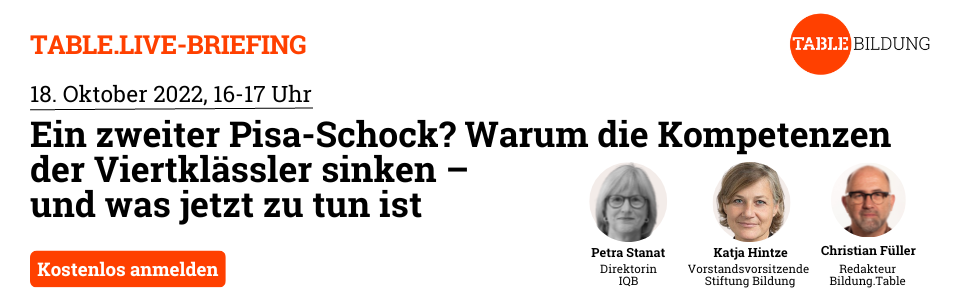ein Corona-Aufholprogramm, das Gelder mit der Gießkanne verteilt; Digitalpakt-Millionen, von denen bedürftige Kinder in Bayern dreimal mehr profitieren als in Bremen. Ein Grundrauschen begleitet solch bildungspolitisches Mäandern: fehlende Daten. Die KMK werkelt seit bald zwanzig Jahren daran, dass die Länder Schülerdaten miteinander teilen und vergleichbar machen. Nun mahnen auch Wissenschaft und Gewerkschaften und beleben eine alte Debatte um die Bildungsdaten – in die ein Player immer selbstbewusster drängt: das BMBF.
Über bessere Bildungsdaten würde sich auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken freuen, die im Interview einen Sozialindex fordert. Anlass für das Gespräch war die erste Sitzung einer neuen Bildungskommission ihrer Partei. Wolkig klingt der Titel (“Bildung in der Transformation”), konkret die Themen: vom zweiten Digitalpakt bis zur Wiederbelebung von Bildungsgerechtigkeit.
Mit einer konkreten Auswirkung der Ampel-Politik beschäftigt sich eine weitere Analyse: Die Bundesschülerkonferenz wird erstmals staatlich gefördert, mit jährlich einer Million Euro. Wir haben geschaut, wofür das Gremium das Geld einsetzen möchte und für welches große Ziel sich die Schülervertretung auf Bundesebene einsetzen will.
Und schließlich möchten wir Sie herzlich zum nächsten Live-Briefing einladen. Petra Stanat, IQB-Direktorin, und Katja Hintze, Vorsitzende der Stiftung Bildung, diskutieren gemeinsam die Detailergebnisse des IQB-Bildungstrends, die am Montag veröffentlicht werden. Setzen Sie sich am nächsten Dienstag, 18. Oktober von 16 bis 17 Uhr digital an unseren Tisch. Hier geht’s zur Anmeldung.
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht,

Die Datenbasis, auf die sich Bildungspolitik und -forschung hierzulande stützen, ist unterentwickelt. Diese Diagnose ist nicht neu, die Klage darüber ist so alt wie die erste Pisa-Studie. Doch neu ist, dass an vielen Stellen Bewegung in eine alte Debatte kommt. Das Ausmaß der Corona-Folgen für Schüler kann bisher kaum mit Empirie belegt werden. So wird das Corona-Aufholprogramm vom Rechnungshof über die Bundespolitik bis in die Wissenschaft verrissen. Denn die Länder verteilten die Gelder nach ihren ganz eigenen Vorstellungen und die zwei Milliarden Euro erreichten nicht immer die Bedürftigsten. Es fehlt an Daten, um die Mittel gerecht zu verteilen und die Wirkung des Programms zu evaluieren. Die Unzufriedenheit auf vielen Seiten ist das erste Indiz dafür, dass sich etwas bewegt.
Das zweite Indiz liefert ein Satz, den das BMBF in seiner groben Skizze des Startchancen-Programms vor zwei Wochen an den Haushaltsausschuss übermittelte (Bildung.Table berichtete). Er lässt aufhorchen: “Die Mitwirkungsbereitschaft der Länder sowie der geförderten Schulen bei der Bereitstellung und Erhebung notwendiger Daten muss im Vorfeld sichergestellt werden.” Das bildungspolitische Prestige-Projekt der Ampel soll die Zeitenwende hin zur evidenzbasierten Bildungspolitik einläuten.
Angesprochen auf den Satz aus dem BMBF, lächelt KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) die Frage bei der Pressekonferenz der Kultusministerkonferenz am Freitag weg. Doch fordert das BMBF nicht etwas Großes? Wenn bundesweit Schulen gefördert werden, sollen sie, so der Wunsch aus Berlin, vergleichbare Daten erheben und übermitteln. Ein Anliegen, das die KMK seit 2003 voranbringen will. Beim Startchancen-Programm, so Prien, geht es ums Tempo, so unkompliziert und schnell wie möglich soll es eingeführt werden. Das klingt, vonseiten der Länder, nicht nach neuer evidenzbasierter Bildungspolitik.
Hinter verschlossenen Türen verhandeln Bund und Länder längst in einem Fachgremium zu “Bildungsstatistik”, mit dem Ziel, ein Bildungsverlaufsregister aufzubauen, darauf verweist das BMBF. Es ist ein neuer Name für ein altes Projekt der Kultusministerkonferenz. Damals, nach dem Pisa-Schock, wurde sich die Bildungsrepublik gewahr, dass es an Bildungsdaten mangelt. Die Länder einigten sich darauf, sogenannte Schülerkerndatensätze zu erheben. So könnten die Bundesländer Daten über Schüler, Lehrkräfte aber auch Unterrichtseinheiten miteinander vergleichen und Längsschnittstudien durchführen. Sie würden sehen, welche bildungspolitischen Maßnahmen wirken – und welche nicht. Doch dazu ist es bisher nicht gekommen. Die Debatte erlahmte, spätestens als 2008 ein Papier der KMK vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangte und fortan die Angst vor dem “gläsernen Schüler” die Schlagzeilen dominierte. Wenn die Daten nicht richtig geschützt sind und in falsche Hände geraten, könnte der gesamte Bildungsverlauf eines Menschen nachvollzogen werden, so die Angst.
Die individuellen Schülerdaten erheben so gut wie alle Schulen, auch dank digitaler Schulsoftware. Bremen führt die Daten bereits seit vielen Jahren zusammen. Andere Bundesländer machten sich jetzt erst auf den Weg, heißt es aus der KMK. Einzelne Länder mag man nicht nennen, zu vermint ist das Terrain im Kampf um die Daten. Dabei sind sich die Länder politisch einig, dass es ein Bildungsverlaufsregister geben soll, bloß scheint der politische Wille nicht überall gleich stark zu sein, dieses auch umzusetzen. Die stockende Realisierung auf KMK-Ebene bekommt nun Antrieb vom Bund.
In dem Fachgremium, in dem Bund, Länder, Statistische Landesämter und Statistisches Bundesamt gemeinsam beraten, seien die vorbereitenden Arbeiten für das Bildungsverlaufsregister in diesem Jahr “weiter vorangeschritten”, sagt ein Sprecher des BMBF. Geklärt werden muss etwa, wie die Einzeldatensätze zusammengeführt werden: mithilfe einer verschlüsselten Schüler-ID, die kaum zurückzuverfolgen ist; oder mit der Steuer-ID. Sie soll auch beim neuen Registerzensus Anwendung finden.
Im vom Innenministerium verantworteten Projekt soll erstmals auch der Bildungsstand der Bevölkerung erhoben werden. Der Registerzensus mit seinen wenigen Bildungsdaten ist ein kleiner Appetithappen, als Hauptgang soll das Bildungsverlaufsregister aufgetischt werden. Das sieht auch das BMBF so und gibt zu Protokoll: “Erkenntnisse aus diesem Prozess [des Registerzensus’, d. Red.] sollen als Grundlage für den anschließenden Aufbau des Bundesbildungsregisters dienen.” Das noch von der Großen Koalition auf den Weg gebrachte Registermodernisierungsgesetz, in dessen Rahmen Registerdaten digitalisiert und zusammenführt werden sollen, erzeugt einen Modernisierungsdruck, den auch die Bildungspolitik auf Bundes- und Landesebene spürt.
Die mühsamen politischen Verhandlungen um das Bildungsverlaufsregister sind das eine. Das andere sind Wissenschaftler und Gewerkschaften, die es immer lauter einfordern. Führende empirische Bildungsforscher blicken neidisch nach Skandinavien oder in die angelsächsischen Länder. Dänemark erfasst seit Jahrzehnten die individuellen Bildungsverläufe seiner Bürger. Eine unabhängige Clearingstelle anonymisiert die Daten und genießt Vertrauen in der Bevölkerung. Die Bildungsdaten können sogar mit anderen Registern, etwa zu Gesundheitsdaten, verknüpft werden.
Kerstin Schneider, Bildungsökonomin und stellvertretende Vorsitzende vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), möchte mehr evidenzbasierte Bildungspolitik in Deutschland. “Dazu brauchen wir so schnell wie möglich ein Bildungsverlaufsregister – und das muss auch der Wissenschaft zugänglich sein.” Sie betont, dass es nicht um das Tracking einzelner Individuen geht, sondern um besseres Monitoring und Steuern der Bildungspolitik.
Die Wissenschaft könne “Wirkzusammenhänge herausarbeiten”, schreibt der RatSWD in einem aktuellen Positionspapier. “Was bedeutet eine Klassenwiederholung oder Sitzenbleiben für den weiteren Bildungsverlauf und die spätere berufliche Laufbahn? Welche Auswirkungen hatten die Schulschließungen in der Pandemie?” Solche Fragen möchte Schneider mit empirischer Evidenz beantworten. “Politische Überzeugungen helfen da nicht weiter. Leider ist die Datenlage in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr schlecht”, sagt sie. Die Forscherin versteht die Vorbehalte gegenüber besseren Bildungsdaten durch ein Bildungsverlaufsregister nicht. Solche Daten würden für mehr Transparenz sorgen – und das sei ein Nutzen für die Gesellschaft. Sie fordert eine unabhängige Stelle, die die Daten datenschutzkonform für die Wissenschaft verfügbar macht.
Dass die Länder endlich vergleichbare Daten erheben müssen, mahnt auch die GEW. Ihr geht es dabei um soziale Gerechtigkeit. In einem kürzlich veröffentlichten Papier zeigt die Gewerkschaft eine Alternative zum Königsteiner Schlüssel auf, der Fördergelder bisher hauptsächlich nach Steueraufkommen verteilt. Auch die Gelder des Digitalpakts werden danach ausgegeben. Vom während Corona vereinbarten Sofortprogramm, das bedürftige Schüler und Schulen mit digitalen Geräten und Lehrinhalten unterstützt, bekommt laut GEW ein Kind, das mit Sozialhilfe aufwächst, in Bayern 910 Euro, in Bremen 228 Euro (bundesweiter Mittelwert: 428 Euro).
Das von der GEW vorgeschlagene Verfahren, quasi ein bundesweiter Sozialindex, soll die Mittel “sozial gerecht und zielgenau” verteilen. Ein solches Verfahren ist jedoch unter anderem auf einen wichtigen Rohstoff angewiesen: Schülerindividualdaten. So könnte berechnet werden, wie bedürftig die Schüler innerhalb eines Bundeslandes sind. Ein Bildungsverlaufsregister, wie ihn der Bund derzeit anstrebt, könnte solche Daten bereitstellen. Dass nicht alle Länder von der Einführung begeistert sein dürften, ist vorhersehbar. Schließlich ließen sich dann mit wenigen Rechenschritten gute von schlechter Bildungspolitik, erfolgreiche von weniger erfolgreichen Schulen unterscheiden – und Fördergelder bundesweit verteilen.

Frau Esken, schon wieder eine Kommission, die sich mit digitaler Bildung befasst. Ihr gehören unter anderen Kultusminister wie Ties Rabe, Oppositionspolitiker wie Andreas Stoch und Vertreter der Zivilgesellschaft wie Dario Schramm und Stephan Dorgerloh an. Warum braucht die Nation so etwas?
Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass das Digitale nur ein Aspekt der Arbeit der Kommission für “Bildung in der Transformation” ist. Unter dem Dach der Gesamterzählung “Gestaltung der Transformation” ist die Digitalisierung natürlich ein wichtiger Aspekt. Weitere Treiber der Transformation sind unser Ziel, so bald wie möglich klimaneutral zu wirtschaften und zu leben, aber auch der demografische Wandel und nicht zuletzt die geopolitische Zeitenwende. Was aber sind die Grundlagen, damit Mensch und Gesellschaft diese Veränderungen nicht scheuen, auch nicht nur ertragen, sondern im Idealfall aktiv mitgestalten? Da ist Bildung als Mittel zur Emanzipation des Menschen ein ganz wichtiger Schlüssel. Deshalb diese Kommission.
Passt da eigentlich noch der alte sozialdemokratische Gassenhauer der Chancengleichheit, um diese großen Phänomene zu erfassen?
Das Thema Bildungsgerechtigkeit ist und bleibt ein verbindendes Leitmotiv für uns. Das Bildungssystem hat klar die Aufgabe, Nachteile auszugleichen. Wir verlieren aber noch viel zu viele Potenziale.
Was heißt das konkret für die Kommission?
Wir wollen darüber nachdenken, wie genau diese Fragen in der Bildung wieder Einzug halten. Es ist nicht zu tolerieren, dass wir bei den Schulvergleichsstudien wieder 20 Prozent Schulverlierer messen. Bei denen sind die Bildungschancen schon in der Grundschule zerbrochen. Das ist später nicht oder nur mit viel Aufwand aufzuholen. Dadurch entlassen wir viel zu viele Jugendliche ohne adäquaten Abschluss aus den Schulen. Das ist ungerecht, aber auch volkswirtschaftlich ein Sündenfall. Dabei geht es mir bei der Chancengleichheit in der Bildung gar nicht so sehr um das Aufstiegsversprechen, sondern erstmal um Emanzipation und Teilhabe des und der Einzelnen. Das ist eine Frage von Respekt, von Gerechtigkeit. Wir können es uns aber auch nicht leisten, in der Transformation auch nur ein Talent liegenzulassen. Sonst fehlen uns die guten Leute für die Bewältigung der großen Herausforderungen.
Auch die Schullandschaft verändert sich seit Pisa radikal: Hauptschulen verschwinden, auch die Realschulen stürzen geradezu ab. Gleichzeitig steigt die Zahl der integrierten Schulen und der Schulen mit mehreren Bildungsgängen. Ist es nicht die historische Aufgabe der Sozialdemokratie, dies zu ordnen?
Sie haben recht, dass in den letzten 20 Jahren ein regelrechtes Blütenmeer an Schularten entstanden ist. Da ist also nicht überall ein Mangel an Veränderungsbereitschaft festzustellen. Es gibt aber schon auch Privilegien und Besitzstände, die verteidigt werden. Wenn wir die Breite und die Heterogenität ihrer Schüler*innenschaft anschauen, dann sind doch unsere Gymnasien die eigentlichen Gemeinschaftsschulen. Sie müssen nur noch einen Umgang mit dieser Verschiedenheit und ihren Potenzialen finden.
Ist Ihre Kommission auch ein Zaunpfahl, mit dem sie Richtung der Bildungsministerin des Bundes winken? Sie hatten ja die letzte Bildungsministerin, Frau Karliczek, mit den Worten kritisiert, sie sei ein Fall betreuten Regierens.
Das ist nicht vergleichbar. Frau Karliczek hatte ihre 100 Tage des Dazulernens praktisch auf vier Jahre Amtszeit ausgedehnt. Das ist bei Bettina Stark-Watzinger ganz anders. Sie hat ambitionierte Aufgaben aus unserem Koalitionsvertrag – etwa das Startchancen-Programm, das diejenigen Schulen, die eine stark benachteiligte Schüler*innenschaft haben, besonders hochwertig ausstatten soll, sächlich und personell. Wir können ja aber nicht erwarten, dass jeder Punkt aus dem Koalitionsvertrag schon im ersten Jahr abgehakt ist.
Was ist daran so kompliziert, die zehn Prozent Brennpunktschulen der Republik besser auszustatten?
Zum Beispiel die Verteilungsfrage. Bisher wird das Geld nach dem Königsteiner Schlüssel gleichmäßig auf die Länder verteilt. Aber es wäre klüger, nach einem Sozialindex vorzugehen. Das gefällt nur nicht jedem.
Ist es nicht so, dass die Länder ständig blockieren? Einer der größten Bremsklötze scheint mir Hamburgs Schulsenator Ties Rabe zu sein, der die sozialdemokratisch geführten Länder koordiniert und zusammen mit Frau Karliczek den Bildungsrat versenkt hat. Der thront nun in Ihrer Kommission.
Da sitzt niemand, den oder die ich nicht ganz gezielt dabei haben wollte. Ich habe als SPD-Vorsitzende und Leiterin der Kommission ganz bewusst Ties Rabe eingeladen, der in Hamburg sehr gute Ergebnisse vorweisen kann, sowohl bei der Digitalisierung als auch bei der Gerechtigkeit.
Als das neue futuristische KMK-Papier zu digitalem Lernen vorgestellt wurde, fiel ihm dazu ein, dass Präsenz das Nonplusultra von Schule ist.
Ich finde es richtig, zu sagen, dass dieser Distanzunterricht, den wir jetzt wegen Corona erleben mussten, nicht unsere Idee von digitaler Bildung ist. Wir sind nicht in Australien, wo wir im Outback Schüler nur über digitale Verbindungen in die Schule bringen können. Es kann und darf kein Dauerzustand sein, dass die Schüler allein zu Hause sitzen. Auch die Bildungsgerechtigkeit hat darunter gelitten.
Sondern?
Wir müssen digitales Lernen und Präsenz zusammen denken. Es hat nichts mit digitaler Bildung zu tun, als Schüler von zu Hause Videounterricht mit dem Lehrer anzuhören. Schülerinnen und Schülern müssen viel mehr lernen, wie sie sich über digitale Methoden neues Wissen, aber auch neue Kompetenzen erschließen.
Sind Sie sicher, dass der zweite Digitalpakt überhaupt noch kommt?
Wir sind uns in der Ampel einig, dass der Digitalpakt keine Eintagsfliege bleibt. Diese Zusage ist da. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Mittel des ersten Digitalpakts abfließen.
Die SPD-Kommission “Bildung in der Transformation” hat 21 Teilnehmer. Sie soll bis zum Bundesparteitag im Dezember 2023 einen Schlussbericht vorlegen. Die Brandenburger Kultusministerin Britta Ernst gehört ihr nicht an.
Im Juni beschloss der Bund, die Bundesschülerkonferenz (BSK) zu fördern. Zum ersten Mal kann das Schülergremium auf eine finanzielle Unterstützung vom Staat bauen – eine Million Euro jährlich. Für das zweite Halbjahr 2022 bedeutet das 500.000 Euro, die die BSK für ihre Arbeit verwenden kann. Oliver Sachsze, 21, ist seit Juli Generalsekretär der BSK, zuvor war er Fachkoordinator für Finanzen. Die BSK vertritt in ihrer Funktion die Interessen von mehr als acht Millionen Schülerinnen und Schülern; Sachsze bezeichnet sie liebevoll als “KMK der Schüler“. Was macht das Gremium mit dem Geld?
Eines sei ihm und den anderen Mitgliedern des Bundessekretariats besonders wichtig. “Wir wollen die Bürokratie outsourcen“, sagt er. Aktuell mache sie 80 Prozent ihrer Arbeit aus – die tatsächliche Schülervertretung dagegen bloß 20 Prozent. Daher plant die BSK, eine Geschäftsstelle aufzubauen, als zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen. Neben einem Büro im Palais am Festungsgraben in Berlin gehört dazu, fachkräftige Unterstützung anzustellen, für die Koordinierung von Förderanträgen oder im Bereich IT und Datenschutz. “Sowas lernt man schließlich nicht in der Schule”, sagt Sachsze. Derzeit suchen sie außerdem eine Büroleitung und jemanden für Veranstaltungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit.
Mit dem Geld wird die BSK also in Personal investieren, aber auch für besseren und tieferen Austausch zwischen den Schulen sorgen. “Wir wollen unsere Tagungen weiter ausbauen, diese größer und besser organisieren und mehr Menschen den Zugang bieten.” Aktuell gibt es regelmäßige Klausur- und Sitzungstagungen, zu denen aber nur drei Delegierte pro Bundesland kommen könnten. Eine Idee für ein neues und offeneres Format könnte ein Schülerkongress sein oder auch Fahrten, die sich zum Beispiel mit Erinnerungskultur auseinandersetzen. Sachsze spricht dabei vom Anspruch, ein Netzwerk zu sein, das zu wirklich allen Schulen durchdringt. “Wir müssen davon wegkommen, dass wir über den Köpfen von Schülern hinweg über Bildung sprechen. Wir müssen die, die es wirklich betrifft, mit an den Tisch holen!”
Für die Zukunft der BSK gibt es aber noch einen anderen Traum: eine gesetzliche Legitimierung. Denn aufgrund der Tatsache, dass die Idee der BSK in keinem Gesetz festgeschrieben ist, gilt sie bisher nur als Konferenz und nicht als Vertretung. Aus diesem Grund übernimmt aktuell die Stiftung Bildung die formale Verwaltung der Förderung und stellt die Strukturen zur Verfügung. Die Landesschülervertretungen hatten sich dafür in einer Abstimmung mit großer Mehrheit ausgesprochen.
“Ziel ist es, unsere Expertise in der Engagementförderung und Bildungspolitik einzubringen”, erzählt Katja Hintze, die seit über zehn Jahren Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung ist. Dabei betont sie, dass die Stiftung unbedingt die unabhängige Meinung der Schülerinnen und Schüler stärken wolle. Auch Oliver Sachsze berichtet, dass die Unterstützung der BSK perfekt zum Ziel der Stiftung Bildung passe – schließlich geht es darum, herauszufinden, was Schülerinnen und Schüler wirklich wollen.
Die Stiftung Bildung hat schon lange für die Bundesförderung von Bildungsengagement lobbyiert – dabei geht es nicht nur um die BSK, sondern auch um Strukturen wie den Bundeselternrat oder den Bundesverband der Kita- und Schulfördervereine. Zuletzt gab die Stiftung Bildung ein juristisches Gutachten in Auftrag, das die Möglichkeiten zur langfristigen Bundesförderung nichtstaatlicher Bildungsengagements untersuchte. Grundsätzlich gilt Bildung in Deutschland als Ländersache, es sei denn, eine Zuständigkeit des Bundes für die finanzielle Förderung von Bildungsakteuren ergebe sich “in gewissem Umfang aus der Natur der Sache”. Das Ergebnis war klar: Eine staatliche Förderung ist möglich und nicht verfassungswidrig, solange das geförderte Engagement auf Bundesebene stattfindet und sich nicht auf einzelne Länder beschränkt.
Bisher seien Bildung und Engagement stets in verschiedenen Ressorts gedacht worden, berichtet Hintze. Das Bewusstsein dafür habe in der Politik lange gefehlt. An der Schnittstelle der beiden Themen gebe es kaum Studien – und das, obwohl Bildung mit rund 16 Millionen Engagierten und 297.000 gemeinnützigen Organisationen das zweitgrößte Engagementfeld in Deutschland darstellt. Hintze und Sachsze wissen vor allem die durch die Förderung gegebene Planungssicherheit zu schätzen. “Die Förderung ist außerdem eine Möglichkeit für die Regierung, ihren versprochenen Kurswechsel im Bereich Bildung zu beweisen und wie im Koalitionsvertrag angekündigt ,mehr Fortschritt zu wagen’”, sagt Hintze.
In Schleswig-Holstein nutzen nur zwölf Prozent aller Schüler die Lernplattform itslearning. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des SPD-Bildungspolitikers Martin Habersaat hervor. Nur die Hälfte aller Schüler hatte mit Stand vom 16. September überhaupt Zugang zu der Plattform. Davon haben sich nur ein Viertel (46.200) schon mindestens einmal seit den Sommerferien angemeldet. Landesweit gibt es 361 700 Schülerinnen und Schüler.
Laut Bildungsministerium haben sich bislang 477 der 795 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Norden für das Portal angemeldet. Davon nutzen 451 Schulen das Portal bereits, darunter 38 Grund- und 107 Gemeinschaftsschulen. Knapp 20.000 Lehrkräfte hätten damit Zugriff. Von ihnen hat sich bis 20. September aber nicht einmal die Hälfte mindestens einmal angemeldet (8.300).
SPD-Bildungspolitiker Halbersaat sagt, es sei “ein Armutszeugnis”, dass es vom Zufall abhänge, ob Schüler und Eltern sich auf die Nutzbarkeit der Lernplattform verlassen könnten. Die Antwort mache zudem ein zweites Problem deutlich: Schulassistenten und Sozialpädagogen können itslearning bisher nicht nutzen, obwohl multiprofessionelle Teams an vielen Schulen bereits selbstverständlich sind. dpa/apa
Im September kündigte das nordrhein-westfälische Schulministerium die Einführung eines Digitalisierungsbeauftragten an allen Schulen an (Bildung.Table berichtete). In einer Schulvorschrift konkretisiert das Ministerium die Qualifizierung, die nach den Herbstferien beginnen soll. In fünf Modulen lernen die künftigen Digitalisierungsbeauftragten unter anderem Schule und Unterricht für die “Kultur der Digitalität” zu gestalten, aber auch überhaupt ein Verständnis für ihre neue Rolle zu gewinnen. 30 Stunden plant das Ministerium dafür ein: drei eintägige Präsenzphasen, dazu digitale Selbstlernangebote. Die Fortbildung führen Mitarbeiter der staatlichen Lehrerfortbildung durch.
Stephan Huber, Schulentwickler an der Pädagogischen Hochschule Zug, hält das Konzept der Qualifizierung von Digitalisierungsbeauftragten für vielversprechend. Er hat das Schulleitungsqualifizierungsprogramm DigiLead entwickelt, das Nordrhein-Westfalen für die Umsetzung der digitalen Fortbildungsoffensive nutzt. Er merkt an, dass Schulen aktuell vor großen Herausforderungen stehen und Zeit brauchen, um sich weiterzuentwickeln. “Zeit ist momentan die wichtigste Ressource“, betont er. Das gilt besonders im Hinblick darauf, dass die Einführung der Digitalisierungsbeauftragten erst vor weniger als einem halben Jahr lanciert worden sei – auch ohne Krisen eine sehr kurze Zeit, um große Effekte zu erwarten. Daher erhofft sich Huber von der Düsseldorfer Initiative primär den Anstoß, dass der Digitalisierungsprozesses als ein fester Bestandteil des Unterrichts gesehen wird – und nicht mehr bloß als eine zusätzliche, nette Möglichkeit. Anouk Schlung
Auf die jüngste große Ausschreibung von Lehrerstellen in Sachsen-Anhalt ist die Resonanz verhalten geblieben. 944 Stellen an allgemeinbildenden Schulen waren angeboten worden, 220 Bewerberinnen und Bewerber bekundeten ihr Interesse, wie das Bildungsministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. Unter den Bewerbern seien 101 ausgebildete Lehrkräfte und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gewesen.
Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) räumte in einem Interview mit der “Magdeburger Volksstimme” ein, dass das Ziel der schwarz-rot-gelben Koalition einer 103-prozentigen Unterrichtsversorgung in den nächsten Jahren nicht mehr erreichbar ist. 103 Prozent seien “aktuell unrealistisch”, sagte sie. “Den Wert werden wir in dieser Legislatur nicht erreichen. Das muss man so offen sagen. Mit einer echten Entspannung rechnen wir erst ab Anfang der 30er Jahre.”
Vor allem an Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen fehlen Lehrkräfte (Bildung.Table berichtete). An beruflichen Schulen sei keine Stelle ohne Interessent geblieben, hieß es. Erklärtes Ziel der Koalition von CDU, SPD und FDP sind 103 Prozent, um Ausfälle etwa wegen Krankheit oder Elternzeit abfedern zu können.
Bei der jüngsten Ausschreibung gaben viele Interessenten jeweils Bewerbungen für verschiedene Stellen ab. Dennoch blieben den Angaben zufolge 449 Stellen an den allgemeinbildenden Schulen ohne Bewerbung. Ein Ministeriumssprecher erklärte: “Stellen ohne Bewerbungen finden sich inzwischen in allen Regionen und Schulformen gleichermaßen. Es lassen sich nicht mehr bestimmte Fächer hervorheben, bei denen die Besetzung besonders schwierig ist. Der gesamte Fächerkanon ist inzwischen vom Mangel betroffen.” dpa

Der Lehrermangel im Freistaat ist eklatant. Direkt zum Schulstart wurde in einigen bayerischen Schulen der Pflichtunterricht gestrichen, mancherorts werden ganze Klassen tageweise nach Hause geschickt, weil die Lehrerin erkrankt ist und niemand einspringen kann. Der Personalmangel trifft die Grund- und Mittelschulen mit besonderer Wucht. Nur: Dem Kultusministerium fehlt eine Strategie.
Dafür müsste die Staatsregierung den Lehrermangel zunächst beziffern können. Doch die Grund- und Mittelschulen verwenden immer noch das Planungsprogramm “Persona-SVS” – eine Software aus dem letzten Jahrtausend. Gleichzeitig liefert das “neue” Programm zur Schulverwaltung ASV auch über 15 Jahre nach Projektstart immer noch nicht die erhofften tagesaktuellen Daten auf Knopfdruck. Belastbare Daten zur Unterrichtssituation gibt es daher erst im Februar des Folgejahres.
Es ist Zeit, das zentralistisch organisierte Schulsystem umzubauen. Jetzt. Die Schulen brauchen mehr Verantwortung und einen größeren Entscheidungsspielraum vor Ort. Schon dieses Jahr wäre hier mehr möglich gewesen. Sechs Impulse.
Das gleiche Einstiegsniveau für alle Schularten auf A13 kann nur ein erster Schritt sein. Es ist überfällig, gute Lehrkräfte als Angestellte mit unbefristeten Verträgen zu werben und sie zu Beamten gleichwertig zu bezahlen. Stattdessen müssen sich die jungen Menschen entscheiden: zwischen einer Verbeamtung auf Lebenszeit und Aushilfsverträgen, die normalerweise auf ein Schuljahr befristet sind. Die feste Bindung an den Staat als Dienstherren und der starre Rahmen der Verbeamtung schrecken viele Berufseinsteiger genauso ab wie ein prekärer Aushilfsjob.
Die Schulverwaltung sollte Abschlüsse aus anderen Ländern einfacher und schneller anerkennen, was teilweise schon zwischen den Bundesländern zu Problemen führt. Für Bewerber aus Ländern außerhalb der EU ist das Anerkennungsverfahren praktisch komplett verschlossen. Die FDP-Fraktion will das mit einem gerade eingebrachten Gesetzentwurf ändern.
Die Schulleiter sollten ein eigenes, dauerhaftes Personalbudget verantworten. Aus diesem Topf könnten sie neben angestellten Lehrkräften auch pädagogische Assistenzen und sogenannte “Teamlehrer”, die in der Corona-Pandemie über Sonderprogramme an die Schulen kamen, bezahlen. Die Schulleiter wären damit nicht mehr an starre ministeriale Fristen gebunden, sondern hätten mehr Freiheit in der Personalakquise. Nur dann lohnt sich der Aufwand wirklich und bringt echte Entlastung.
In diesem Modell braucht es nicht ständig neue bürokratische Anstellungsverfahren, die sowieso dringend entschlackt werden müssten. Dazu kommt das Problem der Schulauswahl: Bewerber sagen ihre Stelle wieder ab, weil das Ministerium sie ans andere Ende von Bayern schickt. Wer will für so einen Arbeitgeber arbeiten? Der Weg zur Wunschschule sollte offenstehen, eine Direktbewerbung von der Ausnahme zur Regel werden und die Schulleitung die nötigen zeitlichen Freiheiten erhalten.
Lesen Sie auch: Eigene Ausbildung für Führungskräfte an Schulen
Das Betretungsverbot für die rund 3.000 schwangeren Lehrkräfte (Hintergrund) sollte durch eine praktikable individuelle Lösung ersetzt werden. Zwar hat das Kabinett nach dem Schulstart neue Regeln angekündigt. Doch erst kurzfristig, am Freitag vor dem Inkrafttreten, informierte das Ministerium in einem 79-seitigen Schreiben über die notwendigen Schritte. So etwas muss doch schneller gehen und – nach Rücksprache mit dem Arzt – ohne eine solche bürokratische und rechtliche Zumutung.
Das Ministerium legt Schwangeren und Schulleitungen mit den überbordenden Vorschriften zur Gefährdungsbeurteilung eher Steine in den Weg, als dass mit peniblen Vorgaben in der Praxis tatsächlich mehr Sicherheit geschaffen würde. Leider ist diese Informationspolitik durch Bayerns Kultusministerium mittlerweile symptomatisch und alles andere als ein Aushängeschild für das Lehramt.
Um einen längeren Schuldienst für ältere Lehrkräfte attraktiv zu halten, reichen immer neue Aufrufe des Ministeriums nicht. Was es braucht: mehr Wertschätzung für ihre Erfahrung, ein ernstzunehmendes betriebliches Gesundheitsmanagement und durchdachte Angebote für einen gleitenden Übergang in die Pension. Ein solches Konzept fehlt. Das Kultusministerium hat trotz einer Fristverlängerung meine parlamentarische Anfrage dazu noch nicht beantwortet.
An Bayerns Grundschulen arbeiten 60 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit, ein Drittel von diesen sogar unter 50 Prozent. Wir könnten große Reserven durch das Aufstocken von Teil- auf Vollzeit heben. Dafür schlagen wir vor: Die Staatsregierung soll eine einmalige Prämie zahlen und gleichzeitig allen Lehrkräften durch zusätzliche Verwaltungskräfte eine Entlastung von Pflichten außerhalb des Unterrichts garantieren. Es ist übrigens kein Widerspruch, auch Teilzeitausbildungen zu ermöglichen. Denn eine zusätzlich ausgebildete Lehrkraft in Teilzeit ist besser als eine komplett fehlende Lehrkraft. Ein Antrag von unserer Fraktion hierzu wird in der Plenarsitzung am heutigen Mittwoch beraten.
Lesen Sie auch: Die Mittelschule in Bayern strauchelt
An allen Schularten sollten wir zügig Programme für Quereinsteiger einrichten. An den Mittelschulen wurde ein solches kürzlich mit heißer Nadel in der Not gestrickt. Das ist der falsche Ansatz. Statt Sondermaßnahmen sollte es ein generelles Angebot geben – mit einem durchdachten pädagogischen Konzept. Ein eignungsorientiertes Auswahlverfahren, ein modularisierter Vorbereitungsdienst, der ständig in wissenschaftlicher Begleitung weiterentwickelt wird, und ausreichend Ressourcen für die Begleitung an der Schule sind die Basis für einen gelingenden Quereinstieg.
Nur wenn die Politik grundlegende Reformen anpackt und den Lehrerberuf vom Staub des letzten Jahrtausends befreit, können wir die aktuellen Herausforderungen meistern. Dafür braucht es mehr Mut, auch heiße Eisen anzufassen!
Matthias Fischbach sitzt seit 2018 für die FDP im Bayerischen Landtag, aktuell als parlamentarischer Geschäftsführer und bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er war von 2011 bis 2013 Landesvorsitzender der Jungen Liberalen, studierte Volkswirtschaftslehre in Konstanz und München und arbeitete vor seiner Zeit im Landtag als Unternehmensberater in der Finanzwirtschaft.

Jürgen Böhm bezeichnet sich selbst im Gespräch mit Bildung.Table als “Realschul-Lobbyist”. Klar, die Existenz dieser Schulform hält er als Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer (VDR) für richtig und wichtig. Mit ruhiger Stimme sagt der 57-Jährige Sätze, die es in sich haben: Binnendifferenzierung im Klassenzimmer hält er für “ein Märchen und Augenwischerei.” Ebenso wenig hält er vom Begriff “dreigliedriges Schulsystem”, vielmehr solle man die Vielfalt im Bildungssystem aufrechterhalten. Weit über 90 Schulformen gebe es aktuell in Deutschland. “Mir konnte bisher niemand erklären, warum wir jetzt alles vereinheitlichen müssen, wo doch die einzelnen Bildungsbiografien immer individueller werden.”
Der gebürtige Thüringer begann 1993 seine Laufbahn als Realschullehrer in Bayern. Zuvor studierte Böhm Germanistik und Geschichte in Jena. 2005 gründete er im niederbayerischen Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn eine Realschule, die er bis 2018 leitete. Seither widmet er sich ausschließlich der Verbandsarbeit und bringt dabei seine Erfahrungen als Schuldirektor und Lehrer ein.
Böhm ist nicht nur seit 2010 Bundesvorsitzender des VDR, sondern auch Landesvorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbands. Außerdem vertritt er den Deutschen Beamtenverbund als stellvertretender Bundesvorsitzender und sitzt im Vorstand weiterer Bildungsverbände wie dem Bündnis Ökonomische Bildung, das die Verankerung ökonomischer Bildung in weiterführenden Schulen fordert.
Seine ehemalige niederbayerische Realschule habe neben einem offenen Ganztagsbereich besonders die klare Profilbildung für Digitalisierung ausgemacht. Schon zu Beginn wurden die Klassenzimmer mit LAN vernetzt, jeder Schüler erhielt eine E-Mail-Adresse. Es gab Laptop-Klassen und später in jedem Klassenzimmer digitale Projektionsmöglichkeiten und WLAN. Früh konnten die Lehrer online untereinander kommunizieren. Die Schule sei, was Digitalisierung betrifft, bis heute gut aufgestellt; die Umstellung in der Corona-Pandemie habe reibungslos funktioniert.
Böhm zufolge werde in der bildungspolitischen Debatte oft vergessen, dass es nicht nur um digitale Strukturen, sondern auch um das Vermitteln von Inhalten und Kompetenzen geht. “Ich bin daher ein großer Verfechter der informationstechnologischen Bildung“, erklärt er. Auch praxisbezogene ökonomische und naturwissenschaftliche Bildung sind dem Realschullehrer wichtig. Er spricht sich für Kooperationen zwischen Schulen und regionaler Wirtschaft aus. Dennoch soll für ihn Schule “kein Zulieferbetrieb für die Wirtschaft sein.”
Um seinen Standpunkt zu erklären, argumentiert Böhm historisch: Gründungsidee der Realschulen war es, zeitgenössische Themen in den Bildungskanon aufzunehmen. Als Schulform des modernen Bürgertums – “heute würden wir sagen des Mittelstands” – sollte sie auf die Anforderungen der Zeit reagieren.
Die Realschule aufrechtzuerhalten, bedeute daher auch nicht, an alten Strukturen festzuhalten. Es gehe vielmehr um ein stetiges “Neudenken von Inhalten”. Jeder Abschluss hat für Böhm seine Berechtigung, es brauche aber jeweils eine Schulform mit entsprechendem Profil. Zwischen Abitur, Mittlerer Reife und Hauptschulabschluss sieht Böhm keine hierarchischen Unterschiede. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler vom Gymnasium in seine Realschule wechselte, habe er gesagt: “‘Du steigst nicht ab von der Bundes- in die Regionalliga, du wechselst rüber. Es ist anders, ein anderes Profil, aber du bekommst einen qualifizierten Abschluss, mit dem Du viel erreichen kannst.”
Böhms Positionen zum Thema Schulformen und -abschlüsse sind nicht unumstritten. So auch seine Sicht auf das Thema Datenschutz, wo er sich für “liberale Lösungen” ausspricht. “Natürlich muss man mit Daten sensibel umgehen”, meint er. Doch die Pflicht zur Umsetzung des Datenschutzes sieht er bei den Anbietern der Softwares. Klare Rahmenbedingungen müssten her. “Wenn die Nutzung von Anwendungen aber künstlich vom Datenschutzbeauftragten behindert wird, halte ich das für ungünstig.”Vera Almotlak
19. Oktober 2022, 14:00 bis 19:00 Uhr
Fachkonferenz: #Startchancen – Fördern, wo es zählt
Mit dem “Startchancen”-Programm will die Ampel-Regierung ihr Engagement im Bildungsbereich beweisen. Auf dieser Fachkonferenz wird mit Inputvorträgen (unter anderem von Ties Rabe und Michael Wrase) und Workshops auf die Themen Chancengleichheit und Schulentwicklung eingegangen. Anmeldeschluss ist der 13. Oktober! INFOS & ANMELDUNG
24. Oktober 2022, 19:00 bis 20:30 Uhr
Diskussion: Mythos Bildung – Ungerechtigkeiten im Bildungssystem und mögliche Auswege
Aladin El-Mafaalani, Autor von “Mythos Bildung“, spricht auf dieser Veranstaltung mit Andreas Stoch (ehemaliger Kultusminister von Baden-Württemberg) und Jörg Fröscher (Schulleiter) über die Ungerechtigkeiten im heutigen Bildungssystem und mögliche Auswege aus der sozialen Ungleichheit. INFOS & ANMELDUNG
24. bis 26. Oktober 2022
Barcamp: OERcamp 2022
Das OERcamp richtet sich an Praktiker und Nutzende von Open Educational Resources. Neben Workshops, Netzwerkveranstaltungen und Podiumsdiskussionen finden Themenwerkstätten zu den sechs Handlungsfeldern der OER-Strategie des BMBF statt. INFOS & ANMELDUNG
28. bis 30. Oktober 2022
Konferenz: 13th International Conference on Distance Learning and Education
Gehostet von der Universität Barcelona beschäftigt sich die 13. ICDLE mit der Gegenwart und der Zukunft des digitalen Lernens. Keynote-Speaker sind Dragan Gasevic (Monash University) und Minjuan Wang (San Diego State University). INFOS & ANMELDUNG
03. bis 04. November 2022
Konferenz: TURN Conference
Unter dem Motto “Wandel gestalten” organisiert die Stiftung Innovation in der Hochschullehre die TURN Conference. Interessierte sollen sich über Veränderung in der Hochschullehre austauschen. Fokus: Herausforderungen, vor denen Hochschulen aktuell stehen. INFOS
07. bis 09. November 2022
Konferenz zu Bildung, Forschung, Innovation: ICERI 2022
Über 800 Dozierende, Forschende, Pädagogen und Technologen aus 80 Ländern werden auf der diesjährigen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) in Sevilla sprechen, ihre Arbeit vorstellen und sich austauschen. Die Konferenz steht unter dem Motto “Transforming Education, Transforming Lives“. INFOS
ein Corona-Aufholprogramm, das Gelder mit der Gießkanne verteilt; Digitalpakt-Millionen, von denen bedürftige Kinder in Bayern dreimal mehr profitieren als in Bremen. Ein Grundrauschen begleitet solch bildungspolitisches Mäandern: fehlende Daten. Die KMK werkelt seit bald zwanzig Jahren daran, dass die Länder Schülerdaten miteinander teilen und vergleichbar machen. Nun mahnen auch Wissenschaft und Gewerkschaften und beleben eine alte Debatte um die Bildungsdaten – in die ein Player immer selbstbewusster drängt: das BMBF.
Über bessere Bildungsdaten würde sich auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken freuen, die im Interview einen Sozialindex fordert. Anlass für das Gespräch war die erste Sitzung einer neuen Bildungskommission ihrer Partei. Wolkig klingt der Titel (“Bildung in der Transformation”), konkret die Themen: vom zweiten Digitalpakt bis zur Wiederbelebung von Bildungsgerechtigkeit.
Mit einer konkreten Auswirkung der Ampel-Politik beschäftigt sich eine weitere Analyse: Die Bundesschülerkonferenz wird erstmals staatlich gefördert, mit jährlich einer Million Euro. Wir haben geschaut, wofür das Gremium das Geld einsetzen möchte und für welches große Ziel sich die Schülervertretung auf Bundesebene einsetzen will.
Und schließlich möchten wir Sie herzlich zum nächsten Live-Briefing einladen. Petra Stanat, IQB-Direktorin, und Katja Hintze, Vorsitzende der Stiftung Bildung, diskutieren gemeinsam die Detailergebnisse des IQB-Bildungstrends, die am Montag veröffentlicht werden. Setzen Sie sich am nächsten Dienstag, 18. Oktober von 16 bis 17 Uhr digital an unseren Tisch. Hier geht’s zur Anmeldung.
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht,

Die Datenbasis, auf die sich Bildungspolitik und -forschung hierzulande stützen, ist unterentwickelt. Diese Diagnose ist nicht neu, die Klage darüber ist so alt wie die erste Pisa-Studie. Doch neu ist, dass an vielen Stellen Bewegung in eine alte Debatte kommt. Das Ausmaß der Corona-Folgen für Schüler kann bisher kaum mit Empirie belegt werden. So wird das Corona-Aufholprogramm vom Rechnungshof über die Bundespolitik bis in die Wissenschaft verrissen. Denn die Länder verteilten die Gelder nach ihren ganz eigenen Vorstellungen und die zwei Milliarden Euro erreichten nicht immer die Bedürftigsten. Es fehlt an Daten, um die Mittel gerecht zu verteilen und die Wirkung des Programms zu evaluieren. Die Unzufriedenheit auf vielen Seiten ist das erste Indiz dafür, dass sich etwas bewegt.
Das zweite Indiz liefert ein Satz, den das BMBF in seiner groben Skizze des Startchancen-Programms vor zwei Wochen an den Haushaltsausschuss übermittelte (Bildung.Table berichtete). Er lässt aufhorchen: “Die Mitwirkungsbereitschaft der Länder sowie der geförderten Schulen bei der Bereitstellung und Erhebung notwendiger Daten muss im Vorfeld sichergestellt werden.” Das bildungspolitische Prestige-Projekt der Ampel soll die Zeitenwende hin zur evidenzbasierten Bildungspolitik einläuten.
Angesprochen auf den Satz aus dem BMBF, lächelt KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) die Frage bei der Pressekonferenz der Kultusministerkonferenz am Freitag weg. Doch fordert das BMBF nicht etwas Großes? Wenn bundesweit Schulen gefördert werden, sollen sie, so der Wunsch aus Berlin, vergleichbare Daten erheben und übermitteln. Ein Anliegen, das die KMK seit 2003 voranbringen will. Beim Startchancen-Programm, so Prien, geht es ums Tempo, so unkompliziert und schnell wie möglich soll es eingeführt werden. Das klingt, vonseiten der Länder, nicht nach neuer evidenzbasierter Bildungspolitik.
Hinter verschlossenen Türen verhandeln Bund und Länder längst in einem Fachgremium zu “Bildungsstatistik”, mit dem Ziel, ein Bildungsverlaufsregister aufzubauen, darauf verweist das BMBF. Es ist ein neuer Name für ein altes Projekt der Kultusministerkonferenz. Damals, nach dem Pisa-Schock, wurde sich die Bildungsrepublik gewahr, dass es an Bildungsdaten mangelt. Die Länder einigten sich darauf, sogenannte Schülerkerndatensätze zu erheben. So könnten die Bundesländer Daten über Schüler, Lehrkräfte aber auch Unterrichtseinheiten miteinander vergleichen und Längsschnittstudien durchführen. Sie würden sehen, welche bildungspolitischen Maßnahmen wirken – und welche nicht. Doch dazu ist es bisher nicht gekommen. Die Debatte erlahmte, spätestens als 2008 ein Papier der KMK vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangte und fortan die Angst vor dem “gläsernen Schüler” die Schlagzeilen dominierte. Wenn die Daten nicht richtig geschützt sind und in falsche Hände geraten, könnte der gesamte Bildungsverlauf eines Menschen nachvollzogen werden, so die Angst.
Die individuellen Schülerdaten erheben so gut wie alle Schulen, auch dank digitaler Schulsoftware. Bremen führt die Daten bereits seit vielen Jahren zusammen. Andere Bundesländer machten sich jetzt erst auf den Weg, heißt es aus der KMK. Einzelne Länder mag man nicht nennen, zu vermint ist das Terrain im Kampf um die Daten. Dabei sind sich die Länder politisch einig, dass es ein Bildungsverlaufsregister geben soll, bloß scheint der politische Wille nicht überall gleich stark zu sein, dieses auch umzusetzen. Die stockende Realisierung auf KMK-Ebene bekommt nun Antrieb vom Bund.
In dem Fachgremium, in dem Bund, Länder, Statistische Landesämter und Statistisches Bundesamt gemeinsam beraten, seien die vorbereitenden Arbeiten für das Bildungsverlaufsregister in diesem Jahr “weiter vorangeschritten”, sagt ein Sprecher des BMBF. Geklärt werden muss etwa, wie die Einzeldatensätze zusammengeführt werden: mithilfe einer verschlüsselten Schüler-ID, die kaum zurückzuverfolgen ist; oder mit der Steuer-ID. Sie soll auch beim neuen Registerzensus Anwendung finden.
Im vom Innenministerium verantworteten Projekt soll erstmals auch der Bildungsstand der Bevölkerung erhoben werden. Der Registerzensus mit seinen wenigen Bildungsdaten ist ein kleiner Appetithappen, als Hauptgang soll das Bildungsverlaufsregister aufgetischt werden. Das sieht auch das BMBF so und gibt zu Protokoll: “Erkenntnisse aus diesem Prozess [des Registerzensus’, d. Red.] sollen als Grundlage für den anschließenden Aufbau des Bundesbildungsregisters dienen.” Das noch von der Großen Koalition auf den Weg gebrachte Registermodernisierungsgesetz, in dessen Rahmen Registerdaten digitalisiert und zusammenführt werden sollen, erzeugt einen Modernisierungsdruck, den auch die Bildungspolitik auf Bundes- und Landesebene spürt.
Die mühsamen politischen Verhandlungen um das Bildungsverlaufsregister sind das eine. Das andere sind Wissenschaftler und Gewerkschaften, die es immer lauter einfordern. Führende empirische Bildungsforscher blicken neidisch nach Skandinavien oder in die angelsächsischen Länder. Dänemark erfasst seit Jahrzehnten die individuellen Bildungsverläufe seiner Bürger. Eine unabhängige Clearingstelle anonymisiert die Daten und genießt Vertrauen in der Bevölkerung. Die Bildungsdaten können sogar mit anderen Registern, etwa zu Gesundheitsdaten, verknüpft werden.
Kerstin Schneider, Bildungsökonomin und stellvertretende Vorsitzende vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), möchte mehr evidenzbasierte Bildungspolitik in Deutschland. “Dazu brauchen wir so schnell wie möglich ein Bildungsverlaufsregister – und das muss auch der Wissenschaft zugänglich sein.” Sie betont, dass es nicht um das Tracking einzelner Individuen geht, sondern um besseres Monitoring und Steuern der Bildungspolitik.
Die Wissenschaft könne “Wirkzusammenhänge herausarbeiten”, schreibt der RatSWD in einem aktuellen Positionspapier. “Was bedeutet eine Klassenwiederholung oder Sitzenbleiben für den weiteren Bildungsverlauf und die spätere berufliche Laufbahn? Welche Auswirkungen hatten die Schulschließungen in der Pandemie?” Solche Fragen möchte Schneider mit empirischer Evidenz beantworten. “Politische Überzeugungen helfen da nicht weiter. Leider ist die Datenlage in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr schlecht”, sagt sie. Die Forscherin versteht die Vorbehalte gegenüber besseren Bildungsdaten durch ein Bildungsverlaufsregister nicht. Solche Daten würden für mehr Transparenz sorgen – und das sei ein Nutzen für die Gesellschaft. Sie fordert eine unabhängige Stelle, die die Daten datenschutzkonform für die Wissenschaft verfügbar macht.
Dass die Länder endlich vergleichbare Daten erheben müssen, mahnt auch die GEW. Ihr geht es dabei um soziale Gerechtigkeit. In einem kürzlich veröffentlichten Papier zeigt die Gewerkschaft eine Alternative zum Königsteiner Schlüssel auf, der Fördergelder bisher hauptsächlich nach Steueraufkommen verteilt. Auch die Gelder des Digitalpakts werden danach ausgegeben. Vom während Corona vereinbarten Sofortprogramm, das bedürftige Schüler und Schulen mit digitalen Geräten und Lehrinhalten unterstützt, bekommt laut GEW ein Kind, das mit Sozialhilfe aufwächst, in Bayern 910 Euro, in Bremen 228 Euro (bundesweiter Mittelwert: 428 Euro).
Das von der GEW vorgeschlagene Verfahren, quasi ein bundesweiter Sozialindex, soll die Mittel “sozial gerecht und zielgenau” verteilen. Ein solches Verfahren ist jedoch unter anderem auf einen wichtigen Rohstoff angewiesen: Schülerindividualdaten. So könnte berechnet werden, wie bedürftig die Schüler innerhalb eines Bundeslandes sind. Ein Bildungsverlaufsregister, wie ihn der Bund derzeit anstrebt, könnte solche Daten bereitstellen. Dass nicht alle Länder von der Einführung begeistert sein dürften, ist vorhersehbar. Schließlich ließen sich dann mit wenigen Rechenschritten gute von schlechter Bildungspolitik, erfolgreiche von weniger erfolgreichen Schulen unterscheiden – und Fördergelder bundesweit verteilen.

Frau Esken, schon wieder eine Kommission, die sich mit digitaler Bildung befasst. Ihr gehören unter anderen Kultusminister wie Ties Rabe, Oppositionspolitiker wie Andreas Stoch und Vertreter der Zivilgesellschaft wie Dario Schramm und Stephan Dorgerloh an. Warum braucht die Nation so etwas?
Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass das Digitale nur ein Aspekt der Arbeit der Kommission für “Bildung in der Transformation” ist. Unter dem Dach der Gesamterzählung “Gestaltung der Transformation” ist die Digitalisierung natürlich ein wichtiger Aspekt. Weitere Treiber der Transformation sind unser Ziel, so bald wie möglich klimaneutral zu wirtschaften und zu leben, aber auch der demografische Wandel und nicht zuletzt die geopolitische Zeitenwende. Was aber sind die Grundlagen, damit Mensch und Gesellschaft diese Veränderungen nicht scheuen, auch nicht nur ertragen, sondern im Idealfall aktiv mitgestalten? Da ist Bildung als Mittel zur Emanzipation des Menschen ein ganz wichtiger Schlüssel. Deshalb diese Kommission.
Passt da eigentlich noch der alte sozialdemokratische Gassenhauer der Chancengleichheit, um diese großen Phänomene zu erfassen?
Das Thema Bildungsgerechtigkeit ist und bleibt ein verbindendes Leitmotiv für uns. Das Bildungssystem hat klar die Aufgabe, Nachteile auszugleichen. Wir verlieren aber noch viel zu viele Potenziale.
Was heißt das konkret für die Kommission?
Wir wollen darüber nachdenken, wie genau diese Fragen in der Bildung wieder Einzug halten. Es ist nicht zu tolerieren, dass wir bei den Schulvergleichsstudien wieder 20 Prozent Schulverlierer messen. Bei denen sind die Bildungschancen schon in der Grundschule zerbrochen. Das ist später nicht oder nur mit viel Aufwand aufzuholen. Dadurch entlassen wir viel zu viele Jugendliche ohne adäquaten Abschluss aus den Schulen. Das ist ungerecht, aber auch volkswirtschaftlich ein Sündenfall. Dabei geht es mir bei der Chancengleichheit in der Bildung gar nicht so sehr um das Aufstiegsversprechen, sondern erstmal um Emanzipation und Teilhabe des und der Einzelnen. Das ist eine Frage von Respekt, von Gerechtigkeit. Wir können es uns aber auch nicht leisten, in der Transformation auch nur ein Talent liegenzulassen. Sonst fehlen uns die guten Leute für die Bewältigung der großen Herausforderungen.
Auch die Schullandschaft verändert sich seit Pisa radikal: Hauptschulen verschwinden, auch die Realschulen stürzen geradezu ab. Gleichzeitig steigt die Zahl der integrierten Schulen und der Schulen mit mehreren Bildungsgängen. Ist es nicht die historische Aufgabe der Sozialdemokratie, dies zu ordnen?
Sie haben recht, dass in den letzten 20 Jahren ein regelrechtes Blütenmeer an Schularten entstanden ist. Da ist also nicht überall ein Mangel an Veränderungsbereitschaft festzustellen. Es gibt aber schon auch Privilegien und Besitzstände, die verteidigt werden. Wenn wir die Breite und die Heterogenität ihrer Schüler*innenschaft anschauen, dann sind doch unsere Gymnasien die eigentlichen Gemeinschaftsschulen. Sie müssen nur noch einen Umgang mit dieser Verschiedenheit und ihren Potenzialen finden.
Ist Ihre Kommission auch ein Zaunpfahl, mit dem sie Richtung der Bildungsministerin des Bundes winken? Sie hatten ja die letzte Bildungsministerin, Frau Karliczek, mit den Worten kritisiert, sie sei ein Fall betreuten Regierens.
Das ist nicht vergleichbar. Frau Karliczek hatte ihre 100 Tage des Dazulernens praktisch auf vier Jahre Amtszeit ausgedehnt. Das ist bei Bettina Stark-Watzinger ganz anders. Sie hat ambitionierte Aufgaben aus unserem Koalitionsvertrag – etwa das Startchancen-Programm, das diejenigen Schulen, die eine stark benachteiligte Schüler*innenschaft haben, besonders hochwertig ausstatten soll, sächlich und personell. Wir können ja aber nicht erwarten, dass jeder Punkt aus dem Koalitionsvertrag schon im ersten Jahr abgehakt ist.
Was ist daran so kompliziert, die zehn Prozent Brennpunktschulen der Republik besser auszustatten?
Zum Beispiel die Verteilungsfrage. Bisher wird das Geld nach dem Königsteiner Schlüssel gleichmäßig auf die Länder verteilt. Aber es wäre klüger, nach einem Sozialindex vorzugehen. Das gefällt nur nicht jedem.
Ist es nicht so, dass die Länder ständig blockieren? Einer der größten Bremsklötze scheint mir Hamburgs Schulsenator Ties Rabe zu sein, der die sozialdemokratisch geführten Länder koordiniert und zusammen mit Frau Karliczek den Bildungsrat versenkt hat. Der thront nun in Ihrer Kommission.
Da sitzt niemand, den oder die ich nicht ganz gezielt dabei haben wollte. Ich habe als SPD-Vorsitzende und Leiterin der Kommission ganz bewusst Ties Rabe eingeladen, der in Hamburg sehr gute Ergebnisse vorweisen kann, sowohl bei der Digitalisierung als auch bei der Gerechtigkeit.
Als das neue futuristische KMK-Papier zu digitalem Lernen vorgestellt wurde, fiel ihm dazu ein, dass Präsenz das Nonplusultra von Schule ist.
Ich finde es richtig, zu sagen, dass dieser Distanzunterricht, den wir jetzt wegen Corona erleben mussten, nicht unsere Idee von digitaler Bildung ist. Wir sind nicht in Australien, wo wir im Outback Schüler nur über digitale Verbindungen in die Schule bringen können. Es kann und darf kein Dauerzustand sein, dass die Schüler allein zu Hause sitzen. Auch die Bildungsgerechtigkeit hat darunter gelitten.
Sondern?
Wir müssen digitales Lernen und Präsenz zusammen denken. Es hat nichts mit digitaler Bildung zu tun, als Schüler von zu Hause Videounterricht mit dem Lehrer anzuhören. Schülerinnen und Schülern müssen viel mehr lernen, wie sie sich über digitale Methoden neues Wissen, aber auch neue Kompetenzen erschließen.
Sind Sie sicher, dass der zweite Digitalpakt überhaupt noch kommt?
Wir sind uns in der Ampel einig, dass der Digitalpakt keine Eintagsfliege bleibt. Diese Zusage ist da. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Mittel des ersten Digitalpakts abfließen.
Die SPD-Kommission “Bildung in der Transformation” hat 21 Teilnehmer. Sie soll bis zum Bundesparteitag im Dezember 2023 einen Schlussbericht vorlegen. Die Brandenburger Kultusministerin Britta Ernst gehört ihr nicht an.
Im Juni beschloss der Bund, die Bundesschülerkonferenz (BSK) zu fördern. Zum ersten Mal kann das Schülergremium auf eine finanzielle Unterstützung vom Staat bauen – eine Million Euro jährlich. Für das zweite Halbjahr 2022 bedeutet das 500.000 Euro, die die BSK für ihre Arbeit verwenden kann. Oliver Sachsze, 21, ist seit Juli Generalsekretär der BSK, zuvor war er Fachkoordinator für Finanzen. Die BSK vertritt in ihrer Funktion die Interessen von mehr als acht Millionen Schülerinnen und Schülern; Sachsze bezeichnet sie liebevoll als “KMK der Schüler“. Was macht das Gremium mit dem Geld?
Eines sei ihm und den anderen Mitgliedern des Bundessekretariats besonders wichtig. “Wir wollen die Bürokratie outsourcen“, sagt er. Aktuell mache sie 80 Prozent ihrer Arbeit aus – die tatsächliche Schülervertretung dagegen bloß 20 Prozent. Daher plant die BSK, eine Geschäftsstelle aufzubauen, als zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen. Neben einem Büro im Palais am Festungsgraben in Berlin gehört dazu, fachkräftige Unterstützung anzustellen, für die Koordinierung von Förderanträgen oder im Bereich IT und Datenschutz. “Sowas lernt man schließlich nicht in der Schule”, sagt Sachsze. Derzeit suchen sie außerdem eine Büroleitung und jemanden für Veranstaltungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit.
Mit dem Geld wird die BSK also in Personal investieren, aber auch für besseren und tieferen Austausch zwischen den Schulen sorgen. “Wir wollen unsere Tagungen weiter ausbauen, diese größer und besser organisieren und mehr Menschen den Zugang bieten.” Aktuell gibt es regelmäßige Klausur- und Sitzungstagungen, zu denen aber nur drei Delegierte pro Bundesland kommen könnten. Eine Idee für ein neues und offeneres Format könnte ein Schülerkongress sein oder auch Fahrten, die sich zum Beispiel mit Erinnerungskultur auseinandersetzen. Sachsze spricht dabei vom Anspruch, ein Netzwerk zu sein, das zu wirklich allen Schulen durchdringt. “Wir müssen davon wegkommen, dass wir über den Köpfen von Schülern hinweg über Bildung sprechen. Wir müssen die, die es wirklich betrifft, mit an den Tisch holen!”
Für die Zukunft der BSK gibt es aber noch einen anderen Traum: eine gesetzliche Legitimierung. Denn aufgrund der Tatsache, dass die Idee der BSK in keinem Gesetz festgeschrieben ist, gilt sie bisher nur als Konferenz und nicht als Vertretung. Aus diesem Grund übernimmt aktuell die Stiftung Bildung die formale Verwaltung der Förderung und stellt die Strukturen zur Verfügung. Die Landesschülervertretungen hatten sich dafür in einer Abstimmung mit großer Mehrheit ausgesprochen.
“Ziel ist es, unsere Expertise in der Engagementförderung und Bildungspolitik einzubringen”, erzählt Katja Hintze, die seit über zehn Jahren Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung ist. Dabei betont sie, dass die Stiftung unbedingt die unabhängige Meinung der Schülerinnen und Schüler stärken wolle. Auch Oliver Sachsze berichtet, dass die Unterstützung der BSK perfekt zum Ziel der Stiftung Bildung passe – schließlich geht es darum, herauszufinden, was Schülerinnen und Schüler wirklich wollen.
Die Stiftung Bildung hat schon lange für die Bundesförderung von Bildungsengagement lobbyiert – dabei geht es nicht nur um die BSK, sondern auch um Strukturen wie den Bundeselternrat oder den Bundesverband der Kita- und Schulfördervereine. Zuletzt gab die Stiftung Bildung ein juristisches Gutachten in Auftrag, das die Möglichkeiten zur langfristigen Bundesförderung nichtstaatlicher Bildungsengagements untersuchte. Grundsätzlich gilt Bildung in Deutschland als Ländersache, es sei denn, eine Zuständigkeit des Bundes für die finanzielle Förderung von Bildungsakteuren ergebe sich “in gewissem Umfang aus der Natur der Sache”. Das Ergebnis war klar: Eine staatliche Förderung ist möglich und nicht verfassungswidrig, solange das geförderte Engagement auf Bundesebene stattfindet und sich nicht auf einzelne Länder beschränkt.
Bisher seien Bildung und Engagement stets in verschiedenen Ressorts gedacht worden, berichtet Hintze. Das Bewusstsein dafür habe in der Politik lange gefehlt. An der Schnittstelle der beiden Themen gebe es kaum Studien – und das, obwohl Bildung mit rund 16 Millionen Engagierten und 297.000 gemeinnützigen Organisationen das zweitgrößte Engagementfeld in Deutschland darstellt. Hintze und Sachsze wissen vor allem die durch die Förderung gegebene Planungssicherheit zu schätzen. “Die Förderung ist außerdem eine Möglichkeit für die Regierung, ihren versprochenen Kurswechsel im Bereich Bildung zu beweisen und wie im Koalitionsvertrag angekündigt ,mehr Fortschritt zu wagen’”, sagt Hintze.
In Schleswig-Holstein nutzen nur zwölf Prozent aller Schüler die Lernplattform itslearning. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des SPD-Bildungspolitikers Martin Habersaat hervor. Nur die Hälfte aller Schüler hatte mit Stand vom 16. September überhaupt Zugang zu der Plattform. Davon haben sich nur ein Viertel (46.200) schon mindestens einmal seit den Sommerferien angemeldet. Landesweit gibt es 361 700 Schülerinnen und Schüler.
Laut Bildungsministerium haben sich bislang 477 der 795 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Norden für das Portal angemeldet. Davon nutzen 451 Schulen das Portal bereits, darunter 38 Grund- und 107 Gemeinschaftsschulen. Knapp 20.000 Lehrkräfte hätten damit Zugriff. Von ihnen hat sich bis 20. September aber nicht einmal die Hälfte mindestens einmal angemeldet (8.300).
SPD-Bildungspolitiker Halbersaat sagt, es sei “ein Armutszeugnis”, dass es vom Zufall abhänge, ob Schüler und Eltern sich auf die Nutzbarkeit der Lernplattform verlassen könnten. Die Antwort mache zudem ein zweites Problem deutlich: Schulassistenten und Sozialpädagogen können itslearning bisher nicht nutzen, obwohl multiprofessionelle Teams an vielen Schulen bereits selbstverständlich sind. dpa/apa
Im September kündigte das nordrhein-westfälische Schulministerium die Einführung eines Digitalisierungsbeauftragten an allen Schulen an (Bildung.Table berichtete). In einer Schulvorschrift konkretisiert das Ministerium die Qualifizierung, die nach den Herbstferien beginnen soll. In fünf Modulen lernen die künftigen Digitalisierungsbeauftragten unter anderem Schule und Unterricht für die “Kultur der Digitalität” zu gestalten, aber auch überhaupt ein Verständnis für ihre neue Rolle zu gewinnen. 30 Stunden plant das Ministerium dafür ein: drei eintägige Präsenzphasen, dazu digitale Selbstlernangebote. Die Fortbildung führen Mitarbeiter der staatlichen Lehrerfortbildung durch.
Stephan Huber, Schulentwickler an der Pädagogischen Hochschule Zug, hält das Konzept der Qualifizierung von Digitalisierungsbeauftragten für vielversprechend. Er hat das Schulleitungsqualifizierungsprogramm DigiLead entwickelt, das Nordrhein-Westfalen für die Umsetzung der digitalen Fortbildungsoffensive nutzt. Er merkt an, dass Schulen aktuell vor großen Herausforderungen stehen und Zeit brauchen, um sich weiterzuentwickeln. “Zeit ist momentan die wichtigste Ressource“, betont er. Das gilt besonders im Hinblick darauf, dass die Einführung der Digitalisierungsbeauftragten erst vor weniger als einem halben Jahr lanciert worden sei – auch ohne Krisen eine sehr kurze Zeit, um große Effekte zu erwarten. Daher erhofft sich Huber von der Düsseldorfer Initiative primär den Anstoß, dass der Digitalisierungsprozesses als ein fester Bestandteil des Unterrichts gesehen wird – und nicht mehr bloß als eine zusätzliche, nette Möglichkeit. Anouk Schlung
Auf die jüngste große Ausschreibung von Lehrerstellen in Sachsen-Anhalt ist die Resonanz verhalten geblieben. 944 Stellen an allgemeinbildenden Schulen waren angeboten worden, 220 Bewerberinnen und Bewerber bekundeten ihr Interesse, wie das Bildungsministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. Unter den Bewerbern seien 101 ausgebildete Lehrkräfte und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gewesen.
Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) räumte in einem Interview mit der “Magdeburger Volksstimme” ein, dass das Ziel der schwarz-rot-gelben Koalition einer 103-prozentigen Unterrichtsversorgung in den nächsten Jahren nicht mehr erreichbar ist. 103 Prozent seien “aktuell unrealistisch”, sagte sie. “Den Wert werden wir in dieser Legislatur nicht erreichen. Das muss man so offen sagen. Mit einer echten Entspannung rechnen wir erst ab Anfang der 30er Jahre.”
Vor allem an Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen fehlen Lehrkräfte (Bildung.Table berichtete). An beruflichen Schulen sei keine Stelle ohne Interessent geblieben, hieß es. Erklärtes Ziel der Koalition von CDU, SPD und FDP sind 103 Prozent, um Ausfälle etwa wegen Krankheit oder Elternzeit abfedern zu können.
Bei der jüngsten Ausschreibung gaben viele Interessenten jeweils Bewerbungen für verschiedene Stellen ab. Dennoch blieben den Angaben zufolge 449 Stellen an den allgemeinbildenden Schulen ohne Bewerbung. Ein Ministeriumssprecher erklärte: “Stellen ohne Bewerbungen finden sich inzwischen in allen Regionen und Schulformen gleichermaßen. Es lassen sich nicht mehr bestimmte Fächer hervorheben, bei denen die Besetzung besonders schwierig ist. Der gesamte Fächerkanon ist inzwischen vom Mangel betroffen.” dpa

Der Lehrermangel im Freistaat ist eklatant. Direkt zum Schulstart wurde in einigen bayerischen Schulen der Pflichtunterricht gestrichen, mancherorts werden ganze Klassen tageweise nach Hause geschickt, weil die Lehrerin erkrankt ist und niemand einspringen kann. Der Personalmangel trifft die Grund- und Mittelschulen mit besonderer Wucht. Nur: Dem Kultusministerium fehlt eine Strategie.
Dafür müsste die Staatsregierung den Lehrermangel zunächst beziffern können. Doch die Grund- und Mittelschulen verwenden immer noch das Planungsprogramm “Persona-SVS” – eine Software aus dem letzten Jahrtausend. Gleichzeitig liefert das “neue” Programm zur Schulverwaltung ASV auch über 15 Jahre nach Projektstart immer noch nicht die erhofften tagesaktuellen Daten auf Knopfdruck. Belastbare Daten zur Unterrichtssituation gibt es daher erst im Februar des Folgejahres.
Es ist Zeit, das zentralistisch organisierte Schulsystem umzubauen. Jetzt. Die Schulen brauchen mehr Verantwortung und einen größeren Entscheidungsspielraum vor Ort. Schon dieses Jahr wäre hier mehr möglich gewesen. Sechs Impulse.
Das gleiche Einstiegsniveau für alle Schularten auf A13 kann nur ein erster Schritt sein. Es ist überfällig, gute Lehrkräfte als Angestellte mit unbefristeten Verträgen zu werben und sie zu Beamten gleichwertig zu bezahlen. Stattdessen müssen sich die jungen Menschen entscheiden: zwischen einer Verbeamtung auf Lebenszeit und Aushilfsverträgen, die normalerweise auf ein Schuljahr befristet sind. Die feste Bindung an den Staat als Dienstherren und der starre Rahmen der Verbeamtung schrecken viele Berufseinsteiger genauso ab wie ein prekärer Aushilfsjob.
Die Schulverwaltung sollte Abschlüsse aus anderen Ländern einfacher und schneller anerkennen, was teilweise schon zwischen den Bundesländern zu Problemen führt. Für Bewerber aus Ländern außerhalb der EU ist das Anerkennungsverfahren praktisch komplett verschlossen. Die FDP-Fraktion will das mit einem gerade eingebrachten Gesetzentwurf ändern.
Die Schulleiter sollten ein eigenes, dauerhaftes Personalbudget verantworten. Aus diesem Topf könnten sie neben angestellten Lehrkräften auch pädagogische Assistenzen und sogenannte “Teamlehrer”, die in der Corona-Pandemie über Sonderprogramme an die Schulen kamen, bezahlen. Die Schulleiter wären damit nicht mehr an starre ministeriale Fristen gebunden, sondern hätten mehr Freiheit in der Personalakquise. Nur dann lohnt sich der Aufwand wirklich und bringt echte Entlastung.
In diesem Modell braucht es nicht ständig neue bürokratische Anstellungsverfahren, die sowieso dringend entschlackt werden müssten. Dazu kommt das Problem der Schulauswahl: Bewerber sagen ihre Stelle wieder ab, weil das Ministerium sie ans andere Ende von Bayern schickt. Wer will für so einen Arbeitgeber arbeiten? Der Weg zur Wunschschule sollte offenstehen, eine Direktbewerbung von der Ausnahme zur Regel werden und die Schulleitung die nötigen zeitlichen Freiheiten erhalten.
Lesen Sie auch: Eigene Ausbildung für Führungskräfte an Schulen
Das Betretungsverbot für die rund 3.000 schwangeren Lehrkräfte (Hintergrund) sollte durch eine praktikable individuelle Lösung ersetzt werden. Zwar hat das Kabinett nach dem Schulstart neue Regeln angekündigt. Doch erst kurzfristig, am Freitag vor dem Inkrafttreten, informierte das Ministerium in einem 79-seitigen Schreiben über die notwendigen Schritte. So etwas muss doch schneller gehen und – nach Rücksprache mit dem Arzt – ohne eine solche bürokratische und rechtliche Zumutung.
Das Ministerium legt Schwangeren und Schulleitungen mit den überbordenden Vorschriften zur Gefährdungsbeurteilung eher Steine in den Weg, als dass mit peniblen Vorgaben in der Praxis tatsächlich mehr Sicherheit geschaffen würde. Leider ist diese Informationspolitik durch Bayerns Kultusministerium mittlerweile symptomatisch und alles andere als ein Aushängeschild für das Lehramt.
Um einen längeren Schuldienst für ältere Lehrkräfte attraktiv zu halten, reichen immer neue Aufrufe des Ministeriums nicht. Was es braucht: mehr Wertschätzung für ihre Erfahrung, ein ernstzunehmendes betriebliches Gesundheitsmanagement und durchdachte Angebote für einen gleitenden Übergang in die Pension. Ein solches Konzept fehlt. Das Kultusministerium hat trotz einer Fristverlängerung meine parlamentarische Anfrage dazu noch nicht beantwortet.
An Bayerns Grundschulen arbeiten 60 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit, ein Drittel von diesen sogar unter 50 Prozent. Wir könnten große Reserven durch das Aufstocken von Teil- auf Vollzeit heben. Dafür schlagen wir vor: Die Staatsregierung soll eine einmalige Prämie zahlen und gleichzeitig allen Lehrkräften durch zusätzliche Verwaltungskräfte eine Entlastung von Pflichten außerhalb des Unterrichts garantieren. Es ist übrigens kein Widerspruch, auch Teilzeitausbildungen zu ermöglichen. Denn eine zusätzlich ausgebildete Lehrkraft in Teilzeit ist besser als eine komplett fehlende Lehrkraft. Ein Antrag von unserer Fraktion hierzu wird in der Plenarsitzung am heutigen Mittwoch beraten.
Lesen Sie auch: Die Mittelschule in Bayern strauchelt
An allen Schularten sollten wir zügig Programme für Quereinsteiger einrichten. An den Mittelschulen wurde ein solches kürzlich mit heißer Nadel in der Not gestrickt. Das ist der falsche Ansatz. Statt Sondermaßnahmen sollte es ein generelles Angebot geben – mit einem durchdachten pädagogischen Konzept. Ein eignungsorientiertes Auswahlverfahren, ein modularisierter Vorbereitungsdienst, der ständig in wissenschaftlicher Begleitung weiterentwickelt wird, und ausreichend Ressourcen für die Begleitung an der Schule sind die Basis für einen gelingenden Quereinstieg.
Nur wenn die Politik grundlegende Reformen anpackt und den Lehrerberuf vom Staub des letzten Jahrtausends befreit, können wir die aktuellen Herausforderungen meistern. Dafür braucht es mehr Mut, auch heiße Eisen anzufassen!
Matthias Fischbach sitzt seit 2018 für die FDP im Bayerischen Landtag, aktuell als parlamentarischer Geschäftsführer und bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er war von 2011 bis 2013 Landesvorsitzender der Jungen Liberalen, studierte Volkswirtschaftslehre in Konstanz und München und arbeitete vor seiner Zeit im Landtag als Unternehmensberater in der Finanzwirtschaft.

Jürgen Böhm bezeichnet sich selbst im Gespräch mit Bildung.Table als “Realschul-Lobbyist”. Klar, die Existenz dieser Schulform hält er als Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer (VDR) für richtig und wichtig. Mit ruhiger Stimme sagt der 57-Jährige Sätze, die es in sich haben: Binnendifferenzierung im Klassenzimmer hält er für “ein Märchen und Augenwischerei.” Ebenso wenig hält er vom Begriff “dreigliedriges Schulsystem”, vielmehr solle man die Vielfalt im Bildungssystem aufrechterhalten. Weit über 90 Schulformen gebe es aktuell in Deutschland. “Mir konnte bisher niemand erklären, warum wir jetzt alles vereinheitlichen müssen, wo doch die einzelnen Bildungsbiografien immer individueller werden.”
Der gebürtige Thüringer begann 1993 seine Laufbahn als Realschullehrer in Bayern. Zuvor studierte Böhm Germanistik und Geschichte in Jena. 2005 gründete er im niederbayerischen Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn eine Realschule, die er bis 2018 leitete. Seither widmet er sich ausschließlich der Verbandsarbeit und bringt dabei seine Erfahrungen als Schuldirektor und Lehrer ein.
Böhm ist nicht nur seit 2010 Bundesvorsitzender des VDR, sondern auch Landesvorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbands. Außerdem vertritt er den Deutschen Beamtenverbund als stellvertretender Bundesvorsitzender und sitzt im Vorstand weiterer Bildungsverbände wie dem Bündnis Ökonomische Bildung, das die Verankerung ökonomischer Bildung in weiterführenden Schulen fordert.
Seine ehemalige niederbayerische Realschule habe neben einem offenen Ganztagsbereich besonders die klare Profilbildung für Digitalisierung ausgemacht. Schon zu Beginn wurden die Klassenzimmer mit LAN vernetzt, jeder Schüler erhielt eine E-Mail-Adresse. Es gab Laptop-Klassen und später in jedem Klassenzimmer digitale Projektionsmöglichkeiten und WLAN. Früh konnten die Lehrer online untereinander kommunizieren. Die Schule sei, was Digitalisierung betrifft, bis heute gut aufgestellt; die Umstellung in der Corona-Pandemie habe reibungslos funktioniert.
Böhm zufolge werde in der bildungspolitischen Debatte oft vergessen, dass es nicht nur um digitale Strukturen, sondern auch um das Vermitteln von Inhalten und Kompetenzen geht. “Ich bin daher ein großer Verfechter der informationstechnologischen Bildung“, erklärt er. Auch praxisbezogene ökonomische und naturwissenschaftliche Bildung sind dem Realschullehrer wichtig. Er spricht sich für Kooperationen zwischen Schulen und regionaler Wirtschaft aus. Dennoch soll für ihn Schule “kein Zulieferbetrieb für die Wirtschaft sein.”
Um seinen Standpunkt zu erklären, argumentiert Böhm historisch: Gründungsidee der Realschulen war es, zeitgenössische Themen in den Bildungskanon aufzunehmen. Als Schulform des modernen Bürgertums – “heute würden wir sagen des Mittelstands” – sollte sie auf die Anforderungen der Zeit reagieren.
Die Realschule aufrechtzuerhalten, bedeute daher auch nicht, an alten Strukturen festzuhalten. Es gehe vielmehr um ein stetiges “Neudenken von Inhalten”. Jeder Abschluss hat für Böhm seine Berechtigung, es brauche aber jeweils eine Schulform mit entsprechendem Profil. Zwischen Abitur, Mittlerer Reife und Hauptschulabschluss sieht Böhm keine hierarchischen Unterschiede. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler vom Gymnasium in seine Realschule wechselte, habe er gesagt: “‘Du steigst nicht ab von der Bundes- in die Regionalliga, du wechselst rüber. Es ist anders, ein anderes Profil, aber du bekommst einen qualifizierten Abschluss, mit dem Du viel erreichen kannst.”
Böhms Positionen zum Thema Schulformen und -abschlüsse sind nicht unumstritten. So auch seine Sicht auf das Thema Datenschutz, wo er sich für “liberale Lösungen” ausspricht. “Natürlich muss man mit Daten sensibel umgehen”, meint er. Doch die Pflicht zur Umsetzung des Datenschutzes sieht er bei den Anbietern der Softwares. Klare Rahmenbedingungen müssten her. “Wenn die Nutzung von Anwendungen aber künstlich vom Datenschutzbeauftragten behindert wird, halte ich das für ungünstig.”Vera Almotlak
19. Oktober 2022, 14:00 bis 19:00 Uhr
Fachkonferenz: #Startchancen – Fördern, wo es zählt
Mit dem “Startchancen”-Programm will die Ampel-Regierung ihr Engagement im Bildungsbereich beweisen. Auf dieser Fachkonferenz wird mit Inputvorträgen (unter anderem von Ties Rabe und Michael Wrase) und Workshops auf die Themen Chancengleichheit und Schulentwicklung eingegangen. Anmeldeschluss ist der 13. Oktober! INFOS & ANMELDUNG
24. Oktober 2022, 19:00 bis 20:30 Uhr
Diskussion: Mythos Bildung – Ungerechtigkeiten im Bildungssystem und mögliche Auswege
Aladin El-Mafaalani, Autor von “Mythos Bildung“, spricht auf dieser Veranstaltung mit Andreas Stoch (ehemaliger Kultusminister von Baden-Württemberg) und Jörg Fröscher (Schulleiter) über die Ungerechtigkeiten im heutigen Bildungssystem und mögliche Auswege aus der sozialen Ungleichheit. INFOS & ANMELDUNG
24. bis 26. Oktober 2022
Barcamp: OERcamp 2022
Das OERcamp richtet sich an Praktiker und Nutzende von Open Educational Resources. Neben Workshops, Netzwerkveranstaltungen und Podiumsdiskussionen finden Themenwerkstätten zu den sechs Handlungsfeldern der OER-Strategie des BMBF statt. INFOS & ANMELDUNG
28. bis 30. Oktober 2022
Konferenz: 13th International Conference on Distance Learning and Education
Gehostet von der Universität Barcelona beschäftigt sich die 13. ICDLE mit der Gegenwart und der Zukunft des digitalen Lernens. Keynote-Speaker sind Dragan Gasevic (Monash University) und Minjuan Wang (San Diego State University). INFOS & ANMELDUNG
03. bis 04. November 2022
Konferenz: TURN Conference
Unter dem Motto “Wandel gestalten” organisiert die Stiftung Innovation in der Hochschullehre die TURN Conference. Interessierte sollen sich über Veränderung in der Hochschullehre austauschen. Fokus: Herausforderungen, vor denen Hochschulen aktuell stehen. INFOS
07. bis 09. November 2022
Konferenz zu Bildung, Forschung, Innovation: ICERI 2022
Über 800 Dozierende, Forschende, Pädagogen und Technologen aus 80 Ländern werden auf der diesjährigen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) in Sevilla sprechen, ihre Arbeit vorstellen und sich austauschen. Die Konferenz steht unter dem Motto “Transforming Education, Transforming Lives“. INFOS