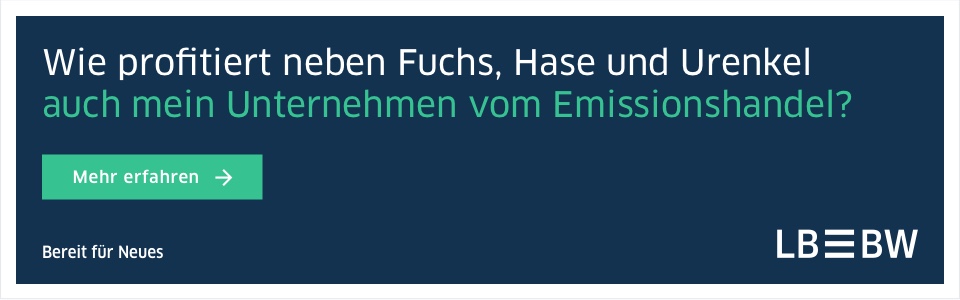“XXL-Gipfel” oder “Mega-Gipfel” titelten Medien zum gestrigen Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag. Tatsächlich war dies eine gewaltige Veranstaltung, nahmen doch die Staats- und Regierungschefs von über 40 europäischen Ländern daran teil. Es sollte ausdrücklich keine reine EU-Veranstaltung sein, und doch ging die Debatte um den Umgang mit der Energiekrise innerhalb der Staatengemeinschaft weiter, wie Ella Joyner berichtet.
Ein wesentlicher Streitpunkt ist dabei der EU-weite Gaspreisdeckel, den viele Länder wollen, andere aber klar ablehnen. Auch die Kommission ist skeptisch. Im Vorfeld des heutigen informellen EU-Gipfels haben mehrere Mitgliedstaaten einen Vorschlag für einen Gaspreisdeckel an die Kommission gesendet, der die Bedenken der EU-Behörde ausräumen soll. Das Papier verfasst haben sollen Italien, Polen, Griechenland und Belgien. Den Forderungen der Kommission, die sie als Voraussetzung für eine Preisobergrenze formuliert hat, wollen die Staaten laut dem Vorschlag nur im Fall einer Gasmangellage nachkommen. Mehr lesen Sie in den News.
Am Montag läuft die Frist ab: Bis zu diesem Stichtag müssen EU-Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, wenn sie gegen die Taxonomie-Verordnung vorgehen wollen, nach der Atomkraft und Gas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig gelten. Trotz erheblicher Bedenken in mehreren Mitgliedstaaten wird Österreich nun wohl das einzige Land sein, das diesen Weg geht. Deutschland jedenfalls hält sich zurück, und Luxemburg will sich lediglich den Österreichern anschließen. In Wien hingegen ist die Ablehnung der Atomkraft so stark, dass sogar die rechtspopulistische FPÖ als Oppositionspartei die Klage unterstützt, wie Eric Bonse berichtet.
Es ist ein bislang beispielloser Handelsstreit zwischen China und einem EU-Land: Seit Einrichtung eines “Taiwanbüros” in der litauischen Hauptstadt Vilnius haben sich die Beziehungen zwischen Litauen und der Volksrepublik immer weiter verschlechtert. “Nur in Einzelfällen schaffen es Produkte litauischer Firmen auf den chinesischen Markt”, sagt der Generaldirektor des litauischen Industrieverbands. Um dennoch Ein- und Ausfuhren zu ermöglichen, lassen sich die litauischen Unternehmen einiges einfallen. Das baltische Land hofft zudem auf Brüssel und das geplante Anti-Coercion-Instrument, wie Amelie Richter und Till Hoppe recherchiert haben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre nutzten die Zusammenkunft in Prag, um eine verstärkte Zusammenarbeit zur Linderung der Energiepreiskrise anzukündigen. Zu diesem Zweck hat die EU-Kommission ein Abkommen mit dem bedeutenden Gaslieferanten Norwegen geschlossen. Ziel sei es, “übermäßig hohe Preise kurz- und längerfristig deutlich zu senken”, wie beide Seiten am Donnerstag in Prag bekannt gaben.
Norwegen und die EU-Kommission wollen “gemeinsam Instrumente entwickeln, um die Energiemärkte zu stabilisieren und die Auswirkungen von Marktmanipulationen und Preisschwankungen zu begrenzen”, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Brüssel und Oslo nannten darin keinen konkreten Vorschlag – die Kommission hofft vermutlich, auf diese Weise den Streit darüber zu entschärfen, wie die EU mit dem extremen Anstieg der Gaspreise nach Russlands Einmarsch in der Ukraine umgehen soll.
Auch während des Treffens hielt die Debatte um die Einführung eines Gaspreisdeckels an. Mehrere Mitgliedstaaten legten gestern ein Papier mit Vorschlägen für ein dreistufiges Verfahren vor, das die Bedenken der Kommission ausräumen soll. (Dazu berichten wir auch in den News.) Befürworter argumentieren, der Gaspreisdeckel sei der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Preise in allen 27 EU-Ländern sinken.
Bundeskanzler Olaf Scholz und der niederländische Premierminister Mark Rutte sprechen sich dagegen klar gegen eine Deckelung auf EU-Ebene aus. Auch die Kommission ist skeptisch und knüpft die Einführung eines Gaspreisdeckels an konkrete Bedingungen.
Zur Senkung der Gaspreise setzt Scholz stattdessen auf Verhandlungen mit wichtigen Lieferländern wie Norwegen und den USA, deren Unternehmen zurzeit enorm profitieren, seitdem händeringend nach Alternativen zu russischem Gas gesucht wird. Den drohenden EU-Gaspreisdeckel sieht man in Berlin als Druckmittel für die Gespräche, insbesondere mit Oslo.
Brisant in der EU-Energiedebatte ist die Frage der nationalen Alleingänge bei Hilfspaketen. Für ihr 200-Milliarden-Euro Energiehilfspaket erntete die Bundesregierung heftige Kritik in Prag – etwa vom polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki. Er sagte, es sei “klar, dass es nicht sein darf, dass die Energiepolitik der Europäischen Union unter dem Diktat Deutschlands umgesetzt wird”.
Kritiker werfen Deutschland vor, einerseits Gas für Haushalte und Unternehmen zu subventionieren, also zum Konsum zu ermuntern. Auf der anderen Seite blockiere Berlin die EU-Preisobergrenze. Scholz erwiderte, alle Staaten müssen ihre Bürger durch diese Krise helfen. Berlin sei nicht der einzige Staat, der so ein Paket beschließe. Auch beim heutigen informellen EU-Gipfel dürfte die Debatte um den Umgang mit der Energiekrise weitergehen.
Das Format der Europäischen Politischen Gemeinschaft geht auf einen Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Ziel ist es, einen engeren Austausch der EU-Länder mit Partnern außerhalb der EU zu ermöglichen. “Wir teilen ein gemeinsames Umfeld, oft eine gemeinsame Geschichte, und wir sind dazu berufen, unsere Zukunft gemeinsam zu schreiben”, sagte Macron in Prag. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete das Treffen als “große Innovation”.
Zu der Runde gehören neben den EU-Staaten Albanien, Nordmazedonien, Kosovo, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Georgien, Moldawien, die Ukraine, Armenien und Aserbaidschan sowie die vier EFTA-Länder (Norwegen, Schweiz, Island und Liechtenstein) und schließlich das Vereinigte Königreich und die Türkei. Russland und Belarus waren nicht zu dem Gipfel eingeladen.
Auf der Tagesordnung standen Gespräche rund um die Sicherheitslage und den russischen Einmarsch in die Ukraine. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj war per Video zugeschaltet. Thema war außerdem die Migration. Wie erwartet wurden bei dem Treffen keine Entscheidungen getroffen. Das nächste Treffen wird im Frühjahr in Chişinău stattfinden, wie die moldauische Präsidentin Maia Sandu am Donnerstag ankündigte. Mit sas, dpa
Der Countdown läuft: Spätestens am 10. Oktober müssen EU-Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die umstrittene Taxonomie klagen, mit der die EU-Kommission Atomkraft und Gas unter bestimmten Bedingungen als “nachhaltig” einstuft. Deutschland hat schon angekündigt, dass es trotz erheblicher Bedenken nicht gerichtlich gegen die EU-Verordnung vorgehen will. Nun macht auch Luxemburg einen Rückzieher.
Das Großherzogtum will nicht selbst aktiv werden, sondern sich lediglich einer Klage Österreichs anschließen, sagte ein Sprecher des luxemburgischen Energieministeriums auf Anfrage von Europe.Table. Dies sei auch von Anfang an so geplant gewesen. Allerdings hatte Energieminister Claude Turmes in einem Tweet zunächst den Eindruck erweckt, dass auch Luxemburg selbst vor den EuGH ziehen würde. Nun ist nur noch von einer Unterstützung die Rede. Im Zuge der sogenannten Streithilfe will Luxemburg der Klage Österreichs beispringen und vor Gericht eigene Argumente vorbringen.
Wien zeigt sich entschlossen. “Unsere Position hat sich nicht verändert”, sagte eine Sprecherin von Energie- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler auf Anfrage. Am kommenden Donnerstag plant die Grünen-Politikerin ein Mediengespräch zur österreichischen Position hinsichtlich der umstrittenen Einstufung von Gas und Atomenergie als klimafreundliche Investitionen. Österreich hat sich bereits vor Jahrzehnten gegen die Kernenergie entschieden. Die Anti-Atomkraft-Haltung gehört zur politischen DNA des EU-Landes. Selbst die rechtspopulistische FPÖ unterstützt als Oppositionspartei die Klage.
Die Haltung Luxemburgs ist dennoch ein herber Rückschlag für die österreichische Regierung. “Wir werden die nächsten Wochen und Monate weiter dazu nützen, weitere Verbündete zu gewinnen“, sagte Gewessler noch im Juli, als sie die rechtlichen Schritte gegen die Taxonomie-Verordnung ankündigte.
Immerhin kann Österreich weiter auf politische Unterstützung setzen. “Luxemburg hat seine Position bezüglich des delegierten Rechtsaktes zur Taxonomie seit dessen Veröffentlichung nicht geändert”, sagte die grüne Europaabgeordnete Tilly Metz. Eine separate Klage “hätte keinen strategischen Nutzen”. Es sei viel besser, die Kräfte zu bündeln und koordiniert vorzugehen. Dennoch sei es “schade, dass nicht mehr Mitgliedstaaten sich klar gegen den Delegierten Rechtsakt und die Kompetenzüberschreitung der Kommission stellen”.
Im September haben mehrere Länderbüros der Umweltorganisation Greenpeace eine Klage vor dem EuGH angekündigt, falls die Kommission ihre Entscheidung nicht revidiert. Eine Klage vor dem EuGH ist die letzte Möglichkeit, die Regulierung doch noch zu Fall zu bringen. Im Juni hatte sich das Europaparlament mit knapper Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission ausgesprochen. Im Rat waren die Gegner von vornherein in der Minderzahl. Mit Hans-Peter Siebenhaar
Trilog: ETS und MSR
10.10.2022
Themen: Beim zweiten Trilog zur Reform des europäischen Emissionshandels stehen erste große politische Fragen auf der Agenda. Unter anderem sollen die Konditionen besprochen werden sowie die Benchmarks, unter denen Industrieanlagen weiterhin kostenlose Emissionsrechte erhalten. Außerdem steht die Einbeziehung von Biomasse und Abfallverwertung in den Emissionshandel auf der Tagesordnung. Die noch offenen Fragen nach einer Export-Regelung für die Einführung des CBAM, dem allgemeinen Ambitionsniveau des ETS sowie die Einführung eines zweiten ETS für Gebäude und Verkehr sollen zumindest angesprochen werden.
Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Berichtsentwurf zu den resilienten Lieferketten im EU-Handel zur Behebung aktueller Engpässe, Entwurf einer Stellungnahme zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz), Berichtsentwurf zum Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten vor wirtschaftlichem Zwang durch Drittländer (Anti-Coercion).
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Entwurf eines Entschließungsantrags zu einem angemessenen Mindesteinkommen zur Gewährleistung der aktiven Inklusion, Berichtsentwurf zu den Leitlinien für die beschäftigungspolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Abstimmung über den Gesamthaushaltsplan der EU für das Haushaltsjahr 2023, Anleihestrategie zur Finanzierung des NextGenerationEU-Programms.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu gemeinsamen Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbare Gase und Erdgas sowie Wasserstoff, öffentliche Anhörung: Den Binnenmarkt für Bauprodukte fit für das 21. Jahrhundert machen.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Gedankenaustausch mit einer Delegation der Globalen Koalition gegen den IS, Meinungsaustausch mit Antoine Bondaz (Research Fellow und Direktor bei der Fondation pour la Recherche Stratégique) zur Analyse der militärischen Einschüchterung Taiwans durch China, Gedankenaustausch mit Toivo Klaar (EU-Sonderbeauftragter für den Südkaukasus) zum neuen militärischen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)
10.10.2022 15:30-18:30 Uhr
Themen: Berichtsentwurf zum Abkommen zwischen der EU und der Ukraine über die Güterbeförderung auf der Straße, Bericht über die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für den nachhaltigen Luftverkehr, Berichtsentwurf über intelligente Verkehrssysteme im Bereich des Straßenverkehrs und für Schnittstellen mit anderen Verkehrsträgern.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)
10.10.2022 15:00-17:15 Uhr
Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Entwurf einer Stellungnahme zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und bessere Informationen.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)
10.10.2022 16:00-18:00 Uhr
Themen: Berichtsentwurf zur Festlegung von Vorschriften zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Briefkastenfirmen für steuerliche Zwecke, Entwurf einer Stellungnahme zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz), Berichtsentwurf über Märkte für Finanzinstrumente.
Vorläufige Tagesordnung
Informelle Ministertagung Energie
11.10.-12.10.2022
Themen: Die Minister für Energie kommen zu Beratungen zusammen.
Infos
Trilog: Batterie-Regulation
11.10.2022
Themen: Die Batterie-Regulation sieht unter anderem vor, dass Autohersteller für das Recycling von Altbatterien aus ihren Elektrofahrzeugen verantwortlich sind, und dass neue Lithium-Ionen-Batterien einen bestimmten Anteil an recyceltem Material enthalten und neue Batterien leichter recycelbar sein müssen.
Trilog: Effort Sharing
11.10.2022
Themen: Die Effort Sharing Regulation (ESR) legt verbindliche Emissionsreduktionsziele für Sektoren fest, die nicht im ETS abgedeckt sind. Beim zweiten Trilog geht es unter anderem um Reduktionsziele für Nicht-CO2-Emissionen, die jährlichen Emissionsberechtigungen für jeden Mitgliedstaat und die nationalen Reduktionspfade.
Informelle Ministertagung Beschäftigung und Soziales
12.10.-13.10.2022
Themen: Arbeitsthemen der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, Auswirkungen der Energiearmut, Ukraine-Krise.
Infos
Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)
12.10.-13.10.2022
Themen: Erläuterung des Erweiterungspakets 2022 durch Olivér Várhelyi (Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für Nachbarschaft und Erweiterung), Gedankenaustausch mit Swjatlana Zichanouskaja (Führerin der demokratischen Kräfte von Weißrussland), Berichtsentwurf zur Förderung der regionalen Stabilität und Sicherheit in der gesamten Nahost-Region, Gedankenaustausch mit Jorge Toledo Albiñana (Botschafter der EU in China) über die Beziehungen zwischen der EU und China.
Vorläufige Tagesordnung
Wöchentliche Kommissionssitzung
12.10.2022
Themen: Mitteilung über die Anwendung des EU-Rechts, jährliches Erweiterungspaket mit Fortschrittsberichten zu den EU-Beitrittskandidaten, 2023 als Europäisches Jahr der Aus- und Weiterbildung.
Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz 12 Uhr
Rat der EU: Justiz und Inneres
13.10.-14.10.2022
Themen: Informationen der Kommission zu Richtlinien über die Haftung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Sachstand zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine und Bekämpfung der Straflosigkeit, Gedankenaustausch zur Wahrung der Grundrechte in Krisenzeiten.
Vorläufige Tagesordnung
Trilog: Social Climate Fund
13.10.2022
Themen: Der Klimasozialfonds soll die zusätzliche Belastung für Verbraucher und kleine Betriebe durch den zweiten Emissionshandel für Gebäude und Verkehr abfedern. Die Verhandlungen sind somit unmittelbar mit den Verhandlungen zur Reform des ETS verknüpft. Offen ist noch der Umfang des Fonds, die Höhe der Eigenmittel der Mitgliedstaaten sowie die Frage, wie viel Geld die Mitgliedstaaten als direkte Einkommensbeihilfen an Verbraucher auszahlen dürfen. Die genaue Agenda für den Trilog am 13.10. steht noch nicht fest.
Sitzung des Ausschusses für Steuerfragen (FISC)
13.10.2022 09:00-11:30 Uhr
Themen: Öffentliche Anhörung zum Thema “Fallstudien zur nationalen Steuerpolitik der Mitgliedstaaten – Luxemburg: durchgeführte nationale Steuerreformen und Bekämpfung aggressiver Steuerpraktiken”.
Vorläufige Tagesordnung
Vor gut einem Jahr nahm ein bisher beispielloser Handelsstreit zwischen einem EU-Staat und China seinen Lauf. Stein des Anstoßes: die Einrichtung eines “Taiwanbüros” in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Peking verhängte darauf Sanktionen gegen Litauen. Die Europäische Union hat mittlerweile eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht – die Lage für den baltischen EU-Staat hat sich aber kaum verbessert: “Generell steht die gesamte Produktion. Die Exporte von Litauen nach China wurden eingestellt. Nur in Einzelfällen schaffen es Produkte litauischer Firmen auf den chinesischen Markt – meistens sind das Technologieunternehmen”, sagt der Generaldirektor des litauischen Industrieverbands, Ričardas Sartatavičius, China.Table.
Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem baltischen Land und der Volksrepublik verlief schrittweise und gipfelte letztendlich darin, dass Litauen ganz aus dem Zollsystem Chinas verschwand und die diplomatischen Beziehungen herabgestuft wurden (China.Table berichtete). Wenige Tage nach dem Zoll-Eklat Anfang Dezember erschien das EU-Land zwar wieder als Auswahl-Option im chinesischen System. “Aber das ändert nichts an der Situation”, sagt Sartatavičius. Die Unternehmen könnten Erklärungen ausfüllen, erhielten dann aber keine Bestätigung.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Getränke-Branche: So seien Container mit Getränken wie Bier von China nach Litauen zurückgeschickt worden, weil die Zollerklärungen nicht akzeptiert worden seien. Der Verband wisse nicht, wie groß der Schaden für die litauische Getränke-Industrie bisher sei. “Aber wenn der chinesische Markt dafür vollständig geschlossen wird, könnten die Unternehmen zwei bis fünf Millionen Euro an Einnahmen im Jahr verlieren. Auf staatlicher litauischer Ebene ist das ein kleiner Geldbetrag, aber für Unternehmen ist das viel.”
Im Frühjahr dieses Jahres wurde überraschend wieder etwas mehr Ware durch den Zoll gelassen – für den Sommer sank die Zahl dann wieder. Im September sind die Einfuhren aus Litauen in die Volksrepublik laut chinesischen Zollangaben um 91,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. Betroffen seien Metall- und Holzprodukte, die zuvor zu den Top-5-Exportwaren des baltischen Staats gehörten. Die Ausfuhren seien “vollständig vernichtet“, so Sartatavičius. Auch Hightech-Laser und Torf-Exporte gehören zu den betroffenen Produkten.
Litauens Exporte nach China hatten im Dezember 2021 einen nahezu vollständigen Einbruch erlitten. Lediglich Waren im Wert von rund 3,35 Millionen Euro schafften es in dem Monat durch den chinesischen Zoll, wie Sartatavičius sagt. Ein massiver Rückgang im Vergleich zum Vorjahr: Da seien es Waren im Wert von 38 Millionen Euro gewesen. Auch im November 2021 lief der Handel noch. Litauen exportierte Waren im Wert von gut 37 Millionen Euro in die Volksrepublik. Im selben Monat hatte das taiwanesische Handelsbüro in Vilnius eröffnet.
Dass China einige Waren ins Land tröpfeln lässt, scheint Verschleierungstaktik – so werden die Beweise für die EU-Beschwerde bei der WTO weniger eindeutig. Aber auch die Litauer sind findig. So werde beispielsweise auf Häfen im lettischen Riga oder im polnischen Danzig ausgewichen. Für Importe aus der Volksrepublik wird ebenfalls “getrickst” und als Entladehafen Riga angegeben. Die lettische Hauptstadt ist mit Lkw-Transport gut an Nord-Litauen angebunden. “Die Unternehmen suchen natürlich nach verschiedenen Lösungen”, sagt Sartatavičius.
China hatte im vergangenen Jahr Druck auf Unternehmen aus anderen EU-Staaten ausgeübt, die mit litauischen Zulieferern arbeiteten oder selbst in Litauen produzierten. Auch hier scheint die Lage weiterhin schwierig. Gesprächsanfragen an betroffene Unternehmen wie den Reifenhersteller Continental wurden abgelehnt. Die litauischen Unternehmen hoffen nun auf einen Erfolg bei der WTO, wie Sartatavičius berichtet.
Auch wenn das noch dauern könnte. “Wir rechnen nicht mit einer baldigen Entscheidung. Das kann ein paar Jahre dauern.” Der direkte Nutzen für litauische Unternehmen stehe zudem noch in den Sternen: “Gemäß den WTO-Entscheidungen gibt es weder eine Verpflichtung, die entstandenen Verluste zu kompensieren, noch eine Garantie dafür, dass die Probleme nicht wieder vorkommen.”
Hoffnungsvoll blickt man in Richtung Brüssel: Auf EU-Ebene wird derzeit über ein neues Instrumentarium diskutiert, um auf solche Praktiken künftig besser antworten zu können. Die EU-Kommission hatte Ende 2021 ihren Vorschlag für das sogenannte Anti-Coercion-Instrument vorgestellt. Derzeit arbeiten Europaparlament und der Rat der Mitgliedstaaten daran, ihre Änderungswünsche zu formulieren. Der Trilog zwischen den EU-Institutionen soll in den kommenden Wochen beginnen, um die finale Fassung der Verordnung festzulegen.
Der Handelsausschuss soll am kommenden Montag die Position des Europaparlaments festzurren. Die Abgeordneten wollen den Kommissionsvorschlag an einigen Stellen verschärfen, wie die von Berichterstatter Bernd Lange zusammengetragenen Änderungswünsche zeigen, die Europe.Table vorliegen. So soll schon die Androhung von Zwangsmaßnahmen durch Drittstaaten ausreichen, damit die Kommission tätig werden kann. Zudem soll sie weiterreichende Maßnahmen verhängen können, um den entstandenen Schaden in einem EU-Land zu kompensieren.
Zu dem vorgesehenen Arsenal zählt etwa, dass die EU Waren aus China oder anderen aggressiv auftretenden Ländern mit höheren Zöllen belegen oder deren Unternehmen von öffentlichen Aufträgen in der EU ausschließen kann. Die Kommission will sich hier weitgehende Entscheidungsbefugnisse einräumen. Das Europaparlament drängt aber auf weiterreichende Informationspflichten der Behörde. Die Mitgliedstaaten fordern im Rat überdies mehr Mitsprache bei der Verhängung der Gegenmaßnahmen. Mitarbeit: Till Hoppe
Einen Tag vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs haben mehrere Mitgliedstaaten gestern einen detaillierteren Vorschlag für einen EU-weiten Gaspreisdeckel an die Kommission gesendet. In dem dreiseitigen Dokument, das Europe.Table vorliegt, schlagen die Unterstützer ein dreistufiges Vorgehen vor und versuchen, mehrere Bedenken der Kommission auszuräumen.
Verfasst haben das Papier Italien, Polen, Griechenland und Belgien, hieß es aus Ratskreisen. Der Vorschlag fasse jedoch die Diskussion unter einer größeren Zahl von Mitgliedstaaten zusammen, sagte ein anderer EU-Diplomat.
Die Kommission hatte für den Fall, dass ein Gaspreisdeckel auf Großhandelsebene eingeführt werden sollte, zwei zentrale Forderungen gestellt: höhere, verpflichtende Gaseinsparungen und verpflichtende Solidaritätsabkommen. Beiden Forderungen wollen die Mitgliedstaaten gemäß dem Papier jedoch erst in einer Gasmangellage nachkommen.
Bei den Verbrauchsreduzierungen wollen sie nicht über die schon im Sommer beschlossene Gassparverordnung hinausgehen. Solidaritätsvereinbarungen sollen laut dem Papier zwar alle Mitgliedstaaten abschließen, jedoch fordern diese von der Kommission zuvor Leitlinien.
Für den Fall einer Mangellage machen die Staaten jedoch das Zugeständnis, auf einen Gaspreisdeckel zu verzichten, damit das Gas marktbasiert auf die EU-Mitglieder verteilt werden kann.
Ohne einen Gasmangel solle jedoch der Preisdeckel gelten. Der Korridor von “zum Beispiel fünf Prozent” um einen neuen Preisindex soll ausreichend Raum für Gebote lassen, damit Gas weiter innerhalb des Binnenmarktes fließen kann.
Falls sich der Marktpreis dem Deckel nähert oder die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden kann, sollen in einer zweiten Stufe zunächst weitere Maßnahmen greifen. Zum einen “verstärkte Maßnahmen zur Nachfragereduzierung und Solidarität”, die jedoch nicht näher ausgeführt werden. Zum anderen sollen Preise oberhalb des Korridors zulässig werden, um weiterhin Importe zu sichern. Dafür soll beispielsweise die gemeinsame Einkaufsplattform der EU Differenzverträge schließen können. ber
Die französische Regierung hat am gestrigen Donnerstag ihren Plan zur Energieeinsparung vorgestellt. Dabei handelt es sich um 15 nicht verbindliche Maßnahmen, deren Ziel es ist, den Energieverbrauch des Landes innerhalb von zwei Jahren um 10 Prozent zu senken (gegenüber 2019).
Dieser Plan zur “sobriété énergétique” ist das Ergebnis von neun Arbeitsgruppen, die seit Juni getagt hatten. Die Planungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs konzentrierten sich auf folgende Bereiche: vorbildlicher Staat, Unternehmen und Arbeitsorganisation, Einrichtungen mit Publikumsverkehr und große Einkaufszentren, Industrie, Digitales, Sport, Wohnungsbau, Mobilität und Gebietskörperschaften.
Die Arbeitsgruppe empfiehlt etwa, die Temperatur in allen Gebäuden auf 19 Grad zu reduzieren. Diese Maßnahme gilt sowohl für die Industrie, für Geschäfte sowie für öffentliche Gebäude. In Sporteinrichtungen soll die Temperatur um zwei Grad und im Wasser von Schwimmbädern um ein Grad gesenkt werden. Es wurden auch Maßnahmen in Bezug auf die Straßenbeleuchtung, die Beleuchtung von Sporteinrichtungen oder die Einführung von Automatisierungs- und Energiekontrollsystemen in öffentlichen Gebäuden angekündigt.
Ein weiterer Bereich des Sparplans ist die sogenannte “sanfte Mobilität” (mobilité douce). Für Privatpersonen sollen Anreize zur Bildung von Fahrgemeinschaften geschaffen werden. Die Regierung erklärt, dass in Kürze ein umfassender Aktionsplan zu diesem Thema vorgestellt wird. Auf der Ebene der Unternehmen wird gefordert, bei Fahrten von weniger als vier Stunden die Bahn zu nehmen, statt das Auto oder Flugzeug. Zudem sollen verstärkt Videokonferenzen genutzt werden. Für Arbeitnehmer wird die Pauschale für nachhaltige Mobilität erhöht, im öffentlichen Dienst etwa von 200 auf 300 Euro.
Einige der wichtigsten Maßnahmen sind aus der Arbeitsgruppe zur Arbeitsorganisation hervorgegangen. Die erste davon betrifft das Home-Office für Staatsbedienstete. Diese soll über eine Erhöhung der Pauschale für Telearbeit um 15 Prozent gefördert werden. Die Unternehmen müssen ihrerseits “eine geeignete Organisation der Telearbeit im Falle einer besonderen Spannung im Netz” vorsehen. Außerdem können Staatsbedienstete aufgefordert werden, im Falle von Spitzenlasten zeitversetzt zu arbeiten. “Es obliegt den einzelnen Unternehmen, ihren Plan zu überwachen”, so die Regierung. Ein Kontrollmechanismus wurde bislang nicht erwähnt.
Privatpersonen sollen durch die Einführung eines Sparbonus für die vorbildlichsten Haushalte in ihren Bemühungen unterstützt werden. Zudem wurde eine Prämie von 9.000 Euro für den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Prämie von 15.000 Euro für den Einbau eines Holzpelletkessels angekündigt.
Eine weitere Maßnahme betrifft die Information der Bürger: Es ist geplant, im Fernsehen nach dem gewöhnlichen Wetterbericht und zwischen anderen Sendungen über die Belastung des Stromnetzes mit grünen, gelben und roten Symbolen zu informieren. Die Hoffnung ist, vier von fünf Menschen in Frankreich auf dem Wege zu erreichen. Mehrere Fernsehsender wie TF1 oder France Télévision hatten bereits ihre Unterstützung für diese Maßnahme angekündigt. Die Regierung wies darauf hin, dass keine dieser Maßnahmen verbindlich sei. cst
Die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden geschäftsführenden Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, Klaus Regling, geht weiter. Die Euro-Staaten konnten sich in einer außerordentlichen Verwaltungsratssitzung nur auf eine Interimslösung verständigen.
Laut einer Mitteilung des ESM soll der stellvertretende Managing Director, der Franzose Christophe Frankel, bis zum 31. Dezember 2022 die Aufgaben des Geschäftsführers übernehmen. Die Frist könne sich auch verkürzen, sollte der Verwaltungsrat in der Zwischenzeit einen permanenten geschäftsführenden Direktor bestimmen. Frankel tritt sein Interimsmandat morgen an, das Mandat von Klaus Regling läuft heute ab. Regling stand mehr als zehn Jahre an der Spitze des ESM.
Paschal Donohoe, Vorsitzender des ESM-Gouverneursrats, unterstrich in der Mitteilung, der Auswahlprozess für die Regling-Nachfolge sei vor Monaten mit mehreren exzellenten Kandidaten gestartet, aber keiner habe die sehr hohe Schwelle von 80 Prozent des ESM-Kapitals auf sich vereinigen können. Donohoe betonte, um die Kontinuität der laufenden Geschäfte des Stabilitätsmechanismus zu gewährleisten, habe der Verwaltungsrat Christophe Frankel interimistisch zum Leiter des ESM ernannt. Frankel sei seit der Gründung des ESM im Jahr 2012 stellvertretender geschäftsführender Direktor und verfüge “über einen hervorragenden beruflichen Hintergrund im Bereich Finanzen und Finanzmärkte”, so der Verwaltungsratsvorsitzende. cr
Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Europaparlament, Adrian Vázquez Lázara, sieht das Zustandekommen eines Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF) als Voraussetzung für weitere Fortschritte bei EU-US-Digitalthemen. “Das wichtigste Problem, das wir lösen müssen, bevor wir vorankommen, ist der Datenschutz“, sagte er Europe.Table. Um eine Nachfolgeregelung für das vor zwei Jahren vor dem Europäischen Gerichtshof durchgefallene Privacy Shield wird seit kurz nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung gerungen.
Die US-Regierung beabsichtigt, in den kommenden Tagen eine Lösung vorzustellen, wie Daten, die der Datenschutzgrundverordnung unterliegen, künftig auch in den USA besser geschützt werden können. Dafür will Joe Biden Präsidialverfügungen erlassen, auf deren Basis dann die EU-Kommission ihrerseits einen Vorschlag für eine sogenannte Angemessenheitsentscheidung erarbeiten kann. Diese ist eine formale Voraussetzung für eine vereinfachte Übertragungserlaubnis personenbezogener Daten ins Nicht-EU-Ausland.
“Wenn der TADPF geklärt ist, können wir mit anderen Aspekten fortfahren”, sagt Adrian Vázquez Lázara. Eine bessere Interoperabilität zwischen beiden Rechtsräumen ist politisches Ziel, doch bislang sind die Regularien oft inkompatibel. “Wie werden wir Künstliche Intelligenz auf beiden Seiten des Ozeans regulieren? Wie gehen wir mit Digital Services Act um, damit sich die US-Unternehmen nicht bedroht fühlen?” Diese Themen seien in Folge des TADPF anzugehen. Für eine bessere Regulierung von Künstlicher Intelligenz hatte das Weiße Haus in dieser Woche Vorschläge unterbreitet.
Ein neuer Rechtsrahmen für den transatlantischen Datentransfer werde auch neue Dynamik in die Gespräche im Handels- und Technologierat (TTC) bringen, erwartet der liberale Politiker aus Spanien. “Der TTC ist eine große Chance, auch wenn er bislang nichts Greifbares gebracht hat.”
Es sei aber an der Zeit, Parlamente und andere Stakeholder in die Gespräche zwischen EU-Kommission und US-Regierung einzubinden, forderte Vázquez Lázara. Der Rechtsausschuss werde die Kommission offiziell auffordern, mit der US-Regierung über die Beteiligung zu verhandeln. “Ich bin zuversichtlich, dass uns das am Ende gelingen wird.”
Die Gespräche einer Delegation des JURI-Ausschusses in Washington hätten gezeigt, dass die Gesprächspartner aufseiten des US-Kongresses wenig wüssten über die Regulierungsvorhaben in Europa, wie etwa AI Act oder Haftungsfragen. “Das ist bemerkenswert, weil US-Unternehmen davon betroffen sein werden.” Deshalb sollten sich auch Vertreter der Legislative im Rahmen des TTC austauschen und beide Seiten zum TTC eingeladen werden, damit Bedenken gehört werden können. “Das ist der beste Weg, um eine gemeinsame Basis zu finden und gleiche Bedingungen zu schaffen.” tho/fst
Deutschland bereitet eine neue Raumfahrtstrategie vor. Im digitalen Zeitalter und angesichts der geopolitischen Lage seien Fähigkeiten im Weltraum wesentliche Bausteine der deutschen und europäischen Souveränität, heißt es dazu in einem Impulspapier für die deutsche Raumfahrtpolitik, das Anna Christmann (Grüne) am Donnerstag vorstellte. Die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt hatte Mitglieder der Raumfahrt-Community nach Berlin eingeladen, um über die Inhalte der neuen Strategie zu diskutieren.
Besonderes Augenmerk legt Christmann bei der Strategieentwicklung auf den Bereich New Space, also die Kommerzialisierung der Raumfahrt und ihre Verknüpfung mit der klassischen Wirtschaft. “Wir müssen zu einer stärker wettbewerbsorientierten Entwicklung in der Raumfahrt kommen”, sagte Christmann. “Auch im Trägerbereich.”
Darüber hinaus verwies die Raumfahrtkoordinatorin auch auf das Secure Connectivity Programme der EU zur Etablierung eines sicheren Kommunikationsnetzes im erdnahen Orbit. “Wir müssen eine europäische Konnektivitätsinitiative auf den Weg bringen und dabei Wettbewerb und Bedarf im Auge behalten”, heißt es dazu im Impulspapier.
Die Bundesregierung sei zufrieden mit der Ratsposition, wonach das satellitengestützte Kommunikationsnetz in mehrere Einzelprojekte aufgeteilt werden soll, damit auch KMU angemessen beteiligt werden können, sagte Christmann. Sie habe sich zum Thema Secure Connectivity mit EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton ausgetauscht, auch zur Beteiligung der European Space Agency (ESA) an dem Projekt. Es sei wichtig, dass es richtig ausgerichtet sei. “Dafür werden wir uns einsetzen.”
Der ESA-Ministerrat trifft sich am 22. und 23. November in Paris. Das höchste Gremium der Agentur arbeitet den europäischen Raumfahrtplan aus und stellt die langfristige Finanzierung der Aktivitäten sicher “Mittelfristig müssen die europäischen Raumfahrtstrukturen noch effizienter werden”, heißt es in dem Papier. Unter anderem müssten die Rollen von ESA und EU in der Raumfahrt eindeutig geklärt werden. “Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir heute festlegen, welche Rolle Deutschland in der Exploration des Weltalls spielen kann und will: Was geschieht nach dem Ende der Internationalen Raumstation ISS, wie beteiligen wir uns am US-amerikanischen Artemis-Programm?”
Das Bundeswirtschaftsministerium als federführendes Raumfahrtressort in Deutschland geht davon aus, “dass wir zukünftig viel stärker auf Raumfahrtanwendungen angewiesen sein werden, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und die eigene Souveränität sicherzustellen”. Es betrachtet die Raumfahrt als “ein wesentliches strategisches Feld für die Zukunft” und die deutsche Raumfahrtstrategie als Ergänzung zur europäischen Strategie.
Sechs Handlungsfelder hat das Ministerium für die Strategieentwicklung identifiziert:
Das Fazit: Deutschland muss sich in seiner neuen Raumfahrtstrategie ambitionierte Ziele setzen, für die jetzt die Weichen richtig gestellt werden müssen. vis

Wird die Energiekrise als Vorspeise, Hauptgericht oder Dessert serviert? Immerhin findet der heutige informelle Gipfel vor dem ebenfalls informellen Treffen der EU-Energieminister statt, das nächste Woche in Prag abgehalten wird. Und all diese informellen Gipfeltreffen bilden den Auftakt für den nächsten Europäischen Rat am 20. und 21. Oktober, bei dem Energiefragen erneut ganz oben auf der politischen Agenda stehen werden.
In der Choreografie dieser Gipfeltreffen taucht eine Frage immer wieder auf: die nach der Sitzordnung, zum Beispiel beim Abendessen. Und die Frage ist keineswegs harmlos. Wer wird neben wem sitzen? Worüber würden sich der sparsame Mark Rutte und ein Kyriakos Mitsotakis, dessen Land von der Finanzkrise mitgerissen wurde, unterhalten? Welche Freundlichkeiten könnten Emmanuel Macron und Viktor Orbán bei einem guten Burgunder austauschen?
Es sieht nicht so aus, aber wir berühren hier den harten Kern der europäischen Verhandlungen, wo es sehr weh tun kann: die Konsensbildung. Hier ist jedes Mittel recht, ob am Arbeitstisch oder am Esstisch. Dabei ist auch die andere Seite der Medaille zu beobachten, nämlich das Einstimmigkeitsprinzip. Mit der Aussicht auf eine Europäische Union, die in nicht allzu ferner Zukunft die Grenze von 30 Mitgliedstaaten überschreiten könnte, kehrt das Ende des Einstimmigkeitsprinzips zugunsten des Mehrheitsprinzips nämlich mit Macht zurück.
Die Forderung, Mehrheitsentscheide auszuweiten, ist ein Dauerthema in der Debatte um die Handlungsfähigkeit der EU – daran erinnern Nicolai von Ondarza, Leiter der Forschungsgruppe EU/Europa beim SWP und Mitarbeiterin Julina Mintel in einer vor kurzen veröffentlichten Analyse. “In einer Union von aktuell 27 Mitgliedstaaten soll die Ausweitung von Mehrheitsentscheiden garantieren, dass die Anzahl an Vetospielern reduziert und somit die Kompromissfindung einfacher wird”, schreiben sie.
Dabei sollen die sogenannte Passerelle-Klausel im EU-Vertrag genutzt werden. Die bitte was? Also nochmal langsam. Eine “Passerelle” ist eine kleine Brücke, ein Steg, der eine Überquerung ermöglicht. Mit anderen Worten: Die Klausel bringt eine gewisse Flexibilität in den Entscheidungsprozess der EU.
Für diejenigen, die den Unterricht in Europapolitik verpasst haben: Passerelle-Klauseln erlauben unter bestimmten Bedingungen den Übergang von der Beschlussfassung mit Einstimmigkeit zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Mit diesen flexiblen Elementen lassen sich die Verträge anpassen, ohne das Revisionsverfahren durchlaufen zu müssen. Ihre Nutzung ist jedoch an die Einhaltung bestimmter Bedingungen geknüpft, insbesondere an die Benachrichtigung der nationalen Parlamente.
Der Europäische Rat muss die nationalen Parlamente von seiner Entscheidung in Kenntnis setzen. Wenn ein nationales Parlament innerhalb von sechs Monaten seine Ablehnung mitteilt, wird der EU-Beschluss nicht erlassen. Erfolgt kein solcher Einspruch, so kann der Beschluss nach seinem Erlass durch den Europäischen Rat in Kraft treten. Die vorgenommene Änderung ist in diesem Fall dann endgültig. In einigen Bereichen (mehrjähriger Finanzrahmen, GASP, bestimmte Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik, Umwelt, etc.) können die Parlamente der Mitgliedsländer jedoch keinen Einspruch erheben. Außerdem kann die Passerelle-Klausel nicht bei “Beschlüssen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen” angewendet werden.
Heute sind es vor allem mittel- und osteuropäischen Staaten, die Mehrheitsentscheidungen ablehnen, wie die SWP-Forscher von Ondarza und Mintel schreiben. “Sie befürchten, dass die EU von Frankreich und Deutschland dominiert werden könnte und in der Außen- und Sicherheitspolitik die Belange kleinerer Mitglieder womöglich übergangen werden.”
Recht gebe ihnen dabei ein Blick auf die Abstimmungsprotokolle, nach denen Frankreich so gut wie nie, Deutschland in den vergangenen Jahren nur selten, aber kleine mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten dafür häufiger überstimmt würden, führen die Analysten fort. “Es ist daher politisch nicht verwunderlich, dass insbesondere diese Staaten skeptisch sind gegenüber einer neuerlichen Ausweitung von Mehrheitsbeschlüssen”, schlussfolgern sie.
Dennoch, eine EU mit 30 und mehr Mitgliedern, darunter etliche neue mit unter 10 Millionen Einwohnern, kann nur handlungsfähig bleiben, wenn gleichzeitig flächendeckend das Mehrheitsprinzip eingeführt wird – mit Ausnahme weniger konstitutioneller Entscheidungen, wie von Ondarza und Mintel betonen.
Sie schlagen deshalb vor, die Überführung zur qualifizierten Mehrheit in kritischen Bereichen mit einer “Notbremse” zu kombinieren. “Mit ihr könnte eine politisch zu definierende kleine Anzahl von Mitgliedstaaten erwirken, dass ein mit qualifizierter Mehrheit gefasster Beschluss, der ihre vitalen nationalen Interessen berührt, noch einmal dem Europäischen Rat vorgelegt wird”, schreiben sie.
“Die Kraft des Fußballs ist die Kraft der Menschen in Europa”, hofierte Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas gestern den UEFA-Boss Aleksander Čeferin. Beide unterzeichneten am Donnerstag eine neue Vereinbarung über die Zusammenarbeit zur Förderung der Werte und Ziele des Europäischen Sportmodells.
Es ist bereits die dritte dieser Art und soll “Klimaschutz, den Green Deal sowie einen gesunden und aktiven Lebensstil für alle” unterstützen. Nicht etwa durch verbindliche und überprüfbare Verpflichtungen, sondern durch ziemlich seichte Absichtserklärungen. Ein Beispiel: UEFA und EU bekräftigen ihr “starkes Engagement für die Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils über alle Generationen und sozialen Gruppen hinweg und verpflichten sich außerdem, die Kraft des Fußballs zur Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils zu nutzen“. Was das konkret bedeuten soll, weiß niemand.
Dass die UEFA nicht gerade als inklusiver gesundheitsorientierter Klimaschutz-Verband bekannt ist – und sich das seit der ersten Vereinbarung 2014 auch nicht geändert hat – spielt offenbar keine Rolle für solche Vereinbarungen. Immer mehr Wettbewerbe, Spiele und elitäre Finanzierungsmodelle sprechen eher für Profitgier der UEFA-Funktionäre als für Reformwillen im Sinne der Fußballfans oder des Klimaschutzes.
Während Schinas also von der Kraft des Fußballs spricht, verschweigt er die Kraftlosigkeit der EU-Kommission, die alle Jubeljahre mit nicht mehr als unverbindlichen Absichtserklärungen um die Ecke kommt. Denn aus diesen Initiativen hat sich bisher nahezu nichts ergeben. Das einzig Grüne am Fußball-Zirkus ist nach wie vor der Rasen.
Immerhin: Man beabsichtige, “bei der Durchführung der EURO 2024 in Deutschland als Flaggschiff für die Nachhaltigkeit solcher Sportereignisse zusammenzuarbeiten”. Inwiefern diese Zusammenarbeit stattfinden soll, ist nicht bekannt. Doch wenn Schinas weiterhin behaupten möchte, der europäische Fußball sei eine von Europas Erfolgsgeschichten, sollten er und die Kommission den Worten auch Taten folgen lassen. Lukas Scheid
“XXL-Gipfel” oder “Mega-Gipfel” titelten Medien zum gestrigen Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag. Tatsächlich war dies eine gewaltige Veranstaltung, nahmen doch die Staats- und Regierungschefs von über 40 europäischen Ländern daran teil. Es sollte ausdrücklich keine reine EU-Veranstaltung sein, und doch ging die Debatte um den Umgang mit der Energiekrise innerhalb der Staatengemeinschaft weiter, wie Ella Joyner berichtet.
Ein wesentlicher Streitpunkt ist dabei der EU-weite Gaspreisdeckel, den viele Länder wollen, andere aber klar ablehnen. Auch die Kommission ist skeptisch. Im Vorfeld des heutigen informellen EU-Gipfels haben mehrere Mitgliedstaaten einen Vorschlag für einen Gaspreisdeckel an die Kommission gesendet, der die Bedenken der EU-Behörde ausräumen soll. Das Papier verfasst haben sollen Italien, Polen, Griechenland und Belgien. Den Forderungen der Kommission, die sie als Voraussetzung für eine Preisobergrenze formuliert hat, wollen die Staaten laut dem Vorschlag nur im Fall einer Gasmangellage nachkommen. Mehr lesen Sie in den News.
Am Montag läuft die Frist ab: Bis zu diesem Stichtag müssen EU-Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, wenn sie gegen die Taxonomie-Verordnung vorgehen wollen, nach der Atomkraft und Gas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig gelten. Trotz erheblicher Bedenken in mehreren Mitgliedstaaten wird Österreich nun wohl das einzige Land sein, das diesen Weg geht. Deutschland jedenfalls hält sich zurück, und Luxemburg will sich lediglich den Österreichern anschließen. In Wien hingegen ist die Ablehnung der Atomkraft so stark, dass sogar die rechtspopulistische FPÖ als Oppositionspartei die Klage unterstützt, wie Eric Bonse berichtet.
Es ist ein bislang beispielloser Handelsstreit zwischen China und einem EU-Land: Seit Einrichtung eines “Taiwanbüros” in der litauischen Hauptstadt Vilnius haben sich die Beziehungen zwischen Litauen und der Volksrepublik immer weiter verschlechtert. “Nur in Einzelfällen schaffen es Produkte litauischer Firmen auf den chinesischen Markt”, sagt der Generaldirektor des litauischen Industrieverbands. Um dennoch Ein- und Ausfuhren zu ermöglichen, lassen sich die litauischen Unternehmen einiges einfallen. Das baltische Land hofft zudem auf Brüssel und das geplante Anti-Coercion-Instrument, wie Amelie Richter und Till Hoppe recherchiert haben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre nutzten die Zusammenkunft in Prag, um eine verstärkte Zusammenarbeit zur Linderung der Energiepreiskrise anzukündigen. Zu diesem Zweck hat die EU-Kommission ein Abkommen mit dem bedeutenden Gaslieferanten Norwegen geschlossen. Ziel sei es, “übermäßig hohe Preise kurz- und längerfristig deutlich zu senken”, wie beide Seiten am Donnerstag in Prag bekannt gaben.
Norwegen und die EU-Kommission wollen “gemeinsam Instrumente entwickeln, um die Energiemärkte zu stabilisieren und die Auswirkungen von Marktmanipulationen und Preisschwankungen zu begrenzen”, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Brüssel und Oslo nannten darin keinen konkreten Vorschlag – die Kommission hofft vermutlich, auf diese Weise den Streit darüber zu entschärfen, wie die EU mit dem extremen Anstieg der Gaspreise nach Russlands Einmarsch in der Ukraine umgehen soll.
Auch während des Treffens hielt die Debatte um die Einführung eines Gaspreisdeckels an. Mehrere Mitgliedstaaten legten gestern ein Papier mit Vorschlägen für ein dreistufiges Verfahren vor, das die Bedenken der Kommission ausräumen soll. (Dazu berichten wir auch in den News.) Befürworter argumentieren, der Gaspreisdeckel sei der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Preise in allen 27 EU-Ländern sinken.
Bundeskanzler Olaf Scholz und der niederländische Premierminister Mark Rutte sprechen sich dagegen klar gegen eine Deckelung auf EU-Ebene aus. Auch die Kommission ist skeptisch und knüpft die Einführung eines Gaspreisdeckels an konkrete Bedingungen.
Zur Senkung der Gaspreise setzt Scholz stattdessen auf Verhandlungen mit wichtigen Lieferländern wie Norwegen und den USA, deren Unternehmen zurzeit enorm profitieren, seitdem händeringend nach Alternativen zu russischem Gas gesucht wird. Den drohenden EU-Gaspreisdeckel sieht man in Berlin als Druckmittel für die Gespräche, insbesondere mit Oslo.
Brisant in der EU-Energiedebatte ist die Frage der nationalen Alleingänge bei Hilfspaketen. Für ihr 200-Milliarden-Euro Energiehilfspaket erntete die Bundesregierung heftige Kritik in Prag – etwa vom polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki. Er sagte, es sei “klar, dass es nicht sein darf, dass die Energiepolitik der Europäischen Union unter dem Diktat Deutschlands umgesetzt wird”.
Kritiker werfen Deutschland vor, einerseits Gas für Haushalte und Unternehmen zu subventionieren, also zum Konsum zu ermuntern. Auf der anderen Seite blockiere Berlin die EU-Preisobergrenze. Scholz erwiderte, alle Staaten müssen ihre Bürger durch diese Krise helfen. Berlin sei nicht der einzige Staat, der so ein Paket beschließe. Auch beim heutigen informellen EU-Gipfel dürfte die Debatte um den Umgang mit der Energiekrise weitergehen.
Das Format der Europäischen Politischen Gemeinschaft geht auf einen Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Ziel ist es, einen engeren Austausch der EU-Länder mit Partnern außerhalb der EU zu ermöglichen. “Wir teilen ein gemeinsames Umfeld, oft eine gemeinsame Geschichte, und wir sind dazu berufen, unsere Zukunft gemeinsam zu schreiben”, sagte Macron in Prag. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete das Treffen als “große Innovation”.
Zu der Runde gehören neben den EU-Staaten Albanien, Nordmazedonien, Kosovo, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Georgien, Moldawien, die Ukraine, Armenien und Aserbaidschan sowie die vier EFTA-Länder (Norwegen, Schweiz, Island und Liechtenstein) und schließlich das Vereinigte Königreich und die Türkei. Russland und Belarus waren nicht zu dem Gipfel eingeladen.
Auf der Tagesordnung standen Gespräche rund um die Sicherheitslage und den russischen Einmarsch in die Ukraine. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj war per Video zugeschaltet. Thema war außerdem die Migration. Wie erwartet wurden bei dem Treffen keine Entscheidungen getroffen. Das nächste Treffen wird im Frühjahr in Chişinău stattfinden, wie die moldauische Präsidentin Maia Sandu am Donnerstag ankündigte. Mit sas, dpa
Der Countdown läuft: Spätestens am 10. Oktober müssen EU-Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die umstrittene Taxonomie klagen, mit der die EU-Kommission Atomkraft und Gas unter bestimmten Bedingungen als “nachhaltig” einstuft. Deutschland hat schon angekündigt, dass es trotz erheblicher Bedenken nicht gerichtlich gegen die EU-Verordnung vorgehen will. Nun macht auch Luxemburg einen Rückzieher.
Das Großherzogtum will nicht selbst aktiv werden, sondern sich lediglich einer Klage Österreichs anschließen, sagte ein Sprecher des luxemburgischen Energieministeriums auf Anfrage von Europe.Table. Dies sei auch von Anfang an so geplant gewesen. Allerdings hatte Energieminister Claude Turmes in einem Tweet zunächst den Eindruck erweckt, dass auch Luxemburg selbst vor den EuGH ziehen würde. Nun ist nur noch von einer Unterstützung die Rede. Im Zuge der sogenannten Streithilfe will Luxemburg der Klage Österreichs beispringen und vor Gericht eigene Argumente vorbringen.
Wien zeigt sich entschlossen. “Unsere Position hat sich nicht verändert”, sagte eine Sprecherin von Energie- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler auf Anfrage. Am kommenden Donnerstag plant die Grünen-Politikerin ein Mediengespräch zur österreichischen Position hinsichtlich der umstrittenen Einstufung von Gas und Atomenergie als klimafreundliche Investitionen. Österreich hat sich bereits vor Jahrzehnten gegen die Kernenergie entschieden. Die Anti-Atomkraft-Haltung gehört zur politischen DNA des EU-Landes. Selbst die rechtspopulistische FPÖ unterstützt als Oppositionspartei die Klage.
Die Haltung Luxemburgs ist dennoch ein herber Rückschlag für die österreichische Regierung. “Wir werden die nächsten Wochen und Monate weiter dazu nützen, weitere Verbündete zu gewinnen“, sagte Gewessler noch im Juli, als sie die rechtlichen Schritte gegen die Taxonomie-Verordnung ankündigte.
Immerhin kann Österreich weiter auf politische Unterstützung setzen. “Luxemburg hat seine Position bezüglich des delegierten Rechtsaktes zur Taxonomie seit dessen Veröffentlichung nicht geändert”, sagte die grüne Europaabgeordnete Tilly Metz. Eine separate Klage “hätte keinen strategischen Nutzen”. Es sei viel besser, die Kräfte zu bündeln und koordiniert vorzugehen. Dennoch sei es “schade, dass nicht mehr Mitgliedstaaten sich klar gegen den Delegierten Rechtsakt und die Kompetenzüberschreitung der Kommission stellen”.
Im September haben mehrere Länderbüros der Umweltorganisation Greenpeace eine Klage vor dem EuGH angekündigt, falls die Kommission ihre Entscheidung nicht revidiert. Eine Klage vor dem EuGH ist die letzte Möglichkeit, die Regulierung doch noch zu Fall zu bringen. Im Juni hatte sich das Europaparlament mit knapper Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission ausgesprochen. Im Rat waren die Gegner von vornherein in der Minderzahl. Mit Hans-Peter Siebenhaar
Trilog: ETS und MSR
10.10.2022
Themen: Beim zweiten Trilog zur Reform des europäischen Emissionshandels stehen erste große politische Fragen auf der Agenda. Unter anderem sollen die Konditionen besprochen werden sowie die Benchmarks, unter denen Industrieanlagen weiterhin kostenlose Emissionsrechte erhalten. Außerdem steht die Einbeziehung von Biomasse und Abfallverwertung in den Emissionshandel auf der Tagesordnung. Die noch offenen Fragen nach einer Export-Regelung für die Einführung des CBAM, dem allgemeinen Ambitionsniveau des ETS sowie die Einführung eines zweiten ETS für Gebäude und Verkehr sollen zumindest angesprochen werden.
Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Berichtsentwurf zu den resilienten Lieferketten im EU-Handel zur Behebung aktueller Engpässe, Entwurf einer Stellungnahme zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz), Berichtsentwurf zum Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten vor wirtschaftlichem Zwang durch Drittländer (Anti-Coercion).
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Entwurf eines Entschließungsantrags zu einem angemessenen Mindesteinkommen zur Gewährleistung der aktiven Inklusion, Berichtsentwurf zu den Leitlinien für die beschäftigungspolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Abstimmung über den Gesamthaushaltsplan der EU für das Haushaltsjahr 2023, Anleihestrategie zur Finanzierung des NextGenerationEU-Programms.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu gemeinsamen Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbare Gase und Erdgas sowie Wasserstoff, öffentliche Anhörung: Den Binnenmarkt für Bauprodukte fit für das 21. Jahrhundert machen.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE)
10.10.2022 15:00-18:30 Uhr
Themen: Gedankenaustausch mit einer Delegation der Globalen Koalition gegen den IS, Meinungsaustausch mit Antoine Bondaz (Research Fellow und Direktor bei der Fondation pour la Recherche Stratégique) zur Analyse der militärischen Einschüchterung Taiwans durch China, Gedankenaustausch mit Toivo Klaar (EU-Sonderbeauftragter für den Südkaukasus) zum neuen militärischen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)
10.10.2022 15:30-18:30 Uhr
Themen: Berichtsentwurf zum Abkommen zwischen der EU und der Ukraine über die Güterbeförderung auf der Straße, Bericht über die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für den nachhaltigen Luftverkehr, Berichtsentwurf über intelligente Verkehrssysteme im Bereich des Straßenverkehrs und für Schnittstellen mit anderen Verkehrsträgern.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)
10.10.2022 15:00-17:15 Uhr
Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Entwurf einer Stellungnahme zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und bessere Informationen.
Vorläufige Tagesordnung
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)
10.10.2022 16:00-18:00 Uhr
Themen: Berichtsentwurf zur Festlegung von Vorschriften zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Briefkastenfirmen für steuerliche Zwecke, Entwurf einer Stellungnahme zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz), Berichtsentwurf über Märkte für Finanzinstrumente.
Vorläufige Tagesordnung
Informelle Ministertagung Energie
11.10.-12.10.2022
Themen: Die Minister für Energie kommen zu Beratungen zusammen.
Infos
Trilog: Batterie-Regulation
11.10.2022
Themen: Die Batterie-Regulation sieht unter anderem vor, dass Autohersteller für das Recycling von Altbatterien aus ihren Elektrofahrzeugen verantwortlich sind, und dass neue Lithium-Ionen-Batterien einen bestimmten Anteil an recyceltem Material enthalten und neue Batterien leichter recycelbar sein müssen.
Trilog: Effort Sharing
11.10.2022
Themen: Die Effort Sharing Regulation (ESR) legt verbindliche Emissionsreduktionsziele für Sektoren fest, die nicht im ETS abgedeckt sind. Beim zweiten Trilog geht es unter anderem um Reduktionsziele für Nicht-CO2-Emissionen, die jährlichen Emissionsberechtigungen für jeden Mitgliedstaat und die nationalen Reduktionspfade.
Informelle Ministertagung Beschäftigung und Soziales
12.10.-13.10.2022
Themen: Arbeitsthemen der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, Auswirkungen der Energiearmut, Ukraine-Krise.
Infos
Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)
12.10.-13.10.2022
Themen: Erläuterung des Erweiterungspakets 2022 durch Olivér Várhelyi (Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für Nachbarschaft und Erweiterung), Gedankenaustausch mit Swjatlana Zichanouskaja (Führerin der demokratischen Kräfte von Weißrussland), Berichtsentwurf zur Förderung der regionalen Stabilität und Sicherheit in der gesamten Nahost-Region, Gedankenaustausch mit Jorge Toledo Albiñana (Botschafter der EU in China) über die Beziehungen zwischen der EU und China.
Vorläufige Tagesordnung
Wöchentliche Kommissionssitzung
12.10.2022
Themen: Mitteilung über die Anwendung des EU-Rechts, jährliches Erweiterungspaket mit Fortschrittsberichten zu den EU-Beitrittskandidaten, 2023 als Europäisches Jahr der Aus- und Weiterbildung.
Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz 12 Uhr
Rat der EU: Justiz und Inneres
13.10.-14.10.2022
Themen: Informationen der Kommission zu Richtlinien über die Haftung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Sachstand zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine und Bekämpfung der Straflosigkeit, Gedankenaustausch zur Wahrung der Grundrechte in Krisenzeiten.
Vorläufige Tagesordnung
Trilog: Social Climate Fund
13.10.2022
Themen: Der Klimasozialfonds soll die zusätzliche Belastung für Verbraucher und kleine Betriebe durch den zweiten Emissionshandel für Gebäude und Verkehr abfedern. Die Verhandlungen sind somit unmittelbar mit den Verhandlungen zur Reform des ETS verknüpft. Offen ist noch der Umfang des Fonds, die Höhe der Eigenmittel der Mitgliedstaaten sowie die Frage, wie viel Geld die Mitgliedstaaten als direkte Einkommensbeihilfen an Verbraucher auszahlen dürfen. Die genaue Agenda für den Trilog am 13.10. steht noch nicht fest.
Sitzung des Ausschusses für Steuerfragen (FISC)
13.10.2022 09:00-11:30 Uhr
Themen: Öffentliche Anhörung zum Thema “Fallstudien zur nationalen Steuerpolitik der Mitgliedstaaten – Luxemburg: durchgeführte nationale Steuerreformen und Bekämpfung aggressiver Steuerpraktiken”.
Vorläufige Tagesordnung
Vor gut einem Jahr nahm ein bisher beispielloser Handelsstreit zwischen einem EU-Staat und China seinen Lauf. Stein des Anstoßes: die Einrichtung eines “Taiwanbüros” in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Peking verhängte darauf Sanktionen gegen Litauen. Die Europäische Union hat mittlerweile eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht – die Lage für den baltischen EU-Staat hat sich aber kaum verbessert: “Generell steht die gesamte Produktion. Die Exporte von Litauen nach China wurden eingestellt. Nur in Einzelfällen schaffen es Produkte litauischer Firmen auf den chinesischen Markt – meistens sind das Technologieunternehmen”, sagt der Generaldirektor des litauischen Industrieverbands, Ričardas Sartatavičius, China.Table.
Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem baltischen Land und der Volksrepublik verlief schrittweise und gipfelte letztendlich darin, dass Litauen ganz aus dem Zollsystem Chinas verschwand und die diplomatischen Beziehungen herabgestuft wurden (China.Table berichtete). Wenige Tage nach dem Zoll-Eklat Anfang Dezember erschien das EU-Land zwar wieder als Auswahl-Option im chinesischen System. “Aber das ändert nichts an der Situation”, sagt Sartatavičius. Die Unternehmen könnten Erklärungen ausfüllen, erhielten dann aber keine Bestätigung.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Getränke-Branche: So seien Container mit Getränken wie Bier von China nach Litauen zurückgeschickt worden, weil die Zollerklärungen nicht akzeptiert worden seien. Der Verband wisse nicht, wie groß der Schaden für die litauische Getränke-Industrie bisher sei. “Aber wenn der chinesische Markt dafür vollständig geschlossen wird, könnten die Unternehmen zwei bis fünf Millionen Euro an Einnahmen im Jahr verlieren. Auf staatlicher litauischer Ebene ist das ein kleiner Geldbetrag, aber für Unternehmen ist das viel.”
Im Frühjahr dieses Jahres wurde überraschend wieder etwas mehr Ware durch den Zoll gelassen – für den Sommer sank die Zahl dann wieder. Im September sind die Einfuhren aus Litauen in die Volksrepublik laut chinesischen Zollangaben um 91,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. Betroffen seien Metall- und Holzprodukte, die zuvor zu den Top-5-Exportwaren des baltischen Staats gehörten. Die Ausfuhren seien “vollständig vernichtet“, so Sartatavičius. Auch Hightech-Laser und Torf-Exporte gehören zu den betroffenen Produkten.
Litauens Exporte nach China hatten im Dezember 2021 einen nahezu vollständigen Einbruch erlitten. Lediglich Waren im Wert von rund 3,35 Millionen Euro schafften es in dem Monat durch den chinesischen Zoll, wie Sartatavičius sagt. Ein massiver Rückgang im Vergleich zum Vorjahr: Da seien es Waren im Wert von 38 Millionen Euro gewesen. Auch im November 2021 lief der Handel noch. Litauen exportierte Waren im Wert von gut 37 Millionen Euro in die Volksrepublik. Im selben Monat hatte das taiwanesische Handelsbüro in Vilnius eröffnet.
Dass China einige Waren ins Land tröpfeln lässt, scheint Verschleierungstaktik – so werden die Beweise für die EU-Beschwerde bei der WTO weniger eindeutig. Aber auch die Litauer sind findig. So werde beispielsweise auf Häfen im lettischen Riga oder im polnischen Danzig ausgewichen. Für Importe aus der Volksrepublik wird ebenfalls “getrickst” und als Entladehafen Riga angegeben. Die lettische Hauptstadt ist mit Lkw-Transport gut an Nord-Litauen angebunden. “Die Unternehmen suchen natürlich nach verschiedenen Lösungen”, sagt Sartatavičius.
China hatte im vergangenen Jahr Druck auf Unternehmen aus anderen EU-Staaten ausgeübt, die mit litauischen Zulieferern arbeiteten oder selbst in Litauen produzierten. Auch hier scheint die Lage weiterhin schwierig. Gesprächsanfragen an betroffene Unternehmen wie den Reifenhersteller Continental wurden abgelehnt. Die litauischen Unternehmen hoffen nun auf einen Erfolg bei der WTO, wie Sartatavičius berichtet.
Auch wenn das noch dauern könnte. “Wir rechnen nicht mit einer baldigen Entscheidung. Das kann ein paar Jahre dauern.” Der direkte Nutzen für litauische Unternehmen stehe zudem noch in den Sternen: “Gemäß den WTO-Entscheidungen gibt es weder eine Verpflichtung, die entstandenen Verluste zu kompensieren, noch eine Garantie dafür, dass die Probleme nicht wieder vorkommen.”
Hoffnungsvoll blickt man in Richtung Brüssel: Auf EU-Ebene wird derzeit über ein neues Instrumentarium diskutiert, um auf solche Praktiken künftig besser antworten zu können. Die EU-Kommission hatte Ende 2021 ihren Vorschlag für das sogenannte Anti-Coercion-Instrument vorgestellt. Derzeit arbeiten Europaparlament und der Rat der Mitgliedstaaten daran, ihre Änderungswünsche zu formulieren. Der Trilog zwischen den EU-Institutionen soll in den kommenden Wochen beginnen, um die finale Fassung der Verordnung festzulegen.
Der Handelsausschuss soll am kommenden Montag die Position des Europaparlaments festzurren. Die Abgeordneten wollen den Kommissionsvorschlag an einigen Stellen verschärfen, wie die von Berichterstatter Bernd Lange zusammengetragenen Änderungswünsche zeigen, die Europe.Table vorliegen. So soll schon die Androhung von Zwangsmaßnahmen durch Drittstaaten ausreichen, damit die Kommission tätig werden kann. Zudem soll sie weiterreichende Maßnahmen verhängen können, um den entstandenen Schaden in einem EU-Land zu kompensieren.
Zu dem vorgesehenen Arsenal zählt etwa, dass die EU Waren aus China oder anderen aggressiv auftretenden Ländern mit höheren Zöllen belegen oder deren Unternehmen von öffentlichen Aufträgen in der EU ausschließen kann. Die Kommission will sich hier weitgehende Entscheidungsbefugnisse einräumen. Das Europaparlament drängt aber auf weiterreichende Informationspflichten der Behörde. Die Mitgliedstaaten fordern im Rat überdies mehr Mitsprache bei der Verhängung der Gegenmaßnahmen. Mitarbeit: Till Hoppe
Einen Tag vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs haben mehrere Mitgliedstaaten gestern einen detaillierteren Vorschlag für einen EU-weiten Gaspreisdeckel an die Kommission gesendet. In dem dreiseitigen Dokument, das Europe.Table vorliegt, schlagen die Unterstützer ein dreistufiges Vorgehen vor und versuchen, mehrere Bedenken der Kommission auszuräumen.
Verfasst haben das Papier Italien, Polen, Griechenland und Belgien, hieß es aus Ratskreisen. Der Vorschlag fasse jedoch die Diskussion unter einer größeren Zahl von Mitgliedstaaten zusammen, sagte ein anderer EU-Diplomat.
Die Kommission hatte für den Fall, dass ein Gaspreisdeckel auf Großhandelsebene eingeführt werden sollte, zwei zentrale Forderungen gestellt: höhere, verpflichtende Gaseinsparungen und verpflichtende Solidaritätsabkommen. Beiden Forderungen wollen die Mitgliedstaaten gemäß dem Papier jedoch erst in einer Gasmangellage nachkommen.
Bei den Verbrauchsreduzierungen wollen sie nicht über die schon im Sommer beschlossene Gassparverordnung hinausgehen. Solidaritätsvereinbarungen sollen laut dem Papier zwar alle Mitgliedstaaten abschließen, jedoch fordern diese von der Kommission zuvor Leitlinien.
Für den Fall einer Mangellage machen die Staaten jedoch das Zugeständnis, auf einen Gaspreisdeckel zu verzichten, damit das Gas marktbasiert auf die EU-Mitglieder verteilt werden kann.
Ohne einen Gasmangel solle jedoch der Preisdeckel gelten. Der Korridor von “zum Beispiel fünf Prozent” um einen neuen Preisindex soll ausreichend Raum für Gebote lassen, damit Gas weiter innerhalb des Binnenmarktes fließen kann.
Falls sich der Marktpreis dem Deckel nähert oder die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden kann, sollen in einer zweiten Stufe zunächst weitere Maßnahmen greifen. Zum einen “verstärkte Maßnahmen zur Nachfragereduzierung und Solidarität”, die jedoch nicht näher ausgeführt werden. Zum anderen sollen Preise oberhalb des Korridors zulässig werden, um weiterhin Importe zu sichern. Dafür soll beispielsweise die gemeinsame Einkaufsplattform der EU Differenzverträge schließen können. ber
Die französische Regierung hat am gestrigen Donnerstag ihren Plan zur Energieeinsparung vorgestellt. Dabei handelt es sich um 15 nicht verbindliche Maßnahmen, deren Ziel es ist, den Energieverbrauch des Landes innerhalb von zwei Jahren um 10 Prozent zu senken (gegenüber 2019).
Dieser Plan zur “sobriété énergétique” ist das Ergebnis von neun Arbeitsgruppen, die seit Juni getagt hatten. Die Planungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs konzentrierten sich auf folgende Bereiche: vorbildlicher Staat, Unternehmen und Arbeitsorganisation, Einrichtungen mit Publikumsverkehr und große Einkaufszentren, Industrie, Digitales, Sport, Wohnungsbau, Mobilität und Gebietskörperschaften.
Die Arbeitsgruppe empfiehlt etwa, die Temperatur in allen Gebäuden auf 19 Grad zu reduzieren. Diese Maßnahme gilt sowohl für die Industrie, für Geschäfte sowie für öffentliche Gebäude. In Sporteinrichtungen soll die Temperatur um zwei Grad und im Wasser von Schwimmbädern um ein Grad gesenkt werden. Es wurden auch Maßnahmen in Bezug auf die Straßenbeleuchtung, die Beleuchtung von Sporteinrichtungen oder die Einführung von Automatisierungs- und Energiekontrollsystemen in öffentlichen Gebäuden angekündigt.
Ein weiterer Bereich des Sparplans ist die sogenannte “sanfte Mobilität” (mobilité douce). Für Privatpersonen sollen Anreize zur Bildung von Fahrgemeinschaften geschaffen werden. Die Regierung erklärt, dass in Kürze ein umfassender Aktionsplan zu diesem Thema vorgestellt wird. Auf der Ebene der Unternehmen wird gefordert, bei Fahrten von weniger als vier Stunden die Bahn zu nehmen, statt das Auto oder Flugzeug. Zudem sollen verstärkt Videokonferenzen genutzt werden. Für Arbeitnehmer wird die Pauschale für nachhaltige Mobilität erhöht, im öffentlichen Dienst etwa von 200 auf 300 Euro.
Einige der wichtigsten Maßnahmen sind aus der Arbeitsgruppe zur Arbeitsorganisation hervorgegangen. Die erste davon betrifft das Home-Office für Staatsbedienstete. Diese soll über eine Erhöhung der Pauschale für Telearbeit um 15 Prozent gefördert werden. Die Unternehmen müssen ihrerseits “eine geeignete Organisation der Telearbeit im Falle einer besonderen Spannung im Netz” vorsehen. Außerdem können Staatsbedienstete aufgefordert werden, im Falle von Spitzenlasten zeitversetzt zu arbeiten. “Es obliegt den einzelnen Unternehmen, ihren Plan zu überwachen”, so die Regierung. Ein Kontrollmechanismus wurde bislang nicht erwähnt.
Privatpersonen sollen durch die Einführung eines Sparbonus für die vorbildlichsten Haushalte in ihren Bemühungen unterstützt werden. Zudem wurde eine Prämie von 9.000 Euro für den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Prämie von 15.000 Euro für den Einbau eines Holzpelletkessels angekündigt.
Eine weitere Maßnahme betrifft die Information der Bürger: Es ist geplant, im Fernsehen nach dem gewöhnlichen Wetterbericht und zwischen anderen Sendungen über die Belastung des Stromnetzes mit grünen, gelben und roten Symbolen zu informieren. Die Hoffnung ist, vier von fünf Menschen in Frankreich auf dem Wege zu erreichen. Mehrere Fernsehsender wie TF1 oder France Télévision hatten bereits ihre Unterstützung für diese Maßnahme angekündigt. Die Regierung wies darauf hin, dass keine dieser Maßnahmen verbindlich sei. cst
Die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden geschäftsführenden Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, Klaus Regling, geht weiter. Die Euro-Staaten konnten sich in einer außerordentlichen Verwaltungsratssitzung nur auf eine Interimslösung verständigen.
Laut einer Mitteilung des ESM soll der stellvertretende Managing Director, der Franzose Christophe Frankel, bis zum 31. Dezember 2022 die Aufgaben des Geschäftsführers übernehmen. Die Frist könne sich auch verkürzen, sollte der Verwaltungsrat in der Zwischenzeit einen permanenten geschäftsführenden Direktor bestimmen. Frankel tritt sein Interimsmandat morgen an, das Mandat von Klaus Regling läuft heute ab. Regling stand mehr als zehn Jahre an der Spitze des ESM.
Paschal Donohoe, Vorsitzender des ESM-Gouverneursrats, unterstrich in der Mitteilung, der Auswahlprozess für die Regling-Nachfolge sei vor Monaten mit mehreren exzellenten Kandidaten gestartet, aber keiner habe die sehr hohe Schwelle von 80 Prozent des ESM-Kapitals auf sich vereinigen können. Donohoe betonte, um die Kontinuität der laufenden Geschäfte des Stabilitätsmechanismus zu gewährleisten, habe der Verwaltungsrat Christophe Frankel interimistisch zum Leiter des ESM ernannt. Frankel sei seit der Gründung des ESM im Jahr 2012 stellvertretender geschäftsführender Direktor und verfüge “über einen hervorragenden beruflichen Hintergrund im Bereich Finanzen und Finanzmärkte”, so der Verwaltungsratsvorsitzende. cr
Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Europaparlament, Adrian Vázquez Lázara, sieht das Zustandekommen eines Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF) als Voraussetzung für weitere Fortschritte bei EU-US-Digitalthemen. “Das wichtigste Problem, das wir lösen müssen, bevor wir vorankommen, ist der Datenschutz“, sagte er Europe.Table. Um eine Nachfolgeregelung für das vor zwei Jahren vor dem Europäischen Gerichtshof durchgefallene Privacy Shield wird seit kurz nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung gerungen.
Die US-Regierung beabsichtigt, in den kommenden Tagen eine Lösung vorzustellen, wie Daten, die der Datenschutzgrundverordnung unterliegen, künftig auch in den USA besser geschützt werden können. Dafür will Joe Biden Präsidialverfügungen erlassen, auf deren Basis dann die EU-Kommission ihrerseits einen Vorschlag für eine sogenannte Angemessenheitsentscheidung erarbeiten kann. Diese ist eine formale Voraussetzung für eine vereinfachte Übertragungserlaubnis personenbezogener Daten ins Nicht-EU-Ausland.
“Wenn der TADPF geklärt ist, können wir mit anderen Aspekten fortfahren”, sagt Adrian Vázquez Lázara. Eine bessere Interoperabilität zwischen beiden Rechtsräumen ist politisches Ziel, doch bislang sind die Regularien oft inkompatibel. “Wie werden wir Künstliche Intelligenz auf beiden Seiten des Ozeans regulieren? Wie gehen wir mit Digital Services Act um, damit sich die US-Unternehmen nicht bedroht fühlen?” Diese Themen seien in Folge des TADPF anzugehen. Für eine bessere Regulierung von Künstlicher Intelligenz hatte das Weiße Haus in dieser Woche Vorschläge unterbreitet.
Ein neuer Rechtsrahmen für den transatlantischen Datentransfer werde auch neue Dynamik in die Gespräche im Handels- und Technologierat (TTC) bringen, erwartet der liberale Politiker aus Spanien. “Der TTC ist eine große Chance, auch wenn er bislang nichts Greifbares gebracht hat.”
Es sei aber an der Zeit, Parlamente und andere Stakeholder in die Gespräche zwischen EU-Kommission und US-Regierung einzubinden, forderte Vázquez Lázara. Der Rechtsausschuss werde die Kommission offiziell auffordern, mit der US-Regierung über die Beteiligung zu verhandeln. “Ich bin zuversichtlich, dass uns das am Ende gelingen wird.”
Die Gespräche einer Delegation des JURI-Ausschusses in Washington hätten gezeigt, dass die Gesprächspartner aufseiten des US-Kongresses wenig wüssten über die Regulierungsvorhaben in Europa, wie etwa AI Act oder Haftungsfragen. “Das ist bemerkenswert, weil US-Unternehmen davon betroffen sein werden.” Deshalb sollten sich auch Vertreter der Legislative im Rahmen des TTC austauschen und beide Seiten zum TTC eingeladen werden, damit Bedenken gehört werden können. “Das ist der beste Weg, um eine gemeinsame Basis zu finden und gleiche Bedingungen zu schaffen.” tho/fst
Deutschland bereitet eine neue Raumfahrtstrategie vor. Im digitalen Zeitalter und angesichts der geopolitischen Lage seien Fähigkeiten im Weltraum wesentliche Bausteine der deutschen und europäischen Souveränität, heißt es dazu in einem Impulspapier für die deutsche Raumfahrtpolitik, das Anna Christmann (Grüne) am Donnerstag vorstellte. Die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt hatte Mitglieder der Raumfahrt-Community nach Berlin eingeladen, um über die Inhalte der neuen Strategie zu diskutieren.
Besonderes Augenmerk legt Christmann bei der Strategieentwicklung auf den Bereich New Space, also die Kommerzialisierung der Raumfahrt und ihre Verknüpfung mit der klassischen Wirtschaft. “Wir müssen zu einer stärker wettbewerbsorientierten Entwicklung in der Raumfahrt kommen”, sagte Christmann. “Auch im Trägerbereich.”
Darüber hinaus verwies die Raumfahrtkoordinatorin auch auf das Secure Connectivity Programme der EU zur Etablierung eines sicheren Kommunikationsnetzes im erdnahen Orbit. “Wir müssen eine europäische Konnektivitätsinitiative auf den Weg bringen und dabei Wettbewerb und Bedarf im Auge behalten”, heißt es dazu im Impulspapier.
Die Bundesregierung sei zufrieden mit der Ratsposition, wonach das satellitengestützte Kommunikationsnetz in mehrere Einzelprojekte aufgeteilt werden soll, damit auch KMU angemessen beteiligt werden können, sagte Christmann. Sie habe sich zum Thema Secure Connectivity mit EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton ausgetauscht, auch zur Beteiligung der European Space Agency (ESA) an dem Projekt. Es sei wichtig, dass es richtig ausgerichtet sei. “Dafür werden wir uns einsetzen.”
Der ESA-Ministerrat trifft sich am 22. und 23. November in Paris. Das höchste Gremium der Agentur arbeitet den europäischen Raumfahrtplan aus und stellt die langfristige Finanzierung der Aktivitäten sicher “Mittelfristig müssen die europäischen Raumfahrtstrukturen noch effizienter werden”, heißt es in dem Papier. Unter anderem müssten die Rollen von ESA und EU in der Raumfahrt eindeutig geklärt werden. “Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir heute festlegen, welche Rolle Deutschland in der Exploration des Weltalls spielen kann und will: Was geschieht nach dem Ende der Internationalen Raumstation ISS, wie beteiligen wir uns am US-amerikanischen Artemis-Programm?”
Das Bundeswirtschaftsministerium als federführendes Raumfahrtressort in Deutschland geht davon aus, “dass wir zukünftig viel stärker auf Raumfahrtanwendungen angewiesen sein werden, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und die eigene Souveränität sicherzustellen”. Es betrachtet die Raumfahrt als “ein wesentliches strategisches Feld für die Zukunft” und die deutsche Raumfahrtstrategie als Ergänzung zur europäischen Strategie.
Sechs Handlungsfelder hat das Ministerium für die Strategieentwicklung identifiziert:
Das Fazit: Deutschland muss sich in seiner neuen Raumfahrtstrategie ambitionierte Ziele setzen, für die jetzt die Weichen richtig gestellt werden müssen. vis

Wird die Energiekrise als Vorspeise, Hauptgericht oder Dessert serviert? Immerhin findet der heutige informelle Gipfel vor dem ebenfalls informellen Treffen der EU-Energieminister statt, das nächste Woche in Prag abgehalten wird. Und all diese informellen Gipfeltreffen bilden den Auftakt für den nächsten Europäischen Rat am 20. und 21. Oktober, bei dem Energiefragen erneut ganz oben auf der politischen Agenda stehen werden.
In der Choreografie dieser Gipfeltreffen taucht eine Frage immer wieder auf: die nach der Sitzordnung, zum Beispiel beim Abendessen. Und die Frage ist keineswegs harmlos. Wer wird neben wem sitzen? Worüber würden sich der sparsame Mark Rutte und ein Kyriakos Mitsotakis, dessen Land von der Finanzkrise mitgerissen wurde, unterhalten? Welche Freundlichkeiten könnten Emmanuel Macron und Viktor Orbán bei einem guten Burgunder austauschen?
Es sieht nicht so aus, aber wir berühren hier den harten Kern der europäischen Verhandlungen, wo es sehr weh tun kann: die Konsensbildung. Hier ist jedes Mittel recht, ob am Arbeitstisch oder am Esstisch. Dabei ist auch die andere Seite der Medaille zu beobachten, nämlich das Einstimmigkeitsprinzip. Mit der Aussicht auf eine Europäische Union, die in nicht allzu ferner Zukunft die Grenze von 30 Mitgliedstaaten überschreiten könnte, kehrt das Ende des Einstimmigkeitsprinzips zugunsten des Mehrheitsprinzips nämlich mit Macht zurück.
Die Forderung, Mehrheitsentscheide auszuweiten, ist ein Dauerthema in der Debatte um die Handlungsfähigkeit der EU – daran erinnern Nicolai von Ondarza, Leiter der Forschungsgruppe EU/Europa beim SWP und Mitarbeiterin Julina Mintel in einer vor kurzen veröffentlichten Analyse. “In einer Union von aktuell 27 Mitgliedstaaten soll die Ausweitung von Mehrheitsentscheiden garantieren, dass die Anzahl an Vetospielern reduziert und somit die Kompromissfindung einfacher wird”, schreiben sie.
Dabei sollen die sogenannte Passerelle-Klausel im EU-Vertrag genutzt werden. Die bitte was? Also nochmal langsam. Eine “Passerelle” ist eine kleine Brücke, ein Steg, der eine Überquerung ermöglicht. Mit anderen Worten: Die Klausel bringt eine gewisse Flexibilität in den Entscheidungsprozess der EU.
Für diejenigen, die den Unterricht in Europapolitik verpasst haben: Passerelle-Klauseln erlauben unter bestimmten Bedingungen den Übergang von der Beschlussfassung mit Einstimmigkeit zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Mit diesen flexiblen Elementen lassen sich die Verträge anpassen, ohne das Revisionsverfahren durchlaufen zu müssen. Ihre Nutzung ist jedoch an die Einhaltung bestimmter Bedingungen geknüpft, insbesondere an die Benachrichtigung der nationalen Parlamente.
Der Europäische Rat muss die nationalen Parlamente von seiner Entscheidung in Kenntnis setzen. Wenn ein nationales Parlament innerhalb von sechs Monaten seine Ablehnung mitteilt, wird der EU-Beschluss nicht erlassen. Erfolgt kein solcher Einspruch, so kann der Beschluss nach seinem Erlass durch den Europäischen Rat in Kraft treten. Die vorgenommene Änderung ist in diesem Fall dann endgültig. In einigen Bereichen (mehrjähriger Finanzrahmen, GASP, bestimmte Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik, Umwelt, etc.) können die Parlamente der Mitgliedsländer jedoch keinen Einspruch erheben. Außerdem kann die Passerelle-Klausel nicht bei “Beschlüssen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen” angewendet werden.
Heute sind es vor allem mittel- und osteuropäischen Staaten, die Mehrheitsentscheidungen ablehnen, wie die SWP-Forscher von Ondarza und Mintel schreiben. “Sie befürchten, dass die EU von Frankreich und Deutschland dominiert werden könnte und in der Außen- und Sicherheitspolitik die Belange kleinerer Mitglieder womöglich übergangen werden.”
Recht gebe ihnen dabei ein Blick auf die Abstimmungsprotokolle, nach denen Frankreich so gut wie nie, Deutschland in den vergangenen Jahren nur selten, aber kleine mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten dafür häufiger überstimmt würden, führen die Analysten fort. “Es ist daher politisch nicht verwunderlich, dass insbesondere diese Staaten skeptisch sind gegenüber einer neuerlichen Ausweitung von Mehrheitsbeschlüssen”, schlussfolgern sie.
Dennoch, eine EU mit 30 und mehr Mitgliedern, darunter etliche neue mit unter 10 Millionen Einwohnern, kann nur handlungsfähig bleiben, wenn gleichzeitig flächendeckend das Mehrheitsprinzip eingeführt wird – mit Ausnahme weniger konstitutioneller Entscheidungen, wie von Ondarza und Mintel betonen.
Sie schlagen deshalb vor, die Überführung zur qualifizierten Mehrheit in kritischen Bereichen mit einer “Notbremse” zu kombinieren. “Mit ihr könnte eine politisch zu definierende kleine Anzahl von Mitgliedstaaten erwirken, dass ein mit qualifizierter Mehrheit gefasster Beschluss, der ihre vitalen nationalen Interessen berührt, noch einmal dem Europäischen Rat vorgelegt wird”, schreiben sie.
“Die Kraft des Fußballs ist die Kraft der Menschen in Europa”, hofierte Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas gestern den UEFA-Boss Aleksander Čeferin. Beide unterzeichneten am Donnerstag eine neue Vereinbarung über die Zusammenarbeit zur Förderung der Werte und Ziele des Europäischen Sportmodells.
Es ist bereits die dritte dieser Art und soll “Klimaschutz, den Green Deal sowie einen gesunden und aktiven Lebensstil für alle” unterstützen. Nicht etwa durch verbindliche und überprüfbare Verpflichtungen, sondern durch ziemlich seichte Absichtserklärungen. Ein Beispiel: UEFA und EU bekräftigen ihr “starkes Engagement für die Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils über alle Generationen und sozialen Gruppen hinweg und verpflichten sich außerdem, die Kraft des Fußballs zur Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils zu nutzen“. Was das konkret bedeuten soll, weiß niemand.
Dass die UEFA nicht gerade als inklusiver gesundheitsorientierter Klimaschutz-Verband bekannt ist – und sich das seit der ersten Vereinbarung 2014 auch nicht geändert hat – spielt offenbar keine Rolle für solche Vereinbarungen. Immer mehr Wettbewerbe, Spiele und elitäre Finanzierungsmodelle sprechen eher für Profitgier der UEFA-Funktionäre als für Reformwillen im Sinne der Fußballfans oder des Klimaschutzes.
Während Schinas also von der Kraft des Fußballs spricht, verschweigt er die Kraftlosigkeit der EU-Kommission, die alle Jubeljahre mit nicht mehr als unverbindlichen Absichtserklärungen um die Ecke kommt. Denn aus diesen Initiativen hat sich bisher nahezu nichts ergeben. Das einzig Grüne am Fußball-Zirkus ist nach wie vor der Rasen.
Immerhin: Man beabsichtige, “bei der Durchführung der EURO 2024 in Deutschland als Flaggschiff für die Nachhaltigkeit solcher Sportereignisse zusammenzuarbeiten”. Inwiefern diese Zusammenarbeit stattfinden soll, ist nicht bekannt. Doch wenn Schinas weiterhin behaupten möchte, der europäische Fußball sei eine von Europas Erfolgsgeschichten, sollten er und die Kommission den Worten auch Taten folgen lassen. Lukas Scheid