Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hat in diesem Jahr so viele Raketen getestet wie seit fünf Jahren nicht mehr. Und dabei ist erst März. Peking ist über die Zündeleien an seiner Grenze unglücklich. Trotzdem braucht China Nordkorea weiterhin als Puffer zwischen sich und dem US-Alliierten Südkorea. Erst Ende Februar hatte Chinas Staatschef Xi Jinping die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit mit Pjöngjang betont. Das ist ein schwieriger diplomatischer Akt, schreibt Christiane Kühl. Bei näherem Hinsehen sind die Ähnlichkeiten zu Russland verblüffend. Sowohl Nordkorea als auch Russland sind zwar wichtige Partner gegen den Westen. Doch beide agieren unberechenbar. Und jetzt betrachtet die internationale Gemeinschaft auch Russland wie Nordkorea als Aggressor. Daher ähnelt sich auch das Hin und Her der chinesischen Kommunikation zu den beiden schwierigen Verbündeten.
Ein Eiertanz sondergleichen bleibt auch die Abwicklung des zahlungsunfähigen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Am Dienstag meldete das Unternehmen, dass es den Termin zur Vorlage seiner Jahresbilanz am 31. März versäumen wird. Die Bilanz, wenn sie einmal herauskommt, wird das Ausmaß der Finanzlöcher offenbaren, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Die monatelang durchgehaltene Hinhaltetaktik gegenüber den Gläubigern ist nur möglich, weil das chinesische Recht keine Insolvenzverschleppung kennt. Intransparenz als Strategie hat aber auch ihre Grenzen. Fragwürdige Kreditvergaben bei gleichzeitiger Verschleierung der Probleme hat bereits Japan Ende der 80er-Jahre ein Ende seines jahrzehntelangen Booms beschert.


Am Sonntag war es mal wieder soweit: Nordkorea meldete einen Raketentest. Vergangene Woche war ein solcher Test offenbar schief gegangen: Es regnete Trümmer nahe Pjöngjang. Satte elf Testreihen mit Dutzenden Raketen hat Machthaber Kim Jong-un in diesem Jahr bisher gestartet, nachdem er die Testfrequenz schon seit Herbst 2021 schrittweise erhöht hatte. Kim zündelt wie zuletzt in der sogenannten “Feuer-und-Zorn”-Ära mit ihrer Kombination aus Nuklear- und Raketentests und besonders kriegerischer Rhetorik sowohl aus Pjöngjang als auch aus Washington. Neue Satellitenbilder zeigen zudem Aktivitäten an der 2018 eigentlich stillgelegten Atomtestanlage Punggye-ri, wie Reuters Anfang März berichtete. Es ist das einzige bekannte Atomtestgelände. Nordkorea habe seine nuklearen und ballistischen Raketenprogramme stetig weiterentwickelt, hieß es Anfang Februar in einem UN-Bericht.
Nordkorea ist den USA trotz des Ukraine-Krieges offenbar wichtig genug, dass der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan das Thema nach Angaben des Weißen Hauses beim eigentlich vom Ukraine-Krieg dominierten Treffen mit Chinas Außenpolitikzar Yang Jiechi in Rom ansprach. Sullivan betonte dort seine “ernsthafte Besorgnis” über Nordkorea. Yangs Antwort ist nicht bekannt.
Peking stellt sich schützend vor Pjöngjang wie eh und je. Zuletzt blockierte es Anfang März gemeinsam mit Moskau im UN-Sicherheitsrat die Verurteilung der jüngsten Raketentests. Doch es ist seit vielen Jahren ein offenes Geheimnis, dass Peking wenig begeistert ist vom Atomprogramm der Kim-Dynastie. Nachdem Russland sich durch die Ukraine-Invasion international isoliert hat, hat China nun gleich zwei Paria-Staaten als Nachbarn und Partner. Und beide fuchteln mit ihren Atomwaffen herum.
Fachleute registrieren nun eine gegenseitige Verstärkung der geopolitischen Störfelder, die von Russland und Nordkorea ausgehen. “Ich denke, dass Peking sehr beunruhigt ist über die von Russland geschaffene Instabilität und die Möglichkeit, dass Nordkorea dies als Gelegenheit zum Eskalieren der Spannungen nutzen könnte”, sagt Ramon Pacheco Pardo, Nordkorea-Experte vom King’s College London.
Zu einer Verschärfung der Lage könnte vor allem der Test einer Interkontinentalrakete führen. “Für China wären das unliebsame Nachrichten”, so Pardo zu China.Table. Noch dazu, weil Nordkorea seine Interkontinentalraketen offenbar nahe an Chinas Territorium stationieren will. Das amerikanische Center for Strategic and International Studies identifizierte mithilfe von Satellitenbildern kürzlich eine dafür vorgesehene Militärbasis bei Hoejung-ni nur 25 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt.
Zu den 130 Raketen und vier Atomsprengköpfen, die Kim seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren testete, gehörte bereits eine Interkontinentalrakete namens Hwasong-15, die das Weiße Haus erreichen könnte. Im Januar feuerte Nordkorea nach eigenen Angaben unter anderem zwei Hyperschallraketen und eine Hwasong-12-Mittelstreckenrakete ab, das stärkste Geschoss seit 2017. Hwasong-12 könnte zumindest die US-Pazifikbasis Guam treffen. Ende Februar und Anfang März folgten ballistische Mittelstreckenraketen – möglicherweise mit dem Ziel, Komponenten eines Bildaufklärungssatelliten für ein paar Minuten zum Test in Betriebshöhe zu bringen.
China macht gute Miene zum bösen Spiel. Staatschef Xi Jinping betonte erst Ende Februar wieder die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit. Beide Seiten nahmen kürzlich den wegen der Corona-Pandemie gestoppten Güterzugverkehr über den Yalu-Fluss bei Dandong wieder auf. Der bilaterale Handel lag daher im Januar und Februar mit 136,5 Millionen US-Dollar auf dem 40-Fachen des Vorjahresniveaus. Dass dieses magere Volumen rund 90 Prozent des nordkoreanischen Außenhandels ausmacht, zeigt die Isolation und Abhängigkeit Kims von China. Doch Kim lässt sich trotzdem nicht umfassend hineinreden. Er weiß: Peking stützt Nordkoreas marode Wirtschaft auch deshalb, weil das Land für China ein wichtiger Pufferstaat ist.
Doch das ist nicht die ganze Geschichte. “Nordkorea hat in den letzten Jahren für China an strategischem Wert gewonnen”, sagt der Nordkorea-Experte Christopher Green von der Denkfabrik Crisis Group. “China und die Vereinigten Staaten sind an Chinas Ostküste in ein ‘Great Game’ verwickelt, und dieser Wettbewerb beginnt im Nordosten mit der koreanischen Halbinsel”, so Green zu China.Table – in Anspielung auf das Ringen der Großmächte um die Vormacht in Zentralasien vor 150 Jahren. “Nordkorea ist widerspenstig und lästig, aber China wird zu Recht als das einzige Land angesehen, das überhaupt in der Lage ist, die Handlungen Nordkoreas zu beeinflussen. Dass Nordkorea während der Olympischen Winterspiele in Peking ein Moratorium für Raketentests einhielt, deutet darauf hin, dass Pjöngjang weiß, wann es wichtig ist, keinen Ärger zu machen.”
Für Peking hat derweil die Funktion Nordkoreas als Bollwerk gegen die USA Priorität. “Ich denke, dass die beiden Hauptgründe, warum China Nordkorea unterstützt, Geopolitik und Grenzstabilität sind”, sagt Pardo. “Wenn Nordkorea aufhört zu existieren, wird sich Korea unter südkoreanischen Bedingungen wiedervereinigen.” Dass China sich vor US-Soldaten an seiner Grenze graut, ist bekannt. Und noch stehen 28.500 US-Soldaten in Südkorea. Zugleich fürchtet es bei einem Zusammenbruch des Regimes eine Flüchtlingswelle. “Für Peking wäre es schwierig, einen großen plötzlichen Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen”, sagt Pardo. China muss also mit Kim klarkommen.
Derweil befürchten Militärexperten infolge der nordkoreanischen Raketentests ein Wettrüsten in Fernost. 71 Prozent der Südkoreaner sind laut einer aktuellen Umfrage dafür, dass ihr Land eigene Atomwaffen entwickelt. 56 Prozent wären für die Stationierung amerikanischer Atomwaffen. Unklar ist, wie sich die kürzliche Präsidentenwahl in Südkorea auswirken wird. Der künftige Präsident Yoon Suk-yeol gilt als China-Kritiker und Befürworter einer engeren Allianz mit den USA und Gruppen wie der Quad. Pardo geht davon aus, dass Yoon gegenüber Nordkorea “der Abschreckung und den Menschenrechten ebenso große Priorität einräumt wie einem möglichen Engagement.”
Auswege scheint es vorerst nicht zu geben. Pardo und Green gehen fest davon aus, dass Nordkorea auf keinen Fall sein Atomprogramm aufgeben wird. Auch sei Kim derzeit nicht an multilateralen Verhandlungen wie die von China ausgerichteten Sechsergespräche der 2000er-Jahre interessiert. Der Ukraine-Krieg sei “eine Erinnerung für Pjöngjang, dass Nordkoreas Hauptverteidigung gegen Einmischung von außen seine Atomwaffen sind”, sagt Green. “Aber ich denke, Peking wäre bereit, Gespräche abzuhalten, sobald Nordkorea bereit wäre daran teilzunehmen.”

Was nicht sein darf, wird auch nicht klar ausgesprochen. Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande ist seit Monaten faktisch zahlungsunfähig (China.Table berichtete). Doch kein Firmenvertreter und kein chinesischer Beamter nimmt das Wort “Insolvenz” in den Mund. Dabei wären die Kriterien längst erfüllt. Doch die Verwerfungen am Finanzmarkt wären einfach zu groß, wenn die Nachricht von der formalen Insolvenz durch alle Nachrichtenportale liefe. Daher versuchen alle Beteiligten derzeit noch, sich durchzuwursteln.
Die Warnzeichen werden allerdings derzeit unmissverständlich. Am Dienstag hat das Unternehmen angekündigt, dass es den Termin zur Vorlage seiner Jahresbilanz am 31. März versäumen werde. Bei einer wichtigen Tochtergesellschaft sei Geld abhandengekommen. Das Unternehmen spricht nun von “Komplikationen” bei der Abfassung des Jahresabschlusses. Bis Ende Juli will der Konzern allerdings einen Plan zur Umschuldung vorlegen, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Investoren bekräftigte. Viel Zeit hat das Unternehmen allerdings nicht mehr. Gläubiger fordern in dieser Woche zusammengenommen rund 1,9 Milliarden Euro an ausstehenden Zahlungen für Anleihen ein.
Ein weiterer Grund für die Verzögerung der Bilanzveröffentlichung ist ein offenes Geheimnis: Die Vorlage des Zahlenwerks würde das Ausmaß der Finanzlöcher offenbaren. In Europa hätte sich Evergrande längst strafbar gemacht, indem es sich weigert, die Probleme exakt zu beziffern. Die Fachanwältin Elske Fehl-Weileder von der Kanzlei Schultze & Braun hat im China.Table bereits erklärt, wo der große Unterschied zur Rechtslage in den meisten anderen großen Volkswirtschaften liegt: In China gibt es den Straftatbestand der Insolvenzverschleppung nicht.
Die vermeintliche Gesetzeslücke bei der Insolvenzverschleppung könnte von der Führung durchaus erwünscht sein. Intransparenz ist eine gemeinsame Eigenschaft der asiatischen Volkswirtschaften, wenn sie an der Schwelle von mittleren und höheren zu sehr hohen Einkommen stehen. Staatliches Wirtschafts-Engineering zusammen mit einem glaubwürdigen Erfolgsnarrativ haben bis zu diesem Punkt gut funktioniert. Die schonungslose Offenlegung der Verhältnisse war nie wirklich notwendig. Dafür ist es Staatsbeamten und Großunternehmen immer gut gelungen, Probleme unter den Teppich zu kehren.
Japan befand sich Ende der 1980er-Jahre an diesem Punkt. Eine fadenscheinige Kreditvergabe hatte sich mit dem Glauben an immer steigende Bewertungen am Immobilienmarkt verbunden. Als den mächtigen Wirtschaftsbeamten klar wurde, wie unseriös das eigene Finanzsystem war, haben sie das Ausmaß der Probleme verschleiert. Sie haben versucht, sie durch Hinterzimmer-Deals verschwinden zu lassen. Echte Transparenz kam erst anderthalb Jahrzehnte später. Ähnlich war es in Südkorea. Doch China wird mangels freier Presse und unabhängiger Gerichte vielleicht nie dahin kommen, die Geschehnisse am Finanzmarkt wirklich offenzulegen.
Tatsächlich ist es auch in westlichen Ländern so, dass systemrelevante Großinsolvenzen nach Möglichkeit vermieden werden. Und auch hier hilft der Staat mit, wenn ein echtes Dickschiff dann doch einmal durch die Insolvenz muss. Der Glaube an die reinigenden Kräfte des Marktes endet da, wo die Furcht vor steigender Arbeitslosigkeit und einer Kettenreaktion anfängt.
Dem kommunistischen China als Einparteienstaat liegt die Neigung zum intransparenten, aber gesichtswahrenden Lösungen in der DNA. Die Genossen handeln sie untereinander aus. Und genau das lässt sich derzeit bei Evergrande beobachten. Der Preis für das Durchwursteln ist jedoch, wie seinerzeit in Japan und in Südkorea, eine immer geringere Effizienz. Auch bei Evergrande ist massig Kapital zu Beton geworden, das sich zu diesen Preisen nicht mehr rentiert.
Konkret steht derzeit die Evergrande-Tochter für das Gebäudemanagement unter Wasser. Die Sparte “Property Services” galt bisher als gesund. Sie macht schließlich realen Gewinn mit nachvollziehbaren Dienstleistungen. Das Evergrande-Imperium mag auf Pump zusammengebaut sein. Doch die Gebäude und vor allem ihre Bewohner sind real. Sie brauchen ein Compound-Büro (“Wuye 物业”), Hausmeisterdienste, Reinigung, Reparaturen. Dafür zahlen die Bewohner Gebühren über die Wohnnebenkosten.
Doch gerade die Gebäudedienste sind es nun, die Evergrande als Grund für die Verzögerung der Bilanzvorstellung vorschiebt. Sie hatten angeblich knapp zwei Milliarden Euro (13,4 Milliarden Yuan) auf einem Konto liegen. Nun stellte sich heraus: Das Konto diente als Sicherheit für einen Kredit. Da die Fähigkeit zur Rückzahlung solcher Kredite in der Evergrande-Gruppe derzeit gegen Null geht, kann man bereits vermuten: Das Geld ist futsch.
Die hier verwendete Praxis, Barmittel für einen Kredit zu verpfänden, klingt bereits nach einem Bilanztrick. Wer liquide ist, könnte das Geld auch direkt einsetzen oder einfach gruppenintern verleihen. Das Manöver geht um zwei Ecken und ist daher wieder einmal: intransparent. Evergrande selbst spricht in gespielter Verwirrung von einem “großen Vorfall” und nennt Covid als Mitgrund für die Verflüchtigung des Kontostands. Der Versuch, die Gebäudemanagement-Tochter gewinnbringend zu verkaufen, ist auf jeden Fall vorerst gescheitert. Als Käufer war Hopson Development aus Guangzhou im Gespräch gewesen.
Zugleich gerät das Unternehmen an der internationalen Front unter Druck. Die Anleihen des Unternehmens werden am Markt bereits verramscht. Derzeit gibt es nur noch 13 Cent pro Euro Anleihewert. Das bedeutet: Evergrande müsste dem Inhaber der Papiere eigentlich den vollen Preis zahlen. Doch das erwartet keiner mehr. Daher werden die Anleihen unter den Marktteilnehmern mit fast 90 Prozent Rabatt weiterverkauft. Der Abschlag drückt das Risiko aus, das die Banker bei Evergrande heute unterstellen. Unnötig zu sagen, dass das Unternehmen sich zu diesen Bedingungen kein Geld mehr leihen kann.
Zahlreiche weitere Immobilienfirmen befinden sich längst im Sog der Probleme. In Hongkong müssen sie bis zum 31. März ihre Abschlüsse vorlegen. Bei dem Evergrande-Konkurrenten Ronshine ist nun sogar der Buchprüfer abgesprungen. Das Unternehmen kündigte nun ebenfalls an, seine Bilanz nicht pünktlich bis zum 31. vorlegen zu können.
Die Aufräumpläne der Regierung kommen derweil bei weitem nicht so gut voran wie geplant. Eigentlich sollten gesunde, vom Staat getragene Immobilienfirmen die guten Teile von Evergrande übernehmen. Doch diese zögern, zuzugreifen, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin berichtet. Die Marktbedingungen sind zu unsicher geworden. Die Manager der intakten Firmen würden zurzeit lieber auf Sicherheit spielen, so das Magazin. Dazu gehört es, seine Bilanz nicht mit fragwürdigen Zukäufen aufzublähen.
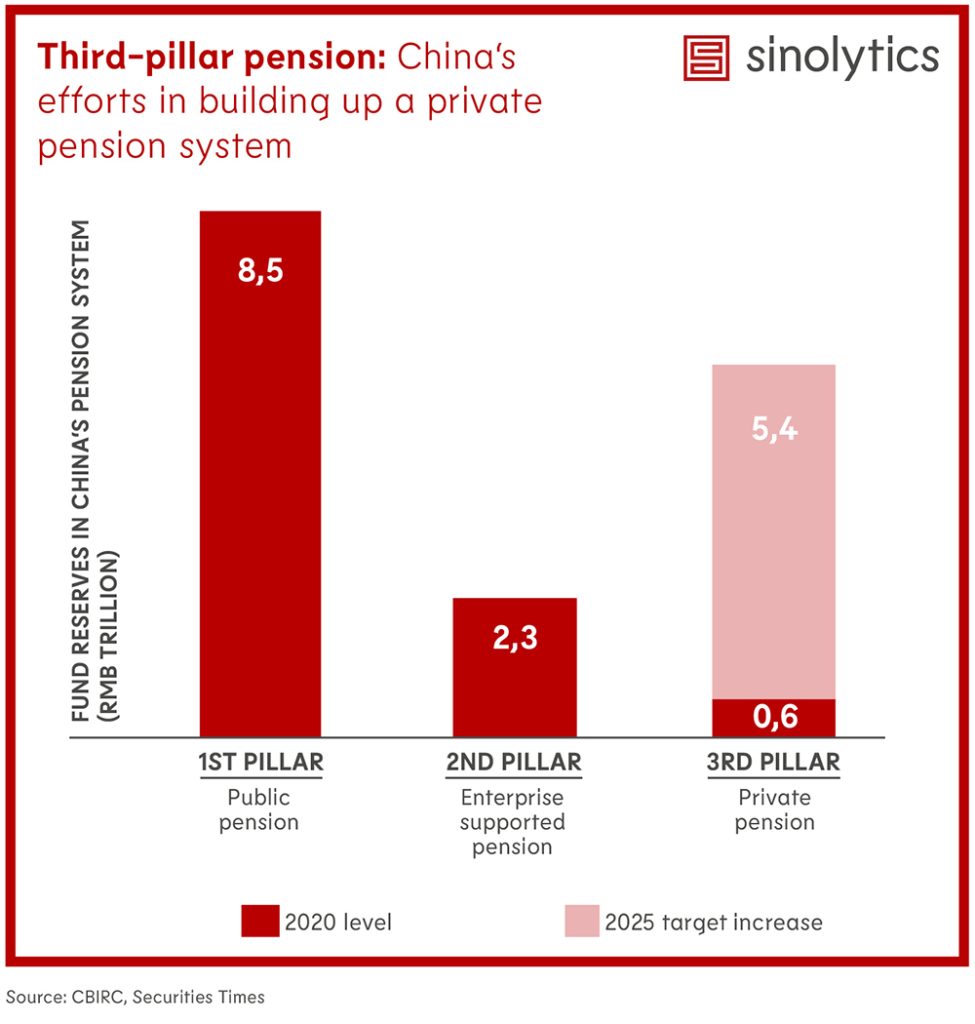
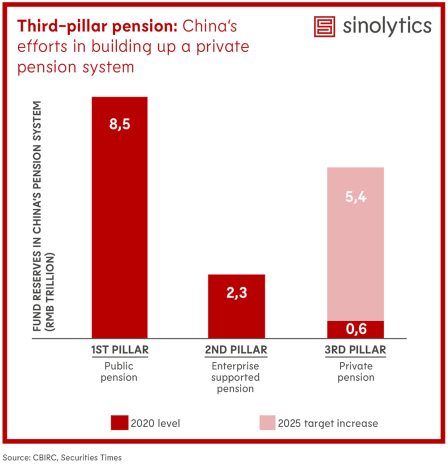
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.
Die Europäische Union will sich für den Fall einer chinesischen Untestützung Russlands im Ukraine-Krieg mit Partnern wie den USA und Japan abstimmen. US-Präsident Joe Biden reist diese Woche nach Brüssel zu einem G7- und Nato-Treffen. Biden nimmt zudem gemeinsam mit dem japanischen Premier Fumio Kishida an einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs teil. Während des Besuchs in Brüssel werde Biden sich mit den EU-Partnern über die Reaktion auf Russlands Invasion in der Ukraine abstimmen, sagte ein hochrangiger US-Beamter der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gehören auch Bedenken, dass China Russland materiell unterstützen könnte.
Brüssel wird sich bei dem Treffen voraussichtlich der Botschaft Washingtons an China anschließen: Es drohen Konsequenzen, wenn Peking die Sanktionen gegen Russland abfedert oder Moskau militärisch unterstützt. Zudem wird erwartet, dass sich EU und USA vor dem EU-China-Gipfel in der kommenden Woche absprechen. EU-Botschafter drängten in der vergangenen Woche darauf, gegenüber Peking zu betonen, dass der Krieg in der Ukraine möglicherweise ein entscheidender Moment für die EU-China-Beziehungen sei, zitiert Bloomberg aus einem Dokument.
Nicht nur die Ukraine-Krise hängt schwer über dem virtuellen EU-China-Treffen am kommenden Freitag: Der Gipfel findet gut ein Jahr nach der Verhängung gegenseitiger Sanktionen im Zusammenhang mit der Menschenrechtslage in Xinjiang statt. Auch Chinas Handelsblockade gegen den EU-Staat Litauen und die damit verbundenen WTO-Konsultationen stehen im Raum. Es gilt als unwahrscheinlich, dass nach dem EU-China-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben wird. Wahrscheinlicher ist, dass beide Seiten hinterher ihre eigenen Mitteilungen zum Gipfel veröffentlichen. rtr/ari
Das US-Außenministerium will bestehende Reiseverbote gegen chinesische Beamte ausweiten. Außenminister Antony Blinken kündigte am Montag Ortszeit an, dass das Reiseverbot künftig für Personen gelte, die für Unterdrückungsmaßnahmen “verantwortlich oder daran beteiligt” seien. Konkret geht es laut Blinken um die Unterdrückung von “religiösen und spirituellen Praktizierenden, Angehörigen ethnischer Minderheiten, Dissidenten, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Gewerkschafter, Organisatoren der Zivilgesellschaft und friedlichen Demonstranten in China und darüber hinaus.”
Ein großer Teil der bereits bestehenden Visabeschränkungen gegenüber chinesischen Beamten wurde von der Trump-Administration verhängt. Sie wollte damit die Verfolgung uigurischer Muslime in Xinjiang sowie die Verhaftungen von demokratischer Aktivisten in Hongkong und Tibet ahnden. Erst in der vergangenen Woche hatte das US-Justizministerium Anklage gegen fünf Männer erhoben, die im Namen der chinesischen Regierung versucht haben sollen, chinesische Dissidenten in den USA zu verfolgen und zu schikanieren. fpe
Wegen der anhaltenden Handelsblockade sind die Exporte des EU-Staats Litauen nach China Anfang 2022 drastisch gefallen. Im Januar und Februar gingen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 88,4 Prozent auf 9,5 Millionen US-Dollar zurück, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Seit Anfang Dezember hat die Volksrepublik litauische Ware im Zollsystem blockiert. Welche Güter es in den ersten beiden Monaten trotz der Blockade offenbar nach China schafften, schlüsseln die Daten nicht auf. Auch ob die Waren eingeführt oder lediglich beim Zoll angemeldet wurden, ging aus den Zahlen nicht hervor.
Laut den Zolldaten sanken zudem die Exporte aus der Region Xinjiang in die 27 EU-Staaten im Januar und Februar um 44,5 Prozent von 146 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun nur noch 81 Millionen US-Dollar. Die Ausfuhren von Xinjiang nach Deutschland gingen demnach um 29 Prozent zurück. Das größte Importvolumen von Xinjiang in einen EU-Staat entfiel im Januar und Februar auf Tomatenmark für Italien.
Die EU arbeitet derzeit an einem EU-Lieferkettengesetz, im Rahmen dessen vor allem Importe aus Xinjiang unter stärkere Kontrolle fallen werden. ari
Die Übernahmeaktivitäten chinesischer Investoren in Deutschland und Europa haben wieder leicht zugenommen. 2021 kauften chinesische Firmen nach einer neuen Analyse der Unternehmensberatung EY 155 europäische Unternehmen für insgesamt 12,4 Milliarden Dollar. Das waren 23 Übernahmen mehr als 2020 – aber nur halb so viele wie im Übernahme-Boomjahr 2016. Der größte Deal des Jahres in Europa war demnach der Verkauf der Philips-Hausgerätesparte in den Niederlanden für 4,3 Milliarden Dollar an das chinesische Finanzhaus Hillhouse Capital Group. Großbritannien löste laut EY erstmals Deutschland als Top-Ziel chinesischer Übernahmen ab. 36 Firmen gingen dort in chinesische Hände über.
In Deutschland übernahmen chinesische Investoren laut der am Dienstag vorgestellten EY-Studie im vergangenen Jahr 35 Firmen für gut zwei Milliarden Dollar, gegenüber 28 in 2020. In der Rangliste ausländischer Firmenkäufer in Deutschland lag China damit aber nur auf Platz 9. An erster Stelle standen US-Unternehmen mit 284 Akquisitionen. Nicht enthalten in diesen Zahlen sind laut EY allerdings Risikokapitalinvestitionen von 1,9 Milliarden Dollar in deutsche Start-ups, an denen sich chinesische Firmen im Rahmen internationaler Investorengruppen beteiligten.
“Chinesische Unternehmen bleiben bei ihren Investitionen in Europa insgesamt noch zurückhaltend”, sagte Sun Yi, Leiterin der China Business Services bei EY in Westeuropa, am Dienstag in Stuttgart. Das liege nicht nur an der Pandemie. “Die meisten chinesischen Unternehmen, die schon im Ausland Firmen übernommen haben, waren in den letzten Jahren eher damit beschäftigt, die Restrukturierung in Europa voranzutreiben als weiter zu expandieren.” Die Zahl der Übernahmen in klassischen Industriesektoren ging 2021 minimal von 36 auf 35 zurück. “Nach wie vor besteht bei chinesischen Investoren Interesse an europäischen Automobilzulieferern oder Maschinenbauern”, so Sun – allerdings inzwischen eher in den Subsektoren Elektromobilität, Autonomes Fahren und High Tech-Materialien.” ck
Die Omikron-Welle breitet sich in Nordostchina offenbar immer weiter aus. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen haben die Behörden am späten Montagabend auch Shenyang in den Lockdown geschickt. Die neun Millionen Einwohner der Provinzhauptstatdt von Liaoning dürfen ihre Wohnanlagen demnach nur mit einem aktuellen negativen Corona-Test verlassen. Shenyang ist die wichtigste Wirtschaftsmetropole des Nordostens. Dort hat BMW eines seiner größten Werke weltweit; auch viele Zulieferer sind dort aktiv.
Die benachbarte Provinz Jilin ist nach wie vor der größte Corona-Hotspot des Landes. Dort gilt in der Provinzhauptstadt Changchun und der gleichnamigen Stadt Jilin eine Ausgangssperre. Chinas Gesundheitsbehörden meldeten am Dienstag landesweit knapp 4800 neue Infektionsfälle, etwas mehr als am Montag. Die meisten von ihnen wurden wie auch in den letzten Tagen in Jilin nachgewiesen.
Dass Shenyang mit nur 47 täglichen Neuinfektionen in den Lockdown muss, zeigt die hochgradige Nervosität der Behörden. Die Impfquote unter den Älteren ist niedrig: Nur 51 Prozent der über 80-Jährigen sind mindestens doppelt geimpft (China.Table berichtete). Auch bringt die hochansteckende Omikron-Variante das Gesundheitssystem inzwischen an seine Belastungsgrenzen. In Jilin waren am Montag laut AFP die ersten 10.000 Dosen des oralen Covid-Medikaments Paxlovid des US-Konzerns Pfizer eingetroffen. Es wäre das erste Mal, dass Paxlovid in China eingesetzt wird.
Unterdessen erteilte Chinas Covid-Zar Liang Wannian Lockerungen der strikten Null-Covid-Politik eine Absage. “Es sollte kein Jota der Entspannung geben, da wir das hart erarbeitete Erreichte in Ehren halten müssen”, sagte Liang, ein erfahrener Epidemiologe, der Chinas Covid-Reaktion seit Beginn der Pandemie leitete und kürzlich als Corona-Krisenmanger nach Hongkong geschickt wurde. Um mit der leicht übertragbaren Omikron-Variante Schritt zu halten, könnten die Maßnahmen aber verfeinert werden, um gezielter und schneller eingesetzt zu werden, sagte Liang am Dienstag laut Bloomberg.
Hongkong hatte trotz anhaltend hoher Inzidenzen am Montag einige seiner strengen Null-Covid-Regeln gelockert. Und auch in China gibt es immer wieder Experten, die ein weniger strikteres Regime mit geringeren Auswirkungen auf die Wirtschaft befürworten. Shenzhen hob am Montag nach einer Woche den Lockdown auf, mit Ausnahme des Bezirks Futian. Shanghai versucht derweil, mit gezielten Lockdowns in einzelnen Gegenden eine Abriegelung der gesamten Stadt abzuwenden. ck

Das internationale Welthandelssystem ab Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 2000er Jahre hinein war nicht nur von der Idee der Liberalisierung, sondern auch der Zurückdrängung von (macht-)politischen gegenüber ökonomischen Aspekten geprägt. Als Sinnbild dafür standen u.a. die Meistbegünstigungsklausel und der institutionalisierte Streitbeilegungsmechanismus der WTO, bzw. des GATT, die eine systematische Benachteiligung kleinerer gegenüber größeren Nationen zumindest einzugrenzen versuchten. Spätestens seit dem Amtsantritt der Trump-Administration werden außen- und handelspolitische Aspekte jedoch weltweit wieder stärker verknüpft, und gewinnen damit Macht- und Größenunterschiede zwischen Staaten auch für die Handelspolitik wieder an Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist die chinesische Erlassung eines de facto-Handelsboykotts gegen Litauen als Folge der Eröffnung eines taiwanesischen Konsulats in der Hauptstadt Wilna unter dem Namen Taiwan (nicht, wie sonst praktiziert, Taipeh).
Die Tatsache, dass der Sanktionscharakter der Maßnahmen von chinesischer Seite nicht offiziell eingeräumt wurde, kann als Versuch gedeutet werden, diese von multilateralen Standards, insbesondere jenen der WTO, fernzuhalten und sich in erster Linie auf eine bilaterale Machtdemonstration gegenüber Litauen zu verlegen. Allerdings solidarisierte sich die Europäische Union rasch mit Litauen und stellte damit eine im Wesentlichen wieder symmetrische Konstellation her, auch wenn keine Gegensanktionen erlassen wurden.
Die EU initiierte im Weiteren ein Verfahren vor der WTO, dessen Potenziale aber begrenzt sind: erstens kann eine WTO-basierte Berechtigung zu unilateralen handelspolitischen Schutzmaßnahmen der EU (zum Beispiel höhere Zölle gegen unrechtmäßig subventionierte Importprodukte) aus dem Profil der chinesischen Sanktionen nicht abgeleitet werden. Zweitens kann eine Urteilsfindung erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Drittens wäre auch im Falle eines Urteils im Sinne der EU dessen Durchsetzung in letzter Konsequenz nur in Form von autorisierten Vergeltungsmaßnahmen möglich.
Solche Maßnahmen waren bei WTO-Verfahren bis jetzt zwar nur in einer kleinen Minderheit der Fälle notwendig; sie sind im Fall der Nichtumsetzung eines Urteils durch den Beklagten, was im vorliegenden Fall für China durchaus nicht unrealistisch erschiene, für die Gegenpartei aber die einzige Möglichkeit, zu ihrem Recht zu kommen. Gleichzeitig bergen sie erhebliches neues Konflikt- und Verzögerungspotenzial und rücken wiederum Größenunterschiede zwischen den Konfliktparteien in den Vordergrund; der Wert der WTO als institutionalisierte Streitbeilegungsinstanz wird dadurch erheblich vermindert.
Die Europäische Union selbst wurde durch die litauischen Maßnahmen vor ein Dilemma gestellt, das für den europäischen Integrationsprozess typisch ist. Einerseits war eine Reaktion auf europäischer Ebene aufgrund der Integrität des Binnenmarkts und der handels- und investitionspolitischen Außenkompetenz der Union folgerichtig. Andererseits beschloss die Regierung Litauens ihre Linie im Rahmen der weiterhin bestehenden außenpolitischen Souveränität der Mitgliedstaaten und stimmte sich nicht mit anderen Mitgliedstaaten ab. Diese tragen damit die potenziellen negativen Folgewirkungen einer Politik, über die sie nicht entschieden haben.
Die Haltung Litauens ist aus interner Perspektive durchaus konsistent. Bereits im Herbst 2020 erfolgten erste Signale in Richtung eines Ausbaus der Beziehungen zu Taiwan; im Frühjahr 2021 verließ Litauen das “17+1”-Format osteuropäischer Staaten mit China, einem Instrument regionaler Einflussnahme Chinas unter anderem im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative. Politische Spielräume waren für Litauen auch insofern gegeben, als seine wirtschaftlichen Beziehungen mit China von vergleichsweise geringer Bedeutung für die litauische Gesamtwirtschaft sind. Dies unterscheidet die litauische Position deutlich von der gesamteuropäischen – beispielsweise ist China inzwischen der wichtigste Import- und drittwichtigste Exportpartner der EU – und jener größerer Mitgliedstaaten, zum Beispiel Deutschlands und Frankreichs. Zumal die chinesische Reaktion auf die Vorgänge in Litauen im Rahmen der jahrzehntelang gepflegten “Ein-China-Politik” keineswegs überraschend kam, hätte diesbezüglich auf gesamteuropäischer Ebene durchaus Diskussions- und wohl auch Entscheidungsbedarf bestanden.
Damit zeigt sich, dass gerade in der Situation einer stärkeren machtpolitischen Prägung der internationalen Handelspolitik der (bereits erfolgte) Integrationsschritt einer Vereinheitlichung der Handels- und Investitionspolitik die Notwendigkeit einer (künftigen) Vereinheitlichung weiterer Bereiche der Außenpolitik nach sich zieht.
Im Ergebnis ist ein einheitliches europäisches Auftreten im Zuge der internationalen Politisierung der Handels- und Investitionsströme notwendiger denn je, nicht zuletzt, um auch den Schutz kleinerer Mitgliedstaaten vor externen Repressionen sicherzustellen. Soll dieses Auftreten effektiv sein, ist aber eine europäische Integration breiterer außenpolitischer Kompetenzen unabdingbar. Die jüngsten Schritte in Richtung eines neuen handelspolitischen EU-Instruments gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittländern können hierfür nur ein Anfang sein.
Dieser Gastbeitrag erscheint im Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Am Donnerstag (24.03.) geht es mit Christian Hederer von der Technischen Hochschule Wildau und Jürgen Matthes vom IW Köln um das Thema: “EU-China-Handelskonflikte und der Fall Litauen: Welche Rolle spielt die WTO?”. Moderatorin ist unsere Redakteurin Amelie Richter. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.
Weijian Shan, Executive Chairman der Investmentgruppe PAG, wird unabhängiger Direktor im Board der Alibaba Group Holding Limited. Er löst Börje Ekholm, Präsident und Chief Executive Officer der Ericsson Group, ab, der am 31. März 2022 aus dem Board ausscheiden wird. Ekholm ist seit Juni 2015 als unabhängiger Direktor für Alibaba tätig.
Wang Xiaozhen wird neuer Vizepräsident der China Media Group, des mächtigsten staatlichen Medienunternehmens der Volksrepublik. Die China Media Group ging 2018 aus einer Fusion staatlicher Medienunternehmen wie China Central Television, China National Radio und China Radio International hervor. Sie steht unter direkter Kontrolle der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei.

Die Tujia leben in den Hügeln Südwestchinas, und besitzen ebenso wie viele ethnische Minderheiten der Region eine reiche Tradition an farbenfroher Webkunst. Viele dieser Traditionen, wie auch die der benachbarten Miao, gehen allmählich verloren, da die jungen Leute sie nicht mehr erlernen. Hier weben Frauen in einem Studio in der Stadt Xiaonanhai nahe Chongqing Stoffe aus Xilankapu, einer Art Tujia-Brokat. Xilankapu-Webereien sind in China bekannt als Bettdecken mit Blumenmuster und wurden 2006 in das nationale immaterielle Kulturerbe aufgenommen.
Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hat in diesem Jahr so viele Raketen getestet wie seit fünf Jahren nicht mehr. Und dabei ist erst März. Peking ist über die Zündeleien an seiner Grenze unglücklich. Trotzdem braucht China Nordkorea weiterhin als Puffer zwischen sich und dem US-Alliierten Südkorea. Erst Ende Februar hatte Chinas Staatschef Xi Jinping die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit mit Pjöngjang betont. Das ist ein schwieriger diplomatischer Akt, schreibt Christiane Kühl. Bei näherem Hinsehen sind die Ähnlichkeiten zu Russland verblüffend. Sowohl Nordkorea als auch Russland sind zwar wichtige Partner gegen den Westen. Doch beide agieren unberechenbar. Und jetzt betrachtet die internationale Gemeinschaft auch Russland wie Nordkorea als Aggressor. Daher ähnelt sich auch das Hin und Her der chinesischen Kommunikation zu den beiden schwierigen Verbündeten.
Ein Eiertanz sondergleichen bleibt auch die Abwicklung des zahlungsunfähigen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Am Dienstag meldete das Unternehmen, dass es den Termin zur Vorlage seiner Jahresbilanz am 31. März versäumen wird. Die Bilanz, wenn sie einmal herauskommt, wird das Ausmaß der Finanzlöcher offenbaren, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Die monatelang durchgehaltene Hinhaltetaktik gegenüber den Gläubigern ist nur möglich, weil das chinesische Recht keine Insolvenzverschleppung kennt. Intransparenz als Strategie hat aber auch ihre Grenzen. Fragwürdige Kreditvergaben bei gleichzeitiger Verschleierung der Probleme hat bereits Japan Ende der 80er-Jahre ein Ende seines jahrzehntelangen Booms beschert.


Am Sonntag war es mal wieder soweit: Nordkorea meldete einen Raketentest. Vergangene Woche war ein solcher Test offenbar schief gegangen: Es regnete Trümmer nahe Pjöngjang. Satte elf Testreihen mit Dutzenden Raketen hat Machthaber Kim Jong-un in diesem Jahr bisher gestartet, nachdem er die Testfrequenz schon seit Herbst 2021 schrittweise erhöht hatte. Kim zündelt wie zuletzt in der sogenannten “Feuer-und-Zorn”-Ära mit ihrer Kombination aus Nuklear- und Raketentests und besonders kriegerischer Rhetorik sowohl aus Pjöngjang als auch aus Washington. Neue Satellitenbilder zeigen zudem Aktivitäten an der 2018 eigentlich stillgelegten Atomtestanlage Punggye-ri, wie Reuters Anfang März berichtete. Es ist das einzige bekannte Atomtestgelände. Nordkorea habe seine nuklearen und ballistischen Raketenprogramme stetig weiterentwickelt, hieß es Anfang Februar in einem UN-Bericht.
Nordkorea ist den USA trotz des Ukraine-Krieges offenbar wichtig genug, dass der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan das Thema nach Angaben des Weißen Hauses beim eigentlich vom Ukraine-Krieg dominierten Treffen mit Chinas Außenpolitikzar Yang Jiechi in Rom ansprach. Sullivan betonte dort seine “ernsthafte Besorgnis” über Nordkorea. Yangs Antwort ist nicht bekannt.
Peking stellt sich schützend vor Pjöngjang wie eh und je. Zuletzt blockierte es Anfang März gemeinsam mit Moskau im UN-Sicherheitsrat die Verurteilung der jüngsten Raketentests. Doch es ist seit vielen Jahren ein offenes Geheimnis, dass Peking wenig begeistert ist vom Atomprogramm der Kim-Dynastie. Nachdem Russland sich durch die Ukraine-Invasion international isoliert hat, hat China nun gleich zwei Paria-Staaten als Nachbarn und Partner. Und beide fuchteln mit ihren Atomwaffen herum.
Fachleute registrieren nun eine gegenseitige Verstärkung der geopolitischen Störfelder, die von Russland und Nordkorea ausgehen. “Ich denke, dass Peking sehr beunruhigt ist über die von Russland geschaffene Instabilität und die Möglichkeit, dass Nordkorea dies als Gelegenheit zum Eskalieren der Spannungen nutzen könnte”, sagt Ramon Pacheco Pardo, Nordkorea-Experte vom King’s College London.
Zu einer Verschärfung der Lage könnte vor allem der Test einer Interkontinentalrakete führen. “Für China wären das unliebsame Nachrichten”, so Pardo zu China.Table. Noch dazu, weil Nordkorea seine Interkontinentalraketen offenbar nahe an Chinas Territorium stationieren will. Das amerikanische Center for Strategic and International Studies identifizierte mithilfe von Satellitenbildern kürzlich eine dafür vorgesehene Militärbasis bei Hoejung-ni nur 25 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt.
Zu den 130 Raketen und vier Atomsprengköpfen, die Kim seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren testete, gehörte bereits eine Interkontinentalrakete namens Hwasong-15, die das Weiße Haus erreichen könnte. Im Januar feuerte Nordkorea nach eigenen Angaben unter anderem zwei Hyperschallraketen und eine Hwasong-12-Mittelstreckenrakete ab, das stärkste Geschoss seit 2017. Hwasong-12 könnte zumindest die US-Pazifikbasis Guam treffen. Ende Februar und Anfang März folgten ballistische Mittelstreckenraketen – möglicherweise mit dem Ziel, Komponenten eines Bildaufklärungssatelliten für ein paar Minuten zum Test in Betriebshöhe zu bringen.
China macht gute Miene zum bösen Spiel. Staatschef Xi Jinping betonte erst Ende Februar wieder die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit. Beide Seiten nahmen kürzlich den wegen der Corona-Pandemie gestoppten Güterzugverkehr über den Yalu-Fluss bei Dandong wieder auf. Der bilaterale Handel lag daher im Januar und Februar mit 136,5 Millionen US-Dollar auf dem 40-Fachen des Vorjahresniveaus. Dass dieses magere Volumen rund 90 Prozent des nordkoreanischen Außenhandels ausmacht, zeigt die Isolation und Abhängigkeit Kims von China. Doch Kim lässt sich trotzdem nicht umfassend hineinreden. Er weiß: Peking stützt Nordkoreas marode Wirtschaft auch deshalb, weil das Land für China ein wichtiger Pufferstaat ist.
Doch das ist nicht die ganze Geschichte. “Nordkorea hat in den letzten Jahren für China an strategischem Wert gewonnen”, sagt der Nordkorea-Experte Christopher Green von der Denkfabrik Crisis Group. “China und die Vereinigten Staaten sind an Chinas Ostküste in ein ‘Great Game’ verwickelt, und dieser Wettbewerb beginnt im Nordosten mit der koreanischen Halbinsel”, so Green zu China.Table – in Anspielung auf das Ringen der Großmächte um die Vormacht in Zentralasien vor 150 Jahren. “Nordkorea ist widerspenstig und lästig, aber China wird zu Recht als das einzige Land angesehen, das überhaupt in der Lage ist, die Handlungen Nordkoreas zu beeinflussen. Dass Nordkorea während der Olympischen Winterspiele in Peking ein Moratorium für Raketentests einhielt, deutet darauf hin, dass Pjöngjang weiß, wann es wichtig ist, keinen Ärger zu machen.”
Für Peking hat derweil die Funktion Nordkoreas als Bollwerk gegen die USA Priorität. “Ich denke, dass die beiden Hauptgründe, warum China Nordkorea unterstützt, Geopolitik und Grenzstabilität sind”, sagt Pardo. “Wenn Nordkorea aufhört zu existieren, wird sich Korea unter südkoreanischen Bedingungen wiedervereinigen.” Dass China sich vor US-Soldaten an seiner Grenze graut, ist bekannt. Und noch stehen 28.500 US-Soldaten in Südkorea. Zugleich fürchtet es bei einem Zusammenbruch des Regimes eine Flüchtlingswelle. “Für Peking wäre es schwierig, einen großen plötzlichen Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen”, sagt Pardo. China muss also mit Kim klarkommen.
Derweil befürchten Militärexperten infolge der nordkoreanischen Raketentests ein Wettrüsten in Fernost. 71 Prozent der Südkoreaner sind laut einer aktuellen Umfrage dafür, dass ihr Land eigene Atomwaffen entwickelt. 56 Prozent wären für die Stationierung amerikanischer Atomwaffen. Unklar ist, wie sich die kürzliche Präsidentenwahl in Südkorea auswirken wird. Der künftige Präsident Yoon Suk-yeol gilt als China-Kritiker und Befürworter einer engeren Allianz mit den USA und Gruppen wie der Quad. Pardo geht davon aus, dass Yoon gegenüber Nordkorea “der Abschreckung und den Menschenrechten ebenso große Priorität einräumt wie einem möglichen Engagement.”
Auswege scheint es vorerst nicht zu geben. Pardo und Green gehen fest davon aus, dass Nordkorea auf keinen Fall sein Atomprogramm aufgeben wird. Auch sei Kim derzeit nicht an multilateralen Verhandlungen wie die von China ausgerichteten Sechsergespräche der 2000er-Jahre interessiert. Der Ukraine-Krieg sei “eine Erinnerung für Pjöngjang, dass Nordkoreas Hauptverteidigung gegen Einmischung von außen seine Atomwaffen sind”, sagt Green. “Aber ich denke, Peking wäre bereit, Gespräche abzuhalten, sobald Nordkorea bereit wäre daran teilzunehmen.”

Was nicht sein darf, wird auch nicht klar ausgesprochen. Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande ist seit Monaten faktisch zahlungsunfähig (China.Table berichtete). Doch kein Firmenvertreter und kein chinesischer Beamter nimmt das Wort “Insolvenz” in den Mund. Dabei wären die Kriterien längst erfüllt. Doch die Verwerfungen am Finanzmarkt wären einfach zu groß, wenn die Nachricht von der formalen Insolvenz durch alle Nachrichtenportale liefe. Daher versuchen alle Beteiligten derzeit noch, sich durchzuwursteln.
Die Warnzeichen werden allerdings derzeit unmissverständlich. Am Dienstag hat das Unternehmen angekündigt, dass es den Termin zur Vorlage seiner Jahresbilanz am 31. März versäumen werde. Bei einer wichtigen Tochtergesellschaft sei Geld abhandengekommen. Das Unternehmen spricht nun von “Komplikationen” bei der Abfassung des Jahresabschlusses. Bis Ende Juli will der Konzern allerdings einen Plan zur Umschuldung vorlegen, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Investoren bekräftigte. Viel Zeit hat das Unternehmen allerdings nicht mehr. Gläubiger fordern in dieser Woche zusammengenommen rund 1,9 Milliarden Euro an ausstehenden Zahlungen für Anleihen ein.
Ein weiterer Grund für die Verzögerung der Bilanzveröffentlichung ist ein offenes Geheimnis: Die Vorlage des Zahlenwerks würde das Ausmaß der Finanzlöcher offenbaren. In Europa hätte sich Evergrande längst strafbar gemacht, indem es sich weigert, die Probleme exakt zu beziffern. Die Fachanwältin Elske Fehl-Weileder von der Kanzlei Schultze & Braun hat im China.Table bereits erklärt, wo der große Unterschied zur Rechtslage in den meisten anderen großen Volkswirtschaften liegt: In China gibt es den Straftatbestand der Insolvenzverschleppung nicht.
Die vermeintliche Gesetzeslücke bei der Insolvenzverschleppung könnte von der Führung durchaus erwünscht sein. Intransparenz ist eine gemeinsame Eigenschaft der asiatischen Volkswirtschaften, wenn sie an der Schwelle von mittleren und höheren zu sehr hohen Einkommen stehen. Staatliches Wirtschafts-Engineering zusammen mit einem glaubwürdigen Erfolgsnarrativ haben bis zu diesem Punkt gut funktioniert. Die schonungslose Offenlegung der Verhältnisse war nie wirklich notwendig. Dafür ist es Staatsbeamten und Großunternehmen immer gut gelungen, Probleme unter den Teppich zu kehren.
Japan befand sich Ende der 1980er-Jahre an diesem Punkt. Eine fadenscheinige Kreditvergabe hatte sich mit dem Glauben an immer steigende Bewertungen am Immobilienmarkt verbunden. Als den mächtigen Wirtschaftsbeamten klar wurde, wie unseriös das eigene Finanzsystem war, haben sie das Ausmaß der Probleme verschleiert. Sie haben versucht, sie durch Hinterzimmer-Deals verschwinden zu lassen. Echte Transparenz kam erst anderthalb Jahrzehnte später. Ähnlich war es in Südkorea. Doch China wird mangels freier Presse und unabhängiger Gerichte vielleicht nie dahin kommen, die Geschehnisse am Finanzmarkt wirklich offenzulegen.
Tatsächlich ist es auch in westlichen Ländern so, dass systemrelevante Großinsolvenzen nach Möglichkeit vermieden werden. Und auch hier hilft der Staat mit, wenn ein echtes Dickschiff dann doch einmal durch die Insolvenz muss. Der Glaube an die reinigenden Kräfte des Marktes endet da, wo die Furcht vor steigender Arbeitslosigkeit und einer Kettenreaktion anfängt.
Dem kommunistischen China als Einparteienstaat liegt die Neigung zum intransparenten, aber gesichtswahrenden Lösungen in der DNA. Die Genossen handeln sie untereinander aus. Und genau das lässt sich derzeit bei Evergrande beobachten. Der Preis für das Durchwursteln ist jedoch, wie seinerzeit in Japan und in Südkorea, eine immer geringere Effizienz. Auch bei Evergrande ist massig Kapital zu Beton geworden, das sich zu diesen Preisen nicht mehr rentiert.
Konkret steht derzeit die Evergrande-Tochter für das Gebäudemanagement unter Wasser. Die Sparte “Property Services” galt bisher als gesund. Sie macht schließlich realen Gewinn mit nachvollziehbaren Dienstleistungen. Das Evergrande-Imperium mag auf Pump zusammengebaut sein. Doch die Gebäude und vor allem ihre Bewohner sind real. Sie brauchen ein Compound-Büro (“Wuye 物业”), Hausmeisterdienste, Reinigung, Reparaturen. Dafür zahlen die Bewohner Gebühren über die Wohnnebenkosten.
Doch gerade die Gebäudedienste sind es nun, die Evergrande als Grund für die Verzögerung der Bilanzvorstellung vorschiebt. Sie hatten angeblich knapp zwei Milliarden Euro (13,4 Milliarden Yuan) auf einem Konto liegen. Nun stellte sich heraus: Das Konto diente als Sicherheit für einen Kredit. Da die Fähigkeit zur Rückzahlung solcher Kredite in der Evergrande-Gruppe derzeit gegen Null geht, kann man bereits vermuten: Das Geld ist futsch.
Die hier verwendete Praxis, Barmittel für einen Kredit zu verpfänden, klingt bereits nach einem Bilanztrick. Wer liquide ist, könnte das Geld auch direkt einsetzen oder einfach gruppenintern verleihen. Das Manöver geht um zwei Ecken und ist daher wieder einmal: intransparent. Evergrande selbst spricht in gespielter Verwirrung von einem “großen Vorfall” und nennt Covid als Mitgrund für die Verflüchtigung des Kontostands. Der Versuch, die Gebäudemanagement-Tochter gewinnbringend zu verkaufen, ist auf jeden Fall vorerst gescheitert. Als Käufer war Hopson Development aus Guangzhou im Gespräch gewesen.
Zugleich gerät das Unternehmen an der internationalen Front unter Druck. Die Anleihen des Unternehmens werden am Markt bereits verramscht. Derzeit gibt es nur noch 13 Cent pro Euro Anleihewert. Das bedeutet: Evergrande müsste dem Inhaber der Papiere eigentlich den vollen Preis zahlen. Doch das erwartet keiner mehr. Daher werden die Anleihen unter den Marktteilnehmern mit fast 90 Prozent Rabatt weiterverkauft. Der Abschlag drückt das Risiko aus, das die Banker bei Evergrande heute unterstellen. Unnötig zu sagen, dass das Unternehmen sich zu diesen Bedingungen kein Geld mehr leihen kann.
Zahlreiche weitere Immobilienfirmen befinden sich längst im Sog der Probleme. In Hongkong müssen sie bis zum 31. März ihre Abschlüsse vorlegen. Bei dem Evergrande-Konkurrenten Ronshine ist nun sogar der Buchprüfer abgesprungen. Das Unternehmen kündigte nun ebenfalls an, seine Bilanz nicht pünktlich bis zum 31. vorlegen zu können.
Die Aufräumpläne der Regierung kommen derweil bei weitem nicht so gut voran wie geplant. Eigentlich sollten gesunde, vom Staat getragene Immobilienfirmen die guten Teile von Evergrande übernehmen. Doch diese zögern, zuzugreifen, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin berichtet. Die Marktbedingungen sind zu unsicher geworden. Die Manager der intakten Firmen würden zurzeit lieber auf Sicherheit spielen, so das Magazin. Dazu gehört es, seine Bilanz nicht mit fragwürdigen Zukäufen aufzublähen.
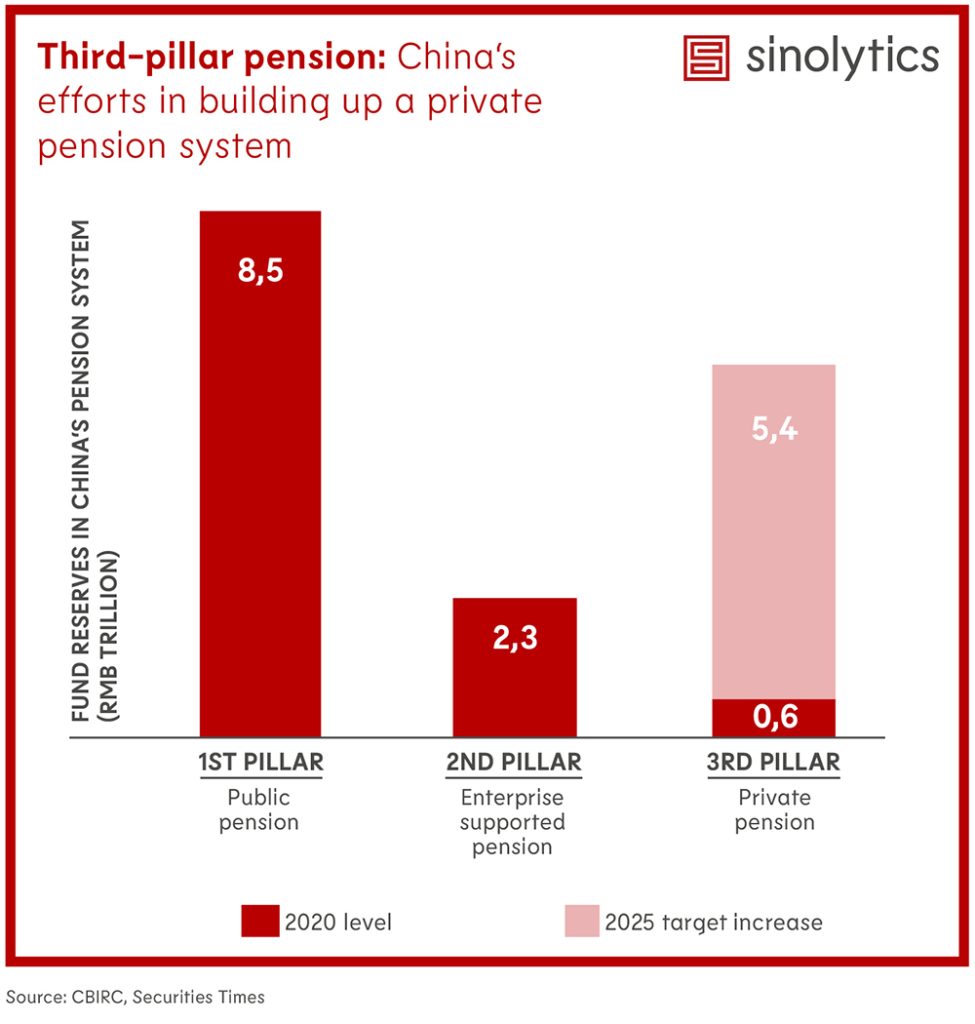
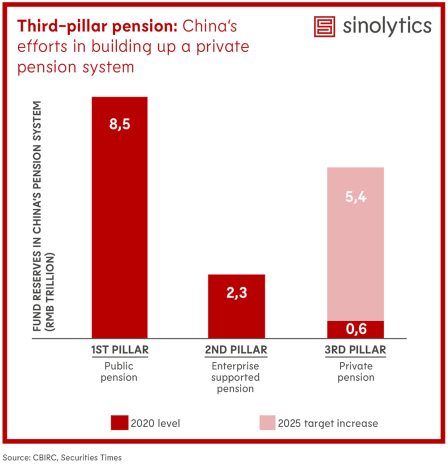
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.
Die Europäische Union will sich für den Fall einer chinesischen Untestützung Russlands im Ukraine-Krieg mit Partnern wie den USA und Japan abstimmen. US-Präsident Joe Biden reist diese Woche nach Brüssel zu einem G7- und Nato-Treffen. Biden nimmt zudem gemeinsam mit dem japanischen Premier Fumio Kishida an einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs teil. Während des Besuchs in Brüssel werde Biden sich mit den EU-Partnern über die Reaktion auf Russlands Invasion in der Ukraine abstimmen, sagte ein hochrangiger US-Beamter der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gehören auch Bedenken, dass China Russland materiell unterstützen könnte.
Brüssel wird sich bei dem Treffen voraussichtlich der Botschaft Washingtons an China anschließen: Es drohen Konsequenzen, wenn Peking die Sanktionen gegen Russland abfedert oder Moskau militärisch unterstützt. Zudem wird erwartet, dass sich EU und USA vor dem EU-China-Gipfel in der kommenden Woche absprechen. EU-Botschafter drängten in der vergangenen Woche darauf, gegenüber Peking zu betonen, dass der Krieg in der Ukraine möglicherweise ein entscheidender Moment für die EU-China-Beziehungen sei, zitiert Bloomberg aus einem Dokument.
Nicht nur die Ukraine-Krise hängt schwer über dem virtuellen EU-China-Treffen am kommenden Freitag: Der Gipfel findet gut ein Jahr nach der Verhängung gegenseitiger Sanktionen im Zusammenhang mit der Menschenrechtslage in Xinjiang statt. Auch Chinas Handelsblockade gegen den EU-Staat Litauen und die damit verbundenen WTO-Konsultationen stehen im Raum. Es gilt als unwahrscheinlich, dass nach dem EU-China-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben wird. Wahrscheinlicher ist, dass beide Seiten hinterher ihre eigenen Mitteilungen zum Gipfel veröffentlichen. rtr/ari
Das US-Außenministerium will bestehende Reiseverbote gegen chinesische Beamte ausweiten. Außenminister Antony Blinken kündigte am Montag Ortszeit an, dass das Reiseverbot künftig für Personen gelte, die für Unterdrückungsmaßnahmen “verantwortlich oder daran beteiligt” seien. Konkret geht es laut Blinken um die Unterdrückung von “religiösen und spirituellen Praktizierenden, Angehörigen ethnischer Minderheiten, Dissidenten, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Gewerkschafter, Organisatoren der Zivilgesellschaft und friedlichen Demonstranten in China und darüber hinaus.”
Ein großer Teil der bereits bestehenden Visabeschränkungen gegenüber chinesischen Beamten wurde von der Trump-Administration verhängt. Sie wollte damit die Verfolgung uigurischer Muslime in Xinjiang sowie die Verhaftungen von demokratischer Aktivisten in Hongkong und Tibet ahnden. Erst in der vergangenen Woche hatte das US-Justizministerium Anklage gegen fünf Männer erhoben, die im Namen der chinesischen Regierung versucht haben sollen, chinesische Dissidenten in den USA zu verfolgen und zu schikanieren. fpe
Wegen der anhaltenden Handelsblockade sind die Exporte des EU-Staats Litauen nach China Anfang 2022 drastisch gefallen. Im Januar und Februar gingen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 88,4 Prozent auf 9,5 Millionen US-Dollar zurück, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Seit Anfang Dezember hat die Volksrepublik litauische Ware im Zollsystem blockiert. Welche Güter es in den ersten beiden Monaten trotz der Blockade offenbar nach China schafften, schlüsseln die Daten nicht auf. Auch ob die Waren eingeführt oder lediglich beim Zoll angemeldet wurden, ging aus den Zahlen nicht hervor.
Laut den Zolldaten sanken zudem die Exporte aus der Region Xinjiang in die 27 EU-Staaten im Januar und Februar um 44,5 Prozent von 146 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun nur noch 81 Millionen US-Dollar. Die Ausfuhren von Xinjiang nach Deutschland gingen demnach um 29 Prozent zurück. Das größte Importvolumen von Xinjiang in einen EU-Staat entfiel im Januar und Februar auf Tomatenmark für Italien.
Die EU arbeitet derzeit an einem EU-Lieferkettengesetz, im Rahmen dessen vor allem Importe aus Xinjiang unter stärkere Kontrolle fallen werden. ari
Die Übernahmeaktivitäten chinesischer Investoren in Deutschland und Europa haben wieder leicht zugenommen. 2021 kauften chinesische Firmen nach einer neuen Analyse der Unternehmensberatung EY 155 europäische Unternehmen für insgesamt 12,4 Milliarden Dollar. Das waren 23 Übernahmen mehr als 2020 – aber nur halb so viele wie im Übernahme-Boomjahr 2016. Der größte Deal des Jahres in Europa war demnach der Verkauf der Philips-Hausgerätesparte in den Niederlanden für 4,3 Milliarden Dollar an das chinesische Finanzhaus Hillhouse Capital Group. Großbritannien löste laut EY erstmals Deutschland als Top-Ziel chinesischer Übernahmen ab. 36 Firmen gingen dort in chinesische Hände über.
In Deutschland übernahmen chinesische Investoren laut der am Dienstag vorgestellten EY-Studie im vergangenen Jahr 35 Firmen für gut zwei Milliarden Dollar, gegenüber 28 in 2020. In der Rangliste ausländischer Firmenkäufer in Deutschland lag China damit aber nur auf Platz 9. An erster Stelle standen US-Unternehmen mit 284 Akquisitionen. Nicht enthalten in diesen Zahlen sind laut EY allerdings Risikokapitalinvestitionen von 1,9 Milliarden Dollar in deutsche Start-ups, an denen sich chinesische Firmen im Rahmen internationaler Investorengruppen beteiligten.
“Chinesische Unternehmen bleiben bei ihren Investitionen in Europa insgesamt noch zurückhaltend”, sagte Sun Yi, Leiterin der China Business Services bei EY in Westeuropa, am Dienstag in Stuttgart. Das liege nicht nur an der Pandemie. “Die meisten chinesischen Unternehmen, die schon im Ausland Firmen übernommen haben, waren in den letzten Jahren eher damit beschäftigt, die Restrukturierung in Europa voranzutreiben als weiter zu expandieren.” Die Zahl der Übernahmen in klassischen Industriesektoren ging 2021 minimal von 36 auf 35 zurück. “Nach wie vor besteht bei chinesischen Investoren Interesse an europäischen Automobilzulieferern oder Maschinenbauern”, so Sun – allerdings inzwischen eher in den Subsektoren Elektromobilität, Autonomes Fahren und High Tech-Materialien.” ck
Die Omikron-Welle breitet sich in Nordostchina offenbar immer weiter aus. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen haben die Behörden am späten Montagabend auch Shenyang in den Lockdown geschickt. Die neun Millionen Einwohner der Provinzhauptstatdt von Liaoning dürfen ihre Wohnanlagen demnach nur mit einem aktuellen negativen Corona-Test verlassen. Shenyang ist die wichtigste Wirtschaftsmetropole des Nordostens. Dort hat BMW eines seiner größten Werke weltweit; auch viele Zulieferer sind dort aktiv.
Die benachbarte Provinz Jilin ist nach wie vor der größte Corona-Hotspot des Landes. Dort gilt in der Provinzhauptstadt Changchun und der gleichnamigen Stadt Jilin eine Ausgangssperre. Chinas Gesundheitsbehörden meldeten am Dienstag landesweit knapp 4800 neue Infektionsfälle, etwas mehr als am Montag. Die meisten von ihnen wurden wie auch in den letzten Tagen in Jilin nachgewiesen.
Dass Shenyang mit nur 47 täglichen Neuinfektionen in den Lockdown muss, zeigt die hochgradige Nervosität der Behörden. Die Impfquote unter den Älteren ist niedrig: Nur 51 Prozent der über 80-Jährigen sind mindestens doppelt geimpft (China.Table berichtete). Auch bringt die hochansteckende Omikron-Variante das Gesundheitssystem inzwischen an seine Belastungsgrenzen. In Jilin waren am Montag laut AFP die ersten 10.000 Dosen des oralen Covid-Medikaments Paxlovid des US-Konzerns Pfizer eingetroffen. Es wäre das erste Mal, dass Paxlovid in China eingesetzt wird.
Unterdessen erteilte Chinas Covid-Zar Liang Wannian Lockerungen der strikten Null-Covid-Politik eine Absage. “Es sollte kein Jota der Entspannung geben, da wir das hart erarbeitete Erreichte in Ehren halten müssen”, sagte Liang, ein erfahrener Epidemiologe, der Chinas Covid-Reaktion seit Beginn der Pandemie leitete und kürzlich als Corona-Krisenmanger nach Hongkong geschickt wurde. Um mit der leicht übertragbaren Omikron-Variante Schritt zu halten, könnten die Maßnahmen aber verfeinert werden, um gezielter und schneller eingesetzt zu werden, sagte Liang am Dienstag laut Bloomberg.
Hongkong hatte trotz anhaltend hoher Inzidenzen am Montag einige seiner strengen Null-Covid-Regeln gelockert. Und auch in China gibt es immer wieder Experten, die ein weniger strikteres Regime mit geringeren Auswirkungen auf die Wirtschaft befürworten. Shenzhen hob am Montag nach einer Woche den Lockdown auf, mit Ausnahme des Bezirks Futian. Shanghai versucht derweil, mit gezielten Lockdowns in einzelnen Gegenden eine Abriegelung der gesamten Stadt abzuwenden. ck

Das internationale Welthandelssystem ab Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 2000er Jahre hinein war nicht nur von der Idee der Liberalisierung, sondern auch der Zurückdrängung von (macht-)politischen gegenüber ökonomischen Aspekten geprägt. Als Sinnbild dafür standen u.a. die Meistbegünstigungsklausel und der institutionalisierte Streitbeilegungsmechanismus der WTO, bzw. des GATT, die eine systematische Benachteiligung kleinerer gegenüber größeren Nationen zumindest einzugrenzen versuchten. Spätestens seit dem Amtsantritt der Trump-Administration werden außen- und handelspolitische Aspekte jedoch weltweit wieder stärker verknüpft, und gewinnen damit Macht- und Größenunterschiede zwischen Staaten auch für die Handelspolitik wieder an Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist die chinesische Erlassung eines de facto-Handelsboykotts gegen Litauen als Folge der Eröffnung eines taiwanesischen Konsulats in der Hauptstadt Wilna unter dem Namen Taiwan (nicht, wie sonst praktiziert, Taipeh).
Die Tatsache, dass der Sanktionscharakter der Maßnahmen von chinesischer Seite nicht offiziell eingeräumt wurde, kann als Versuch gedeutet werden, diese von multilateralen Standards, insbesondere jenen der WTO, fernzuhalten und sich in erster Linie auf eine bilaterale Machtdemonstration gegenüber Litauen zu verlegen. Allerdings solidarisierte sich die Europäische Union rasch mit Litauen und stellte damit eine im Wesentlichen wieder symmetrische Konstellation her, auch wenn keine Gegensanktionen erlassen wurden.
Die EU initiierte im Weiteren ein Verfahren vor der WTO, dessen Potenziale aber begrenzt sind: erstens kann eine WTO-basierte Berechtigung zu unilateralen handelspolitischen Schutzmaßnahmen der EU (zum Beispiel höhere Zölle gegen unrechtmäßig subventionierte Importprodukte) aus dem Profil der chinesischen Sanktionen nicht abgeleitet werden. Zweitens kann eine Urteilsfindung erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Drittens wäre auch im Falle eines Urteils im Sinne der EU dessen Durchsetzung in letzter Konsequenz nur in Form von autorisierten Vergeltungsmaßnahmen möglich.
Solche Maßnahmen waren bei WTO-Verfahren bis jetzt zwar nur in einer kleinen Minderheit der Fälle notwendig; sie sind im Fall der Nichtumsetzung eines Urteils durch den Beklagten, was im vorliegenden Fall für China durchaus nicht unrealistisch erschiene, für die Gegenpartei aber die einzige Möglichkeit, zu ihrem Recht zu kommen. Gleichzeitig bergen sie erhebliches neues Konflikt- und Verzögerungspotenzial und rücken wiederum Größenunterschiede zwischen den Konfliktparteien in den Vordergrund; der Wert der WTO als institutionalisierte Streitbeilegungsinstanz wird dadurch erheblich vermindert.
Die Europäische Union selbst wurde durch die litauischen Maßnahmen vor ein Dilemma gestellt, das für den europäischen Integrationsprozess typisch ist. Einerseits war eine Reaktion auf europäischer Ebene aufgrund der Integrität des Binnenmarkts und der handels- und investitionspolitischen Außenkompetenz der Union folgerichtig. Andererseits beschloss die Regierung Litauens ihre Linie im Rahmen der weiterhin bestehenden außenpolitischen Souveränität der Mitgliedstaaten und stimmte sich nicht mit anderen Mitgliedstaaten ab. Diese tragen damit die potenziellen negativen Folgewirkungen einer Politik, über die sie nicht entschieden haben.
Die Haltung Litauens ist aus interner Perspektive durchaus konsistent. Bereits im Herbst 2020 erfolgten erste Signale in Richtung eines Ausbaus der Beziehungen zu Taiwan; im Frühjahr 2021 verließ Litauen das “17+1”-Format osteuropäischer Staaten mit China, einem Instrument regionaler Einflussnahme Chinas unter anderem im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative. Politische Spielräume waren für Litauen auch insofern gegeben, als seine wirtschaftlichen Beziehungen mit China von vergleichsweise geringer Bedeutung für die litauische Gesamtwirtschaft sind. Dies unterscheidet die litauische Position deutlich von der gesamteuropäischen – beispielsweise ist China inzwischen der wichtigste Import- und drittwichtigste Exportpartner der EU – und jener größerer Mitgliedstaaten, zum Beispiel Deutschlands und Frankreichs. Zumal die chinesische Reaktion auf die Vorgänge in Litauen im Rahmen der jahrzehntelang gepflegten “Ein-China-Politik” keineswegs überraschend kam, hätte diesbezüglich auf gesamteuropäischer Ebene durchaus Diskussions- und wohl auch Entscheidungsbedarf bestanden.
Damit zeigt sich, dass gerade in der Situation einer stärkeren machtpolitischen Prägung der internationalen Handelspolitik der (bereits erfolgte) Integrationsschritt einer Vereinheitlichung der Handels- und Investitionspolitik die Notwendigkeit einer (künftigen) Vereinheitlichung weiterer Bereiche der Außenpolitik nach sich zieht.
Im Ergebnis ist ein einheitliches europäisches Auftreten im Zuge der internationalen Politisierung der Handels- und Investitionsströme notwendiger denn je, nicht zuletzt, um auch den Schutz kleinerer Mitgliedstaaten vor externen Repressionen sicherzustellen. Soll dieses Auftreten effektiv sein, ist aber eine europäische Integration breiterer außenpolitischer Kompetenzen unabdingbar. Die jüngsten Schritte in Richtung eines neuen handelspolitischen EU-Instruments gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittländern können hierfür nur ein Anfang sein.
Dieser Gastbeitrag erscheint im Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Am Donnerstag (24.03.) geht es mit Christian Hederer von der Technischen Hochschule Wildau und Jürgen Matthes vom IW Köln um das Thema: “EU-China-Handelskonflikte und der Fall Litauen: Welche Rolle spielt die WTO?”. Moderatorin ist unsere Redakteurin Amelie Richter. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.
Weijian Shan, Executive Chairman der Investmentgruppe PAG, wird unabhängiger Direktor im Board der Alibaba Group Holding Limited. Er löst Börje Ekholm, Präsident und Chief Executive Officer der Ericsson Group, ab, der am 31. März 2022 aus dem Board ausscheiden wird. Ekholm ist seit Juni 2015 als unabhängiger Direktor für Alibaba tätig.
Wang Xiaozhen wird neuer Vizepräsident der China Media Group, des mächtigsten staatlichen Medienunternehmens der Volksrepublik. Die China Media Group ging 2018 aus einer Fusion staatlicher Medienunternehmen wie China Central Television, China National Radio und China Radio International hervor. Sie steht unter direkter Kontrolle der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei.

Die Tujia leben in den Hügeln Südwestchinas, und besitzen ebenso wie viele ethnische Minderheiten der Region eine reiche Tradition an farbenfroher Webkunst. Viele dieser Traditionen, wie auch die der benachbarten Miao, gehen allmählich verloren, da die jungen Leute sie nicht mehr erlernen. Hier weben Frauen in einem Studio in der Stadt Xiaonanhai nahe Chongqing Stoffe aus Xilankapu, einer Art Tujia-Brokat. Xilankapu-Webereien sind in China bekannt als Bettdecken mit Blumenmuster und wurden 2006 in das nationale immaterielle Kulturerbe aufgenommen.
