pünktlich zum Beginn der Koalitionsverhandlungen liegen die Probleme der Bildungs-Digitalisierung vergrößert wie unter einem Brennglas. Es fehlt an Strukturen und Geld, um die Schulen aus ihrem digitalen Dornröschenschlaf zu erwecken. Unterbrochen wurde er bisher nur dort, wo mutige Pädagogen in den Pandemie-Monaten einfach mal losgelegt haben, ohne allzu viel auf Vorschriften und Haushaltsordnungen zu geben.
Nun wehren sich ausgerechnet in Brandenburg, der Heimat von Deutschlands oberster Kultusministerin, die Kommunen, für ihr Lehrpersonal Laptops und Tablets anzuschaffen, ohne dass ihnen dafür auch die laufenden Kosten für Betrieb, Reparatur oder Neubeschaffung im föderalen Finanzgeflecht zuerkannt werden. Finden die Bundesländer nicht sehr schnell gemeinsam mit dem Bund eine Lösung, werden sich Bürgermeister anderenorts dem Boykott anschließen. Zwecklos zu fragen: Hätte man das Problem nicht schon lange klären können?
Eine – zugegeben – rhetorische Frage, die auch das Datenschutzproblem betrifft. Denn auch mit der Sicherheit der Daten stehen Lehrerinnen und Lehrer ziemlich alleine da. Nun allerdings macht der Datenschutzbeauftragte Lutz Hasse in Thüringen einen ersten Schritt auf die Schulen zu.
Die Themen liegen auf dem Tisch, wenn die Arbeitsgruppen von SPD, Grünen und FDP heute ihre konkreten Gespräche für das politische Arbeitsprogramm der kommenden vier Jahre starten. Für das Themengebiet “Bildung und Chancen für alle” sitzen am Verhandlungstisch: Für die SPD Andreas Stoch, Ties Rabe, Stefanie Hubig, Oliver Kaczmarek. Für die Grünen: Felix Banaszak, Theresa Schopper, Anke Erdmann, Lasse Petersdotter. Für die FDP: Jens Brandenburg, Björn Försterlin, Yvonne Gebauer und Thomas Sattelberger.
Christian Füller und sein Redaktionsteam von Bildung.Table haben auch in dieser Woche die aktuellen Entwicklungen für Sie zusammen getragen. Sie klären über die Hintergründe auf und geben Hinweise für Praktiker, von Terminen für Lehrerfortbildung bis zu didaktischen Erfahrungsberichten. Wenn Sie mich fragen: Pflichtlektüre für Koalitionsverhandler und Lehrende zugleich.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), wollte 2021 zum Jahr der Digitalisierung der Schulen machen. In ihrem eigenen Bundesland erleidet sie nun einen schweren Rückschlag: Der Städte- und Gemeindebund will keine weiteren Dienstgeräte für Lehrkräfte anschaffen, wenn nicht vorher die Folgekosten geklärt werden. In einem Schreiben an seine Mitglieder, das Bildung.Table vorliegt, wird ultimativ erklärt: “Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg lehnt die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte, die in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis mit dem Land Brandenburg stehen, nach wie vor ab und rät seinen Mitgliedern von der Inanspruchnahme des Förderprogramms ab.” Das könnte Auswirkungen auf alle Bundesländer haben.
Damit steht die digitale Bildung nämlich insgesamt vor einer Zäsur. Der selbstbewusste Brandenburger Kommunalverband will nicht nur für sein Bundesland eine Änderung, sondern eine generelle. “Wir haben das Geld regelmäßig weder in den Haushalten noch in der Finanzplanung veranschlagt. Die Frage der Aufgabenverantwortung muss grundsätzlich geklärt werden,” sagte Geschäftsführer Jens Graf Bildung.Table. “Wir können nicht für vom Land beschäftigte 20.000 Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg Dienstgeräte anschaffen, die mit hohen Folgekosten verbunden sind.”
Was Graf meint, ist die Grundsatzfrage, die besonders seit der Ausrufung des Dienstgeräteprogramms mitten in der Coronavirus-Pandemie auf die Tagesordnung kam: Wer ist eigentlich für die Kosten der Digitalisierung der Schulen zuständig? Sind es Schulträger, die prinzipiell für die Sachausstattung der Schulen gerade stehen? Oder sind es die Bundesländer, die qua Verfassung die generelle Zuständigkeit für Schulen beanspruchen? Beim Geld tun sie das allerdings immer seltener. “Das Land kann sich gerade bei den Lehrer-Dienstgeräten nicht aus seiner Verpflichtung als Dienstherr der Lehrkräfte stehlen”, sagt Graf dazu.
Bei den Dienstgeräten für Lehrer wird exemplarisch deutlich, wie verworren die Zuständigkeiten bei Schule sind: für das Personal der Schulen, also die Lehrer, sind normalerweise die Länder verantwortlich – die sich aber nicht die Kosten für die Administration, die Reparatur oder gar die Ersatzbeschaffung aufhalsen lassen wollen. Die Städte und Gemeinden wiederum sagen, dass sie für die Dienstgeräte der Lehrer schlicht nicht zuständig sind. “Für unsere Mitgliedsstädte und Gemeinden haben die Dienstgeräte jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht,” betonte Geschäftsführer Graf. “Die Digitalisierung des Schulwesens erfordert eine Verständigung über Aufgaben und Standards sowie eine Anpassung der rechtlichen Grundlagen.” Das wisse jeder, bisher sei aber nichts in dieser Richtung geschehen. Deswegen trete Brandenburgs Städte- und Gemeindebund in Kontakt mit anderen Kommunalverbänden, um eine grundsätzliche Klärung herbeizuführen.
In einem Interview mit Bildung.Table hatte der Verhandlungsführer der Länder für die Digitalisierung, Mecklenburg-Vorpommerns Staatssekretär Steffen Freiberg (SPD), vor einem solchen Konflikt gewarnt: “Die Idee einer guten Lösung sollte man zuerst an der guten Lösung festmachen und erst danach überlegen, wie man an das notwendige Geld kommt oder wer bezahlt.” Auf Deutsch: Streit bringt keinen weiter. Dennoch gibt es bei der Vergabe von Dienstgeräten immer wieder große Probleme. In Brandenburg ist der Punkt jetzt aber erreicht, an dem die Kommunen wissen wollen, wer wirklich zuständig für die Finanzierung der Dienstgeräte ist. Das könnte eine Lawine von Beschwerden der Kommunalverbände quer durch die Republik auslösen.
“Die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte obliegt nicht dem Schulträger, sondern dem Arbeitgeber,” steht in dem Schreiben des Potsdamer Kommunalverbandes an seine Mitglieder. Das sei so im brandenburgischen Schulgesetz verankert. Den Städten und Gemeinden würden nicht gedeckte Folgekosten angelastet. Dazu gehören die Administration, die Softwareausstattung und die Ersatzbeschaffung der Notebooks. “Es wird geschätzt, dass die Fördermittel ca. 20 Prozent der letztlich auflaufenden Gesamtkosten decken werden,” schreiben die Kommunen. In Brandenburg soll jetzt ein IT-Rat, in dem die Regierung mit mehreren Ministerien und die kommunalen Verbände vertreten sind, einen Ausweg finden. Auf diesen Potsdamer Konferenzen steht dann die Digitalisierung der Schulen in ganz Deutschland auf der Kippe.
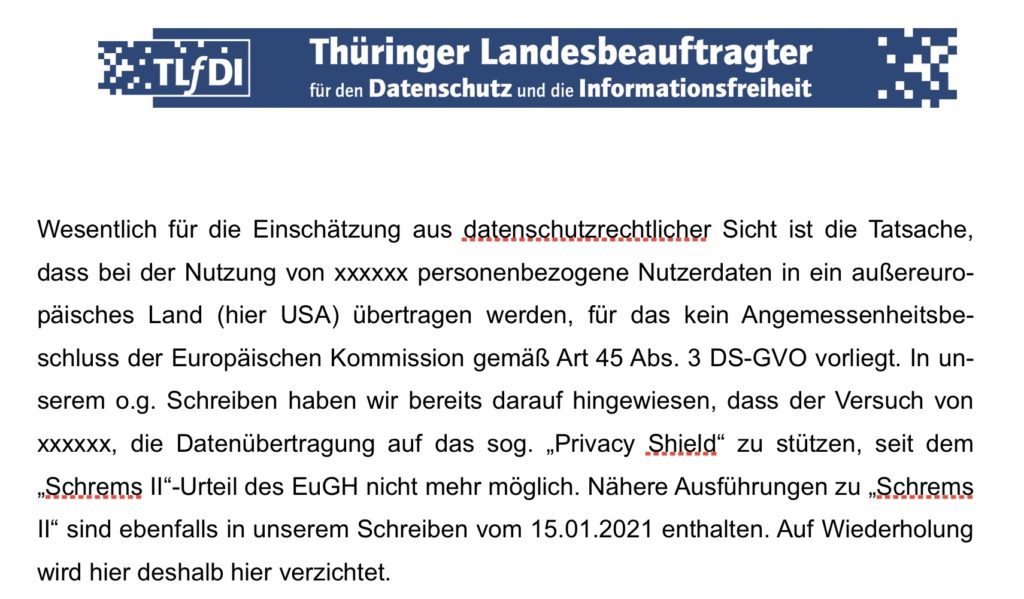
Es hat gedauert, aber nun ist es so weit. Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse hat den Schulen des Landes konkrete Empfehlungen zur Rechtskonformität von einem halben Hundert pädagogischer Anwendungen gegeben. Damit liegt eine erste große Aufstellung von Anwendungen vor, die Lehrer:innen unbedenklich im Unterricht nutzen können. Verlangt wird eine solche Orientierung schon lange. Grund für Hasses Intervention war die Notlage der Schulleiterinnen und Schulleiter während der Corona-Pandemie. “Wir haben Anfragen von Schulen bekommen – und diese Anfragen haben wir gespiegelt und an alle Schulen in Thüringen herausgegeben”, sagte Hasse zu Bildung.Table. “Das bedeutet, dass die Thüringer Schulen etwa 45-50 Produkte kennen, die aus datenschutzrechtlicher Sicht geeignet sind – oder eben nicht.” Allerdings gibt es strenggenommen keine zusammenhängende öffentliche Liste. Die Angaben seien nur für den Gebrauch in der Schule, betonte Hasse.
Bildung.Table konnte einige der Empfehlungen einsehen. “Die Nutzung ist auf der Grundlage des aktuellen Wissensstands bei Beachtung der genannten Kriterien derzeit aus Sicht des TLfDI [Datenschutzbeauftragter Thüringen, Red] als zulässig anzusehen”, heißt es zum Beispiel in einem der Papiere. Unter anderem haben Hasses Mitarbeiter die App “Anton” und die Anwendung “Mundo” auf ihre Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unter die Lupe genommen.
Zuletzt hatte der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) scharfe Kritik an den Datenschutzbeauftragten der Länder geübt, weil sie sich nicht auf eine einheitliche Empfehlungen für Schulen einigen könnten. Auch die Zusammenstellung von Lutz Hasse dürfte die Kritiker des Datenschutzes nicht vollständig zufrieden stellen. Denn die Thüringer Hinweise sind nur für den Dienstgebrauch der Schulen gedacht. Im Gespräch mit Bildung.Table wies der Sprecher der Arbeitskreise für Bildung und Medienkompetenz der Datenschutzkonferenz darauf hin, dass negative Empfehlungen gerade bei den großen US-Anbietern schnell zu Problemen führten.
Die bisher weitestgehende Liste hatte Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk über Videosysteme veröffentlicht. Smoltczyk, deren Amtszeit heute endet, bekam dafür Kontra gerade von US-Konzernen. Sie gab freilich nicht nach. Lutz Hasse hatte, ehe er seine gesammelten Hinweise herausgab, ein ähnliches Erlebnis. “Ich habe mich zu einem Produkt von Google mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt: ˋDas ist jetzt aber komplett datenschutzwidrig, das verwenden wir in Thüringen nicht mehr.ˋ Und dann haben sie natürlich drei Tage später die Kronjuristen für Player Deutschland an der Backe”, erzählte Hasse vergangenen Donnerstag auf der Buchmesse in Frankfurt. “Es erfordert unheimlich viel Aufwand, sich dem Widerstand, den man dann bekommt, zu widersetzen und darzulegen, dass man selber Recht hat.” Deswegen sei er nun den Weg gegangen, nur eine schulöffentliche Liste herauszugeben, “die ja auch ihren Zweck erfüllt.”
Hasses Schilderung verweist auf das grundsätzliche Problem: Die Datenschutzbehörden der Länder sind personell und technisch zu schlecht ausgestattet, um derartige Auseinandersetzungen gegen Milliarden-Konzerne durchstehen zu können. “Es wäre wichtig, wenn die Landesdatenschützer besser ausgestattet wären und eine sichere Rechtsgrundlage hätten”, sagte Hasse Bildung.Table. “Dann wäre das am Ende auch für Schulen einfacher.”
Wie kritisch Hasses Bemerkungen ausfallen, konnte Bildung.Table begutachten. In einem der Schreiben für Thüringens Schulen heißt es über eine US-Anwendung: “Wie ersichtlich ist, sind die rechtlichen Hürden und der Aufwand für den Einsatz von xxxxxx so hoch, dass gegenwärtig eine Nutzung durch Schulen unmöglich ist.” Zu dem Schluss kam der Datenschutzbeauftragte in diesem Fall, weil “personenbezogene Nutzerdaten in ein außereuropäisches Land (hier USA) übertragen werden, für das kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gemäß Art 45 Abs. 3 DS-GVO vorliegt.” Dass bei dem US-Instrument Nutzerdaten auch an Dritte fließen, so steht es in der Information für die Schulen, sei für jedermann einfach nachweisbar. Eine dem Schreiben beigefügte Untersuchung zeige die Einbindung einer “Vielzahl von Tracking-Instrumenten von Drittanbietern, die für den Zweck der Plattform (Bereitstellung von Informationen vom Nutzer für andere Nutzer) nicht erforderlich sind.”
Hasse machte gegenüber Bildung.Table nun Hoffnung darauf, dass die Datenschutzbehörden bei den US-Anbietern auf dem Weg zu einer einheitlichen Meinung seien. Er habe auch mit der Kultusministerkonferenz den Schulterschluss gesucht. Ergebnis ist, dass es mit einem amerikanischen Anbieter weitere Gespräche geben soll. “Die Gespräche sind aber leider nicht zielführend,” berichtete Hasse seine bisherigen Erfahrungen. Auf der Frankfurter Buchmesse empfahl er Anbietern, frühzeitig mit den Datenschutzbeauftragten zusammenzuarbeiten. Hasse nannte dafür als gutes Beispiel die Brandenburger “Schulcloud”, wo das gelungen sei. Und als schlechtes Beispiel Microsoft. Landesdatenschützer Stefan Brink aus Baden-Württemberg habe zusammen mit dem Konzern aus den USA nachmessen wollen, welche Daten für die Entwicklung des Cloud- und Office-Systems Microsoft MS 365 fließen. “Dann finden wir in Gesprächen mit großen Playern nicht heraus, was damit gemeint ist,” sagte Hasse auf der Messe. “Das ist der Knackpunkt.”
Für diese Äußerung wurde Datenschützer Hasse nun scharf kritisiert. “Datenschutzbeauftragte deutscher Bundesländer erwarten allen Ernstes, dass ein Tech-Weltkonzern seine Betriebsgeheimnisse mit ihnen teilt,” hieß es in einem Online-Portal. Kooperierten die Konzerne nicht, rieten Datenschutzbeauftragte davon ab, Produkte zu nutzen, die millionenfach selbstverständlich im Einsatz seien. “Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht um festgestellten Missbrauch von Schülerdaten. Den gibt es nämlich nicht”, war der Kommentator überzeugt. Hasse widersprach dem freundlich, aber bestimmt. “Zur Frage, ob tatsächliche Rechtsverstöße vorliegen, empfehle ich die Lektüre des aktuellen Gutachtens meines Kollegen aus Baden-Württemberg, das eine klare Sprache spricht”.
Datenschutz wird sicher auch in den Koalitionsverhandlungen Thema werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Listen mit erlaubten Anwendungen verlangt. “Sie können mir glauben, dass ich mit dem Bundes-Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber und seinen Länderkollegen in einem intensiven Gespräch bin, was da machbar wäre.” Christian Füller

Herr Ganten, was sollte in den Koalitionsverhandlungen zu digitaler Bildung besprochen werden?
Wir reden die ganze Zeit darüber, wie viel Geld in die Schulen fließen soll und wie die technischen Grundvoraussetzungen für digitales Lernen zu erreichen sind. Ich finde, darüber sollte man gar nicht mehr reden müssen. Es muss doch heute selbstverständlich sein, dass für alle Menschen und Unternehmen vernünftige Internet-Anschlüsse da sind – überall in der Republik.
So ist es aber nicht.
Was mir als Bürger mehr Kopfzerbrechen bereitet: Wie kriegen wir das hin, Bildung anders zu organisieren? Bei den Fragen der digitalen Bildungsinfrastruktur oder bei “Schulbuch oder OER?” touchieren wir noch nicht mal den wichtigsten Punkt: Wie kann es gelingen, dass Menschen durch das Schulsystem zu interessierten, gestaltungsfähigen und gestaltungswilligen Persönlichkeiten werden?
Hat das was mit Digitalisierung zu tun?
Ja, denn wir können Schule heute nicht mehr so denken wie zu der Zeit, als es digitale Tools und Möglichkeiten nicht gab. Konkret heißt das, dass Lehrkräfte ein Verständnis von ihrer neuen Rolle bekommen müssen. Dass sie nicht mehr die allwissenden Vermittler geben, sondern eher Coaches im Lernprozess von Schülerinnen und Schülern sind, die sich ihren Weg selbst zum Wissen bahnen. Menschenentwickler im besten Sinne. Was nutzt uns die schönste Digitalisierung, wenn wir weiter preußischen Schulunterricht machen wollen!
Wie soll etwa Lehrerfortbildung in Zukunft besser organisiert werden?
Ich glaube, man muss sich von vielen alten Zöpfen trennen und eine moderne Lehrerfortbildung aufbauen. Die zeichnet sich auch dadurch aus, dass Lehrer:innen viel seltener sagen: “Tschüss, ich bin jetzt eine Woche auf Fortbildung!”
Sondern?
Es geht um Formate – die es übrigens an vielen Schulen schon gibt -, die Lehrer begleitend zum Unterricht belegen können. Wo sie in eigener Anschauung lernen, dass man mit digitalen Tools und Zugängen oft schneller und mit mehr Begeisterung bei den Schülern umsetzbares Wissen erzeugt. Es gibt viele Beispiele von Unternehmen, die kontinuierliche Weiterbildungsprozesse organisieren. Wieso sollte man die nicht auch in der Schule einsetzen können?
Wie kann man die Schulträger, die im Moment die Hauptinvestitionslast bei der Digitalisierung tragen, in die Lage versetzen, die sehr teure Digitalisierung auch zu finanzieren?
Wir können davon ausgehen, dass alle Beteiligten jetzt wissen, dass man den Digitalpakt verstetigen muss. Das kann keine einmalige Ausgabe sein, und das steht im Sondierungspapier auch schon so drin. Ich glaube also, es liegt nicht am Geld. Das Problem ist in der Tat, dass das ganze System viel zu komplex ist. Kleine Schulträger können die Digitalisierung nicht allein bewältigen, die Kommunen, geschweige denn die Schulämter haben oft das IT-Knowhow gar nicht, um das hinzukriegen. Es gilt grundsätzlich, dass viel zu viele komplizierte Überlegungen angestellt werden müssen, um den Digitalpakt umzusetzen. Auch sehr relevante Fragen in Bezug auf Datenschutz und digitale Souveränität sind sinnvoll zu beantworten, und zwar so, dass keine Sackgassen entstehen, aus denen man später nicht wieder herauskommt. Damit sind eigentlich alle überfordert.
Wie könnte man das anders besser machen?
Kurz gesagt, müsste man das ganze Beschaffungswesen vereinfachen. Wozu brauchen wir zum Beispiel noch die Medienentwicklungs- und Nutzungspläne? Es wissen doch jetzt alle, was sie brauchen. Wir machen ja auch keine Toilettennutzungspläne. Da würden sich alle tot lachen, wenn wir sagen würden, schreib erst mal ein Plan für Wasserklosetts und Waschbecken. Die werden gebraucht und die werden eingebaut – das Gleiche muss für die digitale Infrastruktur an Schulen gelten.
Das sagt sich so leicht, aber wie geht das?
Vielleicht müsste der Bund ein zentrales IT-Kaufhaus für Schulträger errichten, das die wesentlichen Komponenten für Schulen bereithält – vom Glasfaseranschluss bis hin zu ordentlichen Wlan-Access-Points, welche die ganze Schule ausleuchten. Das wären alles IT-Standard-Lösungen. Wichtig ist, dass die Lösungen hinsichtlich der Sicherstellung von Datenschutz und digitaler Souveränität für das Schulsystem vorgeprüft sind und dass Kompatibilität mit anderen Lösungen Pflicht ist. Und das muss dann über extrem einfache Beschaffungsverfahren abgewickelt werden.
Also Schluss mit Wettbewerb?
Nein, Wettbewerb muss sein. Wir wissen nicht genau, wo wir mit der Digitalisierung in zehn Jahren gelandet sein werden. Das bedeutet, man braucht – bei aller Standardisierung – verschiedene Lösungen und Zugänge.
Welches sind die Standards und wo gelten sie?
Es muss Basisdienste beim Thema ID-Management, bei der Frage der Datenspeicherung und bei der Inhalte-Bereitstellung geben. Die Lösungen dafür muss nicht jeder Schulträger neu erfinden. Sowas kann es einmal zentral z.B. in jedem Bundesland geben. Wichtig ist, dass wir eine grundsätzliche Architektur bekommen, die Föderation ermöglicht. Das heißt, wenn im Bundesland Bremen ein System läuft, muss man es interoperabel mit einem System verschalten können, das in Sachsen oder in Bayern läuft.
Sie haben vor über vier Jahren ein ID-Management für die ganze Republik vorgeschlagen, das immer noch nicht fertig ist. Sollen die Länder weiter an dem “Vermittlungsdienst digitale Schule”, kurz Vidis, herumbasteln? Oder sollte man das dem Bund geben?
Wir brauchen eine grundlegende Architektur und die benötigen wir nicht fünf oder sechs Mal, sondern sie muss die Voraussetzung erfüllen, dass verschiedene Systeme miteinander föderiert werden können. Ob die Architektur von einer GmbH entwickelt wird, die zufällig den Ländern gehört, oder ob das der Bund macht, ist zweitrangig. Und auch wir treiben eine solche Architektur mit einem “ID-Broker” im Auftrag des Landes Bremen anderen Partnern wie, dem Verband-Bildungsmedien, weiter voran – nicht gegen das Medieninstitut der Länder FWU, sondern als Baustein einer Gesamtarchitektur miteinander föderierbarer und auf offenen Standards basierender Systeme.
Sie sind nicht glücklich darüber, was mit ihrer Ursprungsidee passiert ist: Die lag ewig in den Schubladen der Länder.
Da haben Sie natürlich völlig recht. Nur müssten Sie jetzt dann auch den Beweis antreten, dass der Bund so wahnsinnig viel besser und schneller arbeitet. Das Grundproblem ist doch, dass öffentliche Verwaltung bei IT-Projekten sich bisher nicht mit Ruhm bekleckert hat. Wir sind bei der Digitalisierung irrsinnig langsam. Das ist aber kein schulspezifisches Problem. Wir müssen mehr Speed in die Digitalisierung insgesamt kriegen.
Wie ginge das bei Vidis?
Vidis ist jetzt in der Pipeline. Es würde überhaupt nichts bringen, das jetzt noch mal neu auszuschreiben. Die sind auf dem Weg und die haben gute Leute an Bord. Aber wie oben schon erwähnt: Wettbewerb ist dennoch wichtig: Wir stellen unsere Entwicklungen der Allgemeinheit unter Open-Source-Lizenzen zur Verfügung. Das kann dann vom Medieninstitut der Länder (FWU) aber auch von anderen genutzt werden, um Lösungen zu schaffen.
Wenn Sie Chief Information Officer der Bundesregierung wären, wie würden Sie digitale Bildung beschleunigen?
Ich bin für diesen Posten nicht verfügbar und glaube, dass es geeignetere Personen gäbe. Abgesehen davon, sind wir da bei den grundsätzlichen Fragen. Wir müssen schneller loslegen, wir müssen mehr experimentieren können. Dafür brauchen wir eine stabile Grundlage, also eine Architektur mit Grundregeln, die von Ländern und Schulträgern sowie allen wichtigen Anbietern getragen wird. Wir müssen Open Source zum Grundprinzip bei der Softwareauswahl machen, um ausprobieren und in schnellen Zyklen verändern, um Kompatibilität herzustellen und teilweise lähmende Herstellerabhängigkeiten leichter überwinden zu können. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch als Staat die besten Leute akquirieren und einstellen können, nicht um alles nochmal selber zu erfinden, sondern um als wirklich kompetente Auftraggeber zu agieren.

Ein Gastbeitrag von Bob Blume
Ich halte es für unangemessen, “Squid Game” als Allegorie auf unser Schulsystem zu lesen. In der Netflix-Serie geht es um eine von einer reichen koreanischen Elite initiierte Spiele-Reihe auf Leben und Tod. Wer eines der in Korea bekannten Kinderspiele verliert, wird getötet. Egal, wie differenziert der Autor Philippe Wampfler im einzelnen begründen mag, was er mit seinem Vergleich evoziert: 800.000 Lehrer:innen in Deutschland kommen in den Ruch der riesigen Squid-Puppe, die Mitspieler mit gezielten Schüssen hinrichtet. Dieser Vergleich ist unverständlich – und unverantwortlich.
Der Schweizer Deutschlehrer und Blogger Philippe Wampfler sichert sich natürlich ab in seiner Gegenüberstellung von Schule und dem Killerspiel. Er will Squid Game nicht als Allegorie auf das Schulsystem als Ganzes sehen, sondern lediglich auf die“Leistungskultur in der Schule” anwenden. Das könnte – so meint man – den unpassenden Vergleich abschwächen, tut es meines Erachtens aber aus unterschiedlichen Gründen nicht.
Philippe führt zunächst an, dass es ja die Schüler selbst seien, die das Squid Game als passend für Schule verwenden würden, weil es immer öfter auf Schulhöfen aufgeführt werde. “Das Nachspielen ist aus meiner Sicht deshalb naheliegend, weil die Leistungskultur der Schule dazu führt, dass sie wie ‘Squid Game’ funktioniert”, schreibt Philippe. “Damit sage ich nicht, dass an Schulen Kinder systematisch umgebracht werden – sondern dass die Serie Aspekte verdeutlicht, die auch in der Schule zu Problemen führen.”
Aus meiner Sicht ergibt sich aus dieser Prämisse des Bloggers eine fragwürdige Argumentationsstruktur. Es ist einfach nicht belegbar, dass Kinder Squid Game nachspielen, weil sie darüber reflektierten, dass damit das Schulsystem gemeint sein könnte. Kinder übernehmen Diskussionen und Memes einfach, weil diese populär sind. That’s it! Keiner würde ernsthaft behaupten, dass Kinder und Jugendliche etwa bei persönlichen Erfolgen einen der “Fortnite-Tänze” nachahmen, weil sie eine Parallele zu ihren Umständen erkennen würden. Nachspielen ist naheliegend, weil es eben medial nahe liegt – aber es gibt keinen inneren Zusammenhang oder auch nur eine Ähnlichkeit, die Kinder zur Nachahmung motivieren würde.
Eine Allegorie aber damit zu beginnen, dass ihr Wesenskern nicht zutrifft, erscheint mindestens fragwürdig. Man könnte auch sagen: fahrlässig. Denn jeder, der Squid Game kennt, weiß um die grausame Pointe der Serie: Menschen entscheiden über Leben und Tod anderer Menschen. Zum Spaß. Das Schulsystem hat gewiss erhebliches Verbesserungspotenzial, keine Frage. Aber die aufgeworfene Parallele ist trotz Philippes knapper Relativierung zynisch und überzogen. Wer zum Beispiel sollen denn im Schulsystem diejenigen sein, die sich am Leid der Sterbenden bzw. schlecht Benoteten erfreuen? Ist es etwa schulische Praxis, dass Lehrer:innen die mit fünf oder sechs benoteten Schülerinnen und Schüler vor der Klasse verlachen und verspotten würden?
Aus meiner Sicht funktionieren also bereits die Prämissen nicht. Aber auch die systemischen Parallelen, die Philippe Wampfler zwischen Squid Game und Schule erkennen will, können meiner Einschätzung nach nicht überzeugen. Er schreibt, in der Schule würden “unmenschliche Formen der Disziplinierung und problematische Formen von Leistungsmessung nach kurzer Zeit von Schüler:innen nicht mehr hinterfragt, sondern als Regel akzeptiert.” Das bedeute, so der Schweizer Lehrer, Schüler akzeptierten den selektiven Grundsatz von Schule: “Wer das nächste Level erreichen und eine Aussicht auf ein erfolgreiches Leben haben will, muss da durch.”
Meines Erachtens funktioniert dieser Vergleich nicht. Schauen wir uns die drei grundlegenden Regeln bei Squid Game an – und vergleichen die Kategorien dann mit Schule:
1. Teilnehmer können das Spiel nicht willkürlich unterbrechen.
2. Spieler, die sich weigern, werden automatisch disqualifiziert.
3. Stimmt die Mehrheit dafür, können die Spiele beendet werden.
Diese Regeln sind innerhalb des Spiels zynisch, weil sie kollektiven Druck auf die Gemeinschaft ausüben. Für das Spiel sind sie gleichwohl auch plausibel, weil sie einen fließenden Ablauf gewährleisten. Schon die “unmenschlichen Formen der Disziplinierung“, die Philippe anführt, sind aber für die heutige Schule grotesk überzogen. Aber auch insgesamt wird hier ein völlig verzerrtes Bild von Schule gezeichnet. Schule baut weder annähernd noch grundsätzlich auf den Grundprinzipien von Squid Game auf. Schule ist per se anders.
Das Argument des zentralen Stücks des Vergleichs von Squid Game und Schule lautet, dass Schüler:innen Dinge lernen müssten, die “nicht sichtbar relevant” sind und “deren Wert sie im Moment nicht beurteilen können”. Philippe schreibt: “So beginnen sie, mechanisch zu lernen. Sie pauken Vokabeln, lernen Seiten aus Büchern und Heften auswendig, um bei der Prüfung irgendwas hinzuschreiben, was hoffentlich noch ein paar Punkte gibt; suchen nach Rezepten, mit denen sie mathematische Aufgaben so abarbeiten können, dass sie aufs richtige Resultat kommen, auch wenn sie die dahinterliegenden Konzepte nicht verstehen. Sie sind wie die Spieler:innen bei »Squid Game«, die nicht mit Murmeln spielen, weil sie dabei Spaß hätten – sondern weil sie nicht anders können.”
Die Argumentation aus diesem Beispiel höre ich ständig. Sie ist, was das Auswendiglernen angeht, aus meiner Sicht aber in den meisten Schulen nicht zutreffend. Der Verweis auf Squid Game ist auch insgesamt wieder deplatziert. Denn in der Serie geht es nicht um eine Note, eine Ziffer oder einen Test. Hier geht es um Leben und Tod, also um die Idee der Serie – und den einzigen Aspekt, um den es ja explizit nicht gehen soll.
Die hier entfaltete Argumentation von Philippe Wampfler klingt zunächst stimmig. Aber schaut man genauer hin, passt die Begründung erneut nicht. “Die Verantwortlichen von »Squid Game« könnten allen Teilnehmenden das Geld geben, das sie für das Spiel aufwenden, wenn sie wollten”, schreibt Philippe. Und “Schulen könnten allen Schüler:innen zeigen, wo ihre Stärken liegen.”
Sollte Schule Schülern zeigen, wo ihre Stärken liegen, anstatt sich an ihren Defiziten zu orientieren? Absolut und ohne Frage. Aber die Parallele ist eben keine. Der Kern von Squid Game ist das Amüsement, das ein superreicher Milliardär und dessen Freunde dabei empfinden, Menschen um Leben und Tod spielen zu sehen. Könnten sie das Geld auch verteilen? Nein, denn dadurch hätten diese Sadisten kein Vergnügen – und das Spiel wäre obsolet. Die Parallele funktioniert insofern genauso wenig, als würde man sagen, dass Werther überlebt hätte, wenn er sich nicht umgebracht hätte. Mag sein, aber: Der Text steht fest. Der Werther ist tot. Die Serie steht fest. Ihr Kern beruht auf dem System, dass es das Geld den Überlebenden schenkt.
Das Squid Game beschreibt Philippe Wampfler so. “Alle Spielenden sollten dieselben Chancen haben. Nur: Das haben sie nicht. Nicht nur können sie die Spiele unterschiedlich gut spielen, die Spiele sind bewusst so designt, dass Zufälle, Willkür und nur wenigen zugängliche Informationen darüber entscheiden, wer gewinnt und wer verliert.” Bezogen auf Schule ist klar, dass die viel beschworenen Leistungsmessungskritierien wie Validität, Reliabilität und Objektivität beim Lernen nur scheinbar Chancengleichheit herstellen können. Da gehe ich gerne mit. Aber die Schlussfolgerung, die Philippe zieht, teile ich nicht.
Im Squid Game ist Chancenungerechtigkeit konstitutiver Baustein. Im System Schule stimmt das gewiss nicht. Denn die meisten an der Schule Beteiligten versuchen – oft bis zur Verzweiflung – Gerechtigkeit herzustellen. Vielen gelingt es nicht, meinetwegen zum Teil auch aus systemimmanenten Hindernissen heraus. Aber Schule ist kein Ort wie Squid Game, in dem alle Schüler:innen völlig ohne Unterstützung, ohne Üben und Lernen und ohne jede Form der Hilfe völlig überraschende Prüfungen durchführen müssten. Und die gesichtslose Armee von Aufsichthabenden im Squid Game operiert so kalt wie das Gewinn-oder-Stirb-System. Das kann man Lehrer:innen in der Schule ganz sicher nicht vorwerfen. In meinen Augen ist das die brutalste und verwerflichste Stelle in diesem insgesamt untauglichen Vergleich: Philippe Wampfler macht die Lehrerschaft zu willenlosen kalten Soldaten eines Killerspiels.
Philippes Artikel enthält Impulse zu einer schonungslosen Bestandsaufnahme der Defizite der Schule. Aber es fehlen ihm aus meiner Sicht an den entscheidenden Stellen überzeugende Belege. Dies liegt gerade daran, dass er ein Bild von Schule zeichnet, das überzogen ist und so alle Verantwortlichen innerhalb eines verbesserungswürdigen Systems zu Mitverantwortlichen am Leid der Kinder macht. Genauso gut könnte man einen Artikel schreiben, in dem Schule mit Krieg verglichen wird. Nur in der Schule halt ohne Tote.
Ich finde, dass es sich immer lohnt, nach neuen Bildern, Parallelen und Anspielungen zu suchen, um herauszufinden, was an Schule und Bildung verbessert werden kann. Dabei sollte man nicht zimperlich sein. Dies aber mithilfe der Serie Squid Game zu tun, ist geschmacklos.
Bob Blume ist Oberstudienrat am Windeck-Gymnasium Bühl und als Netzlehrer der Pädagoge mit der größten Reichweite auf Twitter und Instagram. Er antwortet auf einen Text von Philippe Wampfler auf Medium.
Nur durchschnittlich 44 Prozent aller bayerischen Schulen verfügt über flächendeckendes Wlan. Einen gigabit-fähigen Anschluss haben 70 Prozent der Schulen. Das geht aus einer Antwort des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultur auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer hervor, die Bildung.Table vorliegt. “Da brauchen wir noch deutlich mehr!”, fordert der Grünen-Politiker. “Eine Wlan Abdeckung von durchschnittlich unter 50 Prozent im Jahr 2021 ist definitiv kein Grund zum Jubeln.” Überdurchschnittlich gut ausgestattet sind Realschulen und Berufsfachschulen/FOS/BOS (nicht Berufsschulen) mit 54 Prozent. Die bayerischen Gymnasien haben zu 52 Prozent flächendeckendes WLan. Besonders schlecht ausgestattet sind Förderschulen (34 Prozent) und “Sonstige” – darunter fallen freie Waldorfschulen, Abendgymnasien und Kollegs.
Das Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus teilte auf Anfrage von Bildung.Table mit, dass die jeweiligen Schulaufwandsträger für “Erschließung eines Schulstandortes mit einem Glasfaseranschluss” zuständig seien. Sie würden vom Freistaat Bayern finanziell unterstützt. Der “Masterplan Bayern Digital II” stellt dafür seit 2018 Fördergelder in Höhe von 212,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gelder des erneuerten Digitalpakts kamen im Mai 2019 dazu. Seitdem habe man in Bayern 42.000 weitere Unterrichtsräume mit Wlan ausgestattet.
Eine Internetanbindung mit einer Bandbreite von mindestens 30 Mbit/s gibt es an 99 Prozent aller Schulen. Schnell ist das nicht – 3,75 Megabyte Daten können pro Sekunde geladen werden. “Die tatsächlich gebuchten Bandbreiten können davon abweichen”, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Ein Gigabit ist ungefähr 40-Mal schneller als 30 Mbit/s und für eine Schule deutlich nützlicher. Das bayerische Kultusministerium empfiehlt in der Ausstattungsempfehlung VOTUM 2021, dass “idealerweise nicht weniger als 100 MBit/s” verfügbar sein sollten. Der konkrete Bedarf und die Ausrüstung einzelner Klassenzimmer mit Wlan sei abhängig von der individuellen Schule und ihren pädagogischen und didaktischen Zielen.
Der Grüne Max Deisenhofer findet das zu wolkig und zu wenig. “Das Kultusministerium ist noch lange nicht da, wo wir hinwollen,” sagte er Bildung.Table. “Wenn wir wollen, dass moderner Unterricht an Bayerns Schulen stattfindet, dann müssen wir die nötige Infrastruktur endlich bieten: Also schnelles Breitband an jeder Schule und flächendeckendes WLAN in jedes Klassenzimmer. Und zwar jetzt – und nicht erst 2030.” Enno Eidens
Forschende der Universität Oberta in Katalonien (UOC) wollen eine Technologie entwickelt haben, die mit Künstlicher Intelligenz prognostiziert, ob Studierende das Semester oder eine spezielle Klausur bestehen werden. Das LIS (Learning Intelligent System) könne dies zu Semesterbeginn mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, gab die UOC bekannt. Im Laufe der Studienzeit soll die Genauigkeit der Prognose auf bis zu 90 Prozent gesteigert werden. Das System bewerte die Leistungstendenz mit einem Ampel-Prinzip: Bei Orange steht das Bestehen auf der Kippe und bei Rot ist es in akuter Gefahr.
Die Software erhebt allerdings vielfältige Daten, darunter anonymisierte Auskünfte über das Online-Verhalten und die Noten der Studierenden. An der UOC werden diese Daten und andere Daten bereits seit sechs Jahren in einer Datenbank gesammelt. Das LIS kombiniert diese Daten mit einem Algorithmus, der den Leistungsstand und die Abschlusschance der Studierenden berechnet.
Die Software kann neben dem Ampel-Feedback auch personalisierte Lernempfehlungen und motivierende Nachrichten per E-Mail verschicken – manuell durch Lehrkräfte oder automatisiert. Die beteiligten Forschenden betonen, dass Motivationslosigkeit, Unsicherheit und Überwältigung zu mehr Studienabbrüchen führen können – vor allem in Online-Lernumgebungen. Mit ihren Muntermacher-Nachrichten wollen sie diesem Problem begegnen.
Die Lehrkräfte haben Zugriff auf die Ergebnisse der Studierenden und können so frühzeitig erkennen, bei welchen Themen Probleme und Schwierigkeiten entstehen könnten. Ana Elena Guerrero Roldán, Dozentin und Forscherin im Bereich IT und Technologien, spricht außerdem davon, dass das System Motivation und Leistung der Studierenden gesteigert habe. Das hätten Messungen mit Vergleichsgruppen ergeben. “Die Gruppe, die das LIS-System nutzte, schnitt besser ab als die beiden anderen Gruppen, was zeigt, dass diese Art von Feedback in Kombination mit dem virtuellen Campus-Panel der Studenten eine positive Wirkung hatte und die normalen Feedback-Mechanismen für Kurse ergänzte”, sagt Guerrero. Von den 552 teilnehmenden BWL-Studierenden des Pilotprojekts hätten zwei Drittel am Ende angegeben, das System weiterhin verwenden zu wollen. Robert Schick
Eine Petition fordert von der Baden-Württembergischen Kultusministerin, Theresa Schopper (Grüne), Schülerinnen und Schülern Prüfungstexte aus Vorjahren kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bisher werden die Urheberrechte an Prüfungen von Schoppers Ministerium an Verlage verkauft. Diese bieten Abschlussjahrgängen dann die alten Prüfungen samt Lösungen an – gegen Geld. Fabian Wilmes und die etwa 4.300 Unterzeichnenden seiner Petition sagen, das sei mit Bildungsgerechtigkeit nicht vereinbar. Sie fordern die Bereitstellung kostenloser Altklausuren für Prüflinge. “Das betreffende Ministerium muss die Dokumente zur Verfügung stellen,” sagte Wilmes Bildung.Table.
Für viele sind Altprüfungen ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung. In Baden-Württemberg und anderen Ländern müssen Prüflinge aber bezahlen, um Zugriff auf die Altklausuren zu erhalten. Für die Prüfungsvorbereitung Leistungsfach Deutsch, enthalten sind u.a. Prüfungen von 2018 bis 2021, fallen 15 Euro an, angeboten vom Stark Verlag. Doch das ist nur ein Fach. So wird es schnell zur Geldfrage, wie gut sich junge Menschen auf wichtige Prüfungen vorbereiten können. Vor allem, weil die Prüfungen in BaWü anders nicht zu bekommen sind.
Auch die Open Knowledge Foundation (OKF) engagiert sich in einem Projekt für offene Prüfungsmaterialien. Sie stellt Alt-Prüfungen auf der Webseite Verschlusssache Prüfung bereit. Dort könnten Schüler vor Prüfungen entweder alte Klausuren für ihre Bundesländer abrufen – oder aber über Frag den Staat diese bei den Ministerien anfordern. “Mit den Informationsfreiheitsgesetzen wollen wir Stück für Stück die Länder dazu zwingen, ihren Klausurenschatz zu öffnen,” sagte Max Kronmüller von der OKF. In einigen Ländern klappe das sehr gut. “Doch viele Länder mauern noch. In Sachsen-Anhalt werden etwa horrende Gebühren für Anfragen erhoben – ganze 150 Euro wird teilweise pro Fach und Jahr von den Schülerinnen und Schülern verlangt. Diese halten wir für absolut unrechtmäßig, weshalb wir Klage eingereicht haben.”
Hierzulande beeinflussen von Kindergarten bis Hörsaal immer noch Faktoren wie Herkunft oder Einkommen der Eltern den Bildungserfolg ihrer Kinder. Eine 2016 von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) veröffentlichte Studie attestiert dem deutschen Bildungssystem große “soziale Selektivität”. Laut dem FES-Befund, geht die soziale Schere zwischen Lernenden in Deutschland so weit wie in kaum einem anderen OECD-Land. Bundesländer wie Bremen versuchen, den finanziellen Nachteil in Sachen Altklausuren abzufangen und stellen Originalprüfungen diverser Fächer im Internet zum kostenlosen Herunterladen bereit. Der Petition von Fabian Wilmes fehlen noch gut 700 Unterschriften. Aber 5.000 Unterschriften vergünstigen die Vorbereitungshefte des Stark-Verlags nicht, das kann nur die Kultusministerin Baden-Württembergs, indem sie die Lernressourcen allen Lernenden kostenlos bereitstellt. Robert Saar
In Baden-Württembergs wichtigstem Bildungsgremium rumort es. Der einflussreiche Landesschulbeirat muss möglicherweise seine Vorstandswahlen wiederholen. Gegen die Wiederwahl der Vorsitzenden, Ingeborge Schöffel-Tschinke, haben Vertreter der Elternschaft eine Anfechtung eingereicht. Der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Michael Mittelstädt, sprach von einer Reihe von Formfehlern bei der Wahl am 14. Oktober. Doch die Kritik am Schulbeirat geht noch viel tiefer. “Wir beklagen den internen Umgang mit denjenigen, für die der Schulbeirat ursprünglich geschaffen wurde”, sagte Mittelstädt Bildung.Table. Viele Mitglieder hätten sich nach 34 Jahren einen Wechsel an der Spitze gewünscht.
Der Landesschulbeirat versammelt Lehrkräfte, Eltern und Schüler. Auch Kommunen, Kirchen, Arbeitgeber und Gewerkschaften sind unter den aktuell 70 Mitgliedern. Seit 1953 existiert das Gremium, das auch im baden-württembergischen Schulgesetz verankert ist. Seit 1987 steht Ingeborge Schöffel-Tschinke an der Spitze. Die Psychologin aus Friesenheim im Ortenaukreis fand in den 80er-Jahren über die ehrenamtliche Arbeit im Schulbereich in den Landesschulbeirat. In ihrer Funktion wurde sie mehrfach ausgezeichnet, so auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und mit der Landesmedaille von Baden-Württemberg. Sie wird seit Jahren in den Landesschulbeirat persönlich berufen, obwohl sie keine gesellschaftliche Gruppe mehr repräsentiert.
Bis zum Juli 2023 würde Schöffel-Tschinkes neuste Amtszeit reichen – doch dagegen rebellieren nun Eltern und Schüler. Immer wieder heißt es, das Gremium verliere den Bezug zur aktuellen Schulwelt und den Fragen der Zeit. In der Coronavirus-Krise war vom Schulbeirat wenig zu vernehmen. An den Debatten über Schulschließungen und Hybridunterricht beteiligte sich das oberste Beratungsgremium kaum. Auch zu den Problemen der Digitalisierung habe der Beirat wenig von sich hören lassen, kritisierte Elternvertreter Mittelstädt. “Bei den wesentlichen Fragen zur Zukunft der Bildung ist vom Landesschülerbeirat nichts zu hören”, so der Elternvertreter.
Im Vorstand finden solche Bedenken indes wenig Gehör. Als Mittelstädt und andere im Vorfeld der Wahlen einen Wechsel an der Spitze ins Gespräch brachten, kam es zu internen Irritationen. Sogar von Königsmord sei die Rede gewesen. Derlei monarchische Anwandlungen passen kaum in die Bildung des 21. Jahrhunderts. Den Kritikern von Schöffel-Tschinke gelang es dennoch nicht, einen Gegenkandidaten in die Wahl zu schicken. Als letztes Mittel, doch noch einen Generationenwechsel herbeizuführen, soll nun eine Wahlanfechtung helfen. Mittelstädt und seine Mitstreiter beanstanden darin, dass die Wahl intransparent und entgegen demokratischen Grundsätzen abgelaufen sei.
Das Stuttgarter Kultusministerium hält sich zu den Vorgängen bedeckt. Bei der Wahl des Landesschulbeirats war ein Ministeriumsvertreter anwesend. Damit hat die Bestätigung der Amtsinhaberin seitens der Landesregierung zunächst ein Placet erhalten. Christine Keilholz

FWU – schonmal gehört? Nein? Damit sind Sie nicht alleine. Obwohl das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) auf eine lange Geschichte zurückblickt, kennt es kaum jemand. Das FWU versteht sich als Medieninstitut der Länder und will eine wichtige Rolle in der deutschen Bildungslandschaft einnehmen. Mit der Digitalisierung könnte das nun gelingen. Vorausgesetzt, es finden sich die richtigen Mitarbeiter.
Mit Veränderungen kennt sich FWU-Direktor Michael Frost aus. An der Akademie für Führungskräfte in Bad Harburg coachte er Manager aus der Wirtschaft und begleitete sie bei den Restrukturierungen ihrer Unternehmen. Die bekannte Management-Schule wurde 1950 von dem Nationalsozialisten Reinhard Höhn aufgebaut. Bevor sein alter Arbeitgeber sich selbst nicht mehr den neuen Zeiten anpassen konnte und Konkurs ging, wechselte Michael Frost 2007 zum FWU.
Auch dieses Institut wurde 1950 gegründet und hat Wurzeln im Nationalsozialismus. Zur Gleichschaltung der Schulen produzierte der FWU-Vorgänger – Die Reichsstelle für den Unterrichtsfilm – ab 1934 Propagandafilme für Schulen, Ausbildungsstätten und Universitäten. Fünf Jahre nach Ende der nationalsozialistischen Diktatur werden die 16 Bundesländer Gesellschafter des FWU, es versteht sich fortan als “Medieninstitut der Länder”. Seine Aufgabe: Lehr- und Lernmittel herstellen, beschaffen und vermitteln.
Trotz über 70-jähriger Geschichte, zahlreicher Projekte und Auszeichnungen, ist das FWU erstaunlich unbekannt. Direktor Michael Frost erklärt sich das so: “Mit Einführung neuer Medien und dem Markteintritt privater Anbieter für Lernmedien hat sich das Bild des FWU gewandelt.” Die monopolistische Stellung, die das FWU lange für die Produktion von 16-Millimeter-Filmen gehabt habe, bröckelte mit der Einführung der VHS-Kassette.
Dass die FWU-Bildungsvideos – egal ob zu Doping, der Tropenlandschaft oder Kommunalpolitik – kaum ins öffentliche Bildungsbewusstsein gelangt sind, liegt vielleicht auch daran, dass das Institut mit seinen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den bundesweiten Bildungsmarkt nur begrenzt bedienen kann. Doch das vergessene Medieninstitut, das seinen Sitz bei Grünwald in München hat, wird in Zukunft wahrscheinlich mehr Leuten ein Begriff werden. “Uns geht es darum, den Ländern eine Infrastruktur anzubieten, mit denen die Schulen die digitalen Kompetenzen ihrer Schüler optimal fördern können,” sagt Frost. Aufgaben hat er mehr als genug.
Denn die Kultusministerkonferenz (KMK) hat das FWU gleich mit vier Großprojekten beauftragt, die der Digitalisierung an den Schulen endlich mal einen richtigen Schub verpassen sollen: Der Educheck Digital, der Schulen bei der Zulassung neuer Bildungssoftware unterstützen soll, in dem sie rechtliche und technische Kriterien vorab prüfen, sodass die Schulen bei den unübersichtlich und langwierigen Verfahren geholfen ist.
Dann das Projekt Vidis, über das sich alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in allen Bildungsangeboten digital einloggen können, ohne ihre eigene Identität preiszugeben. Außerdem die länderübergreifende Bildungsmediathek Mundo und der dazugehörige Webcrawler Sodix, der aus dem Netz Lernmaterialien fischt und automatisiert in den virtuellen “Bücherschrank” stellt.
Mundo läuft bereits und lockt mit über 43.000-Medien, Educheck soll in zwei Jahren fertig sein, Vidis in drei. Ob die Produkte wirklich so vielversprechend sind, wie sie klingen, lässt sich noch nicht absehen. Wie sie funktionieren, von wem sie genutzt werden, welche Anwendungen die Pädagog:innen unterstützen und den Schülerinnen und Schülern helfen – all das, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Der Erfolg wird auch davon abhängen, wie viel Geld die Länder ins FWU zu stecken wollen und wie viele kundige Digitalexperten das FWU und sein Direktor Michael Frost für sich gewinnen kann.
“Gerade durch die länderübergreifenden Projekte macht das FWU wieder einen Change Prozess durch”, sagt Frost. Um ein Unternehmen digital umzubauen, braucht es kundige Leute. Das weiß auch Michael Frost. Neun Stellen hat er aktuell ausgeschrieben, vom Projektleiter für Educheck bis zu Online-Redakteuren und IT-Projektmanager:innen. Einen bekannten Projektmanager konnte Michael Frost auf dem umkämpften Arbeitsmarkt in und um München herum bereits abwerben: den Identity-Management-Experten Michael Smidt, der seit letztem Jahr das Vidis-Projekt leitet. Sofie Czilwik
Egal um welche digitale Anwendung es geht, wir technisch affinen Lehrer:innen versuchen mit jeglichen medialen Zusätzen, Lernen in der Schule erlebbar zu machen: Mit einer VR-Brille für virtuelle Realität hat man die Chance, dass die Schüler sich gewissermaßen in eine andere Welt beamen. Sie erleben Lerneinheiten ganz anders. Sie sind plötzlich in der historischen Szene des Sturms auf die Bastille und erleben den geschichtlichen Hintergrund scheinbar direkt – und blättern nicht mehr nur im Schulbuch-Kapitel Französische Revolution oder gucken frontal auf dem PC ein Video darüber an. Sie ziehen die Brille auf, tauchen in die Epoche oder Sachwelt ein und begreifen sie mit Händen. In der Regel motiviert das Schüler – gerade bei Themen, die vielleicht nicht so spannend sind, aber halt im Lehrplan stehen.
Man braucht definitiv Platz. Wenn die Schüler:innen mit den Brillen auf dem Kopf in der virtuellen Welt herumlaufen, dann sollten sie in der realen Welt nicht über das Pult im Klassenzimmer stolpern. Natürlich benötigt man starkes WLan, auf jeden Fall einen PC und ein bestimmtes Programm – und die VR-Brillen selbst. Am wichtigsten: die Lehrkraft muss das Programm so aufbereiten können, dass es pädagogisch sinnvoll ist, diese Lektion mit den Schülern virtuell zu erleben – und zu verstehen. Das ist kein Hexenwerk, aber die entscheidende Hürde: Die Lehrer:in muss wissen, wann und wozu die VR-Brille hilft – und wo nicht.
Es wird in meinen Augen unendlich viele beste Möglichkeiten geben, der Fantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Wir haben an unserer beruflichen Schule einen Supermarkt nachgestellt, sodass die Lernenden sich nicht mit der Maus durch den Laden klicken, sondern die Warenpräsentation live erleben und überprüfen können, ob die Regalzonen eingehalten werden usw. In Erdkunde reist man virtuell in den Städten herum oder fährt in Gesteinsschichten ein, in Biologie erkundet man das Innere einer Zelle, in Geschichte die 1938 zerstörte Synagoge Erfurts in Kunst das Städelmuseum im Jahr 1878. Die Lernwelt der Zukunft wird spannender und experimenteller. Wir werden Schüler:innen abholen, die uns bisher nicht zugehört haben.
Ich glaube, wir können uns noch nicht wirklich vorstellen, wie virtuelle und experimentelle Realitäten unsere Lernräume verändern. Es geht nicht nur darum, den Blick ins Biologie-Buch durch die scheinbare Exkursion in ein menschliches Herz zu ersetzen, wo man praktisch in einer Herzkammer zu stehen glaubt. Vielleicht ist die VR-Brille nur ein Zwischenschritt in vermischte Lernwelten, in denen Schüler:innen Marie Curie und Albert Einstein interviewen oder in Martin Luthers Reformation aktiv eingreifen wie in einem Computerspiel. Das ist Zukunftsmusik, aber eine vorstellbare. Zunächst müssen wir allerdings aufpassen, dass sich Schüler:innen nicht am realen Kartenständer verletzen, wenn sie einem virtuellen Lavastrom ausweichen.
Die Kritik ist die, dass erstmal die technischen Voraussetzungen der Schule und das Know-how der Lehrer gegeben sein müssen. Zudem sind die Brillen noch nicht wirklich günstig, von daher ist natürlich die Frage: sitzen 29 Schüler außen rum, während ein Mitschüler virtuell an der Potsdamer Konferenz teilnimmt? Es ist meines Erachtens noch ein Stück des Weges, weil man – wenn die Budgets der Schulen so knapp bleiben – Eltern nicht ohne weiteres für die Finanzierung der kostspieligen Geräte heranziehen kann. Man müsste Lernmittelfreiheit neu definieren. Und es muss natürlich immer auch um den reflektierten pädagogischen Einsatz von virtuellen oder erweiterten Realitäten gehen. Das bedeutet: Zu lernen heißt nicht nur, zu erleben, sondern zu verstehen, zu analysieren und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen.
Saskia Ebel ist Lehrerin für Informatik und BWL an der beruflichen Walter-Eucken-Schule in Karlsruhe. Sie arbeitet am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg im Referat für Innovationen und ist Projektleiterin des Digitalkongresses Wes4.0, der ab Mittwoch wieder stattfindet (online).
29. Oktober 2021
Tag der offenen Tür: Inside Empirische Bildungsforschung
Das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation möchte mit Vorträgen, Filmen und Diskussionen die wichtigsten Fragen bezüglich der Bildungslehre ansprechen und digitale Einblicke in derzeitige Forschungen gewähren. Infos & Anmeldung
3. November 2021, 16:00 bis 17:00 Uhr
Fortbildung: iPad in der Grundschule (Mobile Schule)
Nils Lion klärt in seiner Einsteiger-Fortbildung über die Vorteile und Möglichkeiten der iPad- Nutzung an Grundschulen auf. Unter anderem wird erklärt, wie digitale Vorträge oder Clips erstellt und sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können. Infos & Anmeldung
4. November 2021, 12:30 bis 16:30 Uhr
Tagung Digital Summit des Bündnis für Bildung 2021
Unter dem Motto “Digitale Bildung – jetzt aber nachhaltig!” geht es auf dem Digital Summit um die Digitalisierung und wie diese stetig vorangetrieben werden kann. Hierzu werden verschiedene Diskussionen, Vorträge und Gesprächsrunden angeboten, die zum Austausch von Ideen und Vorstellungen konzipiert wurden. Infos & Anmeldung
pünktlich zum Beginn der Koalitionsverhandlungen liegen die Probleme der Bildungs-Digitalisierung vergrößert wie unter einem Brennglas. Es fehlt an Strukturen und Geld, um die Schulen aus ihrem digitalen Dornröschenschlaf zu erwecken. Unterbrochen wurde er bisher nur dort, wo mutige Pädagogen in den Pandemie-Monaten einfach mal losgelegt haben, ohne allzu viel auf Vorschriften und Haushaltsordnungen zu geben.
Nun wehren sich ausgerechnet in Brandenburg, der Heimat von Deutschlands oberster Kultusministerin, die Kommunen, für ihr Lehrpersonal Laptops und Tablets anzuschaffen, ohne dass ihnen dafür auch die laufenden Kosten für Betrieb, Reparatur oder Neubeschaffung im föderalen Finanzgeflecht zuerkannt werden. Finden die Bundesländer nicht sehr schnell gemeinsam mit dem Bund eine Lösung, werden sich Bürgermeister anderenorts dem Boykott anschließen. Zwecklos zu fragen: Hätte man das Problem nicht schon lange klären können?
Eine – zugegeben – rhetorische Frage, die auch das Datenschutzproblem betrifft. Denn auch mit der Sicherheit der Daten stehen Lehrerinnen und Lehrer ziemlich alleine da. Nun allerdings macht der Datenschutzbeauftragte Lutz Hasse in Thüringen einen ersten Schritt auf die Schulen zu.
Die Themen liegen auf dem Tisch, wenn die Arbeitsgruppen von SPD, Grünen und FDP heute ihre konkreten Gespräche für das politische Arbeitsprogramm der kommenden vier Jahre starten. Für das Themengebiet “Bildung und Chancen für alle” sitzen am Verhandlungstisch: Für die SPD Andreas Stoch, Ties Rabe, Stefanie Hubig, Oliver Kaczmarek. Für die Grünen: Felix Banaszak, Theresa Schopper, Anke Erdmann, Lasse Petersdotter. Für die FDP: Jens Brandenburg, Björn Försterlin, Yvonne Gebauer und Thomas Sattelberger.
Christian Füller und sein Redaktionsteam von Bildung.Table haben auch in dieser Woche die aktuellen Entwicklungen für Sie zusammen getragen. Sie klären über die Hintergründe auf und geben Hinweise für Praktiker, von Terminen für Lehrerfortbildung bis zu didaktischen Erfahrungsberichten. Wenn Sie mich fragen: Pflichtlektüre für Koalitionsverhandler und Lehrende zugleich.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), wollte 2021 zum Jahr der Digitalisierung der Schulen machen. In ihrem eigenen Bundesland erleidet sie nun einen schweren Rückschlag: Der Städte- und Gemeindebund will keine weiteren Dienstgeräte für Lehrkräfte anschaffen, wenn nicht vorher die Folgekosten geklärt werden. In einem Schreiben an seine Mitglieder, das Bildung.Table vorliegt, wird ultimativ erklärt: “Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg lehnt die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte, die in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis mit dem Land Brandenburg stehen, nach wie vor ab und rät seinen Mitgliedern von der Inanspruchnahme des Förderprogramms ab.” Das könnte Auswirkungen auf alle Bundesländer haben.
Damit steht die digitale Bildung nämlich insgesamt vor einer Zäsur. Der selbstbewusste Brandenburger Kommunalverband will nicht nur für sein Bundesland eine Änderung, sondern eine generelle. “Wir haben das Geld regelmäßig weder in den Haushalten noch in der Finanzplanung veranschlagt. Die Frage der Aufgabenverantwortung muss grundsätzlich geklärt werden,” sagte Geschäftsführer Jens Graf Bildung.Table. “Wir können nicht für vom Land beschäftigte 20.000 Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg Dienstgeräte anschaffen, die mit hohen Folgekosten verbunden sind.”
Was Graf meint, ist die Grundsatzfrage, die besonders seit der Ausrufung des Dienstgeräteprogramms mitten in der Coronavirus-Pandemie auf die Tagesordnung kam: Wer ist eigentlich für die Kosten der Digitalisierung der Schulen zuständig? Sind es Schulträger, die prinzipiell für die Sachausstattung der Schulen gerade stehen? Oder sind es die Bundesländer, die qua Verfassung die generelle Zuständigkeit für Schulen beanspruchen? Beim Geld tun sie das allerdings immer seltener. “Das Land kann sich gerade bei den Lehrer-Dienstgeräten nicht aus seiner Verpflichtung als Dienstherr der Lehrkräfte stehlen”, sagt Graf dazu.
Bei den Dienstgeräten für Lehrer wird exemplarisch deutlich, wie verworren die Zuständigkeiten bei Schule sind: für das Personal der Schulen, also die Lehrer, sind normalerweise die Länder verantwortlich – die sich aber nicht die Kosten für die Administration, die Reparatur oder gar die Ersatzbeschaffung aufhalsen lassen wollen. Die Städte und Gemeinden wiederum sagen, dass sie für die Dienstgeräte der Lehrer schlicht nicht zuständig sind. “Für unsere Mitgliedsstädte und Gemeinden haben die Dienstgeräte jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht,” betonte Geschäftsführer Graf. “Die Digitalisierung des Schulwesens erfordert eine Verständigung über Aufgaben und Standards sowie eine Anpassung der rechtlichen Grundlagen.” Das wisse jeder, bisher sei aber nichts in dieser Richtung geschehen. Deswegen trete Brandenburgs Städte- und Gemeindebund in Kontakt mit anderen Kommunalverbänden, um eine grundsätzliche Klärung herbeizuführen.
In einem Interview mit Bildung.Table hatte der Verhandlungsführer der Länder für die Digitalisierung, Mecklenburg-Vorpommerns Staatssekretär Steffen Freiberg (SPD), vor einem solchen Konflikt gewarnt: “Die Idee einer guten Lösung sollte man zuerst an der guten Lösung festmachen und erst danach überlegen, wie man an das notwendige Geld kommt oder wer bezahlt.” Auf Deutsch: Streit bringt keinen weiter. Dennoch gibt es bei der Vergabe von Dienstgeräten immer wieder große Probleme. In Brandenburg ist der Punkt jetzt aber erreicht, an dem die Kommunen wissen wollen, wer wirklich zuständig für die Finanzierung der Dienstgeräte ist. Das könnte eine Lawine von Beschwerden der Kommunalverbände quer durch die Republik auslösen.
“Die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte obliegt nicht dem Schulträger, sondern dem Arbeitgeber,” steht in dem Schreiben des Potsdamer Kommunalverbandes an seine Mitglieder. Das sei so im brandenburgischen Schulgesetz verankert. Den Städten und Gemeinden würden nicht gedeckte Folgekosten angelastet. Dazu gehören die Administration, die Softwareausstattung und die Ersatzbeschaffung der Notebooks. “Es wird geschätzt, dass die Fördermittel ca. 20 Prozent der letztlich auflaufenden Gesamtkosten decken werden,” schreiben die Kommunen. In Brandenburg soll jetzt ein IT-Rat, in dem die Regierung mit mehreren Ministerien und die kommunalen Verbände vertreten sind, einen Ausweg finden. Auf diesen Potsdamer Konferenzen steht dann die Digitalisierung der Schulen in ganz Deutschland auf der Kippe.
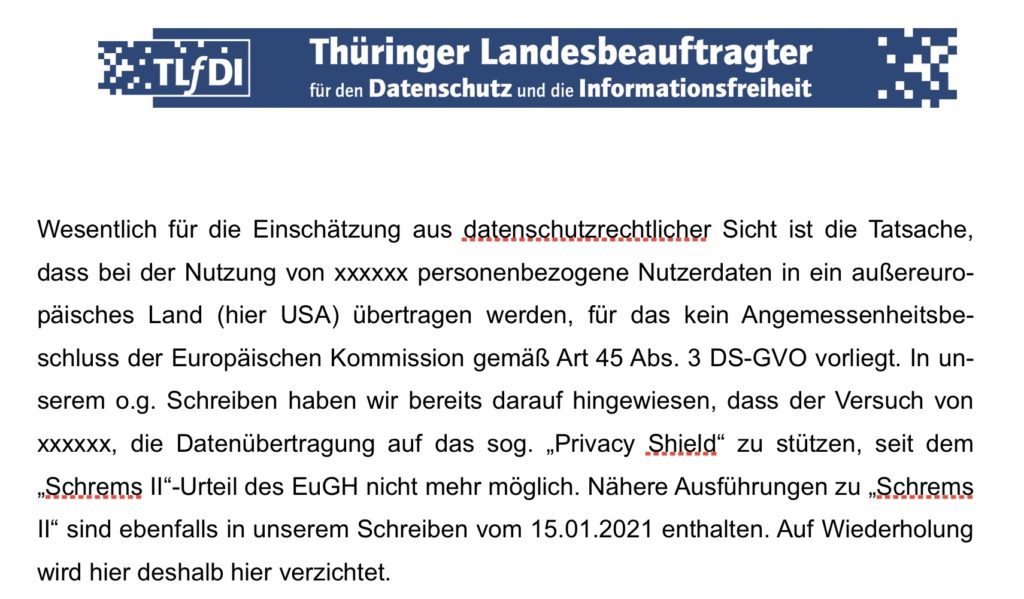
Es hat gedauert, aber nun ist es so weit. Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse hat den Schulen des Landes konkrete Empfehlungen zur Rechtskonformität von einem halben Hundert pädagogischer Anwendungen gegeben. Damit liegt eine erste große Aufstellung von Anwendungen vor, die Lehrer:innen unbedenklich im Unterricht nutzen können. Verlangt wird eine solche Orientierung schon lange. Grund für Hasses Intervention war die Notlage der Schulleiterinnen und Schulleiter während der Corona-Pandemie. “Wir haben Anfragen von Schulen bekommen – und diese Anfragen haben wir gespiegelt und an alle Schulen in Thüringen herausgegeben”, sagte Hasse zu Bildung.Table. “Das bedeutet, dass die Thüringer Schulen etwa 45-50 Produkte kennen, die aus datenschutzrechtlicher Sicht geeignet sind – oder eben nicht.” Allerdings gibt es strenggenommen keine zusammenhängende öffentliche Liste. Die Angaben seien nur für den Gebrauch in der Schule, betonte Hasse.
Bildung.Table konnte einige der Empfehlungen einsehen. “Die Nutzung ist auf der Grundlage des aktuellen Wissensstands bei Beachtung der genannten Kriterien derzeit aus Sicht des TLfDI [Datenschutzbeauftragter Thüringen, Red] als zulässig anzusehen”, heißt es zum Beispiel in einem der Papiere. Unter anderem haben Hasses Mitarbeiter die App “Anton” und die Anwendung “Mundo” auf ihre Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unter die Lupe genommen.
Zuletzt hatte der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) scharfe Kritik an den Datenschutzbeauftragten der Länder geübt, weil sie sich nicht auf eine einheitliche Empfehlungen für Schulen einigen könnten. Auch die Zusammenstellung von Lutz Hasse dürfte die Kritiker des Datenschutzes nicht vollständig zufrieden stellen. Denn die Thüringer Hinweise sind nur für den Dienstgebrauch der Schulen gedacht. Im Gespräch mit Bildung.Table wies der Sprecher der Arbeitskreise für Bildung und Medienkompetenz der Datenschutzkonferenz darauf hin, dass negative Empfehlungen gerade bei den großen US-Anbietern schnell zu Problemen führten.
Die bisher weitestgehende Liste hatte Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk über Videosysteme veröffentlicht. Smoltczyk, deren Amtszeit heute endet, bekam dafür Kontra gerade von US-Konzernen. Sie gab freilich nicht nach. Lutz Hasse hatte, ehe er seine gesammelten Hinweise herausgab, ein ähnliches Erlebnis. “Ich habe mich zu einem Produkt von Google mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt: ˋDas ist jetzt aber komplett datenschutzwidrig, das verwenden wir in Thüringen nicht mehr.ˋ Und dann haben sie natürlich drei Tage später die Kronjuristen für Player Deutschland an der Backe”, erzählte Hasse vergangenen Donnerstag auf der Buchmesse in Frankfurt. “Es erfordert unheimlich viel Aufwand, sich dem Widerstand, den man dann bekommt, zu widersetzen und darzulegen, dass man selber Recht hat.” Deswegen sei er nun den Weg gegangen, nur eine schulöffentliche Liste herauszugeben, “die ja auch ihren Zweck erfüllt.”
Hasses Schilderung verweist auf das grundsätzliche Problem: Die Datenschutzbehörden der Länder sind personell und technisch zu schlecht ausgestattet, um derartige Auseinandersetzungen gegen Milliarden-Konzerne durchstehen zu können. “Es wäre wichtig, wenn die Landesdatenschützer besser ausgestattet wären und eine sichere Rechtsgrundlage hätten”, sagte Hasse Bildung.Table. “Dann wäre das am Ende auch für Schulen einfacher.”
Wie kritisch Hasses Bemerkungen ausfallen, konnte Bildung.Table begutachten. In einem der Schreiben für Thüringens Schulen heißt es über eine US-Anwendung: “Wie ersichtlich ist, sind die rechtlichen Hürden und der Aufwand für den Einsatz von xxxxxx so hoch, dass gegenwärtig eine Nutzung durch Schulen unmöglich ist.” Zu dem Schluss kam der Datenschutzbeauftragte in diesem Fall, weil “personenbezogene Nutzerdaten in ein außereuropäisches Land (hier USA) übertragen werden, für das kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gemäß Art 45 Abs. 3 DS-GVO vorliegt.” Dass bei dem US-Instrument Nutzerdaten auch an Dritte fließen, so steht es in der Information für die Schulen, sei für jedermann einfach nachweisbar. Eine dem Schreiben beigefügte Untersuchung zeige die Einbindung einer “Vielzahl von Tracking-Instrumenten von Drittanbietern, die für den Zweck der Plattform (Bereitstellung von Informationen vom Nutzer für andere Nutzer) nicht erforderlich sind.”
Hasse machte gegenüber Bildung.Table nun Hoffnung darauf, dass die Datenschutzbehörden bei den US-Anbietern auf dem Weg zu einer einheitlichen Meinung seien. Er habe auch mit der Kultusministerkonferenz den Schulterschluss gesucht. Ergebnis ist, dass es mit einem amerikanischen Anbieter weitere Gespräche geben soll. “Die Gespräche sind aber leider nicht zielführend,” berichtete Hasse seine bisherigen Erfahrungen. Auf der Frankfurter Buchmesse empfahl er Anbietern, frühzeitig mit den Datenschutzbeauftragten zusammenzuarbeiten. Hasse nannte dafür als gutes Beispiel die Brandenburger “Schulcloud”, wo das gelungen sei. Und als schlechtes Beispiel Microsoft. Landesdatenschützer Stefan Brink aus Baden-Württemberg habe zusammen mit dem Konzern aus den USA nachmessen wollen, welche Daten für die Entwicklung des Cloud- und Office-Systems Microsoft MS 365 fließen. “Dann finden wir in Gesprächen mit großen Playern nicht heraus, was damit gemeint ist,” sagte Hasse auf der Messe. “Das ist der Knackpunkt.”
Für diese Äußerung wurde Datenschützer Hasse nun scharf kritisiert. “Datenschutzbeauftragte deutscher Bundesländer erwarten allen Ernstes, dass ein Tech-Weltkonzern seine Betriebsgeheimnisse mit ihnen teilt,” hieß es in einem Online-Portal. Kooperierten die Konzerne nicht, rieten Datenschutzbeauftragte davon ab, Produkte zu nutzen, die millionenfach selbstverständlich im Einsatz seien. “Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht um festgestellten Missbrauch von Schülerdaten. Den gibt es nämlich nicht”, war der Kommentator überzeugt. Hasse widersprach dem freundlich, aber bestimmt. “Zur Frage, ob tatsächliche Rechtsverstöße vorliegen, empfehle ich die Lektüre des aktuellen Gutachtens meines Kollegen aus Baden-Württemberg, das eine klare Sprache spricht”.
Datenschutz wird sicher auch in den Koalitionsverhandlungen Thema werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Listen mit erlaubten Anwendungen verlangt. “Sie können mir glauben, dass ich mit dem Bundes-Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber und seinen Länderkollegen in einem intensiven Gespräch bin, was da machbar wäre.” Christian Füller

Herr Ganten, was sollte in den Koalitionsverhandlungen zu digitaler Bildung besprochen werden?
Wir reden die ganze Zeit darüber, wie viel Geld in die Schulen fließen soll und wie die technischen Grundvoraussetzungen für digitales Lernen zu erreichen sind. Ich finde, darüber sollte man gar nicht mehr reden müssen. Es muss doch heute selbstverständlich sein, dass für alle Menschen und Unternehmen vernünftige Internet-Anschlüsse da sind – überall in der Republik.
So ist es aber nicht.
Was mir als Bürger mehr Kopfzerbrechen bereitet: Wie kriegen wir das hin, Bildung anders zu organisieren? Bei den Fragen der digitalen Bildungsinfrastruktur oder bei “Schulbuch oder OER?” touchieren wir noch nicht mal den wichtigsten Punkt: Wie kann es gelingen, dass Menschen durch das Schulsystem zu interessierten, gestaltungsfähigen und gestaltungswilligen Persönlichkeiten werden?
Hat das was mit Digitalisierung zu tun?
Ja, denn wir können Schule heute nicht mehr so denken wie zu der Zeit, als es digitale Tools und Möglichkeiten nicht gab. Konkret heißt das, dass Lehrkräfte ein Verständnis von ihrer neuen Rolle bekommen müssen. Dass sie nicht mehr die allwissenden Vermittler geben, sondern eher Coaches im Lernprozess von Schülerinnen und Schülern sind, die sich ihren Weg selbst zum Wissen bahnen. Menschenentwickler im besten Sinne. Was nutzt uns die schönste Digitalisierung, wenn wir weiter preußischen Schulunterricht machen wollen!
Wie soll etwa Lehrerfortbildung in Zukunft besser organisiert werden?
Ich glaube, man muss sich von vielen alten Zöpfen trennen und eine moderne Lehrerfortbildung aufbauen. Die zeichnet sich auch dadurch aus, dass Lehrer:innen viel seltener sagen: “Tschüss, ich bin jetzt eine Woche auf Fortbildung!”
Sondern?
Es geht um Formate – die es übrigens an vielen Schulen schon gibt -, die Lehrer begleitend zum Unterricht belegen können. Wo sie in eigener Anschauung lernen, dass man mit digitalen Tools und Zugängen oft schneller und mit mehr Begeisterung bei den Schülern umsetzbares Wissen erzeugt. Es gibt viele Beispiele von Unternehmen, die kontinuierliche Weiterbildungsprozesse organisieren. Wieso sollte man die nicht auch in der Schule einsetzen können?
Wie kann man die Schulträger, die im Moment die Hauptinvestitionslast bei der Digitalisierung tragen, in die Lage versetzen, die sehr teure Digitalisierung auch zu finanzieren?
Wir können davon ausgehen, dass alle Beteiligten jetzt wissen, dass man den Digitalpakt verstetigen muss. Das kann keine einmalige Ausgabe sein, und das steht im Sondierungspapier auch schon so drin. Ich glaube also, es liegt nicht am Geld. Das Problem ist in der Tat, dass das ganze System viel zu komplex ist. Kleine Schulträger können die Digitalisierung nicht allein bewältigen, die Kommunen, geschweige denn die Schulämter haben oft das IT-Knowhow gar nicht, um das hinzukriegen. Es gilt grundsätzlich, dass viel zu viele komplizierte Überlegungen angestellt werden müssen, um den Digitalpakt umzusetzen. Auch sehr relevante Fragen in Bezug auf Datenschutz und digitale Souveränität sind sinnvoll zu beantworten, und zwar so, dass keine Sackgassen entstehen, aus denen man später nicht wieder herauskommt. Damit sind eigentlich alle überfordert.
Wie könnte man das anders besser machen?
Kurz gesagt, müsste man das ganze Beschaffungswesen vereinfachen. Wozu brauchen wir zum Beispiel noch die Medienentwicklungs- und Nutzungspläne? Es wissen doch jetzt alle, was sie brauchen. Wir machen ja auch keine Toilettennutzungspläne. Da würden sich alle tot lachen, wenn wir sagen würden, schreib erst mal ein Plan für Wasserklosetts und Waschbecken. Die werden gebraucht und die werden eingebaut – das Gleiche muss für die digitale Infrastruktur an Schulen gelten.
Das sagt sich so leicht, aber wie geht das?
Vielleicht müsste der Bund ein zentrales IT-Kaufhaus für Schulträger errichten, das die wesentlichen Komponenten für Schulen bereithält – vom Glasfaseranschluss bis hin zu ordentlichen Wlan-Access-Points, welche die ganze Schule ausleuchten. Das wären alles IT-Standard-Lösungen. Wichtig ist, dass die Lösungen hinsichtlich der Sicherstellung von Datenschutz und digitaler Souveränität für das Schulsystem vorgeprüft sind und dass Kompatibilität mit anderen Lösungen Pflicht ist. Und das muss dann über extrem einfache Beschaffungsverfahren abgewickelt werden.
Also Schluss mit Wettbewerb?
Nein, Wettbewerb muss sein. Wir wissen nicht genau, wo wir mit der Digitalisierung in zehn Jahren gelandet sein werden. Das bedeutet, man braucht – bei aller Standardisierung – verschiedene Lösungen und Zugänge.
Welches sind die Standards und wo gelten sie?
Es muss Basisdienste beim Thema ID-Management, bei der Frage der Datenspeicherung und bei der Inhalte-Bereitstellung geben. Die Lösungen dafür muss nicht jeder Schulträger neu erfinden. Sowas kann es einmal zentral z.B. in jedem Bundesland geben. Wichtig ist, dass wir eine grundsätzliche Architektur bekommen, die Föderation ermöglicht. Das heißt, wenn im Bundesland Bremen ein System läuft, muss man es interoperabel mit einem System verschalten können, das in Sachsen oder in Bayern läuft.
Sie haben vor über vier Jahren ein ID-Management für die ganze Republik vorgeschlagen, das immer noch nicht fertig ist. Sollen die Länder weiter an dem “Vermittlungsdienst digitale Schule”, kurz Vidis, herumbasteln? Oder sollte man das dem Bund geben?
Wir brauchen eine grundlegende Architektur und die benötigen wir nicht fünf oder sechs Mal, sondern sie muss die Voraussetzung erfüllen, dass verschiedene Systeme miteinander föderiert werden können. Ob die Architektur von einer GmbH entwickelt wird, die zufällig den Ländern gehört, oder ob das der Bund macht, ist zweitrangig. Und auch wir treiben eine solche Architektur mit einem “ID-Broker” im Auftrag des Landes Bremen anderen Partnern wie, dem Verband-Bildungsmedien, weiter voran – nicht gegen das Medieninstitut der Länder FWU, sondern als Baustein einer Gesamtarchitektur miteinander föderierbarer und auf offenen Standards basierender Systeme.
Sie sind nicht glücklich darüber, was mit ihrer Ursprungsidee passiert ist: Die lag ewig in den Schubladen der Länder.
Da haben Sie natürlich völlig recht. Nur müssten Sie jetzt dann auch den Beweis antreten, dass der Bund so wahnsinnig viel besser und schneller arbeitet. Das Grundproblem ist doch, dass öffentliche Verwaltung bei IT-Projekten sich bisher nicht mit Ruhm bekleckert hat. Wir sind bei der Digitalisierung irrsinnig langsam. Das ist aber kein schulspezifisches Problem. Wir müssen mehr Speed in die Digitalisierung insgesamt kriegen.
Wie ginge das bei Vidis?
Vidis ist jetzt in der Pipeline. Es würde überhaupt nichts bringen, das jetzt noch mal neu auszuschreiben. Die sind auf dem Weg und die haben gute Leute an Bord. Aber wie oben schon erwähnt: Wettbewerb ist dennoch wichtig: Wir stellen unsere Entwicklungen der Allgemeinheit unter Open-Source-Lizenzen zur Verfügung. Das kann dann vom Medieninstitut der Länder (FWU) aber auch von anderen genutzt werden, um Lösungen zu schaffen.
Wenn Sie Chief Information Officer der Bundesregierung wären, wie würden Sie digitale Bildung beschleunigen?
Ich bin für diesen Posten nicht verfügbar und glaube, dass es geeignetere Personen gäbe. Abgesehen davon, sind wir da bei den grundsätzlichen Fragen. Wir müssen schneller loslegen, wir müssen mehr experimentieren können. Dafür brauchen wir eine stabile Grundlage, also eine Architektur mit Grundregeln, die von Ländern und Schulträgern sowie allen wichtigen Anbietern getragen wird. Wir müssen Open Source zum Grundprinzip bei der Softwareauswahl machen, um ausprobieren und in schnellen Zyklen verändern, um Kompatibilität herzustellen und teilweise lähmende Herstellerabhängigkeiten leichter überwinden zu können. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch als Staat die besten Leute akquirieren und einstellen können, nicht um alles nochmal selber zu erfinden, sondern um als wirklich kompetente Auftraggeber zu agieren.

Ein Gastbeitrag von Bob Blume
Ich halte es für unangemessen, “Squid Game” als Allegorie auf unser Schulsystem zu lesen. In der Netflix-Serie geht es um eine von einer reichen koreanischen Elite initiierte Spiele-Reihe auf Leben und Tod. Wer eines der in Korea bekannten Kinderspiele verliert, wird getötet. Egal, wie differenziert der Autor Philippe Wampfler im einzelnen begründen mag, was er mit seinem Vergleich evoziert: 800.000 Lehrer:innen in Deutschland kommen in den Ruch der riesigen Squid-Puppe, die Mitspieler mit gezielten Schüssen hinrichtet. Dieser Vergleich ist unverständlich – und unverantwortlich.
Der Schweizer Deutschlehrer und Blogger Philippe Wampfler sichert sich natürlich ab in seiner Gegenüberstellung von Schule und dem Killerspiel. Er will Squid Game nicht als Allegorie auf das Schulsystem als Ganzes sehen, sondern lediglich auf die“Leistungskultur in der Schule” anwenden. Das könnte – so meint man – den unpassenden Vergleich abschwächen, tut es meines Erachtens aber aus unterschiedlichen Gründen nicht.
Philippe führt zunächst an, dass es ja die Schüler selbst seien, die das Squid Game als passend für Schule verwenden würden, weil es immer öfter auf Schulhöfen aufgeführt werde. “Das Nachspielen ist aus meiner Sicht deshalb naheliegend, weil die Leistungskultur der Schule dazu führt, dass sie wie ‘Squid Game’ funktioniert”, schreibt Philippe. “Damit sage ich nicht, dass an Schulen Kinder systematisch umgebracht werden – sondern dass die Serie Aspekte verdeutlicht, die auch in der Schule zu Problemen führen.”
Aus meiner Sicht ergibt sich aus dieser Prämisse des Bloggers eine fragwürdige Argumentationsstruktur. Es ist einfach nicht belegbar, dass Kinder Squid Game nachspielen, weil sie darüber reflektierten, dass damit das Schulsystem gemeint sein könnte. Kinder übernehmen Diskussionen und Memes einfach, weil diese populär sind. That’s it! Keiner würde ernsthaft behaupten, dass Kinder und Jugendliche etwa bei persönlichen Erfolgen einen der “Fortnite-Tänze” nachahmen, weil sie eine Parallele zu ihren Umständen erkennen würden. Nachspielen ist naheliegend, weil es eben medial nahe liegt – aber es gibt keinen inneren Zusammenhang oder auch nur eine Ähnlichkeit, die Kinder zur Nachahmung motivieren würde.
Eine Allegorie aber damit zu beginnen, dass ihr Wesenskern nicht zutrifft, erscheint mindestens fragwürdig. Man könnte auch sagen: fahrlässig. Denn jeder, der Squid Game kennt, weiß um die grausame Pointe der Serie: Menschen entscheiden über Leben und Tod anderer Menschen. Zum Spaß. Das Schulsystem hat gewiss erhebliches Verbesserungspotenzial, keine Frage. Aber die aufgeworfene Parallele ist trotz Philippes knapper Relativierung zynisch und überzogen. Wer zum Beispiel sollen denn im Schulsystem diejenigen sein, die sich am Leid der Sterbenden bzw. schlecht Benoteten erfreuen? Ist es etwa schulische Praxis, dass Lehrer:innen die mit fünf oder sechs benoteten Schülerinnen und Schüler vor der Klasse verlachen und verspotten würden?
Aus meiner Sicht funktionieren also bereits die Prämissen nicht. Aber auch die systemischen Parallelen, die Philippe Wampfler zwischen Squid Game und Schule erkennen will, können meiner Einschätzung nach nicht überzeugen. Er schreibt, in der Schule würden “unmenschliche Formen der Disziplinierung und problematische Formen von Leistungsmessung nach kurzer Zeit von Schüler:innen nicht mehr hinterfragt, sondern als Regel akzeptiert.” Das bedeute, so der Schweizer Lehrer, Schüler akzeptierten den selektiven Grundsatz von Schule: “Wer das nächste Level erreichen und eine Aussicht auf ein erfolgreiches Leben haben will, muss da durch.”
Meines Erachtens funktioniert dieser Vergleich nicht. Schauen wir uns die drei grundlegenden Regeln bei Squid Game an – und vergleichen die Kategorien dann mit Schule:
1. Teilnehmer können das Spiel nicht willkürlich unterbrechen.
2. Spieler, die sich weigern, werden automatisch disqualifiziert.
3. Stimmt die Mehrheit dafür, können die Spiele beendet werden.
Diese Regeln sind innerhalb des Spiels zynisch, weil sie kollektiven Druck auf die Gemeinschaft ausüben. Für das Spiel sind sie gleichwohl auch plausibel, weil sie einen fließenden Ablauf gewährleisten. Schon die “unmenschlichen Formen der Disziplinierung“, die Philippe anführt, sind aber für die heutige Schule grotesk überzogen. Aber auch insgesamt wird hier ein völlig verzerrtes Bild von Schule gezeichnet. Schule baut weder annähernd noch grundsätzlich auf den Grundprinzipien von Squid Game auf. Schule ist per se anders.
Das Argument des zentralen Stücks des Vergleichs von Squid Game und Schule lautet, dass Schüler:innen Dinge lernen müssten, die “nicht sichtbar relevant” sind und “deren Wert sie im Moment nicht beurteilen können”. Philippe schreibt: “So beginnen sie, mechanisch zu lernen. Sie pauken Vokabeln, lernen Seiten aus Büchern und Heften auswendig, um bei der Prüfung irgendwas hinzuschreiben, was hoffentlich noch ein paar Punkte gibt; suchen nach Rezepten, mit denen sie mathematische Aufgaben so abarbeiten können, dass sie aufs richtige Resultat kommen, auch wenn sie die dahinterliegenden Konzepte nicht verstehen. Sie sind wie die Spieler:innen bei »Squid Game«, die nicht mit Murmeln spielen, weil sie dabei Spaß hätten – sondern weil sie nicht anders können.”
Die Argumentation aus diesem Beispiel höre ich ständig. Sie ist, was das Auswendiglernen angeht, aus meiner Sicht aber in den meisten Schulen nicht zutreffend. Der Verweis auf Squid Game ist auch insgesamt wieder deplatziert. Denn in der Serie geht es nicht um eine Note, eine Ziffer oder einen Test. Hier geht es um Leben und Tod, also um die Idee der Serie – und den einzigen Aspekt, um den es ja explizit nicht gehen soll.
Die hier entfaltete Argumentation von Philippe Wampfler klingt zunächst stimmig. Aber schaut man genauer hin, passt die Begründung erneut nicht. “Die Verantwortlichen von »Squid Game« könnten allen Teilnehmenden das Geld geben, das sie für das Spiel aufwenden, wenn sie wollten”, schreibt Philippe. Und “Schulen könnten allen Schüler:innen zeigen, wo ihre Stärken liegen.”
Sollte Schule Schülern zeigen, wo ihre Stärken liegen, anstatt sich an ihren Defiziten zu orientieren? Absolut und ohne Frage. Aber die Parallele ist eben keine. Der Kern von Squid Game ist das Amüsement, das ein superreicher Milliardär und dessen Freunde dabei empfinden, Menschen um Leben und Tod spielen zu sehen. Könnten sie das Geld auch verteilen? Nein, denn dadurch hätten diese Sadisten kein Vergnügen – und das Spiel wäre obsolet. Die Parallele funktioniert insofern genauso wenig, als würde man sagen, dass Werther überlebt hätte, wenn er sich nicht umgebracht hätte. Mag sein, aber: Der Text steht fest. Der Werther ist tot. Die Serie steht fest. Ihr Kern beruht auf dem System, dass es das Geld den Überlebenden schenkt.
Das Squid Game beschreibt Philippe Wampfler so. “Alle Spielenden sollten dieselben Chancen haben. Nur: Das haben sie nicht. Nicht nur können sie die Spiele unterschiedlich gut spielen, die Spiele sind bewusst so designt, dass Zufälle, Willkür und nur wenigen zugängliche Informationen darüber entscheiden, wer gewinnt und wer verliert.” Bezogen auf Schule ist klar, dass die viel beschworenen Leistungsmessungskritierien wie Validität, Reliabilität und Objektivität beim Lernen nur scheinbar Chancengleichheit herstellen können. Da gehe ich gerne mit. Aber die Schlussfolgerung, die Philippe zieht, teile ich nicht.
Im Squid Game ist Chancenungerechtigkeit konstitutiver Baustein. Im System Schule stimmt das gewiss nicht. Denn die meisten an der Schule Beteiligten versuchen – oft bis zur Verzweiflung – Gerechtigkeit herzustellen. Vielen gelingt es nicht, meinetwegen zum Teil auch aus systemimmanenten Hindernissen heraus. Aber Schule ist kein Ort wie Squid Game, in dem alle Schüler:innen völlig ohne Unterstützung, ohne Üben und Lernen und ohne jede Form der Hilfe völlig überraschende Prüfungen durchführen müssten. Und die gesichtslose Armee von Aufsichthabenden im Squid Game operiert so kalt wie das Gewinn-oder-Stirb-System. Das kann man Lehrer:innen in der Schule ganz sicher nicht vorwerfen. In meinen Augen ist das die brutalste und verwerflichste Stelle in diesem insgesamt untauglichen Vergleich: Philippe Wampfler macht die Lehrerschaft zu willenlosen kalten Soldaten eines Killerspiels.
Philippes Artikel enthält Impulse zu einer schonungslosen Bestandsaufnahme der Defizite der Schule. Aber es fehlen ihm aus meiner Sicht an den entscheidenden Stellen überzeugende Belege. Dies liegt gerade daran, dass er ein Bild von Schule zeichnet, das überzogen ist und so alle Verantwortlichen innerhalb eines verbesserungswürdigen Systems zu Mitverantwortlichen am Leid der Kinder macht. Genauso gut könnte man einen Artikel schreiben, in dem Schule mit Krieg verglichen wird. Nur in der Schule halt ohne Tote.
Ich finde, dass es sich immer lohnt, nach neuen Bildern, Parallelen und Anspielungen zu suchen, um herauszufinden, was an Schule und Bildung verbessert werden kann. Dabei sollte man nicht zimperlich sein. Dies aber mithilfe der Serie Squid Game zu tun, ist geschmacklos.
Bob Blume ist Oberstudienrat am Windeck-Gymnasium Bühl und als Netzlehrer der Pädagoge mit der größten Reichweite auf Twitter und Instagram. Er antwortet auf einen Text von Philippe Wampfler auf Medium.
Nur durchschnittlich 44 Prozent aller bayerischen Schulen verfügt über flächendeckendes Wlan. Einen gigabit-fähigen Anschluss haben 70 Prozent der Schulen. Das geht aus einer Antwort des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultur auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer hervor, die Bildung.Table vorliegt. “Da brauchen wir noch deutlich mehr!”, fordert der Grünen-Politiker. “Eine Wlan Abdeckung von durchschnittlich unter 50 Prozent im Jahr 2021 ist definitiv kein Grund zum Jubeln.” Überdurchschnittlich gut ausgestattet sind Realschulen und Berufsfachschulen/FOS/BOS (nicht Berufsschulen) mit 54 Prozent. Die bayerischen Gymnasien haben zu 52 Prozent flächendeckendes WLan. Besonders schlecht ausgestattet sind Förderschulen (34 Prozent) und “Sonstige” – darunter fallen freie Waldorfschulen, Abendgymnasien und Kollegs.
Das Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus teilte auf Anfrage von Bildung.Table mit, dass die jeweiligen Schulaufwandsträger für “Erschließung eines Schulstandortes mit einem Glasfaseranschluss” zuständig seien. Sie würden vom Freistaat Bayern finanziell unterstützt. Der “Masterplan Bayern Digital II” stellt dafür seit 2018 Fördergelder in Höhe von 212,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gelder des erneuerten Digitalpakts kamen im Mai 2019 dazu. Seitdem habe man in Bayern 42.000 weitere Unterrichtsräume mit Wlan ausgestattet.
Eine Internetanbindung mit einer Bandbreite von mindestens 30 Mbit/s gibt es an 99 Prozent aller Schulen. Schnell ist das nicht – 3,75 Megabyte Daten können pro Sekunde geladen werden. “Die tatsächlich gebuchten Bandbreiten können davon abweichen”, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Ein Gigabit ist ungefähr 40-Mal schneller als 30 Mbit/s und für eine Schule deutlich nützlicher. Das bayerische Kultusministerium empfiehlt in der Ausstattungsempfehlung VOTUM 2021, dass “idealerweise nicht weniger als 100 MBit/s” verfügbar sein sollten. Der konkrete Bedarf und die Ausrüstung einzelner Klassenzimmer mit Wlan sei abhängig von der individuellen Schule und ihren pädagogischen und didaktischen Zielen.
Der Grüne Max Deisenhofer findet das zu wolkig und zu wenig. “Das Kultusministerium ist noch lange nicht da, wo wir hinwollen,” sagte er Bildung.Table. “Wenn wir wollen, dass moderner Unterricht an Bayerns Schulen stattfindet, dann müssen wir die nötige Infrastruktur endlich bieten: Also schnelles Breitband an jeder Schule und flächendeckendes WLAN in jedes Klassenzimmer. Und zwar jetzt – und nicht erst 2030.” Enno Eidens
Forschende der Universität Oberta in Katalonien (UOC) wollen eine Technologie entwickelt haben, die mit Künstlicher Intelligenz prognostiziert, ob Studierende das Semester oder eine spezielle Klausur bestehen werden. Das LIS (Learning Intelligent System) könne dies zu Semesterbeginn mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, gab die UOC bekannt. Im Laufe der Studienzeit soll die Genauigkeit der Prognose auf bis zu 90 Prozent gesteigert werden. Das System bewerte die Leistungstendenz mit einem Ampel-Prinzip: Bei Orange steht das Bestehen auf der Kippe und bei Rot ist es in akuter Gefahr.
Die Software erhebt allerdings vielfältige Daten, darunter anonymisierte Auskünfte über das Online-Verhalten und die Noten der Studierenden. An der UOC werden diese Daten und andere Daten bereits seit sechs Jahren in einer Datenbank gesammelt. Das LIS kombiniert diese Daten mit einem Algorithmus, der den Leistungsstand und die Abschlusschance der Studierenden berechnet.
Die Software kann neben dem Ampel-Feedback auch personalisierte Lernempfehlungen und motivierende Nachrichten per E-Mail verschicken – manuell durch Lehrkräfte oder automatisiert. Die beteiligten Forschenden betonen, dass Motivationslosigkeit, Unsicherheit und Überwältigung zu mehr Studienabbrüchen führen können – vor allem in Online-Lernumgebungen. Mit ihren Muntermacher-Nachrichten wollen sie diesem Problem begegnen.
Die Lehrkräfte haben Zugriff auf die Ergebnisse der Studierenden und können so frühzeitig erkennen, bei welchen Themen Probleme und Schwierigkeiten entstehen könnten. Ana Elena Guerrero Roldán, Dozentin und Forscherin im Bereich IT und Technologien, spricht außerdem davon, dass das System Motivation und Leistung der Studierenden gesteigert habe. Das hätten Messungen mit Vergleichsgruppen ergeben. “Die Gruppe, die das LIS-System nutzte, schnitt besser ab als die beiden anderen Gruppen, was zeigt, dass diese Art von Feedback in Kombination mit dem virtuellen Campus-Panel der Studenten eine positive Wirkung hatte und die normalen Feedback-Mechanismen für Kurse ergänzte”, sagt Guerrero. Von den 552 teilnehmenden BWL-Studierenden des Pilotprojekts hätten zwei Drittel am Ende angegeben, das System weiterhin verwenden zu wollen. Robert Schick
Eine Petition fordert von der Baden-Württembergischen Kultusministerin, Theresa Schopper (Grüne), Schülerinnen und Schülern Prüfungstexte aus Vorjahren kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bisher werden die Urheberrechte an Prüfungen von Schoppers Ministerium an Verlage verkauft. Diese bieten Abschlussjahrgängen dann die alten Prüfungen samt Lösungen an – gegen Geld. Fabian Wilmes und die etwa 4.300 Unterzeichnenden seiner Petition sagen, das sei mit Bildungsgerechtigkeit nicht vereinbar. Sie fordern die Bereitstellung kostenloser Altklausuren für Prüflinge. “Das betreffende Ministerium muss die Dokumente zur Verfügung stellen,” sagte Wilmes Bildung.Table.
Für viele sind Altprüfungen ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung. In Baden-Württemberg und anderen Ländern müssen Prüflinge aber bezahlen, um Zugriff auf die Altklausuren zu erhalten. Für die Prüfungsvorbereitung Leistungsfach Deutsch, enthalten sind u.a. Prüfungen von 2018 bis 2021, fallen 15 Euro an, angeboten vom Stark Verlag. Doch das ist nur ein Fach. So wird es schnell zur Geldfrage, wie gut sich junge Menschen auf wichtige Prüfungen vorbereiten können. Vor allem, weil die Prüfungen in BaWü anders nicht zu bekommen sind.
Auch die Open Knowledge Foundation (OKF) engagiert sich in einem Projekt für offene Prüfungsmaterialien. Sie stellt Alt-Prüfungen auf der Webseite Verschlusssache Prüfung bereit. Dort könnten Schüler vor Prüfungen entweder alte Klausuren für ihre Bundesländer abrufen – oder aber über Frag den Staat diese bei den Ministerien anfordern. “Mit den Informationsfreiheitsgesetzen wollen wir Stück für Stück die Länder dazu zwingen, ihren Klausurenschatz zu öffnen,” sagte Max Kronmüller von der OKF. In einigen Ländern klappe das sehr gut. “Doch viele Länder mauern noch. In Sachsen-Anhalt werden etwa horrende Gebühren für Anfragen erhoben – ganze 150 Euro wird teilweise pro Fach und Jahr von den Schülerinnen und Schülern verlangt. Diese halten wir für absolut unrechtmäßig, weshalb wir Klage eingereicht haben.”
Hierzulande beeinflussen von Kindergarten bis Hörsaal immer noch Faktoren wie Herkunft oder Einkommen der Eltern den Bildungserfolg ihrer Kinder. Eine 2016 von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) veröffentlichte Studie attestiert dem deutschen Bildungssystem große “soziale Selektivität”. Laut dem FES-Befund, geht die soziale Schere zwischen Lernenden in Deutschland so weit wie in kaum einem anderen OECD-Land. Bundesländer wie Bremen versuchen, den finanziellen Nachteil in Sachen Altklausuren abzufangen und stellen Originalprüfungen diverser Fächer im Internet zum kostenlosen Herunterladen bereit. Der Petition von Fabian Wilmes fehlen noch gut 700 Unterschriften. Aber 5.000 Unterschriften vergünstigen die Vorbereitungshefte des Stark-Verlags nicht, das kann nur die Kultusministerin Baden-Württembergs, indem sie die Lernressourcen allen Lernenden kostenlos bereitstellt. Robert Saar
In Baden-Württembergs wichtigstem Bildungsgremium rumort es. Der einflussreiche Landesschulbeirat muss möglicherweise seine Vorstandswahlen wiederholen. Gegen die Wiederwahl der Vorsitzenden, Ingeborge Schöffel-Tschinke, haben Vertreter der Elternschaft eine Anfechtung eingereicht. Der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Michael Mittelstädt, sprach von einer Reihe von Formfehlern bei der Wahl am 14. Oktober. Doch die Kritik am Schulbeirat geht noch viel tiefer. “Wir beklagen den internen Umgang mit denjenigen, für die der Schulbeirat ursprünglich geschaffen wurde”, sagte Mittelstädt Bildung.Table. Viele Mitglieder hätten sich nach 34 Jahren einen Wechsel an der Spitze gewünscht.
Der Landesschulbeirat versammelt Lehrkräfte, Eltern und Schüler. Auch Kommunen, Kirchen, Arbeitgeber und Gewerkschaften sind unter den aktuell 70 Mitgliedern. Seit 1953 existiert das Gremium, das auch im baden-württembergischen Schulgesetz verankert ist. Seit 1987 steht Ingeborge Schöffel-Tschinke an der Spitze. Die Psychologin aus Friesenheim im Ortenaukreis fand in den 80er-Jahren über die ehrenamtliche Arbeit im Schulbereich in den Landesschulbeirat. In ihrer Funktion wurde sie mehrfach ausgezeichnet, so auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und mit der Landesmedaille von Baden-Württemberg. Sie wird seit Jahren in den Landesschulbeirat persönlich berufen, obwohl sie keine gesellschaftliche Gruppe mehr repräsentiert.
Bis zum Juli 2023 würde Schöffel-Tschinkes neuste Amtszeit reichen – doch dagegen rebellieren nun Eltern und Schüler. Immer wieder heißt es, das Gremium verliere den Bezug zur aktuellen Schulwelt und den Fragen der Zeit. In der Coronavirus-Krise war vom Schulbeirat wenig zu vernehmen. An den Debatten über Schulschließungen und Hybridunterricht beteiligte sich das oberste Beratungsgremium kaum. Auch zu den Problemen der Digitalisierung habe der Beirat wenig von sich hören lassen, kritisierte Elternvertreter Mittelstädt. “Bei den wesentlichen Fragen zur Zukunft der Bildung ist vom Landesschülerbeirat nichts zu hören”, so der Elternvertreter.
Im Vorstand finden solche Bedenken indes wenig Gehör. Als Mittelstädt und andere im Vorfeld der Wahlen einen Wechsel an der Spitze ins Gespräch brachten, kam es zu internen Irritationen. Sogar von Königsmord sei die Rede gewesen. Derlei monarchische Anwandlungen passen kaum in die Bildung des 21. Jahrhunderts. Den Kritikern von Schöffel-Tschinke gelang es dennoch nicht, einen Gegenkandidaten in die Wahl zu schicken. Als letztes Mittel, doch noch einen Generationenwechsel herbeizuführen, soll nun eine Wahlanfechtung helfen. Mittelstädt und seine Mitstreiter beanstanden darin, dass die Wahl intransparent und entgegen demokratischen Grundsätzen abgelaufen sei.
Das Stuttgarter Kultusministerium hält sich zu den Vorgängen bedeckt. Bei der Wahl des Landesschulbeirats war ein Ministeriumsvertreter anwesend. Damit hat die Bestätigung der Amtsinhaberin seitens der Landesregierung zunächst ein Placet erhalten. Christine Keilholz

FWU – schonmal gehört? Nein? Damit sind Sie nicht alleine. Obwohl das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) auf eine lange Geschichte zurückblickt, kennt es kaum jemand. Das FWU versteht sich als Medieninstitut der Länder und will eine wichtige Rolle in der deutschen Bildungslandschaft einnehmen. Mit der Digitalisierung könnte das nun gelingen. Vorausgesetzt, es finden sich die richtigen Mitarbeiter.
Mit Veränderungen kennt sich FWU-Direktor Michael Frost aus. An der Akademie für Führungskräfte in Bad Harburg coachte er Manager aus der Wirtschaft und begleitete sie bei den Restrukturierungen ihrer Unternehmen. Die bekannte Management-Schule wurde 1950 von dem Nationalsozialisten Reinhard Höhn aufgebaut. Bevor sein alter Arbeitgeber sich selbst nicht mehr den neuen Zeiten anpassen konnte und Konkurs ging, wechselte Michael Frost 2007 zum FWU.
Auch dieses Institut wurde 1950 gegründet und hat Wurzeln im Nationalsozialismus. Zur Gleichschaltung der Schulen produzierte der FWU-Vorgänger – Die Reichsstelle für den Unterrichtsfilm – ab 1934 Propagandafilme für Schulen, Ausbildungsstätten und Universitäten. Fünf Jahre nach Ende der nationalsozialistischen Diktatur werden die 16 Bundesländer Gesellschafter des FWU, es versteht sich fortan als “Medieninstitut der Länder”. Seine Aufgabe: Lehr- und Lernmittel herstellen, beschaffen und vermitteln.
Trotz über 70-jähriger Geschichte, zahlreicher Projekte und Auszeichnungen, ist das FWU erstaunlich unbekannt. Direktor Michael Frost erklärt sich das so: “Mit Einführung neuer Medien und dem Markteintritt privater Anbieter für Lernmedien hat sich das Bild des FWU gewandelt.” Die monopolistische Stellung, die das FWU lange für die Produktion von 16-Millimeter-Filmen gehabt habe, bröckelte mit der Einführung der VHS-Kassette.
Dass die FWU-Bildungsvideos – egal ob zu Doping, der Tropenlandschaft oder Kommunalpolitik – kaum ins öffentliche Bildungsbewusstsein gelangt sind, liegt vielleicht auch daran, dass das Institut mit seinen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den bundesweiten Bildungsmarkt nur begrenzt bedienen kann. Doch das vergessene Medieninstitut, das seinen Sitz bei Grünwald in München hat, wird in Zukunft wahrscheinlich mehr Leuten ein Begriff werden. “Uns geht es darum, den Ländern eine Infrastruktur anzubieten, mit denen die Schulen die digitalen Kompetenzen ihrer Schüler optimal fördern können,” sagt Frost. Aufgaben hat er mehr als genug.
Denn die Kultusministerkonferenz (KMK) hat das FWU gleich mit vier Großprojekten beauftragt, die der Digitalisierung an den Schulen endlich mal einen richtigen Schub verpassen sollen: Der Educheck Digital, der Schulen bei der Zulassung neuer Bildungssoftware unterstützen soll, in dem sie rechtliche und technische Kriterien vorab prüfen, sodass die Schulen bei den unübersichtlich und langwierigen Verfahren geholfen ist.
Dann das Projekt Vidis, über das sich alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in allen Bildungsangeboten digital einloggen können, ohne ihre eigene Identität preiszugeben. Außerdem die länderübergreifende Bildungsmediathek Mundo und der dazugehörige Webcrawler Sodix, der aus dem Netz Lernmaterialien fischt und automatisiert in den virtuellen “Bücherschrank” stellt.
Mundo läuft bereits und lockt mit über 43.000-Medien, Educheck soll in zwei Jahren fertig sein, Vidis in drei. Ob die Produkte wirklich so vielversprechend sind, wie sie klingen, lässt sich noch nicht absehen. Wie sie funktionieren, von wem sie genutzt werden, welche Anwendungen die Pädagog:innen unterstützen und den Schülerinnen und Schülern helfen – all das, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Der Erfolg wird auch davon abhängen, wie viel Geld die Länder ins FWU zu stecken wollen und wie viele kundige Digitalexperten das FWU und sein Direktor Michael Frost für sich gewinnen kann.
“Gerade durch die länderübergreifenden Projekte macht das FWU wieder einen Change Prozess durch”, sagt Frost. Um ein Unternehmen digital umzubauen, braucht es kundige Leute. Das weiß auch Michael Frost. Neun Stellen hat er aktuell ausgeschrieben, vom Projektleiter für Educheck bis zu Online-Redakteuren und IT-Projektmanager:innen. Einen bekannten Projektmanager konnte Michael Frost auf dem umkämpften Arbeitsmarkt in und um München herum bereits abwerben: den Identity-Management-Experten Michael Smidt, der seit letztem Jahr das Vidis-Projekt leitet. Sofie Czilwik
Egal um welche digitale Anwendung es geht, wir technisch affinen Lehrer:innen versuchen mit jeglichen medialen Zusätzen, Lernen in der Schule erlebbar zu machen: Mit einer VR-Brille für virtuelle Realität hat man die Chance, dass die Schüler sich gewissermaßen in eine andere Welt beamen. Sie erleben Lerneinheiten ganz anders. Sie sind plötzlich in der historischen Szene des Sturms auf die Bastille und erleben den geschichtlichen Hintergrund scheinbar direkt – und blättern nicht mehr nur im Schulbuch-Kapitel Französische Revolution oder gucken frontal auf dem PC ein Video darüber an. Sie ziehen die Brille auf, tauchen in die Epoche oder Sachwelt ein und begreifen sie mit Händen. In der Regel motiviert das Schüler – gerade bei Themen, die vielleicht nicht so spannend sind, aber halt im Lehrplan stehen.
Man braucht definitiv Platz. Wenn die Schüler:innen mit den Brillen auf dem Kopf in der virtuellen Welt herumlaufen, dann sollten sie in der realen Welt nicht über das Pult im Klassenzimmer stolpern. Natürlich benötigt man starkes WLan, auf jeden Fall einen PC und ein bestimmtes Programm – und die VR-Brillen selbst. Am wichtigsten: die Lehrkraft muss das Programm so aufbereiten können, dass es pädagogisch sinnvoll ist, diese Lektion mit den Schülern virtuell zu erleben – und zu verstehen. Das ist kein Hexenwerk, aber die entscheidende Hürde: Die Lehrer:in muss wissen, wann und wozu die VR-Brille hilft – und wo nicht.
Es wird in meinen Augen unendlich viele beste Möglichkeiten geben, der Fantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Wir haben an unserer beruflichen Schule einen Supermarkt nachgestellt, sodass die Lernenden sich nicht mit der Maus durch den Laden klicken, sondern die Warenpräsentation live erleben und überprüfen können, ob die Regalzonen eingehalten werden usw. In Erdkunde reist man virtuell in den Städten herum oder fährt in Gesteinsschichten ein, in Biologie erkundet man das Innere einer Zelle, in Geschichte die 1938 zerstörte Synagoge Erfurts in Kunst das Städelmuseum im Jahr 1878. Die Lernwelt der Zukunft wird spannender und experimenteller. Wir werden Schüler:innen abholen, die uns bisher nicht zugehört haben.
Ich glaube, wir können uns noch nicht wirklich vorstellen, wie virtuelle und experimentelle Realitäten unsere Lernräume verändern. Es geht nicht nur darum, den Blick ins Biologie-Buch durch die scheinbare Exkursion in ein menschliches Herz zu ersetzen, wo man praktisch in einer Herzkammer zu stehen glaubt. Vielleicht ist die VR-Brille nur ein Zwischenschritt in vermischte Lernwelten, in denen Schüler:innen Marie Curie und Albert Einstein interviewen oder in Martin Luthers Reformation aktiv eingreifen wie in einem Computerspiel. Das ist Zukunftsmusik, aber eine vorstellbare. Zunächst müssen wir allerdings aufpassen, dass sich Schüler:innen nicht am realen Kartenständer verletzen, wenn sie einem virtuellen Lavastrom ausweichen.
Die Kritik ist die, dass erstmal die technischen Voraussetzungen der Schule und das Know-how der Lehrer gegeben sein müssen. Zudem sind die Brillen noch nicht wirklich günstig, von daher ist natürlich die Frage: sitzen 29 Schüler außen rum, während ein Mitschüler virtuell an der Potsdamer Konferenz teilnimmt? Es ist meines Erachtens noch ein Stück des Weges, weil man – wenn die Budgets der Schulen so knapp bleiben – Eltern nicht ohne weiteres für die Finanzierung der kostspieligen Geräte heranziehen kann. Man müsste Lernmittelfreiheit neu definieren. Und es muss natürlich immer auch um den reflektierten pädagogischen Einsatz von virtuellen oder erweiterten Realitäten gehen. Das bedeutet: Zu lernen heißt nicht nur, zu erleben, sondern zu verstehen, zu analysieren und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen.
Saskia Ebel ist Lehrerin für Informatik und BWL an der beruflichen Walter-Eucken-Schule in Karlsruhe. Sie arbeitet am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg im Referat für Innovationen und ist Projektleiterin des Digitalkongresses Wes4.0, der ab Mittwoch wieder stattfindet (online).
29. Oktober 2021
Tag der offenen Tür: Inside Empirische Bildungsforschung
Das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation möchte mit Vorträgen, Filmen und Diskussionen die wichtigsten Fragen bezüglich der Bildungslehre ansprechen und digitale Einblicke in derzeitige Forschungen gewähren. Infos & Anmeldung
3. November 2021, 16:00 bis 17:00 Uhr
Fortbildung: iPad in der Grundschule (Mobile Schule)
Nils Lion klärt in seiner Einsteiger-Fortbildung über die Vorteile und Möglichkeiten der iPad- Nutzung an Grundschulen auf. Unter anderem wird erklärt, wie digitale Vorträge oder Clips erstellt und sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können. Infos & Anmeldung
4. November 2021, 12:30 bis 16:30 Uhr
Tagung Digital Summit des Bündnis für Bildung 2021
Unter dem Motto “Digitale Bildung – jetzt aber nachhaltig!” geht es auf dem Digital Summit um die Digitalisierung und wie diese stetig vorangetrieben werden kann. Hierzu werden verschiedene Diskussionen, Vorträge und Gesprächsrunden angeboten, die zum Austausch von Ideen und Vorstellungen konzipiert wurden. Infos & Anmeldung
