die Konferenz zur Zukunft Europas ging gestern zu Ende. 800 EU-Bürgerinnen und Bürger hatten 49 Vorschläge für ein besseres Europa erarbeitet. Nun gelte es, diese Vorschläge umzusetzen, “entweder, in dem wir die Grenzen der Verträge ausreizen, oder, ja, in dem wir die Verträge ändern, wenn nötig”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei den Feierlichkeiten.
Die EU bereitet unterdessen weiter ein umfassendes Ölembargo gegen Russland vor. Von der Leyen war am Montag nach Ungarn gereist, um mit Viktor Orbán “Fragen im Zusammenhang mit Sanktionen und Energiesicherheit zu klären”.
Um einer drohenden Lebensmittelknappheit aufgrund des Ukraine-Krieges vorzubeugen, lässt die EU-Kommission Ausnahmen bei den gesetzlich vorgeschriebenen Brachflächen zu. Fast alle EU-Länder wollen ihre Brachflächen zumindest temporär wieder landwirtschaftlich nutzen. Deutschland wählt allerdings -wieder einmal – einen Sonderweg. Die Gründe erläutert Timo Landenberger in seiner Analyse.
Woher soll das Geld kommen, das die EU künftig in ihre Verteidigung stecken will? Zur Finanzierung, aber auch zu den Investitionslücken selbst, will die Kommission kommende Woche ihre Analyse vorlegen. Gefördert werden sollen vor allem gemeinsame Projekte der Länder, denn bislang behindert eine ineffiziente Ressourcenverteilung den Aufbau einer europäischen Verteidigung, wie Italiens Ministerpräsident Mario Draghi urteilte. Ella Joyner mit den Hintergründen.
Die Einführung des zweiten, EU-weiten Emissionshandels sozial verträglich zu gestalten – das ist nicht nur nötig, sondern auch möglich, vor allem durch eine “regressive” CO2-Bepreisung, schreiben Martin Menner und Götz Reichert vom Centrum für Europäische Politik im Standpunkt. Denn je niedriger die Belastung für die Bürger:innen, desto höher falle die Akzeptanz für das ETS 2 aus.

Um mehr als ein Viertel ist die Zahl der weltweit akut an Hunger leidenden Menschen im vergangenen Jahr angestiegen. Das geht aus einem Bericht des internationalen Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen hervor, das 2016 von der EU, der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) sowie dem Welternährungsprogramm WFP gegründet wurde. Dem am Mittwoch erschienenen Global Report on Food Crises zufolge hatten 2021 rund 193 Millionen Menschen in 53 Ländern nicht ausreichend Zugang zu Lebensmitteln, 40 Millionen mehr als im letzten Rekordjahr 2020.
Durch den Krieg in der Ukraine werde sich die prekäre Situation noch einmal erheblich verschärfen, heißt es in dem Bericht. Die Ukraine gehört, ebenso wie Russland, zu den wichtigsten Getreide-Exporteuren der Welt. Zahlreiche afrikanische Länder sind von den Lieferungen abhängig. Ägypten, nach Einwohnern das drittgrößte Land des Kontinents, bezieht UN-Daten zufolge über 80 Prozent seines Weizen- und Maisbedarfs aus Russland und der Ukraine, Somalia sogar 100 Prozent.
Doch nun droht ein Totalausfall. Moskau hat einen Exportstopp für Getreide verhängt. In der Ukraine steht die Landwirtschaft aufgrund der Kriegshandlungen weitgehend still. Dazu würden derzeit rund 4,5 Millionen Tonnen an dringend benötigtem Getreide in Häfen der Ukraine blockiert, teilte das WFP vor wenigen Tagen mit. Denn fast die gesamten Lebensmittelexporte aus dem Land erfolgen über den Seeweg, der jedoch aufgrund des Krieges versperrt ist.
Dazu treibt die Lebensmittelknappheit sowie die infolge der Energiepreiskrise enorm gestiegenen Produktionskosten die Inflation weiter an. Der FAO Food Price Index sei zwischen Februar und März um den höchsten jemals verzeichneten Wert gestiegen und befinde sich auf einem Allzeithoch, erklärt Alexander Müller, Geschäftsführer des TMG Think Tank for Sustainability und ehemaliger stellvertretender FAO-Direktor. Auch das bekämen insbesondere die Importländer in Afrika zu spüren, da dort bis zu 80 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel ausgegeben werde, so Müller. Noch sei der Umfang der Ernährungskrise nicht absehbar. Wenn jedoch keine umfangreichen Gegenmaßnahmen getroffen würden, “dann wird es bitterböse enden”.
Auch in Europa machen sich die gestiegenen Preise deutlich bemerkbar, die Versorgung mit Nahrungsmitteln sei jedoch nicht gefährdet. Denn bei der Lebensmittelerzeugung sei der Kontinent weitgehend autark, bekräftigte die EU-Kommission in einer Mitteilung. Die Brüsseler Behörde will aber “alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die EU als Netto-Lebensmittelexporteur und führender Agrar- und Lebensmittelerzeuger zur weltweiten Ernährungssicherheit beiträgt”.
Unter anderem will die Kommission mittels Ausnahmeregelung den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, indem Brachflächen zumindest temporär wieder landwirtschaftlich genutzt werden dürfen. Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist die Stilllegung dieser sogenannten ökologischen Vorrangflächen für Betriebe ab einer Größe von 15 Hektar grundsätzlich verpflichtend.
Die Brachen sollen dem Umwelt- und Artenschutz dienen und umfassen laut Kommission EU-weit rund 1,7 Millionen Hektar (bei knapp 180 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche). Durch die Regelung dürfen dort zunächst auf das Jahr 2022 begrenzt sogenannte Frühjahreskulturen, also insbesondere Getreide, Eiweißpflanzen und Ölsaaten wieder angebaut werden. Einsatz von Pestiziden und mineralischem Dünger inklusive.
Fast alle EU-Staaten machen von der Ausnahmeregelung Gebrauch. “Jeder Hektar, den wir in der EU in Bewirtschaftung bringen, hilft”, sagt etwa Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Lediglich fünf Länder hätten der Kommission gegenüber angekündigt, auf die Möglichkeit verzichten zu wollen, so eine Sprecherin zu Europe.Table. Dazu zähle neben Dänemark, Malta, Rumänien und Irland auch Deutschland. Auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bestätigte die Bundesregierung, dass eine entsprechende Frist abgelaufen und die Nutzung der Ausnahmeregelung nun nicht mehr möglich sei. Das sorgt für heftige Kritik in der Opposition.
Alber Stegemann, Agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU im Bundestag spricht von einer “vertanen Chance für die Ernährungssicherung. Das wird der ethisch-moralischen Verantwortung Deutschlands, die weit über die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinausragt, nicht gerecht.” Agrarpolitik sei auch Sicherheitspolitik. Denn jeder Beitrag aus Deutschland könne für mehr Stabilität in Nordafrika sorgen. Für Marlene Mortler, CSU-Agrarpolitikerin im Europaparlament, ist es “beschämend, wie sich Deutschland derzeit agrarpolitisch in Europa präsentiert.” Die Bundesregierung isoliere sich “mit dieser ideologisch engstirnigen Politik zunehmend in der europäischen Gesellschaft.”
Auch der Deutsche Bauernverband (DBV) kritisiert das Vorgehen Deutschlands. “Die Transformation der Landwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit muss weitergehen, dazu stehen wir, aber wir haben kein Verständnis dafür, dass die Vorgaben aus Brüssel zur verstärkten Nutzung von Brachen und ökologischen Vorrangflächen nicht vollumfänglich in Deutschland umgesetzt werden”, so DBV-Präsident Joachim Rukwied.
Wirklich überraschend kam die Entscheidung, auf die Ausnahmeregelung zu verzichten, indes nicht. Schließlich hatte der Bundesrat bereits Anfang April dem Vorgehen zugestimmt. Demnach dürfen Deutschlands Landwirte auf den Brachflächen zwar keinen Ackerbau betreiben, jedoch den Aufwuchs zur Futternutzung ernten. Die gesamte Ausnahme inklusive Pestizid- und Düngemitteleinsatz sehe man kritisch, so eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums (BMEL).
“Auch wenn der Ukrainekrieg zu Recht im Fokus steht, dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns in einer Lage multipler Krisen befinden und die Bekämpfung von Klimakrise und Artensterben keinen Aufschub mehr erlaubt.” Bereits jetzt sei die Hälfte der Menschheit durch den Klimawandel “hochgradig gefährdet”, auch, da infolge zunehmender Dürren weltweit immer geringere Ernteerträge drohten.
Peter Feindt, Leiter des Fachgebiets Agrar- und Ernährungspolitik an der Berliner Humboldt-Universität, warnte ebenfalls davor, dass kurzfristige Maßnahmen zur Produktionssteigerung langfristig problematisch wirkten. Denn eine etwaige Flächenausweitung treffe unter anderem rasch auf weitere, kaum hinnehmbare Biodiversitätsverluste. Statt knappe finanzielle Mittel zugunsten kurzfristiger Effekte auszugeben, gelte es, langfristig wirksame agrarökologische Konzepte zu verfolgen.
Wie die aussehen könnten, konkretisierte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir am Mittwoch in der ARD-Sendung “Maischberger”. So müsse bei der Verwendung der Getreideernte die Reihenfolge geändert werden. “Bei Tank Trog und Teller sollte meiner Ansicht nach der Teller zuerst kommen”, sagte der Minister. Die Ernährungskrise sei also weniger ein Verfügbarkeits- als vielmehr ein Verteilungsproblem. Tatsächlich werden laut Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft rund 58 Prozent des Getreides in Deutschland als Futtermittel eingesetzt, 20 Prozent zur Nahrungsmittelproduktion und rund 17 Prozent für industrielle und energetische Nutzung.
11.05.-13.05.2022, München
Messe The Smarter E Europe
The Smarter E Europe vereint die vier Messen Electrical Energy Storage Europe, Intersolar Europe, Power to Drive Europe und EM-Power Europe, um einen Einblick in aktuelle Entwicklungen auf dem internationalen Energiemarkt zu geben. INFOS & ANMELDUNG
11.05.-12.05.2022, Madrid (Spanien)
EC, Conference The European Gas Regulatory Forum
The European Gas Regulatory Forum gathers key stakeholders across the European energy sector to discuss opportunities and challenges related to the further development and decarbonisation of the internal EU gas market and to its integration with other energy sectors. INFOS
11.05.-12.05.2022, Frankfurt
Messe Cloud Expo Europe
Die Cloud Expo Europe Frankfurt bringt Cloud-Innovatoren, Technologieexperten und Unternehmensführer zusammen, um bei der Gestaltung der Zukunft und der erfolgreichen digitalen Transformation zu unterstützen. INFOS & REGISTRATION
11.05.-12.05.2022, Berlin/online
Health Capital, Conference Bionnale 2022
Representatives from academia and industry attend the annual life sciences event in Berlin to identify, engage and start strategic relationships. INFOS & REGISTRATION
11.05.2022 – 10:00-10:30 Uhr, online
BMBF, Seminar Missionen in Horizont Europa – Ihre Fördermöglichkeiten: Städte
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt die konkreten Fördermöglichkeiten im Rahmen des aktualisierten Arbeitsprogramms 2021-2022 zur Erfüllung der Mission “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” vor. INFOS & ANMELDUNG
12.05.2022 – 09:00-10:00 Uhr, online
SME2B, Seminar European Free Trade Agreements: How SMEs Can Benefit
The European Entrepreneurs (SME2B) introduces free trade agreements the European Union has with different third countries that can provide the opportunity to make up for the recent international crisis. INFOS & REGISTRATION
12.05.2022 – 09:30-17:15 Uhr, online
LSE, Conference Chillin’ Competition
The London School of Economics (LSE) brings together government officials and academics to discuss the future of competition law and regulation. INFOS & REGISTRATION
12.05.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online
TÜV-Verband, Diskussion EU-Sorgfaltspflichtengesetz
Der TÜV-Verband diskutiert die neuen Verpflichtungen für Unternehmen im Rahmen des EU-Sorgfaltspflichtengesetz und stellt die Frage nach ihrer Effektivität. INFOS & ANMELDUNG
12.05.2022 – 10:00-10:30 Uhr, online
BMBF, Seminar Missionen in Horizont Europa – Ihre Fördermöglichkeiten: Böden
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt die konkreten Fördermöglichkeiten im Rahmen des aktualisierten Arbeitsprogramms 2022 zur Erfüllung der Mission “A Soil Deal for Europe” vor. INFOS & ANMELDUNG
12.05.2022 – 13:30-16:30 Uhr, online
VBI Hauptstadt-Kongress 2022
Der Verband Beratender Ingenieure (VBI) widmet sich dem Thema Mobilität und der drängenden Frage, was zu tun ist, um eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten. INFOS & ANMELDUNG
Anders als in Russland wird das Ende des Zweiten Weltkrieges in der Europäischen Union nicht mehr mit großen Militärparaden gefeiert. Der russische Einmarsch in der Ukraine hat aber auch den Streitkräften in der Europäischen Union neue Aufmerksamkeit beschert: Viele Mitgliedstaaten haben wie Deutschland angekündigt, mehr Geld in Rüstung und militärische Forschung zu investieren.
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine sei eine tektonische Verschiebung für Europa, heißt es im Strategischen Kompass, den die Regierungen vor einigen Wochen beschlossen haben (Europe.Table berichtete). Das 47-seitige Dokument soll die Sicherheitsbelange und das Verhalten der EU für das nächste Jahrzehnt bestimmen. Die EU-Kommission wurde beauftragt, mithilfe der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) die Schwachstellen der Verteidigung in Europa zu ermitteln und bis Mitte Mai geeignete Vorschläge zu unterbreiten.
Das Problem: Die Rüstungsbeschaffung in Europa ist stark fragmentiert. Die Mitgliedstaaten beschaffen den größten Teil ihrer Ausrüstung bei den heimischen Rüstungsfirmen, was oft ineffizient und teuer ist. Seit mehr als einem Jahrzehnt schon bemühen sich die EU-Staaten, der Zersplitterung entgegenzuwirken. Mit überschaubarem Erfolg.
Italiens Ministerpräsident Mario Draghi geißelte dies vergangene Woche im Europaparlament: Die Staaten in Europa gäben dreimal so viel für Verteidigung aus wie Russland, setzten dabei aber auf 146 unterschiedliche Waffensysteme, sagte. “Das ist eine ineffiziente Ressourcenverteilung und behindert den Aufbau einer wahrhaftigen europäischen Verteidigung.” Er sprach sich dafür aus, bei einer hochrangigen Konferenz zu diskutieren, wie die Koordinierung verbessert werden könne.
Zunächst aber ist die EU-Kommission am Zug. Am 18. Mai wird sie nach aktueller Planung ihre Analyse zu den Investitionslücken vorlegen. Die Behörde will sich vorher nicht zu ihren Plänen äußern, aber Brancheninsider sagen, es sei ziemlich klar, was zu erwarten ist. Konkrete Ideen für Verbesserungen liegen schließlich schon länger auf dem Tisch.
Die Kommission werde voraussichtlich neue Ideen zur Finanzierung gemeinsamer Projekte vorlegen, sagt Luigi Scazzieri, Sicherheitsexperte vom Centre for European Reform (CER). Zu diesem Zweck hatte die Kommission bereits den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) eingerichtet, der für den Zeitraum 2021 bis 2027 mit rund acht Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt ausgestattet wurde. Er finanziert gemeinsame EU-Projekte zur Herstellung von Ausrüstung im Rahmen der PESCO-Programme. 25 Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, im Rahmen der ständige strukturierten Zusammenarbeit (Permanent Structured Cooperation – PESCO) bei der Fähigkeitsplanung enger zu kooperieren.
Die Kommission denke voraussichtlich, so Scazzieri, an mehr “mehr Geld für den EDF, mehr Geld für die Verteidigungsforschung, ein neues EDF-Bonussystem, um mehr Mittel für Projekte bereitzustellen, bei denen sich die Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Beschaffung und zum gemeinsamen Eigentum verpflichten”.
Von der Leyen hatte im September überdies eine Senkung der Mehrwertsteuer auf in und für Europa produzierte Rüstungsgüter ins Gespräch gebracht. Die Maßnahme könnte die Interoperabilität fördern und Abhängigkeiten entgegenwirken, sagte die Kommissionschefin in ihrer Rede zur Lage der Union. Die Idee wurde im Februar dann erneut in einer Kommunikation erwähnt. Ähnliche Projekte der EDA sind bereits seit 2015 mehrwertsteuerfrei.
Eine Sprecherin sagte auf Anfrage, die Kommission werde bis Anfang 2023 einen Vorschlag im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation unterbreiten. Zudem prüfe man ein Bonussystem, das mehr EU-Gelder für grenzüberschreitende oder mittelstandsbetriebene Projekte freimache, und andere Finanzierungsmöglichkeiten.
Die ehrgeizigste Option sei die erneute Aufnahme von Schulden auf EU-Ebene ähnlich wie beim Corona-Aufbaufonds, um Verteidigungskapazitäten zu finanzieren, so Scazzieri. Die Kommissionssprecherin bezeichnet dies aber als reine Spekulation. “Und Spekulation kommentieren wir nicht.”
Neue Finanzierungshilfen aber wird es wohl geben. Wohin aber sollte das zusätzliche Geld aus Sicht der EU-Institutionen fließen? Das lasse sich ebenfalls aus existierenden Dokumenten ablesen, so Scazzieri. Die gemeinsamen Prioritäten sind bereits im Strategischen Kompass und im CARD-Bericht der EDA festgelegt. Letzterer wurde bisher nur einmal im 2020 veröffentlicht und gibt einen Überblick über die bestehenden Verteidigungskapazitäten in Europa sowie über mögliche Bereiche der Zusammenarbeit. Es enthält auch konkrete Empfehlungen für Investitionen.
Der Strategische Kompass zielt darauf ab, kritische Lücken bei sogenannten “strategischen Enablern” zu schließen. Dazu zählen laut Scazzieri etwa Lufttransport, Weltraumkommunikationsmittel, amphibische Fähigkeiten, medizinische Mittel, Cyberverteidigung und nachrichtendienstliche Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten.
Im CARD-Bericht wird es noch konkreter. Das Dokument nennt sechs Prioritäten:
Panzer: Die EDA schlug vor, Kampfpanzer für konventionelle Einsätze hoher Intensität und für das Krisenmanagement aufzurüsten, zu modernisieren oder neu zu beschaffen. In 18 Mitgliedstaaten gebe es 4.000 Kampfpanzer, von denen viele veraltet seien. Die bestehenden Flotten sollten im Laufe des nächsten Jahrzehnts und darüber hinaus schrittweise ersetzt werden.
Systeme für Soldaten: Auch die persönliche Ausrüstung der Soldaten in Europa müsse mit den neuesten technologischen Entwicklungen wie dem Internet der Dinge Schritt halten, so die EDA. Das können etwa Kommunikationstechnik, Nachtsichtgeräte oder Handfeuerwaffen sein. Wichtig sei auch, dass die neue Ausrüstung auf einer gemeinsamen europäischen Architektur aufgebaut seien.
Maritim: Die Küsten- und Offshore-Patrouillenschiffe zu erneuern, ist für die EDA ebenfalls eine Priorität. Das Sicherheitsbedürfnis Europas werde auf dem Meer immer größer. Eine Gruppe von Mittelmeerstaaten arbeitet bereits an einem Konzept für eine “Europäische Patrouillen-Korvette” (EPC). Das moderne Schiff sollte in der Lage sein, mehrere Systeme und Nutzlasten aufzunehmen, um eine breite Palette von Aufgaben und Missionen mit einem modularen Ansatz zu erfüllen.
Drohnenabwehr: Die Mitgliedstaaten investieren bereits in großem Umfang in ihre Drohnenabwehrkapazitäten, aber nach Ansicht der EDA ist eine weitere Entwicklung für den Schutz der Streitkräfte wichtig. Dies sollte auch dazu beitragen, einen europäischen Standard für den A2AD-Territorialschutz zu schaffen (Mittel oder Strategien, die einen Gegner daran hindern, ein Land-, See- oder Luftgebiet zu besetzen oder zu durchqueren).
Weltraum: Im Bereich Weltraum geht es bei der EDA um die Entwicklung eines europäischen Konzepts für die Verteidigung, um den Zugang zu Weltraumdiensten und den Schutz weltraumgestützter Anlagen zu verbessern. Investitionen in die Satellitenkommunikation und die Erdbeobachtung seien wichtig.
Militärische Mobilität: Vorrangig geht es darum, innerhalb weniger Jahre die Logistik sowie die Widerstandsfähigkeit der IT-Systeme und -Prozesse unter den Bedingungen der hybriden Kriegsführung zu verbessern (Schutz der Häfen, Cyberverteidigung).
Für Scazzieri klingt das alles logisch. Aber um dies zu ermöglichen, müssten die Regierungen die Verteidigungsausgaben wie zugesagt erhöhen und das zusätzliche Geld kollektiv ausgeben, sagt der CER-Experte. “Wir werden sehen, wie die Versprechen angesichts konkurrierender Prioritäten eingehalten werden können, und die hohe Inflation wird den realen Wert der Budgets auffressen”, sagt er. Viele EU-Staaten würden es schaffen, andere hätten zu kämpfen. Eine große Herausforderung werde auch sein, das Geld kooperativ auszugeben, “da bei der Auftragsvergabe immer noch der Instinkt besteht, national zu denken”, warnt er.
Die Zusammenarbeit werde auch durch die abweichende Wahrnehmung erschwert, sagt Jan Pie, Generalsekretär des Branchenverbands der europäischen Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ASD. Wenn es um Russland gehe, sei die Bedrohungsanalyse unter den Mitgliedstaaten nicht einheitlich: “Das hängt von der geografischen Lage ab, selbst wenn man ein NATO-Land ist.” Neue Panzer könnten entsprechend für Finnland mit seiner Landgrenze zu Russland sinnvoller sein als für Frankreich. Von Ella Joyner
Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen haben den Europatag genutzt, um für eine weitreichende Reform der Europäischen Union zu werben. Frankreichs Präsident sprach sich bei den Feierlichkeiten im Europaparlament in Straßburg dafür aus, dafür auch die europäischen Verträge zu ändern. “Wir werden unsere Texte reformieren müssen”, sagte er. Ein Weg sei die Einberufung eines Verfassungskonvents, wie ihn das Europaparlament fordere.
Macron sprach als amtierender EU-Ratspräsident bei der Abschlussveranstaltung der Konferenz zur Zukunft Europas. In deren Rahmen hatten vier Bürgerpanels mit 800 zufällig ausgewählten Teilnehmern insgesamt 49 Vorschläge erarbeitet (Europe.Table berichtete), der finale Bericht wurde gestern übergeben. Die Bürger hätten der Politik den Weg gewiesen, sagte von der Leyen. Nun gelte es, diesen zu gehen – “entweder, in dem wir die Grenzen der Verträge ausreizen, oder, ja, in dem wir die Verträge ändern, wenn nötig”.
Parlamentspräsidentin Roberta Metsola forderte erneut, dafür einen Konvent einzuberufen. Die Konferenz zur Zukunft Europas habe gezeigt, dass es eine Lücke gebe zwischen den Erwartungen der Bürger und dem, was Europa liefern könne, sagte sie. Macron kündigte an, den kommenden Wochen unter den anderen Staats- und Regierungschefs für ein solches Konvent zu werben und dies auf die Agenda des Gipfels im Juni zu setzen.
Konkret forderte Macron, das Mehrheitsprinzip im Rat auf weitere Felder auszudehnen. Zudem müsse die EU solidarischer werden. Auch die Organisation der europäischen Wahlen, die demokratische Kontrolle und ein Recht des Europaparlaments auf Gesetzesinitiativen gehörten in einem solchen Konvent diskutiert. Reformen seien nötig, um die Handlungsfähigkeit der EU und damit den Zusammenhalt zu stärken.
Vergangene Woche hatte sich bereits Italiens Ministerpräsident Mario Draghi für eine Weiterentwicklung der Verträge ausgesprochen. Parallel zur Ankündigung Macrons veröffentlichten aber 13 EU-Staaten ein gemeinsames Papier, indem sie sich skeptisch äußern zu “unausgegorenen Versuchen, einen Prozess für eine Vertragsänderung zu beginnen”. Europa funktioniert auch so, heißt es in der Stellungnahme. Es gebe keinen Grund, institutionelle Reformen durchführen, um Ergebnisse abzuliefern. Das Papier wurde vor allem von nördlichen und östlichen EU-Ländern unterstützt, darunter Dänemark, Polen, Rumänien und Tschechien.
Macron lässt sich davon nicht beirren. Ihm schwebt ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor, mit Frankreich und anderen als Avantgarde. Um auch Staaten wie die Ukraine an Europa zu binden, deren regulärer EU-Beitritt Jahre und Jahrzehnte dauern werde, müsse es neue Formen der Kooperationen geben: Macron sprach von der “europäischen politischen Gemeinschaft”, die auch Ex-Mitgliedern wie Großbritannien offenstehe. Ziel müsse es sein, demokratischen Staaten einen neuen Raum der politischen Zusammenarbeit zu geben, etwa im Energiebereich, im Verkehr oder der Freizügigkeit von Personen und insbesondere der Jugend. Auch hierfür wolle er in den verbleibenden Wochen der Ratspräsidentschaft werben.
Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich offen für die Idee. Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass Länder des westlichen Balkans, die eine EU-Beitrittsperspektive haben, davon abgehalten werden, sagte Scholz am Abend vor einem Treffen mit Macron im Kanzleramt. Zu den Forderungen nach Vertragsänderungen in der EU sagte Scholz, Deutschland werde dabei nicht auf der Bremse stehen.
Allerdings lasse sich eine effizientere EU auch unterhalb der Ebene von Änderungen der EU-Verträge erreichen. Dazu gehöre auch die Abschaffung der Einstimmigkeit in vielen Politikbereichen. Scholz hatte sich schon kurz nach seinem Amtsantritt gegen entsprechende französischen Forderungen gewandt, weil Vertragsänderungen in der EU oft Jahre brauche.
Von der Leyen kündigte zudem an, sie werde neue Formate für die Beteiligung der Bürger vorschlagen. Die Bürgerpanels sollten die nötigen Ressourcen erhalten, um eigene Empfehlungen zu erarbeiten, bevor die Kommission wichtige Legislativvorschläge vorlege. Zudem wolle sie die Ideen der Konferenz zur Zukunft Europas aufgreifen und in ihrer Rede zur Lage der EU im September erste Vorschläge auf deren Grundlage vorlegen. tho
Europas Bürgerinnen und Bürger wollen zusätzliche Anstrengungen, um den Treibhausgasausstoß von Gas- und Kohlekraftwerken zu reduzieren. Für fossile Kraftwerke in der EU sollten “CO2-Filter” vorgeschrieben werden, heißt es im Abschlussbericht der Konferenz zur Zukunft Europas. Mitgliedstaaten, denen die finanziellen Mittel dafür fehlten, sollten unterstützt werden. Keine Aussage trifft der Bericht dazu, ob das abgeschiedene Kohlendioxid anschließend gespeichert oder in Kohlenstoffkreisläufen wieder genutzt werden soll – zum Beispiel zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen.
Für wenig praktikabel hält den Vorschlag ein Klimaexperte des Wuppertal Instituts. “Wenn wir erneuerbare Energien stark ausbauen, werden Gas- und Kohlekraftwerke nur noch in wenigen Stunden des Jahres laufen“, sagt Stefan Lechtenböhmer, Leiter der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme, auf Anfrage von Europe.Table. Eine Nachrüstung der CO2-Abscheidung sei nur bei neueren Kraftwerken machbar und auch dort nur in Ausnahmefällen wirtschaftlich. Sinnvoll könnte dies beispielsweise sein, wenn dort Biomasse eingesetzt würde und dadurch negative Emissionen möglich würden (BECCS).
“Aus Klimaschutzgründen wäre es sinnvoller, die CO2-Abscheidung direkt mit der unterirdischen Lagerung zu verbinden (DACCS) oder sie während einer Übergangszeit, bis genügend grüner Wasserstoff verfügbar ist, für die Herstellung von blauem Wasserstoff aus Erdgas zu nutzen. Mit dem Wasserstoff könnten sowohl Gaskraftwerke als auch Industrieanlagen nahezu klimaneutral betrieben werden”, sagt Lechtenböhmer. ber
Die Europäische Union will die Genehmigung von erneuerbaren Energien beschleunigen. Deshalb soll einigen Projekten für erneuerbare Energien schon innerhalb eines Jahres die Genehmigung erteilt werden, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der Europe.Table am Montag vorlag. Mit einer Änderung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie will die Kommission die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, für erneuerbare Energien geeignete Land- oder Meeresgebiete auszuweisen, in denen derartige Projekte nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben.
“Das Genehmigungsverfahren für neue Projekte in Gebieten, die für erneuerbare Energien geeignet sind, soll ein Jahr nicht überschreiten”, heißt es in dem Dokument, wobei dieser Zeitraum unter außergewöhnlichen Umständen um drei Monate verlängert werden kann. Im Vergleich dazu gilt in der EU derzeit eine Frist von zwei Jahren für die Genehmigung solcher Vorhaben, die um ein weiteres Jahr verlängert werden kann.
Kern der Beschleunigung ist, dass in den sogenannten “go-to areas” die Pflicht zu projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) entfallen soll. Ausreichen soll stattdessen allein eine Strategische Umweltprüfung (SUP) bei der Auswahl der go-to areas. Ausgenommen von der UVP-Befreiung sind allerdings Feuerungsanlagen für Biomasse sowie Projekte, die wesentliche Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten haben. Bei der Ausweisung der go-to areas sollen “künstliche und bebaute Flächen” Priorität erhalten, zum Beispiel Dächer, Parkplätze, Straßen und Schienenwege sowie degradierte Böden.
Eine UVP-Pflicht gilt in Deutschland zurzeit regelmäßig für große Windparks mit mindestens 20 Anlagen. Schon ab drei Anlagen muss die zuständige Behörde jedoch im Rahmen einer vereinfachten Vorprüfung klären, ob eine UVP-Pflicht besteht.
Die Genehmigung und der Bau von Projekten für erneuerbare Energien würden künftig als im “überragenden öffentlichen Interesse” liegend eingestuft, wie es auch die Bundesregierung vorsieht. Laut dem EU-Entwurf sollen die Staaten allerdings die Möglichkeit erhalten, die Bestimmung auf einzelne Regionen, Technologien oder Projekte mit bestimmten technischen Eigenschaften zu beschränken.
Die Grünen im Europaparlament sehen die Chance verpasst, noch weitere Bestimmungen in die Erneuerbaren-Richtlinie aufzunehmen. “Mit netten Worten und Absichten bauen wir keine Solarzellen oder installieren diese auf Europas Dächern. Aber genau in diese Richtung scheint die EU-Kommission zu gehen. Wir brauchen einen Gesetzesvorschlag mit einer gesetzlich verankerten Solarpflicht und europäischer Solarfinanzierung“, sagte der Abgeordnete Michael Bloss. ber/rtr
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Montag, sie habe in den Gesprächen mit dem Premierminister Ungarns Viktor Orbán über ein mögliches EU-weites Verbot russischer fossiler Brennstoffe Fortschritte erzielt.
“Das Gespräch war hilfreich, um Fragen im Zusammenhang mit Sanktionen und Energiesicherheit zu klären”, so von der Leyen in einem Tweet. “Wir haben Fortschritte gemacht, aber es ist noch mehr Arbeit nötig”, fügte sie hinzu.
Von der Leyen sagte, sie werde eine Videokonferenz mit anderen Ländern in der Region einberufen, um die regionale Zusammenarbeit bei der Öl-Infrastruktur zu stärken. rtr
Die Verhandlungen über Flüssiggas-Lieferungen aus Katar für Deutschland laufen Insidern zufolge zäh. Hauptgrund sei, dass Katar auf langfristigen Lieferverträgen über mindestens 20 Jahre bestehe, sagten mit den Gesprächen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Die deutschen Verhandlungspartner haben daran allerdings wenig Interesse, da Deutschland bereits 2045 klimaneutral sein will.
Gemäß den jüngsten vom Kabinett beschlossenen Gesetzesvorhaben soll der Energiesektor bereits 2035 praktisch ohne CO2-Ausstoß auskommen. Das würde also bedeuten, dass dann auch kein Gas mehr zum Heizen oder zur Stromerzeugung eingesetzt werden darf. Für die nächsten Jahre ist Deutschland jedoch auf Flüssiggas angewiesen, um das Pipeline-Gas aus Russland zu ersetzen.
Das Bundeswirtschaftsministerium äußerte sich auf Anfrage ebenso wenig wie die Regierung von Katar. Auch die Gas-Importeure Uniper und RWE wollten zu den Gesprächen nichts sagen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte Katar im März besucht und anschließend von einer Energiepartnerschaft berichtet. Den Insidern zufolge will der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, noch im Mai nach Deutschland kommen und dort eine Vereinbarung unterschreiben. Dies heiße aber nicht, dass damit auch Lieferverträge schon vereinbart würden, sagten mit den Besuchsplänen Vertraute. rtr
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich gestern über den russischen Angriff auf die Ukraine und seine Auswirkungen unter anderem auf die globale Nahrungsmittelversorgung und Energiesicherheit ausgetauscht. Außerdem sei es in der Videokonferenz von Scholz und Xi Jinping um “die Entwicklung und die Konsequenzen der Covid-19-Pandemie, eine vertiefte Kooperation beim Klimaschutz, die Energietransformation sowie die EU-China-Beziehungen” gegangen. Zudem sei über eine weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen und über die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich gesprochen worden, teilte die Bundesregierung in einer nur elfzeiligen Pressemitteilung mit.
Am Sonntag hatte SPD-Chef Lars Klingbeil in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix zu einem anderen Auftreten im Umgang mit der Volksrepublik aufgerufen. Politik und Wirtschaft hätten im Falle Russlands stets auf einen politischen Konsens mit Moskau gedrungen. Das sei ein Fehler gewesen, gestand Klingbeil ein und zog daraus den Schluss, dass man China gegenüber “heute anders auftreten und kritischer sein” müsse. China hat die russische Invasion der Ukraine nicht verurteilt, sondern schiebt die Schuld für den Krieg auf die USA und die Nato. grz
Der Hersteller von Dating-Apps, Match, verklagte am Montag Google und bezeichnete die Klage als “letzten Ausweg”, um zu verhindern, dass Tinder und seine anderen Apps aus dem Play Store verbannt werden. Sie weigern sich, bis zu 30 Prozent ihrer Umsätze zu teilen.
Die Klage von Match ist die jüngste, die sich gegen Googles angeblich wettbewerbswidriges Verhalten im Play Store richtet. Sie reiht sich ein in die laufenden Klagen des “Fortnite”-Herstellers Epic Games, Dutzender Generalstaatsanwälte von US-Bundesstaaten und anderer.
Google hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu der neuen Klage nicht reagiert, erklärte jedoch, dass Entwickler die Möglichkeit haben, den Play Store zu umgehen. Außerdem habe Google die Gebühren gesenkt und andere Programme geschaffen, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen. rtr
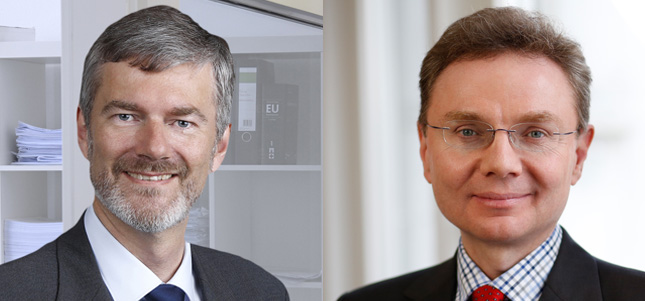
Es ist der umstrittenste Vorschlag des “Fit for 55“-Klimapakets der Europäischen Kommission: die Einführung eines separaten EU-Emissionshandels für die CO2-Emissionen von Gebäuden und Straßenfahrzeugen (ETS 2). Kein Wunder: Um die verschärften EU-Klimaziele auch in diesen Sektoren erreichen zu können, würde das ETS 2 fossile Kraft- und Heizstoffe verteuern. Alle könnten künftig direkt von der Zapfsäule und ihrer Heizkostenrechnung ablesen, dass Klimaschutz seinen Preis hat. Das ist immer unpopulär, und gerade in Zeiten stark steigender Inflation träfe dies insbesondere Menschen mit niedrigerem und auch mittlerem Einkommen hart.
Niemand will soziale Verwerfungen, und der Politik stehen noch die französischen Gelbwesten-Proteste lebhaft vor Augen, die sich an einem CO2-Preisaufschlag auf Benzin und Diesel entzündeten. Von Anfang an war daher auch der Widerstand gegen ein ETS 2 groß – nicht allein von osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, sondern selbst innerhalb der Kommission, die daher zur sozialen Abfederung auch einen Klima-Sozialfonds vorgeschlagen hat.
Dennoch droht jetzt das ETS 2 sowohl im Europäischen Parlament als auch im Rat ganz zu scheitern. Klimapolitisch wäre dies ein fataler Fehler, denn ein ETS 2 kann CO2-Emissionen wirksamer und kostengünstiger als andere Klimaschutzinstrumente senken sowie zugleich sozial ausgestaltet werden.
Während die CO2-Emissionen von energieintensiven Industrien und Energieerzeugern bereits seit 2005 vom ETS 1 gedeckelt und wunschgemäß gesenkt wurden, ist im gleichen Zeitraum der CO2-Ausstoß von Gebäuden kaum gesunken und der des Straßenverkehrs trotz verschiedener Klimaschutzmaßnahmen wie CO2-Flottengrenzwerten für Pkw, Kleintransporter und Lkw sogar gestiegen. Dafür gibt es Gründe:
Entscheidend ist, dass ein Emissionshandel die Gesamtmenge an Emissionsrechten und damit die maximal erlaubten CO2-Emissionen deckelt (“Cap”) und stetig absenkt, sodass das vorab festgelegte EU-Klimaziel sicher erreicht wird. Im ETS 2 müssen Unternehmen für die von ihnen auf den Markt gebrachte Brennstoffmenge eine entsprechende Zahl an Emissionsrechten abgeben (“Upstream-Emissionshandel”). Die stetige Verknappung der verfügbaren Emissionsrechte führt dazu, dass ihr Preis steigt und sich folglich die Nutzung von zum Beispiel fossiler Kraftstoffe im Vergleich zu CO2-ärmeren Alternativen entsprechend verteuert.
Auf diese Weise setzte das CO2-Preissignal Anreize für CO2-sparendes Verhalten. So kann man angesichts steigender Spritpreise weniger und langsamer fahren, zu einem spritsparenden Fahrzeug wechseln oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
Im Gegensatz dazu haben zum Beispiel im Straßenverkehrssektor die bereits seit Jahren geltenden CO2-Grenzwerte für Straßenfahrzeuge weder eine effektive noch eine kosteneffiziente CO2-Reduktion erreichen können. Das liegt nicht nur daran, dass sie im Gegensatz zu einem Emissionshandel nur für Neu- und nicht auch für Altfahrzeuge gelten. Vielmehr führen durch CO2-Grenzwerte verordnete kraftstoffeffizientere Fahrzeuge zwar zu relativen Kraftstoffeinsparungen. Die dadurch eingesparten Kraftstoffkosten regen tendenziell jedoch dazu an, schwerere und leistungsstärkere Fahrzeuge zu fahren sowie mehr Kilometer zurückzulegen. Unterm Strich steigen so sogar der absolute Kraftstoffverbrauch und der damit verbundene CO2-Ausstoß. Das sinkende Cap des ETS 2 würde solchen “Rebound-Effekten” entgegenwirken.
Außerdem würde vom ETS 2 das starke Signal ausgehen, dass die Preise fossiler Kraft- und Heizstoffe langfristig steigen werden, selbst wenn der Weltmarktpreis für Öl- und Gas wieder sinkt. Hierauf können sich Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen einstellen, sodass Planungs- und Investitionssicherheit für die Umstellung zum Beispiel auf alternative Fahrzeugantriebe und CO2-arme Heizungen besteht. Zudem wird durch die Dekarbonisierung dieser Sektoren Europa unabhängiger vom Import fossiler Energien, auch aus Russland.
Insgesamt würde ohne das ETS 2 das zentrale Element der nach der Gesamtkonzeption des “Fit for 55”-Klimapakets aufeinander bezogenen Instrumente zur CO2-Reduktion bei Gebäuden und im Straßenverkehr fehlen. Die EU kann es sich jedoch angesichts der klimapolitischen Versäumnisse der Vergangenheit und ihrer verschärften Klimaziele schlicht nicht weiter leisten, auf die Einführung eines Emissionshandels auch für diese Sektoren zu verzichten.
Europäische Klimapolitik kann auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn sie sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern als auch zwischen den Mitgliedstaaten als sozial ausgewogen akzeptiert wird. Die gute Nachricht ist, dass ein ETS 2 durchaus sozial ausgestaltet werden kann.
Entscheidend für eine breite Akzeptanz des ETS 2 in der Bevölkerung ist nicht die Höhe des von ihm erzeugten CO2-Preises für fossile Kraft- und Heizstoffe, sondern die effektive Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Durch eine geeignete Verwendung der Erlöse aus der Versteigerung von ETS 2-Zertifikaten und die Ausgestaltung des vorgeschlagenen Klima-Sozialfonds lassen sich durch Pro-Kopf-Transferzahlungen übermäßige Belastungen niedriger und mittlerer Einkommen vermeiden.
Werden ETS 2-Versteigerungserlöse weitgehend als identische Pro-Kopf-Zahlungen an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt, die diese ab einer gewissen Einkommenshöhe versteuern müssen, können weite Teile der Bevölkerung hinreichend für die steigenden CO2-Preise des ETS 2 kompensiert werden. Damit führt die “regressive” CO2-Bepreisung insgesamt zu einer mit dem Einkommen abnehmenden Entlastung. Dies ist sozial gerecht, denn Bürgerinnen und Bürger mit höheren Einkommen heizen im Schnitt mehr Wohnraum, fahren größere Autos und verursachen folglich mehr CO2-Emissionen. Klimaschutzmaßnahmen werden zudem sozial gerechter durch “progressive” Steuern finanziert statt durch einen “regressiven” CO2-Preis.
Würden die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, einen Gutteil der ETS 2-Versteigerungserlöse pro Kopf an ihre Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen und Härtefälle gezielt zu unterstützen, entfiele auch die aufwendige Aufstellung umfangreicher Klima-Sozialpläne, wie sie die Kommission vorgeschlagen hat. Durch Wegfall der bürokratischen Klima-Sozialpläne würde der Klimasozialfonds so zum reinen Transferinstrument.
Insgesamt ist eine soziale Ausgestaltung des ETS 2 möglich. Auch wenn kurzfristig die aktuell stark steigende Inflation und explodierende Energiepreise den Widerstand gegen die Einführung einer CO2-Bepreisung fossiler Kraft- und Heizstoffe verstärken, ist ein ETS 2 langfristig der richtige Weg zur Dekarbonisierung des Gebäude- und Straßenverkehrssektors. Daher sollten sich jetzt das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung für den Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit bewusst sein und sich nicht weiter aus unberechtigter Furcht vor sozialen Verwerfungen gegen das wirksame, kosteneffiziente und sozial gestaltbare Klimaschutzinstrument des ETS 2 sperren. Diese klimapolitische Chance darf jetzt nicht verspielt werden.
die Konferenz zur Zukunft Europas ging gestern zu Ende. 800 EU-Bürgerinnen und Bürger hatten 49 Vorschläge für ein besseres Europa erarbeitet. Nun gelte es, diese Vorschläge umzusetzen, “entweder, in dem wir die Grenzen der Verträge ausreizen, oder, ja, in dem wir die Verträge ändern, wenn nötig”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei den Feierlichkeiten.
Die EU bereitet unterdessen weiter ein umfassendes Ölembargo gegen Russland vor. Von der Leyen war am Montag nach Ungarn gereist, um mit Viktor Orbán “Fragen im Zusammenhang mit Sanktionen und Energiesicherheit zu klären”.
Um einer drohenden Lebensmittelknappheit aufgrund des Ukraine-Krieges vorzubeugen, lässt die EU-Kommission Ausnahmen bei den gesetzlich vorgeschriebenen Brachflächen zu. Fast alle EU-Länder wollen ihre Brachflächen zumindest temporär wieder landwirtschaftlich nutzen. Deutschland wählt allerdings -wieder einmal – einen Sonderweg. Die Gründe erläutert Timo Landenberger in seiner Analyse.
Woher soll das Geld kommen, das die EU künftig in ihre Verteidigung stecken will? Zur Finanzierung, aber auch zu den Investitionslücken selbst, will die Kommission kommende Woche ihre Analyse vorlegen. Gefördert werden sollen vor allem gemeinsame Projekte der Länder, denn bislang behindert eine ineffiziente Ressourcenverteilung den Aufbau einer europäischen Verteidigung, wie Italiens Ministerpräsident Mario Draghi urteilte. Ella Joyner mit den Hintergründen.
Die Einführung des zweiten, EU-weiten Emissionshandels sozial verträglich zu gestalten – das ist nicht nur nötig, sondern auch möglich, vor allem durch eine “regressive” CO2-Bepreisung, schreiben Martin Menner und Götz Reichert vom Centrum für Europäische Politik im Standpunkt. Denn je niedriger die Belastung für die Bürger:innen, desto höher falle die Akzeptanz für das ETS 2 aus.

Um mehr als ein Viertel ist die Zahl der weltweit akut an Hunger leidenden Menschen im vergangenen Jahr angestiegen. Das geht aus einem Bericht des internationalen Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen hervor, das 2016 von der EU, der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) sowie dem Welternährungsprogramm WFP gegründet wurde. Dem am Mittwoch erschienenen Global Report on Food Crises zufolge hatten 2021 rund 193 Millionen Menschen in 53 Ländern nicht ausreichend Zugang zu Lebensmitteln, 40 Millionen mehr als im letzten Rekordjahr 2020.
Durch den Krieg in der Ukraine werde sich die prekäre Situation noch einmal erheblich verschärfen, heißt es in dem Bericht. Die Ukraine gehört, ebenso wie Russland, zu den wichtigsten Getreide-Exporteuren der Welt. Zahlreiche afrikanische Länder sind von den Lieferungen abhängig. Ägypten, nach Einwohnern das drittgrößte Land des Kontinents, bezieht UN-Daten zufolge über 80 Prozent seines Weizen- und Maisbedarfs aus Russland und der Ukraine, Somalia sogar 100 Prozent.
Doch nun droht ein Totalausfall. Moskau hat einen Exportstopp für Getreide verhängt. In der Ukraine steht die Landwirtschaft aufgrund der Kriegshandlungen weitgehend still. Dazu würden derzeit rund 4,5 Millionen Tonnen an dringend benötigtem Getreide in Häfen der Ukraine blockiert, teilte das WFP vor wenigen Tagen mit. Denn fast die gesamten Lebensmittelexporte aus dem Land erfolgen über den Seeweg, der jedoch aufgrund des Krieges versperrt ist.
Dazu treibt die Lebensmittelknappheit sowie die infolge der Energiepreiskrise enorm gestiegenen Produktionskosten die Inflation weiter an. Der FAO Food Price Index sei zwischen Februar und März um den höchsten jemals verzeichneten Wert gestiegen und befinde sich auf einem Allzeithoch, erklärt Alexander Müller, Geschäftsführer des TMG Think Tank for Sustainability und ehemaliger stellvertretender FAO-Direktor. Auch das bekämen insbesondere die Importländer in Afrika zu spüren, da dort bis zu 80 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel ausgegeben werde, so Müller. Noch sei der Umfang der Ernährungskrise nicht absehbar. Wenn jedoch keine umfangreichen Gegenmaßnahmen getroffen würden, “dann wird es bitterböse enden”.
Auch in Europa machen sich die gestiegenen Preise deutlich bemerkbar, die Versorgung mit Nahrungsmitteln sei jedoch nicht gefährdet. Denn bei der Lebensmittelerzeugung sei der Kontinent weitgehend autark, bekräftigte die EU-Kommission in einer Mitteilung. Die Brüsseler Behörde will aber “alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die EU als Netto-Lebensmittelexporteur und führender Agrar- und Lebensmittelerzeuger zur weltweiten Ernährungssicherheit beiträgt”.
Unter anderem will die Kommission mittels Ausnahmeregelung den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, indem Brachflächen zumindest temporär wieder landwirtschaftlich genutzt werden dürfen. Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist die Stilllegung dieser sogenannten ökologischen Vorrangflächen für Betriebe ab einer Größe von 15 Hektar grundsätzlich verpflichtend.
Die Brachen sollen dem Umwelt- und Artenschutz dienen und umfassen laut Kommission EU-weit rund 1,7 Millionen Hektar (bei knapp 180 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche). Durch die Regelung dürfen dort zunächst auf das Jahr 2022 begrenzt sogenannte Frühjahreskulturen, also insbesondere Getreide, Eiweißpflanzen und Ölsaaten wieder angebaut werden. Einsatz von Pestiziden und mineralischem Dünger inklusive.
Fast alle EU-Staaten machen von der Ausnahmeregelung Gebrauch. “Jeder Hektar, den wir in der EU in Bewirtschaftung bringen, hilft”, sagt etwa Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Lediglich fünf Länder hätten der Kommission gegenüber angekündigt, auf die Möglichkeit verzichten zu wollen, so eine Sprecherin zu Europe.Table. Dazu zähle neben Dänemark, Malta, Rumänien und Irland auch Deutschland. Auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bestätigte die Bundesregierung, dass eine entsprechende Frist abgelaufen und die Nutzung der Ausnahmeregelung nun nicht mehr möglich sei. Das sorgt für heftige Kritik in der Opposition.
Alber Stegemann, Agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU im Bundestag spricht von einer “vertanen Chance für die Ernährungssicherung. Das wird der ethisch-moralischen Verantwortung Deutschlands, die weit über die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinausragt, nicht gerecht.” Agrarpolitik sei auch Sicherheitspolitik. Denn jeder Beitrag aus Deutschland könne für mehr Stabilität in Nordafrika sorgen. Für Marlene Mortler, CSU-Agrarpolitikerin im Europaparlament, ist es “beschämend, wie sich Deutschland derzeit agrarpolitisch in Europa präsentiert.” Die Bundesregierung isoliere sich “mit dieser ideologisch engstirnigen Politik zunehmend in der europäischen Gesellschaft.”
Auch der Deutsche Bauernverband (DBV) kritisiert das Vorgehen Deutschlands. “Die Transformation der Landwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit muss weitergehen, dazu stehen wir, aber wir haben kein Verständnis dafür, dass die Vorgaben aus Brüssel zur verstärkten Nutzung von Brachen und ökologischen Vorrangflächen nicht vollumfänglich in Deutschland umgesetzt werden”, so DBV-Präsident Joachim Rukwied.
Wirklich überraschend kam die Entscheidung, auf die Ausnahmeregelung zu verzichten, indes nicht. Schließlich hatte der Bundesrat bereits Anfang April dem Vorgehen zugestimmt. Demnach dürfen Deutschlands Landwirte auf den Brachflächen zwar keinen Ackerbau betreiben, jedoch den Aufwuchs zur Futternutzung ernten. Die gesamte Ausnahme inklusive Pestizid- und Düngemitteleinsatz sehe man kritisch, so eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums (BMEL).
“Auch wenn der Ukrainekrieg zu Recht im Fokus steht, dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns in einer Lage multipler Krisen befinden und die Bekämpfung von Klimakrise und Artensterben keinen Aufschub mehr erlaubt.” Bereits jetzt sei die Hälfte der Menschheit durch den Klimawandel “hochgradig gefährdet”, auch, da infolge zunehmender Dürren weltweit immer geringere Ernteerträge drohten.
Peter Feindt, Leiter des Fachgebiets Agrar- und Ernährungspolitik an der Berliner Humboldt-Universität, warnte ebenfalls davor, dass kurzfristige Maßnahmen zur Produktionssteigerung langfristig problematisch wirkten. Denn eine etwaige Flächenausweitung treffe unter anderem rasch auf weitere, kaum hinnehmbare Biodiversitätsverluste. Statt knappe finanzielle Mittel zugunsten kurzfristiger Effekte auszugeben, gelte es, langfristig wirksame agrarökologische Konzepte zu verfolgen.
Wie die aussehen könnten, konkretisierte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir am Mittwoch in der ARD-Sendung “Maischberger”. So müsse bei der Verwendung der Getreideernte die Reihenfolge geändert werden. “Bei Tank Trog und Teller sollte meiner Ansicht nach der Teller zuerst kommen”, sagte der Minister. Die Ernährungskrise sei also weniger ein Verfügbarkeits- als vielmehr ein Verteilungsproblem. Tatsächlich werden laut Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft rund 58 Prozent des Getreides in Deutschland als Futtermittel eingesetzt, 20 Prozent zur Nahrungsmittelproduktion und rund 17 Prozent für industrielle und energetische Nutzung.
11.05.-13.05.2022, München
Messe The Smarter E Europe
The Smarter E Europe vereint die vier Messen Electrical Energy Storage Europe, Intersolar Europe, Power to Drive Europe und EM-Power Europe, um einen Einblick in aktuelle Entwicklungen auf dem internationalen Energiemarkt zu geben. INFOS & ANMELDUNG
11.05.-12.05.2022, Madrid (Spanien)
EC, Conference The European Gas Regulatory Forum
The European Gas Regulatory Forum gathers key stakeholders across the European energy sector to discuss opportunities and challenges related to the further development and decarbonisation of the internal EU gas market and to its integration with other energy sectors. INFOS
11.05.-12.05.2022, Frankfurt
Messe Cloud Expo Europe
Die Cloud Expo Europe Frankfurt bringt Cloud-Innovatoren, Technologieexperten und Unternehmensführer zusammen, um bei der Gestaltung der Zukunft und der erfolgreichen digitalen Transformation zu unterstützen. INFOS & REGISTRATION
11.05.-12.05.2022, Berlin/online
Health Capital, Conference Bionnale 2022
Representatives from academia and industry attend the annual life sciences event in Berlin to identify, engage and start strategic relationships. INFOS & REGISTRATION
11.05.2022 – 10:00-10:30 Uhr, online
BMBF, Seminar Missionen in Horizont Europa – Ihre Fördermöglichkeiten: Städte
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt die konkreten Fördermöglichkeiten im Rahmen des aktualisierten Arbeitsprogramms 2021-2022 zur Erfüllung der Mission “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” vor. INFOS & ANMELDUNG
12.05.2022 – 09:00-10:00 Uhr, online
SME2B, Seminar European Free Trade Agreements: How SMEs Can Benefit
The European Entrepreneurs (SME2B) introduces free trade agreements the European Union has with different third countries that can provide the opportunity to make up for the recent international crisis. INFOS & REGISTRATION
12.05.2022 – 09:30-17:15 Uhr, online
LSE, Conference Chillin’ Competition
The London School of Economics (LSE) brings together government officials and academics to discuss the future of competition law and regulation. INFOS & REGISTRATION
12.05.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online
TÜV-Verband, Diskussion EU-Sorgfaltspflichtengesetz
Der TÜV-Verband diskutiert die neuen Verpflichtungen für Unternehmen im Rahmen des EU-Sorgfaltspflichtengesetz und stellt die Frage nach ihrer Effektivität. INFOS & ANMELDUNG
12.05.2022 – 10:00-10:30 Uhr, online
BMBF, Seminar Missionen in Horizont Europa – Ihre Fördermöglichkeiten: Böden
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt die konkreten Fördermöglichkeiten im Rahmen des aktualisierten Arbeitsprogramms 2022 zur Erfüllung der Mission “A Soil Deal for Europe” vor. INFOS & ANMELDUNG
12.05.2022 – 13:30-16:30 Uhr, online
VBI Hauptstadt-Kongress 2022
Der Verband Beratender Ingenieure (VBI) widmet sich dem Thema Mobilität und der drängenden Frage, was zu tun ist, um eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten. INFOS & ANMELDUNG
Anders als in Russland wird das Ende des Zweiten Weltkrieges in der Europäischen Union nicht mehr mit großen Militärparaden gefeiert. Der russische Einmarsch in der Ukraine hat aber auch den Streitkräften in der Europäischen Union neue Aufmerksamkeit beschert: Viele Mitgliedstaaten haben wie Deutschland angekündigt, mehr Geld in Rüstung und militärische Forschung zu investieren.
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine sei eine tektonische Verschiebung für Europa, heißt es im Strategischen Kompass, den die Regierungen vor einigen Wochen beschlossen haben (Europe.Table berichtete). Das 47-seitige Dokument soll die Sicherheitsbelange und das Verhalten der EU für das nächste Jahrzehnt bestimmen. Die EU-Kommission wurde beauftragt, mithilfe der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) die Schwachstellen der Verteidigung in Europa zu ermitteln und bis Mitte Mai geeignete Vorschläge zu unterbreiten.
Das Problem: Die Rüstungsbeschaffung in Europa ist stark fragmentiert. Die Mitgliedstaaten beschaffen den größten Teil ihrer Ausrüstung bei den heimischen Rüstungsfirmen, was oft ineffizient und teuer ist. Seit mehr als einem Jahrzehnt schon bemühen sich die EU-Staaten, der Zersplitterung entgegenzuwirken. Mit überschaubarem Erfolg.
Italiens Ministerpräsident Mario Draghi geißelte dies vergangene Woche im Europaparlament: Die Staaten in Europa gäben dreimal so viel für Verteidigung aus wie Russland, setzten dabei aber auf 146 unterschiedliche Waffensysteme, sagte. “Das ist eine ineffiziente Ressourcenverteilung und behindert den Aufbau einer wahrhaftigen europäischen Verteidigung.” Er sprach sich dafür aus, bei einer hochrangigen Konferenz zu diskutieren, wie die Koordinierung verbessert werden könne.
Zunächst aber ist die EU-Kommission am Zug. Am 18. Mai wird sie nach aktueller Planung ihre Analyse zu den Investitionslücken vorlegen. Die Behörde will sich vorher nicht zu ihren Plänen äußern, aber Brancheninsider sagen, es sei ziemlich klar, was zu erwarten ist. Konkrete Ideen für Verbesserungen liegen schließlich schon länger auf dem Tisch.
Die Kommission werde voraussichtlich neue Ideen zur Finanzierung gemeinsamer Projekte vorlegen, sagt Luigi Scazzieri, Sicherheitsexperte vom Centre for European Reform (CER). Zu diesem Zweck hatte die Kommission bereits den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) eingerichtet, der für den Zeitraum 2021 bis 2027 mit rund acht Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt ausgestattet wurde. Er finanziert gemeinsame EU-Projekte zur Herstellung von Ausrüstung im Rahmen der PESCO-Programme. 25 Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, im Rahmen der ständige strukturierten Zusammenarbeit (Permanent Structured Cooperation – PESCO) bei der Fähigkeitsplanung enger zu kooperieren.
Die Kommission denke voraussichtlich, so Scazzieri, an mehr “mehr Geld für den EDF, mehr Geld für die Verteidigungsforschung, ein neues EDF-Bonussystem, um mehr Mittel für Projekte bereitzustellen, bei denen sich die Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Beschaffung und zum gemeinsamen Eigentum verpflichten”.
Von der Leyen hatte im September überdies eine Senkung der Mehrwertsteuer auf in und für Europa produzierte Rüstungsgüter ins Gespräch gebracht. Die Maßnahme könnte die Interoperabilität fördern und Abhängigkeiten entgegenwirken, sagte die Kommissionschefin in ihrer Rede zur Lage der Union. Die Idee wurde im Februar dann erneut in einer Kommunikation erwähnt. Ähnliche Projekte der EDA sind bereits seit 2015 mehrwertsteuerfrei.
Eine Sprecherin sagte auf Anfrage, die Kommission werde bis Anfang 2023 einen Vorschlag im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation unterbreiten. Zudem prüfe man ein Bonussystem, das mehr EU-Gelder für grenzüberschreitende oder mittelstandsbetriebene Projekte freimache, und andere Finanzierungsmöglichkeiten.
Die ehrgeizigste Option sei die erneute Aufnahme von Schulden auf EU-Ebene ähnlich wie beim Corona-Aufbaufonds, um Verteidigungskapazitäten zu finanzieren, so Scazzieri. Die Kommissionssprecherin bezeichnet dies aber als reine Spekulation. “Und Spekulation kommentieren wir nicht.”
Neue Finanzierungshilfen aber wird es wohl geben. Wohin aber sollte das zusätzliche Geld aus Sicht der EU-Institutionen fließen? Das lasse sich ebenfalls aus existierenden Dokumenten ablesen, so Scazzieri. Die gemeinsamen Prioritäten sind bereits im Strategischen Kompass und im CARD-Bericht der EDA festgelegt. Letzterer wurde bisher nur einmal im 2020 veröffentlicht und gibt einen Überblick über die bestehenden Verteidigungskapazitäten in Europa sowie über mögliche Bereiche der Zusammenarbeit. Es enthält auch konkrete Empfehlungen für Investitionen.
Der Strategische Kompass zielt darauf ab, kritische Lücken bei sogenannten “strategischen Enablern” zu schließen. Dazu zählen laut Scazzieri etwa Lufttransport, Weltraumkommunikationsmittel, amphibische Fähigkeiten, medizinische Mittel, Cyberverteidigung und nachrichtendienstliche Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten.
Im CARD-Bericht wird es noch konkreter. Das Dokument nennt sechs Prioritäten:
Panzer: Die EDA schlug vor, Kampfpanzer für konventionelle Einsätze hoher Intensität und für das Krisenmanagement aufzurüsten, zu modernisieren oder neu zu beschaffen. In 18 Mitgliedstaaten gebe es 4.000 Kampfpanzer, von denen viele veraltet seien. Die bestehenden Flotten sollten im Laufe des nächsten Jahrzehnts und darüber hinaus schrittweise ersetzt werden.
Systeme für Soldaten: Auch die persönliche Ausrüstung der Soldaten in Europa müsse mit den neuesten technologischen Entwicklungen wie dem Internet der Dinge Schritt halten, so die EDA. Das können etwa Kommunikationstechnik, Nachtsichtgeräte oder Handfeuerwaffen sein. Wichtig sei auch, dass die neue Ausrüstung auf einer gemeinsamen europäischen Architektur aufgebaut seien.
Maritim: Die Küsten- und Offshore-Patrouillenschiffe zu erneuern, ist für die EDA ebenfalls eine Priorität. Das Sicherheitsbedürfnis Europas werde auf dem Meer immer größer. Eine Gruppe von Mittelmeerstaaten arbeitet bereits an einem Konzept für eine “Europäische Patrouillen-Korvette” (EPC). Das moderne Schiff sollte in der Lage sein, mehrere Systeme und Nutzlasten aufzunehmen, um eine breite Palette von Aufgaben und Missionen mit einem modularen Ansatz zu erfüllen.
Drohnenabwehr: Die Mitgliedstaaten investieren bereits in großem Umfang in ihre Drohnenabwehrkapazitäten, aber nach Ansicht der EDA ist eine weitere Entwicklung für den Schutz der Streitkräfte wichtig. Dies sollte auch dazu beitragen, einen europäischen Standard für den A2AD-Territorialschutz zu schaffen (Mittel oder Strategien, die einen Gegner daran hindern, ein Land-, See- oder Luftgebiet zu besetzen oder zu durchqueren).
Weltraum: Im Bereich Weltraum geht es bei der EDA um die Entwicklung eines europäischen Konzepts für die Verteidigung, um den Zugang zu Weltraumdiensten und den Schutz weltraumgestützter Anlagen zu verbessern. Investitionen in die Satellitenkommunikation und die Erdbeobachtung seien wichtig.
Militärische Mobilität: Vorrangig geht es darum, innerhalb weniger Jahre die Logistik sowie die Widerstandsfähigkeit der IT-Systeme und -Prozesse unter den Bedingungen der hybriden Kriegsführung zu verbessern (Schutz der Häfen, Cyberverteidigung).
Für Scazzieri klingt das alles logisch. Aber um dies zu ermöglichen, müssten die Regierungen die Verteidigungsausgaben wie zugesagt erhöhen und das zusätzliche Geld kollektiv ausgeben, sagt der CER-Experte. “Wir werden sehen, wie die Versprechen angesichts konkurrierender Prioritäten eingehalten werden können, und die hohe Inflation wird den realen Wert der Budgets auffressen”, sagt er. Viele EU-Staaten würden es schaffen, andere hätten zu kämpfen. Eine große Herausforderung werde auch sein, das Geld kooperativ auszugeben, “da bei der Auftragsvergabe immer noch der Instinkt besteht, national zu denken”, warnt er.
Die Zusammenarbeit werde auch durch die abweichende Wahrnehmung erschwert, sagt Jan Pie, Generalsekretär des Branchenverbands der europäischen Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ASD. Wenn es um Russland gehe, sei die Bedrohungsanalyse unter den Mitgliedstaaten nicht einheitlich: “Das hängt von der geografischen Lage ab, selbst wenn man ein NATO-Land ist.” Neue Panzer könnten entsprechend für Finnland mit seiner Landgrenze zu Russland sinnvoller sein als für Frankreich. Von Ella Joyner
Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen haben den Europatag genutzt, um für eine weitreichende Reform der Europäischen Union zu werben. Frankreichs Präsident sprach sich bei den Feierlichkeiten im Europaparlament in Straßburg dafür aus, dafür auch die europäischen Verträge zu ändern. “Wir werden unsere Texte reformieren müssen”, sagte er. Ein Weg sei die Einberufung eines Verfassungskonvents, wie ihn das Europaparlament fordere.
Macron sprach als amtierender EU-Ratspräsident bei der Abschlussveranstaltung der Konferenz zur Zukunft Europas. In deren Rahmen hatten vier Bürgerpanels mit 800 zufällig ausgewählten Teilnehmern insgesamt 49 Vorschläge erarbeitet (Europe.Table berichtete), der finale Bericht wurde gestern übergeben. Die Bürger hätten der Politik den Weg gewiesen, sagte von der Leyen. Nun gelte es, diesen zu gehen – “entweder, in dem wir die Grenzen der Verträge ausreizen, oder, ja, in dem wir die Verträge ändern, wenn nötig”.
Parlamentspräsidentin Roberta Metsola forderte erneut, dafür einen Konvent einzuberufen. Die Konferenz zur Zukunft Europas habe gezeigt, dass es eine Lücke gebe zwischen den Erwartungen der Bürger und dem, was Europa liefern könne, sagte sie. Macron kündigte an, den kommenden Wochen unter den anderen Staats- und Regierungschefs für ein solches Konvent zu werben und dies auf die Agenda des Gipfels im Juni zu setzen.
Konkret forderte Macron, das Mehrheitsprinzip im Rat auf weitere Felder auszudehnen. Zudem müsse die EU solidarischer werden. Auch die Organisation der europäischen Wahlen, die demokratische Kontrolle und ein Recht des Europaparlaments auf Gesetzesinitiativen gehörten in einem solchen Konvent diskutiert. Reformen seien nötig, um die Handlungsfähigkeit der EU und damit den Zusammenhalt zu stärken.
Vergangene Woche hatte sich bereits Italiens Ministerpräsident Mario Draghi für eine Weiterentwicklung der Verträge ausgesprochen. Parallel zur Ankündigung Macrons veröffentlichten aber 13 EU-Staaten ein gemeinsames Papier, indem sie sich skeptisch äußern zu “unausgegorenen Versuchen, einen Prozess für eine Vertragsänderung zu beginnen”. Europa funktioniert auch so, heißt es in der Stellungnahme. Es gebe keinen Grund, institutionelle Reformen durchführen, um Ergebnisse abzuliefern. Das Papier wurde vor allem von nördlichen und östlichen EU-Ländern unterstützt, darunter Dänemark, Polen, Rumänien und Tschechien.
Macron lässt sich davon nicht beirren. Ihm schwebt ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor, mit Frankreich und anderen als Avantgarde. Um auch Staaten wie die Ukraine an Europa zu binden, deren regulärer EU-Beitritt Jahre und Jahrzehnte dauern werde, müsse es neue Formen der Kooperationen geben: Macron sprach von der “europäischen politischen Gemeinschaft”, die auch Ex-Mitgliedern wie Großbritannien offenstehe. Ziel müsse es sein, demokratischen Staaten einen neuen Raum der politischen Zusammenarbeit zu geben, etwa im Energiebereich, im Verkehr oder der Freizügigkeit von Personen und insbesondere der Jugend. Auch hierfür wolle er in den verbleibenden Wochen der Ratspräsidentschaft werben.
Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich offen für die Idee. Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass Länder des westlichen Balkans, die eine EU-Beitrittsperspektive haben, davon abgehalten werden, sagte Scholz am Abend vor einem Treffen mit Macron im Kanzleramt. Zu den Forderungen nach Vertragsänderungen in der EU sagte Scholz, Deutschland werde dabei nicht auf der Bremse stehen.
Allerdings lasse sich eine effizientere EU auch unterhalb der Ebene von Änderungen der EU-Verträge erreichen. Dazu gehöre auch die Abschaffung der Einstimmigkeit in vielen Politikbereichen. Scholz hatte sich schon kurz nach seinem Amtsantritt gegen entsprechende französischen Forderungen gewandt, weil Vertragsänderungen in der EU oft Jahre brauche.
Von der Leyen kündigte zudem an, sie werde neue Formate für die Beteiligung der Bürger vorschlagen. Die Bürgerpanels sollten die nötigen Ressourcen erhalten, um eigene Empfehlungen zu erarbeiten, bevor die Kommission wichtige Legislativvorschläge vorlege. Zudem wolle sie die Ideen der Konferenz zur Zukunft Europas aufgreifen und in ihrer Rede zur Lage der EU im September erste Vorschläge auf deren Grundlage vorlegen. tho
Europas Bürgerinnen und Bürger wollen zusätzliche Anstrengungen, um den Treibhausgasausstoß von Gas- und Kohlekraftwerken zu reduzieren. Für fossile Kraftwerke in der EU sollten “CO2-Filter” vorgeschrieben werden, heißt es im Abschlussbericht der Konferenz zur Zukunft Europas. Mitgliedstaaten, denen die finanziellen Mittel dafür fehlten, sollten unterstützt werden. Keine Aussage trifft der Bericht dazu, ob das abgeschiedene Kohlendioxid anschließend gespeichert oder in Kohlenstoffkreisläufen wieder genutzt werden soll – zum Beispiel zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen.
Für wenig praktikabel hält den Vorschlag ein Klimaexperte des Wuppertal Instituts. “Wenn wir erneuerbare Energien stark ausbauen, werden Gas- und Kohlekraftwerke nur noch in wenigen Stunden des Jahres laufen“, sagt Stefan Lechtenböhmer, Leiter der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme, auf Anfrage von Europe.Table. Eine Nachrüstung der CO2-Abscheidung sei nur bei neueren Kraftwerken machbar und auch dort nur in Ausnahmefällen wirtschaftlich. Sinnvoll könnte dies beispielsweise sein, wenn dort Biomasse eingesetzt würde und dadurch negative Emissionen möglich würden (BECCS).
“Aus Klimaschutzgründen wäre es sinnvoller, die CO2-Abscheidung direkt mit der unterirdischen Lagerung zu verbinden (DACCS) oder sie während einer Übergangszeit, bis genügend grüner Wasserstoff verfügbar ist, für die Herstellung von blauem Wasserstoff aus Erdgas zu nutzen. Mit dem Wasserstoff könnten sowohl Gaskraftwerke als auch Industrieanlagen nahezu klimaneutral betrieben werden”, sagt Lechtenböhmer. ber
Die Europäische Union will die Genehmigung von erneuerbaren Energien beschleunigen. Deshalb soll einigen Projekten für erneuerbare Energien schon innerhalb eines Jahres die Genehmigung erteilt werden, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der Europe.Table am Montag vorlag. Mit einer Änderung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie will die Kommission die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, für erneuerbare Energien geeignete Land- oder Meeresgebiete auszuweisen, in denen derartige Projekte nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben.
“Das Genehmigungsverfahren für neue Projekte in Gebieten, die für erneuerbare Energien geeignet sind, soll ein Jahr nicht überschreiten”, heißt es in dem Dokument, wobei dieser Zeitraum unter außergewöhnlichen Umständen um drei Monate verlängert werden kann. Im Vergleich dazu gilt in der EU derzeit eine Frist von zwei Jahren für die Genehmigung solcher Vorhaben, die um ein weiteres Jahr verlängert werden kann.
Kern der Beschleunigung ist, dass in den sogenannten “go-to areas” die Pflicht zu projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) entfallen soll. Ausreichen soll stattdessen allein eine Strategische Umweltprüfung (SUP) bei der Auswahl der go-to areas. Ausgenommen von der UVP-Befreiung sind allerdings Feuerungsanlagen für Biomasse sowie Projekte, die wesentliche Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten haben. Bei der Ausweisung der go-to areas sollen “künstliche und bebaute Flächen” Priorität erhalten, zum Beispiel Dächer, Parkplätze, Straßen und Schienenwege sowie degradierte Böden.
Eine UVP-Pflicht gilt in Deutschland zurzeit regelmäßig für große Windparks mit mindestens 20 Anlagen. Schon ab drei Anlagen muss die zuständige Behörde jedoch im Rahmen einer vereinfachten Vorprüfung klären, ob eine UVP-Pflicht besteht.
Die Genehmigung und der Bau von Projekten für erneuerbare Energien würden künftig als im “überragenden öffentlichen Interesse” liegend eingestuft, wie es auch die Bundesregierung vorsieht. Laut dem EU-Entwurf sollen die Staaten allerdings die Möglichkeit erhalten, die Bestimmung auf einzelne Regionen, Technologien oder Projekte mit bestimmten technischen Eigenschaften zu beschränken.
Die Grünen im Europaparlament sehen die Chance verpasst, noch weitere Bestimmungen in die Erneuerbaren-Richtlinie aufzunehmen. “Mit netten Worten und Absichten bauen wir keine Solarzellen oder installieren diese auf Europas Dächern. Aber genau in diese Richtung scheint die EU-Kommission zu gehen. Wir brauchen einen Gesetzesvorschlag mit einer gesetzlich verankerten Solarpflicht und europäischer Solarfinanzierung“, sagte der Abgeordnete Michael Bloss. ber/rtr
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Montag, sie habe in den Gesprächen mit dem Premierminister Ungarns Viktor Orbán über ein mögliches EU-weites Verbot russischer fossiler Brennstoffe Fortschritte erzielt.
“Das Gespräch war hilfreich, um Fragen im Zusammenhang mit Sanktionen und Energiesicherheit zu klären”, so von der Leyen in einem Tweet. “Wir haben Fortschritte gemacht, aber es ist noch mehr Arbeit nötig”, fügte sie hinzu.
Von der Leyen sagte, sie werde eine Videokonferenz mit anderen Ländern in der Region einberufen, um die regionale Zusammenarbeit bei der Öl-Infrastruktur zu stärken. rtr
Die Verhandlungen über Flüssiggas-Lieferungen aus Katar für Deutschland laufen Insidern zufolge zäh. Hauptgrund sei, dass Katar auf langfristigen Lieferverträgen über mindestens 20 Jahre bestehe, sagten mit den Gesprächen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Die deutschen Verhandlungspartner haben daran allerdings wenig Interesse, da Deutschland bereits 2045 klimaneutral sein will.
Gemäß den jüngsten vom Kabinett beschlossenen Gesetzesvorhaben soll der Energiesektor bereits 2035 praktisch ohne CO2-Ausstoß auskommen. Das würde also bedeuten, dass dann auch kein Gas mehr zum Heizen oder zur Stromerzeugung eingesetzt werden darf. Für die nächsten Jahre ist Deutschland jedoch auf Flüssiggas angewiesen, um das Pipeline-Gas aus Russland zu ersetzen.
Das Bundeswirtschaftsministerium äußerte sich auf Anfrage ebenso wenig wie die Regierung von Katar. Auch die Gas-Importeure Uniper und RWE wollten zu den Gesprächen nichts sagen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte Katar im März besucht und anschließend von einer Energiepartnerschaft berichtet. Den Insidern zufolge will der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, noch im Mai nach Deutschland kommen und dort eine Vereinbarung unterschreiben. Dies heiße aber nicht, dass damit auch Lieferverträge schon vereinbart würden, sagten mit den Besuchsplänen Vertraute. rtr
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich gestern über den russischen Angriff auf die Ukraine und seine Auswirkungen unter anderem auf die globale Nahrungsmittelversorgung und Energiesicherheit ausgetauscht. Außerdem sei es in der Videokonferenz von Scholz und Xi Jinping um “die Entwicklung und die Konsequenzen der Covid-19-Pandemie, eine vertiefte Kooperation beim Klimaschutz, die Energietransformation sowie die EU-China-Beziehungen” gegangen. Zudem sei über eine weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen und über die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich gesprochen worden, teilte die Bundesregierung in einer nur elfzeiligen Pressemitteilung mit.
Am Sonntag hatte SPD-Chef Lars Klingbeil in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix zu einem anderen Auftreten im Umgang mit der Volksrepublik aufgerufen. Politik und Wirtschaft hätten im Falle Russlands stets auf einen politischen Konsens mit Moskau gedrungen. Das sei ein Fehler gewesen, gestand Klingbeil ein und zog daraus den Schluss, dass man China gegenüber “heute anders auftreten und kritischer sein” müsse. China hat die russische Invasion der Ukraine nicht verurteilt, sondern schiebt die Schuld für den Krieg auf die USA und die Nato. grz
Der Hersteller von Dating-Apps, Match, verklagte am Montag Google und bezeichnete die Klage als “letzten Ausweg”, um zu verhindern, dass Tinder und seine anderen Apps aus dem Play Store verbannt werden. Sie weigern sich, bis zu 30 Prozent ihrer Umsätze zu teilen.
Die Klage von Match ist die jüngste, die sich gegen Googles angeblich wettbewerbswidriges Verhalten im Play Store richtet. Sie reiht sich ein in die laufenden Klagen des “Fortnite”-Herstellers Epic Games, Dutzender Generalstaatsanwälte von US-Bundesstaaten und anderer.
Google hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu der neuen Klage nicht reagiert, erklärte jedoch, dass Entwickler die Möglichkeit haben, den Play Store zu umgehen. Außerdem habe Google die Gebühren gesenkt und andere Programme geschaffen, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen. rtr
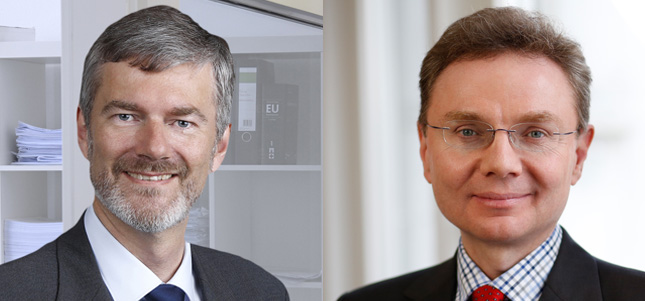
Es ist der umstrittenste Vorschlag des “Fit for 55“-Klimapakets der Europäischen Kommission: die Einführung eines separaten EU-Emissionshandels für die CO2-Emissionen von Gebäuden und Straßenfahrzeugen (ETS 2). Kein Wunder: Um die verschärften EU-Klimaziele auch in diesen Sektoren erreichen zu können, würde das ETS 2 fossile Kraft- und Heizstoffe verteuern. Alle könnten künftig direkt von der Zapfsäule und ihrer Heizkostenrechnung ablesen, dass Klimaschutz seinen Preis hat. Das ist immer unpopulär, und gerade in Zeiten stark steigender Inflation träfe dies insbesondere Menschen mit niedrigerem und auch mittlerem Einkommen hart.
Niemand will soziale Verwerfungen, und der Politik stehen noch die französischen Gelbwesten-Proteste lebhaft vor Augen, die sich an einem CO2-Preisaufschlag auf Benzin und Diesel entzündeten. Von Anfang an war daher auch der Widerstand gegen ein ETS 2 groß – nicht allein von osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, sondern selbst innerhalb der Kommission, die daher zur sozialen Abfederung auch einen Klima-Sozialfonds vorgeschlagen hat.
Dennoch droht jetzt das ETS 2 sowohl im Europäischen Parlament als auch im Rat ganz zu scheitern. Klimapolitisch wäre dies ein fataler Fehler, denn ein ETS 2 kann CO2-Emissionen wirksamer und kostengünstiger als andere Klimaschutzinstrumente senken sowie zugleich sozial ausgestaltet werden.
Während die CO2-Emissionen von energieintensiven Industrien und Energieerzeugern bereits seit 2005 vom ETS 1 gedeckelt und wunschgemäß gesenkt wurden, ist im gleichen Zeitraum der CO2-Ausstoß von Gebäuden kaum gesunken und der des Straßenverkehrs trotz verschiedener Klimaschutzmaßnahmen wie CO2-Flottengrenzwerten für Pkw, Kleintransporter und Lkw sogar gestiegen. Dafür gibt es Gründe:
Entscheidend ist, dass ein Emissionshandel die Gesamtmenge an Emissionsrechten und damit die maximal erlaubten CO2-Emissionen deckelt (“Cap”) und stetig absenkt, sodass das vorab festgelegte EU-Klimaziel sicher erreicht wird. Im ETS 2 müssen Unternehmen für die von ihnen auf den Markt gebrachte Brennstoffmenge eine entsprechende Zahl an Emissionsrechten abgeben (“Upstream-Emissionshandel”). Die stetige Verknappung der verfügbaren Emissionsrechte führt dazu, dass ihr Preis steigt und sich folglich die Nutzung von zum Beispiel fossiler Kraftstoffe im Vergleich zu CO2-ärmeren Alternativen entsprechend verteuert.
Auf diese Weise setzte das CO2-Preissignal Anreize für CO2-sparendes Verhalten. So kann man angesichts steigender Spritpreise weniger und langsamer fahren, zu einem spritsparenden Fahrzeug wechseln oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
Im Gegensatz dazu haben zum Beispiel im Straßenverkehrssektor die bereits seit Jahren geltenden CO2-Grenzwerte für Straßenfahrzeuge weder eine effektive noch eine kosteneffiziente CO2-Reduktion erreichen können. Das liegt nicht nur daran, dass sie im Gegensatz zu einem Emissionshandel nur für Neu- und nicht auch für Altfahrzeuge gelten. Vielmehr führen durch CO2-Grenzwerte verordnete kraftstoffeffizientere Fahrzeuge zwar zu relativen Kraftstoffeinsparungen. Die dadurch eingesparten Kraftstoffkosten regen tendenziell jedoch dazu an, schwerere und leistungsstärkere Fahrzeuge zu fahren sowie mehr Kilometer zurückzulegen. Unterm Strich steigen so sogar der absolute Kraftstoffverbrauch und der damit verbundene CO2-Ausstoß. Das sinkende Cap des ETS 2 würde solchen “Rebound-Effekten” entgegenwirken.
Außerdem würde vom ETS 2 das starke Signal ausgehen, dass die Preise fossiler Kraft- und Heizstoffe langfristig steigen werden, selbst wenn der Weltmarktpreis für Öl- und Gas wieder sinkt. Hierauf können sich Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen einstellen, sodass Planungs- und Investitionssicherheit für die Umstellung zum Beispiel auf alternative Fahrzeugantriebe und CO2-arme Heizungen besteht. Zudem wird durch die Dekarbonisierung dieser Sektoren Europa unabhängiger vom Import fossiler Energien, auch aus Russland.
Insgesamt würde ohne das ETS 2 das zentrale Element der nach der Gesamtkonzeption des “Fit for 55”-Klimapakets aufeinander bezogenen Instrumente zur CO2-Reduktion bei Gebäuden und im Straßenverkehr fehlen. Die EU kann es sich jedoch angesichts der klimapolitischen Versäumnisse der Vergangenheit und ihrer verschärften Klimaziele schlicht nicht weiter leisten, auf die Einführung eines Emissionshandels auch für diese Sektoren zu verzichten.
Europäische Klimapolitik kann auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn sie sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern als auch zwischen den Mitgliedstaaten als sozial ausgewogen akzeptiert wird. Die gute Nachricht ist, dass ein ETS 2 durchaus sozial ausgestaltet werden kann.
Entscheidend für eine breite Akzeptanz des ETS 2 in der Bevölkerung ist nicht die Höhe des von ihm erzeugten CO2-Preises für fossile Kraft- und Heizstoffe, sondern die effektive Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Durch eine geeignete Verwendung der Erlöse aus der Versteigerung von ETS 2-Zertifikaten und die Ausgestaltung des vorgeschlagenen Klima-Sozialfonds lassen sich durch Pro-Kopf-Transferzahlungen übermäßige Belastungen niedriger und mittlerer Einkommen vermeiden.
Werden ETS 2-Versteigerungserlöse weitgehend als identische Pro-Kopf-Zahlungen an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt, die diese ab einer gewissen Einkommenshöhe versteuern müssen, können weite Teile der Bevölkerung hinreichend für die steigenden CO2-Preise des ETS 2 kompensiert werden. Damit führt die “regressive” CO2-Bepreisung insgesamt zu einer mit dem Einkommen abnehmenden Entlastung. Dies ist sozial gerecht, denn Bürgerinnen und Bürger mit höheren Einkommen heizen im Schnitt mehr Wohnraum, fahren größere Autos und verursachen folglich mehr CO2-Emissionen. Klimaschutzmaßnahmen werden zudem sozial gerechter durch “progressive” Steuern finanziert statt durch einen “regressiven” CO2-Preis.
Würden die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, einen Gutteil der ETS 2-Versteigerungserlöse pro Kopf an ihre Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen und Härtefälle gezielt zu unterstützen, entfiele auch die aufwendige Aufstellung umfangreicher Klima-Sozialpläne, wie sie die Kommission vorgeschlagen hat. Durch Wegfall der bürokratischen Klima-Sozialpläne würde der Klimasozialfonds so zum reinen Transferinstrument.
Insgesamt ist eine soziale Ausgestaltung des ETS 2 möglich. Auch wenn kurzfristig die aktuell stark steigende Inflation und explodierende Energiepreise den Widerstand gegen die Einführung einer CO2-Bepreisung fossiler Kraft- und Heizstoffe verstärken, ist ein ETS 2 langfristig der richtige Weg zur Dekarbonisierung des Gebäude- und Straßenverkehrssektors. Daher sollten sich jetzt das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung für den Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit bewusst sein und sich nicht weiter aus unberechtigter Furcht vor sozialen Verwerfungen gegen das wirksame, kosteneffiziente und sozial gestaltbare Klimaschutzinstrument des ETS 2 sperren. Diese klimapolitische Chance darf jetzt nicht verspielt werden.

