Carrie Lam fürchtet, es ist Wahl und keiner geht hin. Die Bürger in Hongkong sehen offenbar so wenig Sinn in der Abstimmung unter Pekinger Regeln, dass sie lieber zu Hause bleiben. Verwaltungschefin Lam versucht allerlei Anreize zu setzen, um die Leute an die Urne zu locken. Die Opposition im Exil rät jedenfalls davon ab, seine Stimme abzugeben, weil eben nur konforme Kandidaten zur Wahl stehen. Das macht die Veranstaltung zur Farce, analysiert Marcel Grzanna. Trotzdem fährt die Stadt Tausende von Polizisten auf, um die Wahl zu schützen. Auffällig ist daran: Zu demokratischeren Zeiten war die verschärfte Überwachung der Wähler unnötig.
Um Überwachung geht es auch in der Analyse zu Sensetime, einem Weltmarktführer bei Gesichtserkennung. Das Unternehmen muss neue Sanktionen der US-Regierung hinnehmen. Es hat schließlich wichtige Ausrüstung für den Aufbau des digitalen Polizeistaats in Xinjiang geliefert. Die Programme von Sensetime erlauben die Identifikation anhand von ethnischen Merkmalen. Uiguren wurden damit wohl auch in anderen Regionen Chinas von der Polizei im öffentlichen Leben zur engmaschigen Überwachung herausgesiebt.
Der Patriotismus der Mehrheitsgesellschaft treibt derweil neue Blüten. Auch in China verbreitet sich Cancel Culture. Sie zeigt sich hier aber in einer nationalistischen und staatstragenden Variante. Die Wut im Netz entlädt sich vor allem über Nutzer, die vorgeblich nicht genug Respekt vor der chinesischen Kultur oder dem chinesischen Volk gezeigt hat. Wenn andere Meinungsäußerungen unterdrückt sind, entladen sich die Emotionen hier über den letzten erlaubten Kanal. Was leidet, ist die Kunstfreiheit, analysiert Fabian Peltsch.


Eine “Geste der kollektiven Verantwortung” nannte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam die Ankündigung, dass am kommenden Sonntag Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr für alle Bürger kostenlos sein werden. Man wolle, dass die Leute wählen gehen, so Lam. Dieser Anreiz dürfte nicht von großer Bedeutung sein, da die meisten Wahllokale in der Nähe des Wohnortes der Wähler liegen. Doch sie ist ein Zeichen dafür, dass die Sorge um eine niedrige Wahlbeteiligung groß ist.
Es ist aber auch paradox. Kaum hat die Volksrepublik China die faktische Kontrolle über die Parlamentswahlen in Hongkong an sich gerissen, sind offenbar 10.000 Polizisten zum Schutz des Urnengangs nötig. In der Vergangenheit – als die Stadt noch deutlicher unabhängiger über ihr politisches Personal abgestimmt hat – verliefen die Wahlen immer friedlich, auch ohne Polizeischutz.
Dabei hatte der Nationale Volkskongress in Peking der Sonderverwaltungszone seine einschneidende Wahlrechtsform im März doch eigens deshalb auferlegt, um die Stadt zu befrieden. Jetzt gehen die Behörden anscheinend lieber auf Nummer sicher, um den Frieden tatsächlich auch zu wahren, wenn am Sonntag (19. Dezember) ein neues Parlament unter neuen Bedingungen durch die rund 4,5 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stadt gewählt werden soll.
Demokratieaktivisten wie Glacier Wong, die derzeit in Deutschland lebt, aber auch Nathan Law, der im Exil in London ist, Regierungsgegner Sunny Cheung und der ehemalige Studentenführer Alex Chow, die beide in den USA sind, haben dieser Tage zu einem Wahlboykott aufgerufen. Erst am Mittwoch wurden vier Personen in Hongkong verhaftet, da sie andere dazu angestiftet haben, nicht an der Wahl des Legislativrats am Sonntag teilzunehmen oder leere Stimmzettel abzugeben. Damit sollen sie angeblich gegen die Wahlverordnung verstoßen haben. Seit Beginn des Jahres verbietet Peking, öffentlich “eine andere Person dazu aufzufordern, nicht zu wählen oder eine ungültige Stimme abzugeben”.
Für den früheren Hongkonger Parlamentarier Ted Hui kommt dieses Vorgehen auch nicht überraschend: “Ich glaube, das Regime hat große Angst vor dem Ergebnis und droht den Menschen deshalb.” Gegen Hui, der in Australien im Exil lebt, wurde ein weiterer Haftbefehl ausgesprochen. Auch Meinungsforschungsinstitute sind ihm zufolge gewarnt worden, die “rote Linie” nicht zu überschreiten.
Vielen seiner politischen Mitstreiter des pro-demokratischen Flügels ist die Flucht nicht gelungen. Mehrere Dutzend von ihnen sitzen nun in Haft und warten auf ihren Prozess. Ihnen wird auf Basis des Nationalen Sicherheitsgesetzes Sezession oder Untergrabung der Staatsgewalt vorgeworfen. Der neue Rechtsrahmen hat den Behörden die Möglichkeit eröffnet, jede Form politischer Opposition als Straftatbestand zu definieren.
Auch viele der einst einflussreichen Oppositionellen sitzen nun schon seit fast einem Jahr hinter Gittern. Die Prozesswelle gegen die Politiker und Aktivisten war im Sommer bis auf Weiteres verschoben worden. Ex-Parlamentarier Hui erkennt darin eine Strategie der Hongkonger Regierung. Von den pro-demokratischen Kräften könne im Vorfeld dieser Wahlen niemand aktiv werden.
Umso mehr Wahlkampf betreibt die Gegenseite, also jener Flügel, der die vorzeitige autoritäre Übernahme der Stadt durch die Volksrepublik China befürwortet. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes forderten in einer konzertierten Aktion ihre Mitbürger:innen dazu auf, “nur Patrioten” zu wählen. Aus Peking stammt die Vorgabe, dass Hongkong künftig nur noch von solchen Patrioten regiert und verwaltet werden möge.
Dazu zählen zwangsweise alle Beamte und Angestellten des Öffentlichen Dienstes. Wer seinen Arbeitsplatz nicht verlieren möchte, sollte tunlichst den Eindruck vermitteln, er sei ein Patriot, der die Linie Pekings voll und ganz unterstützt. Um das zu gewährleisten, führte die Stadt sogar ein neues Gesetz ein, das Amtsträgern einen Eid abverlangt, patriotisch – und damit im Geiste der Kommunistischen Partei – zu handeln.
Doch die Aufrufe wirken geradezu grotesk und dienen eher als ein Versuch, den Wahlen einen demokratischen Anstrich zu verpassen. Das Wahlsystem lässt ohnehin nur noch wenige Lücken für mögliche demokratische Kräfte zu. Ihr Einfluss auf die Legislative wird nur noch sehr gering sein.
Die Wähler:innen haben nur noch die Möglichkeit, die Besetzung von 20 der insgesamt 90 Sitze mit ihrer Stimme zu beeinflussen. Die Mehrheit der Sitze, 70 an der Zahl, wird stattdessen von einem Komitee vergeben, das der Pekinger Führung nahesteht. Bei der letzten Wahl waren es immerhin noch 50 Prozent der Sitze, die von der Bevölkerung bestimmt wurden. Alle Kandidat:innen mussten zudem durch einen Tauglichkeits-Check gehen. Wer dabei den Verdacht erweckte, nicht patriotisch genug zu sein, wurde seines Bürgerrechts der politischen Teilhabe enthoben.
Die chinesische Führung in Peking stellt damit sicher, dass ihr Einfluss in Hongkong noch größer wird. Zwar hatte sie in den 1980er-Jahren einen Vertrag mit den damaligen britischen Kolonialherren unterschrieben, dass der Stadt nach Übergabe 1997 an die Volksrepublik demokratische Freiheiten für 50 Jahre erhalten bleiben sollten. Doch schon wenige Jahre nach Übergabe zeichnete sich ab, dass Peking andere Pläne verfolgte und den Vertrag mit den Briten allenfalls als groben Orientierungsrahmen interpretierte.
Weil auch die Hongkonger Bürgerinnen und Bürger schnell spitz bekamen, dass die ihnen versprochenen Rechte schneller geschluckt würden als zugesagt, begannen schon zu Beginn des Jahrtausends die ersten Proteste gegen den wachsenden Pekinger Einfluss. Das Brodeln brach sich im Jahr 2019 endgültig in einer Massenbewegung bahn, die mehrere Millionen Menschen auf die Straße brachte. Hongkongs Regierung schlug mit Pekinger Unterstützung und voller Härte gegen die Demonstranten zurück. Ein Jahr nach dem Beginn der Protestbewegung schaffte Peking mit der Einführung des Sicherheitsgesetzes neue Fakten.
“Die Demokratie-Bewegung in Hongkong ist faktisch nicht mehr existent”, stellt Ex-Parlamentarier Hui fest. Der Widerstand der Opposition wird deshalb seit geraumer Zeit aus dem Ausland koordiniert. Hui schaut jetzt aus der Ferne zu, wie am kommenden Sonntag gewählt wird. 620 Wahllokale stehen zur Verfügung. 38.000 Verwaltungsbeamte werden den Ablauf des Wahlgangs begleiten. Und die 10.000 Polizisten werden dafür sorgen, dass es zu keinen Zwischenfällen kommt, die an der Legitimität der Wahl Zweifel wecken könnten. Mitarbeit: Ning Wang
Sensetime ist eine der KI-Firmen, die ihre Anwendungen bereits in der Praxis einsetzt. Die Software des Unternehmens leistet Personenerkennung mit vorher unbekannter Genauigkeit. Doch trotz Interesse der Investoren hat das Unternehmen einen geplanten Börsengang in Hongkong vorläufig verschoben. Grund ist eine Entscheidung der US-Regierung. Diese hat neue Sanktionen gegen Sensetime verhängt (China.Table berichtete), die auch die künftige Finanzposition der Firma betreffen. Grund für die Sanktionen ist der großflächige Einsatz der Sensetime-Produkte zur Überwachung der Minderheit der Uiguren.
Sensetime ist damit ein weiteres prominentes Unternehmen, das Teil der politischen Gemengelage geworden ist. Es gibt jedoch Unterschiede zu anderen Firmen, die von US-Sanktionen betroffen sind. Der Telekom-Ausrüster Huawei, der Halbleiterhersteller SMIC oder der Mobilfunker China Mobile weisen darauf hin, nur oberflächliche Beziehungen zu Chinas Sicherheitsbehörden zu haben. Sensetime dagegen liefert Kernkomponenten für den totalen digitalen Überwachungsstaat.
Der vergangene Freitag war der verhängnisvolle Tag für die Börsenpläne von Sensetime. Der 10. Dezember ist einerseits der Tag der Menschenrechte. Für US-Präsident Joe Biden ging zudem ein nur mäßig produktiver Demokratiegipfel zu Ende, zu dem China ausdrücklich nicht eingeladen war. Die US-Regierung hat dann anlässlich von Menschenrechtstag und Demokratiegipfel noch mit Sanktionen nachgelegt. Sensetime als berüchtigter Hersteller von Überwachungssoftware war ein logisches Ziel. Anders als bei früheren US-Sanktionen ging es diesmal ausdrücklich um eine Reaktion auf die Unterdrückung der Uiguren. Ebenfalls betroffen waren an diesem Tag Myanmar und Nordkorea. Rechtliche Grundlage war die Einstufung von Sensetime als Teil des “militärischen-industriellen Komplexes der Volksrepublik China”.
Am Donnerstag kamen dann bereits Gerüchte auf, dass Sensetime auf die Schwarze Liste kommen könnte (China.Table berichtete). Am Freitag wollte Sensetime eigentlich Details zum Börsengang bekannt geben. Stattdessen nahm das Management mit der Börse Hongkong Kontakt auf und verständigte sich darauf, die Börsenpläne vorerst auf Eis zu legen.
Die Art der US-Sanktionen betreffen durchaus die künftige finanzielle Lage des Unternehmens und sind damit börsenrelevant. Die Unternehmen auf der betreffenden Liste können sich in den USA nicht mehr mit Kapital versorgen. Dazu kommt der entsprechende Imageschaden. Am Samstag wehrte sich Sensetime gegen die Begründung des US-Finanzministeriums für die Sanktionen. Die Anschuldigungen “entbehren jeder Grundlage”, teilte das Unternehmen mit. “Wir halten uns in jedem Markt, auf dem wir tätig sind, an die geltenden Gesetze der dortigen Jurisdiktion.”
Das ist vermutlich richtig. In China ist es der Einparteienstaat, der auf Basis selbstgemachter Gesetze ein Kontrollregime durchsetzt. Vermutlich könnte China es Sensetime eher umgekehrt als Gesetzesverstoß auslegen, wenn es sich der Teilnahme an staatlichen Operationen verweigerte. Letztlich kann sich kein Unternehmen den Wünschen des Staates verweigern. Aus internationaler Sicht – und zumal aus der Warte einer wertegeleiteten Außenpolitik, wie sie derzeit wieder mehr im Gespräch ist – ist die Rolle des Technikunternehmens aus Shenzhen aber zumindest vielschichtig zu sehen.
Im Laufe der Jahre 2018 und 2019 wurde nach und nach bekannt, wie engmaschig die Überwachung der Wohnbevölkerung von Xinjiang und insbesondere der Uiguren geworden ist. Die New York Times veröffentlichte damals eine Reihe von einflussreichen Artikeln mit Details zum Einsatz moderner Technik in der Region. Die Software kann demnach anhand des Aussehens zwischen Uiguren und Han-Chinesen unterscheiden. Die Polizei verwendet diese Funktion möglicherweise auch außerhalb Xinjiangs. So soll sie auch in den Küstenstädten die Bewegungen und Handlungen von Uiguren mit Softwarehilfe gezielt und lückenlos verfolgen. “Minderheitenidentifikation” heißt das Ausstattungsmerkmal der Software den Berichten zufolge.
Sensetime gehörte damit fast sicher zu den Firmen, die technische Infrastruktur für die Errichtung eines digitalen Polizeistaats in der Region Xinjiang geliefert haben. Zusammen mit anderen Unternehmen wurde Sensetime damit in der westlichen Öffentlichkeit zum Synonym für lückenlose Überwachung. Mitte Oktober gab das Unternehmen dann bekannt, einen Börsengang in Hongkong anzustreben. Sofort nach Ankündigung war jedoch die Verstrickung in den Aufbau des Überwachungsstaates wieder ein Thema (China.Table berichtete).
Der größte Vorteil von Sensetime ist auf der internationalen Bühne also auch sein größtes Problem: Der chinesische Staat ist der weltweit größtmögliche Kunde für Überwachungstechnik. In anderen Ländern gibt es ebenfalls kompetente Anbieter von Software zur Erkennung biometrischer Merkmale, auch wenn viele von ihnen nicht in der gleichen Liga wie Sensetime spielen. So sitzt in Dresden die Firma Cognitec, deren Gesichtserkennung ebenfalls präzise funktioniert. Sie arbeitet auch durchaus mit dem Bundeskriminalamt zusammen. Doch das auffälligste Projekt, an dem Cognitec mitgewirkt hat, war lediglich ein Testlauf für Gesichtserkennung im öffentlichen Raum am Berliner Bahnhof Südkreuz.
Die einzelne Kamera über einer Rolltreppe hat jedoch bereits eine landesweite Debatte über die Gefahren der Gesichtserkennung ausgelöst. Es sind in Deutschland in absehbarer Zeit also keine Aufträge für großflächige Personenerkennung im öffentlichen Raum zu erwarten. Eine Initiative zur Überwachung von 100 Knotenpunkten von Ex-Innenminister Horst Seehofer ist krachend gescheitert. Die Software von Cognitec kommt beim BKA also nur intern zur “Lichtbildrecherche” in Datenbanken zum Einsatz.
Die chinesischen Anbieter wie Sensetime und Megvii können ihre Anwendungen dagegen im Masseneinsatz weiterentwickeln. Die Staatsaufträge spülen ihnen Geld in die Kasse, das wiederum in die Produkte fließt. Der Börsengang in Hongkong hätte für Sensetime einen weiteren Geldsegen gebracht: 680 Millionen Euro wollte das Unternehmen durch die Ausgabe der Anteilsscheine einnehmen.
Das ursprüngliche Interesse der Investoren hatte nicht nur mit dem chinesischen Staat als Hauptkunden zu tun, sondern auch mit dem erreichten technischen Niveau. Wie viele KI-Anbieter verwendet Sensetime neuronale Netze für die Mustererkennung im Kern des Systems. Es verwendet dabei eine ähnliche Struktur wie ein Nervensystem und lernt die entscheidenden Fähigkeiten anhand von Beispielen. Sensetime bettet die reine Musterkennung aber auch besonders geschickt in einen Rahmen aus konventioneller Software ein.
Die Software verfolgt Personen in der realen Welt von Kamera zu Kamera durch die Stadt. Außerdem erkennt sie Personen nicht nur am Gesicht, sondern auch am Gang, der Armhaltung und anderen Eigenschaften. Um diese Muster aufzunehmen, müssen sie nur einmal zusammen mit dem Gesicht auf den Kamerabildern zu sehen gewesen sein. All das macht die Fähigkeiten der Software so wertvoll für die allgegenwärtige Überwachung beispielsweise in Xinjiang.
Im Jahr 2018 war Sensetime mit einer Bewertung von sechs Milliarden US-Dollar bereits das wertvollste KI-Startup der Welt. Da war das Unternehmen bereits profitabel. Sensetime arbeitet weltweit bereits mit Hunderten von Kunden zusammen, darunter der US-Chiphersteller Qualcomm oder der japanische Autohersteller Honda im Bereich des autonomen Fahrens. Hier erkennt und bewertet das System, was vor dem Auto auf der Straße passiert. Dennoch musste das Unternehmen seinen Börsengang wegen der Menschenrechtsdebatte bereits kleiner fahren als ursprünglich erhofft.
Sensetime wurde 2014 von Tang Xiao’ou gegründet, einem Informatiker von der Chinese University of Hongkong. Der Fokus lag von Anfang an darauf, eigene Algorithmen zu entwickeln. Viele Wettbewerber verwenden Techniken, die frei zur Verfügung stehen oder ganz einfach dem Stand dessen, was an den Unis gelehrt wird. In den ersten Jahren der Unternehmensgeschichte hat die besonders gut funktionierende Gesichtserkennung von Sensetime noch Begeisterung ausgelöst. Das Start-up galt als Beispiel dafür, wie fortschrittlich Chinas Technikfirmen sind.
Der Blick auf Sensetime hat sich durch die Ereignisse der vergangenen Jahre dann stark verändert. Die klare Sprache des US-Finanzministeriums, die das Unternehmen mit den Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang in Verbindung bringt, verstärkt nun den Eindruck: Sensetime hat seine Unschuld als Technikunternehmen endgültig verloren. Das wichtige Segment ethischer oder nachhaltiger Investoren steht dem Unternehmen bei seinen Börsenplänen nicht mehr als Kapitalgeber zur Verfügung. Zugleich zeigt das Beispiel Sensetime, dass es in kritischen Sektoren fast unmöglich wird, sich einfach nur an die regionalen Gesetze zu halten und es damit allen recht zu machen.
Dass sie wegen eines Fotos als “Verräterin Chinas” gebrandmarkt würde, hatte Chen Man nicht kommen sehen. Nachdem die 41-jährige Starfotografin aus Peking ein asiatisches Modell für eine Handtaschen-Werbung von Dior abgelichtet hatte, stand sie Mitte November plötzlich am Internet-Pranger: Chen bediene mit ihren Bildern westliche Klischees chinesischer Frauen, schrieben empörte User auf chinesischen Social-Media-Kanälen wie Weibo. Die Augen seien zu schmal, die Wangenknochen zu hoch, das Make-up und die Kleidung erinnern an eine “gruselige Konkubine” aus der Qing-Dynastie. Chinesische Schönheit sehe anders aus.
Auch die staatliche Zeitung Beijing Daily stimmte in den Chor der Entrüstung ein: Das Foto “verzerre die chinesische Kultur”. Daraufhin entschuldigte sich Chen für ihre “Rücksichtslosigkeit” und “Ignoranz”. Die “Rénròu Sōusuo 人肉搜索”, die “Menschenfleischsuche”, wie man eine Online-Hetzjagd in China nennt, war da jedoch bereits in vollem Gange. Die User arbeiteten sich systematisch durch Chens Portfolio und sammelten Beweisfotos, die Rückschlüsse auf ihre vermeintlich unpatriotische Haltung zulassen.
Bilder eines leicht bekleideten Models auf dem Drei-Schluchten-Damm, die Chen bereits 2008 veröffentlicht hatte, galten plötzlich als “antichinesisch”. Um “die Gefühle der Chinesen nicht weiter zu verletzen”, löschte die weltweit gefragte Fashion-Fotografin alle “problematischen” Bilder aus ihrem Werk. “In der Zwischenzeit werde ich mich besser über die chinesische Geschichte informieren und den selbstbewussten Geist der neuen Ära Chinas als Inspirationsquelle nutzen, um die chinesische Geschichte durch meine Arbeit zu erzählen”, erklärte Chen in einem offenen Brief auf Weibo. Eine Selbstkritik wie aus dem Parteileitfaden.
Auch in den USA und in Europa gibt es die Tendenz, die Absender von unkorrekten Äußerungen zu brandmarken und möglichst zum Schweigen bringen. Dafür hat sich in den vergangenen Jahren der Begriff “Cancel Culture” etabliert. Wer etwas Unpassendes sagt, wird von der Netzgemeinde scharf kritisiert und seine Meinung “ausgelöscht” oder “rückgängig gemacht”, sprich: gecancelt. Es gibt diese Tendenz in allen Lagern von links bis rechts und von religiös bis liberal. In China ist ihre Ausprägung als patriotische Bewegung besonders stark.
Chinas nationalistische Cancel Culture macht heute vor niemandem Halt. Davon kann auch die Wirtschaftswelt ein Lied singen. Die Liste der Unternehmen, die bereits dafür abgestraft wurden, die “Gefühle des chinesischen Volkes” verletzt zu haben, wird mit jedem Monat länger. VW, H&M, Nike, Zara, Burberry, Adidas, Puma, Dolce & Gabbana und sogar die US-Basketball-Liga NBA sind nur einige Beispiele internationaler Player, die in China öffentlich angeprangert und boykottiert wurden.
Mal war der Stein des Anstoßes die Verwendung eines Dalai-Lama-Zitats, mal die vermeintlich böswillige Dreistigkeit, Taiwan auf der Firmenwebseite als eigenständiges Land zu kennzeichnen. “Jeder, der das chinesische Volk beleidigt, sollte darauf vorbereitet sein, den Preis zu bezahlen”, kommentierte Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Anfang des Jahres die kollektive Wut über H&Ms Ankündigung, keine in Zwangsarbeit geerntete Baumwolle aus Xinjiang mehr verwenden zu wollen (China.Table berichtete).
Was bei solchen Online-Hetzkampagnen tatsächlich auf das chinesische Volk zurückgeht und was von der Regierung orchestriert wird, sei sei oft schwer zu bestimmen, erklärt Adam Ni, Vorstandsmitglied beim China Policy Center, einem unabhängigen australischen China-Think Tank. In dem von Ni herausgegebenen Blog “The China Story” und seiner dortigen Online-Kolumne “Neican 内参” hat sich der Jurist intensiv mit dem Phänomen des chinesischen Cyber-Nationalismus auseinandergesetzt. “Ich denke, dass sich die Regierungsaktivitäten und die Empörung der Internet-User gegenseitig bedingen und befeuern.”
Dass die chinesische Regierung seit Mitte der Nullerjahre gezielt das Meinungsbild in Online-Foren und sozialen Netzwerken mit bezahlten Kommentatoren manipuliert, ist kein Geheimnis. Oft werden diese Keyboard-Krieger als “Wumao 五毛” bezeichnet, ein Begriff, der suggeriert, dass sie für jeden ihrer Kommentare mit 0,5 Yuan entlohnt werden, umgerechnet sieben Cent. Das Bild des willenlosen Cyber-Söldners ist jedoch veraltet. Die lautesten und aggressivsten Stimmen in Chinas Online-Community sind heute oftmals Digital Natives aus der Mittelschicht, die über VPN-Kanäle Zugang zu westlichen Medien und Netzwerken haben. Man nennt sie auch “Little Pinks”, 小粉红 xiǎo fěnhóng”, nach der Farbe eines Online-Forums, in dem sich die jungen Cyber-Nationalisten früher oft tummelten.
Laut einer Umfrage von Asian Barometer Survey (ABS) legt die “Generation Z” der zwischen 1990 und 2000 geborenen Chinesen großen Wert auf persönlichen Selbstausdruck. Gleichzeitig sind sie mit der Propagandamaschinerie von Xi Jinping aufgewachsen, der die “Verjüngung der chinesischen Nation” heraufbeschwört. Sie unterstellt “ausländischen Kräften”, Chinas Aufstieg zu sabotieren. Die Spannungen mit dem Westen und die Überzeugung, dass China die Covid-Pandemie besser gemeistert habe als der Rest der Welt, erfüllt die jungen Chinesen mit Stolz, zugleich aber auch mit Trotz gegen die Außenwelt. Hier ist eine explosive Mischung entstanden, die schnell in offene Aggression umschlagen kann.
Eine bekannte Vertreterin der patriotischen Online-Bewegung ist die Bloggerin Guyanmuchan, die auf Weibo rund 6,5 Millionen Follower hat, aber auch auf westlichen Portalen wie Twitter Stimmung gegen die “Feinde Chinas” macht. Die Ästhetik ihres Kanals ist Teenie-gerecht, Memes und niedliche Comic-Figuren treffen dort auf Überschriften wie “Europa ist nur ein Hund an der Leine der USA”.
Der Staat bedient dieses nationalistische Sentiment gezielt, in dem er seine eigene Propaganda zusehends verjüngt. Regierungskanäle nutzen längst auch Internet-Slang. Staatlich produzierte Cartoons machen sich über den Westen lustig. “Rote” Rapsongs feiern die Errungenschaften der KPCh. Teilweise werden die Kommentare und Essays aus dem Little-Pink-Universum von offiziellen Medien aufgegriffen und weiterverbreitet. “Oft beginnt eine Hetzkampagne mit ehrlicher Empörung. Wenn der Staat aber eine eigene Agenda zum jeweiligen Thema hat, gießt er weiter Öl ins Feuer”, erläutert Adam Ni. Darin liege auch der große Unterschied zur westlichen Ausprägung der sogenannten Cancel Culture. “In China mischt die Regierung vorne mit.”
Weil sie eine Stimmung der Angst erzeugen, verglichen Kritiker wie der in Shanghai und New York lebende Schriftsteller Xia Shang die Internet-Hetzer bereits mit den Roten Garden. Für Adam Ni geht dieser Vergleich zu weit: “Während der Kulturrevolution waren die Konsequenzen schrecklicher als heute”, erklärt der Blogger. Im Land habe Chaos geherrscht, Menschen seien ganz real ermordet worden. “Viele Funktionäre haben das Leid damals am eigenen Leib erfahren. Dass so etwas noch einmal passiert, will die Partei unbedingt vermeiden.” Die heutige Situation gleiche eher einem Dampfkochtopf, bei dem Peking den Deckel fest in der Hand hält, so Ni. “Die Regierung weiß ganz genau, wie man den Druck jederzeit wieder rausnimmt.”
Das kann etwa passieren, wenn eine staatliche Zeitung selbst plötzlich Opfer des Online-Mobs wird, zum Beispiel weil sie gegenüber dem Ausland eine gefühlt zu weiche Position vertreten hat. Dann werden kritische Kommentare und Accounts von den Zensoren gelöscht und beschwichtigende Artikel als Gegengewicht lanciert. “Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Little Pinks nicht dazu beitragen, Chinas Image in der Welt zu verbessern”, erläutert Ni. Andererseits benutzt die Regierung die Empörung der Massen gezielt, um außenpolitische Positionen zu rechtfertigen, etwa wenn sie erklärt, dass die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Covid-Pandemie “die Gefühle des chinesischen Volkes” verletze.
Wie zerbrechlich diese Gefühle sind, besingt mittlerweile sogar ein Popsong. Die beiden auf Taiwan lebenden Musiker Namewee und Kimberly Chen haben mit “Fragile” im Oktober eine musikalische Parodie auf die “gläsernen Herzen” der chinesischen Online-Krieger veröffentlicht, die bei der kleinsten Kritik zu zerspringen drohen. “Tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe”, heißt es im Refrain. “Ich höre, wie dein fragiles Selbstwertgefühl in 1000 Teile zerbricht.” Das Musikvideo ist voller Querverweise, von der Baumwolle, die auf den H&M-Skandal Bezug nimmt, bis hin zu Winnie The Pooh, dessen Ähnlichkeit mit Xi Jinping immer noch eines der vielen Tabus in der chinesischen Internet-Landschaft darstellt. Dort wurde der Song mitsamt der Künstler-Accounts erwartungsgemäß umgehend gelöscht. Die beiden Musiker nehmen es auf die leichte Schulter. Die australische Staatsbürgerin Kimberly Chen erklärt, ihr blieben ja immer noch Instagram und Facebook. Und der aus Singapur stammende Rapper Namewee schreibt in einem Beitrag auf Instagram, dass nicht er es war, der geblockt wurde: “Diejenigen, die wirklich geblockt sind, sind jene, die nicht das Recht haben, in Freiheit Musik zu hören.”
Mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor deren Gipfeltreffen am Donnerstag zu einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufgerufen. In einem offenen Brief appellieren die Organisationen an die EU-Mitgliedsstaaten, aufgrund der schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen eine klare Botschaft an die chinesische Regierung zu senden. “Es besteht keine Aussicht darauf, dass die Winterspiele 2022 in Peking eine positive Rolle für die Menschenrechte spielen”, schrieben die NGOs. Ein gemeinsamer Boykott der EU-Länder habe das Potenzial, die “bisher stärkste Erklärung” von Regierungen zu sein, sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen.
Zu den Unterzeichnern gehörte unter anderem die International Campaign for Tibet (ICT). “Mit einem Besuch der Spiele würden sich europäische Regierungsvertreter und Diplomaten zu Komplizen der KP-Propaganda machen und die Verbrechen der KP relativieren”, betonte ICT-Geschäftsführer Kai Müller. Er geht nicht von einem positiven Effekt der Spiele im Land aus. “Die mit den Spielen 2008 versprochene Öffnung Chinas hat nie stattgefunden”, sagt Müller mit Verweis auf die Olympischen Sommerspiele in Peking vor 13 Jahren.
Den offenen Brief unterschrieben neben der ICT unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), die Ostturkestanische Union in Europa, die Tibet Initiative Deutschland (TID) und der Weltkongress der Uiguren (WUC). Für Mittwoch kündigten sie Menschenrechtsorganisationen eine Aktion vor dem Auswärtigen Amt in Berlin an. Die EU-Außenminister waren am Montag zu keinem einheitlichen Ansatz gekommen. ari
Die Europäische Union hat China anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember mit ungewohnt deutlichen Worten kritisiert. “Die EU ist weiterhin sehr besorgt über die Menschenrechtslage in der Autonomen Region Xinjiang, insbesondere über die weit verbreiteten willkürlichen Verhaftungen, die Massenüberwachung und die systematischen Verletzungen der Rede- und Religionsfreiheit”, teilte die EU-Vertretung in Peking am Freitag mit. Sie forderte die Uno-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, auf, sich des Themas mehr anzunehmen. Die EU-Diplomaten verlangen zudem “unbeschränkten und unüberwachten Zugang zu Xinjiang” für Experten, Korrespondenten und Diplomaten. In der Erklärung listete die EU-Vertretung detailliert Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auf und nannte inhaftierte Dissidenten und Journalisten.
Die Lage in Xinjiang war bereits für mehrere Staaten Anlass für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Es wird erwartet, dass die EU-Außenminister am Montag über eine gemeinsame Position der Mitgliedsstaaten debattieren werden, wie China.Table aus EU-Kreisen erfuhr. Die EU ringt derzeit um ihren Ansatz gegenüber eines diplomatischen Boykotts der Spiele. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte vergangene Woche erklärt, dass er von einem derartigen Fernbleiben nicht viel hält: “Ich denke nicht, dass wir diese Themen politisieren sollten, insbesondere wenn es sich um unbedeutende und symbolische Schritte handelt”, so Macron. Den Winterspielen sicher diplomatisch fernbleiben will bisher EU-Staat Litauen.
Die Entscheidung Litauens gegen die Entsendung offizieller Vertreter zu den Spielen ist keine Überraschung angesichts des derzeit schwelende Handelskriegs (China.Table berichtete). Dieser soll am Montag ebenfalls beim Treffen der EU-Außenminister besprochen werden. Berichten zufolge hatte es am Freitag ein erstes Treffen zwischen Vertretern der EU und des chinesischen Zolls gegeben, jedoch ohne Ergebnisse oder einer konkreten Reaktion auf die Handelsblockade.fin/ari
Mehrere Hongkonger Demokratie-Aktivisten sind am Montag zu Haftstrafen von bis zu 14 Monaten verurteilt worden. Ihnen wird vorgeworfen, gegen die Corona-Auflagen verstoßen zu haben. Sie alle hatten im vergangenen Jahr eine verbotene Mahnwache für die Opfer der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste am Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 organisiert, daran teilgenommen oder zur Teilnahme aufgerufen.
Kritiker sagten, die Behörden hätten die Pandemiebeschränkungen als Vorwand benutzt, um die Mahnwache zu untersagen. Die Hongkonger-Richterin Amanda Woodcock sagte, die Angeklagten hätten “eine echte Krise der öffentlichen Gesundheit ignoriert und herabgesetzt” und “fälschlicherweise und arrogant geglaubt”, an den 4. Juni zu gedenken, anstatt die Gesundheit der Gemeinschaft zu schützen.
Der 74 Jahre alte Medienunternehmer Jimmy Lai, ehemaliger Herausgeber der eingestellten, prodemokratischen Tageszeitung Apple Daily, erhielt eine Haftstrafe von 13 Monaten. Lai sitzt bereit wegen Verstöße gegen das Nationale Sicherheitsgesetz im Gefängnis (China.Table berichtete). Der Anwalt Chow Hang Tung, 36, wurde zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt. Die Aktivistin Gwyneth Ho, 31, wurde zu von sechs Monaten Haft verurteilt. Alle drei wurden bereits am vergangenen Donnerstag für schuldig befunden (China.Table berichtete). Lee Cheuk-yan, Anführer einer inzwischen aufgelösten Mahnwachen-Organisation, muss 14 Monaten ins Gefängnis. Insgesamt erhielten mit Lai, Chow, Lee und Ho acht Demokratie-Aktivisten Haftstrafen.
Lai verband die Verurteilung mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit. “Wenn es ein Verbrechen ist, derer zu gedenken, die wegen Ungerechtigkeit gestorben sind, dann füge mir dieses Verbrechen zu und lass mich die Strafe für dieses Verbrechen erleiden, damit ich die Last und den Ruhm dieser jungen Männer und Frauen teilen kann, die am 4. Juni ihr Blut vergossen haben, um Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte zu verkünden”, verlas Lais Anwalt einen handgeschriebenen Brief seines Mandanten vor der Verurteilung. niw/rtr
“Fair” und “kritisch” – so umreißt der frisch ins Amt gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Vorstellung einer neuen China-Politik. Ein Land von der Größe und Geschichte Chinas habe einen zentralen Platz im internationalen Konzert der Völker, erklärte Scholz in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag. “Deshalb bieten wir China Zusammenarbeit an bei Menschheitsherausforderungen wie der Klimakrise, der Pandemie oder der Rüstungskontrolle.” Weiter sagte Scholz: “Wir bieten China einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb zu beiderseitigem Nutzen an mit gleichen Spielregeln für alle.”
Zugleich verwies Scholz auf Unterschiede insbesondere in Menschenrechtsfragen. “Wir müssen unsere China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden”, sagte er. “Das heißt aber auch, dass wir unsere Augen nicht verschließen vor der kritischen Menschenrechtslage, und Verstöße gegen universelle Normen beim Namen nennen.”
CDU-Oppositionsführer Ralph Brinkhaus mahnte eine China-Strategie an, die auch Deutschlands Wirtschaftsinteressen im Blick hat. “Eine Werte-geleitete Außenpolitik ist wichtig, Menschenrechte sind wichtig”, betonte Brinkhaus. “Aber Sie haben auch die Funktion, unsere wirtschaftlichen Interessen zu vertreten“, sagte der CDU-Politiker an die Grünen und Außenministerin Annalena Baerbock gewandt. “China ist für unseren Mittelstand, für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand eine größere Herausforderung als alle Steuer- und Sozialgesetze, die wir falsch und richtig zusammen machen”, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hatte am Morgen im Deutschlandfunk dafür plädiert, dass wegen Chinas anhaltenden Menschenrechtsverletzungen kein Mitglied der Bundesregierung zu den Olympischen Winterspielen nach China fahren solle. Auch wenn das Trittin nicht ausdrücklich so formulierte, würde sich Deutschland damit dem diplomatischen Olympia-Boykott der USA und anderer Staaten anschließen. Zugleich betonte Trittin aber, Deutschland solle gemeinsam mit den anderen EU-Staaten zu einer Position kommen. Europa in dieser Frage zusammenzuhalten, werde die erste Bewährungsprobe für den Anspruch der deutschen Außenpolitik, eine europäische Politik zu formulieren, sagte der Grünen-Politiker. flee
Die chinesische Internet-Plattform Weibo ist von Chinas Internet-Regulierungsbehörde zu einer Geldstrafe von drei Millionen Yuan verurteilt worden – umgerechnet knapp 420.000 Euro. Die Cyberspace Administration of China (CAC) begründete die Strafe mit Verstößen gegen das neue Cybersicherheitsgesetz. Die Behörde erklärte jedoch nicht, gegen welche Regelungen Weibo genau verstoßen haben soll. Das Unternehmen, das ähnlich wie Twitter funktioniert, wurde angewiesen, “sofort Abhilfe zu schaffen und mit den entsprechenden Verantwortlichen ernsthaft ins Gericht zu gehen”, teilte CAC in einer Erklärung mit.
Weibo ist einer der meistgenutzten Social-Media-Kanäle Chinas und auch immer wieder Ort gesellschaftlicher Debatten und viraler Skandal-Posts. Auch die Tennisspielerin Peng Shuai hatte ihre Missbrauchsvorwürfe gegen den hochrangigen Politiker Zhang Gaoli erstmals auf Weibo publik gemacht (China.Table berichtete). Das Unternehmen mit Sitz in Peking erklärte, es “akzeptiere die aufrichtige Kritik” der Regulierungsbehörde und werde umgehend eine Arbeitsgruppe einrichten, um der Beschwerde Folge zu leisten. fpe
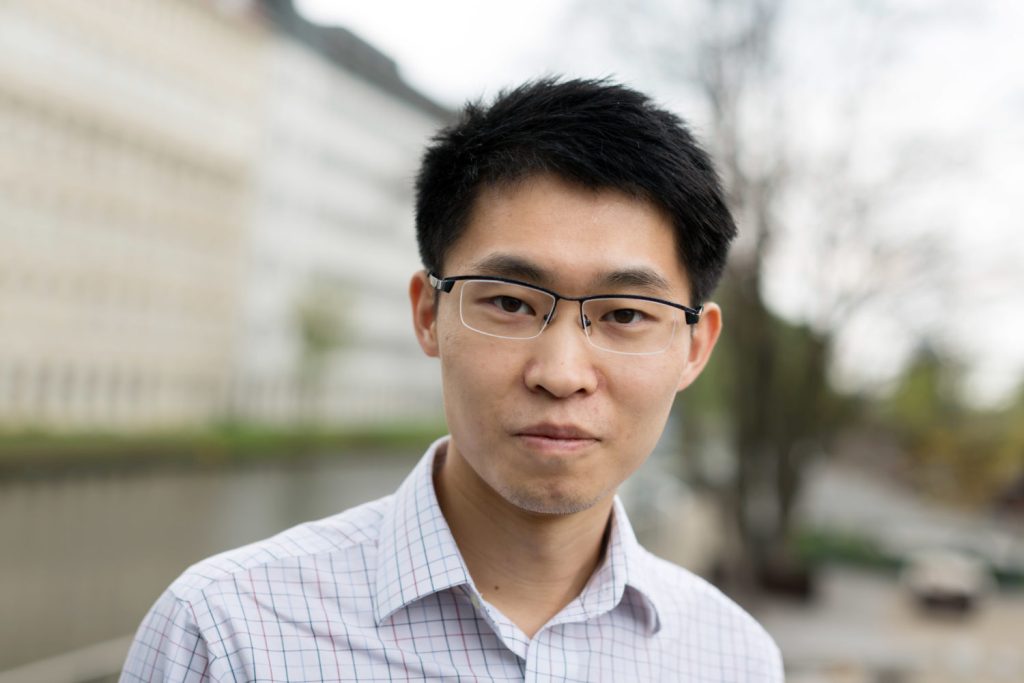
Seine letzte arbeitsbedingte Reise vor Beginn der Corona-Pandemie führte ihn nach Deutschland, Berlin. Die Stadt ist ihm nicht fremd: 2015 arbeitete Li Shuo hier im Rahmen des Internationalen Klimaschutzstipendiums der Humboldt-Stiftung. Auf die Frage, ob er die Landessprache gelernt habe, antwortet er bescheiden, aber grammatisch einwandfrei auf Deutsch: “Ich verstehe mehr oder weniger, aber mein Sprechen ist nicht genug.”
Nach der Schule studierte Li zunächst Politikwissenschaft und internationale Beziehungen am Hopkins-Nanjing-Zentrum in der Hauptstadt der Provinz Jiangsu. Sein Abschlussjahr verbrachte er dann in Washington D.C. Im Anschluss kehrte er zurück in sein Heimatland China und nahm an einem Graduiertenprogramm teil, welches sich auf die Beziehungen zwischen China und den USA fokussiert. Es ist naheliegend, dass er mit dieser akademischen Laufbahn einen Job mit “internationalem Flair” anvisierte, wie er sagt.
Bei Greenpeace arbeitet der 34-Jährige nun mit chinesischen Interessenvertretern und internationalen Akteuren gleichermaßen. Die Tätigkeit bei Greenpeace war für ihn zudem besonders reizvoll, da es sich um einen “Frontline-Job” handelt. Im chinesischen sozialwissenschaftlichen Bildungssystem lege man großen Wert auf Theorien und weniger auf Praxis, so Li. “Aber ich will mich unbedingt ins Wasser stürzen und schwimmen lernen.”
Greenpeace ist eine der größten internationalen Nichtregierungsorganisationen in China. Die Organisation sei auch dort eine bekannte Marke, so Li Shuo. In der Struktur unterscheide sie sich aber deutlich von dem, was man gemeinhin mit Greenpeace verbindet. In China findet man keine Greenpeace-Aktivisten, die auf der Straße mit Flyern und Ballons neue Mitglieder anwerben. Von freiwilligen Mitgliedschaften und Fundraising nimmt Greenpeace in China Abstand. Im Pekinger Büro der Organisation sind derzeit an die 90 Mitarbeiter beschäftigt. Nachdem Li Shuo hier 2011 als Campaigner mit dem Fokus Klima begonnen hatte, weitete sich sein Arbeitsfeld über die vergangenen zehn Jahre deutlich aus: Luftverschmutzung, Energiepolitik, Wasser und Biodiversität sind Themenkomplexe, die inzwischen in seinen Kompetenzbereich fallen.
Während er in seinem Job daran arbeitet, Chinas Klima- und Umweltpolitik zu optimieren, ist er auch in seinem Privatleben bemüht, den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, zum Beispiel, indem er seinen Fleischkonsum reduziert. Bezüglich Chinas Energieerzeugung der Zukunft setzt Li eher auf den Ausbau und die Weiterentwicklung bereits bestehender Technologien. Über Projekte wie den chinesischen Kernfusions-Reaktor Künstliche Sonne sagt er: “Ich stehe nicht so auf Science-Fiction, um ehrlich zu sein”. Und ergänzt: “Dekarbonisierung ist in gewisser Weise keine Raketenwissenschaft.” Juliane Scholübbers
Carrie Lam fürchtet, es ist Wahl und keiner geht hin. Die Bürger in Hongkong sehen offenbar so wenig Sinn in der Abstimmung unter Pekinger Regeln, dass sie lieber zu Hause bleiben. Verwaltungschefin Lam versucht allerlei Anreize zu setzen, um die Leute an die Urne zu locken. Die Opposition im Exil rät jedenfalls davon ab, seine Stimme abzugeben, weil eben nur konforme Kandidaten zur Wahl stehen. Das macht die Veranstaltung zur Farce, analysiert Marcel Grzanna. Trotzdem fährt die Stadt Tausende von Polizisten auf, um die Wahl zu schützen. Auffällig ist daran: Zu demokratischeren Zeiten war die verschärfte Überwachung der Wähler unnötig.
Um Überwachung geht es auch in der Analyse zu Sensetime, einem Weltmarktführer bei Gesichtserkennung. Das Unternehmen muss neue Sanktionen der US-Regierung hinnehmen. Es hat schließlich wichtige Ausrüstung für den Aufbau des digitalen Polizeistaats in Xinjiang geliefert. Die Programme von Sensetime erlauben die Identifikation anhand von ethnischen Merkmalen. Uiguren wurden damit wohl auch in anderen Regionen Chinas von der Polizei im öffentlichen Leben zur engmaschigen Überwachung herausgesiebt.
Der Patriotismus der Mehrheitsgesellschaft treibt derweil neue Blüten. Auch in China verbreitet sich Cancel Culture. Sie zeigt sich hier aber in einer nationalistischen und staatstragenden Variante. Die Wut im Netz entlädt sich vor allem über Nutzer, die vorgeblich nicht genug Respekt vor der chinesischen Kultur oder dem chinesischen Volk gezeigt hat. Wenn andere Meinungsäußerungen unterdrückt sind, entladen sich die Emotionen hier über den letzten erlaubten Kanal. Was leidet, ist die Kunstfreiheit, analysiert Fabian Peltsch.


Eine “Geste der kollektiven Verantwortung” nannte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam die Ankündigung, dass am kommenden Sonntag Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr für alle Bürger kostenlos sein werden. Man wolle, dass die Leute wählen gehen, so Lam. Dieser Anreiz dürfte nicht von großer Bedeutung sein, da die meisten Wahllokale in der Nähe des Wohnortes der Wähler liegen. Doch sie ist ein Zeichen dafür, dass die Sorge um eine niedrige Wahlbeteiligung groß ist.
Es ist aber auch paradox. Kaum hat die Volksrepublik China die faktische Kontrolle über die Parlamentswahlen in Hongkong an sich gerissen, sind offenbar 10.000 Polizisten zum Schutz des Urnengangs nötig. In der Vergangenheit – als die Stadt noch deutlicher unabhängiger über ihr politisches Personal abgestimmt hat – verliefen die Wahlen immer friedlich, auch ohne Polizeischutz.
Dabei hatte der Nationale Volkskongress in Peking der Sonderverwaltungszone seine einschneidende Wahlrechtsform im März doch eigens deshalb auferlegt, um die Stadt zu befrieden. Jetzt gehen die Behörden anscheinend lieber auf Nummer sicher, um den Frieden tatsächlich auch zu wahren, wenn am Sonntag (19. Dezember) ein neues Parlament unter neuen Bedingungen durch die rund 4,5 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stadt gewählt werden soll.
Demokratieaktivisten wie Glacier Wong, die derzeit in Deutschland lebt, aber auch Nathan Law, der im Exil in London ist, Regierungsgegner Sunny Cheung und der ehemalige Studentenführer Alex Chow, die beide in den USA sind, haben dieser Tage zu einem Wahlboykott aufgerufen. Erst am Mittwoch wurden vier Personen in Hongkong verhaftet, da sie andere dazu angestiftet haben, nicht an der Wahl des Legislativrats am Sonntag teilzunehmen oder leere Stimmzettel abzugeben. Damit sollen sie angeblich gegen die Wahlverordnung verstoßen haben. Seit Beginn des Jahres verbietet Peking, öffentlich “eine andere Person dazu aufzufordern, nicht zu wählen oder eine ungültige Stimme abzugeben”.
Für den früheren Hongkonger Parlamentarier Ted Hui kommt dieses Vorgehen auch nicht überraschend: “Ich glaube, das Regime hat große Angst vor dem Ergebnis und droht den Menschen deshalb.” Gegen Hui, der in Australien im Exil lebt, wurde ein weiterer Haftbefehl ausgesprochen. Auch Meinungsforschungsinstitute sind ihm zufolge gewarnt worden, die “rote Linie” nicht zu überschreiten.
Vielen seiner politischen Mitstreiter des pro-demokratischen Flügels ist die Flucht nicht gelungen. Mehrere Dutzend von ihnen sitzen nun in Haft und warten auf ihren Prozess. Ihnen wird auf Basis des Nationalen Sicherheitsgesetzes Sezession oder Untergrabung der Staatsgewalt vorgeworfen. Der neue Rechtsrahmen hat den Behörden die Möglichkeit eröffnet, jede Form politischer Opposition als Straftatbestand zu definieren.
Auch viele der einst einflussreichen Oppositionellen sitzen nun schon seit fast einem Jahr hinter Gittern. Die Prozesswelle gegen die Politiker und Aktivisten war im Sommer bis auf Weiteres verschoben worden. Ex-Parlamentarier Hui erkennt darin eine Strategie der Hongkonger Regierung. Von den pro-demokratischen Kräften könne im Vorfeld dieser Wahlen niemand aktiv werden.
Umso mehr Wahlkampf betreibt die Gegenseite, also jener Flügel, der die vorzeitige autoritäre Übernahme der Stadt durch die Volksrepublik China befürwortet. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes forderten in einer konzertierten Aktion ihre Mitbürger:innen dazu auf, “nur Patrioten” zu wählen. Aus Peking stammt die Vorgabe, dass Hongkong künftig nur noch von solchen Patrioten regiert und verwaltet werden möge.
Dazu zählen zwangsweise alle Beamte und Angestellten des Öffentlichen Dienstes. Wer seinen Arbeitsplatz nicht verlieren möchte, sollte tunlichst den Eindruck vermitteln, er sei ein Patriot, der die Linie Pekings voll und ganz unterstützt. Um das zu gewährleisten, führte die Stadt sogar ein neues Gesetz ein, das Amtsträgern einen Eid abverlangt, patriotisch – und damit im Geiste der Kommunistischen Partei – zu handeln.
Doch die Aufrufe wirken geradezu grotesk und dienen eher als ein Versuch, den Wahlen einen demokratischen Anstrich zu verpassen. Das Wahlsystem lässt ohnehin nur noch wenige Lücken für mögliche demokratische Kräfte zu. Ihr Einfluss auf die Legislative wird nur noch sehr gering sein.
Die Wähler:innen haben nur noch die Möglichkeit, die Besetzung von 20 der insgesamt 90 Sitze mit ihrer Stimme zu beeinflussen. Die Mehrheit der Sitze, 70 an der Zahl, wird stattdessen von einem Komitee vergeben, das der Pekinger Führung nahesteht. Bei der letzten Wahl waren es immerhin noch 50 Prozent der Sitze, die von der Bevölkerung bestimmt wurden. Alle Kandidat:innen mussten zudem durch einen Tauglichkeits-Check gehen. Wer dabei den Verdacht erweckte, nicht patriotisch genug zu sein, wurde seines Bürgerrechts der politischen Teilhabe enthoben.
Die chinesische Führung in Peking stellt damit sicher, dass ihr Einfluss in Hongkong noch größer wird. Zwar hatte sie in den 1980er-Jahren einen Vertrag mit den damaligen britischen Kolonialherren unterschrieben, dass der Stadt nach Übergabe 1997 an die Volksrepublik demokratische Freiheiten für 50 Jahre erhalten bleiben sollten. Doch schon wenige Jahre nach Übergabe zeichnete sich ab, dass Peking andere Pläne verfolgte und den Vertrag mit den Briten allenfalls als groben Orientierungsrahmen interpretierte.
Weil auch die Hongkonger Bürgerinnen und Bürger schnell spitz bekamen, dass die ihnen versprochenen Rechte schneller geschluckt würden als zugesagt, begannen schon zu Beginn des Jahrtausends die ersten Proteste gegen den wachsenden Pekinger Einfluss. Das Brodeln brach sich im Jahr 2019 endgültig in einer Massenbewegung bahn, die mehrere Millionen Menschen auf die Straße brachte. Hongkongs Regierung schlug mit Pekinger Unterstützung und voller Härte gegen die Demonstranten zurück. Ein Jahr nach dem Beginn der Protestbewegung schaffte Peking mit der Einführung des Sicherheitsgesetzes neue Fakten.
“Die Demokratie-Bewegung in Hongkong ist faktisch nicht mehr existent”, stellt Ex-Parlamentarier Hui fest. Der Widerstand der Opposition wird deshalb seit geraumer Zeit aus dem Ausland koordiniert. Hui schaut jetzt aus der Ferne zu, wie am kommenden Sonntag gewählt wird. 620 Wahllokale stehen zur Verfügung. 38.000 Verwaltungsbeamte werden den Ablauf des Wahlgangs begleiten. Und die 10.000 Polizisten werden dafür sorgen, dass es zu keinen Zwischenfällen kommt, die an der Legitimität der Wahl Zweifel wecken könnten. Mitarbeit: Ning Wang
Sensetime ist eine der KI-Firmen, die ihre Anwendungen bereits in der Praxis einsetzt. Die Software des Unternehmens leistet Personenerkennung mit vorher unbekannter Genauigkeit. Doch trotz Interesse der Investoren hat das Unternehmen einen geplanten Börsengang in Hongkong vorläufig verschoben. Grund ist eine Entscheidung der US-Regierung. Diese hat neue Sanktionen gegen Sensetime verhängt (China.Table berichtete), die auch die künftige Finanzposition der Firma betreffen. Grund für die Sanktionen ist der großflächige Einsatz der Sensetime-Produkte zur Überwachung der Minderheit der Uiguren.
Sensetime ist damit ein weiteres prominentes Unternehmen, das Teil der politischen Gemengelage geworden ist. Es gibt jedoch Unterschiede zu anderen Firmen, die von US-Sanktionen betroffen sind. Der Telekom-Ausrüster Huawei, der Halbleiterhersteller SMIC oder der Mobilfunker China Mobile weisen darauf hin, nur oberflächliche Beziehungen zu Chinas Sicherheitsbehörden zu haben. Sensetime dagegen liefert Kernkomponenten für den totalen digitalen Überwachungsstaat.
Der vergangene Freitag war der verhängnisvolle Tag für die Börsenpläne von Sensetime. Der 10. Dezember ist einerseits der Tag der Menschenrechte. Für US-Präsident Joe Biden ging zudem ein nur mäßig produktiver Demokratiegipfel zu Ende, zu dem China ausdrücklich nicht eingeladen war. Die US-Regierung hat dann anlässlich von Menschenrechtstag und Demokratiegipfel noch mit Sanktionen nachgelegt. Sensetime als berüchtigter Hersteller von Überwachungssoftware war ein logisches Ziel. Anders als bei früheren US-Sanktionen ging es diesmal ausdrücklich um eine Reaktion auf die Unterdrückung der Uiguren. Ebenfalls betroffen waren an diesem Tag Myanmar und Nordkorea. Rechtliche Grundlage war die Einstufung von Sensetime als Teil des “militärischen-industriellen Komplexes der Volksrepublik China”.
Am Donnerstag kamen dann bereits Gerüchte auf, dass Sensetime auf die Schwarze Liste kommen könnte (China.Table berichtete). Am Freitag wollte Sensetime eigentlich Details zum Börsengang bekannt geben. Stattdessen nahm das Management mit der Börse Hongkong Kontakt auf und verständigte sich darauf, die Börsenpläne vorerst auf Eis zu legen.
Die Art der US-Sanktionen betreffen durchaus die künftige finanzielle Lage des Unternehmens und sind damit börsenrelevant. Die Unternehmen auf der betreffenden Liste können sich in den USA nicht mehr mit Kapital versorgen. Dazu kommt der entsprechende Imageschaden. Am Samstag wehrte sich Sensetime gegen die Begründung des US-Finanzministeriums für die Sanktionen. Die Anschuldigungen “entbehren jeder Grundlage”, teilte das Unternehmen mit. “Wir halten uns in jedem Markt, auf dem wir tätig sind, an die geltenden Gesetze der dortigen Jurisdiktion.”
Das ist vermutlich richtig. In China ist es der Einparteienstaat, der auf Basis selbstgemachter Gesetze ein Kontrollregime durchsetzt. Vermutlich könnte China es Sensetime eher umgekehrt als Gesetzesverstoß auslegen, wenn es sich der Teilnahme an staatlichen Operationen verweigerte. Letztlich kann sich kein Unternehmen den Wünschen des Staates verweigern. Aus internationaler Sicht – und zumal aus der Warte einer wertegeleiteten Außenpolitik, wie sie derzeit wieder mehr im Gespräch ist – ist die Rolle des Technikunternehmens aus Shenzhen aber zumindest vielschichtig zu sehen.
Im Laufe der Jahre 2018 und 2019 wurde nach und nach bekannt, wie engmaschig die Überwachung der Wohnbevölkerung von Xinjiang und insbesondere der Uiguren geworden ist. Die New York Times veröffentlichte damals eine Reihe von einflussreichen Artikeln mit Details zum Einsatz moderner Technik in der Region. Die Software kann demnach anhand des Aussehens zwischen Uiguren und Han-Chinesen unterscheiden. Die Polizei verwendet diese Funktion möglicherweise auch außerhalb Xinjiangs. So soll sie auch in den Küstenstädten die Bewegungen und Handlungen von Uiguren mit Softwarehilfe gezielt und lückenlos verfolgen. “Minderheitenidentifikation” heißt das Ausstattungsmerkmal der Software den Berichten zufolge.
Sensetime gehörte damit fast sicher zu den Firmen, die technische Infrastruktur für die Errichtung eines digitalen Polizeistaats in der Region Xinjiang geliefert haben. Zusammen mit anderen Unternehmen wurde Sensetime damit in der westlichen Öffentlichkeit zum Synonym für lückenlose Überwachung. Mitte Oktober gab das Unternehmen dann bekannt, einen Börsengang in Hongkong anzustreben. Sofort nach Ankündigung war jedoch die Verstrickung in den Aufbau des Überwachungsstaates wieder ein Thema (China.Table berichtete).
Der größte Vorteil von Sensetime ist auf der internationalen Bühne also auch sein größtes Problem: Der chinesische Staat ist der weltweit größtmögliche Kunde für Überwachungstechnik. In anderen Ländern gibt es ebenfalls kompetente Anbieter von Software zur Erkennung biometrischer Merkmale, auch wenn viele von ihnen nicht in der gleichen Liga wie Sensetime spielen. So sitzt in Dresden die Firma Cognitec, deren Gesichtserkennung ebenfalls präzise funktioniert. Sie arbeitet auch durchaus mit dem Bundeskriminalamt zusammen. Doch das auffälligste Projekt, an dem Cognitec mitgewirkt hat, war lediglich ein Testlauf für Gesichtserkennung im öffentlichen Raum am Berliner Bahnhof Südkreuz.
Die einzelne Kamera über einer Rolltreppe hat jedoch bereits eine landesweite Debatte über die Gefahren der Gesichtserkennung ausgelöst. Es sind in Deutschland in absehbarer Zeit also keine Aufträge für großflächige Personenerkennung im öffentlichen Raum zu erwarten. Eine Initiative zur Überwachung von 100 Knotenpunkten von Ex-Innenminister Horst Seehofer ist krachend gescheitert. Die Software von Cognitec kommt beim BKA also nur intern zur “Lichtbildrecherche” in Datenbanken zum Einsatz.
Die chinesischen Anbieter wie Sensetime und Megvii können ihre Anwendungen dagegen im Masseneinsatz weiterentwickeln. Die Staatsaufträge spülen ihnen Geld in die Kasse, das wiederum in die Produkte fließt. Der Börsengang in Hongkong hätte für Sensetime einen weiteren Geldsegen gebracht: 680 Millionen Euro wollte das Unternehmen durch die Ausgabe der Anteilsscheine einnehmen.
Das ursprüngliche Interesse der Investoren hatte nicht nur mit dem chinesischen Staat als Hauptkunden zu tun, sondern auch mit dem erreichten technischen Niveau. Wie viele KI-Anbieter verwendet Sensetime neuronale Netze für die Mustererkennung im Kern des Systems. Es verwendet dabei eine ähnliche Struktur wie ein Nervensystem und lernt die entscheidenden Fähigkeiten anhand von Beispielen. Sensetime bettet die reine Musterkennung aber auch besonders geschickt in einen Rahmen aus konventioneller Software ein.
Die Software verfolgt Personen in der realen Welt von Kamera zu Kamera durch die Stadt. Außerdem erkennt sie Personen nicht nur am Gesicht, sondern auch am Gang, der Armhaltung und anderen Eigenschaften. Um diese Muster aufzunehmen, müssen sie nur einmal zusammen mit dem Gesicht auf den Kamerabildern zu sehen gewesen sein. All das macht die Fähigkeiten der Software so wertvoll für die allgegenwärtige Überwachung beispielsweise in Xinjiang.
Im Jahr 2018 war Sensetime mit einer Bewertung von sechs Milliarden US-Dollar bereits das wertvollste KI-Startup der Welt. Da war das Unternehmen bereits profitabel. Sensetime arbeitet weltweit bereits mit Hunderten von Kunden zusammen, darunter der US-Chiphersteller Qualcomm oder der japanische Autohersteller Honda im Bereich des autonomen Fahrens. Hier erkennt und bewertet das System, was vor dem Auto auf der Straße passiert. Dennoch musste das Unternehmen seinen Börsengang wegen der Menschenrechtsdebatte bereits kleiner fahren als ursprünglich erhofft.
Sensetime wurde 2014 von Tang Xiao’ou gegründet, einem Informatiker von der Chinese University of Hongkong. Der Fokus lag von Anfang an darauf, eigene Algorithmen zu entwickeln. Viele Wettbewerber verwenden Techniken, die frei zur Verfügung stehen oder ganz einfach dem Stand dessen, was an den Unis gelehrt wird. In den ersten Jahren der Unternehmensgeschichte hat die besonders gut funktionierende Gesichtserkennung von Sensetime noch Begeisterung ausgelöst. Das Start-up galt als Beispiel dafür, wie fortschrittlich Chinas Technikfirmen sind.
Der Blick auf Sensetime hat sich durch die Ereignisse der vergangenen Jahre dann stark verändert. Die klare Sprache des US-Finanzministeriums, die das Unternehmen mit den Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang in Verbindung bringt, verstärkt nun den Eindruck: Sensetime hat seine Unschuld als Technikunternehmen endgültig verloren. Das wichtige Segment ethischer oder nachhaltiger Investoren steht dem Unternehmen bei seinen Börsenplänen nicht mehr als Kapitalgeber zur Verfügung. Zugleich zeigt das Beispiel Sensetime, dass es in kritischen Sektoren fast unmöglich wird, sich einfach nur an die regionalen Gesetze zu halten und es damit allen recht zu machen.
Dass sie wegen eines Fotos als “Verräterin Chinas” gebrandmarkt würde, hatte Chen Man nicht kommen sehen. Nachdem die 41-jährige Starfotografin aus Peking ein asiatisches Modell für eine Handtaschen-Werbung von Dior abgelichtet hatte, stand sie Mitte November plötzlich am Internet-Pranger: Chen bediene mit ihren Bildern westliche Klischees chinesischer Frauen, schrieben empörte User auf chinesischen Social-Media-Kanälen wie Weibo. Die Augen seien zu schmal, die Wangenknochen zu hoch, das Make-up und die Kleidung erinnern an eine “gruselige Konkubine” aus der Qing-Dynastie. Chinesische Schönheit sehe anders aus.
Auch die staatliche Zeitung Beijing Daily stimmte in den Chor der Entrüstung ein: Das Foto “verzerre die chinesische Kultur”. Daraufhin entschuldigte sich Chen für ihre “Rücksichtslosigkeit” und “Ignoranz”. Die “Rénròu Sōusuo 人肉搜索”, die “Menschenfleischsuche”, wie man eine Online-Hetzjagd in China nennt, war da jedoch bereits in vollem Gange. Die User arbeiteten sich systematisch durch Chens Portfolio und sammelten Beweisfotos, die Rückschlüsse auf ihre vermeintlich unpatriotische Haltung zulassen.
Bilder eines leicht bekleideten Models auf dem Drei-Schluchten-Damm, die Chen bereits 2008 veröffentlicht hatte, galten plötzlich als “antichinesisch”. Um “die Gefühle der Chinesen nicht weiter zu verletzen”, löschte die weltweit gefragte Fashion-Fotografin alle “problematischen” Bilder aus ihrem Werk. “In der Zwischenzeit werde ich mich besser über die chinesische Geschichte informieren und den selbstbewussten Geist der neuen Ära Chinas als Inspirationsquelle nutzen, um die chinesische Geschichte durch meine Arbeit zu erzählen”, erklärte Chen in einem offenen Brief auf Weibo. Eine Selbstkritik wie aus dem Parteileitfaden.
Auch in den USA und in Europa gibt es die Tendenz, die Absender von unkorrekten Äußerungen zu brandmarken und möglichst zum Schweigen bringen. Dafür hat sich in den vergangenen Jahren der Begriff “Cancel Culture” etabliert. Wer etwas Unpassendes sagt, wird von der Netzgemeinde scharf kritisiert und seine Meinung “ausgelöscht” oder “rückgängig gemacht”, sprich: gecancelt. Es gibt diese Tendenz in allen Lagern von links bis rechts und von religiös bis liberal. In China ist ihre Ausprägung als patriotische Bewegung besonders stark.
Chinas nationalistische Cancel Culture macht heute vor niemandem Halt. Davon kann auch die Wirtschaftswelt ein Lied singen. Die Liste der Unternehmen, die bereits dafür abgestraft wurden, die “Gefühle des chinesischen Volkes” verletzt zu haben, wird mit jedem Monat länger. VW, H&M, Nike, Zara, Burberry, Adidas, Puma, Dolce & Gabbana und sogar die US-Basketball-Liga NBA sind nur einige Beispiele internationaler Player, die in China öffentlich angeprangert und boykottiert wurden.
Mal war der Stein des Anstoßes die Verwendung eines Dalai-Lama-Zitats, mal die vermeintlich böswillige Dreistigkeit, Taiwan auf der Firmenwebseite als eigenständiges Land zu kennzeichnen. “Jeder, der das chinesische Volk beleidigt, sollte darauf vorbereitet sein, den Preis zu bezahlen”, kommentierte Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Anfang des Jahres die kollektive Wut über H&Ms Ankündigung, keine in Zwangsarbeit geerntete Baumwolle aus Xinjiang mehr verwenden zu wollen (China.Table berichtete).
Was bei solchen Online-Hetzkampagnen tatsächlich auf das chinesische Volk zurückgeht und was von der Regierung orchestriert wird, sei sei oft schwer zu bestimmen, erklärt Adam Ni, Vorstandsmitglied beim China Policy Center, einem unabhängigen australischen China-Think Tank. In dem von Ni herausgegebenen Blog “The China Story” und seiner dortigen Online-Kolumne “Neican 内参” hat sich der Jurist intensiv mit dem Phänomen des chinesischen Cyber-Nationalismus auseinandergesetzt. “Ich denke, dass sich die Regierungsaktivitäten und die Empörung der Internet-User gegenseitig bedingen und befeuern.”
Dass die chinesische Regierung seit Mitte der Nullerjahre gezielt das Meinungsbild in Online-Foren und sozialen Netzwerken mit bezahlten Kommentatoren manipuliert, ist kein Geheimnis. Oft werden diese Keyboard-Krieger als “Wumao 五毛” bezeichnet, ein Begriff, der suggeriert, dass sie für jeden ihrer Kommentare mit 0,5 Yuan entlohnt werden, umgerechnet sieben Cent. Das Bild des willenlosen Cyber-Söldners ist jedoch veraltet. Die lautesten und aggressivsten Stimmen in Chinas Online-Community sind heute oftmals Digital Natives aus der Mittelschicht, die über VPN-Kanäle Zugang zu westlichen Medien und Netzwerken haben. Man nennt sie auch “Little Pinks”, 小粉红 xiǎo fěnhóng”, nach der Farbe eines Online-Forums, in dem sich die jungen Cyber-Nationalisten früher oft tummelten.
Laut einer Umfrage von Asian Barometer Survey (ABS) legt die “Generation Z” der zwischen 1990 und 2000 geborenen Chinesen großen Wert auf persönlichen Selbstausdruck. Gleichzeitig sind sie mit der Propagandamaschinerie von Xi Jinping aufgewachsen, der die “Verjüngung der chinesischen Nation” heraufbeschwört. Sie unterstellt “ausländischen Kräften”, Chinas Aufstieg zu sabotieren. Die Spannungen mit dem Westen und die Überzeugung, dass China die Covid-Pandemie besser gemeistert habe als der Rest der Welt, erfüllt die jungen Chinesen mit Stolz, zugleich aber auch mit Trotz gegen die Außenwelt. Hier ist eine explosive Mischung entstanden, die schnell in offene Aggression umschlagen kann.
Eine bekannte Vertreterin der patriotischen Online-Bewegung ist die Bloggerin Guyanmuchan, die auf Weibo rund 6,5 Millionen Follower hat, aber auch auf westlichen Portalen wie Twitter Stimmung gegen die “Feinde Chinas” macht. Die Ästhetik ihres Kanals ist Teenie-gerecht, Memes und niedliche Comic-Figuren treffen dort auf Überschriften wie “Europa ist nur ein Hund an der Leine der USA”.
Der Staat bedient dieses nationalistische Sentiment gezielt, in dem er seine eigene Propaganda zusehends verjüngt. Regierungskanäle nutzen längst auch Internet-Slang. Staatlich produzierte Cartoons machen sich über den Westen lustig. “Rote” Rapsongs feiern die Errungenschaften der KPCh. Teilweise werden die Kommentare und Essays aus dem Little-Pink-Universum von offiziellen Medien aufgegriffen und weiterverbreitet. “Oft beginnt eine Hetzkampagne mit ehrlicher Empörung. Wenn der Staat aber eine eigene Agenda zum jeweiligen Thema hat, gießt er weiter Öl ins Feuer”, erläutert Adam Ni. Darin liege auch der große Unterschied zur westlichen Ausprägung der sogenannten Cancel Culture. “In China mischt die Regierung vorne mit.”
Weil sie eine Stimmung der Angst erzeugen, verglichen Kritiker wie der in Shanghai und New York lebende Schriftsteller Xia Shang die Internet-Hetzer bereits mit den Roten Garden. Für Adam Ni geht dieser Vergleich zu weit: “Während der Kulturrevolution waren die Konsequenzen schrecklicher als heute”, erklärt der Blogger. Im Land habe Chaos geherrscht, Menschen seien ganz real ermordet worden. “Viele Funktionäre haben das Leid damals am eigenen Leib erfahren. Dass so etwas noch einmal passiert, will die Partei unbedingt vermeiden.” Die heutige Situation gleiche eher einem Dampfkochtopf, bei dem Peking den Deckel fest in der Hand hält, so Ni. “Die Regierung weiß ganz genau, wie man den Druck jederzeit wieder rausnimmt.”
Das kann etwa passieren, wenn eine staatliche Zeitung selbst plötzlich Opfer des Online-Mobs wird, zum Beispiel weil sie gegenüber dem Ausland eine gefühlt zu weiche Position vertreten hat. Dann werden kritische Kommentare und Accounts von den Zensoren gelöscht und beschwichtigende Artikel als Gegengewicht lanciert. “Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Little Pinks nicht dazu beitragen, Chinas Image in der Welt zu verbessern”, erläutert Ni. Andererseits benutzt die Regierung die Empörung der Massen gezielt, um außenpolitische Positionen zu rechtfertigen, etwa wenn sie erklärt, dass die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Covid-Pandemie “die Gefühle des chinesischen Volkes” verletze.
Wie zerbrechlich diese Gefühle sind, besingt mittlerweile sogar ein Popsong. Die beiden auf Taiwan lebenden Musiker Namewee und Kimberly Chen haben mit “Fragile” im Oktober eine musikalische Parodie auf die “gläsernen Herzen” der chinesischen Online-Krieger veröffentlicht, die bei der kleinsten Kritik zu zerspringen drohen. “Tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe”, heißt es im Refrain. “Ich höre, wie dein fragiles Selbstwertgefühl in 1000 Teile zerbricht.” Das Musikvideo ist voller Querverweise, von der Baumwolle, die auf den H&M-Skandal Bezug nimmt, bis hin zu Winnie The Pooh, dessen Ähnlichkeit mit Xi Jinping immer noch eines der vielen Tabus in der chinesischen Internet-Landschaft darstellt. Dort wurde der Song mitsamt der Künstler-Accounts erwartungsgemäß umgehend gelöscht. Die beiden Musiker nehmen es auf die leichte Schulter. Die australische Staatsbürgerin Kimberly Chen erklärt, ihr blieben ja immer noch Instagram und Facebook. Und der aus Singapur stammende Rapper Namewee schreibt in einem Beitrag auf Instagram, dass nicht er es war, der geblockt wurde: “Diejenigen, die wirklich geblockt sind, sind jene, die nicht das Recht haben, in Freiheit Musik zu hören.”
Mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor deren Gipfeltreffen am Donnerstag zu einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufgerufen. In einem offenen Brief appellieren die Organisationen an die EU-Mitgliedsstaaten, aufgrund der schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen eine klare Botschaft an die chinesische Regierung zu senden. “Es besteht keine Aussicht darauf, dass die Winterspiele 2022 in Peking eine positive Rolle für die Menschenrechte spielen”, schrieben die NGOs. Ein gemeinsamer Boykott der EU-Länder habe das Potenzial, die “bisher stärkste Erklärung” von Regierungen zu sein, sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen.
Zu den Unterzeichnern gehörte unter anderem die International Campaign for Tibet (ICT). “Mit einem Besuch der Spiele würden sich europäische Regierungsvertreter und Diplomaten zu Komplizen der KP-Propaganda machen und die Verbrechen der KP relativieren”, betonte ICT-Geschäftsführer Kai Müller. Er geht nicht von einem positiven Effekt der Spiele im Land aus. “Die mit den Spielen 2008 versprochene Öffnung Chinas hat nie stattgefunden”, sagt Müller mit Verweis auf die Olympischen Sommerspiele in Peking vor 13 Jahren.
Den offenen Brief unterschrieben neben der ICT unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), die Ostturkestanische Union in Europa, die Tibet Initiative Deutschland (TID) und der Weltkongress der Uiguren (WUC). Für Mittwoch kündigten sie Menschenrechtsorganisationen eine Aktion vor dem Auswärtigen Amt in Berlin an. Die EU-Außenminister waren am Montag zu keinem einheitlichen Ansatz gekommen. ari
Die Europäische Union hat China anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember mit ungewohnt deutlichen Worten kritisiert. “Die EU ist weiterhin sehr besorgt über die Menschenrechtslage in der Autonomen Region Xinjiang, insbesondere über die weit verbreiteten willkürlichen Verhaftungen, die Massenüberwachung und die systematischen Verletzungen der Rede- und Religionsfreiheit”, teilte die EU-Vertretung in Peking am Freitag mit. Sie forderte die Uno-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, auf, sich des Themas mehr anzunehmen. Die EU-Diplomaten verlangen zudem “unbeschränkten und unüberwachten Zugang zu Xinjiang” für Experten, Korrespondenten und Diplomaten. In der Erklärung listete die EU-Vertretung detailliert Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auf und nannte inhaftierte Dissidenten und Journalisten.
Die Lage in Xinjiang war bereits für mehrere Staaten Anlass für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Es wird erwartet, dass die EU-Außenminister am Montag über eine gemeinsame Position der Mitgliedsstaaten debattieren werden, wie China.Table aus EU-Kreisen erfuhr. Die EU ringt derzeit um ihren Ansatz gegenüber eines diplomatischen Boykotts der Spiele. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte vergangene Woche erklärt, dass er von einem derartigen Fernbleiben nicht viel hält: “Ich denke nicht, dass wir diese Themen politisieren sollten, insbesondere wenn es sich um unbedeutende und symbolische Schritte handelt”, so Macron. Den Winterspielen sicher diplomatisch fernbleiben will bisher EU-Staat Litauen.
Die Entscheidung Litauens gegen die Entsendung offizieller Vertreter zu den Spielen ist keine Überraschung angesichts des derzeit schwelende Handelskriegs (China.Table berichtete). Dieser soll am Montag ebenfalls beim Treffen der EU-Außenminister besprochen werden. Berichten zufolge hatte es am Freitag ein erstes Treffen zwischen Vertretern der EU und des chinesischen Zolls gegeben, jedoch ohne Ergebnisse oder einer konkreten Reaktion auf die Handelsblockade.fin/ari
Mehrere Hongkonger Demokratie-Aktivisten sind am Montag zu Haftstrafen von bis zu 14 Monaten verurteilt worden. Ihnen wird vorgeworfen, gegen die Corona-Auflagen verstoßen zu haben. Sie alle hatten im vergangenen Jahr eine verbotene Mahnwache für die Opfer der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste am Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 organisiert, daran teilgenommen oder zur Teilnahme aufgerufen.
Kritiker sagten, die Behörden hätten die Pandemiebeschränkungen als Vorwand benutzt, um die Mahnwache zu untersagen. Die Hongkonger-Richterin Amanda Woodcock sagte, die Angeklagten hätten “eine echte Krise der öffentlichen Gesundheit ignoriert und herabgesetzt” und “fälschlicherweise und arrogant geglaubt”, an den 4. Juni zu gedenken, anstatt die Gesundheit der Gemeinschaft zu schützen.
Der 74 Jahre alte Medienunternehmer Jimmy Lai, ehemaliger Herausgeber der eingestellten, prodemokratischen Tageszeitung Apple Daily, erhielt eine Haftstrafe von 13 Monaten. Lai sitzt bereit wegen Verstöße gegen das Nationale Sicherheitsgesetz im Gefängnis (China.Table berichtete). Der Anwalt Chow Hang Tung, 36, wurde zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt. Die Aktivistin Gwyneth Ho, 31, wurde zu von sechs Monaten Haft verurteilt. Alle drei wurden bereits am vergangenen Donnerstag für schuldig befunden (China.Table berichtete). Lee Cheuk-yan, Anführer einer inzwischen aufgelösten Mahnwachen-Organisation, muss 14 Monaten ins Gefängnis. Insgesamt erhielten mit Lai, Chow, Lee und Ho acht Demokratie-Aktivisten Haftstrafen.
Lai verband die Verurteilung mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit. “Wenn es ein Verbrechen ist, derer zu gedenken, die wegen Ungerechtigkeit gestorben sind, dann füge mir dieses Verbrechen zu und lass mich die Strafe für dieses Verbrechen erleiden, damit ich die Last und den Ruhm dieser jungen Männer und Frauen teilen kann, die am 4. Juni ihr Blut vergossen haben, um Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte zu verkünden”, verlas Lais Anwalt einen handgeschriebenen Brief seines Mandanten vor der Verurteilung. niw/rtr
“Fair” und “kritisch” – so umreißt der frisch ins Amt gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Vorstellung einer neuen China-Politik. Ein Land von der Größe und Geschichte Chinas habe einen zentralen Platz im internationalen Konzert der Völker, erklärte Scholz in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag. “Deshalb bieten wir China Zusammenarbeit an bei Menschheitsherausforderungen wie der Klimakrise, der Pandemie oder der Rüstungskontrolle.” Weiter sagte Scholz: “Wir bieten China einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb zu beiderseitigem Nutzen an mit gleichen Spielregeln für alle.”
Zugleich verwies Scholz auf Unterschiede insbesondere in Menschenrechtsfragen. “Wir müssen unsere China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden”, sagte er. “Das heißt aber auch, dass wir unsere Augen nicht verschließen vor der kritischen Menschenrechtslage, und Verstöße gegen universelle Normen beim Namen nennen.”
CDU-Oppositionsführer Ralph Brinkhaus mahnte eine China-Strategie an, die auch Deutschlands Wirtschaftsinteressen im Blick hat. “Eine Werte-geleitete Außenpolitik ist wichtig, Menschenrechte sind wichtig”, betonte Brinkhaus. “Aber Sie haben auch die Funktion, unsere wirtschaftlichen Interessen zu vertreten“, sagte der CDU-Politiker an die Grünen und Außenministerin Annalena Baerbock gewandt. “China ist für unseren Mittelstand, für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand eine größere Herausforderung als alle Steuer- und Sozialgesetze, die wir falsch und richtig zusammen machen”, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hatte am Morgen im Deutschlandfunk dafür plädiert, dass wegen Chinas anhaltenden Menschenrechtsverletzungen kein Mitglied der Bundesregierung zu den Olympischen Winterspielen nach China fahren solle. Auch wenn das Trittin nicht ausdrücklich so formulierte, würde sich Deutschland damit dem diplomatischen Olympia-Boykott der USA und anderer Staaten anschließen. Zugleich betonte Trittin aber, Deutschland solle gemeinsam mit den anderen EU-Staaten zu einer Position kommen. Europa in dieser Frage zusammenzuhalten, werde die erste Bewährungsprobe für den Anspruch der deutschen Außenpolitik, eine europäische Politik zu formulieren, sagte der Grünen-Politiker. flee
Die chinesische Internet-Plattform Weibo ist von Chinas Internet-Regulierungsbehörde zu einer Geldstrafe von drei Millionen Yuan verurteilt worden – umgerechnet knapp 420.000 Euro. Die Cyberspace Administration of China (CAC) begründete die Strafe mit Verstößen gegen das neue Cybersicherheitsgesetz. Die Behörde erklärte jedoch nicht, gegen welche Regelungen Weibo genau verstoßen haben soll. Das Unternehmen, das ähnlich wie Twitter funktioniert, wurde angewiesen, “sofort Abhilfe zu schaffen und mit den entsprechenden Verantwortlichen ernsthaft ins Gericht zu gehen”, teilte CAC in einer Erklärung mit.
Weibo ist einer der meistgenutzten Social-Media-Kanäle Chinas und auch immer wieder Ort gesellschaftlicher Debatten und viraler Skandal-Posts. Auch die Tennisspielerin Peng Shuai hatte ihre Missbrauchsvorwürfe gegen den hochrangigen Politiker Zhang Gaoli erstmals auf Weibo publik gemacht (China.Table berichtete). Das Unternehmen mit Sitz in Peking erklärte, es “akzeptiere die aufrichtige Kritik” der Regulierungsbehörde und werde umgehend eine Arbeitsgruppe einrichten, um der Beschwerde Folge zu leisten. fpe
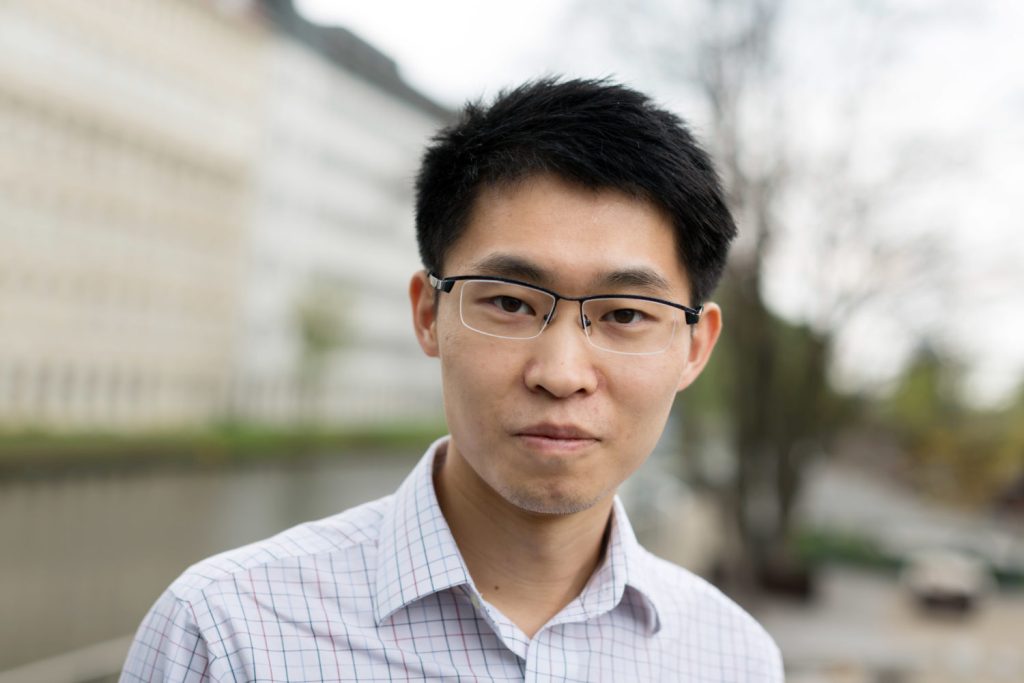
Seine letzte arbeitsbedingte Reise vor Beginn der Corona-Pandemie führte ihn nach Deutschland, Berlin. Die Stadt ist ihm nicht fremd: 2015 arbeitete Li Shuo hier im Rahmen des Internationalen Klimaschutzstipendiums der Humboldt-Stiftung. Auf die Frage, ob er die Landessprache gelernt habe, antwortet er bescheiden, aber grammatisch einwandfrei auf Deutsch: “Ich verstehe mehr oder weniger, aber mein Sprechen ist nicht genug.”
Nach der Schule studierte Li zunächst Politikwissenschaft und internationale Beziehungen am Hopkins-Nanjing-Zentrum in der Hauptstadt der Provinz Jiangsu. Sein Abschlussjahr verbrachte er dann in Washington D.C. Im Anschluss kehrte er zurück in sein Heimatland China und nahm an einem Graduiertenprogramm teil, welches sich auf die Beziehungen zwischen China und den USA fokussiert. Es ist naheliegend, dass er mit dieser akademischen Laufbahn einen Job mit “internationalem Flair” anvisierte, wie er sagt.
Bei Greenpeace arbeitet der 34-Jährige nun mit chinesischen Interessenvertretern und internationalen Akteuren gleichermaßen. Die Tätigkeit bei Greenpeace war für ihn zudem besonders reizvoll, da es sich um einen “Frontline-Job” handelt. Im chinesischen sozialwissenschaftlichen Bildungssystem lege man großen Wert auf Theorien und weniger auf Praxis, so Li. “Aber ich will mich unbedingt ins Wasser stürzen und schwimmen lernen.”
Greenpeace ist eine der größten internationalen Nichtregierungsorganisationen in China. Die Organisation sei auch dort eine bekannte Marke, so Li Shuo. In der Struktur unterscheide sie sich aber deutlich von dem, was man gemeinhin mit Greenpeace verbindet. In China findet man keine Greenpeace-Aktivisten, die auf der Straße mit Flyern und Ballons neue Mitglieder anwerben. Von freiwilligen Mitgliedschaften und Fundraising nimmt Greenpeace in China Abstand. Im Pekinger Büro der Organisation sind derzeit an die 90 Mitarbeiter beschäftigt. Nachdem Li Shuo hier 2011 als Campaigner mit dem Fokus Klima begonnen hatte, weitete sich sein Arbeitsfeld über die vergangenen zehn Jahre deutlich aus: Luftverschmutzung, Energiepolitik, Wasser und Biodiversität sind Themenkomplexe, die inzwischen in seinen Kompetenzbereich fallen.
Während er in seinem Job daran arbeitet, Chinas Klima- und Umweltpolitik zu optimieren, ist er auch in seinem Privatleben bemüht, den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, zum Beispiel, indem er seinen Fleischkonsum reduziert. Bezüglich Chinas Energieerzeugung der Zukunft setzt Li eher auf den Ausbau und die Weiterentwicklung bereits bestehender Technologien. Über Projekte wie den chinesischen Kernfusions-Reaktor Künstliche Sonne sagt er: “Ich stehe nicht so auf Science-Fiction, um ehrlich zu sein”. Und ergänzt: “Dekarbonisierung ist in gewisser Weise keine Raketenwissenschaft.” Juliane Scholübbers
