wir leben in einer merkwürdigen Zwischenzeit: Die Coronapandemie verlangt eigentlich danach, dass viel schneller digitalisiert wird. Aber die politischen Akteure tun sich schwer damit, das angekündigte milliardenschwere Programm voranzutreiben. Das sieht man an der neuen Präsidentin der Kultusminister, Karin Prien (CDU), die gerade offiziell inthronisiert wurde. Sie beginnt nun, immerhin, über ihre digitalen Pläne zu sprechen.
Auch der Bundestag hat seine Rolle noch nicht gefunden. Die Ampel ist damit beschäftigt, ihre Koalitionsvereinbarung wieder und wieder vorzulesen. Und die Opposition, vor allem die CDU, bietet sich abwartend als Partner an. Nun hat der neue Sprecher für Bildung und Forschung der CDU, Thomas Jarzombek, eine Grundgesetzänderung für den Digitalpakt angetönt, wie Niklas Prenzel im Parlament erfahren hat.
Wie dringend eine pädagogische Transformation mithilfe digitaler Medien ist, kann man gerade an den außerparlamentarischen Akteuren erkennen. Wir haben mit Familie Balk gesprochen, die ihre Kinder nicht in die Präsenzschule schicken kann – und von sicheren, weil digitalen Möglichkeiten berichtet. Schülersprecher Anjo Genow lernt an einer digitalen Modellschule. Er weiß, dass es viele Schüler gibt, die endlich das volle digitale Potenzial ausschöpfen wollen. Diese Potenziale kennt der zornige Digitallehrer Simon Maria Hassemer. Er erzählt davon, wie virtuelle Realitäten neue, ungekannte Räume für das Lernen öffnen.
Lassen Sie sich entführen!


Jetzt also digitale Transformation. Als Karin Prien, Christdemokratin und Schulministerin im Norden, offiziell ihr Amt als neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) antrat, sparte sie nicht mit großen Worten. Sie schwärmte von einer Dynamik im Schulsystem, “die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten.” Prien lobte den gewaltigen Digitalisierungsschub der Schulen. Und sie nahm Worte in den Mund, auf die man lange gewartet hatte: Eine Transformation, “um unser Bildungssystem in die Zukunft zu führen.” Sie sagte das in der James-Simon-Galerie, in dem prachtvoll renovierten Besucherzentrum der Berliner Museumsinsel. Jeder Ort hat seine Rhetorik.
Eine Woche zuvor, bei der ersten Pressekonferenz Karin Priens als KMK-Präsidentin, hatte man vergeblich auf diese wichtigen Schlüsselbegriffe gehofft. Da ging es der neuen Prima inter Pares nur um eines: Die Schulen müssen offen bleiben! Die Schulen dürfen nicht geschlossen werden! Die 56-Jährige wiederholte ihr Mantra so oft, dass man sich ein bisschen an ihre stets sachliche, aber repetitive Vorgängerin erinnert fühlte, Britta Ernst (SPD) aus Brandenburg. Die Formel “digitale Bildung” war in der Online-Pressekonferenz geradezu ein Tabu. Wie kommt es, dass Karin Prien die Digitalisierung der Bildung wenige Tage später plötzlich so wichtig war?
Weil sie das kann, schnelle Positionswechsel. Als die Wirtschaftsanwältin von Hamburg nach Schleswig-Holstein berufen wurde, um dort Bildungsministerin zu werden, war das erstmals deutlich geworden. Aus der Hansestadt brach eine entschiedene Gegnerin der Rückkehr zum G9 auf, dem Gymnasium mit neun Jahren Laufzeit. In Kiel kam indes eine Befürworterin des G9 an. Wie konnte das passieren? Der starke Mann der CDU in Kiel hatte zuvor genau dieses neunjährige Gymnasium zu einem seiner Wahlkampfschlager gemacht. Obwohl die Verkürzung der wichtigsten deutschen Schulform eigentlich kein Thema mehr war, heizte der heutige Ministerpräsident Daniel Günther den Kulturkampf ums Gymnasium zu Machtzwecken wieder an.
Und Karin Prien? Stellte sich wortgewandt auf die neue Lage ein. Sie habe nicht mitbeschlossen, vom gekürzten wieder aufs lange Gymnasium zurückzukehren, sagte sie dem Hamburger Abendblatt. “Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass G8 oder G9 keine Glaubensfrage, sondern eine Abwägungsfrage ist.” In Schleswig-Holstein herrschten ganz andere Verhältnisse als in Hamburg. Prien war also nun für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium an der Waterkant – mit plausiblen Gründen.
Bekannt, geradezu berühmt wurde Prien allerdings nicht durch schulpolitische Finessen. Sie beherrscht einen Klartext, den in der CDU nur wenige können. Verschwörungserzähler wie Hans-Georg Maaßen mag sie nicht in der Union dulden. Prien hat mit dieser klaren Haltung die CDU in Teilen der Gesellschaft erst wieder satisfaktionsfähig gemacht. “Ça suffit“, twitterte Prien etwa, als Maaßen ein Impfverbot gefordert hatte. Diese beiden Worte der viersprachigen Intellektuellen reichten, um einen Twitterorkan auszulösen “Wenn ein ehemaliger Spitzenbeamter und Verfassungsschützer solch einen verschwörungstheoretischen Unsinn verbreitet”, erklärte Prien danach, “dann können wir als CDU das nicht länger tolerieren.” Sie werde beantragen, ihn aus der Partei zu werfen.
Manche rieben sich die Augen, woher eine aus der gelegentlich blassen Riege der Kultusminister diesen Mut nahm. Das könnte biografische Gründe haben. Karin Prien kam in Amsterdam zur Welt, als Enkelin vor den Nazis geflohener Juden. Um es ganz genau zu sagen, befinden sich in ihrer Familie zwei jüdische Großväter, die nach Amsterdam fliehen mussten – der eine vor den Nazis, der andere vor Kommunisten. Die derzeitige Präsidentin der Kultusminister hat eine Biografie, die für mehr geschaffen ist. Hätte die taumelnde und mit sich selbst befasste CDU früher nachgedacht, dann hätte sie mit Karin Prien vielleicht sogar eine Kandidatin gehabt, die Frank-Walter Steinmeier hätte schlagen können: die erste Frau mit jüdischen Wurzeln als Anwärterin auf das Schloss Bellevue. Aber das war dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz wohl zu gefährlich – auch den hat sich Prien bereits einige Male zurechtgelegt.
Die ehrgeizige Wirtschaftsanwältin regiert in Schleswig-Holstein mit FDP und Grünen, die nicht selten Karin zu ihr sagen. “Das hat sich ganz schnell so ergeben, sie ist im Umgang total unkompliziert“, berichtet eine, die dabei ist. Sie höre wirklich zu – auch, wenn man Argumente vorträgt, die nicht die ihren sind. “Sie verändert ihre Haltung dann oder begründet sie besser”, sagt ein Grüner beinahe bewundernd.
Die Bildungsministerin Prien bringt Grüne aber auch auf die Palme. Etwa, wenn sie den Schulen einen Erlass zustellt, der Gender-Sternchen de facto verbietet. Sie tat das, ohne den Koalitionspartner zu fragen. Sie verfahre, so hört man in Kiel, immer öfter nach der “Ich bin die Ministerin”-Methode: “sich hinterher entschuldigen, statt es vorher in der Koalition absprechen”. Das sei so, seit sie für hohe CDU-Posten, wie etwa Armin Laschets Zukunftsteam, qualifiziert wurde.
Bei der Digitalisierung ihrer Schulen kann Karin Prien Ordentliches vorweisen. Das hängt allerdings kaum an ihr selbst. Nach dem Schullockdown vom 16. März 2020 vom blockierten Digitalpakt auf eine Instant-Digitalisierung umzustellen – das ließ sich auch in Schleswig-Holstein nicht vermeiden. Das Land hat sich das skandinavische “itslearning” als Landeslösung eines Lernmanagementsystems angeschafft. IServ gabs schon eine Weile vorher. Freilich merkt, wer Prien gut zuhört, dass nicht sehr konsistent ist, was sie zu digitaler Bildung sagt. Einer ihrer Mitregierenden meint: Sie habe ein strategisches Verhältnis zu Digitalisierung. Das komme nicht von Herzen, im Detail sei sie nicht gut informiert.
Das könnte die KMK-Präsidentin Karin Prien ziemlich gut beschreiben: große Worte, die nicht immer durch Fakten gedeckt sind. In ihren ersten Interviews als Präsidentin etwa hob sie hervor, wie groß die Lernlücken seien, die Schüler während der Pandemie erlitten hätten. “Wir müssen uns klarmachen: Für Kinder und Jugendliche bedeuten Schulschließungen eine massive Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, ihrer Lernchancen, der Chancengerechtigkeit”, sagte Prien in einem Gespräch auf Phoenix.
Allerdings zeigen die Lernstandsanalysen in Schleswig-Holstein ein Bild, das dieses scharfe Urteil schwerlich rechtfertigt. Bei den Vergleichsarbeiten der achten Klassen fanden sich jedenfalls an der Küste keinerlei coronabedingte Leistungseinbrüche. “In Deutsch sind weder in der Domäne Lesen noch in Orthografie Veränderungen feststellbar“, fanden die Analysten der Vergleichsarbeiten heraus. “Im Fach Mathematik sind ebenfalls keine Veränderungen feststellbar.” In den Gymnasien stieg der Anteil der Schüler, die auf gehobenem Niveau Englisch sprechen können, in der Pandemie gar um 10 Prozent. Und so wirkte die Präsidentin wie eine nervöse Mutter, die das hohe Fieber ihres Kindes beklagt – aber das Fieber-Thermometer, das 37 Grad anzeigt, einfach nicht anschauen will.
Karin Prien freilich blieb der bislang lichteste Moment in der Pandemie überlassen. Sie schlug kurz nach dem Lockdown im März 2020 vor, die bevorstehenden finalen Abiturprüfungen ausfallen zu lassen. Es wurde ein Wimpernschlag der pädagogischen Revolution: Viele Lehrer:innen und vor allem Schulreformer jubelten. Denn der Wegfall der Abschlussklausuren hätte vieles im Lernen während der Pandemie einfacher gemacht – und einen enormen Schub für das Schulsystem ausgelöst. Allerdings kassierten Priens Kultusminister-Kolleginnen diese Idee sofort und emotionslos. Und Prien? Entfernte den Vorschlag ebenso kühl wieder aus dem Korb ihrer Ideen.

Leistungsfähige VR-Brillen sind inzwischen bezahlbar. Für 200 Euro können Nutzende in virtuelle Welten abtauchen – kabellos und ohne zusätzlichen Computer. Digitale Bildungsrevoluzzer wie Simon Maria Hassemer wollen mehr Virtualität im Unterricht, doch bezahlbare Hardware ist nicht alles. “Was könnten wir so alles machen, wenn es die entsprechenden Anwendungen schon gäbe?”, klagt der Berufsschullehrer. Simon Maria Hassemer (Bildung.Table berichtete) unterrichtet an der Josef-Durler-Schule in Rastatt. Hassemer stellt sich zum Beispiel vor, wie Schüler:innen aus verschiedenen Ländern gemeinsam einen Offshore-Windpark besuchen. Danach optimieren sie gemeinsam den Generator der Anlage – theoretisch und vereinfacht. Das kann eine VR-Anwendung möglich machen.
Das Stichwort ist: VR könnte Lernen so viel attraktiver machen. “Aber es kostet halt Geld und momentan gibt es noch keinen Markt dafür”, seufzt Hassemer. Er nutzt bereits VR und Game-based Learning im Unterricht. Fragt man ihn nach seinen virtuellen Visionen, sprudelt es geradezu aus ihm heraus. Schülerinnen und Schüler könnten mit virtueller Realität individuell in virtuelle Lernwelten abtauchen und Simulationen in jeglicher Form erleben. Sie hätten die Möglichkeit, Lerninhalte begehbar und interaktiv zu erleben. Es wäre zum Beispiel kein Problem, chirurgische Eingriffe nachzustellen und gefahrlos Experimente mit hochexplosiven Chemikalien durchzuführen. Exkursionen mit Lerngruppen an entlegene Orte wären genauso möglich wie das gemeinsame virtuelle Arbeiten in Breakout-Räumen – mit Lernpartner:innen an beliebigen Orten.
Lernende und Lehrende können auch selber Inhalte erstellen, beispielsweise mit 3D-Kameras oder im digitalen 3D-Studio. Andere können das Erstellte dann erleben und verändern. Schüler:innen aus Paraguay nehmen eine Tour durch das subtropische Bergland auf und stellen ihrer spanisch-lernenden Partnerklasse in Europa ein 3D-Video zur Verfügung. Die nehmen dann im Gegenzug ein Video aus den Alpen auf. So könnte transkulturelles Lernen mit VR im Unterricht funktionieren. Das Beispiel Video-Tour zeigt: Die virtuelle Realität und der physische Raum sind nicht klar voneinander abgegrenzt, sie ergänzen sich. So funktioniert vor allem Augmented Reality (AR), zu Deutsch: die erweiterte Realität. Schüler:innen laufen mit dem Smartphone durch die Natur und bestimmen Blumen per Smartphone-App – oder sie erweitern die Realität selbst und verpassen den Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt virtuelle Info-Tafeln. Digitales Schnitzeljagen ist jetzt schon eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Dafür braucht es nur ein Smartphone, Internet und gute Anleitung durch die Lehrenden.
VR-Hardware und -Software kosten Geld, doch das ist nicht das größte Hindernis. Der Hardware-Einkauf ist schon jetzt einfach. Am praktischsten sind sogenannte Standalone-Headsets. Diese Geräte sind Bildschirm und Rechner in einem; sie sind mobil und brauchen keinen Computer, der die Simulation für sie berechnet. Je nach Hersteller und Modell kosten diese Brillen ab 200 Euro aufwärts. Da nicht alle Brillen mit jeder Software kompatibel sind, müssen sich Beschaffende vorher gut informieren – und werden dabei wahrscheinlich enttäuscht. “Die Potenziale von VR für die Bildung sehen viele schnell, aber dann scheitern die meisten auf ihrer frustrierenden Suche nach passenden und qualitativen Anwendungen für die Schule”, sagt Hassemer.
Das Klassenzimmer mit VR ersetzen möchte er nicht. “Ein realer Ort der Begegnung und des voneinander Lernens ist pädagogisch unersetzlich“, sagt der Lehrer. Für ihn sind virtueller und realer Raum auch keine Gegensätze: “Reale und virtuelle Lernsettings können problemlos und sich gegenseitig bereichernd koexistieren.” Er möchte mit Virtual Reality möglichst gute Lernräume schaffen. Die Schüler:innen können Italienisch im virtuellen Rom lernen, in Physik den atomaren Raum erkunden und in Chemie ein Labor besuchen, in dem alle Experimente möglich sind. Da, wo es nur ein kooperatives Textpad oder eine Videokonferenz braucht, sollte auch kein VR eingesetzt werden. “Für eine reine Gadgetifizierung ist VR zu schade”, stellt Hassemer fest.
Das Festhalten am realen Raum bedeutet für Hassemer allerdings nicht das Festhalten am Klassenzimmer. Das werde verschwinden, aber nicht nur wegen Virtual Reality und digitaler Zusammenarbeit. “Gesellschaftliche Megatrends wie Individualisierung, Konnektivität, Wissenskultur und anderes sorgen dafür, dass das Klassenzimmer als Lernraum ausgemustert wird.” Für ihn bedeutet Schule mehr: Jugendtreff, Sportanlage, Ganztagsbetreuung. “Es wird noch lange und aus gutem Grund physisch reale Lernorte geben, an denen sich Menschen begegnen, um voneinander zu lernen.” Ob diese noch Schule heißen werden, sei dahingestellt. Von “´Klassenzimmern´ wird dann aber niemand mehr sprechen”, schließt Hassemer seine Reise in die Klasse der Zukunft.

Vergangene Woche ist die 13-jährige Yasmin aus Hagen bundesweit bekannt geworden. Als Risikopatientin wollte sie nicht länger im Klassenzimmer unterrichtet werden. Sie baute Pult und Laptop auf dem Schulhof auf. Du hast Dich mit ihr auf sozialen Netzwerken solidarisiert. Warum?
Im Dezember habe ich mit anderen eine erfolgreiche Petition gestartet: #Kinderdurchseuchenstoppen. Mitstreitende der Petition haben mich auf Yasmin aufmerksam gemacht. Ich verstehe, dass sie mit Asthma nicht in einen überfüllten, unsicheren Klassenraum gehen möchte, wo sie Corona ausgesetzt ist. Sie will trotzdem Bildung genießen und ihrer Schulpflicht nachkommen. Dass sie das auf dem Schulhof macht, ist ein symbolischer Akt. Sie hat den öffentlichen Diskurs über die Präsenzpflicht noch einmal mehr angestoßen. Dafür bin ich dankbar. Auch Streiks und ähnliche Aktionen sind für viele jetzt denkbar.
Deine gesamte Stufe ist vergangene Woche in den Lockdown gegangen. Ist das ein Streik oder waren es zu viele Corona-Infektionen in der Schule?
Nach den Ferien hatten wir in der elften und zwölften Klasse viele Infektionen. Wir konnten nicht mehr nachvollziehen, wer mit wem Kontakt hatte oder in der Pause interagierte. Deswegen haben wir dann in Absprache mit der Schulleitung Distanzunterricht gemacht. Ein Streik ist das nicht.
Du schreibst an einem Forderungskatalog, der sich an Schulleitungen, Ministerien und Behörden richtet. Was wird darin stehen?
Wir wollen, dass Schulen und Kitas die empfohlenen Schutzmaßnahmen des RKI umsetzen. Dazu gehören die S3-Richtlinien, FFP2-Masken und Luftfilter. Menschen wie Yasmin, die eine Vorerkrankung haben, müssen selbst entscheiden können, ob sie in Präsenz oder digital lernen wollen. Auch Regierung und Ministerien müssen sich bemühen. Sie sollten allen Schüler:innen die Möglichkeit zum digitalen Distanzunterricht bieten. Statt Präsenzpflicht brauchen wir eine Bildungspflicht.
Wie willst Du das erreichen?
Wir wollen, dass man uns anhört und mit statt über uns spricht. Ich vernetze mich gerade mit anderen Schülersprecher:innen aus ganz Deutschland. So bekommen unsere Forderungen mehr Gewicht. Den Behörden würde klar, dass wir streiken – wenn die Schulpolitik unsere Forderungen weiterhin nicht umsetzt.
Nun werden die Schulen aus gutem Grund so lange wie möglich offengehalten. Mit Schulschließungen nimmt man soziale und psychologische Folgeschäden in Kauf.
Es stimmt natürlich, dass Distanzunterricht einigen leichter und anderen schwerer fällt. Die Chancenungerechtigkeit existiert aber schon sehr lange an deutschen Schulen. Jetzt heißt es, dass einige Kinder von zu Hause nicht lernen können. Hätte man das nicht früher, vor der Pandemie, erkennen können? Warum gibt es dann zum Beispiel noch Hausaufgaben und Hausarbeiten? Strukturell muss sich etwas ändern. Die psychische Gesundheit hat nicht exklusiv durch die Schulschließungen gelitten. Alle Schüler:innen sind von der Pandemie belastet – und dem Versagen der Politik. Warum fragt niemand, wie man Distanzunterricht besser machen kann, damit es nicht zu so angeblich hohen psychischen Belastungen kommt?
Du wirst jetzt wieder digital unterrichtet. Funktioniert das an Deiner Schule gut?
Schon im Jahr 1800 haben Schüler:innen die Schulbank im Klassenraum gedrückt. Dieses Modell ist mittlerweile veraltet. Es gibt so viele tolle Angebote, wie man auch digital lernen kann. Meine Schule gehört als digitale Modellschule zu einem Berliner Schulversuch.
Was bedeutet das?
Das Otto-Nagel-Gymnasium hat schon vor über zehn Jahren mit dem Wechsel zu digitalen Medien angefangen. So steht jetzt beispielsweise in jedem Raum ein modernes Smartboard. In mehreren Fächern testen wir, wie man Videospiele gut in den Unterricht einbinden kann. In der Coronazeit haben wir einen Avatar an die Schule bekommen. Das ist ein Roboter, der ein Long-Covid-Kind zu Hause in den Unterricht mit einbezieht. Ganz praktisch bedeutet Modellschule, dass wir bei einem Heizungsausfall sämtlichen Unterricht von zu Hause ersetzen konnten. Wir mussten also nicht in der Schule frieren. Aber wir saßen auch nicht ohne Unterricht zu Hause.
Was ist der Vorteil digitalen Lernens für Dich?
Digitale Medien bieten ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Man ist nicht mehr so von Ort und Zeit abhängig. Auch beim Projektmanagement fällt uns der Überblick deutlich einfacher.
Hast Du ein Beispiel dafür?
Vor einem Jahr sollten wir für meinen Englisch-Leistungskurs als Klausurersatzleistung ein Werbevideo produzieren. Wir haben schnell eine To-do-Liste geschrieben, im Gruppen-Chat angepinnt und einen Termin für ein Online-Treffen geplant. Bei Abweichungen konnten wir uns schnell gegenseitig informieren. Ohne moderne Tools wäre dieser Prozess deutlich lästiger gewesen. Bei uns kriegt jeder Schüler ab der siebten Klasse ein eigenes Laptop. Wir nutzen Microsoft Teams, um das ganze Homeschooling zu regeln, und Moodle als Plattform für Dateimanagement.
Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Moodle und Microsoft?
Meist teilt die Lehrkraft die Aufgaben über unser Lernmanagementsystem Moodle. Über MS Teams findet dann vor allem Kommunikation und Projektplanung statt. Im Unterricht läuft es so ab, dass die Lehrkraft am Anfang sagt, “geht mal auf Moodle. Ich habe gerade die Dokumente für diese Stunde freigegeben.” Danach treffen wir uns auf Teams in Breakout-Räumen. Dort finden Gruppen- und Partnerarbeit sowie Präsentationen statt. Oder wir reichen die Arbeitsergebnisse wieder auf Moodle ein.
Hat Euch in der Schule jemand erklärt, was das datenschutzrechtliche Problem der Nutzung von Microsoft ist?
Es gibt leider kein Fach, in dem Lehrer erklären, wie man sich in der heutigen Zeit als Kind oder Jugendlicher im Netz zu bewegen hat. Vieles bringen wir uns selbst über YouTube-Videos oder durchs Ausprobieren bei. Auf einer früheren Schule war ich quasi der einzige, der wegen Datenschutz-Bedenken kein WhatsApp hatte. So habe ich wichtige Infos für die Schule gar nicht mitbekommen.
Und die neue Schule?
Meine jetzige Schule hat uns darüber aufgeklärt, dass Microsoft Teams nur ein Kompromiss ist. Wir haben in Europa leider noch keine richtige Konkurrenz für die Big-Tech-Angebote aus den USA. Das ist natürlich äußerst bedauerlich.
Bedauerlich ist auch, dass nicht alle Schulen so weit sind wie die Otto-Nagel-Schule.
Ja, als ich als Tutor während der Pandemie Ferienschulen betreut habe, war ich schockiert. An manchen Schulen sieht es mit der Digitalisierung schlecht aus. Ich bin wohl ein bisschen verwöhnt von meiner Schule. Wir könnten von jetzt auf gleich gut in Distanzunterricht wechseln. Aber das ist von oben einfach nicht erwünscht.
Anjo Genow, 17, geht in die zwölfte Klasse des Otto-Nagel-Gymnasiums in Berlin Marzahn-Hellersdorf. Er ist Schulsprecher, im Vorstand des Bezirksschülerausschusses und Mitglied der Partei Volt.
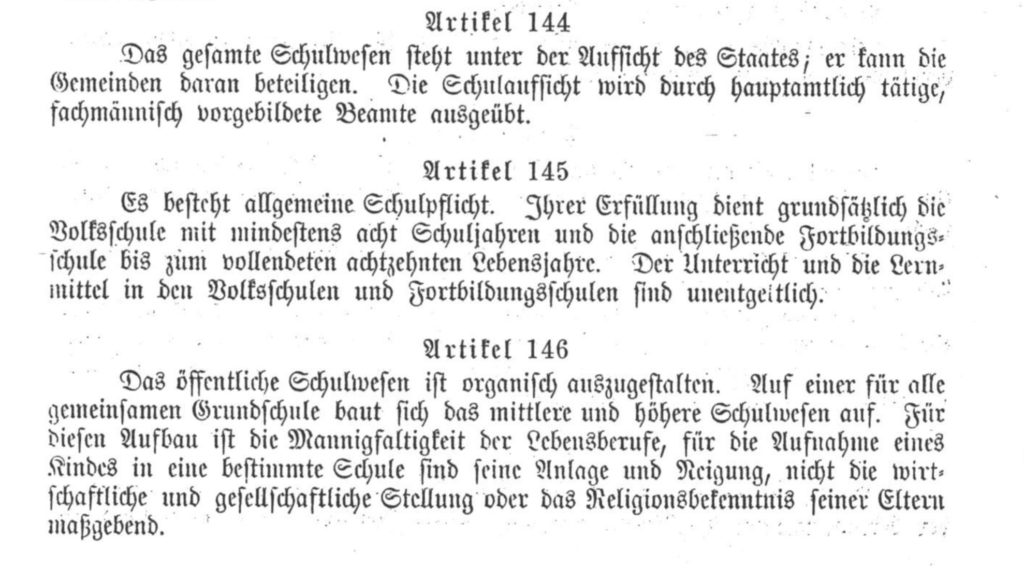
Gastbeitrag von Isabel Ruland
Die Schulpflicht im Sinne eines Gebots zur Anwesenheit in staatlichen Schulgebäuden besteht in Deutschland seit 1919. Damals war die Schulpflicht eine Errungenschaft für die demokratischen und – erstmals – halbwegs milieuunabhängigen Möglichkeiten für die Bildung aller Kinder.
Ihr voraus ging seit dem 18. Jahrhunderts eine Unterrichtspflicht. Die forderte Eltern auf, ihren Kindern Bildung zuteil werden zu lassen. Das geschah auch, um sie vor Ausbeutung als Arbeitskräfte unter Missachtung ihrer Bedürfnisse zu schützen. Es war nicht festgelegt, wie und wo die Bildung stattzufinden hatte. Oft wurde sie in einer Form des Hausunterrichtes umgesetzt, reiche Familien schickten ihre Kinder auf Privatschulen oder engagierten Hauslehrer. Für Eltern, die weder Neigung noch Ressourcen besaßen, ihre Kinder zu bilden, sprang zur Verwirklichung der Unterrichtspflicht der Staat ein.
Die Durchsetzung der Schulpflicht wurde aufgrund ihrer Historie als schwerer Eingriff in elterliche Rechte angesehen. Bis heute – manchen mag es in den Ohren klingeln – wird sie kontrovers diskutiert. Die Begründung der Schulpflicht liegt im Recht der Kinder, die zur Entwicklung und ihrem gesellschaftlichen Bestehen notwendige Bildung zu erlangen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Schulpflicht – man halte die Luft an – erst im Jahr 2006 ausgeführt. Sie dient der Durchsetzung des staatlichen Erziehungsauftrages. Der alltägliche Kontakt mit der demokratischen und pluralistischen Gesellschaft nebst ihren Diskursen wirkt toleranzfördernd.
Die hinter diesen Begründungen liegenden Bildungs- und Sozialisationsmöglichkeiten waren natürlich ausschließlich analoger Natur. Digitalisierung gab es noch nicht. Eine Familie, die die Schulpflicht nicht erfüllte, ihre Kinder isolierte (aus welchen Gründen auch immer), verletzte in der Tat im Beharren auf dem Recht der Eltern das Recht des Kindes – und auch das Recht des Staates.
Jahrzehnte nach diesen bis heute gültigen Grundlagen sieht unsere Bildungslandschaft ganz anders aus. Die Digitalisierung hat Einzug gefunden, seit Beginn der Pandemie auch (im Verhältnis zu vorpandemischen Schulausstattungen) in rasantem Tempo. Unterricht kann an fast jedem Punkt dieses Landes gewährt werden – ohne die Anwesenheit in einem bestimmten Raum dafür zu benötigen. Die Konsequenz ist, dass wir elterliche Erziehungs- und Bildungspflicht, Bildungsrecht, Schulpflicht, Präsenz- und Distanzlernen und staatliches Erziehungsrecht unter sich verändernden Gegebenheiten neu betrachten müssen. Wir werden dann zu modernen und angepassten Schlüssen kommen – wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft auch.
Konnte Bildung in vordigitaler Zeit nur in Präsenz vermittelt werden, so könnte das heute ohne unüberwindliche Probleme auch in Distanz erfolgen.
Dieser Entwicklung hat das Verfassungsgericht in seinem jüngsten Urteil im November 2021 zur Verfassungsmäßigkeit der Bundesnotbremse entsprochen, die den Präsenzunterricht verbot. Karlsruhe erkennt erstmalig das Recht auf schulische Bildung von Kindern gegenüber dem Staat an. Es lässt aber offen, in welcher Form dieses Recht wahrgenommen werden kann. Dabei wird explizit auf die Verpflichtung des Staates hingewiesen, das Bildungsrecht der Schüler in der Zeit des Präsenzunterrichtsverbotes auch durch Distanzunterricht zu gewährleisten. Damit nimmt das Gericht einen wichtigen, den technischen Entwicklungen und modernen pädagogischen Erkenntnissen angemessenen, zukunftsweisenden Standpunkt ein. Viele andere Länder dieser Welt vertreten mit der Abschaffung der Schulpflicht (im Sinne einer Präsenzpflicht) diese Idee schon länger.
Die Digitalisierung bedeutet für die Home- oder Fernbeschulung eine unermessliche Erleichterung. Sie verschafft der Welt – und auch Deutschland – neue Möglichkeiten, flexibel auf unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse moderner Familien reagieren zu können.
Die staatliche Schulbildungspflicht ist zunehmend unabhängig von der Präsenz-/Distanzfrage. Didaktik, Methodik und Kommunikation sind dafür durchaus entwickelbar.
Der staatliche Erziehungswille hinsichtlich Sozialisation in einer pluralistischen, toleranten, demokratischen Gesellschaft und der wichtige Kontakt der Kinder untereinander ist ebenfalls nicht zwangsläufig abhängig von der Frage nach Schulpräsenz. Den Kontakt zu andersdenkenden, altersdifferenten oder auch gleichgesinnten Menschen finden Kinder ebenso oder sogar besser bedürfnisorientiert und gewinnbringend jenseits der Schule. Bestehende Onlineschulen in Deutschland bieten beispielsweise auch Klassen-/Gruppenmöglichkeiten und hybride Lernformen an. Dem berechtigten Bedürfnis der Kinder kann somit auch anders als durch Schulpflicht entsprochen werden.
Den sozioökonomisch unabhängigen Zugang zu digitalen oder Nicht-Regelschulangeboten könnten staatliche kostenlose Onlineschulen oder vergleichbare flexible Möglichkeiten gewähren. Auch könnte man die bestehenden Onlineschulen in Deutschland als Ersatzschulen analog zu anderen Ländern rund um den Globus anerkennen. Bislang können hierzulande nur unter streng limitierten Bedingungen langfristig und/oder schwer erkrankte oder in Regelschulen nicht beschulbare Kinder solche Möglichkeiten nutzen, die teils auch hohe Schuljahreskosten erheben.
Wissenschaftlich wird die Schulpflicht schon lange kritisch als mögliches Hemmnis einer selbstbestimmten und kreativen Bildung und als Ausdruck des Misstrauens gegenüber der Lernwilligkeit von Kindern und der Erziehungsfähigkeit von Eltern diskutiert.
Die Schulpflicht in Deutschland ist also eine historisch berechtigte und in vielen Facetten gut begründete “Pflicht”, die über Bildungspflicht und Erziehungsrecht des Staates hinaus gesellschaftliche Funktionen etwa für die Erwerbstätigkeit von Eltern erfüllt. Ihr Bestand ist mit der Digitalisierung, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über Lernen und Sozialisation und zukünftige Erfordernisse der Gesellschaft sowie mit einem Fokus auf das originäre Recht der Kinder auf bedürfnisorientierte Bildung ohne Zuschreibung erwachsener oder wirtschaftlicher Erwartungen diskussionswürdig.
Isabel Ruland ist Pädagogin und Kriminologin, deren beide Kinder Schulen in NRW besuchen. Ihren Text veröffentlichte sie zunächst als Folge von Tweets im sozialen Netzwerk Twitter.
Die derzeit interessanteste Lehrerfortbildung “Mobile Schule” stand wohl einen Moment vor dem Aus. Jetzt bekommt sie überraschend eine zweite Chance – die der Mobilen Schule hilft und zugleich die größte europäische Bildungs-Messe Didacta aufwertet. Nach Informationen von Bildung.Table haben Andreas Hofmann, der Gründer und Erfinder der Mobilen Schule, und der Geschäftsführer des Didacta-Verbandes, Reinhard Koslitz, eine Kooperation vereinbart. Danach wird die Mobile Schule die Messe der Bildungswirtschaft verstärken, die nun von 7. bis 11. Juni in Köln stattfindet. Das bedeutet, dass Hofmanns Fortbildungsprogramm von Lehrern für Lehrer, das bundesweit Tausende Lehrende erreicht, künftig Bestandteil der Didacta werden könnte. Hauptgeschäftsführer Reinhard Koslitz sagte Bildung.Table, er wisse, dass die Didacta oldschool sei, daher müsse man das Neue integrieren.
Allerdings begann die neue Zusammenarbeit mit einem Foul. Die Didacta verschob kurzerhand ihre Messe 2022 von März auf Juni – und damit genau auf den Termin, an dem die Mobile Schule nach zwei Jahren erstmalig wieder in Präsenz stattfinden sollte. Für Hofmann eine gefährliche Kollision. Denn kurz zuvor hatte bereits die Learntec ihren Messe-Termin verschoben und ebenfalls die Mobile Schule verdrängt. Das seien existenzielle Fragen, sagte Hofmann, der sich erst vor zwei Jahren selbstständig gemacht hatte. Da hingen Mietkosten für große Hallen dran. Es hätten Referenten und Aussteller umgebucht werden müssen. Dass es bei den jüngsten Kollisionen von Messen und Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer:innen nicht nur um Corona und Terminfragen geht, zeigt die Äußerung eines Messemachers. “Wenn wir jemanden platt machen wollen, dann können wir das natürlich.”
Für die Mobile Schule ist die jetzige Entwicklung möglicherweise sogar ein Vorteil. Bisher gab es einen Termin im Juni. Nun bekommt die Lehrerfortbildung mit großer Gemeinde zwei Präsenz-Termine im Jahr 2022: zum einen als “autonomer Part” auf der Didacta im Juni, zum anderen mit einem eigenen Termin in der Messe Hannover am 26. und 27. September. Die Mobile Schule wird dem Vernehmen nach während der Didacta nicht nur an einem, sondern an mehreren Tagen stattfinden. Ob die Sessions mitten im Trubel der Didacta oder im Seminarbereich abgehalten werden, sei noch nicht entschieden. cif
Die Deutsche Telekom und Rednet haben mit Rheinland-Pfalz einen millionenschweren Vertrag abgeschlossen, über den Schüler mit Notebooks und Tablets ausgestattet werden. Die Unternehmen organisieren im Auftrag des Staates die Verteilung und Einrichtung von Endgeräten an allen rheinland-pfälzischen Schulen. Insgesamt befindet sich das Volumen der Rahmenverträge bei 200 Millionen Euro, teilte das Bildungsministerium mit.
Rheinland-Pfalz hatte ein europaweites Ausschreibungsverfahren für die Schulen und Schulträger organisiert, weil die in der Pandemie so viel geleistet hätten. Das sagte die zuständige Ministerin Stefanie Hubig. “Das Land hat deshalb für sie die Zeit und die Mittel für europaweite Ausschreibungen in die Hand genommen, so dass die Schulträger keine eigenen Vergabe-verfahren mehr durchführen müssen,” so die Schulministerin.
Laut Telekom “profitieren rund 1.660 Schulen und damit mehr als 400.000 Lernende im Präsenz- wie auch im Distanzunterricht” von dieser Übereinkunft. Über Rednet können die Schulträger 150.000 Notebooks beziehen. Die Unternehmen begrüßten die Initiative des Bundeslandes, die Digitalisierung der Schulen mit ihrer Beteiligung voranzutreiben. Die Telekom verspricht, ein “ganzheitliches Konzept und breites Portfolio” zu liefern. Die Tablets und Notebooks sollen für die Schüler sicher und für Distanzunterricht gut geeignet sein. Zum Deal mit Rheinland-Pfalz gehört auch die Verwaltung der Geräte und Zubehör-Lieferungen. Die Vertriebspartner des Apple-Konzerns bieten Komplettlösungen für Schüler aus Hard- und Software für die Tablets an. Zusätzlich können Lehrkräfte fortgebildet werden. An dieser Gesamtlösung gibt es Kritik, weil sich Schulen von Herstellern abhängig machen.
Im Rahmen des DigitalPakts Schule steht Rheinland-Pfalz von 2019 bis einschließlich 2024 ein Betrag von insgesamt rund 241 Millionen Euro zu. Zusätzlich hat das Land mit dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes DigitalPakt II noch weitere Mittel zur Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schüler:innen erhalten. Auf Rheinland-Pfalz entfielen aus diesem Programm rund 24 Millionen Euro, das reichte bisher für rund 57.000 mobile Endgeräte. Jan Lubschik
In seiner ersten großen Debatte in Anwesenheit der neuen Bundesbildungsministerin hat der Bundestag wenig Neues über die digitale Bildung erfahren. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) stellte lediglich die im Koalitionsvertrag beschlossenen Pläne des Digitalpakts 2.0 erneut vor. “Die digitale Revolution passiert. Geben wir unseren Kindern und Jugendlichen den Pass in die Zukunft, den sie brauchen!”, sagte sie. Mit dem neuen Digitalpakt wolle man die nächste Stufe der Digitalisierung schaffen. Wie dieser Schritt aussieht, verriet sie nicht.
Die CDU bot erneut an, bei einer Grundgesetzänderung für digitale Bildung als Partner zur Verfügung zu stehen. “Sie werden zeigen müssen, wie sie das Grundgesetz wirklich ändern wollen”, sagte der neue bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Jarzombek. “Weil eins ist doch klar: wir werden hier mehr machen wollen und müssen, aber wir werden nicht unkonditioniert Geld an Länder geben können. Das wird eine schwierige Aufgabe. Wir werden ihre Partner dabei sein”.
Die Ampel-Regierung wolle für mehr Chancengerechtigkeit sorgen, sagte die Bildungsministerin. Sie werde mit einem Startchancen-Programm bundesweit 4.000 Schulen “in sozial schwierigen Lagen” fördern. Zudem soll sich das Bafög grundlegend verändern. Stark-Watzinger betonte, dass Schulen in der Pandemie so lange wie möglich offen bleiben sollten. So wolle sie das Recht auf Bildung gewährleisten. Schulen sollten zur kritischen Infrastruktur zählen. Stark-Watzinger bekräftigte ihre Forderung nach mehr Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen und formulierte an die Länder gerichtet: “Wir stehen bereit.”
Die neue bildungspolitische Sprecherin von Bündnis90/Grüne, Nina Stahr, stellte im Bundestag mit Blick auf digitale Bildung klar: “Wir bauen Bürokratie ab und sorgen dafür, dass das Geld schnell und direkt an den Schulen ankommt.” Der Digitalpakt solle neben der Anschaffung von Technik und Geräten stärker die Medienkompetenz fördern. Gemeinsam mit den Ländern werde man “Beratungen rund um den digitalen Unterricht vom Kopf auf die Füße stellen”. Katrin Zschau (SPD) sagte: “Wir richten den Fokus auf Digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung.” Der Digitalpakt 2.0 solle eine Laufzeit bis 2030 haben und nachhaltige Neuanschaffung von Hardware, den Austausch veralteter Technik sowie Gerätewartung und Administration umfassen.
Die Union, neu in der Rolle der Opposition und bis zuletzt Hausherrin im Bundesbildungsministerium, klopfte sich selbst auf die Schulter. Der Etat des BMBF habe sich seit 2005 fast verdreifacht. “Sie bekommen ein ausgesprochen gut bestelltes Haus”, sagte Thomas Jarzombek in Richtung der neuen Koalition. Mit Blick auf die Digitalisierung der Bildung wünsche er sich mehr Offenheit und Wettbewerb. Er denke dabei an Plattformen, die auch für Start-ups offen sind, “wo pro Klick bezahlt wird und nicht Schulbuchverlage über viele Jahre sichere Verträge bekommen, die keine Innovation anreizen.” Mehr Tempo bei der Digitalisierung im Bildungsbereich könne es nur mit einer Grundgesetzänderung geben. Seine Partei stehe dabei als Partner und kritischer Begleiter an der Seite der Ampel-Regierung. npr

“Wir waren sehr verzweifelt“, sagt Undine Balk, wenn sie an die Anfänge der Pandemie vor zwei Jahren zurückdenkt. Nach dem ersten Schul-Lockdown im März 2020 zeichnete sich schnell ab, dass die Kinder bald wieder zurück in die Klassenzimmer müssen. Für die Familie Balk wäre eine Ansteckung jedoch lebensgefährlich: Drei der sechs Familienmitglieder leiden unter Blutarmut, ihr Immunsystem ist geschwächt. Undine Balk und ihr Mann Olaf wollten ihre Kinder, drei von ihnen sind noch schulpflichtig, von der Präsenzpflicht befreien. Digitale Bildung würde sie als Risikogruppe besser schützen. Da die Schule sich wehrte, mussten die Balks klagen.
“Wir haben uns ziemlich alleine gefühlt”, sagt Undine Balk. Gleichzeitig waren sie davon überzeugt, sie seien nicht die einzigen Eltern in Deutschland, für die Schulunterricht in Präsenz für die ganze Familie gefährlich werden könnte. Sie suchten auf Social Media Verbündete und wurden auf Twitter fündig. Die Initiative “Sichere Bildung Jetzt!” hatte sich zu Beginn der Pandemie gegründet. Sie fordert genau das, wofür die Balks streiten: Ein Aussetzen der Präsenzpflicht und einen konsequenten Schutz für alle Familien, für die Covid-19 ein besonders hohes Risiko darstellt.
Seitdem organisieren Undine und Olaf Balk zusammen mit den anderen Engagierten von der bundesweiten Initiative “Sichere Bildung Jetzt!” Mahnwachen und Demonstrationen auf Brücken, Plätzen und vor Rathäusern in Hamburg, Berlin oder Potsdam. Sie schickten Videobotschaften an die ehemalige Regierungschefin Angela Merkel und laden immer wieder Politiker in Zoom-Räume ein, um mit ihnen über die Neugestaltung von Schulen zu diskutieren.
Undine und Olaf Balk träumen von einer Schule, die auch in einer weltweiten Pandemie sicher ist. Eine Schule für alle. Wie diese neue Schulform aussehen könnte, probieren sie gerade selbst bei sich zu Hause aus. Ihre drei Jüngsten, die gerade in die 5., 6. und 9. Klasse gehen, haben seit zwei Jahren keine Schule mehr von innen gesehen – Bildung bekommen sie nun digital und häuslich.
Ihre 10-jährige Tochter und ihr 12-jähriger Sohn nehmen von zu Hause am Regelunterricht teil und werden dabei von Lehramtsstudentinnen via Zoom unterstützt. Zwar empfinden Olaf und Undine die Unterrichtsgestaltung zuweilen als “zu analog”, doch sie beobachten eine gesteigerte Selbstständigkeit bei ihren Jüngsten. Die haben in der Pandemie ihren eigenen Lernrhythmus gefunden, beginnen mit der Schule nun um etwa neun Uhr – in Potsdam, wo sie schulpflichtig sind, geht es eigentlich um halb acht los. Das sei aber zu früh, finden die Balks, um diese Zeit könnten sich die Kinder noch nicht konzentrieren.
Und dann haben sie noch einen 16-jährigen Jungen, dem die Schule schon immer zu schaffen machte. Er wurde von seinen Mitschülern gemobbt, entwickelte eine Angst- und Zwangsstörung. Der normale Klassenverbund, also das Lernen mit 30 anderen Kindern in einem Raum, ist für ihn auch ohne die Angst vor einer Virusinfektion nicht auszuhalten. Für ihren Sohn erkämpften seine Eltern eine andere Lösung. Die Balks suchten ihm eine Schule, die nur online stattfindet, in Deutschland bisher undenkbar. Denn digitale Bildung schützt zwar Risikogruppen, genügt aber eigentlich nicht der Schulpflicht.
Im März 2021 stellten sie also Anträge beim Schulamt auf Aussetzung der Schulpflicht, kümmerten sich um psychologische Atteste, legten Widerspruch ein, als das Schulamt ihren Antrag ablehnte. Schließlich klagten sie sogar vor Gericht. Auf eine Entscheidung mussten die Balks zwar monatelang warten, doch wenigstens das Jugendamt stand ihnen zur Seite: Es übernimmt nun die Kosten der Privatschule.
Nun loggt sich ihr Sohn täglich über die Microsoft-Anwendungen in ein virtuelles Klassenzimmer ein. Seine Schulkameraden kommen aus Costa Rica oder Korea. Die Wilhelm von Humboldt Online Privatschule kostet 5.880 Euro im Jahr und ist ein Beispiel rein digitaler Bildung. Die Eltern sagen, hier bekäme er das, was ihm an staatlichen Schulen fehlte: individuelle Betreuung.
Dass Schule auch anders geht, lässt die Balks auf eine Schulform hoffen, die es bisher in Deutschland noch nicht gibt. “Die ideale Schule wäre eine Schule, die den individuellen Bedarf der Schüler erkennt und diesen auch abdeckt“, sagt Olaf Balk. Und eine, die eben nicht privat, sondern staatlich ist. Einen Unterricht, bei dem alle Kinder gleich mitkommen würden, gebe es eben nicht, finden sie. Jedes Kind habe unterschiedliche Interessen und Stärken, sagt Olaf Balk. Digitale Bildung ist eine Chance, findet er und redet nicht nur von Risikogruppen. Über digitale Anwendungen könnten jedem Kind unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, individuelles Lernen sei online viel besser umzusetzen als an der Kreidetafel.
“Es ist unbestritten, dass sich Kinder auch physisch treffen müssen”, sagt Undine Balk. Doch gerade in Pandemiezeiten sei es für Jugendliche wichtig, sich in ihrer Freizeit persönlich treffen zu können und nicht in der Schule, glaubt sie. Und das ginge zurzeit am sichersten draußen, wo Abstand eingehalten werden könne und das Risiko, sich anzustecken, geringer ist. “Wir möchten alle Bildungseinrichtungen in Deutschland in dieser Pandemie sicher wissen”, sagt Undine Balk. “Und das wird uns seit fast zwei Jahren einfach verwehrt.”
wir leben in einer merkwürdigen Zwischenzeit: Die Coronapandemie verlangt eigentlich danach, dass viel schneller digitalisiert wird. Aber die politischen Akteure tun sich schwer damit, das angekündigte milliardenschwere Programm voranzutreiben. Das sieht man an der neuen Präsidentin der Kultusminister, Karin Prien (CDU), die gerade offiziell inthronisiert wurde. Sie beginnt nun, immerhin, über ihre digitalen Pläne zu sprechen.
Auch der Bundestag hat seine Rolle noch nicht gefunden. Die Ampel ist damit beschäftigt, ihre Koalitionsvereinbarung wieder und wieder vorzulesen. Und die Opposition, vor allem die CDU, bietet sich abwartend als Partner an. Nun hat der neue Sprecher für Bildung und Forschung der CDU, Thomas Jarzombek, eine Grundgesetzänderung für den Digitalpakt angetönt, wie Niklas Prenzel im Parlament erfahren hat.
Wie dringend eine pädagogische Transformation mithilfe digitaler Medien ist, kann man gerade an den außerparlamentarischen Akteuren erkennen. Wir haben mit Familie Balk gesprochen, die ihre Kinder nicht in die Präsenzschule schicken kann – und von sicheren, weil digitalen Möglichkeiten berichtet. Schülersprecher Anjo Genow lernt an einer digitalen Modellschule. Er weiß, dass es viele Schüler gibt, die endlich das volle digitale Potenzial ausschöpfen wollen. Diese Potenziale kennt der zornige Digitallehrer Simon Maria Hassemer. Er erzählt davon, wie virtuelle Realitäten neue, ungekannte Räume für das Lernen öffnen.
Lassen Sie sich entführen!


Jetzt also digitale Transformation. Als Karin Prien, Christdemokratin und Schulministerin im Norden, offiziell ihr Amt als neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) antrat, sparte sie nicht mit großen Worten. Sie schwärmte von einer Dynamik im Schulsystem, “die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten.” Prien lobte den gewaltigen Digitalisierungsschub der Schulen. Und sie nahm Worte in den Mund, auf die man lange gewartet hatte: Eine Transformation, “um unser Bildungssystem in die Zukunft zu führen.” Sie sagte das in der James-Simon-Galerie, in dem prachtvoll renovierten Besucherzentrum der Berliner Museumsinsel. Jeder Ort hat seine Rhetorik.
Eine Woche zuvor, bei der ersten Pressekonferenz Karin Priens als KMK-Präsidentin, hatte man vergeblich auf diese wichtigen Schlüsselbegriffe gehofft. Da ging es der neuen Prima inter Pares nur um eines: Die Schulen müssen offen bleiben! Die Schulen dürfen nicht geschlossen werden! Die 56-Jährige wiederholte ihr Mantra so oft, dass man sich ein bisschen an ihre stets sachliche, aber repetitive Vorgängerin erinnert fühlte, Britta Ernst (SPD) aus Brandenburg. Die Formel “digitale Bildung” war in der Online-Pressekonferenz geradezu ein Tabu. Wie kommt es, dass Karin Prien die Digitalisierung der Bildung wenige Tage später plötzlich so wichtig war?
Weil sie das kann, schnelle Positionswechsel. Als die Wirtschaftsanwältin von Hamburg nach Schleswig-Holstein berufen wurde, um dort Bildungsministerin zu werden, war das erstmals deutlich geworden. Aus der Hansestadt brach eine entschiedene Gegnerin der Rückkehr zum G9 auf, dem Gymnasium mit neun Jahren Laufzeit. In Kiel kam indes eine Befürworterin des G9 an. Wie konnte das passieren? Der starke Mann der CDU in Kiel hatte zuvor genau dieses neunjährige Gymnasium zu einem seiner Wahlkampfschlager gemacht. Obwohl die Verkürzung der wichtigsten deutschen Schulform eigentlich kein Thema mehr war, heizte der heutige Ministerpräsident Daniel Günther den Kulturkampf ums Gymnasium zu Machtzwecken wieder an.
Und Karin Prien? Stellte sich wortgewandt auf die neue Lage ein. Sie habe nicht mitbeschlossen, vom gekürzten wieder aufs lange Gymnasium zurückzukehren, sagte sie dem Hamburger Abendblatt. “Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass G8 oder G9 keine Glaubensfrage, sondern eine Abwägungsfrage ist.” In Schleswig-Holstein herrschten ganz andere Verhältnisse als in Hamburg. Prien war also nun für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium an der Waterkant – mit plausiblen Gründen.
Bekannt, geradezu berühmt wurde Prien allerdings nicht durch schulpolitische Finessen. Sie beherrscht einen Klartext, den in der CDU nur wenige können. Verschwörungserzähler wie Hans-Georg Maaßen mag sie nicht in der Union dulden. Prien hat mit dieser klaren Haltung die CDU in Teilen der Gesellschaft erst wieder satisfaktionsfähig gemacht. “Ça suffit“, twitterte Prien etwa, als Maaßen ein Impfverbot gefordert hatte. Diese beiden Worte der viersprachigen Intellektuellen reichten, um einen Twitterorkan auszulösen “Wenn ein ehemaliger Spitzenbeamter und Verfassungsschützer solch einen verschwörungstheoretischen Unsinn verbreitet”, erklärte Prien danach, “dann können wir als CDU das nicht länger tolerieren.” Sie werde beantragen, ihn aus der Partei zu werfen.
Manche rieben sich die Augen, woher eine aus der gelegentlich blassen Riege der Kultusminister diesen Mut nahm. Das könnte biografische Gründe haben. Karin Prien kam in Amsterdam zur Welt, als Enkelin vor den Nazis geflohener Juden. Um es ganz genau zu sagen, befinden sich in ihrer Familie zwei jüdische Großväter, die nach Amsterdam fliehen mussten – der eine vor den Nazis, der andere vor Kommunisten. Die derzeitige Präsidentin der Kultusminister hat eine Biografie, die für mehr geschaffen ist. Hätte die taumelnde und mit sich selbst befasste CDU früher nachgedacht, dann hätte sie mit Karin Prien vielleicht sogar eine Kandidatin gehabt, die Frank-Walter Steinmeier hätte schlagen können: die erste Frau mit jüdischen Wurzeln als Anwärterin auf das Schloss Bellevue. Aber das war dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz wohl zu gefährlich – auch den hat sich Prien bereits einige Male zurechtgelegt.
Die ehrgeizige Wirtschaftsanwältin regiert in Schleswig-Holstein mit FDP und Grünen, die nicht selten Karin zu ihr sagen. “Das hat sich ganz schnell so ergeben, sie ist im Umgang total unkompliziert“, berichtet eine, die dabei ist. Sie höre wirklich zu – auch, wenn man Argumente vorträgt, die nicht die ihren sind. “Sie verändert ihre Haltung dann oder begründet sie besser”, sagt ein Grüner beinahe bewundernd.
Die Bildungsministerin Prien bringt Grüne aber auch auf die Palme. Etwa, wenn sie den Schulen einen Erlass zustellt, der Gender-Sternchen de facto verbietet. Sie tat das, ohne den Koalitionspartner zu fragen. Sie verfahre, so hört man in Kiel, immer öfter nach der “Ich bin die Ministerin”-Methode: “sich hinterher entschuldigen, statt es vorher in der Koalition absprechen”. Das sei so, seit sie für hohe CDU-Posten, wie etwa Armin Laschets Zukunftsteam, qualifiziert wurde.
Bei der Digitalisierung ihrer Schulen kann Karin Prien Ordentliches vorweisen. Das hängt allerdings kaum an ihr selbst. Nach dem Schullockdown vom 16. März 2020 vom blockierten Digitalpakt auf eine Instant-Digitalisierung umzustellen – das ließ sich auch in Schleswig-Holstein nicht vermeiden. Das Land hat sich das skandinavische “itslearning” als Landeslösung eines Lernmanagementsystems angeschafft. IServ gabs schon eine Weile vorher. Freilich merkt, wer Prien gut zuhört, dass nicht sehr konsistent ist, was sie zu digitaler Bildung sagt. Einer ihrer Mitregierenden meint: Sie habe ein strategisches Verhältnis zu Digitalisierung. Das komme nicht von Herzen, im Detail sei sie nicht gut informiert.
Das könnte die KMK-Präsidentin Karin Prien ziemlich gut beschreiben: große Worte, die nicht immer durch Fakten gedeckt sind. In ihren ersten Interviews als Präsidentin etwa hob sie hervor, wie groß die Lernlücken seien, die Schüler während der Pandemie erlitten hätten. “Wir müssen uns klarmachen: Für Kinder und Jugendliche bedeuten Schulschließungen eine massive Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, ihrer Lernchancen, der Chancengerechtigkeit”, sagte Prien in einem Gespräch auf Phoenix.
Allerdings zeigen die Lernstandsanalysen in Schleswig-Holstein ein Bild, das dieses scharfe Urteil schwerlich rechtfertigt. Bei den Vergleichsarbeiten der achten Klassen fanden sich jedenfalls an der Küste keinerlei coronabedingte Leistungseinbrüche. “In Deutsch sind weder in der Domäne Lesen noch in Orthografie Veränderungen feststellbar“, fanden die Analysten der Vergleichsarbeiten heraus. “Im Fach Mathematik sind ebenfalls keine Veränderungen feststellbar.” In den Gymnasien stieg der Anteil der Schüler, die auf gehobenem Niveau Englisch sprechen können, in der Pandemie gar um 10 Prozent. Und so wirkte die Präsidentin wie eine nervöse Mutter, die das hohe Fieber ihres Kindes beklagt – aber das Fieber-Thermometer, das 37 Grad anzeigt, einfach nicht anschauen will.
Karin Prien freilich blieb der bislang lichteste Moment in der Pandemie überlassen. Sie schlug kurz nach dem Lockdown im März 2020 vor, die bevorstehenden finalen Abiturprüfungen ausfallen zu lassen. Es wurde ein Wimpernschlag der pädagogischen Revolution: Viele Lehrer:innen und vor allem Schulreformer jubelten. Denn der Wegfall der Abschlussklausuren hätte vieles im Lernen während der Pandemie einfacher gemacht – und einen enormen Schub für das Schulsystem ausgelöst. Allerdings kassierten Priens Kultusminister-Kolleginnen diese Idee sofort und emotionslos. Und Prien? Entfernte den Vorschlag ebenso kühl wieder aus dem Korb ihrer Ideen.

Leistungsfähige VR-Brillen sind inzwischen bezahlbar. Für 200 Euro können Nutzende in virtuelle Welten abtauchen – kabellos und ohne zusätzlichen Computer. Digitale Bildungsrevoluzzer wie Simon Maria Hassemer wollen mehr Virtualität im Unterricht, doch bezahlbare Hardware ist nicht alles. “Was könnten wir so alles machen, wenn es die entsprechenden Anwendungen schon gäbe?”, klagt der Berufsschullehrer. Simon Maria Hassemer (Bildung.Table berichtete) unterrichtet an der Josef-Durler-Schule in Rastatt. Hassemer stellt sich zum Beispiel vor, wie Schüler:innen aus verschiedenen Ländern gemeinsam einen Offshore-Windpark besuchen. Danach optimieren sie gemeinsam den Generator der Anlage – theoretisch und vereinfacht. Das kann eine VR-Anwendung möglich machen.
Das Stichwort ist: VR könnte Lernen so viel attraktiver machen. “Aber es kostet halt Geld und momentan gibt es noch keinen Markt dafür”, seufzt Hassemer. Er nutzt bereits VR und Game-based Learning im Unterricht. Fragt man ihn nach seinen virtuellen Visionen, sprudelt es geradezu aus ihm heraus. Schülerinnen und Schüler könnten mit virtueller Realität individuell in virtuelle Lernwelten abtauchen und Simulationen in jeglicher Form erleben. Sie hätten die Möglichkeit, Lerninhalte begehbar und interaktiv zu erleben. Es wäre zum Beispiel kein Problem, chirurgische Eingriffe nachzustellen und gefahrlos Experimente mit hochexplosiven Chemikalien durchzuführen. Exkursionen mit Lerngruppen an entlegene Orte wären genauso möglich wie das gemeinsame virtuelle Arbeiten in Breakout-Räumen – mit Lernpartner:innen an beliebigen Orten.
Lernende und Lehrende können auch selber Inhalte erstellen, beispielsweise mit 3D-Kameras oder im digitalen 3D-Studio. Andere können das Erstellte dann erleben und verändern. Schüler:innen aus Paraguay nehmen eine Tour durch das subtropische Bergland auf und stellen ihrer spanisch-lernenden Partnerklasse in Europa ein 3D-Video zur Verfügung. Die nehmen dann im Gegenzug ein Video aus den Alpen auf. So könnte transkulturelles Lernen mit VR im Unterricht funktionieren. Das Beispiel Video-Tour zeigt: Die virtuelle Realität und der physische Raum sind nicht klar voneinander abgegrenzt, sie ergänzen sich. So funktioniert vor allem Augmented Reality (AR), zu Deutsch: die erweiterte Realität. Schüler:innen laufen mit dem Smartphone durch die Natur und bestimmen Blumen per Smartphone-App – oder sie erweitern die Realität selbst und verpassen den Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt virtuelle Info-Tafeln. Digitales Schnitzeljagen ist jetzt schon eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Dafür braucht es nur ein Smartphone, Internet und gute Anleitung durch die Lehrenden.
VR-Hardware und -Software kosten Geld, doch das ist nicht das größte Hindernis. Der Hardware-Einkauf ist schon jetzt einfach. Am praktischsten sind sogenannte Standalone-Headsets. Diese Geräte sind Bildschirm und Rechner in einem; sie sind mobil und brauchen keinen Computer, der die Simulation für sie berechnet. Je nach Hersteller und Modell kosten diese Brillen ab 200 Euro aufwärts. Da nicht alle Brillen mit jeder Software kompatibel sind, müssen sich Beschaffende vorher gut informieren – und werden dabei wahrscheinlich enttäuscht. “Die Potenziale von VR für die Bildung sehen viele schnell, aber dann scheitern die meisten auf ihrer frustrierenden Suche nach passenden und qualitativen Anwendungen für die Schule”, sagt Hassemer.
Das Klassenzimmer mit VR ersetzen möchte er nicht. “Ein realer Ort der Begegnung und des voneinander Lernens ist pädagogisch unersetzlich“, sagt der Lehrer. Für ihn sind virtueller und realer Raum auch keine Gegensätze: “Reale und virtuelle Lernsettings können problemlos und sich gegenseitig bereichernd koexistieren.” Er möchte mit Virtual Reality möglichst gute Lernräume schaffen. Die Schüler:innen können Italienisch im virtuellen Rom lernen, in Physik den atomaren Raum erkunden und in Chemie ein Labor besuchen, in dem alle Experimente möglich sind. Da, wo es nur ein kooperatives Textpad oder eine Videokonferenz braucht, sollte auch kein VR eingesetzt werden. “Für eine reine Gadgetifizierung ist VR zu schade”, stellt Hassemer fest.
Das Festhalten am realen Raum bedeutet für Hassemer allerdings nicht das Festhalten am Klassenzimmer. Das werde verschwinden, aber nicht nur wegen Virtual Reality und digitaler Zusammenarbeit. “Gesellschaftliche Megatrends wie Individualisierung, Konnektivität, Wissenskultur und anderes sorgen dafür, dass das Klassenzimmer als Lernraum ausgemustert wird.” Für ihn bedeutet Schule mehr: Jugendtreff, Sportanlage, Ganztagsbetreuung. “Es wird noch lange und aus gutem Grund physisch reale Lernorte geben, an denen sich Menschen begegnen, um voneinander zu lernen.” Ob diese noch Schule heißen werden, sei dahingestellt. Von “´Klassenzimmern´ wird dann aber niemand mehr sprechen”, schließt Hassemer seine Reise in die Klasse der Zukunft.

Vergangene Woche ist die 13-jährige Yasmin aus Hagen bundesweit bekannt geworden. Als Risikopatientin wollte sie nicht länger im Klassenzimmer unterrichtet werden. Sie baute Pult und Laptop auf dem Schulhof auf. Du hast Dich mit ihr auf sozialen Netzwerken solidarisiert. Warum?
Im Dezember habe ich mit anderen eine erfolgreiche Petition gestartet: #Kinderdurchseuchenstoppen. Mitstreitende der Petition haben mich auf Yasmin aufmerksam gemacht. Ich verstehe, dass sie mit Asthma nicht in einen überfüllten, unsicheren Klassenraum gehen möchte, wo sie Corona ausgesetzt ist. Sie will trotzdem Bildung genießen und ihrer Schulpflicht nachkommen. Dass sie das auf dem Schulhof macht, ist ein symbolischer Akt. Sie hat den öffentlichen Diskurs über die Präsenzpflicht noch einmal mehr angestoßen. Dafür bin ich dankbar. Auch Streiks und ähnliche Aktionen sind für viele jetzt denkbar.
Deine gesamte Stufe ist vergangene Woche in den Lockdown gegangen. Ist das ein Streik oder waren es zu viele Corona-Infektionen in der Schule?
Nach den Ferien hatten wir in der elften und zwölften Klasse viele Infektionen. Wir konnten nicht mehr nachvollziehen, wer mit wem Kontakt hatte oder in der Pause interagierte. Deswegen haben wir dann in Absprache mit der Schulleitung Distanzunterricht gemacht. Ein Streik ist das nicht.
Du schreibst an einem Forderungskatalog, der sich an Schulleitungen, Ministerien und Behörden richtet. Was wird darin stehen?
Wir wollen, dass Schulen und Kitas die empfohlenen Schutzmaßnahmen des RKI umsetzen. Dazu gehören die S3-Richtlinien, FFP2-Masken und Luftfilter. Menschen wie Yasmin, die eine Vorerkrankung haben, müssen selbst entscheiden können, ob sie in Präsenz oder digital lernen wollen. Auch Regierung und Ministerien müssen sich bemühen. Sie sollten allen Schüler:innen die Möglichkeit zum digitalen Distanzunterricht bieten. Statt Präsenzpflicht brauchen wir eine Bildungspflicht.
Wie willst Du das erreichen?
Wir wollen, dass man uns anhört und mit statt über uns spricht. Ich vernetze mich gerade mit anderen Schülersprecher:innen aus ganz Deutschland. So bekommen unsere Forderungen mehr Gewicht. Den Behörden würde klar, dass wir streiken – wenn die Schulpolitik unsere Forderungen weiterhin nicht umsetzt.
Nun werden die Schulen aus gutem Grund so lange wie möglich offengehalten. Mit Schulschließungen nimmt man soziale und psychologische Folgeschäden in Kauf.
Es stimmt natürlich, dass Distanzunterricht einigen leichter und anderen schwerer fällt. Die Chancenungerechtigkeit existiert aber schon sehr lange an deutschen Schulen. Jetzt heißt es, dass einige Kinder von zu Hause nicht lernen können. Hätte man das nicht früher, vor der Pandemie, erkennen können? Warum gibt es dann zum Beispiel noch Hausaufgaben und Hausarbeiten? Strukturell muss sich etwas ändern. Die psychische Gesundheit hat nicht exklusiv durch die Schulschließungen gelitten. Alle Schüler:innen sind von der Pandemie belastet – und dem Versagen der Politik. Warum fragt niemand, wie man Distanzunterricht besser machen kann, damit es nicht zu so angeblich hohen psychischen Belastungen kommt?
Du wirst jetzt wieder digital unterrichtet. Funktioniert das an Deiner Schule gut?
Schon im Jahr 1800 haben Schüler:innen die Schulbank im Klassenraum gedrückt. Dieses Modell ist mittlerweile veraltet. Es gibt so viele tolle Angebote, wie man auch digital lernen kann. Meine Schule gehört als digitale Modellschule zu einem Berliner Schulversuch.
Was bedeutet das?
Das Otto-Nagel-Gymnasium hat schon vor über zehn Jahren mit dem Wechsel zu digitalen Medien angefangen. So steht jetzt beispielsweise in jedem Raum ein modernes Smartboard. In mehreren Fächern testen wir, wie man Videospiele gut in den Unterricht einbinden kann. In der Coronazeit haben wir einen Avatar an die Schule bekommen. Das ist ein Roboter, der ein Long-Covid-Kind zu Hause in den Unterricht mit einbezieht. Ganz praktisch bedeutet Modellschule, dass wir bei einem Heizungsausfall sämtlichen Unterricht von zu Hause ersetzen konnten. Wir mussten also nicht in der Schule frieren. Aber wir saßen auch nicht ohne Unterricht zu Hause.
Was ist der Vorteil digitalen Lernens für Dich?
Digitale Medien bieten ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Man ist nicht mehr so von Ort und Zeit abhängig. Auch beim Projektmanagement fällt uns der Überblick deutlich einfacher.
Hast Du ein Beispiel dafür?
Vor einem Jahr sollten wir für meinen Englisch-Leistungskurs als Klausurersatzleistung ein Werbevideo produzieren. Wir haben schnell eine To-do-Liste geschrieben, im Gruppen-Chat angepinnt und einen Termin für ein Online-Treffen geplant. Bei Abweichungen konnten wir uns schnell gegenseitig informieren. Ohne moderne Tools wäre dieser Prozess deutlich lästiger gewesen. Bei uns kriegt jeder Schüler ab der siebten Klasse ein eigenes Laptop. Wir nutzen Microsoft Teams, um das ganze Homeschooling zu regeln, und Moodle als Plattform für Dateimanagement.
Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Moodle und Microsoft?
Meist teilt die Lehrkraft die Aufgaben über unser Lernmanagementsystem Moodle. Über MS Teams findet dann vor allem Kommunikation und Projektplanung statt. Im Unterricht läuft es so ab, dass die Lehrkraft am Anfang sagt, “geht mal auf Moodle. Ich habe gerade die Dokumente für diese Stunde freigegeben.” Danach treffen wir uns auf Teams in Breakout-Räumen. Dort finden Gruppen- und Partnerarbeit sowie Präsentationen statt. Oder wir reichen die Arbeitsergebnisse wieder auf Moodle ein.
Hat Euch in der Schule jemand erklärt, was das datenschutzrechtliche Problem der Nutzung von Microsoft ist?
Es gibt leider kein Fach, in dem Lehrer erklären, wie man sich in der heutigen Zeit als Kind oder Jugendlicher im Netz zu bewegen hat. Vieles bringen wir uns selbst über YouTube-Videos oder durchs Ausprobieren bei. Auf einer früheren Schule war ich quasi der einzige, der wegen Datenschutz-Bedenken kein WhatsApp hatte. So habe ich wichtige Infos für die Schule gar nicht mitbekommen.
Und die neue Schule?
Meine jetzige Schule hat uns darüber aufgeklärt, dass Microsoft Teams nur ein Kompromiss ist. Wir haben in Europa leider noch keine richtige Konkurrenz für die Big-Tech-Angebote aus den USA. Das ist natürlich äußerst bedauerlich.
Bedauerlich ist auch, dass nicht alle Schulen so weit sind wie die Otto-Nagel-Schule.
Ja, als ich als Tutor während der Pandemie Ferienschulen betreut habe, war ich schockiert. An manchen Schulen sieht es mit der Digitalisierung schlecht aus. Ich bin wohl ein bisschen verwöhnt von meiner Schule. Wir könnten von jetzt auf gleich gut in Distanzunterricht wechseln. Aber das ist von oben einfach nicht erwünscht.
Anjo Genow, 17, geht in die zwölfte Klasse des Otto-Nagel-Gymnasiums in Berlin Marzahn-Hellersdorf. Er ist Schulsprecher, im Vorstand des Bezirksschülerausschusses und Mitglied der Partei Volt.
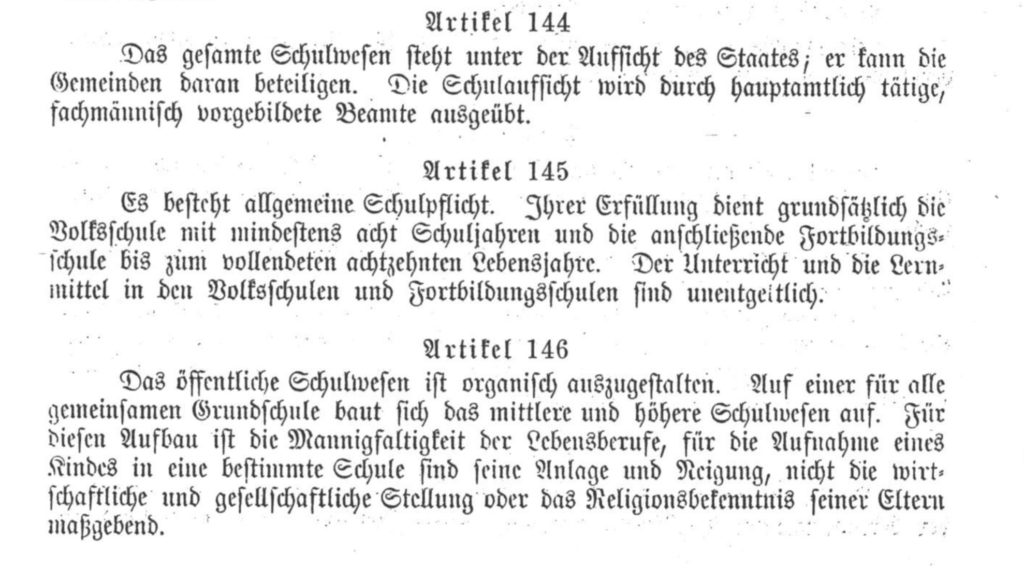
Gastbeitrag von Isabel Ruland
Die Schulpflicht im Sinne eines Gebots zur Anwesenheit in staatlichen Schulgebäuden besteht in Deutschland seit 1919. Damals war die Schulpflicht eine Errungenschaft für die demokratischen und – erstmals – halbwegs milieuunabhängigen Möglichkeiten für die Bildung aller Kinder.
Ihr voraus ging seit dem 18. Jahrhunderts eine Unterrichtspflicht. Die forderte Eltern auf, ihren Kindern Bildung zuteil werden zu lassen. Das geschah auch, um sie vor Ausbeutung als Arbeitskräfte unter Missachtung ihrer Bedürfnisse zu schützen. Es war nicht festgelegt, wie und wo die Bildung stattzufinden hatte. Oft wurde sie in einer Form des Hausunterrichtes umgesetzt, reiche Familien schickten ihre Kinder auf Privatschulen oder engagierten Hauslehrer. Für Eltern, die weder Neigung noch Ressourcen besaßen, ihre Kinder zu bilden, sprang zur Verwirklichung der Unterrichtspflicht der Staat ein.
Die Durchsetzung der Schulpflicht wurde aufgrund ihrer Historie als schwerer Eingriff in elterliche Rechte angesehen. Bis heute – manchen mag es in den Ohren klingeln – wird sie kontrovers diskutiert. Die Begründung der Schulpflicht liegt im Recht der Kinder, die zur Entwicklung und ihrem gesellschaftlichen Bestehen notwendige Bildung zu erlangen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Schulpflicht – man halte die Luft an – erst im Jahr 2006 ausgeführt. Sie dient der Durchsetzung des staatlichen Erziehungsauftrages. Der alltägliche Kontakt mit der demokratischen und pluralistischen Gesellschaft nebst ihren Diskursen wirkt toleranzfördernd.
Die hinter diesen Begründungen liegenden Bildungs- und Sozialisationsmöglichkeiten waren natürlich ausschließlich analoger Natur. Digitalisierung gab es noch nicht. Eine Familie, die die Schulpflicht nicht erfüllte, ihre Kinder isolierte (aus welchen Gründen auch immer), verletzte in der Tat im Beharren auf dem Recht der Eltern das Recht des Kindes – und auch das Recht des Staates.
Jahrzehnte nach diesen bis heute gültigen Grundlagen sieht unsere Bildungslandschaft ganz anders aus. Die Digitalisierung hat Einzug gefunden, seit Beginn der Pandemie auch (im Verhältnis zu vorpandemischen Schulausstattungen) in rasantem Tempo. Unterricht kann an fast jedem Punkt dieses Landes gewährt werden – ohne die Anwesenheit in einem bestimmten Raum dafür zu benötigen. Die Konsequenz ist, dass wir elterliche Erziehungs- und Bildungspflicht, Bildungsrecht, Schulpflicht, Präsenz- und Distanzlernen und staatliches Erziehungsrecht unter sich verändernden Gegebenheiten neu betrachten müssen. Wir werden dann zu modernen und angepassten Schlüssen kommen – wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft auch.
Konnte Bildung in vordigitaler Zeit nur in Präsenz vermittelt werden, so könnte das heute ohne unüberwindliche Probleme auch in Distanz erfolgen.
Dieser Entwicklung hat das Verfassungsgericht in seinem jüngsten Urteil im November 2021 zur Verfassungsmäßigkeit der Bundesnotbremse entsprochen, die den Präsenzunterricht verbot. Karlsruhe erkennt erstmalig das Recht auf schulische Bildung von Kindern gegenüber dem Staat an. Es lässt aber offen, in welcher Form dieses Recht wahrgenommen werden kann. Dabei wird explizit auf die Verpflichtung des Staates hingewiesen, das Bildungsrecht der Schüler in der Zeit des Präsenzunterrichtsverbotes auch durch Distanzunterricht zu gewährleisten. Damit nimmt das Gericht einen wichtigen, den technischen Entwicklungen und modernen pädagogischen Erkenntnissen angemessenen, zukunftsweisenden Standpunkt ein. Viele andere Länder dieser Welt vertreten mit der Abschaffung der Schulpflicht (im Sinne einer Präsenzpflicht) diese Idee schon länger.
Die Digitalisierung bedeutet für die Home- oder Fernbeschulung eine unermessliche Erleichterung. Sie verschafft der Welt – und auch Deutschland – neue Möglichkeiten, flexibel auf unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse moderner Familien reagieren zu können.
Die staatliche Schulbildungspflicht ist zunehmend unabhängig von der Präsenz-/Distanzfrage. Didaktik, Methodik und Kommunikation sind dafür durchaus entwickelbar.
Der staatliche Erziehungswille hinsichtlich Sozialisation in einer pluralistischen, toleranten, demokratischen Gesellschaft und der wichtige Kontakt der Kinder untereinander ist ebenfalls nicht zwangsläufig abhängig von der Frage nach Schulpräsenz. Den Kontakt zu andersdenkenden, altersdifferenten oder auch gleichgesinnten Menschen finden Kinder ebenso oder sogar besser bedürfnisorientiert und gewinnbringend jenseits der Schule. Bestehende Onlineschulen in Deutschland bieten beispielsweise auch Klassen-/Gruppenmöglichkeiten und hybride Lernformen an. Dem berechtigten Bedürfnis der Kinder kann somit auch anders als durch Schulpflicht entsprochen werden.
Den sozioökonomisch unabhängigen Zugang zu digitalen oder Nicht-Regelschulangeboten könnten staatliche kostenlose Onlineschulen oder vergleichbare flexible Möglichkeiten gewähren. Auch könnte man die bestehenden Onlineschulen in Deutschland als Ersatzschulen analog zu anderen Ländern rund um den Globus anerkennen. Bislang können hierzulande nur unter streng limitierten Bedingungen langfristig und/oder schwer erkrankte oder in Regelschulen nicht beschulbare Kinder solche Möglichkeiten nutzen, die teils auch hohe Schuljahreskosten erheben.
Wissenschaftlich wird die Schulpflicht schon lange kritisch als mögliches Hemmnis einer selbstbestimmten und kreativen Bildung und als Ausdruck des Misstrauens gegenüber der Lernwilligkeit von Kindern und der Erziehungsfähigkeit von Eltern diskutiert.
Die Schulpflicht in Deutschland ist also eine historisch berechtigte und in vielen Facetten gut begründete “Pflicht”, die über Bildungspflicht und Erziehungsrecht des Staates hinaus gesellschaftliche Funktionen etwa für die Erwerbstätigkeit von Eltern erfüllt. Ihr Bestand ist mit der Digitalisierung, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über Lernen und Sozialisation und zukünftige Erfordernisse der Gesellschaft sowie mit einem Fokus auf das originäre Recht der Kinder auf bedürfnisorientierte Bildung ohne Zuschreibung erwachsener oder wirtschaftlicher Erwartungen diskussionswürdig.
Isabel Ruland ist Pädagogin und Kriminologin, deren beide Kinder Schulen in NRW besuchen. Ihren Text veröffentlichte sie zunächst als Folge von Tweets im sozialen Netzwerk Twitter.
Die derzeit interessanteste Lehrerfortbildung “Mobile Schule” stand wohl einen Moment vor dem Aus. Jetzt bekommt sie überraschend eine zweite Chance – die der Mobilen Schule hilft und zugleich die größte europäische Bildungs-Messe Didacta aufwertet. Nach Informationen von Bildung.Table haben Andreas Hofmann, der Gründer und Erfinder der Mobilen Schule, und der Geschäftsführer des Didacta-Verbandes, Reinhard Koslitz, eine Kooperation vereinbart. Danach wird die Mobile Schule die Messe der Bildungswirtschaft verstärken, die nun von 7. bis 11. Juni in Köln stattfindet. Das bedeutet, dass Hofmanns Fortbildungsprogramm von Lehrern für Lehrer, das bundesweit Tausende Lehrende erreicht, künftig Bestandteil der Didacta werden könnte. Hauptgeschäftsführer Reinhard Koslitz sagte Bildung.Table, er wisse, dass die Didacta oldschool sei, daher müsse man das Neue integrieren.
Allerdings begann die neue Zusammenarbeit mit einem Foul. Die Didacta verschob kurzerhand ihre Messe 2022 von März auf Juni – und damit genau auf den Termin, an dem die Mobile Schule nach zwei Jahren erstmalig wieder in Präsenz stattfinden sollte. Für Hofmann eine gefährliche Kollision. Denn kurz zuvor hatte bereits die Learntec ihren Messe-Termin verschoben und ebenfalls die Mobile Schule verdrängt. Das seien existenzielle Fragen, sagte Hofmann, der sich erst vor zwei Jahren selbstständig gemacht hatte. Da hingen Mietkosten für große Hallen dran. Es hätten Referenten und Aussteller umgebucht werden müssen. Dass es bei den jüngsten Kollisionen von Messen und Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer:innen nicht nur um Corona und Terminfragen geht, zeigt die Äußerung eines Messemachers. “Wenn wir jemanden platt machen wollen, dann können wir das natürlich.”
Für die Mobile Schule ist die jetzige Entwicklung möglicherweise sogar ein Vorteil. Bisher gab es einen Termin im Juni. Nun bekommt die Lehrerfortbildung mit großer Gemeinde zwei Präsenz-Termine im Jahr 2022: zum einen als “autonomer Part” auf der Didacta im Juni, zum anderen mit einem eigenen Termin in der Messe Hannover am 26. und 27. September. Die Mobile Schule wird dem Vernehmen nach während der Didacta nicht nur an einem, sondern an mehreren Tagen stattfinden. Ob die Sessions mitten im Trubel der Didacta oder im Seminarbereich abgehalten werden, sei noch nicht entschieden. cif
Die Deutsche Telekom und Rednet haben mit Rheinland-Pfalz einen millionenschweren Vertrag abgeschlossen, über den Schüler mit Notebooks und Tablets ausgestattet werden. Die Unternehmen organisieren im Auftrag des Staates die Verteilung und Einrichtung von Endgeräten an allen rheinland-pfälzischen Schulen. Insgesamt befindet sich das Volumen der Rahmenverträge bei 200 Millionen Euro, teilte das Bildungsministerium mit.
Rheinland-Pfalz hatte ein europaweites Ausschreibungsverfahren für die Schulen und Schulträger organisiert, weil die in der Pandemie so viel geleistet hätten. Das sagte die zuständige Ministerin Stefanie Hubig. “Das Land hat deshalb für sie die Zeit und die Mittel für europaweite Ausschreibungen in die Hand genommen, so dass die Schulträger keine eigenen Vergabe-verfahren mehr durchführen müssen,” so die Schulministerin.
Laut Telekom “profitieren rund 1.660 Schulen und damit mehr als 400.000 Lernende im Präsenz- wie auch im Distanzunterricht” von dieser Übereinkunft. Über Rednet können die Schulträger 150.000 Notebooks beziehen. Die Unternehmen begrüßten die Initiative des Bundeslandes, die Digitalisierung der Schulen mit ihrer Beteiligung voranzutreiben. Die Telekom verspricht, ein “ganzheitliches Konzept und breites Portfolio” zu liefern. Die Tablets und Notebooks sollen für die Schüler sicher und für Distanzunterricht gut geeignet sein. Zum Deal mit Rheinland-Pfalz gehört auch die Verwaltung der Geräte und Zubehör-Lieferungen. Die Vertriebspartner des Apple-Konzerns bieten Komplettlösungen für Schüler aus Hard- und Software für die Tablets an. Zusätzlich können Lehrkräfte fortgebildet werden. An dieser Gesamtlösung gibt es Kritik, weil sich Schulen von Herstellern abhängig machen.
Im Rahmen des DigitalPakts Schule steht Rheinland-Pfalz von 2019 bis einschließlich 2024 ein Betrag von insgesamt rund 241 Millionen Euro zu. Zusätzlich hat das Land mit dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes DigitalPakt II noch weitere Mittel zur Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schüler:innen erhalten. Auf Rheinland-Pfalz entfielen aus diesem Programm rund 24 Millionen Euro, das reichte bisher für rund 57.000 mobile Endgeräte. Jan Lubschik
In seiner ersten großen Debatte in Anwesenheit der neuen Bundesbildungsministerin hat der Bundestag wenig Neues über die digitale Bildung erfahren. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) stellte lediglich die im Koalitionsvertrag beschlossenen Pläne des Digitalpakts 2.0 erneut vor. “Die digitale Revolution passiert. Geben wir unseren Kindern und Jugendlichen den Pass in die Zukunft, den sie brauchen!”, sagte sie. Mit dem neuen Digitalpakt wolle man die nächste Stufe der Digitalisierung schaffen. Wie dieser Schritt aussieht, verriet sie nicht.
Die CDU bot erneut an, bei einer Grundgesetzänderung für digitale Bildung als Partner zur Verfügung zu stehen. “Sie werden zeigen müssen, wie sie das Grundgesetz wirklich ändern wollen”, sagte der neue bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Jarzombek. “Weil eins ist doch klar: wir werden hier mehr machen wollen und müssen, aber wir werden nicht unkonditioniert Geld an Länder geben können. Das wird eine schwierige Aufgabe. Wir werden ihre Partner dabei sein”.
Die Ampel-Regierung wolle für mehr Chancengerechtigkeit sorgen, sagte die Bildungsministerin. Sie werde mit einem Startchancen-Programm bundesweit 4.000 Schulen “in sozial schwierigen Lagen” fördern. Zudem soll sich das Bafög grundlegend verändern. Stark-Watzinger betonte, dass Schulen in der Pandemie so lange wie möglich offen bleiben sollten. So wolle sie das Recht auf Bildung gewährleisten. Schulen sollten zur kritischen Infrastruktur zählen. Stark-Watzinger bekräftigte ihre Forderung nach mehr Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen und formulierte an die Länder gerichtet: “Wir stehen bereit.”
Die neue bildungspolitische Sprecherin von Bündnis90/Grüne, Nina Stahr, stellte im Bundestag mit Blick auf digitale Bildung klar: “Wir bauen Bürokratie ab und sorgen dafür, dass das Geld schnell und direkt an den Schulen ankommt.” Der Digitalpakt solle neben der Anschaffung von Technik und Geräten stärker die Medienkompetenz fördern. Gemeinsam mit den Ländern werde man “Beratungen rund um den digitalen Unterricht vom Kopf auf die Füße stellen”. Katrin Zschau (SPD) sagte: “Wir richten den Fokus auf Digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung.” Der Digitalpakt 2.0 solle eine Laufzeit bis 2030 haben und nachhaltige Neuanschaffung von Hardware, den Austausch veralteter Technik sowie Gerätewartung und Administration umfassen.
Die Union, neu in der Rolle der Opposition und bis zuletzt Hausherrin im Bundesbildungsministerium, klopfte sich selbst auf die Schulter. Der Etat des BMBF habe sich seit 2005 fast verdreifacht. “Sie bekommen ein ausgesprochen gut bestelltes Haus”, sagte Thomas Jarzombek in Richtung der neuen Koalition. Mit Blick auf die Digitalisierung der Bildung wünsche er sich mehr Offenheit und Wettbewerb. Er denke dabei an Plattformen, die auch für Start-ups offen sind, “wo pro Klick bezahlt wird und nicht Schulbuchverlage über viele Jahre sichere Verträge bekommen, die keine Innovation anreizen.” Mehr Tempo bei der Digitalisierung im Bildungsbereich könne es nur mit einer Grundgesetzänderung geben. Seine Partei stehe dabei als Partner und kritischer Begleiter an der Seite der Ampel-Regierung. npr

“Wir waren sehr verzweifelt“, sagt Undine Balk, wenn sie an die Anfänge der Pandemie vor zwei Jahren zurückdenkt. Nach dem ersten Schul-Lockdown im März 2020 zeichnete sich schnell ab, dass die Kinder bald wieder zurück in die Klassenzimmer müssen. Für die Familie Balk wäre eine Ansteckung jedoch lebensgefährlich: Drei der sechs Familienmitglieder leiden unter Blutarmut, ihr Immunsystem ist geschwächt. Undine Balk und ihr Mann Olaf wollten ihre Kinder, drei von ihnen sind noch schulpflichtig, von der Präsenzpflicht befreien. Digitale Bildung würde sie als Risikogruppe besser schützen. Da die Schule sich wehrte, mussten die Balks klagen.
“Wir haben uns ziemlich alleine gefühlt”, sagt Undine Balk. Gleichzeitig waren sie davon überzeugt, sie seien nicht die einzigen Eltern in Deutschland, für die Schulunterricht in Präsenz für die ganze Familie gefährlich werden könnte. Sie suchten auf Social Media Verbündete und wurden auf Twitter fündig. Die Initiative “Sichere Bildung Jetzt!” hatte sich zu Beginn der Pandemie gegründet. Sie fordert genau das, wofür die Balks streiten: Ein Aussetzen der Präsenzpflicht und einen konsequenten Schutz für alle Familien, für die Covid-19 ein besonders hohes Risiko darstellt.
Seitdem organisieren Undine und Olaf Balk zusammen mit den anderen Engagierten von der bundesweiten Initiative “Sichere Bildung Jetzt!” Mahnwachen und Demonstrationen auf Brücken, Plätzen und vor Rathäusern in Hamburg, Berlin oder Potsdam. Sie schickten Videobotschaften an die ehemalige Regierungschefin Angela Merkel und laden immer wieder Politiker in Zoom-Räume ein, um mit ihnen über die Neugestaltung von Schulen zu diskutieren.
Undine und Olaf Balk träumen von einer Schule, die auch in einer weltweiten Pandemie sicher ist. Eine Schule für alle. Wie diese neue Schulform aussehen könnte, probieren sie gerade selbst bei sich zu Hause aus. Ihre drei Jüngsten, die gerade in die 5., 6. und 9. Klasse gehen, haben seit zwei Jahren keine Schule mehr von innen gesehen – Bildung bekommen sie nun digital und häuslich.
Ihre 10-jährige Tochter und ihr 12-jähriger Sohn nehmen von zu Hause am Regelunterricht teil und werden dabei von Lehramtsstudentinnen via Zoom unterstützt. Zwar empfinden Olaf und Undine die Unterrichtsgestaltung zuweilen als “zu analog”, doch sie beobachten eine gesteigerte Selbstständigkeit bei ihren Jüngsten. Die haben in der Pandemie ihren eigenen Lernrhythmus gefunden, beginnen mit der Schule nun um etwa neun Uhr – in Potsdam, wo sie schulpflichtig sind, geht es eigentlich um halb acht los. Das sei aber zu früh, finden die Balks, um diese Zeit könnten sich die Kinder noch nicht konzentrieren.
Und dann haben sie noch einen 16-jährigen Jungen, dem die Schule schon immer zu schaffen machte. Er wurde von seinen Mitschülern gemobbt, entwickelte eine Angst- und Zwangsstörung. Der normale Klassenverbund, also das Lernen mit 30 anderen Kindern in einem Raum, ist für ihn auch ohne die Angst vor einer Virusinfektion nicht auszuhalten. Für ihren Sohn erkämpften seine Eltern eine andere Lösung. Die Balks suchten ihm eine Schule, die nur online stattfindet, in Deutschland bisher undenkbar. Denn digitale Bildung schützt zwar Risikogruppen, genügt aber eigentlich nicht der Schulpflicht.
Im März 2021 stellten sie also Anträge beim Schulamt auf Aussetzung der Schulpflicht, kümmerten sich um psychologische Atteste, legten Widerspruch ein, als das Schulamt ihren Antrag ablehnte. Schließlich klagten sie sogar vor Gericht. Auf eine Entscheidung mussten die Balks zwar monatelang warten, doch wenigstens das Jugendamt stand ihnen zur Seite: Es übernimmt nun die Kosten der Privatschule.
Nun loggt sich ihr Sohn täglich über die Microsoft-Anwendungen in ein virtuelles Klassenzimmer ein. Seine Schulkameraden kommen aus Costa Rica oder Korea. Die Wilhelm von Humboldt Online Privatschule kostet 5.880 Euro im Jahr und ist ein Beispiel rein digitaler Bildung. Die Eltern sagen, hier bekäme er das, was ihm an staatlichen Schulen fehlte: individuelle Betreuung.
Dass Schule auch anders geht, lässt die Balks auf eine Schulform hoffen, die es bisher in Deutschland noch nicht gibt. “Die ideale Schule wäre eine Schule, die den individuellen Bedarf der Schüler erkennt und diesen auch abdeckt“, sagt Olaf Balk. Und eine, die eben nicht privat, sondern staatlich ist. Einen Unterricht, bei dem alle Kinder gleich mitkommen würden, gebe es eben nicht, finden sie. Jedes Kind habe unterschiedliche Interessen und Stärken, sagt Olaf Balk. Digitale Bildung ist eine Chance, findet er und redet nicht nur von Risikogruppen. Über digitale Anwendungen könnten jedem Kind unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, individuelles Lernen sei online viel besser umzusetzen als an der Kreidetafel.
“Es ist unbestritten, dass sich Kinder auch physisch treffen müssen”, sagt Undine Balk. Doch gerade in Pandemiezeiten sei es für Jugendliche wichtig, sich in ihrer Freizeit persönlich treffen zu können und nicht in der Schule, glaubt sie. Und das ginge zurzeit am sichersten draußen, wo Abstand eingehalten werden könne und das Risiko, sich anzustecken, geringer ist. “Wir möchten alle Bildungseinrichtungen in Deutschland in dieser Pandemie sicher wissen”, sagt Undine Balk. “Und das wird uns seit fast zwei Jahren einfach verwehrt.”
