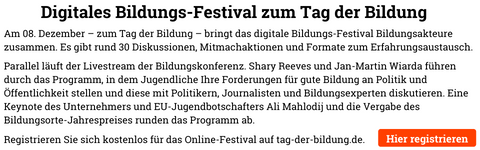als Anja Karliczek ins Amt der Bildungsministerin des Bundes kam, grämte sich die Bildungs- und Wissenschaftsszene in Deutschland lange. Die CDU-Parlamentsmanagerin musste erst beweisen, dass sie sich für das komplexe Ressort erwärmen kann. Ich habe sie übrigens in Interviews immer mit großem Enthusiasmus erlebt. Geht das mit Bettina Stark-Watzinger jetzt genauso? Vordergründig hatte die FDP-Frau aus Hessen noch nicht viel mit Bildung zu tun. Aber Vorsicht, Sofie Czilwik zeigt uns, wo sich die Kauffrau und Psychologin sehr gut auskennt. Die Leute im Ministerium sollten sich warm anziehen.
Da fahren zwei Züge aufeinander zu: Von der einen Seite kommt die Ampelkoalition und ihr Wunsch, dass Schulen endlich Positivlisten erhalten. Und von der anderen Seite rollen die Landesdatenschützer heran. Einer von ihnen empfindet es tatsächlich als Machtmissbrauch, wenn man Schulen hilft, datenschutzkonforme Apps, Tools und Lernwolken zu finden. Das ist ein starkes Stück – und eine schöne Herausforderung für Rot-Grün-Gelb. Bald können die neuen Regierenden zeigen, wie ernst es ihnen damit ist, dass die vielen Digital-Milliarden nicht weiter durch offene Datenschutzfragen gebremst werden. Aber lesen Sie selbst, mit welchen Girlanden die Landesdatenschutzbehörden ihre Indolenz begründen.
Bleiben Sie gesund!

Die Haltung von Jens Brandenburg ist eindeutig: “Wir dürfen die Lehrerinnen und Lehrer beim Datenschutz nicht länger in einer juristischen Grauzone hängen lassen,” sagte der Verhandlungsführer “Bildung” der FDP bei den Gesprächen der Koalition. Auch der SPD-Vorsitzende Baden-Württembergs, Andreas Stoch, der die Delegation der Sozialdemokraten anführte, nannte die sogenannte Whitelist ein prioritäres Ziel der kommenden Bundesregierung. Und Lasse Petersdotter, der grüne Digitalisierungsexperte aus Schleswig-Holstein forderte gegenüber Bildung.Table: “Wir dürfen die Schulleiter:innen nicht dabei alleine lassen, die Datenschutzkonformität digitaler Angebote abwägen zu müssen.” Eine Positivliste solle ihnen Orientierung bei der Nutzung digitaler Tools geben, findet die neue Koalition.
Auf einer solchen Liste können sich Schulträger und Schulleiter unkompliziert über “datenschutzkonforme, digitale Lehr- und Lernmittel” informieren. So steht es im Koalitionsvertrag. Die Liste soll “gemeinsam mit den Ländern” entstehen. Aber genau dort herrscht eine ambivalente Haltung gegenüber der von der Ampel-Koalition geplanten Positivliste. Eine Umfrage unter den Landes-Datenschutzbehörden von Bildung.Table zeigt: Viele Datenschützer preisen die Liste – sehen sich aber außerstande, sie zu erstellen. Einige Datenschützer lehnen sie ab. Sachsens Datenschutzsprecher sagte, man könne eine Positivliste als “Missbrauch einer Machtposition begreifen.”
Unklare, sich zum Teil widersprechende Aussagen zum Datenschutz sind ein wesentliches Hindernis bei der Digitalisierung von Schulen. Lehrer, Schulleiter wie auch Experten fordern seit langem, dass sie belastbare Auskünfte über die Zulässigkeit in der Nutzung von Endgeräten, Schulclouds oder Apps bekommen – idealerweise durch die Landesdatenschützer.
Die finden zwar reihum, dass solche Auskünfte für die Schulen und den Prozess der Digitalisierung wichtig wären. “Der Aufbau eines derartigen, bundesweit abrufbaren Registers ist für Lehrkräfte und Schulleitungen sinnvoll und wünschenswert“, sagte die Sprecherin des hessischen Datenschutzbeauftragten (HBDI). Die Sprecherin des Datenschutzbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern, Antje Kaiser, äußerte sich positiv: “Diese Listen hätte es schon vor zehn Jahren geben sollen.” Auch Saarlands Datenschützerin Monika Grethel finde eine Positivliste “geprüfter Apps für den Schulunterricht sinnvoll. Dies würde für einen rechtskonformen Einsatz der Apps im Unterricht sowie Rechtssicherheit für die Lehrkräfte, Schüler:innen und Eltern sorgen.”
Warum aber gibt es dann eine solche Liste dann nicht? Weil sich die Datenschützer nicht in der Lage sehen, der Flut von digitalen Anwendungen für Schulen Herr zu werden. Eine solche Liste gebe es im Norden nicht, sagte Antje Kaiser, “weil wir keine Kapazitäten dafür haben”. Ähnlich Hessen: Für eine Liste würden die personellen Kapazitäten nicht ausreichen. Nur “in ganz besonderen Ausnahmefällen kommt es vor, dass sich der HBDI zu Produkten im Einzelfall äußert.” Selbst den Datenschutzbeauftragten der großen Länder NRW, Bayern und Baden-Württemberg fehle die Manpower. Die technische Prüfung von digitalen Lernprodukten sei relativ aufwendig, ließ Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink mitteilen. “Daher ist eine vollständige Prüfung nicht ohne Weiteres zu leisten.”
Hier zeigt sich ein Phänomen der Selbstüberforderung: Die Landesdatenschützer wollen unter einer Liste eine rechtssichere, topaktuelle und den gesamten Markt abdeckende Übersicht verstehen. Eine solche Alles-Liste wird es selbstverständlich nicht geben. Das hat auch kein Schulleiter verlangt. Aber zwischen alles und nichts gibt es Zwischenstationen. Selbst die unvollständigen Listen aus Berlin und Thüringen finden bei Schulleitern reißenden Absatz – und hielten gegen die Billion-Dollar-Player Google und Microsoft stand. Auch in der Arbeitsgruppe der Koalition herrscht offenbar eine pragmatische Haltung, wie perfekt eine Liste sein solle.
Der Grüne Petersdotter etwa sagte Bildung.Table: “Es könnte vielleicht ein gutes und einfaches Verfahren sein, wenn beim Datenschutzbeauftragten des Bundes eine Liste datenschutzkonformer Angebote angelegt ist, die von den Landesdatenschutzbeauftragten der Länder jeweils aktualisiert wird.” Die Landesdatenschützer freilich lehnten diese Variante zum Teil brüsk ab. Daher empfahl FDP-Verhandlungsführer Jens Brandenburg, “wichtig ist, dass es funktioniert. Es wäre falsch gewesen, sich in der Koalition vorschnell auf eine Option festzulegen.” Brandenburg ließ offen, ob eine Positivliste durch gegenseitige Anerkennungen, eine zentrale Stelle oder die Federführung einzelner Bundesländer zustande kommt. “Wir brauchen möglichst pragmatische und schnelle Lösungen für die Schulen.”
Strenggenommen existiert bereits eine Reihe von Lösungen, schnell und pragmatisch ist allerdings keine von ihnen. Zum einen der von den Bundesländern angestoßene “eduCheck digital“, ein Projekt, das didaktische, urheberrechtliche und datenschutzrechtliche Empfehlungen verknüpfen soll. Allerdings startete das Projekt erst im September. Ob und wie die Datenschutzbehörden dort mitwirken, steht in den Sternen. Zum anderen gibt es ein vom Bund angestoßenes Zertifizierungsverfahren, das am Karlsruher Institut für Technologie entstehen soll. Das Data Protection Certification for Educational Information Systems (“DIRECTIONS“) soll zu einer Datenschutzzertifizierung für schulische Informationssysteme führen. Das Projekt startet heute, es soll 2027 abgeschlossen sein. Von der jetzigen Schülergeneration profitieren also bestenfalls noch die Erst- bis Sechstklässler.
Obwohl (oder weil?) die Listen von Bund und Ländern Schulen erst in Jahren verlässliche Auskünfte liefern, beriefen sich die Datenschützer darauf – negativ. Der Sprecher von Saarlands Datenschützerin Grethel erteilte der Mitarbeit bei “eduCheck digital” eine Absage: “Eine Beteiligung unserer Dienststelle wäre schon mangels personeller Ressourcen nicht möglich.”
Zur Zertifizierung äußerte sich die Datenschutzbeauftragte Schleswig-Holstein, Marit Hansen, die den gleichnamigen Ausschuss der Datenschutzkonferenz leitet. Hansen befürwortet die DSGVO-Zertifizierung von Verarbeitungen im schulischen Bereich. “Ich rechne aber damit, dass es noch etwas dauert, bis die ersten Zertifikate da sein werden.”
Keine der Lösungen kommt in seiner Verfügbarkeit bisher an die Liste heran, die Lutz Hasse auflegte, der Datenschutzbeauftragte Thüringens. In Rundmails an die Schulleiter:innen seines Bundeslandes informierte Hasse – wie berichtet – über die Datenschutzkonformität von Apps und Schulclouds. Bei Lehrern und Schulleitern bekam die Positivliste stürmischen Beifall – unter den Landesdatenschützern wurde die Nase gerümpft. Ein Sprecher der Landesdatenschutzbehörde Sachsen-Anhalts bezweifelte im Gespräch mit Bildung.Table, ob man die Rundschreiben “überhaupt als Liste bezeichnen kann“. Nordrhein-Westfalens Datenschutzbeauftragte Bettina Gayk nannte die “Beteiligung an einer Black- bzw. Whitelist digitaler Angebote für Schulen derzeit nicht für zielführend.” Wie ließe sich eine solche Blockadehaltung überwinden?
Die Verhandler der Koalition in Berlin hoffen für die Aufstellung einer Positivliste auf jenen guten Geist, der in ihren Gesprächen geherrscht habe. Andreas Stoch, SPD-Chefunterhändler sagte, der Druck der Öffentlichkeit auf schnelle Antworten werde helfen. Seine Kollegen Petersdotter und Brandenburg meinten fast gleichlautend, ohne die Länder gehe nichts. “Eine Positivliste kann nur funktionieren, wenn wir uns mit den Ländern auf einem gemeinsamen Prozess verabreden“, zeigte sich Jens Brandenburg überzeugt.
Vielleicht sollte man sich da nicht zu große Hoffnungen machen. Denn der Wind ist bitterkalt, der in der Koalition der Unwilligen in den Ländern weht. “Auch ordnungspolitisch wäre es zu hinterfragen, sofern ‘Vater Staat‘ in dem von Ihnen fokussierten Bereich Produktempfehlungen wie ‘geht’, ‘geht so’ oder ‘geht gar nicht’ herausgäbe”, schrieb Sachsens Datenschutzsprecher Andreas Schneider über eine nützliche Positivliste. “Wo soll die Verdrängung von Eigenverantwortung noch hinführen? Empfiehlt der Bürgermeister in seinem Gemeindegebiet demnächst über eine Liste den Einwohnern Backstuben, die gesundes Brot anbieten?”

Herr Karlitschek, Sie haben gegen Microsoft eine Kartellbeschwerde erhoben. Wegen einer marktbeherrschenden Stellung auch in Deutschland. In welchen Bereichen sehen Sie diese marktverzerrende Position?
Unsere Kartellbeschwerde ist für alle Branchen und Bereiche wichtig. Microsoft nimmt nach und nach alle Software-Produkte, die man selbst betreiben kann, vom Markt und setzt voll auf Cloud-Anwendungen. Daher stehen alle Microsoft-Kunden jetzt unter Druck, zu Microsoft Cloud-Produkten zu migrieren. Oder sie setzen auf datenschutzfreundlichere Produkte.
An den Schulen sind Lernmanagementsysteme wie Moodle und wahrscheinlich sogar itslearning und IServ weiter verbreitet als Microsoft.
Wir haben ja in Deutschland, insbesondere im Bildungsbereich, einen Digitalisierungs-Stau. Daher ist der Druck hier um so höher, den Datenschutz zu ignorieren – und alle Daten von Schülern und Lehrer in die Microsoft-Cloud zu laden. Das wäre aus meiner Sicht ein sehr großer Fehler. Mit dieser Kartellbeschwerde versuchen wir Microsoft zu zwingen, allen Kunden datenschutzfreundliche Alternativen aufzuzeigen.
Hat Microsoft im Schulbereich nicht gerade eine empfindliche Niederlage einstecken müssen? Der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat erhebliche Bedenken gegen die Anwendung von MS 365 an Schulen. Wo kommt da die Marktbeherrschung her?
Ich freue mich sehr darüber, dass mehr und mehr Organisationen und Datenschutzbeauftragte das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ernst nehmen und erkennen, dass Microsoft Cloud Produkte nicht DSGVO-konform sind. Der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat hier berechtigte Bedenken vorgetragen. Allerdings ist das momentan leider noch die Ausnahme. Viele Organisationen und Schulen versuchen, momentan noch, die DSGVO einfach zu ignorieren und hoffen, dass es gut geht. Das ist aber – meiner Meinung nach – keine langfristig gute Strategie.
An den Berufsschulen ist Microsoft dominierend vertreten. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das an diesen Schulen eingespielte System durch andere Lösungen zu ersetzen?
Es ist wichtig, endlich in die Digitalisierung und Modernisierung unserer Schulen zu investieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bildung in Deutschland die höchste Priorität genießt. Sonst riskieren wir, dass Deutschland seine Rolle als führende Industrienation einbüßt. Ein Teil dieser neuen Investitionen sollte sicherlich in Infrastruktur wie zum Beispiel Lernmanagement- und Cloud-Systeme fließen.
Wie gehen Sie eigentlich mit der großen Fan-Lobby von Microsoft um? Sowohl unter Lehrern als auch unter Politikern gibt es MS-Anhänger.
Wir als sehr kleiner Software-Anbieter haben natürlich nicht die Lobby- und Marketingbudgets, um es mit Microsoft aufzunehmen. Da ich persönlich aber ein unverbesserlicher Optimist bin, hoffe ich, dass sich am Ende des Tages die Fakten durchsetzen. Die Tatsache, dass der EuGH geurteilt hat, dass amerikanische Cloud-Anwendungen nicht DSGVO-kompatibel sind, lässt sich auch mit der größten Lobbyisten-Armee nicht wegdiskutieren.

Von Sebastian Horndasch
Manchmal lohnt sich der Blick zurück. Legt man den Koalitionsvertrag der GroKo zum Thema Hochschulen aus dem Jahr 2018 neben den der Ampel, zeigt sich: damals dominierte vielerorts eine wohlklingende Politlyrik mit wenig Substanz. Heute findet sich kaum ein Absatz mehr ohne konkrete politische Festlegungen. Das ist bürgerfreundlich, das erleichtert die Exegese des Papiers.
Das vermutlich wichtigste Versprechen im Koalitionsvertrag der Ampel mit Blick auf mein Arbeitsfeld: es gibt mehr Geld für Hochschulen. “Wir werden den ‘Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken‘ ab 2022 analog zum Pakt für Forschung und Innovation dynamisieren.” Konkret sollte das heißen: Jedes Jahr drei Prozent mehr Mittel. Denn das ist der fest geschriebene jährliche Aufwuchs für außeruniversitären Forschungseinrichtungen bis 2030. Das ist ordentlich und schafft Planungssicherheit.
Auch ein neues Förderprogramm ist geplant: “Mit einem Bundesprogramm ‘Digitale Hochschule‘ fördern wir in der Breite Konzepte für den Ausbau innovativer Lehre, Qualifizierungsmaßnahmen, digitale Infrastrukturen und Cybersicherheit.” Quasi der Digitalpakt Hochschule, den Anja Karliczek verweigert hatte. Es wird nicht nur auf Hardware gesetzt, sondern auch auf Konzepte und Qualifizierung. Das freut mich sehr; die Community des Hochschulforums Digitalisierung hatte auch lange genug darauf gepocht. Wobei: In einer idealen Welt wäre das eine Selbstverständlichkeit. In der realen Welt ist es eine positive Erwähnung wert.
Die neu eingerichtete Stiftung Innovation in der Hochschullehre soll “insbesondere im Bereich digitaler Lehre” weiterentwickelt werden. Nun war digitale Lehre dort bereits das Top-Thema der ersten großen Ausschreibung. Bedeutet das also noch stärkeren Fokus aufs Digitale? Mehr Geld? Oder mehr Personal? Mehr Aufgaben? Hier bleibt das Papier vage. Definitiv jedes Jahr mehr Geld gibt es jedenfalls für die Akademien der Wissenschaften, den Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH). Das passt in die allgemeine Logik der berechenbaren Budgetsteigerungen. Und Berechenbarkeit ist gut.
Auch dicke Bretter verspricht die Koalition zu bohren. So will die Ampel eine “Weiterentwicklung des Kapazitätsrechts” umsetzen, unter anderem, um digitale Lehre fairer abbilden zu können. Eine große Aufgabe; hier herrscht seit Jahrzehnten Stillstand. Wie sie es allerdings machen wollen, sagen die Koalitionäre nicht.
Es soll die eine “Deutsche Agentur für Transfer und Innovation” gegründet werden, die die Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen sowie kleinen und mittleren Universitäten mit Unternehmen und öffentlichen Organisationen fördern soll. Aus meiner Sicht ist das klar positiv – aber abhängig von der konkreten Ausgestaltung. Setzt man die falschen Anreize, droht eine ungerechtfertigte Einflussnahme privater Akteure auf öffentliche Hochschulen.
Daneben reagiert die Ampel auf die #IchbinHanna-Debatte und verspricht eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die Planbarkeit und Verbindlichkeit für Post-Docs erhöhen soll. Gutes Ziel – man hat diese Absicht allerdings auch schon in der Vergangenheit gehört. Und in Berlin sehen wir gerade, wie gute Absichten bei der Befristung nach hinten losgehen können. Nötig ist ein guter Mittelweg – und vor allem die breite Einführung einer professionellen Personalentwicklung an Hochschulen.
Ein großes Problem an Hochschulen ist die Software. Lokal an Hochschulen entwickelte Lösungen sind oft umständlich in der Nutzung. Lösungen internationaler Großunternehmen funktionieren gut, sind aber datenschutzrechtlich problematisch. Was es braucht: Öffentlich geförderte hochschulübergreifende IT-Zusammenarbeit – mit Ergebnissen, die open source veröffentlicht werden. Die Koalition verspricht nun “IT-Verfahren nach dem Einer-für-alle-Prinzip (EfA)”, eine “Cloud der öffentlichen Verwaltung” sowie open source als allgemeine Regel. Das klingt sehr gut; allerdings betrifft dieses Versprechen im Koalitionsvertrag vor allem die Verwaltung, aber nicht die Lehre der Hochschulen. Für mich ist es eindeutig, dass es auch für Hochschulen gelten muss. Denn dies wäre mittelfristig ein gigantischer Schritt hin zu mehr digitaler Souveränität in der Hochschulbildung.
Wer sich schon länger mit Bildungspolitik beschäftigt, dem werden einige Formulierungen bekannt vorkommen. Gleich mehrere Zusagen von 2018 haben es wieder in den Koalitionsvertrag geschafft.
So möchte die neue Bundesregierung für die wissenschaftliche Weiterbildung “die Einführung von Micro-Degrees prüfen”. Ein unterstützenswertes Ziel, doch etwas ähnliches wollte man bereits 2018. Da hieß es, Nano-Degrees sollten “(auch im Rahmen von Weiterbildungsstudienangeboten) an staatlichen Hochschulen erworben werden können”. 2021 nutzt man nicht mehr den urheberrechtlich durch Udacity geschützten Titel des “Nano-Degrees”, was von Kenntnis der Materie zeugt. Das Ziel bleibt gleich – und richtig! Denn mehr Flexibilität bei den Hochschulabschlüssen wäre für alle Beteiligten hilfreich.
Ebenfalls 2018 versprach man die Erarbeitung einer “umfassenden Open Educational Resources-Strategie“. Daraus ist bekanntermaßen wenig geworden. Nun heißt es zum Thema: “Wir werden gemeinsam mit den Ländern digitale Programmstrukturen und Plattformen für Open Educational Resources (OER), die Entwicklung intelligenter, auch lizenzfreier Lehr- und Lernsoftware … unterstützen”. Das klingt weniger vollmundig und hat vielleicht gerade dadurch mehr Aussicht auf Erfolg.
2018 versprach die GroKo, man würde die Regelungen im Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz “umfassend evaluieren”. Das ist nicht passiert. In der kommenden Legislatur will man sich nun für ein “wissenschaftsfreundlicheres Urheberrecht” einsetzen. Ähnliche Schlagrichtung, in der Zielsetzung aber positiver – was Hoffnung macht.
Was hätte im Koalitionsvertrag für die Hochschulen realistischerweise stehen können? Bei Open Educational Resources war die GroKo als Tiger gesprungen (“umfassende Strategie”) und als Bettvorleger gelandet. Dass die jetzigen Aussagen zum Thema weniger vollmundig sind, kann man als Realismus loben – oder als Mutlosigkeit kritisieren. Gewünscht hätte ich mir persönlich mehr.
Meinen Optimismus zusätzlich gesteigert hätten konkrete Zahlen zur Finanzierung. Der Koalitionsvertrag verspricht, mehr Geld für die richtigen Dinge auszugeben. Es bleibt zu hoffen, dass diese Versprechungen nicht der ungeklärten Finanzierungssituation direkt wieder zum Opfer fallen. Auch droht das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche: Der Bund könnte den Länderzuschuss in der höhe der zusätzlichen Mittel herunterhandeln – das hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. Und doch: Bei allen bleibenden Fragezeichen setzt der Vertrag die richtigen Signale.
Allerdings sind es so viele Vorhaben, dass ich vor allem einen Wunsch habe – und zwar, dass diese lange Liste tatsächlich kompetent abgearbeitet wird. Offen bleibt für mich übrigens die Frage, wie sich die geplanten Reformen auf den Föderalismus auswirken. Wird die Rolle des Bundes bei den Hochschulen noch dominanter?
Wie gesagt: Das Glas ist zu zwei Dritteln voll. Für mich ein Anfang. Nicht mehr und nicht weniger.
Sebastian Horndasch arbeitet seit sieben Jahren fürs Hochschulforum Digitalisierung, aktuell in der Position des Leiters der University:Future Festivals. Er ist studierter Bildungswissenschaftler und Volkswirt.

Gastbeitrag von Florian Nuxoll
Die Schulen in Deutschland stehen aktuell vor zwei riesigen Herausforderungen. Auf der einen Seite müssen Schulen auf die Digitalisierung reagieren. Hier scheint bereits die Bereitstellung der Infrastruktur wesentlich komplizierter zu sein, als man denken würde. Weitaus komplexere Aspekte, wie zum Beispiel die Entwicklung überzeugender Unterrichtskonzepte, die Fortbildung von Lehrkräften und die Entwicklung von lehr- und lernwirksamer Software für die Kultur der Digitalität heißen die Baustellen. Auf der anderen Seite muss die Kultusministerkonferenz (KMK) dringend die Folgen der Lockdowns, der Fernunterrichtsphasen und der hybriden Lernszenarien angehen. Für beide Herausforderungen braucht es Zeit – und einen Krisenstab Bildung.
Im Frühling diesen Jahres haben die Wirtschaftswissenschaftler Anna Rohlfing-Bastian und Gunther Glenk einen Airfiltercalculator entwickelt, ein Tool zur Berechnung von Kosten für Raumluftfilter für Schulen. Mit wenigen Klicks können Schulträger sehen, welche Kosten pro Schüler/pro Jahr für verschiedene Modelle und Einsatzszenarien auf sie zukommen. In den deutschen Klassenräumen stehen aber bis heute nur selten Raumfilter. Entweder die Kultusminister scheuten die Kosten. Oder sie rechneten nicht damit, dass sich die Corona-Lage wieder verschärfen würde. Beides ist schwer verzeihlich.
Relativ früh im Verlauf der Pandemie äußerten Politiker jeder Couleur, dass offene Schule höchste Priorität hätten. In der Praxis hatten diese Äußerungen aber kaum Konsequenzen. Wenn man aber die Forderung nach geöffneten Schulen ernst genommen hätte, hätte man an anderer Stelle früher reagieren müssen. 50.000 Zuschauer beim Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach führen dazu, dass Schulen früher oder später wieder schließen müssen. Volle Restaurants und Einkaufszentren führen dazu, dass die Schulen die Schließung droht. Wenn eine Impfpflicht erst das letzte Mittel sein darf, bedeutet das, dass Schulen die Türen zumachen müssen. Es gibt (vermutlich) gute Gründe, die Zuschauer beim Fußball, die Kunden im Gastgewerbe und die Ungeimpften machen zu lassen, was sie machen wollen. Aber es hat enorme Konsequenzen für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler.
Anna Mayr griff die Idee des Leiters eines Berliner Gymnasiums auf: zwei längere Schuljahre. Das aktuelle und das folgende Schuljahr dauern dann sechs Monate länger. Damit würde das aktuelle Schuljahr bis Dezember 2022 gehen und das folgende bis zum Sommer 2023. Danach kehrt man wieder in den normalen Rhythmus zurück. Die Idee klingt nicht nur schockierend einfach, sondern sie ist es auch. Man bräuchte keine neuen Lehrkräfte, Klassenräume und so weiter.
Natürlich ist es keine Win-Win-Win Situation. Kindergärten müssten ihre Vorschüler sechs Monate länger in der Einrichtung behalten und könnten daher neue Kinder erst verzögert aufnehmen. Das würde junge Eltern treffen, die damit gerechnet haben, ihr Kinder zum Sommer 2022 in die Betreuung zu geben. Diese Eltern bräuchten Unterstützung. Dafür könnte man die eine Milliarde Euro der Aktion Rückenwind verwenden. Die sind bislang ohnehin nicht wirklich in den Schulen angekommen. Arbeitgeber müssten sechs Monate länger auf neue Schulabgänger warten. Das müsste die Bundesregierung auch abfedern.
Wir brauchen einen Krisenstab Bildung. Jetzt! Denn Lehrkräfte müssen am Anfang des zweiten Halbjahres wissen, was der Plan ist. Sie können nicht wieder am späten Freitagabend Rundmails aus den Ministerien für den Schulbetrieb am Montag bekommen. Von einem Krisenstab mit klaren Regeln versorgt, könnten Klassenlehrer zusammen mit den Fachlehrern planen, wie sie sowohl Lerndefizite, als auch soziale Defizite am besten angehen können. So können Schulen zusätzliche Projekttage oder sogar Projektmonate vorbereiten. Sie könnten gegebenenfalls Stundenpläne kürzen, damit Kinder und Jugendliche die so wichtigen Angebote von Vereinen wieder nutzen können.
Diese zwölf zusätzlichen Monate würden ebenfalls bei der zweiten oben erwähnten Herausforderung helfen, der Digitalisierung. Denn Schulen können sich nur dann nachhaltig und sinnhaft mit der Kultur der Digitalität beschäftigen, wenn sie dafür Zeit haben. Zeit für Fortbildungen, Zeit fürs Ausprobieren und Zeit für Diskussionen. Ohne diese zusätzliche Zeit werden die Schulen die nächsten Jahre damit verbringen, die durch Corona verursachten Defizite aufzuholen. Die Digitalisierung würde wieder hintangestellt.
Der Krisenstab muss besetzt sein mit Experten aus der Theorie und Praxis. Neben Bildungsforschern und Kinderpsychiatern müssen Schulleiter, Lehrkräfte und Vertreter von Vereinen sofort beginnen, eine Lösung zu finden. Damit jenen Schüler, die Schulen und Lehrer unter den Bedingungen von Corona unterrichteten, nicht lebenslang darunter leiden. #mehrZeitfürSchüler
Florian Nuxoll ist Lehrer, Autor, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Tübingen (intelligente Tutorsysteme), Fortbildner und Podcaster bei Die Doppelstunde von Westermann.
Der Monitor Lehrerbildung mahnt mehr Tempo für digitale Inhalte im Studium aufs Lehramt an. Schulen und Lehrkräfte seien noch immer nicht genügend auf Bildung und Unterricht in der digitalen Welt vorbereitet. Das kritisiert ein Bündnis von Bildungsstiftungen. Konkret hat der Monitor die Curricula der Lehramts-Studiengänge untersucht. Der Befund: Zwischen 2017 und 2020 seien nur wenige Lehrinhalte zur digitalen Medienkompetenz hinzugekommen.
Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann würde etwa das Lehramt an Gymnasien lange warten. Frühestens im Jahr 2040 würde es flächendeckend in der ersten Phase digitale Kompetenzen vermitteln, bemängelt das Bündnis. Die Folgen habe die Coronavirus-Krise gezeigt, als die Schulen häufig einfach die analoge Lehre ins Digitale verlegten. “Es braucht aber ebenso eine neue digitale Didaktik, die nun dringend flächendeckend in der Lehrerbildungsanstalt angelegt werden muss”, steht es im Monitor. Auch sechs Jahre nach der Strategie “Bildung in der digitalen Welt” der Kultusminister bleibt digitale Medienkompetenz in Lehrerbildung und Lehramt weitgehend im Wahlpflichtbereich.
Demnach war im Frühjahr 2020 die digitale Medienkompetenz zwar als ein Thema der Bildungswissenschaften an 80 Prozent der Hochschulen verankert. Doch nur ein knappes Drittel der Hochschulen machte das Digitale durch alle Fachdidaktiken hinweg zum Lehrinhalt.
Der Eindruck, dass sich wenig tue, relativiert sich allerdings beim Blick auf die Zahlen. Zwar liegen die Medienkompetenz-Angebote in den Curricula in allen Bereichen des Lehramts unter 30 Prozent. Allerdings ist die Steigerung deutlich zu erkennen. Verdoppelt haben sich von 2017 auf 2020 die digitalen Inhalte für die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufen 2 – in der Sonderpädagogik sogar verdreifacht.
Der Monitor Lehrerbildung ist ein Projekt des Centrums für Hochschulentwicklung mit dem Stifterverband und den Stiftungen Bertelsmann und Robert Bosch. Sie vereint die Sorge, dass die Förderprogramme von Bund und Ländern bei der digitalen Bildung einseitig die Infrastruktur im Blick haben. Gute digitale Bildung mache aber aus, dass “die Lehrkräfte so gut qualifiziert sind, dass sie die jetzigen und zukünftigen Herausforderungen, die die Digitalisierung an ihre Lehrtätigkeit stellt, meistern und die sich daraus ergebenden Chancen nutzen können.” Christine Keilholz

Deutschland hat in der Coronavirus-Pandemie im internationalen Vergleich mit einer (zu) langen Schulschließung agiert. Das geht aus einem Vergleich von sieben europäischen Staaten hervor, den das Münchener Ifo-Institut vornahm. “Andere Länder in Europa legten größeren Wert darauf, die Schulen weitgehend offen zu halten“, sagte ifo-Forscherin Larissa Zierow. “Gleichzeitig waren die anderen Länder für digitalen Fernunterricht besser gerüstet.” Deutschlands Schulen waren 183 Tage lang ganz oder teilweise zu. Nur die Schulen in Polen waren mit insgesamt 273 Tagen länger geschlossen. Im Mittelfeld des Ländervergleichs liegen Österreich und die Niederlande (152 bzw. 134 Tage), während Frankreich, Spanien und Schweden mit je 56, 45 und 31 Tagen die kürzesten Schulschließungen verzeichnet hätten. Die entstandenen Lernrückstände seien gerade für Leistungsschwächere besonders hoch gewesen, nehmen die Forscher:innen an.
Diese Schlußfolgerung wird allerdings nicht empirisch durch Kompetenzmessungen unterlegt. Das ifo-Institut hat eigene Messungen mit Hilfe von Vergleichsarbeiten nicht vorgenommen. Die Forscher arbeiten hier mit einer Studie ihres ifo-Kollegen Ludger Woessmann, der die Lernzeit während der Pandemie durch Elternbefragungen in Erfahrung brachte. “In Ermangelung nationaler Schülerleistungstests bieten Einschätzungen der Lernzeitveränderung eine Annäherung an die Kompetenzentwicklung deutscher Schüler:innen,” heißt es in der Studie. Die Lernzeit von Schulkindern in Deutschland habe sich während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 von 7,4 auf 3,6 Stunden pro Tag halbiert. Diese Erhebung – ebenfalls des ifo-Institutes – wurde vor allem von Lehrern infrage gestellt. Fragwürdig sind auch die Zahlen für den Distanzunterricht, die das ifo-Institut verwendet. Es arbeitet mit Quoten von Lernmanagementsystemen, die aus dem Jahr 2018 stammen.
Interessant ist die Studie des Ifo-Instituts besonders im Hinblick auf die Methoden der Lockdowns. Deutschland auf der einen sowie Spanien und Frankreich auf der anderen Seite wendeten ganz unterschiedliche Formen an. Während in Deutschland die Schulschließung Priorität hatte, “bestand für die erwachsene Bevölkerung während der Pandemie größtenteils keine Verpflichtung, bei realisierbarem Homeoffice von zu Hause aus zu arbeiten.” Ganz anders agierten Frankreich und Spanien. Sie öffneten – trotz extrem hoher Todeszahlen in der Bevökerung – die Schulen relativ schnell wieder, legten aber gleichzeitig das öffentliche Leben und Arbeiten der Erwachsenen lahm. Für sie “wurden aber mehrere harte Lockdowns mit strengen Ausgangssperren und Bestimmungen, sich nicht über einen sehr engen Radius vom eigenen Wohnort zu entfernen, vollzogen”, schreiben Larissa Zierow und ihre Kolleg:innen. “Zusätzlich bestand ab Oktober 2020 für alle Arbeitnehmer:innen in Homeoffice-fähigen Berufen eine Pflicht, von zu Hause aus zu arbeiten.” cif
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürokratie und Ungleichheit in der Bildung kritisiert. Beim 10. Deutschen Schulleiter-Kongress in Düsseldorf sagte er: “Wir erleben, dass gerade diejenigen Schülerinnen und Schüler, die aus armen oder bildungsfernen Familien stammen, in der Krise noch weiter zurückfallen.” Ausgerechnet Schulen, die in sogenannten sozialen Brennpunkten liegen, “sind oft am schlechtesten auf die vierte Welle vorbereitet.” Steinmeier forderte weniger Bürokratie bei der Digitalisierung der deutschen Schulen. “Ich habe den Verdacht, dass wir uns mit der Umsetzung deshalb so schwertun, weil uns häufig der Mut fehlt”, so der Präsident, “die Schulen einfach mal machen zu lassen!”
Die Schulleiter seien enorm wichtig, betonte Steinmeier. Er war wegen der Coronalage nicht selbst nach Düsseldorf gekommen, sondern verlas eine Videobotschaft. In den Schulen entscheide sich, “ob gute Bildung ganz praktisch gelingt“. Er lobte das Innovationsvermögen all derer, die aus “der Not eine Tugend” gemacht, und digitales Lernen vorangebracht hätten. Er stellte heraus, dass es bei Digitalisierung nicht nur um finanzielle Mittel gehe: “Wir brauchen Geld, ja, aber wir brauchen keine goldenen Zügel, die jeden Euro mit zwei Dutzend Vorschriften und haufenweise Formularen verknüpfen.” Stattdessen bräuchte es “pragmatische, bewegliche und unbürokratische Lösungen – und das gilt ganz besonders mit Blick auf die Digitalisierung!”
Steinmeier bedauerte, dass “Schulleiterstellen an vielen Orten unseres Landes für lange Zeit unbesetzt bleiben, weil es an Bewerbern fehlt”. Jeder fünfte Direktor denke darüber nach, “an eine andere Schule zu wechseln, in die Bildungsverwaltung abzuwandern oder den Beruf sogar ganz an den Nagel zu hängen.” Gerade, weil Schulleiterinnen und Schulleiter eine so wichtige Rolle spielten, muss sich etwas ändern. Es brauche mehr Wertschätzung und eine bessere Vorbereitung auf den Beruf.
Die Pandemie führe vor Augen, “wie stark der Bildungserfolg in unserem Land immer noch von Herkunft und dem Geldbeutel der Eltern abhängt.” Angesichts von Coronazahlen auf einem Allzeithoch mahnte der Präsident Solidarität mit denen an, die in dieser Pandemie lange auf andere Rücksicht genommen hätten: Kinder und Jugendliche. Laut Steinmeier hätten viele dieser jungen Leute bis heute mit den Folgen von “Isolation und Einsamkeit” zu kämpfen. Sie litten darunter. Er rief die Menschen dazu auf, sich auch ohne rechtlichen Zwang verantwortungsbewusst zu verhalten. Der Bundespräsident definiert Verantwortungsbewusstsein in Zeiten von Corona so: sich impfen lassen und Kontakte einschränken. Robert Saar

Bettina Stark-Watzinger soll sie also heißen, die neue Bildungsministerin für Deutschland. Und das kann man eine Woche nach der Bekanntgabe über die Verteilung der Ministerposten festhalten: Die Personalie der liberalen Bettina Stark-Watzinger wurde von vielen mit großer Zustimmung wahrgenommen. Oder löste zumindest keine Abwehrreaktionen hervor.
Natürlich liegt das auch daran, dass Stark-Watzinger als unbeschriebenes Blatt gilt. Außerhalb der FDP. Innerhalb ihrer Partei wird sie geschätzt, gemocht und vor allem: Ihr wird das Amt der Bildungsministerin zugetraut. Die Eckdaten haben sich schnell herumgesprochen. Hessin, Landes-Generalsekretärin in ihrem Bundesland, seit 2017 Abgeordnete im Bundestag, 2020 Aufstieg ins Bundes-Parteipräsidium und parlamentarische Geschäftsführerin im Bundestag, seit 2021 Chefin der hessischen FDP.
Parteiarbeit kann sie also, aber nicht nur das: Sie ist Diplom-Volkswirtin und hat neun Jahre lang als kaufmännische Geschäftsführerin am LOEWE-Zentrum (später Leipniz-Institut) an der Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main gearbeitet, einer Exzellenzinitiative, finanziert vom Land Hessen. Sie ist eine, die eine Familienauszeit nimmt und gleichzeitig in London ein Psychologie-Studium absolviert.
Es wirkt, als hätte die FDP schon länger auf das Bildungsressort geschielt und Stark-Watzinger früh den Finger gehoben. In einem Interview mit der Hessenschau vor der Bundestagswahl ließ sie durchblicken, dass sie Lust hätte, nicht nur als Parlamentarierin zu gestalten. Im August schrieb sie einen Gastbeitrag in der “Welt” über ihre bildungspolitischen Forderungen. Und fragte man an der FDP-Basis nach, vor allem bei den Karliczek-kritischen Jüngeren, tauchte immer wieder der Name Stark-Watzinger als Traumkandidatin für das Bildungs- und Wissenschaftsministerium auf. Zuletzt war sie im Haushaltsausschuss für den Etat Bundesbildungs- und Forschungsministeriums zuständig. Auf den zweiten Blick wirkt ihre Besetzung alles andere als eine Überraschung.
Wofür steht sie also? Und wie digital wird ihre Bildungspolitik? Sie will das Bauchschmerzen-Thema Digitalpakt angehen. Denn obwohl viel Geld für die Schulen vom Bund zur Verfügung steht, sind aus dem ersten Topf immer noch längst nicht alle Mittel abgeflossen. Warum? Diese Frage hat Stark-Watzinger schon im Haushaltsausschuss gestellt, deshalb ist zu erwarten, dass sie den ersten und den nächsten Digitalpakt entbürokratisieren will. Zudem, so heißt es im Koalitionsvertrag, sollen extra eingerichtete Digitalpaktstellen vor Ort, die Schulleitungen beim Ausfüllen der Anträge unterstützen.
In ihrem Weltartikel sprach sie sich zudem für digitale Endgeräte für alle Kinder aus. Digitales Lernen müsse Priorität haben, schreibt Stark-Watzinger. Auch den Koalitionsvertrag kann man dahingehend interpretieren. Darin sind “digitale Lernmittelfreiheit für bedürftige Schülerinnen und Schüler” vorgesehen.
In ihrem ersten Tweet, nachdem bekannt wurde, dass sie das Bildungsministerium künftig leiten soll, spricht sich Bettina Stark-Watzinger zudem für “Talentschulen” aus, nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalen. Das Unterstützungsprogramme stellt für Brennpunktschulen mehr Personal für dienSchulentwicklung bereit. Vielleicht könnte Stark-Watzinger diesen “Talentschulen” auch beim Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur helfen. Bisher liegt da die Zuständigkeit bei den Schulträgern.
Dabei es könnte gut sein, dass sich die Zuständigkeiten generell unter einem FDP-geführten Bildungsministerium verschieben. Die Liberalen wollen schon lange das Kooperationsverbot abschaffen, die neue Regierung will zumindest ein “Kooperationsgebot” einführen. Ob und wie sie das überhaupt gestalten kann, werden die kommenden vier Jahre zeigen. Es verspricht zumindest, dass bei Problemen, die Schuldigen nicht immer die anderen sind.
Und ganz nach liberaler Façon will Stark-Watzinger die Exzelleninitiativen ausbauen, und zwar für den Nachwuchs in den Ausbildungsberufen. Dass die Auszubildenden vor allem finanziell besser abgesichert werden, ist schon lange überfällig. Aber ob Bestenförderung die Bildungsgerechtigkeit im Land vorantreibt?
Eine abschließende Beobachtung: Sie hat offenbar jetzt schon einen besseren Eindruck hinterlassen, als Anja Karliczek (CDU) in ihrer gesamten Ministerzeit. Das liegt nicht nur an der bald ehemaligen Ministerin selbst, sondern auch die Hoffnungen, die mit der neuen Regierung verbunden sind. Hoffnungen, auf einen echten Wandel.
Nicht weniger als eine “Bildungsrevolution” für Deutschland will Bettina Stark-Watzinger. Das Bildungssystem hätte es nötig. Sie steht für einen Aufbruch und ihre Art und ihr Ruf verspricht eine Ministerin, die anpackt. Nun liegt es an ihr, diesen Aufbruch zu gestalten.
Dass ich mit der LernApp bei den Schülern verschiedene Kanäle anspreche: den auditiven, indem sie etwas anhören, oder den visuellen, weil es ein Modell oder eine Illustration gibt oder sie ein Video ansehen können. Jeder Schüler kann ein Video in der für ihn idealen Geschwindigkeit verfolgen, er kann es doppelt gucken oder sich nur Ausschnitte ansehen. Ein Lehrer lässt sich halt extrem schlecht zurückspulen.
Die Low Budget-Version wäre ein Beamer an der Wand, jeder Schüler besitzt ein Smartphone, und die Schule hat WLAN. Besser wäre es natürlich, wenn es eine interaktive Tafel gäbe und einen Klassensatz an Tablets.
Ja, natürlich. Als Beispiel nenne ich in der Chemie die Elektronenkonfiguration, das ist ein relativ komplexes Thema. Dazu gibt es bei Simpleclub ein sehr gutes Video, das mit Farben animiert genau zeigt, welches Teilchen wo andockt. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Es war das erste Video, das ich im Unterricht benutzt habe – die Schüler sind inzwischen schon drei oder vier Jahre aus der Schule. Ich hab den Schülern damals den Link gegeben und ihnen 45 Minuten Zeit gelassen, sich das Thema selbst zu erarbeiten. Jeder in seinem Tempo. Wer schneller fertig war, hatte Freizeit. Im zweiten Teil der Stunde trafen wir uns im Laborraum und haben das dann besprochen. Das ging oft sehr individuell, weil man bei diesem Prinzip des sogenannten “flipped classroom” viel näher an die Lernentwicklung des einzelnen Schülers herankommt.
Mit der Lernapp werden die Möglichkeiten noch einmal deutlich größer als allein mit Videos. Wir haben das gerade in der Klasse gesehen. Mit dem animierten Modell eines Hochofens lässt sich Eisenschmelze viel leichter erklären. Ich kann als Lehrerin einzelne Aspekte zuschalten, also die Zonen des Hochofens, die Temperatur oder bestimmte Reaktionen ablaufen lassen. Natürlich gibt es Illustrationen eines Hochofens auch in Schulbüchern, aber das ist dann statisch, da lässt sich keine Reaktion beobachten. Oft gibt es für Schulbücher multimediale Ergänzungen, aber da müsste ich für jedes Lehrbuch extra eine Lizenz kaufen.
In der LernApp habe ich alles auf einmal, und zwar für alle Fächer. Gerade in Biologie und Chemie läuft so viel auf Teilchenebene, da bieten digitale Medien eine große Chance. Das gibt es in 3D, die Schüler:innen können vor- und zurückspulen, die Visualisierungen sind sehr einfach zu erzeugen. Ich nenne Simpleclub gerne die Einstiegsdroge zum Lernen. Ich finde das gerade für Schüler in verschiedenen Entwicklungsphasen sehr gut. Mancher würde ja zu Hause nie ein Buch aufschlagen. Ich benutze im Unterricht aber nicht allein die App. Ich hab immer ein Buch dabei, ich verteile Arbeitsblätter, ich setze Videos ein und bringe oft eine eigene Präsentation mit. Vor allem bringe ich mich als Person mit. Gerade in der Pandemie hat man gelernt: das wichtigste, das Schule bietet, ist die persönliche Beziehung.
Meine Kritik wäre, dass man mit den Lernmodellen wie der App von Simpleclub den Schülern oft etwas zu sehr entgegenkommt. Lesekompetenz ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Die brauche ich bei Erklärvideos aber kaum noch. Meine Erfahrung gerade in der Corona-Zeit war die, dass die Schüler:innen sehr gute Texte bekommen hatten, aus denen sie aber recht wenig mitgenommen hatten. Die erzählten mir hinterher dann irgendeinen Schmuh, und ich sagte oft: “Mensch, das stand doch alles ganz genau in dem Text drin”. Ich beobachte öfter bei Schülern, dass sie einen Text lesen, aber die wichtigen Informationen gar nicht herausziehen. Lernapps mit Videos und Illustrationen und so weiter sind eine richtig gute Lernhilfe – aber sie fördern die Lesekompetenz oft nicht, sondern sie umgehen sie bloß. Wichtig in meinen Augen: Viele Kollegen haben Angst, dass sie durch Lernapps überflüssig werden. Diese Angst kann ich nicht nachvollziehen. Das wichtigste Medium beim Lernen bleibt die Person des Lehrers.
Maria Kammerer unterrichtet Biologie und Chemie an der Don-Bosco-Schule in Rostock und ist dort die Digitalisierungsbeauftragte.
als Anja Karliczek ins Amt der Bildungsministerin des Bundes kam, grämte sich die Bildungs- und Wissenschaftsszene in Deutschland lange. Die CDU-Parlamentsmanagerin musste erst beweisen, dass sie sich für das komplexe Ressort erwärmen kann. Ich habe sie übrigens in Interviews immer mit großem Enthusiasmus erlebt. Geht das mit Bettina Stark-Watzinger jetzt genauso? Vordergründig hatte die FDP-Frau aus Hessen noch nicht viel mit Bildung zu tun. Aber Vorsicht, Sofie Czilwik zeigt uns, wo sich die Kauffrau und Psychologin sehr gut auskennt. Die Leute im Ministerium sollten sich warm anziehen.
Da fahren zwei Züge aufeinander zu: Von der einen Seite kommt die Ampelkoalition und ihr Wunsch, dass Schulen endlich Positivlisten erhalten. Und von der anderen Seite rollen die Landesdatenschützer heran. Einer von ihnen empfindet es tatsächlich als Machtmissbrauch, wenn man Schulen hilft, datenschutzkonforme Apps, Tools und Lernwolken zu finden. Das ist ein starkes Stück – und eine schöne Herausforderung für Rot-Grün-Gelb. Bald können die neuen Regierenden zeigen, wie ernst es ihnen damit ist, dass die vielen Digital-Milliarden nicht weiter durch offene Datenschutzfragen gebremst werden. Aber lesen Sie selbst, mit welchen Girlanden die Landesdatenschutzbehörden ihre Indolenz begründen.
Bleiben Sie gesund!

Die Haltung von Jens Brandenburg ist eindeutig: “Wir dürfen die Lehrerinnen und Lehrer beim Datenschutz nicht länger in einer juristischen Grauzone hängen lassen,” sagte der Verhandlungsführer “Bildung” der FDP bei den Gesprächen der Koalition. Auch der SPD-Vorsitzende Baden-Württembergs, Andreas Stoch, der die Delegation der Sozialdemokraten anführte, nannte die sogenannte Whitelist ein prioritäres Ziel der kommenden Bundesregierung. Und Lasse Petersdotter, der grüne Digitalisierungsexperte aus Schleswig-Holstein forderte gegenüber Bildung.Table: “Wir dürfen die Schulleiter:innen nicht dabei alleine lassen, die Datenschutzkonformität digitaler Angebote abwägen zu müssen.” Eine Positivliste solle ihnen Orientierung bei der Nutzung digitaler Tools geben, findet die neue Koalition.
Auf einer solchen Liste können sich Schulträger und Schulleiter unkompliziert über “datenschutzkonforme, digitale Lehr- und Lernmittel” informieren. So steht es im Koalitionsvertrag. Die Liste soll “gemeinsam mit den Ländern” entstehen. Aber genau dort herrscht eine ambivalente Haltung gegenüber der von der Ampel-Koalition geplanten Positivliste. Eine Umfrage unter den Landes-Datenschutzbehörden von Bildung.Table zeigt: Viele Datenschützer preisen die Liste – sehen sich aber außerstande, sie zu erstellen. Einige Datenschützer lehnen sie ab. Sachsens Datenschutzsprecher sagte, man könne eine Positivliste als “Missbrauch einer Machtposition begreifen.”
Unklare, sich zum Teil widersprechende Aussagen zum Datenschutz sind ein wesentliches Hindernis bei der Digitalisierung von Schulen. Lehrer, Schulleiter wie auch Experten fordern seit langem, dass sie belastbare Auskünfte über die Zulässigkeit in der Nutzung von Endgeräten, Schulclouds oder Apps bekommen – idealerweise durch die Landesdatenschützer.
Die finden zwar reihum, dass solche Auskünfte für die Schulen und den Prozess der Digitalisierung wichtig wären. “Der Aufbau eines derartigen, bundesweit abrufbaren Registers ist für Lehrkräfte und Schulleitungen sinnvoll und wünschenswert“, sagte die Sprecherin des hessischen Datenschutzbeauftragten (HBDI). Die Sprecherin des Datenschutzbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern, Antje Kaiser, äußerte sich positiv: “Diese Listen hätte es schon vor zehn Jahren geben sollen.” Auch Saarlands Datenschützerin Monika Grethel finde eine Positivliste “geprüfter Apps für den Schulunterricht sinnvoll. Dies würde für einen rechtskonformen Einsatz der Apps im Unterricht sowie Rechtssicherheit für die Lehrkräfte, Schüler:innen und Eltern sorgen.”
Warum aber gibt es dann eine solche Liste dann nicht? Weil sich die Datenschützer nicht in der Lage sehen, der Flut von digitalen Anwendungen für Schulen Herr zu werden. Eine solche Liste gebe es im Norden nicht, sagte Antje Kaiser, “weil wir keine Kapazitäten dafür haben”. Ähnlich Hessen: Für eine Liste würden die personellen Kapazitäten nicht ausreichen. Nur “in ganz besonderen Ausnahmefällen kommt es vor, dass sich der HBDI zu Produkten im Einzelfall äußert.” Selbst den Datenschutzbeauftragten der großen Länder NRW, Bayern und Baden-Württemberg fehle die Manpower. Die technische Prüfung von digitalen Lernprodukten sei relativ aufwendig, ließ Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink mitteilen. “Daher ist eine vollständige Prüfung nicht ohne Weiteres zu leisten.”
Hier zeigt sich ein Phänomen der Selbstüberforderung: Die Landesdatenschützer wollen unter einer Liste eine rechtssichere, topaktuelle und den gesamten Markt abdeckende Übersicht verstehen. Eine solche Alles-Liste wird es selbstverständlich nicht geben. Das hat auch kein Schulleiter verlangt. Aber zwischen alles und nichts gibt es Zwischenstationen. Selbst die unvollständigen Listen aus Berlin und Thüringen finden bei Schulleitern reißenden Absatz – und hielten gegen die Billion-Dollar-Player Google und Microsoft stand. Auch in der Arbeitsgruppe der Koalition herrscht offenbar eine pragmatische Haltung, wie perfekt eine Liste sein solle.
Der Grüne Petersdotter etwa sagte Bildung.Table: “Es könnte vielleicht ein gutes und einfaches Verfahren sein, wenn beim Datenschutzbeauftragten des Bundes eine Liste datenschutzkonformer Angebote angelegt ist, die von den Landesdatenschutzbeauftragten der Länder jeweils aktualisiert wird.” Die Landesdatenschützer freilich lehnten diese Variante zum Teil brüsk ab. Daher empfahl FDP-Verhandlungsführer Jens Brandenburg, “wichtig ist, dass es funktioniert. Es wäre falsch gewesen, sich in der Koalition vorschnell auf eine Option festzulegen.” Brandenburg ließ offen, ob eine Positivliste durch gegenseitige Anerkennungen, eine zentrale Stelle oder die Federführung einzelner Bundesländer zustande kommt. “Wir brauchen möglichst pragmatische und schnelle Lösungen für die Schulen.”
Strenggenommen existiert bereits eine Reihe von Lösungen, schnell und pragmatisch ist allerdings keine von ihnen. Zum einen der von den Bundesländern angestoßene “eduCheck digital“, ein Projekt, das didaktische, urheberrechtliche und datenschutzrechtliche Empfehlungen verknüpfen soll. Allerdings startete das Projekt erst im September. Ob und wie die Datenschutzbehörden dort mitwirken, steht in den Sternen. Zum anderen gibt es ein vom Bund angestoßenes Zertifizierungsverfahren, das am Karlsruher Institut für Technologie entstehen soll. Das Data Protection Certification for Educational Information Systems (“DIRECTIONS“) soll zu einer Datenschutzzertifizierung für schulische Informationssysteme führen. Das Projekt startet heute, es soll 2027 abgeschlossen sein. Von der jetzigen Schülergeneration profitieren also bestenfalls noch die Erst- bis Sechstklässler.
Obwohl (oder weil?) die Listen von Bund und Ländern Schulen erst in Jahren verlässliche Auskünfte liefern, beriefen sich die Datenschützer darauf – negativ. Der Sprecher von Saarlands Datenschützerin Grethel erteilte der Mitarbeit bei “eduCheck digital” eine Absage: “Eine Beteiligung unserer Dienststelle wäre schon mangels personeller Ressourcen nicht möglich.”
Zur Zertifizierung äußerte sich die Datenschutzbeauftragte Schleswig-Holstein, Marit Hansen, die den gleichnamigen Ausschuss der Datenschutzkonferenz leitet. Hansen befürwortet die DSGVO-Zertifizierung von Verarbeitungen im schulischen Bereich. “Ich rechne aber damit, dass es noch etwas dauert, bis die ersten Zertifikate da sein werden.”
Keine der Lösungen kommt in seiner Verfügbarkeit bisher an die Liste heran, die Lutz Hasse auflegte, der Datenschutzbeauftragte Thüringens. In Rundmails an die Schulleiter:innen seines Bundeslandes informierte Hasse – wie berichtet – über die Datenschutzkonformität von Apps und Schulclouds. Bei Lehrern und Schulleitern bekam die Positivliste stürmischen Beifall – unter den Landesdatenschützern wurde die Nase gerümpft. Ein Sprecher der Landesdatenschutzbehörde Sachsen-Anhalts bezweifelte im Gespräch mit Bildung.Table, ob man die Rundschreiben “überhaupt als Liste bezeichnen kann“. Nordrhein-Westfalens Datenschutzbeauftragte Bettina Gayk nannte die “Beteiligung an einer Black- bzw. Whitelist digitaler Angebote für Schulen derzeit nicht für zielführend.” Wie ließe sich eine solche Blockadehaltung überwinden?
Die Verhandler der Koalition in Berlin hoffen für die Aufstellung einer Positivliste auf jenen guten Geist, der in ihren Gesprächen geherrscht habe. Andreas Stoch, SPD-Chefunterhändler sagte, der Druck der Öffentlichkeit auf schnelle Antworten werde helfen. Seine Kollegen Petersdotter und Brandenburg meinten fast gleichlautend, ohne die Länder gehe nichts. “Eine Positivliste kann nur funktionieren, wenn wir uns mit den Ländern auf einem gemeinsamen Prozess verabreden“, zeigte sich Jens Brandenburg überzeugt.
Vielleicht sollte man sich da nicht zu große Hoffnungen machen. Denn der Wind ist bitterkalt, der in der Koalition der Unwilligen in den Ländern weht. “Auch ordnungspolitisch wäre es zu hinterfragen, sofern ‘Vater Staat‘ in dem von Ihnen fokussierten Bereich Produktempfehlungen wie ‘geht’, ‘geht so’ oder ‘geht gar nicht’ herausgäbe”, schrieb Sachsens Datenschutzsprecher Andreas Schneider über eine nützliche Positivliste. “Wo soll die Verdrängung von Eigenverantwortung noch hinführen? Empfiehlt der Bürgermeister in seinem Gemeindegebiet demnächst über eine Liste den Einwohnern Backstuben, die gesundes Brot anbieten?”

Herr Karlitschek, Sie haben gegen Microsoft eine Kartellbeschwerde erhoben. Wegen einer marktbeherrschenden Stellung auch in Deutschland. In welchen Bereichen sehen Sie diese marktverzerrende Position?
Unsere Kartellbeschwerde ist für alle Branchen und Bereiche wichtig. Microsoft nimmt nach und nach alle Software-Produkte, die man selbst betreiben kann, vom Markt und setzt voll auf Cloud-Anwendungen. Daher stehen alle Microsoft-Kunden jetzt unter Druck, zu Microsoft Cloud-Produkten zu migrieren. Oder sie setzen auf datenschutzfreundlichere Produkte.
An den Schulen sind Lernmanagementsysteme wie Moodle und wahrscheinlich sogar itslearning und IServ weiter verbreitet als Microsoft.
Wir haben ja in Deutschland, insbesondere im Bildungsbereich, einen Digitalisierungs-Stau. Daher ist der Druck hier um so höher, den Datenschutz zu ignorieren – und alle Daten von Schülern und Lehrer in die Microsoft-Cloud zu laden. Das wäre aus meiner Sicht ein sehr großer Fehler. Mit dieser Kartellbeschwerde versuchen wir Microsoft zu zwingen, allen Kunden datenschutzfreundliche Alternativen aufzuzeigen.
Hat Microsoft im Schulbereich nicht gerade eine empfindliche Niederlage einstecken müssen? Der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat erhebliche Bedenken gegen die Anwendung von MS 365 an Schulen. Wo kommt da die Marktbeherrschung her?
Ich freue mich sehr darüber, dass mehr und mehr Organisationen und Datenschutzbeauftragte das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ernst nehmen und erkennen, dass Microsoft Cloud Produkte nicht DSGVO-konform sind. Der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat hier berechtigte Bedenken vorgetragen. Allerdings ist das momentan leider noch die Ausnahme. Viele Organisationen und Schulen versuchen, momentan noch, die DSGVO einfach zu ignorieren und hoffen, dass es gut geht. Das ist aber – meiner Meinung nach – keine langfristig gute Strategie.
An den Berufsschulen ist Microsoft dominierend vertreten. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das an diesen Schulen eingespielte System durch andere Lösungen zu ersetzen?
Es ist wichtig, endlich in die Digitalisierung und Modernisierung unserer Schulen zu investieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bildung in Deutschland die höchste Priorität genießt. Sonst riskieren wir, dass Deutschland seine Rolle als führende Industrienation einbüßt. Ein Teil dieser neuen Investitionen sollte sicherlich in Infrastruktur wie zum Beispiel Lernmanagement- und Cloud-Systeme fließen.
Wie gehen Sie eigentlich mit der großen Fan-Lobby von Microsoft um? Sowohl unter Lehrern als auch unter Politikern gibt es MS-Anhänger.
Wir als sehr kleiner Software-Anbieter haben natürlich nicht die Lobby- und Marketingbudgets, um es mit Microsoft aufzunehmen. Da ich persönlich aber ein unverbesserlicher Optimist bin, hoffe ich, dass sich am Ende des Tages die Fakten durchsetzen. Die Tatsache, dass der EuGH geurteilt hat, dass amerikanische Cloud-Anwendungen nicht DSGVO-kompatibel sind, lässt sich auch mit der größten Lobbyisten-Armee nicht wegdiskutieren.

Von Sebastian Horndasch
Manchmal lohnt sich der Blick zurück. Legt man den Koalitionsvertrag der GroKo zum Thema Hochschulen aus dem Jahr 2018 neben den der Ampel, zeigt sich: damals dominierte vielerorts eine wohlklingende Politlyrik mit wenig Substanz. Heute findet sich kaum ein Absatz mehr ohne konkrete politische Festlegungen. Das ist bürgerfreundlich, das erleichtert die Exegese des Papiers.
Das vermutlich wichtigste Versprechen im Koalitionsvertrag der Ampel mit Blick auf mein Arbeitsfeld: es gibt mehr Geld für Hochschulen. “Wir werden den ‘Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken‘ ab 2022 analog zum Pakt für Forschung und Innovation dynamisieren.” Konkret sollte das heißen: Jedes Jahr drei Prozent mehr Mittel. Denn das ist der fest geschriebene jährliche Aufwuchs für außeruniversitären Forschungseinrichtungen bis 2030. Das ist ordentlich und schafft Planungssicherheit.
Auch ein neues Förderprogramm ist geplant: “Mit einem Bundesprogramm ‘Digitale Hochschule‘ fördern wir in der Breite Konzepte für den Ausbau innovativer Lehre, Qualifizierungsmaßnahmen, digitale Infrastrukturen und Cybersicherheit.” Quasi der Digitalpakt Hochschule, den Anja Karliczek verweigert hatte. Es wird nicht nur auf Hardware gesetzt, sondern auch auf Konzepte und Qualifizierung. Das freut mich sehr; die Community des Hochschulforums Digitalisierung hatte auch lange genug darauf gepocht. Wobei: In einer idealen Welt wäre das eine Selbstverständlichkeit. In der realen Welt ist es eine positive Erwähnung wert.
Die neu eingerichtete Stiftung Innovation in der Hochschullehre soll “insbesondere im Bereich digitaler Lehre” weiterentwickelt werden. Nun war digitale Lehre dort bereits das Top-Thema der ersten großen Ausschreibung. Bedeutet das also noch stärkeren Fokus aufs Digitale? Mehr Geld? Oder mehr Personal? Mehr Aufgaben? Hier bleibt das Papier vage. Definitiv jedes Jahr mehr Geld gibt es jedenfalls für die Akademien der Wissenschaften, den Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH). Das passt in die allgemeine Logik der berechenbaren Budgetsteigerungen. Und Berechenbarkeit ist gut.
Auch dicke Bretter verspricht die Koalition zu bohren. So will die Ampel eine “Weiterentwicklung des Kapazitätsrechts” umsetzen, unter anderem, um digitale Lehre fairer abbilden zu können. Eine große Aufgabe; hier herrscht seit Jahrzehnten Stillstand. Wie sie es allerdings machen wollen, sagen die Koalitionäre nicht.
Es soll die eine “Deutsche Agentur für Transfer und Innovation” gegründet werden, die die Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen sowie kleinen und mittleren Universitäten mit Unternehmen und öffentlichen Organisationen fördern soll. Aus meiner Sicht ist das klar positiv – aber abhängig von der konkreten Ausgestaltung. Setzt man die falschen Anreize, droht eine ungerechtfertigte Einflussnahme privater Akteure auf öffentliche Hochschulen.
Daneben reagiert die Ampel auf die #IchbinHanna-Debatte und verspricht eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die Planbarkeit und Verbindlichkeit für Post-Docs erhöhen soll. Gutes Ziel – man hat diese Absicht allerdings auch schon in der Vergangenheit gehört. Und in Berlin sehen wir gerade, wie gute Absichten bei der Befristung nach hinten losgehen können. Nötig ist ein guter Mittelweg – und vor allem die breite Einführung einer professionellen Personalentwicklung an Hochschulen.
Ein großes Problem an Hochschulen ist die Software. Lokal an Hochschulen entwickelte Lösungen sind oft umständlich in der Nutzung. Lösungen internationaler Großunternehmen funktionieren gut, sind aber datenschutzrechtlich problematisch. Was es braucht: Öffentlich geförderte hochschulübergreifende IT-Zusammenarbeit – mit Ergebnissen, die open source veröffentlicht werden. Die Koalition verspricht nun “IT-Verfahren nach dem Einer-für-alle-Prinzip (EfA)”, eine “Cloud der öffentlichen Verwaltung” sowie open source als allgemeine Regel. Das klingt sehr gut; allerdings betrifft dieses Versprechen im Koalitionsvertrag vor allem die Verwaltung, aber nicht die Lehre der Hochschulen. Für mich ist es eindeutig, dass es auch für Hochschulen gelten muss. Denn dies wäre mittelfristig ein gigantischer Schritt hin zu mehr digitaler Souveränität in der Hochschulbildung.
Wer sich schon länger mit Bildungspolitik beschäftigt, dem werden einige Formulierungen bekannt vorkommen. Gleich mehrere Zusagen von 2018 haben es wieder in den Koalitionsvertrag geschafft.
So möchte die neue Bundesregierung für die wissenschaftliche Weiterbildung “die Einführung von Micro-Degrees prüfen”. Ein unterstützenswertes Ziel, doch etwas ähnliches wollte man bereits 2018. Da hieß es, Nano-Degrees sollten “(auch im Rahmen von Weiterbildungsstudienangeboten) an staatlichen Hochschulen erworben werden können”. 2021 nutzt man nicht mehr den urheberrechtlich durch Udacity geschützten Titel des “Nano-Degrees”, was von Kenntnis der Materie zeugt. Das Ziel bleibt gleich – und richtig! Denn mehr Flexibilität bei den Hochschulabschlüssen wäre für alle Beteiligten hilfreich.
Ebenfalls 2018 versprach man die Erarbeitung einer “umfassenden Open Educational Resources-Strategie“. Daraus ist bekanntermaßen wenig geworden. Nun heißt es zum Thema: “Wir werden gemeinsam mit den Ländern digitale Programmstrukturen und Plattformen für Open Educational Resources (OER), die Entwicklung intelligenter, auch lizenzfreier Lehr- und Lernsoftware … unterstützen”. Das klingt weniger vollmundig und hat vielleicht gerade dadurch mehr Aussicht auf Erfolg.
2018 versprach die GroKo, man würde die Regelungen im Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz “umfassend evaluieren”. Das ist nicht passiert. In der kommenden Legislatur will man sich nun für ein “wissenschaftsfreundlicheres Urheberrecht” einsetzen. Ähnliche Schlagrichtung, in der Zielsetzung aber positiver – was Hoffnung macht.
Was hätte im Koalitionsvertrag für die Hochschulen realistischerweise stehen können? Bei Open Educational Resources war die GroKo als Tiger gesprungen (“umfassende Strategie”) und als Bettvorleger gelandet. Dass die jetzigen Aussagen zum Thema weniger vollmundig sind, kann man als Realismus loben – oder als Mutlosigkeit kritisieren. Gewünscht hätte ich mir persönlich mehr.
Meinen Optimismus zusätzlich gesteigert hätten konkrete Zahlen zur Finanzierung. Der Koalitionsvertrag verspricht, mehr Geld für die richtigen Dinge auszugeben. Es bleibt zu hoffen, dass diese Versprechungen nicht der ungeklärten Finanzierungssituation direkt wieder zum Opfer fallen. Auch droht das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche: Der Bund könnte den Länderzuschuss in der höhe der zusätzlichen Mittel herunterhandeln – das hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. Und doch: Bei allen bleibenden Fragezeichen setzt der Vertrag die richtigen Signale.
Allerdings sind es so viele Vorhaben, dass ich vor allem einen Wunsch habe – und zwar, dass diese lange Liste tatsächlich kompetent abgearbeitet wird. Offen bleibt für mich übrigens die Frage, wie sich die geplanten Reformen auf den Föderalismus auswirken. Wird die Rolle des Bundes bei den Hochschulen noch dominanter?
Wie gesagt: Das Glas ist zu zwei Dritteln voll. Für mich ein Anfang. Nicht mehr und nicht weniger.
Sebastian Horndasch arbeitet seit sieben Jahren fürs Hochschulforum Digitalisierung, aktuell in der Position des Leiters der University:Future Festivals. Er ist studierter Bildungswissenschaftler und Volkswirt.

Gastbeitrag von Florian Nuxoll
Die Schulen in Deutschland stehen aktuell vor zwei riesigen Herausforderungen. Auf der einen Seite müssen Schulen auf die Digitalisierung reagieren. Hier scheint bereits die Bereitstellung der Infrastruktur wesentlich komplizierter zu sein, als man denken würde. Weitaus komplexere Aspekte, wie zum Beispiel die Entwicklung überzeugender Unterrichtskonzepte, die Fortbildung von Lehrkräften und die Entwicklung von lehr- und lernwirksamer Software für die Kultur der Digitalität heißen die Baustellen. Auf der anderen Seite muss die Kultusministerkonferenz (KMK) dringend die Folgen der Lockdowns, der Fernunterrichtsphasen und der hybriden Lernszenarien angehen. Für beide Herausforderungen braucht es Zeit – und einen Krisenstab Bildung.
Im Frühling diesen Jahres haben die Wirtschaftswissenschaftler Anna Rohlfing-Bastian und Gunther Glenk einen Airfiltercalculator entwickelt, ein Tool zur Berechnung von Kosten für Raumluftfilter für Schulen. Mit wenigen Klicks können Schulträger sehen, welche Kosten pro Schüler/pro Jahr für verschiedene Modelle und Einsatzszenarien auf sie zukommen. In den deutschen Klassenräumen stehen aber bis heute nur selten Raumfilter. Entweder die Kultusminister scheuten die Kosten. Oder sie rechneten nicht damit, dass sich die Corona-Lage wieder verschärfen würde. Beides ist schwer verzeihlich.
Relativ früh im Verlauf der Pandemie äußerten Politiker jeder Couleur, dass offene Schule höchste Priorität hätten. In der Praxis hatten diese Äußerungen aber kaum Konsequenzen. Wenn man aber die Forderung nach geöffneten Schulen ernst genommen hätte, hätte man an anderer Stelle früher reagieren müssen. 50.000 Zuschauer beim Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach führen dazu, dass Schulen früher oder später wieder schließen müssen. Volle Restaurants und Einkaufszentren führen dazu, dass die Schulen die Schließung droht. Wenn eine Impfpflicht erst das letzte Mittel sein darf, bedeutet das, dass Schulen die Türen zumachen müssen. Es gibt (vermutlich) gute Gründe, die Zuschauer beim Fußball, die Kunden im Gastgewerbe und die Ungeimpften machen zu lassen, was sie machen wollen. Aber es hat enorme Konsequenzen für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler.
Anna Mayr griff die Idee des Leiters eines Berliner Gymnasiums auf: zwei längere Schuljahre. Das aktuelle und das folgende Schuljahr dauern dann sechs Monate länger. Damit würde das aktuelle Schuljahr bis Dezember 2022 gehen und das folgende bis zum Sommer 2023. Danach kehrt man wieder in den normalen Rhythmus zurück. Die Idee klingt nicht nur schockierend einfach, sondern sie ist es auch. Man bräuchte keine neuen Lehrkräfte, Klassenräume und so weiter.
Natürlich ist es keine Win-Win-Win Situation. Kindergärten müssten ihre Vorschüler sechs Monate länger in der Einrichtung behalten und könnten daher neue Kinder erst verzögert aufnehmen. Das würde junge Eltern treffen, die damit gerechnet haben, ihr Kinder zum Sommer 2022 in die Betreuung zu geben. Diese Eltern bräuchten Unterstützung. Dafür könnte man die eine Milliarde Euro der Aktion Rückenwind verwenden. Die sind bislang ohnehin nicht wirklich in den Schulen angekommen. Arbeitgeber müssten sechs Monate länger auf neue Schulabgänger warten. Das müsste die Bundesregierung auch abfedern.
Wir brauchen einen Krisenstab Bildung. Jetzt! Denn Lehrkräfte müssen am Anfang des zweiten Halbjahres wissen, was der Plan ist. Sie können nicht wieder am späten Freitagabend Rundmails aus den Ministerien für den Schulbetrieb am Montag bekommen. Von einem Krisenstab mit klaren Regeln versorgt, könnten Klassenlehrer zusammen mit den Fachlehrern planen, wie sie sowohl Lerndefizite, als auch soziale Defizite am besten angehen können. So können Schulen zusätzliche Projekttage oder sogar Projektmonate vorbereiten. Sie könnten gegebenenfalls Stundenpläne kürzen, damit Kinder und Jugendliche die so wichtigen Angebote von Vereinen wieder nutzen können.
Diese zwölf zusätzlichen Monate würden ebenfalls bei der zweiten oben erwähnten Herausforderung helfen, der Digitalisierung. Denn Schulen können sich nur dann nachhaltig und sinnhaft mit der Kultur der Digitalität beschäftigen, wenn sie dafür Zeit haben. Zeit für Fortbildungen, Zeit fürs Ausprobieren und Zeit für Diskussionen. Ohne diese zusätzliche Zeit werden die Schulen die nächsten Jahre damit verbringen, die durch Corona verursachten Defizite aufzuholen. Die Digitalisierung würde wieder hintangestellt.
Der Krisenstab muss besetzt sein mit Experten aus der Theorie und Praxis. Neben Bildungsforschern und Kinderpsychiatern müssen Schulleiter, Lehrkräfte und Vertreter von Vereinen sofort beginnen, eine Lösung zu finden. Damit jenen Schüler, die Schulen und Lehrer unter den Bedingungen von Corona unterrichteten, nicht lebenslang darunter leiden. #mehrZeitfürSchüler
Florian Nuxoll ist Lehrer, Autor, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Tübingen (intelligente Tutorsysteme), Fortbildner und Podcaster bei Die Doppelstunde von Westermann.
Der Monitor Lehrerbildung mahnt mehr Tempo für digitale Inhalte im Studium aufs Lehramt an. Schulen und Lehrkräfte seien noch immer nicht genügend auf Bildung und Unterricht in der digitalen Welt vorbereitet. Das kritisiert ein Bündnis von Bildungsstiftungen. Konkret hat der Monitor die Curricula der Lehramts-Studiengänge untersucht. Der Befund: Zwischen 2017 und 2020 seien nur wenige Lehrinhalte zur digitalen Medienkompetenz hinzugekommen.
Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann würde etwa das Lehramt an Gymnasien lange warten. Frühestens im Jahr 2040 würde es flächendeckend in der ersten Phase digitale Kompetenzen vermitteln, bemängelt das Bündnis. Die Folgen habe die Coronavirus-Krise gezeigt, als die Schulen häufig einfach die analoge Lehre ins Digitale verlegten. “Es braucht aber ebenso eine neue digitale Didaktik, die nun dringend flächendeckend in der Lehrerbildungsanstalt angelegt werden muss”, steht es im Monitor. Auch sechs Jahre nach der Strategie “Bildung in der digitalen Welt” der Kultusminister bleibt digitale Medienkompetenz in Lehrerbildung und Lehramt weitgehend im Wahlpflichtbereich.
Demnach war im Frühjahr 2020 die digitale Medienkompetenz zwar als ein Thema der Bildungswissenschaften an 80 Prozent der Hochschulen verankert. Doch nur ein knappes Drittel der Hochschulen machte das Digitale durch alle Fachdidaktiken hinweg zum Lehrinhalt.
Der Eindruck, dass sich wenig tue, relativiert sich allerdings beim Blick auf die Zahlen. Zwar liegen die Medienkompetenz-Angebote in den Curricula in allen Bereichen des Lehramts unter 30 Prozent. Allerdings ist die Steigerung deutlich zu erkennen. Verdoppelt haben sich von 2017 auf 2020 die digitalen Inhalte für die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufen 2 – in der Sonderpädagogik sogar verdreifacht.
Der Monitor Lehrerbildung ist ein Projekt des Centrums für Hochschulentwicklung mit dem Stifterverband und den Stiftungen Bertelsmann und Robert Bosch. Sie vereint die Sorge, dass die Förderprogramme von Bund und Ländern bei der digitalen Bildung einseitig die Infrastruktur im Blick haben. Gute digitale Bildung mache aber aus, dass “die Lehrkräfte so gut qualifiziert sind, dass sie die jetzigen und zukünftigen Herausforderungen, die die Digitalisierung an ihre Lehrtätigkeit stellt, meistern und die sich daraus ergebenden Chancen nutzen können.” Christine Keilholz

Deutschland hat in der Coronavirus-Pandemie im internationalen Vergleich mit einer (zu) langen Schulschließung agiert. Das geht aus einem Vergleich von sieben europäischen Staaten hervor, den das Münchener Ifo-Institut vornahm. “Andere Länder in Europa legten größeren Wert darauf, die Schulen weitgehend offen zu halten“, sagte ifo-Forscherin Larissa Zierow. “Gleichzeitig waren die anderen Länder für digitalen Fernunterricht besser gerüstet.” Deutschlands Schulen waren 183 Tage lang ganz oder teilweise zu. Nur die Schulen in Polen waren mit insgesamt 273 Tagen länger geschlossen. Im Mittelfeld des Ländervergleichs liegen Österreich und die Niederlande (152 bzw. 134 Tage), während Frankreich, Spanien und Schweden mit je 56, 45 und 31 Tagen die kürzesten Schulschließungen verzeichnet hätten. Die entstandenen Lernrückstände seien gerade für Leistungsschwächere besonders hoch gewesen, nehmen die Forscher:innen an.
Diese Schlußfolgerung wird allerdings nicht empirisch durch Kompetenzmessungen unterlegt. Das ifo-Institut hat eigene Messungen mit Hilfe von Vergleichsarbeiten nicht vorgenommen. Die Forscher arbeiten hier mit einer Studie ihres ifo-Kollegen Ludger Woessmann, der die Lernzeit während der Pandemie durch Elternbefragungen in Erfahrung brachte. “In Ermangelung nationaler Schülerleistungstests bieten Einschätzungen der Lernzeitveränderung eine Annäherung an die Kompetenzentwicklung deutscher Schüler:innen,” heißt es in der Studie. Die Lernzeit von Schulkindern in Deutschland habe sich während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 von 7,4 auf 3,6 Stunden pro Tag halbiert. Diese Erhebung – ebenfalls des ifo-Institutes – wurde vor allem von Lehrern infrage gestellt. Fragwürdig sind auch die Zahlen für den Distanzunterricht, die das ifo-Institut verwendet. Es arbeitet mit Quoten von Lernmanagementsystemen, die aus dem Jahr 2018 stammen.
Interessant ist die Studie des Ifo-Instituts besonders im Hinblick auf die Methoden der Lockdowns. Deutschland auf der einen sowie Spanien und Frankreich auf der anderen Seite wendeten ganz unterschiedliche Formen an. Während in Deutschland die Schulschließung Priorität hatte, “bestand für die erwachsene Bevölkerung während der Pandemie größtenteils keine Verpflichtung, bei realisierbarem Homeoffice von zu Hause aus zu arbeiten.” Ganz anders agierten Frankreich und Spanien. Sie öffneten – trotz extrem hoher Todeszahlen in der Bevökerung – die Schulen relativ schnell wieder, legten aber gleichzeitig das öffentliche Leben und Arbeiten der Erwachsenen lahm. Für sie “wurden aber mehrere harte Lockdowns mit strengen Ausgangssperren und Bestimmungen, sich nicht über einen sehr engen Radius vom eigenen Wohnort zu entfernen, vollzogen”, schreiben Larissa Zierow und ihre Kolleg:innen. “Zusätzlich bestand ab Oktober 2020 für alle Arbeitnehmer:innen in Homeoffice-fähigen Berufen eine Pflicht, von zu Hause aus zu arbeiten.” cif
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürokratie und Ungleichheit in der Bildung kritisiert. Beim 10. Deutschen Schulleiter-Kongress in Düsseldorf sagte er: “Wir erleben, dass gerade diejenigen Schülerinnen und Schüler, die aus armen oder bildungsfernen Familien stammen, in der Krise noch weiter zurückfallen.” Ausgerechnet Schulen, die in sogenannten sozialen Brennpunkten liegen, “sind oft am schlechtesten auf die vierte Welle vorbereitet.” Steinmeier forderte weniger Bürokratie bei der Digitalisierung der deutschen Schulen. “Ich habe den Verdacht, dass wir uns mit der Umsetzung deshalb so schwertun, weil uns häufig der Mut fehlt”, so der Präsident, “die Schulen einfach mal machen zu lassen!”
Die Schulleiter seien enorm wichtig, betonte Steinmeier. Er war wegen der Coronalage nicht selbst nach Düsseldorf gekommen, sondern verlas eine Videobotschaft. In den Schulen entscheide sich, “ob gute Bildung ganz praktisch gelingt“. Er lobte das Innovationsvermögen all derer, die aus “der Not eine Tugend” gemacht, und digitales Lernen vorangebracht hätten. Er stellte heraus, dass es bei Digitalisierung nicht nur um finanzielle Mittel gehe: “Wir brauchen Geld, ja, aber wir brauchen keine goldenen Zügel, die jeden Euro mit zwei Dutzend Vorschriften und haufenweise Formularen verknüpfen.” Stattdessen bräuchte es “pragmatische, bewegliche und unbürokratische Lösungen – und das gilt ganz besonders mit Blick auf die Digitalisierung!”
Steinmeier bedauerte, dass “Schulleiterstellen an vielen Orten unseres Landes für lange Zeit unbesetzt bleiben, weil es an Bewerbern fehlt”. Jeder fünfte Direktor denke darüber nach, “an eine andere Schule zu wechseln, in die Bildungsverwaltung abzuwandern oder den Beruf sogar ganz an den Nagel zu hängen.” Gerade, weil Schulleiterinnen und Schulleiter eine so wichtige Rolle spielten, muss sich etwas ändern. Es brauche mehr Wertschätzung und eine bessere Vorbereitung auf den Beruf.
Die Pandemie führe vor Augen, “wie stark der Bildungserfolg in unserem Land immer noch von Herkunft und dem Geldbeutel der Eltern abhängt.” Angesichts von Coronazahlen auf einem Allzeithoch mahnte der Präsident Solidarität mit denen an, die in dieser Pandemie lange auf andere Rücksicht genommen hätten: Kinder und Jugendliche. Laut Steinmeier hätten viele dieser jungen Leute bis heute mit den Folgen von “Isolation und Einsamkeit” zu kämpfen. Sie litten darunter. Er rief die Menschen dazu auf, sich auch ohne rechtlichen Zwang verantwortungsbewusst zu verhalten. Der Bundespräsident definiert Verantwortungsbewusstsein in Zeiten von Corona so: sich impfen lassen und Kontakte einschränken. Robert Saar

Bettina Stark-Watzinger soll sie also heißen, die neue Bildungsministerin für Deutschland. Und das kann man eine Woche nach der Bekanntgabe über die Verteilung der Ministerposten festhalten: Die Personalie der liberalen Bettina Stark-Watzinger wurde von vielen mit großer Zustimmung wahrgenommen. Oder löste zumindest keine Abwehrreaktionen hervor.
Natürlich liegt das auch daran, dass Stark-Watzinger als unbeschriebenes Blatt gilt. Außerhalb der FDP. Innerhalb ihrer Partei wird sie geschätzt, gemocht und vor allem: Ihr wird das Amt der Bildungsministerin zugetraut. Die Eckdaten haben sich schnell herumgesprochen. Hessin, Landes-Generalsekretärin in ihrem Bundesland, seit 2017 Abgeordnete im Bundestag, 2020 Aufstieg ins Bundes-Parteipräsidium und parlamentarische Geschäftsführerin im Bundestag, seit 2021 Chefin der hessischen FDP.
Parteiarbeit kann sie also, aber nicht nur das: Sie ist Diplom-Volkswirtin und hat neun Jahre lang als kaufmännische Geschäftsführerin am LOEWE-Zentrum (später Leipniz-Institut) an der Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main gearbeitet, einer Exzellenzinitiative, finanziert vom Land Hessen. Sie ist eine, die eine Familienauszeit nimmt und gleichzeitig in London ein Psychologie-Studium absolviert.
Es wirkt, als hätte die FDP schon länger auf das Bildungsressort geschielt und Stark-Watzinger früh den Finger gehoben. In einem Interview mit der Hessenschau vor der Bundestagswahl ließ sie durchblicken, dass sie Lust hätte, nicht nur als Parlamentarierin zu gestalten. Im August schrieb sie einen Gastbeitrag in der “Welt” über ihre bildungspolitischen Forderungen. Und fragte man an der FDP-Basis nach, vor allem bei den Karliczek-kritischen Jüngeren, tauchte immer wieder der Name Stark-Watzinger als Traumkandidatin für das Bildungs- und Wissenschaftsministerium auf. Zuletzt war sie im Haushaltsausschuss für den Etat Bundesbildungs- und Forschungsministeriums zuständig. Auf den zweiten Blick wirkt ihre Besetzung alles andere als eine Überraschung.
Wofür steht sie also? Und wie digital wird ihre Bildungspolitik? Sie will das Bauchschmerzen-Thema Digitalpakt angehen. Denn obwohl viel Geld für die Schulen vom Bund zur Verfügung steht, sind aus dem ersten Topf immer noch längst nicht alle Mittel abgeflossen. Warum? Diese Frage hat Stark-Watzinger schon im Haushaltsausschuss gestellt, deshalb ist zu erwarten, dass sie den ersten und den nächsten Digitalpakt entbürokratisieren will. Zudem, so heißt es im Koalitionsvertrag, sollen extra eingerichtete Digitalpaktstellen vor Ort, die Schulleitungen beim Ausfüllen der Anträge unterstützen.
In ihrem Weltartikel sprach sie sich zudem für digitale Endgeräte für alle Kinder aus. Digitales Lernen müsse Priorität haben, schreibt Stark-Watzinger. Auch den Koalitionsvertrag kann man dahingehend interpretieren. Darin sind “digitale Lernmittelfreiheit für bedürftige Schülerinnen und Schüler” vorgesehen.
In ihrem ersten Tweet, nachdem bekannt wurde, dass sie das Bildungsministerium künftig leiten soll, spricht sich Bettina Stark-Watzinger zudem für “Talentschulen” aus, nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalen. Das Unterstützungsprogramme stellt für Brennpunktschulen mehr Personal für dienSchulentwicklung bereit. Vielleicht könnte Stark-Watzinger diesen “Talentschulen” auch beim Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur helfen. Bisher liegt da die Zuständigkeit bei den Schulträgern.
Dabei es könnte gut sein, dass sich die Zuständigkeiten generell unter einem FDP-geführten Bildungsministerium verschieben. Die Liberalen wollen schon lange das Kooperationsverbot abschaffen, die neue Regierung will zumindest ein “Kooperationsgebot” einführen. Ob und wie sie das überhaupt gestalten kann, werden die kommenden vier Jahre zeigen. Es verspricht zumindest, dass bei Problemen, die Schuldigen nicht immer die anderen sind.
Und ganz nach liberaler Façon will Stark-Watzinger die Exzelleninitiativen ausbauen, und zwar für den Nachwuchs in den Ausbildungsberufen. Dass die Auszubildenden vor allem finanziell besser abgesichert werden, ist schon lange überfällig. Aber ob Bestenförderung die Bildungsgerechtigkeit im Land vorantreibt?
Eine abschließende Beobachtung: Sie hat offenbar jetzt schon einen besseren Eindruck hinterlassen, als Anja Karliczek (CDU) in ihrer gesamten Ministerzeit. Das liegt nicht nur an der bald ehemaligen Ministerin selbst, sondern auch die Hoffnungen, die mit der neuen Regierung verbunden sind. Hoffnungen, auf einen echten Wandel.
Nicht weniger als eine “Bildungsrevolution” für Deutschland will Bettina Stark-Watzinger. Das Bildungssystem hätte es nötig. Sie steht für einen Aufbruch und ihre Art und ihr Ruf verspricht eine Ministerin, die anpackt. Nun liegt es an ihr, diesen Aufbruch zu gestalten.
Dass ich mit der LernApp bei den Schülern verschiedene Kanäle anspreche: den auditiven, indem sie etwas anhören, oder den visuellen, weil es ein Modell oder eine Illustration gibt oder sie ein Video ansehen können. Jeder Schüler kann ein Video in der für ihn idealen Geschwindigkeit verfolgen, er kann es doppelt gucken oder sich nur Ausschnitte ansehen. Ein Lehrer lässt sich halt extrem schlecht zurückspulen.
Die Low Budget-Version wäre ein Beamer an der Wand, jeder Schüler besitzt ein Smartphone, und die Schule hat WLAN. Besser wäre es natürlich, wenn es eine interaktive Tafel gäbe und einen Klassensatz an Tablets.
Ja, natürlich. Als Beispiel nenne ich in der Chemie die Elektronenkonfiguration, das ist ein relativ komplexes Thema. Dazu gibt es bei Simpleclub ein sehr gutes Video, das mit Farben animiert genau zeigt, welches Teilchen wo andockt. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Es war das erste Video, das ich im Unterricht benutzt habe – die Schüler sind inzwischen schon drei oder vier Jahre aus der Schule. Ich hab den Schülern damals den Link gegeben und ihnen 45 Minuten Zeit gelassen, sich das Thema selbst zu erarbeiten. Jeder in seinem Tempo. Wer schneller fertig war, hatte Freizeit. Im zweiten Teil der Stunde trafen wir uns im Laborraum und haben das dann besprochen. Das ging oft sehr individuell, weil man bei diesem Prinzip des sogenannten “flipped classroom” viel näher an die Lernentwicklung des einzelnen Schülers herankommt.
Mit der Lernapp werden die Möglichkeiten noch einmal deutlich größer als allein mit Videos. Wir haben das gerade in der Klasse gesehen. Mit dem animierten Modell eines Hochofens lässt sich Eisenschmelze viel leichter erklären. Ich kann als Lehrerin einzelne Aspekte zuschalten, also die Zonen des Hochofens, die Temperatur oder bestimmte Reaktionen ablaufen lassen. Natürlich gibt es Illustrationen eines Hochofens auch in Schulbüchern, aber das ist dann statisch, da lässt sich keine Reaktion beobachten. Oft gibt es für Schulbücher multimediale Ergänzungen, aber da müsste ich für jedes Lehrbuch extra eine Lizenz kaufen.
In der LernApp habe ich alles auf einmal, und zwar für alle Fächer. Gerade in Biologie und Chemie läuft so viel auf Teilchenebene, da bieten digitale Medien eine große Chance. Das gibt es in 3D, die Schüler:innen können vor- und zurückspulen, die Visualisierungen sind sehr einfach zu erzeugen. Ich nenne Simpleclub gerne die Einstiegsdroge zum Lernen. Ich finde das gerade für Schüler in verschiedenen Entwicklungsphasen sehr gut. Mancher würde ja zu Hause nie ein Buch aufschlagen. Ich benutze im Unterricht aber nicht allein die App. Ich hab immer ein Buch dabei, ich verteile Arbeitsblätter, ich setze Videos ein und bringe oft eine eigene Präsentation mit. Vor allem bringe ich mich als Person mit. Gerade in der Pandemie hat man gelernt: das wichtigste, das Schule bietet, ist die persönliche Beziehung.
Meine Kritik wäre, dass man mit den Lernmodellen wie der App von Simpleclub den Schülern oft etwas zu sehr entgegenkommt. Lesekompetenz ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Die brauche ich bei Erklärvideos aber kaum noch. Meine Erfahrung gerade in der Corona-Zeit war die, dass die Schüler:innen sehr gute Texte bekommen hatten, aus denen sie aber recht wenig mitgenommen hatten. Die erzählten mir hinterher dann irgendeinen Schmuh, und ich sagte oft: “Mensch, das stand doch alles ganz genau in dem Text drin”. Ich beobachte öfter bei Schülern, dass sie einen Text lesen, aber die wichtigen Informationen gar nicht herausziehen. Lernapps mit Videos und Illustrationen und so weiter sind eine richtig gute Lernhilfe – aber sie fördern die Lesekompetenz oft nicht, sondern sie umgehen sie bloß. Wichtig in meinen Augen: Viele Kollegen haben Angst, dass sie durch Lernapps überflüssig werden. Diese Angst kann ich nicht nachvollziehen. Das wichtigste Medium beim Lernen bleibt die Person des Lehrers.
Maria Kammerer unterrichtet Biologie und Chemie an der Don-Bosco-Schule in Rostock und ist dort die Digitalisierungsbeauftragte.