die Geschichte der digitalen Bildung in Deutschland ist eine Geschichte des Wartens. Ein Beispiel dafür ist Arndt Kwiatkowski, ein früher Digitalisierer, der 2008 die Mathe-Lernplattform “Bettermarks” aufbaute. Allerdings bekam er erst 2018 den ersten Auftrag eines Bundeslandes, mit seiner Mathe-App Schülern beim Lernen zu helfen – und Lehrern beim Unterrichten. “In manchen Bundesländern finden wir nicht mal jemanden, der mit uns spricht”, verriet Kwiatkowski meiner Kollegin Sofie Czilwik, die ihn besucht hat.
Genauso geht es der Lernplattform “Optima” aus der Ukraine. Die Online-Schule hat alle ihre Angebote auf gratis umgestellt – wegen des Krieges. Damit alle Geflüchteten, egal wohin es sie in Europa verschlagen hat, umsonst lernen können. Seit Wochen allerdings wartet Optima vergeblich darauf, von den Kultusministerministern oder dem BMBF eine finanzielle Förderung zu bekommen. Nun ändert Optima sein Geschäftsmodell: sie verwandelt sich in eine NGO, ein gemeinwohlorientiertes Angebot. Die Hoffnung: dass dann aus Deutschland eine Förderung kommt – bevor das Portal pleite geht. Wir berichten genauer, sollten sich die Kultusminister bewegen.
Und noch ein Start-up haben wir im Fokus: “Simpleclub”. Die enervierend frechen Sprecher der Simpleclub-Lernvideos sollen nun auch Azubis zum Lernen anstacheln. Die Gründer wollen bis zum Jahresende den Lernstoff von 20 Berufen in der App haben. Aber auch Simpleclub hat eben nicht nur Freunde. Die ehemaligen Mathe-Youtuber hätten ein “parasitäres Verhältnis zum Schulsystem”, sagt einer der einflussreichsten deutschen Didaktiker. Wie kommt er darauf?
Ich wünsche eine spannende Lektüre


Die unter Jugendlichen beliebteste Lernapp will die duale Ausbildung modernisieren: Simpleclub digitalisiert mit Lernvideos die Berufsbildung. Die Ausbildungsinhalte der Maler und Lackierer, Bank- und Industriekaufleute sind mithilfe der Industrie bereits als Videos, Aufgaben und Tests auf der Lern- und Videoplattform verfügbar. Derzeit arbeiteten 40 Mitarbeiter daran, den Stoff eines weiteren Dutzends von Berufen zu digitalisieren, teilte Simpleclub mit. Nach eigenen Angaben nutzten knapp 21.000 Auszubildende die Lern-App, um sich auf die Arbeit und Prüfungen vorzubereiten. Insgesamt gibt es 1,3 Millionen Lehrlinge in Deutschland.
Die Lernvideos sind auch für die Berufsbildung im typischen frechen Stil der Simpleclub-Erfinder Alexander Giesecke und Nicolai Schork gehalten. “Was zur Hölle ist eine Ammoniakalische Netzmittelwäsche?”, fragt der Sprecher im Video über Lackieruntergründe. “Aha, cool, und wo brauche ich sowas, bitte, im echten Leben?” lautet die Frage bei Sortieralgorithmen. Dieser Stil stößt bei Lehrer:innen auf Kopfschütteln bis Empörung, kommt bei Jugendlichen aber häufig an. Und er ist erfrischender als bei der Konkurrenz. Die Erklärfilme bei Westermanns “Georg” oder dem Unternehmen “Vocanto” sind fachlich korrekt, aber lange nicht so munter. Die “Cornelsen-Ecademy” hat mit ihrer automatisierten Stimme den Charme des “Pauk mit: Latein” im Telekolleg des Bayerischen Fernsehens von vor 50 Jahren. Nur dass es heute bei Cornelsen vorgelesene Texte wie dieser sind: “Die elektrische Energie für die Energieversorgung wird zuvor aus einer anderen Energieform umgewandelt.”
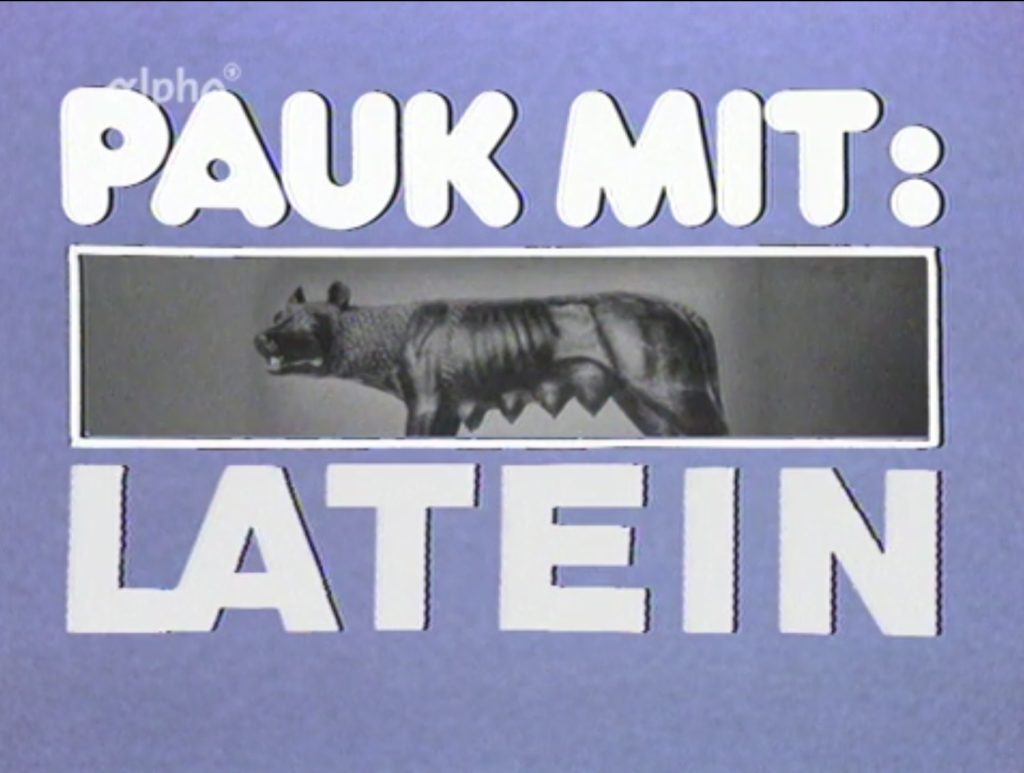
Simpleclub ist schon seit zehn Jahren auf dem Markt, anfangs nur mit Lernvideos, inzwischen mit einer App, die vom Karteikartensystem über Aufgaben bis zu virtueller Realität reicht. Die Videoschmiede der beiden Gründer Schork und Giesecke ist Objekt einer Hassliebe. Schüler verehren die kessen Lernvideos, die selbsternannte pädagogische Elite verachtet sie. Das Konsumieren von Videos löse bei Schülern zwar Euphorie aus, sei aber nicht mehr als Kompetenzsimulation. So kritisiert etwa der Erlanger Deutschdidaktiker Axel Krommer, Simpleclub habe ein “parasitäres Verhältnis zum Schulsystem”.
Am Anfang haben Unternehmen wie der Lackhersteller Brillux oder die Sparkassen die Produktion von Simpleclub-Lernvideos, Aufgaben und Tests für die Berufsbildung bezahlt. Seitdem finanziert das EdTech Simpleclub, das inzwischen rund 120 Mitarbeiter hat und 500 Millionen Klicks verzeichnet, die Digitalisierung des Lernpensums weiterer Berufe eigenständig. Bis Ende nächsten Jahres will die Azubi-Sparte von Simpleclub unter Alexander Powell 40 Berufsbilder in der App darstellen. Dann geht es nicht mehr nur um die Elektroniker und Mechatroniker sowie die vielen Kaufmannsberufe, die zusammen rund 750.000 Lehrlinge in Deutschland stellen, sondern auch um Handwerk und Gesundheitsberufe. Simpleclub registriert 200.000 Nutzungen der Azubi-Inhalte pro Monat.
Aus der Industrie kommt Beifall für das digital unterstützte Lernen. Die Azubis des Gebäude-Digitalisierers “Johnson Consults” etwa seien positiv überrascht gewesen über die Anschaffung von Simpleclub-Lizenzen, berichtet Ausbildungsleiter Tobias Loreth. “Das ist genau das, was wir brauchen”, hätten die Azubis gesagt. “Das ist in unserer Sprache, und ich habe direkt Lust weiterzulernen.” Johnson Consults bildet ein Dutzend Berufsbilder aus, die von den Kaufleuten über die Elektroniker für Automatisierungstechnik bis zu Mechatronikern für Kältetechnik reichen.
Obwohl Simpleclub diese Berufe nicht komplett abdeckt, hat das Unternehmen den Schritt gewagt. “Die Auszubildenden können die Themen, die sie gerade in der Berufsschule haben, nachschlagen und sich einfach aneignen“, sagte der Ausbildungsleiter. “Früher hat man dem Auszubildenden einen Gutschein für ein Buch überreicht, das geht nicht mehr.” Heute gebe man ihnen einen überall verfügbaren Link. “Dann können die Azubis alle Themen, die sie für ihre Ausbildung brauchen, in ihrer Sprache finden. Das ist meiner Meinung nach zeitgemäßes Lernen.”
Allerdings hat Johnson Consults auch hohe Erwartungen an Simpleclub. Das Problem sei, dass noch nicht alle Berufe abgebildet sind. “Für uns ist wichtig, dass bis Ende des Jahres der Hauptteil unserer zwölf Ausbildungsberufe in Simpleclub auftauchen”, sagte Loreth. Der 30-Jährige hat selbst als Schüler und Studierender Simpleclub genutzt. Ihn bewegen allerdings nicht Emotionen, sondern der Nutzen. “Ich sehe Simpleclub einfach als ein weiteres Buch – nur in einer neuen Form”, sagt er. “Das ist eine Möglichkeit, für eine Generation, die das Digitale gewöhnt ist, sich Informationen gebündelt und leicht aufbereitet anzueignen. Nicht mehr und nicht weniger”. Auch beim Datenschutz ist Loreth kritischer als die Azubis und manches Start-up. Das Thema Datenschutz sei bei den Azubis nicht präsent, sagt Loreth. “Aber für uns als Firma ist das extrem wichtig. Deswegen gehen unsere Azubis auch nicht mit ihrem vollen Namen und ihrer Mailadresse in die App, sondern komplett anonym.”
Intuitive Lernapps könnten helfen, zwei Probleme der dualen Ausbildung zu kontern. Erstens gibt es eine Reihe von Berufsschülern, die dem Medium Buch abhold sind; sie lassen sich möglicherweise durch kurzweilige Lernvideos besser motivieren. “Es gibt junge Leute, die du mit einem Arbeitsblatt nicht mehr engagieren kannst”, sagte Alexander Powell. Zweitens ist die Digitalisierung für die duale Ausbildung nicht nur ein Problem, sondern auch ein Hilfsmittel.
Das sieht man an Tobias Loreth. Wollte der Ausbildungsleiter alle seine 60 Azubis ohne digitale Kommunikationsmittel regelmäßig persönlich treffen, dann wäre er nur noch auf der Autobahn. Digital kann Loreth in regionalen Videocalls sich immer wieder die Sorgen und Nöte der Azubis anhören. “Es gibt leider nicht wenige Ausbilder und Betriebe, die noch wie in den 60er Jahren arbeiten – konsequent analog”, sagt Loreth. “Erst wenn wir die technische Entwicklung und die Lebenswelt unserer Azubis ernst nehmen, dann können wir die berufliche Ausbildung durch Digitalisierung wieder attraktiv machen.”
Das allerdings dürfte noch ein bisschen dauern. Die großen digitalen Plattformen für Azubis Cornelsen Ecademy, Simpleclub, Westermann Georg und Vocanto haben nach einer Umfrage von Bildung.Table zusammen um die 70.000 Nutzer. Das bedeutet, dass nur etwas über fünf Prozent der Lehrlinge ihre Smartphones und Laptops auch zum Lernen nutzen.

Bettermarks ist wohl die erfolgreichste digitale Lernanwendung in Deutschland. Die Plattform hilft Schüler:innen dabei, Mathe besser zu verstehen. Mehrere Studien, vom Unternehmen Bettermarks GmbH in Auftrag gegeben, belegen, dass das für Schüler:innen tatsächlich funktioniert: Sie schneiden in Mathe besser ab, wenn sie Bettermarks nutzen. Mittlerweile lernen in mehreren Bundesländern und Schulen in Deutschland, aber auch in den Niederlanden, in Südafrika und in Urugay, Kinder und Jugendliche mit Bettermarks. Doch bis dahin war es ein weiter Weg, sagt Gründer und Geschäftsführer Arndt Kwiatkowski.
Was ist eine gute Geschäftsidee?
Aus meiner Sicht: Wenn man es durch technische Innovation schafft, für viele das Leben einfacher zu machen. Es interessiert mich nicht, den nächsten Energydrink auf den Markt zu bringen, nur um am Ende mehr rauszubekommen, als man reingesteckt hat. Mir und meinem Team geht es darum, zur Lösung gesellschaftlich relevanter Probleme beizutragen.
Sie haben 1997 das Portal Immobilienscout24 gegründet. Was genau ist daran gesellschaftlich relevant?
Als wir angefangen haben, hat eine Suche nach einer Immobilie in Deutschland über vier Monate gedauert, mit Immobilienscout24 fanden Wohnungssuchende 2007 innerhalb von zwei Monaten eine neue Wohnung. Einfach, weil durch uns der Markt transparenter wurde.
Mit Bettermarks haben Sie eine Mathe-Lernplattform entwickelt. Wie kamen Sie von Immobilien zu Schule?
Nachdem Christophe Speroni, Marianne Voigt und ich 2008 aus immobilienscout24 ausgestiegen sind, haben wir uns gemeinsam überlegt, in welchem Bereich wir gründen wollen. Zur Auswahl stand die Gesundheitsbranche und der Bildungsbereich. Beides Felder, in denen die Digitalisierung in Zukunft eine zunehmende Rolle spielen würde. Wir entschieden uns für Bildung. Das interessierte uns mehr. Außerdem dachten wir, dass es viel einfacher sei, hier eine Lösung zu finden. Dem war dann nicht so.
Das heißt, für eine Geschäftsidee braucht man erst ein Problem, das gelöst werden muss, und dazu dann die passende Lösung?
Absolut. Deshalb ging es uns auch nicht darum, eine Nachhilfeapp für ein paar Schüler zu entwickeln, sondern von Anfang an zielten wir auf das öffentliche Schulsystem ab. Dass das aber so lange dauern würde, bis unser Produkt in diesem Schulsystem auch wirklich genutzt wird, hätten wir nicht gedacht.
Sie haben 2008 gegründet, wann haben Sie die erste Lizenz für ein Bundesland verkauft?
Zehn Jahre nach der Gründung, also 2018 an Hamburg. Mittlerweile haben auch Rheinland-Pfalz, Bremen, Brandenburg, Niedersachsen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Lizenzen erworben. Sodass wir als Unternehmen letztes Jahr unseren Break Even erreicht haben. Heißt: Wir nehmen jetzt mehr ein als wir ausgeben und können unsere Produkte weiterentwickeln.
Sie haben sich 12 Jahre lang als Unternehmen nicht getragen? Wie haben Sie so lange überlebt?
Zu einem geringen Teil durch unser Eigenkapital, das ich und meine Mitgründer mitgebracht haben, aus dem Verkauf unserer Anteile von Immobilienscout24. Und vor allem durch regelmäßige Finanzierungsrunden mit externen Investoren.
Wie oft mussten Sie Geld einsammeln?
Gefühlt endlos. Bestimmt alle eineinhalb Jahre. Insgesamt haben wir über 30 Millionen Euro in Bettermarks investiert, bevor es sich getragen hat. Und Geld bekamen wir auch nur, weil wir immer wieder Erfolge vorweisen konnten. Beispielsweise verkauften wir an ganz Uruguay 2013 eine Lizenz für die Klassenstufen 5 bis 10.
Warum wollte keine deutsche Bildungsbehörde ihre Lernapp?
Im Jahr 2010 haben wir einen Piloten durchgeführt, mit 12 Schulen. Nach drei Monaten haben sich die teilnehmenden Lehrkräfte zusammengesetzt und haben gesagt: Wenn wir in der Breite bessere Ergebnisse in Mathematik erzielen wollen, dann brauchen wir Bettermarks! Die Reaktion des Vertreters des Bildungsministeriums war: herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Projekt! Die Bildungsrendite ist toll! Leider kann ich nichts für Sie tun!
Heißt: kein Geld. Ab wann haben sich die Bildungsbehörden dann für Sie interessiert?
Erst ab 2016, als die KMK ihre Strategie “Bildung in der digitalen Welt” veröffentlichte. Ab dann gab es ein breiteres Interesse daran, das Bildungssystem wirklich zu digitalisieren. Denn mit der wachsenden Heterogenität der Schulklassen steigen die Herausforderungen für Lehrkräfte. Adaptive Lernsysteme, wie Bettermarks, können die Lehrkräfte entlasten und den Schülern das Lernen im individuellen Tempo ermöglichen.
Das deutsche Bildungssystem gilt als zu bürokratisch und starr. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit?
Dort, wo es zu einer Zusammenarbeit gekommen ist, klappt sie sehr gut. In etlichen Bundesländern existiert das Bewusstsein, dass digitale Innovationen, weder von bestehenden Marktspielern kommen, noch von den Behörden selbst. Das Bildungssystem braucht also Unternehmen wie uns. Allerdings haben wir uns als Gesellschaft komplizierte Strukturen auferlegt: Etwa die Ausschreibungen oder dass die Behörden in die Unterrichtsgestaltung der Schulen nicht eingreifen dürfen. Und in manchen Bundesländern suchen wir immer noch nach Entscheidern, die mit uns sprechen können.
Wo ist es besonders schwierig?
Wir haben Lizenzen an sieben Bundesländer verkauft, im Saarland und in Schleswig-Holstein führen wir Pilotprojekte durch, in den meisten anderen haben wir noch keine Möglichkeit für eine breitere Zusammenarbeit gefunden.
Sie verkaufen nicht nur an Länder, sondern auch an einzelne Schulen. Lohnt sich das überhaupt?
Unsere Lizenz kostet für alle gleich, 10 Euro pro Kind, pro Jahr. Natürlich ist es sowohl für uns als auch für die Schulen sinnvoller, über die Landesbehörden zu gehen. Denn so beschleunigen wir die Verbreitung unseres Angebotes und die Schulen müssen sich nicht um alles selbst kümmern. Sie brauchen, um Bettermarks zu nutzen, idealerweise eine digitale Infrastruktur, sie müssen Fragen des Datenschutzes klären und ihren Lehrern Weiterbildungen anbieten. Und vor allem: Sie brauchen ein Budget. Mit Unterstützung der Bildungsbehörden ist das natürlich einfacher. Es gibt immer noch Schulen, in denen die Lehrer mit dem Klingelbeutel durch die Klassen laufen müssen, um die Bettermarks-Lizenzen zu finanzieren.
Wohin geht es für Ihr Unternehmen als Nächstes?
Zuerst wollen wir möglichst alle Schüler in Deutschland erreichen. Bisher wird Bettermarks von gut 400 Tausend Schülerinnen und Schüler genutzt, über fünf Millionen könnten wir in den Klassenstufen 4 bis 13 erreichen.
Und danach?
Mathematik eignet sich sehr gut für digitale Lösungen. Wir bieten ein adaptives Übungsheft an, das sich an das Wissen und Können der Schüler anpasst. Wir wollen dies zu einem adaptiven Lehrwerk weiterentwickeln, sodass Lehrkräfte das System für alle Phasen des Mathematik-Unterrichts nutzen können. Zum Beispiel auch, um die Klasse in ein neues Thema einzuführen.
Werden Sie Lernsysteme für andere Fächer anbieten?
Wir haben zusammen mit unseren Partnern begonnen, ein adaptives Lehrwerk für das Fach Deutsch zu entwickeln. Dieses, und das für Mathematik, soll für die Klassenstufe 5 ab September 2023 in einer ersten Version nutzbar sein. Ab wann wir dann weitere Fächer angehen, hängt natürlich auch vom Interesse der Schulen und Landesbehörden ab.
Das digitale Schulzeugnis kommt -die Frage ist nur weiterhin wie. Das Projekt will dafür sorgen, dass das Einreichen von Zeugnissen bei Bewerbungen reibungslos und fälschungssicher wird. Damit ist es Teil eines ehrgeizigen Digitalisierungsvorhabens des Bundes, bei dem alle staatlichen Leistungen auch digital angeboten werden sollen. Der erste Testlauf, der von dem federführend zuständigen Bundesland Sachsen-Anhalt organisiert wurde, kam nun massiv in die Kritik: Ein Hacker und eine Hackerin konnten ungehindert in das Testsystem eingreifen und sich angeblich Zeugnisse ausstellen. Ein Fachjournalist beim IT-Nachrichtendienst Golem urteilte über das Pilotprojekt, es habe “haarsträubend triviale Anfängerfehler”. Für Aufregung sorgt aber auch das Festhalten an der umstrittenen Blockchain-Technologie. Dass diese gar nicht aus technischen Gründen verwendet wurde, zeigen jetzt auch ältere Strategieentwürfe zur Digitalisierung und ein internes Positionspapier, das Bildung.Table vorliegt.
Die Technologie hinter dem “Digitalen Schulzeugnis” entwickelt die Bundesdruckerei. Die Ziele des Projekts sind nachvollziehbar: Die analogen Zeugnisse verursachen in den Amtsstuben viel Arbeit. Bewirbt sich eine Person nach der Schule bei einer Universität, muss sie meist eine beglaubigte Zeugniskopie einreichen. Ein beliebig kopierbares digitales Schulzeugnisses soll hingegen technisch leicht in der Uni oder auch von einem Arbeitgeber auf Echtheit überprüft werden können. Damit das funktioniert, wird in das ausdruckbare PDF-Zeugnis noch eine XML-Datei mit strukturierten, maschinenlesbaren Daten integriert.
Bereits hier setzte die Kritik der erwähnten Hacker:innen an: Denn beide Dateiformate sind durch ihre Komplexität sehr anfällig für Angriffe. Lilith Wittmann berichtete auf Twitter, dass sie ein eigenes Zeugnis generieren konnte, ohne autorisiert zu sein. Die Bundesdruckerei nahm daraufhin das System offline und entschuldigte sich: “Naturgemäß ist ein System während des Testbetriebs noch nicht fertig, kann also Fehler, Schwachstellen oder Funktionseinschränkungen enthalten.”
Aber wie kam das digitale Zeugnis nun zu einer Blockchain: Damit die ins PDF integrierte digitale Zeugnisdatei zertifiziert und fälschungssicher ist, wird für jedes Zeugnis eine kryptografische Prüfsumme (ein sogenannter Hash) errechnet. So kann man die Inhalte auf Echtheit und Unveränderlichkeit überprüfen. Bei der kleinsten Änderung des PDFs ändert sich diese Prüfsumme und ein Fehler wird ausgegeben. Und weil nur anerkannte Ausgabestellen autorisiert sind, eine korrekte Prüfsumme zu errechnen, kann von einer betrügerischen Person nach einer Veränderung keine gültige, neue Prüfsumme berechnet werden. Bis zur Prüfsumme ist die Technologie unumstritten. Aber offen ist die Frage, wie eine Ausgabestelle autorisiert wird und wo die Prüfsummen gespeichert werden soll. Da gibt es sehr kontrovers diskutierte Lösungen.
Möglich wäre ein zentrales Zertifikatesystem, eine sogenannte Public Key Infrastruktur, wie sie sie in der Informatik seit Jahren bekannt und bewährt ist. Ein solche wurde beispielsweise auch bei der Ausgabe und Prüfung von Impfnachweisen in der EU eingesetzt: Eine zentrale Stelle autorisiert Ausgabestellen und die stellen so Zertifikate aus, die von beliebigen Apps oder Tools auf Echtheit überprüft werden können. Stattdessen hat die Bundesdruckerei aber eine andere, sehr neue Technologie eingesetzt, mit der staatliche Institutionen noch kaum Erfahrung haben: die Blockchain-Technologie. Dort wird das Zeugniszertifikat nicht von einem zentralen Schlüssel zertifiziert, sondern als Block an eine lange Kette vorheriger Zertifikate angehängt und kryptographisch mit ihnen verknüpft. Diese Verkettung von kryptografischen Datensätzen baut immer auf den vorherigen Datensätzen auf. Man kann daher an den bestehenden Daten nichts ändern, ohne dass dies einen Fehler verursacht. Dadurch ist es unmöglich, vorherige Datensätze unbemerkt zu manipulieren. Wenn ein Zeugnis korrigiert wird, muss man es als neue Version in der Blockchain ablegen. Und das Anhängen neuer Blocke geschieht nur mit Konsens aller anderen Parteien, die die Blockchain betreiben.
Die Blockchain-Technologie kennt man vor allem vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Auch dort muss jede Überweisung von Bitcoin von der gesamten Community überprüft werden können, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt. Das digitale Zeugnis nutzt übrigens keine dieser öffentlich nutzbaren Blockchains aus dem Bereich der Kryptowährungen. Eine Genossenschaft aus 15 IT-Dienstleistern wird eine eigene Blockchain-Infrastruktur betreiben -laut Lilith Wittmann basiert die Software aber auf der bekannten Blockchain der Kryptowährung Ethereum. Spätestens hier stellt sich die Frage, warum eine einfache Zeugnis-Zertifizierung mit derart neuer, aufwändiger und komplizierter Softwarestruktur gebaut werden soll. Die Blockchain löst ein Problem, das hier gar nicht vorliegt: ein vertrauenswürdiges System in einem dezentralen, nicht vertrauenswürdigem Umfeld zu schaffen.
Wir wissen, dass es zwischen den Bundesländern oft Reibung gibt, aber ein derartiges Niveau von Misstrauen zwischen den Schulbehörden oder den IT-Betreibern scheint nicht gegeben. Das Vertrauen zwischen ausstellenden Schulen, Universitäten und Rechenzentren muss vorausgesetzt werden, sonst wäre bereits vor der Eingabe eine Manipulation möglich. Das sieht auch die IT-Sicherheitscommunity aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs nicht anders, berichtet die “Zeit”: “Was die Verantwortlichen damit erreichen wollen, sei auch mit weniger aufwendiger, längst etablierter Technologie möglich. Mit einer Infrastruktur aus digitalen Signaturen und Zertifikaten zum Beispiel ließen sich Dokumente absichern und verifizieren.”
Warum also Blockchain? Hinweise auf den eigentlichen Grund finden sich nun in einem internen Positionspapier, das Bildung.Table vorliegt. Dort heißt es: “Ausschlaggebend für die Entscheidung, diese Blockchainlösung zu favorisieren (…) waren neben der Betrachtung und Bewertung der verschiedenen Architekturoptionen auch die Blockchainstrategie des Bundes, die das digitale Zeugnis als einen möglichen Anwendungsfall enthielt. “Tatsächlich wurde bereits in der 30. Sitzung des IT-Planungsrats im Beschluss 2019/58 erklärt, dass eine Blockchain-basierte Zeugnisvalidierung als Anwendungsfall umzusetzen sei. Man beabsichtige, Finanzmittel für eine exemplarische Blockchain-Implementierung bereitzustellen. “Nachweise incl. Zeugnisvalidierung” seien solche Beispiele für den Einsatz der Blockchain-Technologie. “Die Ausarbeitung und Durchführung von Proof of Concepts sind für die Erprobung der Blockchain-Technologie von Bedeutung”, heißt es weiter.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe sich dafür ausgesprochen, “in Blockchain-Technologie… zu investieren”. Die Entscheidung zur Blockchain-Technologie wurde also gar nicht bei der Bundesdruckerei aufgrund einer technologieneutralen Bewertung getroffen, sondern wurde von oben herab diktiert und mit Fördergeld ausgestattet. Zum Glück scheint in letzter Minute Einsicht eingekehrt zu sein: bestehende Architekturansätze (also die Blockchain) sollen nun überprüft und andere Ansätze (vermutlich das zentrale Zertifikatsmodell) nochmals mit betrachtet werden.
Der Fokus solle eine leichtgewichtige Lösung ermöglichen, heißt es in dem internen Bewertungspapier aus der Behörde in Sachsen-Anhalt. In dem Papier kritisiert man auch die Beteiligung der 15 IT-Dienstleister, die an der Blockchain mitwirken. Diese sind keineswegs, wie von der Bundesdruckerei behauptet, “im Staatsbesitz”. Ein Gründungsmitglied ist beispielsweise Governikus, ein anderes regio IT. Ganz normale Unternehmen, die hier natürlich auch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Entsprechend fürchtet das interne Positionspapier einen “Vendor Lock-In” und verweist auf unklare langfristige Betriebskosten. Ab Mai 2022 soll die bestehende technische Konzeption überarbeitet werden. Für alle betroffenen Schulen bleibt zu wünschen, dass ab dann die beste und sicherste technische Lösung gesucht wird, anstatt die jungen Leute zu Blockchain-Labormäusen der Bundes-IT zu machen. Matthias Eberl
Die Arbeit mit Microsoft MS 365 ist an Schulen in Baden-Württemberg wegen mangelnden Datenschutzes nur bis zum Sommer erlaubt. “Ab dem kommenden Schuljahr ist die Nutzung von MS 365 an Schulen zu beenden”, ließ der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, mitteilen. Er setzt damit eine Leitentscheidung für die Bundesrepublik. Den anderen Ländern dürfte es nun schwerfallen, ihre unstete Haltung zu Microsoft aufrechtzuerhalten. Brink “setzt konsequent die richtig erkannte Rechtslage um.” So kommentierte der Sprecher der Arbeitskreise Schule und Medienbildung der Datenschutzkonferenz, Lutz Hasse. Den betroffenen Schulen im Ländle will Brink helfen. Sie sollen digitale Schreibprogramme, Lernwolken und Mail-Systeme finden, die nicht das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung der Schüler verletzen.
Die Reaktion aus dem Bildungsministerium in Stuttgart war ambivalent. Einerseits teilte ein Sprecher mit, den betroffenen Schulen “stehen die Lernmanagementsysteme itslearning und Moodle als Alternative zur Verfügung.” Andererseits fand er den Zeitpunkt der Mitteilung ungünstig. “Die Schulen befinden sich momentan in den schriftlichen Prüfungen zum Abitur.” Allerdings werden Prüfungen nicht mit Microsoft geschrieben. Ohnehin ist die Nutzung von Microsoft an den Schulen wegen der Datenschutz-Probleme nicht sofort untersagt. Es ist nur lange klar, dass die Zeit abläuft.
Entsprechend äußerten sich Schulleitungen. “Ich spüre keinen Schmerz. Wir sind anderweitig sehr gut aufgestellt”, schrieb der Leiter der Friedrich-Boysen-Realschule in Altensteig, Klaus Ramsaier. Seine Kollege Steffen Siegert von der Josef-Schmitt-Realschule in Lauda-Königshofen lobte Microsoft: “die Möglichkeiten von MS 365 habe ich noch bei keiner anderen Plattform gefunden.” Die Teamleiterin des Landesmedienzentrums, Saskia Ebel, begrüßte die klare Ansage. Sie verwies auf die bevorstehenden Moodletage und die itslearning-Tage, bei denen sich Schulen Alternativen anschauen könnten. “Schade nur für all die Schulen, die sich da nun eingearbeitet haben”, schrieb Ebel. Allerdings: die Schulen wussten, dass für Microsoft die Sanduhr abläuft. “Wir sind gar nicht erst eingestiegen”, sagte Dominic Brucker von der Gemeinschaftsschule Jettingen. “Ungeschickt war aber sicherlich, dass dieses Produkt explizit in einem der ersten Corona-Schreiben des Bildungsministeriums aufgeführt wurde.” Der Datenschutzexperte der GEW, René Scheppler sieht “für die Schulleitungen ein deutliches Signal, sich ihrer vollen, alleinigen Verantwortung bewusst sein zu müssen.”
Die unendliche Geschichte des Datenschutz-Streits um Microsoft für Schulen ist noch nicht zu Ende. Die Datenschutzbeauftragten warten noch auf einen Bericht aus Bayern, wo der Präsident des dortigen Landesamtes mit Microsoft sprach. Zugleich gibt es eine weitere Arbeitsgruppe der Datenschutzkonferenz, die zusammen mit den Kultusministern mit Microsoft verhandelt. Über all diesen Gesprächen schwebt das geplante neue Abkommen zwischen EU und USA, das US-Präsident Biden und Kommissionspräsidentin von der Leyen skizziert haben. Die USA planen etwa, für Datentransfers ein eigenes Gericht aufzubauen. Das könnte bedeuten, dass betroffene europäische Bürger ein Klagerecht in den USA bekommen – bisher sind sie nicht existent. Allerdings ist nicht klar, welchen Status dieses Gericht haben wird. “Das sind neue Rechtskonstrukte, die zunächst daraufhin durchleuchtet werden müssen, ob sie den bisherigen Forderungen des EuGH genügen”, sagte Lutz Hasse. Sollte die Kommission einen Angemessenheitsbeschluss erlassen, wären Microsoft-Produkte wieder nutzbar. Auch an Schulen. Christian Füller
Diese Schulcloud ist nun auch auf Ukrainisch benutzbar. Muttersprachler, “die für ein Übersetzungsbüro arbeiten”, haben die Navigation der Lernwolke der Länder Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen ins Ukrainische übersetzt. Das teilte der Betreiber Dataport auf Anfrage mit. In den drei Ländern, welche die Schulcloud als Landeslösung angeschafft haben, ist die Bedienung für Schüler und Lehrer ohne weiteres möglich. So können etwa Lehrkräfte, die Willkommensklassen betreuen, sofort mit ihr arbeiten. Nach Informationen von Bildung.Table wollen auch andere Länder die Schulcloud für diesen Zweck nutzen. Dafür gibt es bislang aber keine offizielle Bestätigung.
Die Übersetzer:innen haben zwar noch keine Lerninhalte der Bildungscloud ins Ukrainische übersetzt. Es stehen aber Lehrmaterialien aus der Ukraine mittlerweile in digitaler Fassung bereit – als PDF bei Mundo (Bildung.Table berichtete). So könnten Lehrkräfte die deutsche Lernplattform als digitale Infrastruktur nutzen und ukrainische Lehrmaterialien sinnvoll in den Unterricht einbauen. Eine Sprecherin von Dataport, welches die Cloud betreibt, sagte Bildung.Table, dass die Idee für die Übersetzung aus dem Schulcloud-Verbund der Länder kam. Bisher war die Cloud in Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar.
Die Schulcloud war ursprünglich als Sprung des deutschen Bildungswesens in die digitale Zukunft gedacht. Das Hasso-Plattner-Institut sollte das Produkt für alle Schulen in Deutschland entwickeln – so der anfängliche Plan, als es 2017 losging. Übrig geblieben sind heute immerhin 1,4 Millionen Nutzende an circa 4.000 Schulen weltweit (z.B. haben auch deutsche Auslandsschulen Zugänge erhalten). Brandenburg, Thüringen und Niedersachsen experimentierten ab 2018 zunächst unabhängig voneinander mit der Schulcloud, bis sich die Länder im Sommer letzten Jahres zu einem Verbund zusammentaten. Dataport, eine Anstalt des Öffentlichen Rechts, übernahm Verantwortung für das Projekt. Die Plattform selbst ist datenschutzkonform, und Nutzende können sich von jedem Endgerät aus einwählen.
Die Initiative des Schulcloud-Verbunds ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, doch stellt sie die Handlungsfähigkeit der KMK-Taskforce infrage. Die leistet bisher nur zwei Dinge: regelmäßige Veröffentlichung von Zahlen über schulpflichtige Kinder und Implementierung eines erleichterten Hochschulzulassungsverfahrens für aus der Ukraine Geflüchtete. Somit reagieren Bundesländer nach wie vor allein oder im selbstgewählten Verbund auf eine bundesweite Herausforderung. Robert Saar
2. Mai 2022, 14:00-17:30 Uhr
Online-Barcamp: Erste Hilfe – Ukrainische Geflüchtete im Bildungsbereich
In diesem Online-Barcamp können die Teilnehmenden Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext des Ukraine-Kriegs besprechen. Der thematische Rahmen ist weit gefasst: Wie sehen gute Bildungsangebote zum Krieg in der Ukraine aus? Wie können Schüler:innen aus der Ukraine in Deutschland unterstützt werden? Konkrete Sessions können auf der Website vorgeschlagen und von den Teilnehmenden, ganz wie beim klassischen Barcamp, selbst durchgeführt werden. Infos & Anmeldung
5. Mai bis 23. September 2022
Schulleitungsqualifizierung (Online und Präsenz): Digital Leadership und die Gestaltung schulischer Transformationsprozesse
Das Forum Bildung Digitalisierung und die Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gemeinnützige GmbH (aim) bieten diese dreiteilige Fortbildung für Schulleitungen an. Teilnehmende sollen lernen, “Entwicklungsvorhaben an ihrer Schule professionell umzusetzen”. Zwei der Module finden in Präsenz in Heilbronn, eines online statt.
die Geschichte der digitalen Bildung in Deutschland ist eine Geschichte des Wartens. Ein Beispiel dafür ist Arndt Kwiatkowski, ein früher Digitalisierer, der 2008 die Mathe-Lernplattform “Bettermarks” aufbaute. Allerdings bekam er erst 2018 den ersten Auftrag eines Bundeslandes, mit seiner Mathe-App Schülern beim Lernen zu helfen – und Lehrern beim Unterrichten. “In manchen Bundesländern finden wir nicht mal jemanden, der mit uns spricht”, verriet Kwiatkowski meiner Kollegin Sofie Czilwik, die ihn besucht hat.
Genauso geht es der Lernplattform “Optima” aus der Ukraine. Die Online-Schule hat alle ihre Angebote auf gratis umgestellt – wegen des Krieges. Damit alle Geflüchteten, egal wohin es sie in Europa verschlagen hat, umsonst lernen können. Seit Wochen allerdings wartet Optima vergeblich darauf, von den Kultusministerministern oder dem BMBF eine finanzielle Förderung zu bekommen. Nun ändert Optima sein Geschäftsmodell: sie verwandelt sich in eine NGO, ein gemeinwohlorientiertes Angebot. Die Hoffnung: dass dann aus Deutschland eine Förderung kommt – bevor das Portal pleite geht. Wir berichten genauer, sollten sich die Kultusminister bewegen.
Und noch ein Start-up haben wir im Fokus: “Simpleclub”. Die enervierend frechen Sprecher der Simpleclub-Lernvideos sollen nun auch Azubis zum Lernen anstacheln. Die Gründer wollen bis zum Jahresende den Lernstoff von 20 Berufen in der App haben. Aber auch Simpleclub hat eben nicht nur Freunde. Die ehemaligen Mathe-Youtuber hätten ein “parasitäres Verhältnis zum Schulsystem”, sagt einer der einflussreichsten deutschen Didaktiker. Wie kommt er darauf?
Ich wünsche eine spannende Lektüre


Die unter Jugendlichen beliebteste Lernapp will die duale Ausbildung modernisieren: Simpleclub digitalisiert mit Lernvideos die Berufsbildung. Die Ausbildungsinhalte der Maler und Lackierer, Bank- und Industriekaufleute sind mithilfe der Industrie bereits als Videos, Aufgaben und Tests auf der Lern- und Videoplattform verfügbar. Derzeit arbeiteten 40 Mitarbeiter daran, den Stoff eines weiteren Dutzends von Berufen zu digitalisieren, teilte Simpleclub mit. Nach eigenen Angaben nutzten knapp 21.000 Auszubildende die Lern-App, um sich auf die Arbeit und Prüfungen vorzubereiten. Insgesamt gibt es 1,3 Millionen Lehrlinge in Deutschland.
Die Lernvideos sind auch für die Berufsbildung im typischen frechen Stil der Simpleclub-Erfinder Alexander Giesecke und Nicolai Schork gehalten. “Was zur Hölle ist eine Ammoniakalische Netzmittelwäsche?”, fragt der Sprecher im Video über Lackieruntergründe. “Aha, cool, und wo brauche ich sowas, bitte, im echten Leben?” lautet die Frage bei Sortieralgorithmen. Dieser Stil stößt bei Lehrer:innen auf Kopfschütteln bis Empörung, kommt bei Jugendlichen aber häufig an. Und er ist erfrischender als bei der Konkurrenz. Die Erklärfilme bei Westermanns “Georg” oder dem Unternehmen “Vocanto” sind fachlich korrekt, aber lange nicht so munter. Die “Cornelsen-Ecademy” hat mit ihrer automatisierten Stimme den Charme des “Pauk mit: Latein” im Telekolleg des Bayerischen Fernsehens von vor 50 Jahren. Nur dass es heute bei Cornelsen vorgelesene Texte wie dieser sind: “Die elektrische Energie für die Energieversorgung wird zuvor aus einer anderen Energieform umgewandelt.”
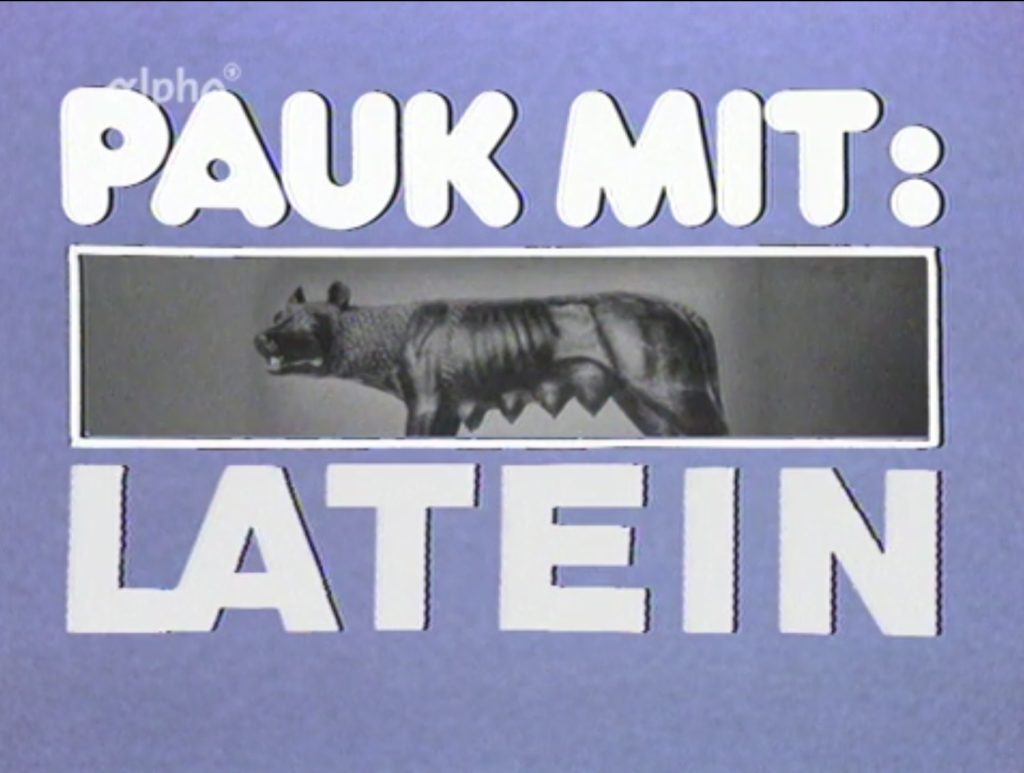
Simpleclub ist schon seit zehn Jahren auf dem Markt, anfangs nur mit Lernvideos, inzwischen mit einer App, die vom Karteikartensystem über Aufgaben bis zu virtueller Realität reicht. Die Videoschmiede der beiden Gründer Schork und Giesecke ist Objekt einer Hassliebe. Schüler verehren die kessen Lernvideos, die selbsternannte pädagogische Elite verachtet sie. Das Konsumieren von Videos löse bei Schülern zwar Euphorie aus, sei aber nicht mehr als Kompetenzsimulation. So kritisiert etwa der Erlanger Deutschdidaktiker Axel Krommer, Simpleclub habe ein “parasitäres Verhältnis zum Schulsystem”.
Am Anfang haben Unternehmen wie der Lackhersteller Brillux oder die Sparkassen die Produktion von Simpleclub-Lernvideos, Aufgaben und Tests für die Berufsbildung bezahlt. Seitdem finanziert das EdTech Simpleclub, das inzwischen rund 120 Mitarbeiter hat und 500 Millionen Klicks verzeichnet, die Digitalisierung des Lernpensums weiterer Berufe eigenständig. Bis Ende nächsten Jahres will die Azubi-Sparte von Simpleclub unter Alexander Powell 40 Berufsbilder in der App darstellen. Dann geht es nicht mehr nur um die Elektroniker und Mechatroniker sowie die vielen Kaufmannsberufe, die zusammen rund 750.000 Lehrlinge in Deutschland stellen, sondern auch um Handwerk und Gesundheitsberufe. Simpleclub registriert 200.000 Nutzungen der Azubi-Inhalte pro Monat.
Aus der Industrie kommt Beifall für das digital unterstützte Lernen. Die Azubis des Gebäude-Digitalisierers “Johnson Consults” etwa seien positiv überrascht gewesen über die Anschaffung von Simpleclub-Lizenzen, berichtet Ausbildungsleiter Tobias Loreth. “Das ist genau das, was wir brauchen”, hätten die Azubis gesagt. “Das ist in unserer Sprache, und ich habe direkt Lust weiterzulernen.” Johnson Consults bildet ein Dutzend Berufsbilder aus, die von den Kaufleuten über die Elektroniker für Automatisierungstechnik bis zu Mechatronikern für Kältetechnik reichen.
Obwohl Simpleclub diese Berufe nicht komplett abdeckt, hat das Unternehmen den Schritt gewagt. “Die Auszubildenden können die Themen, die sie gerade in der Berufsschule haben, nachschlagen und sich einfach aneignen“, sagte der Ausbildungsleiter. “Früher hat man dem Auszubildenden einen Gutschein für ein Buch überreicht, das geht nicht mehr.” Heute gebe man ihnen einen überall verfügbaren Link. “Dann können die Azubis alle Themen, die sie für ihre Ausbildung brauchen, in ihrer Sprache finden. Das ist meiner Meinung nach zeitgemäßes Lernen.”
Allerdings hat Johnson Consults auch hohe Erwartungen an Simpleclub. Das Problem sei, dass noch nicht alle Berufe abgebildet sind. “Für uns ist wichtig, dass bis Ende des Jahres der Hauptteil unserer zwölf Ausbildungsberufe in Simpleclub auftauchen”, sagte Loreth. Der 30-Jährige hat selbst als Schüler und Studierender Simpleclub genutzt. Ihn bewegen allerdings nicht Emotionen, sondern der Nutzen. “Ich sehe Simpleclub einfach als ein weiteres Buch – nur in einer neuen Form”, sagt er. “Das ist eine Möglichkeit, für eine Generation, die das Digitale gewöhnt ist, sich Informationen gebündelt und leicht aufbereitet anzueignen. Nicht mehr und nicht weniger”. Auch beim Datenschutz ist Loreth kritischer als die Azubis und manches Start-up. Das Thema Datenschutz sei bei den Azubis nicht präsent, sagt Loreth. “Aber für uns als Firma ist das extrem wichtig. Deswegen gehen unsere Azubis auch nicht mit ihrem vollen Namen und ihrer Mailadresse in die App, sondern komplett anonym.”
Intuitive Lernapps könnten helfen, zwei Probleme der dualen Ausbildung zu kontern. Erstens gibt es eine Reihe von Berufsschülern, die dem Medium Buch abhold sind; sie lassen sich möglicherweise durch kurzweilige Lernvideos besser motivieren. “Es gibt junge Leute, die du mit einem Arbeitsblatt nicht mehr engagieren kannst”, sagte Alexander Powell. Zweitens ist die Digitalisierung für die duale Ausbildung nicht nur ein Problem, sondern auch ein Hilfsmittel.
Das sieht man an Tobias Loreth. Wollte der Ausbildungsleiter alle seine 60 Azubis ohne digitale Kommunikationsmittel regelmäßig persönlich treffen, dann wäre er nur noch auf der Autobahn. Digital kann Loreth in regionalen Videocalls sich immer wieder die Sorgen und Nöte der Azubis anhören. “Es gibt leider nicht wenige Ausbilder und Betriebe, die noch wie in den 60er Jahren arbeiten – konsequent analog”, sagt Loreth. “Erst wenn wir die technische Entwicklung und die Lebenswelt unserer Azubis ernst nehmen, dann können wir die berufliche Ausbildung durch Digitalisierung wieder attraktiv machen.”
Das allerdings dürfte noch ein bisschen dauern. Die großen digitalen Plattformen für Azubis Cornelsen Ecademy, Simpleclub, Westermann Georg und Vocanto haben nach einer Umfrage von Bildung.Table zusammen um die 70.000 Nutzer. Das bedeutet, dass nur etwas über fünf Prozent der Lehrlinge ihre Smartphones und Laptops auch zum Lernen nutzen.

Bettermarks ist wohl die erfolgreichste digitale Lernanwendung in Deutschland. Die Plattform hilft Schüler:innen dabei, Mathe besser zu verstehen. Mehrere Studien, vom Unternehmen Bettermarks GmbH in Auftrag gegeben, belegen, dass das für Schüler:innen tatsächlich funktioniert: Sie schneiden in Mathe besser ab, wenn sie Bettermarks nutzen. Mittlerweile lernen in mehreren Bundesländern und Schulen in Deutschland, aber auch in den Niederlanden, in Südafrika und in Urugay, Kinder und Jugendliche mit Bettermarks. Doch bis dahin war es ein weiter Weg, sagt Gründer und Geschäftsführer Arndt Kwiatkowski.
Was ist eine gute Geschäftsidee?
Aus meiner Sicht: Wenn man es durch technische Innovation schafft, für viele das Leben einfacher zu machen. Es interessiert mich nicht, den nächsten Energydrink auf den Markt zu bringen, nur um am Ende mehr rauszubekommen, als man reingesteckt hat. Mir und meinem Team geht es darum, zur Lösung gesellschaftlich relevanter Probleme beizutragen.
Sie haben 1997 das Portal Immobilienscout24 gegründet. Was genau ist daran gesellschaftlich relevant?
Als wir angefangen haben, hat eine Suche nach einer Immobilie in Deutschland über vier Monate gedauert, mit Immobilienscout24 fanden Wohnungssuchende 2007 innerhalb von zwei Monaten eine neue Wohnung. Einfach, weil durch uns der Markt transparenter wurde.
Mit Bettermarks haben Sie eine Mathe-Lernplattform entwickelt. Wie kamen Sie von Immobilien zu Schule?
Nachdem Christophe Speroni, Marianne Voigt und ich 2008 aus immobilienscout24 ausgestiegen sind, haben wir uns gemeinsam überlegt, in welchem Bereich wir gründen wollen. Zur Auswahl stand die Gesundheitsbranche und der Bildungsbereich. Beides Felder, in denen die Digitalisierung in Zukunft eine zunehmende Rolle spielen würde. Wir entschieden uns für Bildung. Das interessierte uns mehr. Außerdem dachten wir, dass es viel einfacher sei, hier eine Lösung zu finden. Dem war dann nicht so.
Das heißt, für eine Geschäftsidee braucht man erst ein Problem, das gelöst werden muss, und dazu dann die passende Lösung?
Absolut. Deshalb ging es uns auch nicht darum, eine Nachhilfeapp für ein paar Schüler zu entwickeln, sondern von Anfang an zielten wir auf das öffentliche Schulsystem ab. Dass das aber so lange dauern würde, bis unser Produkt in diesem Schulsystem auch wirklich genutzt wird, hätten wir nicht gedacht.
Sie haben 2008 gegründet, wann haben Sie die erste Lizenz für ein Bundesland verkauft?
Zehn Jahre nach der Gründung, also 2018 an Hamburg. Mittlerweile haben auch Rheinland-Pfalz, Bremen, Brandenburg, Niedersachsen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Lizenzen erworben. Sodass wir als Unternehmen letztes Jahr unseren Break Even erreicht haben. Heißt: Wir nehmen jetzt mehr ein als wir ausgeben und können unsere Produkte weiterentwickeln.
Sie haben sich 12 Jahre lang als Unternehmen nicht getragen? Wie haben Sie so lange überlebt?
Zu einem geringen Teil durch unser Eigenkapital, das ich und meine Mitgründer mitgebracht haben, aus dem Verkauf unserer Anteile von Immobilienscout24. Und vor allem durch regelmäßige Finanzierungsrunden mit externen Investoren.
Wie oft mussten Sie Geld einsammeln?
Gefühlt endlos. Bestimmt alle eineinhalb Jahre. Insgesamt haben wir über 30 Millionen Euro in Bettermarks investiert, bevor es sich getragen hat. Und Geld bekamen wir auch nur, weil wir immer wieder Erfolge vorweisen konnten. Beispielsweise verkauften wir an ganz Uruguay 2013 eine Lizenz für die Klassenstufen 5 bis 10.
Warum wollte keine deutsche Bildungsbehörde ihre Lernapp?
Im Jahr 2010 haben wir einen Piloten durchgeführt, mit 12 Schulen. Nach drei Monaten haben sich die teilnehmenden Lehrkräfte zusammengesetzt und haben gesagt: Wenn wir in der Breite bessere Ergebnisse in Mathematik erzielen wollen, dann brauchen wir Bettermarks! Die Reaktion des Vertreters des Bildungsministeriums war: herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Projekt! Die Bildungsrendite ist toll! Leider kann ich nichts für Sie tun!
Heißt: kein Geld. Ab wann haben sich die Bildungsbehörden dann für Sie interessiert?
Erst ab 2016, als die KMK ihre Strategie “Bildung in der digitalen Welt” veröffentlichte. Ab dann gab es ein breiteres Interesse daran, das Bildungssystem wirklich zu digitalisieren. Denn mit der wachsenden Heterogenität der Schulklassen steigen die Herausforderungen für Lehrkräfte. Adaptive Lernsysteme, wie Bettermarks, können die Lehrkräfte entlasten und den Schülern das Lernen im individuellen Tempo ermöglichen.
Das deutsche Bildungssystem gilt als zu bürokratisch und starr. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit?
Dort, wo es zu einer Zusammenarbeit gekommen ist, klappt sie sehr gut. In etlichen Bundesländern existiert das Bewusstsein, dass digitale Innovationen, weder von bestehenden Marktspielern kommen, noch von den Behörden selbst. Das Bildungssystem braucht also Unternehmen wie uns. Allerdings haben wir uns als Gesellschaft komplizierte Strukturen auferlegt: Etwa die Ausschreibungen oder dass die Behörden in die Unterrichtsgestaltung der Schulen nicht eingreifen dürfen. Und in manchen Bundesländern suchen wir immer noch nach Entscheidern, die mit uns sprechen können.
Wo ist es besonders schwierig?
Wir haben Lizenzen an sieben Bundesländer verkauft, im Saarland und in Schleswig-Holstein führen wir Pilotprojekte durch, in den meisten anderen haben wir noch keine Möglichkeit für eine breitere Zusammenarbeit gefunden.
Sie verkaufen nicht nur an Länder, sondern auch an einzelne Schulen. Lohnt sich das überhaupt?
Unsere Lizenz kostet für alle gleich, 10 Euro pro Kind, pro Jahr. Natürlich ist es sowohl für uns als auch für die Schulen sinnvoller, über die Landesbehörden zu gehen. Denn so beschleunigen wir die Verbreitung unseres Angebotes und die Schulen müssen sich nicht um alles selbst kümmern. Sie brauchen, um Bettermarks zu nutzen, idealerweise eine digitale Infrastruktur, sie müssen Fragen des Datenschutzes klären und ihren Lehrern Weiterbildungen anbieten. Und vor allem: Sie brauchen ein Budget. Mit Unterstützung der Bildungsbehörden ist das natürlich einfacher. Es gibt immer noch Schulen, in denen die Lehrer mit dem Klingelbeutel durch die Klassen laufen müssen, um die Bettermarks-Lizenzen zu finanzieren.
Wohin geht es für Ihr Unternehmen als Nächstes?
Zuerst wollen wir möglichst alle Schüler in Deutschland erreichen. Bisher wird Bettermarks von gut 400 Tausend Schülerinnen und Schüler genutzt, über fünf Millionen könnten wir in den Klassenstufen 4 bis 13 erreichen.
Und danach?
Mathematik eignet sich sehr gut für digitale Lösungen. Wir bieten ein adaptives Übungsheft an, das sich an das Wissen und Können der Schüler anpasst. Wir wollen dies zu einem adaptiven Lehrwerk weiterentwickeln, sodass Lehrkräfte das System für alle Phasen des Mathematik-Unterrichts nutzen können. Zum Beispiel auch, um die Klasse in ein neues Thema einzuführen.
Werden Sie Lernsysteme für andere Fächer anbieten?
Wir haben zusammen mit unseren Partnern begonnen, ein adaptives Lehrwerk für das Fach Deutsch zu entwickeln. Dieses, und das für Mathematik, soll für die Klassenstufe 5 ab September 2023 in einer ersten Version nutzbar sein. Ab wann wir dann weitere Fächer angehen, hängt natürlich auch vom Interesse der Schulen und Landesbehörden ab.
Das digitale Schulzeugnis kommt -die Frage ist nur weiterhin wie. Das Projekt will dafür sorgen, dass das Einreichen von Zeugnissen bei Bewerbungen reibungslos und fälschungssicher wird. Damit ist es Teil eines ehrgeizigen Digitalisierungsvorhabens des Bundes, bei dem alle staatlichen Leistungen auch digital angeboten werden sollen. Der erste Testlauf, der von dem federführend zuständigen Bundesland Sachsen-Anhalt organisiert wurde, kam nun massiv in die Kritik: Ein Hacker und eine Hackerin konnten ungehindert in das Testsystem eingreifen und sich angeblich Zeugnisse ausstellen. Ein Fachjournalist beim IT-Nachrichtendienst Golem urteilte über das Pilotprojekt, es habe “haarsträubend triviale Anfängerfehler”. Für Aufregung sorgt aber auch das Festhalten an der umstrittenen Blockchain-Technologie. Dass diese gar nicht aus technischen Gründen verwendet wurde, zeigen jetzt auch ältere Strategieentwürfe zur Digitalisierung und ein internes Positionspapier, das Bildung.Table vorliegt.
Die Technologie hinter dem “Digitalen Schulzeugnis” entwickelt die Bundesdruckerei. Die Ziele des Projekts sind nachvollziehbar: Die analogen Zeugnisse verursachen in den Amtsstuben viel Arbeit. Bewirbt sich eine Person nach der Schule bei einer Universität, muss sie meist eine beglaubigte Zeugniskopie einreichen. Ein beliebig kopierbares digitales Schulzeugnisses soll hingegen technisch leicht in der Uni oder auch von einem Arbeitgeber auf Echtheit überprüft werden können. Damit das funktioniert, wird in das ausdruckbare PDF-Zeugnis noch eine XML-Datei mit strukturierten, maschinenlesbaren Daten integriert.
Bereits hier setzte die Kritik der erwähnten Hacker:innen an: Denn beide Dateiformate sind durch ihre Komplexität sehr anfällig für Angriffe. Lilith Wittmann berichtete auf Twitter, dass sie ein eigenes Zeugnis generieren konnte, ohne autorisiert zu sein. Die Bundesdruckerei nahm daraufhin das System offline und entschuldigte sich: “Naturgemäß ist ein System während des Testbetriebs noch nicht fertig, kann also Fehler, Schwachstellen oder Funktionseinschränkungen enthalten.”
Aber wie kam das digitale Zeugnis nun zu einer Blockchain: Damit die ins PDF integrierte digitale Zeugnisdatei zertifiziert und fälschungssicher ist, wird für jedes Zeugnis eine kryptografische Prüfsumme (ein sogenannter Hash) errechnet. So kann man die Inhalte auf Echtheit und Unveränderlichkeit überprüfen. Bei der kleinsten Änderung des PDFs ändert sich diese Prüfsumme und ein Fehler wird ausgegeben. Und weil nur anerkannte Ausgabestellen autorisiert sind, eine korrekte Prüfsumme zu errechnen, kann von einer betrügerischen Person nach einer Veränderung keine gültige, neue Prüfsumme berechnet werden. Bis zur Prüfsumme ist die Technologie unumstritten. Aber offen ist die Frage, wie eine Ausgabestelle autorisiert wird und wo die Prüfsummen gespeichert werden soll. Da gibt es sehr kontrovers diskutierte Lösungen.
Möglich wäre ein zentrales Zertifikatesystem, eine sogenannte Public Key Infrastruktur, wie sie sie in der Informatik seit Jahren bekannt und bewährt ist. Ein solche wurde beispielsweise auch bei der Ausgabe und Prüfung von Impfnachweisen in der EU eingesetzt: Eine zentrale Stelle autorisiert Ausgabestellen und die stellen so Zertifikate aus, die von beliebigen Apps oder Tools auf Echtheit überprüft werden können. Stattdessen hat die Bundesdruckerei aber eine andere, sehr neue Technologie eingesetzt, mit der staatliche Institutionen noch kaum Erfahrung haben: die Blockchain-Technologie. Dort wird das Zeugniszertifikat nicht von einem zentralen Schlüssel zertifiziert, sondern als Block an eine lange Kette vorheriger Zertifikate angehängt und kryptographisch mit ihnen verknüpft. Diese Verkettung von kryptografischen Datensätzen baut immer auf den vorherigen Datensätzen auf. Man kann daher an den bestehenden Daten nichts ändern, ohne dass dies einen Fehler verursacht. Dadurch ist es unmöglich, vorherige Datensätze unbemerkt zu manipulieren. Wenn ein Zeugnis korrigiert wird, muss man es als neue Version in der Blockchain ablegen. Und das Anhängen neuer Blocke geschieht nur mit Konsens aller anderen Parteien, die die Blockchain betreiben.
Die Blockchain-Technologie kennt man vor allem vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Auch dort muss jede Überweisung von Bitcoin von der gesamten Community überprüft werden können, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt. Das digitale Zeugnis nutzt übrigens keine dieser öffentlich nutzbaren Blockchains aus dem Bereich der Kryptowährungen. Eine Genossenschaft aus 15 IT-Dienstleistern wird eine eigene Blockchain-Infrastruktur betreiben -laut Lilith Wittmann basiert die Software aber auf der bekannten Blockchain der Kryptowährung Ethereum. Spätestens hier stellt sich die Frage, warum eine einfache Zeugnis-Zertifizierung mit derart neuer, aufwändiger und komplizierter Softwarestruktur gebaut werden soll. Die Blockchain löst ein Problem, das hier gar nicht vorliegt: ein vertrauenswürdiges System in einem dezentralen, nicht vertrauenswürdigem Umfeld zu schaffen.
Wir wissen, dass es zwischen den Bundesländern oft Reibung gibt, aber ein derartiges Niveau von Misstrauen zwischen den Schulbehörden oder den IT-Betreibern scheint nicht gegeben. Das Vertrauen zwischen ausstellenden Schulen, Universitäten und Rechenzentren muss vorausgesetzt werden, sonst wäre bereits vor der Eingabe eine Manipulation möglich. Das sieht auch die IT-Sicherheitscommunity aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs nicht anders, berichtet die “Zeit”: “Was die Verantwortlichen damit erreichen wollen, sei auch mit weniger aufwendiger, längst etablierter Technologie möglich. Mit einer Infrastruktur aus digitalen Signaturen und Zertifikaten zum Beispiel ließen sich Dokumente absichern und verifizieren.”
Warum also Blockchain? Hinweise auf den eigentlichen Grund finden sich nun in einem internen Positionspapier, das Bildung.Table vorliegt. Dort heißt es: “Ausschlaggebend für die Entscheidung, diese Blockchainlösung zu favorisieren (…) waren neben der Betrachtung und Bewertung der verschiedenen Architekturoptionen auch die Blockchainstrategie des Bundes, die das digitale Zeugnis als einen möglichen Anwendungsfall enthielt. “Tatsächlich wurde bereits in der 30. Sitzung des IT-Planungsrats im Beschluss 2019/58 erklärt, dass eine Blockchain-basierte Zeugnisvalidierung als Anwendungsfall umzusetzen sei. Man beabsichtige, Finanzmittel für eine exemplarische Blockchain-Implementierung bereitzustellen. “Nachweise incl. Zeugnisvalidierung” seien solche Beispiele für den Einsatz der Blockchain-Technologie. “Die Ausarbeitung und Durchführung von Proof of Concepts sind für die Erprobung der Blockchain-Technologie von Bedeutung”, heißt es weiter.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe sich dafür ausgesprochen, “in Blockchain-Technologie… zu investieren”. Die Entscheidung zur Blockchain-Technologie wurde also gar nicht bei der Bundesdruckerei aufgrund einer technologieneutralen Bewertung getroffen, sondern wurde von oben herab diktiert und mit Fördergeld ausgestattet. Zum Glück scheint in letzter Minute Einsicht eingekehrt zu sein: bestehende Architekturansätze (also die Blockchain) sollen nun überprüft und andere Ansätze (vermutlich das zentrale Zertifikatsmodell) nochmals mit betrachtet werden.
Der Fokus solle eine leichtgewichtige Lösung ermöglichen, heißt es in dem internen Bewertungspapier aus der Behörde in Sachsen-Anhalt. In dem Papier kritisiert man auch die Beteiligung der 15 IT-Dienstleister, die an der Blockchain mitwirken. Diese sind keineswegs, wie von der Bundesdruckerei behauptet, “im Staatsbesitz”. Ein Gründungsmitglied ist beispielsweise Governikus, ein anderes regio IT. Ganz normale Unternehmen, die hier natürlich auch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Entsprechend fürchtet das interne Positionspapier einen “Vendor Lock-In” und verweist auf unklare langfristige Betriebskosten. Ab Mai 2022 soll die bestehende technische Konzeption überarbeitet werden. Für alle betroffenen Schulen bleibt zu wünschen, dass ab dann die beste und sicherste technische Lösung gesucht wird, anstatt die jungen Leute zu Blockchain-Labormäusen der Bundes-IT zu machen. Matthias Eberl
Die Arbeit mit Microsoft MS 365 ist an Schulen in Baden-Württemberg wegen mangelnden Datenschutzes nur bis zum Sommer erlaubt. “Ab dem kommenden Schuljahr ist die Nutzung von MS 365 an Schulen zu beenden”, ließ der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, mitteilen. Er setzt damit eine Leitentscheidung für die Bundesrepublik. Den anderen Ländern dürfte es nun schwerfallen, ihre unstete Haltung zu Microsoft aufrechtzuerhalten. Brink “setzt konsequent die richtig erkannte Rechtslage um.” So kommentierte der Sprecher der Arbeitskreise Schule und Medienbildung der Datenschutzkonferenz, Lutz Hasse. Den betroffenen Schulen im Ländle will Brink helfen. Sie sollen digitale Schreibprogramme, Lernwolken und Mail-Systeme finden, die nicht das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung der Schüler verletzen.
Die Reaktion aus dem Bildungsministerium in Stuttgart war ambivalent. Einerseits teilte ein Sprecher mit, den betroffenen Schulen “stehen die Lernmanagementsysteme itslearning und Moodle als Alternative zur Verfügung.” Andererseits fand er den Zeitpunkt der Mitteilung ungünstig. “Die Schulen befinden sich momentan in den schriftlichen Prüfungen zum Abitur.” Allerdings werden Prüfungen nicht mit Microsoft geschrieben. Ohnehin ist die Nutzung von Microsoft an den Schulen wegen der Datenschutz-Probleme nicht sofort untersagt. Es ist nur lange klar, dass die Zeit abläuft.
Entsprechend äußerten sich Schulleitungen. “Ich spüre keinen Schmerz. Wir sind anderweitig sehr gut aufgestellt”, schrieb der Leiter der Friedrich-Boysen-Realschule in Altensteig, Klaus Ramsaier. Seine Kollege Steffen Siegert von der Josef-Schmitt-Realschule in Lauda-Königshofen lobte Microsoft: “die Möglichkeiten von MS 365 habe ich noch bei keiner anderen Plattform gefunden.” Die Teamleiterin des Landesmedienzentrums, Saskia Ebel, begrüßte die klare Ansage. Sie verwies auf die bevorstehenden Moodletage und die itslearning-Tage, bei denen sich Schulen Alternativen anschauen könnten. “Schade nur für all die Schulen, die sich da nun eingearbeitet haben”, schrieb Ebel. Allerdings: die Schulen wussten, dass für Microsoft die Sanduhr abläuft. “Wir sind gar nicht erst eingestiegen”, sagte Dominic Brucker von der Gemeinschaftsschule Jettingen. “Ungeschickt war aber sicherlich, dass dieses Produkt explizit in einem der ersten Corona-Schreiben des Bildungsministeriums aufgeführt wurde.” Der Datenschutzexperte der GEW, René Scheppler sieht “für die Schulleitungen ein deutliches Signal, sich ihrer vollen, alleinigen Verantwortung bewusst sein zu müssen.”
Die unendliche Geschichte des Datenschutz-Streits um Microsoft für Schulen ist noch nicht zu Ende. Die Datenschutzbeauftragten warten noch auf einen Bericht aus Bayern, wo der Präsident des dortigen Landesamtes mit Microsoft sprach. Zugleich gibt es eine weitere Arbeitsgruppe der Datenschutzkonferenz, die zusammen mit den Kultusministern mit Microsoft verhandelt. Über all diesen Gesprächen schwebt das geplante neue Abkommen zwischen EU und USA, das US-Präsident Biden und Kommissionspräsidentin von der Leyen skizziert haben. Die USA planen etwa, für Datentransfers ein eigenes Gericht aufzubauen. Das könnte bedeuten, dass betroffene europäische Bürger ein Klagerecht in den USA bekommen – bisher sind sie nicht existent. Allerdings ist nicht klar, welchen Status dieses Gericht haben wird. “Das sind neue Rechtskonstrukte, die zunächst daraufhin durchleuchtet werden müssen, ob sie den bisherigen Forderungen des EuGH genügen”, sagte Lutz Hasse. Sollte die Kommission einen Angemessenheitsbeschluss erlassen, wären Microsoft-Produkte wieder nutzbar. Auch an Schulen. Christian Füller
Diese Schulcloud ist nun auch auf Ukrainisch benutzbar. Muttersprachler, “die für ein Übersetzungsbüro arbeiten”, haben die Navigation der Lernwolke der Länder Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen ins Ukrainische übersetzt. Das teilte der Betreiber Dataport auf Anfrage mit. In den drei Ländern, welche die Schulcloud als Landeslösung angeschafft haben, ist die Bedienung für Schüler und Lehrer ohne weiteres möglich. So können etwa Lehrkräfte, die Willkommensklassen betreuen, sofort mit ihr arbeiten. Nach Informationen von Bildung.Table wollen auch andere Länder die Schulcloud für diesen Zweck nutzen. Dafür gibt es bislang aber keine offizielle Bestätigung.
Die Übersetzer:innen haben zwar noch keine Lerninhalte der Bildungscloud ins Ukrainische übersetzt. Es stehen aber Lehrmaterialien aus der Ukraine mittlerweile in digitaler Fassung bereit – als PDF bei Mundo (Bildung.Table berichtete). So könnten Lehrkräfte die deutsche Lernplattform als digitale Infrastruktur nutzen und ukrainische Lehrmaterialien sinnvoll in den Unterricht einbauen. Eine Sprecherin von Dataport, welches die Cloud betreibt, sagte Bildung.Table, dass die Idee für die Übersetzung aus dem Schulcloud-Verbund der Länder kam. Bisher war die Cloud in Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar.
Die Schulcloud war ursprünglich als Sprung des deutschen Bildungswesens in die digitale Zukunft gedacht. Das Hasso-Plattner-Institut sollte das Produkt für alle Schulen in Deutschland entwickeln – so der anfängliche Plan, als es 2017 losging. Übrig geblieben sind heute immerhin 1,4 Millionen Nutzende an circa 4.000 Schulen weltweit (z.B. haben auch deutsche Auslandsschulen Zugänge erhalten). Brandenburg, Thüringen und Niedersachsen experimentierten ab 2018 zunächst unabhängig voneinander mit der Schulcloud, bis sich die Länder im Sommer letzten Jahres zu einem Verbund zusammentaten. Dataport, eine Anstalt des Öffentlichen Rechts, übernahm Verantwortung für das Projekt. Die Plattform selbst ist datenschutzkonform, und Nutzende können sich von jedem Endgerät aus einwählen.
Die Initiative des Schulcloud-Verbunds ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, doch stellt sie die Handlungsfähigkeit der KMK-Taskforce infrage. Die leistet bisher nur zwei Dinge: regelmäßige Veröffentlichung von Zahlen über schulpflichtige Kinder und Implementierung eines erleichterten Hochschulzulassungsverfahrens für aus der Ukraine Geflüchtete. Somit reagieren Bundesländer nach wie vor allein oder im selbstgewählten Verbund auf eine bundesweite Herausforderung. Robert Saar
2. Mai 2022, 14:00-17:30 Uhr
Online-Barcamp: Erste Hilfe – Ukrainische Geflüchtete im Bildungsbereich
In diesem Online-Barcamp können die Teilnehmenden Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext des Ukraine-Kriegs besprechen. Der thematische Rahmen ist weit gefasst: Wie sehen gute Bildungsangebote zum Krieg in der Ukraine aus? Wie können Schüler:innen aus der Ukraine in Deutschland unterstützt werden? Konkrete Sessions können auf der Website vorgeschlagen und von den Teilnehmenden, ganz wie beim klassischen Barcamp, selbst durchgeführt werden. Infos & Anmeldung
5. Mai bis 23. September 2022
Schulleitungsqualifizierung (Online und Präsenz): Digital Leadership und die Gestaltung schulischer Transformationsprozesse
Das Forum Bildung Digitalisierung und die Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gemeinnützige GmbH (aim) bieten diese dreiteilige Fortbildung für Schulleitungen an. Teilnehmende sollen lernen, “Entwicklungsvorhaben an ihrer Schule professionell umzusetzen”. Zwei der Module finden in Präsenz in Heilbronn, eines online statt.