ab dem kommenden Frühjahr will die EU gemeinsam Gas einkaufen und damit die Speicher für den folgenden Winter befüllen. Bei der Energieplattform wird den Gasunternehmen voraussichtlich eine entscheidende Rolle zukommen. “Die Gasunternehmen sind es, die die Plattform zum Laufen bringen müssen”, sagte der stellvertretende Generaldirektor Matthew Baldwin in dieser Woche. Bereits am Dienstag will die Kommission einen ersten konkreten Vorschlag vorlegen. Manuel Berkel hat recherchiert, welche Modelle für den EU-Gaseinkauf im Gespräch sind.
Vier Jahre lang war die sozialistische Parteienfamilie nicht mehr zusammengekommen, nun ist es wieder so weit: Heute Nachmittag beginnt der Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Berlin. Auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Vorsitzenden: Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven soll den Bulgaren Sergej Stanischew ablösen. Einen wichtigen Schritt nach vorn macht aber besonders SPD-Politikerin Katarina Barley, die Stellvertreterin von Löfven werden soll. Damit verschafft sie sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Europawahlen 2024, wie Markus Grabitz und Till Hoppe analysieren.
Weil die USA Druck machen, könnte die EU in Zukunft monatlich 1,5 Milliarden Euro an die Staatskasse in Kiew überweisen. Die Kommission arbeitet zurzeit an einem Vorschlag, ein Entwurf wird am Dienstag erwartet. Die genaue Zahl sei noch offen, doch man strebe “strukturierte Hilfe” für die Ukraine an, sagte ein EU-Diplomat. Eric Bonse berichtet.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start ins Wochenende!

Die Energieplattform ist wie eine EU im Kleinen. Zusammenarbeit finden alle gut, aber hinter den Kulissen wird heftig gerungen – um Einfluss, Spielregeln und Finanzen. Wenige Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte die Kommission zum ersten Mal eine gemeinsame europäische Plattform vorgeschlagen, um neue, günstige Verträge mit großen Gasexporteuren abzuschließen. Doch erst in den vergangenen Tagen setzte sich die Idee wirklich durch.
Im Sommer schwärmten die Energieminister der wichtigsten europäischen Volkswirtschaften noch zu eigenen Gasbeschaffungstouren aus. Gemeinsam beschlossen sie zwar, ihre Speicher für den Winter zu befüllen. Doch die Kosten dafür waren hoch und dieser ruinöse Wettkampf soll sich im nächsten Sommer nicht wiederholen. “Wir müssen ein Szenario vermeiden, bei dem sich die Mitgliedstaaten wieder gegenseitig auf den Weltmärkten überbieten und die Preise für Europa in die Höhe treiben”, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vergangene Woche vor dem Parlament in Straßburg an. Seitdem ist Bewegung in die Sache gekommen.
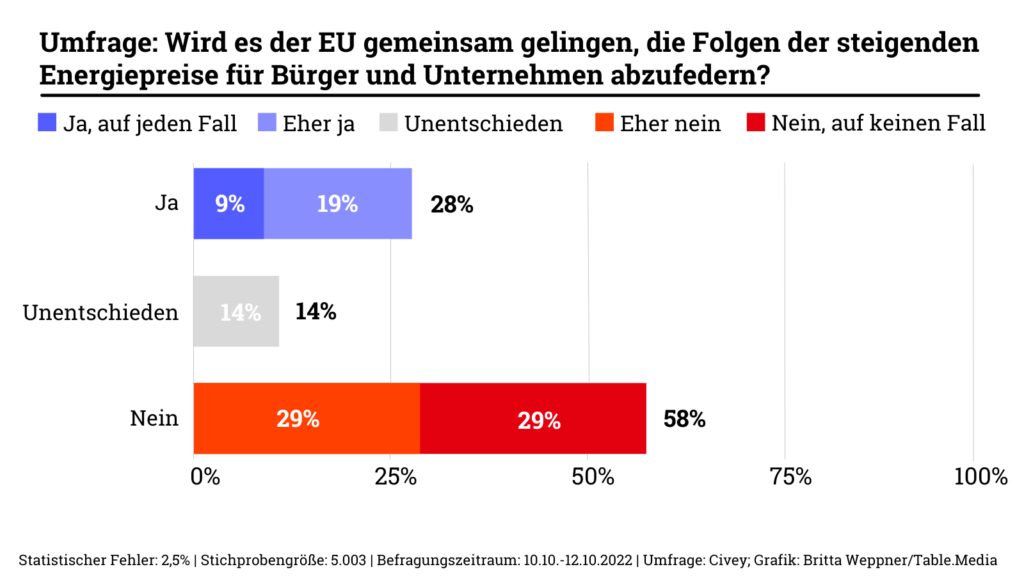
Deutschland soll sich lange gegen einen gemeinsamen Gaseinkauf gewehrt haben, weil es seine Marktmacht ausspielen wollte, um der eigenen Industrie genug Energie zu sichern. Die Bedenken waren nicht unbegründet. Die Notlage dürfe nicht noch dadurch verschärft werden, dass sich die reichen westeuropäischen Länder das gesamte Gas sichern und die am stärksten abhängigen Staaten noch verwundbarer machen, warnte die Denkfabrik Bruegel im Juni. Die Energieplattform sehen die Experten nicht nur als Mittel zum Preisdumping, sondern auch zur gerechteren Verteilung des eingekauften Gases zwischen finanzstärkeren und -schwächeren Mitgliedstaaten.
Anfang der Woche kursierte dann ein Non-Paper Deutschlands und der Niederlande, in dem sie der gemeinsamen Beschaffung das Wort redeten. Der Druck war allerdings auch gewachsen: 17 Staaten unterstützen inzwischen als radikalste Maßnahme einen allgemeinen Preisdeckel, der den gesamten Gashandel in der EU bedrohen könnte. Bei ihrem informellen Treffen in Prag stellten sich die Energieminister am Mittwoch hinter die Forderung der Kommission, die Energieplattform schon bis zum nächsten Frühjahr an den Start zu bringen.
Bereits am Dienstag will die Kommission einen ersten konkreten Vorschlag vorlegen. An diesem Tag soll sich auch zum ersten Mal der industrielle Beirat der Energieplattform treffen. Denn bisher kaum beachtet, wird die Plattform bereits aufgebaut. Ende Mai gründete die Generaldirektion Energie eine Task Force, in der sie inzwischen über 40 Mitarbeiter zusammengezogen hat.
Weiteres Personal soll folgen, berichtete diese Woche der stellvertretende Generaldirektor Matthew Baldwin bei einer Veranstaltung. Geleitet wird das Team von der Chefin für Energiepolitik, der spanischen Juristin Cristina Lobillo Borrero. Ihr zur Seite stehen drei Direktoren für Verhandlungen, Beziehungen zu den Mitgliedstaaten und internationale Beziehungen.
Eine wesentliche Rolle sollen aber die Gasunternehmen bilden. Die Kommission erwäge, die Mitgliedstaaten über den Notfallartikel 122 jeweils einen Versorger auswählen zu lassen, welcher der Energieplattform angehört, berichtete Anfang der Woche die “Financial Times”. Diese könnten angewiesen werden, einen Teil ihres Gases über die gemeinsame Plattform zu beschaffen.
“Die Gasunternehmen sind es, die die Plattform zum Laufen bringen müssen”, sagt Baldwin. “Die Mitgliedstaaten kaufen kein Gas und ich kann definitiv sagen, dass die Kommission auch kein Gas kaufen wird.”
Auf dem Weltmarkt für LNG gelten zwar auch europäische Versorger nicht zu den erfahrensten Spielern, aber trotzdem verfügen nur sie über das nötige Wissen: das Buchen und Versichern von Flüssiggas-Schiffen oder das Bewirtschaften von Regasifizierungsterminals, Pipelines und Speichern.
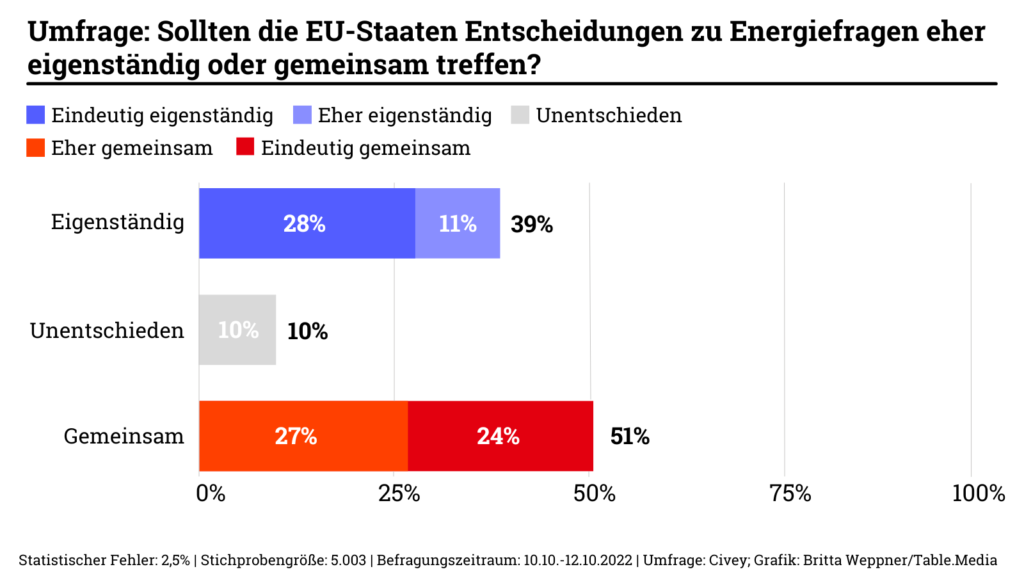
Organisieren könnten die Beschaffung über die Plattform entweder ein einzelner Käufer im Auftrag der europäischen Versorger oder aber Joint Ventures der Unternehmen, sagte die Direktorin für Verhandlungen, Monika Zsigri, vor einigen Wochen. Die Kommission werde Pilotprojekte vorschlagen, um die finanziellen Vorteile zu testen, kündigte sie bei Eurogas an.
Bruegel hat für LNG-Importe Auktionen untersucht. Eine Herausforderung werde es allerdings, sich wirklich zusätzliche Mengen zu sichern und nicht einfach vorhandene europäische Käufer auszustechen. Absprachen könnten auch mit Großbritannien nötig werden, das sowohl über LNG-Importterminals als auch über Gasleitungen in die EU verfügt.
Gemeinsame Beschaffung war nach dem REPowerEU-Plan der Kommission vom Mai allerdings erst als zweiter Schritt für die Energieplattform gedacht. Ein Vorteil wäre demnach schon das Bündeln der Nachfrage. Dafür solle die Plattform zunächst einmal Daten darüber sammeln, welche Langfristverträge wann auslaufen und welche noch ungenutzte Optionen für zusätzliche Lieferungen beinhalten.
Unterstützen sollen die Koordinierung fünf regionale Task-Forces, von denen sich bisher zwei gebildet haben. Deutschland ist in einer Gruppe mit acht weiteren Staaten von Polen bis zu Kroatien und Italien.
Wie Energiekommissarin Kadri Simson in Prag sagte, soll der neue Fokus der Plattform aber wie von Ursula von der Leyen angekündigt auf einem koordinierten Befüllen der Speicher im nächsten Frühjahr und Sommer liegen. Bruegel hat dazu untersucht, wie das deutsche Modell der Strategic Storage Based Options (SSBO) auf die ganze EU übertragen werden könnte. Dabei würde ein Marktgebietsverantwortlicher wie die Trading Hub Europe (THE) der deutschen Netzbetreiber Speicheroptionen versteigern und das gespeicherte Gas im Krisenfall selbst verkaufen.
Allerdings würde dieses System weiter unterschiedliche Gaspreise innerhalb Europas voraussetzen und nachträgliche Hilfen für finanzschwächere Staaten. Die 17er-Gruppe um Frankreich, Spanien, Italien und Polen befürwortet dagegen einen engen Preiskorridor für alle Mitgliedstaaten. Auf den nächsten europäischen Gipfeln gibt es also noch einige Fragen rund um die Energieplattform zu lösen.
Die EU-Abgeordnete Katarina Barley (SPD) steigt in der europäischen Parteienfamilie der Sozialisten (PES) auf. Wenn die PES an diesem Freitag bei ihrem Kongress in Berlin die neue Spitze wählt, wird Barley Stellvertreterin von Stefan Löfven. Der neue Parteichef Löfven ist ehemaliger Ministerpräsident von Schweden.
Barley verschafft sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Europawahlen 2024. Die Frauen in der PES wollten in der Partei eigentlich eine Doppelspitze durchsetzen, scheiterten aber am Widerstand aus den Mitgliedsparteien. Der Kompromiss ist, dass der Vorstand der PES von vier auf acht Sitze verdoppelt wird. Zugleich haben die PES-Frauen das Recht durchgesetzt, unabhängig von der Postenverteilung nach Länderproporz eine Kandidatin in den Vorstand zu berufen. Diese Kandidatin ist Barley.
Andernfalls hätte Achim Post, Bundestagsabgeordneter aus NRW, wohl sein Amt als Generalsekretär der PES abgeben müssen. Wenn Barley nicht auf dem “Frauen-Ticket” Partei-Vize geworden wäre, wäre die Ämterhäufung bei den deutschen Sozialdemokraten in der Parteienfamilie nicht durchgegangen. Im Hinblick auf das enttäuschende Wahlergebnis 2019 mahnt ein einflussreicher deutscher Sozialdemokrat auch die Schärfung des inhaltlichen Profils an: “Nur auf neue Köpfe zu setzen, reicht nicht. Die Parteienfamilie muss auch an ihren Positionen arbeiten und die Kräfte bündeln.”
Führende Sozialdemokraten kritisieren die Strukturen beim Kongress der PES, wie der Parteitag in der sozialistischen Parteienfamilie genannt wird. Die Delegierten seien nicht nach den üblichen Regeln der innerparteilichen Demokratie bestimmt worden. Die wahlberechtigten Teilnehmer des Treffens seien vielmehr “wild zusammengesetzt” worden. Ein Teilnehmer spricht von einem “interessant ausgewählten Delegiertenkörper”.
Gewählt wird bei dem Treffen auch nur der Vorsitzende. Die Besetzung der acht Stellvertreterposten wurde zuvor unter den großen europäischen Parteien ausgehandelt sowie im Fall von Barley von den PES-Frauen durchgesetzt. Ein Teilnehmer bezeichnet denn auch die neue Führungsspitze nicht als Parteivorstand, sondern spöttisch als “sozialdemokratischen Aufsichtsrat”.
In der deutschen SPD ist Barley bereits die europapolitische Nummer eins. Sie ist Europabeauftragte im SPD-Parteivorstand. Ein Amt, das seinerzeit für Martin Schulz geschaffen wurde und auf der Hierarchiestufe der Vizeparteichefs steht. Sie steuert die europapolitische Ausrichtung der SPD. Sie leitet einen informellen Strategiekreis, in dem sich sechs einflussreiche Sozialdemokraten regelmäßig abstimmen. Mit dabei sind unter anderem der Fraktionsvorsitzende Ralf Mützenich und der Staatssekretär im Kanzleramt, Jörg Kukies.
Barley, in der schwarz-roten Koalition einst Justizministerin, war bei der Europawahl 2019 auf Listenplatz eins ins Straßburger Parlament eingezogen. Sie ist eine von 14 Vize-Präsidentinnen und -Präsidenten im EU-Parlament. Und sie wurde von Parteichefin Saskia Esken bereits als Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokraten bei der nächsten Europawahl 2024 benannt. Von der Ankündigung wurden Jens Geier, der die Gruppe der 16 deutschen EU-Abgeordneten führt, sowie der ehemalige Fraktionschef im EU-Parlament, Udo Bullmann, kalt erwischt.
Mit der Resolution, die der PES-Kongress in Berlin beschließt, bekennt sich die PES zum Spitzenkandidaten-Prinzip. Wie 2014 und 2019 wird sie also einen europäischen Spitzenkandidaten benennen. Die Parteienfamilien wollen gegenüber den Staats- und Regierungschefs den Spitzenkandidaten, der bei der Wahl die meisten Stimmen holt, als nächsten Kommissionspräsidenten durchsetzen.
Vier Jahre lang war die sozialistische Parteienfamilie wegen der Pandemie nicht mehr zusammengekommen. Beim Kongress in Berlin begannen jetzt die Sondierungen, wer der nächste Spitzenkandidat und damit das Gesicht der PES bei der nächsten Europawahl werden soll. Gehandelt werden der neue Parteichef Löfven sowie Portugals Ministerpräsident António Costa. Vielleicht versucht es auch Frans Timmermans noch einmal, der beim letzten Mal knapp vor dem Einzug in die oberste Etage im Berlaymont abgefangen wurde.
Die Frauen bringen bereits Katarina Barley und Iratxe García Pérez ins Gespräch. Wobei García Pérez, die Fraktionschefin, bei vielen EU-Abgeordneten keinen guten Stand hat. Sie werfen ihr vor, zu sehr am Gängelband von Pedro Sánchez zu sein, dem sozialistischen Ministerpräsidenten von Spanien. Mit Till Hoppe
Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei
17.10.-18.10.2022
Themen: Informationen der Kommission zu handelsbezogenen landwirtschaftlichen Fragen, Informationen der Kommission zur Marktsituation, insbesondere nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.
Vorläufige Tagesordnung
Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten
17.10.2022 09:30 Uhr
Themen: Gedankenaustausch zur russischen Aggression gegen die Ukraine, Gedankenaustausch zu China.
Vorläufige Tagesordnung
Plenartagung des EU-Parlaments: COP27, alternative Kraftstoffe, beschäftigungspolitische Maßnahmen
17.10.2022 17:00-22:00 Uhr
Themen: Aussprache zur Klimaschutzkonferenz 2022 der Vereinten Nationen (COP27), Aussprache zu alternativen Kraftstoffen, Aussprache zu den Leitlinien für die beschäftigungspolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten.
Vorläufige Tagesordnung
Wöchentliche Kommissionssitzung
18.10.2022
Themen: Arbeitsprogramm der EU-Kommission für das Jahr 2023.
Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz 15 Uhr
Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten
18.10.2022 10:00 Uhr
Themen: Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rats am 20. und 21. Oktober 2022, Folgemaßnahmen zur Konferenz über die Zukunft Europas, Sachstand zur Rechtsstaatlichkeit in Polen.
Vorläufige Tagesordnung
Plenartagung des EU-Parlaments: Folgen des Ukraine-Kriegs, Erweiterung Schengen-Raum, Arbeitsprogramm der Kommission
18.10.2022 09:00-22:00 Uhr
Themen: Aussprache zu den sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, Abstimmung zum Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum, Aussprache zum Arbeitsprogramm der Kommission 2023.
Vorläufige Tagesordnung
Dreigliedriger Sozialgipfel
19.10.2022
Themen: Die Regierungschefs, die EU-Kommission und die europäischen Sozialpartner beraten zur Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Infos
Plenartagung des EU-Parlaments: Europäischer Rat, Ansprache Čaputová, Gesamthaushaltsplan 2023
19.10.2022 09:00-22:00 Uhr
Themen: Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rats vom 20./21. Oktober, Ansprache von Zuzana Čaputová (Präsidentin der Slowakischen Republik), Abstimmung zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der EU für das Haushaltsjahr 2023.
Vorläufige Tagesordnung
Europäischer Rat
20.10.-21.10.2022
Themen: Ukraine, Energie, Fragen der Wirtschaft, Außenbeziehungen.
Vorläufige Tagesordnung
Informelle Ministertagung Verkehr
20.10.-21.10.2022
Themen: Die Verkehrsminister kommen zu Beratungen zusammen.
Infos
Die EU bereitet sich auf die Zahlung von direkten und permanenten Budgethilfen für die Ukraine vor. Sie sollen sich an den angekündigten US-Zahlungen in Höhe von monatlich 1,5 Milliarden Dollar orientieren, heißt es in Brüsseler EU-Kreisen. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, betont die EU-Kommission, die mit Hochdruck an einem Vorschlag arbeitet. Der Entwurf der Brüsseler Behörde wird am kommenden Dienstag erwartet.
Hintergrund ist die anhaltende und existenzbedrohende Finanzierungslücke im ukrainischen Staatshaushalt. Sein Land brauche im kommenden Jahr 55 Milliarden US-Dollar zur Deckung der Budgetlücke und für den Wiederaufbau, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte bei der IWF-Tagung der Finanzminister am Mittwoch in New York. Den monatlichen Finanzbedarf bezifferte er auf zwei bis vier Milliarden Dollar.
Je mehr Hilfe die Ukraine bekomme, desto schneller könne sie den Krieg mit Russland beenden und mit dem Wiederaufbau beginnen, sagte Selenskyj. Nötig sei auch ein neues, ständiges Format mit den Geberländern nach dem Vorbild der internationalen Waffenhilfe. Sie wird von den USA im sogenannten Ramstein-Format organisiert und umfasst 50 Staaten und Organisationen.
Die USA stellten sich hinter Selenskyjs Forderungen – und machen nun Druck auf die EU. Brüssel könnte künftig, ähnlich wie Washington, monatlich 1,5 Milliarden Euro an die Staatskasse in Kiew überweisen. Die genaue Zahl sei noch offen, allerdings werde an “strukturierter Hilfe” für die Ukraine gearbeitet, sagte ein EU-Diplomat. Ähnlich äußerte sich die EU-Kommission, die sich auch noch nicht auf eine bestimmte Summe festlegen will.
Es sei wichtig, mit den internationalen Partnern einen Weg zu finden, wie man die Ukraine auch nach 2022 unterstützen könne, “und zwar in einer Weise, die vorhersehbare und stabile Finanzströme in die Ukraine gewährleistet und eine internationale Lastenteilung vorsieht”, sagt ein Kommissionssprecher auf Anfrage von Europe.Table.
Neben der Höhe der Finanzhilfen steht auch zur Debatte, ob sie als Kredite oder als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden sollen. Deutschland hatte im Sommer eine Milliarde Euro als Zuschuss gewährt und die EU-Partner aufgefordert, ebenso zu verfahren. Allerdings verhallte der Ruf ungehört. Die Finanzminister haben Ende September fünf Milliarden Euro als zusätzliche Makrofinanzhilfe bewilligt. Sie wird in Form von langfristigen Darlehen zu besonders günstigen Bedingungen gewährt.
Insgesamt hat das “Team Europa” der Ukraine nach Angaben der EU-Kommission bis Mitte September bereits 19 Milliarden Euro an Finanzhilfen gewährt. Direkte monatliche Budgethilfen an ein EU-Kandidatenland im Krieg hat es bisher noch nicht gegeben; auch deswegen gestalten sich die Beratungen in Brüssel schwierig.
Eine Einigung wurde dagegen bereits in der Frage einer EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten erzielt. In einem ersten Schritt will die EU rund 15.000 ukrainische Soldaten ausbilden. Neben Deutschland will auch Polen ein Hauptquartier einrichten. Er erwarte einen Beschluss beim nächsten Treffen der EU-Außenminister am Montag, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.
Die ungarische Regierung erhält mehr Zeit, um die drohende Sperrung von EU-Geldern wegen rechtsstaatlicher Defizite abzuwenden. Die Mitgliedstaaten beschlossen am Donnerstag, die Frist für Budapest um zwei Monate bis zum 19. Dezember zu verlängern. Die rechtspopulistische Regierung von Premier Viktor Orbán muss 17 Maßnahmen umsetzen, damit die insgesamt 7,5 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln fließen.
Orbán hat der EU-Kommission zugesichert, die 17 Maßnahmen zum Kampf gegen Korruption und mehr Transparenz nach einem festen Zeitplan umzusetzen. Dies soll in den kommenden Wochen geschehen. Die Kommission soll die Fortschritte beurteilen, auf Basis der Bewertung wird der Rat dann spätestens vor Weihnachten über die Freigabe der Milliarden aus Brüssel entscheiden.
Viele Regierungen misstrauen Orbáns Zusicherungen, den Kampf gegen die Korruption endlich ernsthaft aufzunehmen. Um sicherzustellen, dass die Reformen auch umgesetzt würden, sei ein “sehr scharfes Monitoring” nötig, sagte die deutsche Europastaatsministerin Anna Lührmann. Eine Anfrage für eine Stellungnahme ließ die ungarische Regierung bis Redaktionsschluss unbeantwortet. tho/hps
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat seine Eckpunkte für das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz ausgearbeitet. In Kürze werde man die Abstimmung mit den Sicherheitsressorts der Bundesregierung einleiten, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen.
Im Koalitionsvertrag hatte die Regierung eine “restriktive Rüstungsexportpolitik” mit “verbindlicheren Regeln” angekündigt. Diese sollen erstmalig in einem nationalen Gesetz festgeschrieben werden. Zugleich will die Bundesregierung eine gemeinsame Verordnung mit den EU-Partnern abstimmen.
Die neuen Kriterien leiten sich aus der bisherigen EU- und Bundespolitik ab, sollen nun aber auch menschenrechtliche Risiken stärker berücksichtigen, heißt es in einem Papier, das Table.Media vorliegt.
Die Eckpunkte sehen vor, dass NATO- und EU-Länder einen privilegierten Zugang zu deutschen Waffen gesetzlich verankert bekommen. Für alle anderen Länder – sogenannte Drittstaaten – gilt das Prinzip der Einzelfallprüfung. Mehrere neue Länder – Südkorea, Singapur, Chile und Uruguay – sollen ebenfalls als NATO-gleichwertig eingestuft werden, heißt es.
Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte im September Kritik von Grünen-Politikern geerntet, als sie sich gegen strenge Exportregeln aussprach. Das von Grünen-Politiker Robert Habeck geleitete BMWK ist federführend für das neue Gesetz.
In Europa gelten die deutschen Exportregeln als relativ streng, was nach Ansicht von Kritikern gemeinsame EU-Rüstungsprojekte erschwert. Dennoch bleibt das Land einer der größten Exporteure der Welt. Im Jahr 2021 wurden Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von rund 9,4 Milliarden Euro aus Deutschland erteilt, wie das BMKW im August mitteilte. Dieser historische Höchststand sei bedeutenden Lieferungen an Ägypten zu bedanken.
Kritiker wie Greenpeace fordern ein ausnahmsloses Rüstungsexportverbot in nicht-EU Länder. “Deutsche Gewehre sind im Jemen in den Händen von Huthi-Rebellen gesichtet worden, bei Drogenkonflikten im mexikanischen Chihuahua, waren an Massakern im Sudan beteiligt, an den Bürgerkriegen in Somalia, Libyen und Myanmar – obwohl sie überall dort gar nicht sein dürften”, schreibt die Umwelt- und Friedensorganisation auf ihre Webseite. joy
Im Zuge der Abstimmung zur Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) hat Berichterstatter Ismail Ertug (S&D) erneut einen Änderungsantrag für die Einführung eines Sanktionsmechanismus eingereicht. Ein identischer Vorschlag zur Durchsetzung der Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur unter Androhung von Strafen für Mitgliedstaaten oder Betreibern von Ladepunkten war im Verkehrsausschuss gescheitert.
Ertug hofft, im Plenum eine breitere Zustimmung zu erhalten, indem er die Notwendigkeit eines Sanktionsmechanismus “besser erklärt”. Man brauche den Druck auf die Mitgliedstaaten, die Ladeinfrastruktur auch tatsächlich aufzubauen, begründete er seine Forderung. Unterstützung kommt von den Grünen, Widerstand dagegen von EVP und Renew.
Die Debatte zur AFIR finden Montagabend (17.10) statt, die Abstimmung im Plenum am Mittwoch (19.10). Die anschließenden Triloge sind ebenfalls bereits teilweise terminiert. Am 27.10 wollen die Verhandlungsparteien erstmals zusammenkommen, am 29.11 zur zweiten Trilogrunde. luk
In die Gespräche über eine Milliardeninvestition des Chipherstellers TSMC in Deutschland kommt Bewegung. Das Magazin Capital berichtet, dass noch im Oktober eine Delegation des Unternehmens aus Taiwan nach Dresden reist, um sich über den Standort zu informieren. Table.Media hat bereits im vergangenen Monat über eine mögliche TSMC-Fabrik in Dresden berichtet.
TSMC scheut sich indes, auf eigene Faust eine Chip-Fabrik in Deutschland zu eröffnen und wirbt um Partner und öffentliche Förderung. Das Unternehmen hat außerhalb Taiwans erst zwei Werke errichtet, in Japan und den USA. Die Kosten für das neue Werk in Arizona, das in einigen Wochen eröffnet werden soll, seien doppelt so hoch ausgefallen wie in Taiwan, sagte Maria Marced, Präsidentin für Europa bei TSMC, am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Brüssel.
Das Unternehmen besitze zudem noch keine Erfahrung mit Geschäftstätigkeit in Europa. “Deshalb brauchen wir Hilfe: um die potenzielle Fabrik wettbewerbsfähig zu machen, um die nötigen Mitarbeiter zu finden, für den optimalen Betrieb”, sagte Marced. Als mögliche Partner einer Fabrik in Dresden gelten unter anderem NXP, Bosch und Infineon. tho/fmk
Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union bereiten Insidern zufolge eine weitere Klage gegen Google vor. Dabei soll es um das digitale Werbegeschäft der Alphabet-Tochter gehen. Die Klage könnte Anfang kommenden Jahres eingereicht werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Damit droht dem Unternehmen die vierte Geldstrafe in der EU in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro.
Die EU sei frustriert über die schleppenden Vergleichsverhandlungen. Sie wirft dem Suchmaschinen-Betreiber vor, seine Technologie zur Platzierung von Online-Werbung zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die Ermittlungen laufen seit Juni vergangenen Jahres. Das Anzeigengeschäft von Google, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 100 Milliarden Dollar erwirtschaftete, ist Alphabets größter Geldbringer. Es macht etwa 80 Prozent des Jahresumsatzes aus.
Die EU-Kommission wollte sich zu dem Thema nicht äußern, Google konnte zunächst nichts dazu sagen. Vor einigen Wochen hatte das Gericht der Europäischen Union eine Milliardenstrafe gegen das Unternehmen wegen illegaler Praktiken im Zusammenhang mit dem Handy-Betriebssystem Android bestätigt. rtr

Es ist wieder so weit: Nächste Woche ist Plenarsitzung in Straßburg. Es wird unter anderem um Geld und Gebäude debattiert und abgestimmt. In den Korridoren des Brüsseler EP-Gebäudes stehen schon die dunkelgrünen Koffer bereit.
Worum geht es? Um einen Änderungsantrag, den der Abgeordnete Nils Ušakovs von der S&D-Fraktion eingebracht hat. Der Antrag richtet sich gegen die Annahme des Vorschlags, über den nächste Woche abgestimmt werden soll, nämlich den Erwerb des Osmose-Gebäudes für das Europäische Parlament in Straßburg. Frankreich bietet dem Parlament diese Immobilie zum Kauf an. Im Gegenzug könnte das Parlament das Madariaga-Gebäude abstoßen – ein furchterregendes Labyrinth mit 80er-Jahre-Charme, das das Parlament beherbergt. Das Gebäude könnte in ein Hotel für die Abgeordneten umgewandelt werden.
Für Ušakovs würde ein solcher Austausch zu einer unvernünftigen Ausgabe von Steuergeldern führen, “besonders zu einer Zeit, in der die europäischen Bürger mit steigenden Energiepreisen und Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben”. Der Fall wäre relativ einfach, wenn das EU-Parlament nur einen Sitz hätte. Das Gebäude, in dem das Parlament in Brüssel untergebracht ist, befindet sich jedoch ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand. Der von Nils Ušakovs eingereichte Änderungsantrag fordert, “die Pläne für die Zukunft des Spaak-Gebäudes in Brüssel vollständig zu überdenken”. Denn auch hier erfordert der Zustand des Gebäudes eine Entscheidung, und zwar eine schnelle.
Das 1993 eröffnete Gebäude, das 303 Millionen Euro gekostet hat, soll Lecks, Stabilitätsprobleme sowie Mängel bei der Klimaanlage und der Isolierung aufweisen. Im Jahr 2012 musste das Gebäude vorübergehend geschlossen werden, nachdem in den Balken über dem Plenarsaal Risse entdeckt worden waren. Man befürchtete, dass sich der Vorfall wiederholen könnte, der sich vier Jahre zuvor im anderen Parlamentsgebäude in Straßburg, also eben dem Madariaga-Gebäude, ereignet hatte.
Abreißen und neu bauen oder komplett renovieren? Diese Frage ist noch offen und drängt in das politische Leben der Stadt Brüssel. Denn die Annahme, ein sehr umstrittenes Gebäude abzureißen, für das zuvor ein ganzes Wohnviertel weichen musste, würde die schlechte Stimmung in der Umgebung möglicherweise noch verschlimmern. Außerdem muss mit der Region Brüssel und den beiden betroffenen Stadtverwaltungen (Brüssel-Stadt und Ixelles) verhandelt werden, die heute etwas eifriger für ein weniger größenwahnsinniges Architekturprojekt eintreten, das die Stadt und ihre Bewohner besser respektiert.
Inzwischen steht immerhin fest, wer den internationalen Architekturwettbewerb zur Neugestaltung gewonnen hat. In der letzten Sitzungswoche im Juli hat die international besetzte unabhängige Jury des Wettbewerbs die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola informiert, welche Architektenentwürfe es auf die ersten fünf Plätze geschafft haben und damit in die nähere Auswahl kommen. Noch ist die Jury-Entscheidung aber geheim.
In die Debatte um die Gebäude mischt sich der nie ganz ausgestandene Streit über den Standort des Hauptsitzes – Brüssel oder Straßburg – und der faule Kompromiss, der drei Wochen in der belgischen Hauptstadt und eine Woche in der französischen Stadt vorsieht. Dieser Kompromiss führt zu einem monatlichen Umzug, dessen Kosten laut Nils Ušakovs auf rund 160 Millionen Euro pro Jahr geschätzt werden. Der vorsichtige lettische Europaabgeordnete plädiert dafür, das Hin und Her zwischen Brüssel und Straßburg “zumindest” während der Energiekrise auszusetzen, “so wie wir es während der Pandemie getan haben”.
Denn es ist bekannt, dass Frankreich seinen Sitz in Straßburg mit Zähnen und Klauen verteidigt. Im Parlament kann Paris insbesondere auf den Einfluss der französischen Europaabgeordneten in der Renew-Fraktion zählen. Darüber hinaus bildet die Wahl der Europaabgeordneten Fabienne Keller (Renew), ehemalige Bürgermeisterin von Straßburg und ehemalige Senatorin des Bas-Rhin, zur Quästorin ein einflussreiches französisches “Pro Straßburg”-Tandem mit ihrer Kollegin Anne Sander (EVP), die seit 2019 erste Quästorin ist.
ab dem kommenden Frühjahr will die EU gemeinsam Gas einkaufen und damit die Speicher für den folgenden Winter befüllen. Bei der Energieplattform wird den Gasunternehmen voraussichtlich eine entscheidende Rolle zukommen. “Die Gasunternehmen sind es, die die Plattform zum Laufen bringen müssen”, sagte der stellvertretende Generaldirektor Matthew Baldwin in dieser Woche. Bereits am Dienstag will die Kommission einen ersten konkreten Vorschlag vorlegen. Manuel Berkel hat recherchiert, welche Modelle für den EU-Gaseinkauf im Gespräch sind.
Vier Jahre lang war die sozialistische Parteienfamilie nicht mehr zusammengekommen, nun ist es wieder so weit: Heute Nachmittag beginnt der Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Berlin. Auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Vorsitzenden: Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven soll den Bulgaren Sergej Stanischew ablösen. Einen wichtigen Schritt nach vorn macht aber besonders SPD-Politikerin Katarina Barley, die Stellvertreterin von Löfven werden soll. Damit verschafft sie sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Europawahlen 2024, wie Markus Grabitz und Till Hoppe analysieren.
Weil die USA Druck machen, könnte die EU in Zukunft monatlich 1,5 Milliarden Euro an die Staatskasse in Kiew überweisen. Die Kommission arbeitet zurzeit an einem Vorschlag, ein Entwurf wird am Dienstag erwartet. Die genaue Zahl sei noch offen, doch man strebe “strukturierte Hilfe” für die Ukraine an, sagte ein EU-Diplomat. Eric Bonse berichtet.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start ins Wochenende!

Die Energieplattform ist wie eine EU im Kleinen. Zusammenarbeit finden alle gut, aber hinter den Kulissen wird heftig gerungen – um Einfluss, Spielregeln und Finanzen. Wenige Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte die Kommission zum ersten Mal eine gemeinsame europäische Plattform vorgeschlagen, um neue, günstige Verträge mit großen Gasexporteuren abzuschließen. Doch erst in den vergangenen Tagen setzte sich die Idee wirklich durch.
Im Sommer schwärmten die Energieminister der wichtigsten europäischen Volkswirtschaften noch zu eigenen Gasbeschaffungstouren aus. Gemeinsam beschlossen sie zwar, ihre Speicher für den Winter zu befüllen. Doch die Kosten dafür waren hoch und dieser ruinöse Wettkampf soll sich im nächsten Sommer nicht wiederholen. “Wir müssen ein Szenario vermeiden, bei dem sich die Mitgliedstaaten wieder gegenseitig auf den Weltmärkten überbieten und die Preise für Europa in die Höhe treiben”, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vergangene Woche vor dem Parlament in Straßburg an. Seitdem ist Bewegung in die Sache gekommen.
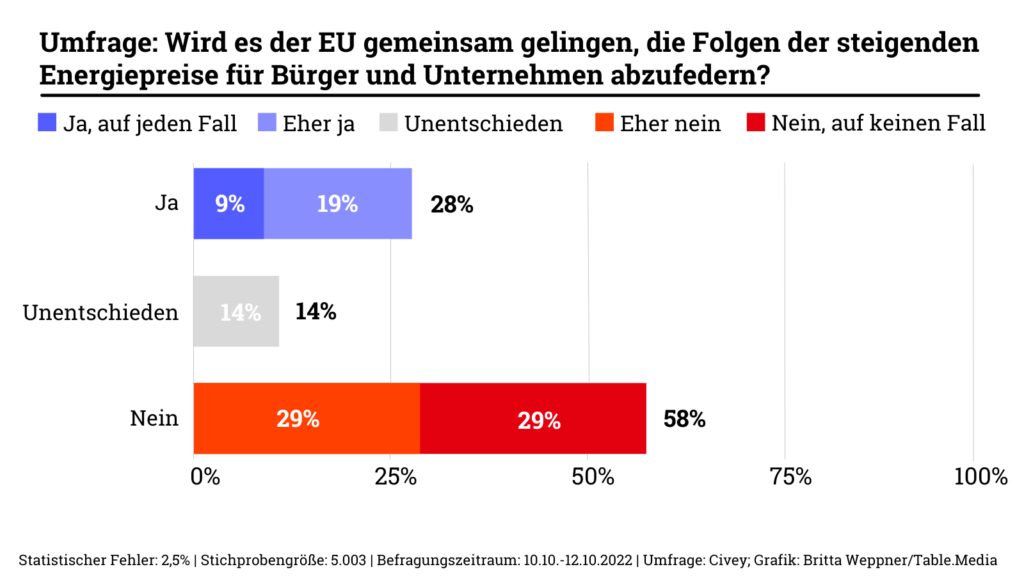
Deutschland soll sich lange gegen einen gemeinsamen Gaseinkauf gewehrt haben, weil es seine Marktmacht ausspielen wollte, um der eigenen Industrie genug Energie zu sichern. Die Bedenken waren nicht unbegründet. Die Notlage dürfe nicht noch dadurch verschärft werden, dass sich die reichen westeuropäischen Länder das gesamte Gas sichern und die am stärksten abhängigen Staaten noch verwundbarer machen, warnte die Denkfabrik Bruegel im Juni. Die Energieplattform sehen die Experten nicht nur als Mittel zum Preisdumping, sondern auch zur gerechteren Verteilung des eingekauften Gases zwischen finanzstärkeren und -schwächeren Mitgliedstaaten.
Anfang der Woche kursierte dann ein Non-Paper Deutschlands und der Niederlande, in dem sie der gemeinsamen Beschaffung das Wort redeten. Der Druck war allerdings auch gewachsen: 17 Staaten unterstützen inzwischen als radikalste Maßnahme einen allgemeinen Preisdeckel, der den gesamten Gashandel in der EU bedrohen könnte. Bei ihrem informellen Treffen in Prag stellten sich die Energieminister am Mittwoch hinter die Forderung der Kommission, die Energieplattform schon bis zum nächsten Frühjahr an den Start zu bringen.
Bereits am Dienstag will die Kommission einen ersten konkreten Vorschlag vorlegen. An diesem Tag soll sich auch zum ersten Mal der industrielle Beirat der Energieplattform treffen. Denn bisher kaum beachtet, wird die Plattform bereits aufgebaut. Ende Mai gründete die Generaldirektion Energie eine Task Force, in der sie inzwischen über 40 Mitarbeiter zusammengezogen hat.
Weiteres Personal soll folgen, berichtete diese Woche der stellvertretende Generaldirektor Matthew Baldwin bei einer Veranstaltung. Geleitet wird das Team von der Chefin für Energiepolitik, der spanischen Juristin Cristina Lobillo Borrero. Ihr zur Seite stehen drei Direktoren für Verhandlungen, Beziehungen zu den Mitgliedstaaten und internationale Beziehungen.
Eine wesentliche Rolle sollen aber die Gasunternehmen bilden. Die Kommission erwäge, die Mitgliedstaaten über den Notfallartikel 122 jeweils einen Versorger auswählen zu lassen, welcher der Energieplattform angehört, berichtete Anfang der Woche die “Financial Times”. Diese könnten angewiesen werden, einen Teil ihres Gases über die gemeinsame Plattform zu beschaffen.
“Die Gasunternehmen sind es, die die Plattform zum Laufen bringen müssen”, sagt Baldwin. “Die Mitgliedstaaten kaufen kein Gas und ich kann definitiv sagen, dass die Kommission auch kein Gas kaufen wird.”
Auf dem Weltmarkt für LNG gelten zwar auch europäische Versorger nicht zu den erfahrensten Spielern, aber trotzdem verfügen nur sie über das nötige Wissen: das Buchen und Versichern von Flüssiggas-Schiffen oder das Bewirtschaften von Regasifizierungsterminals, Pipelines und Speichern.
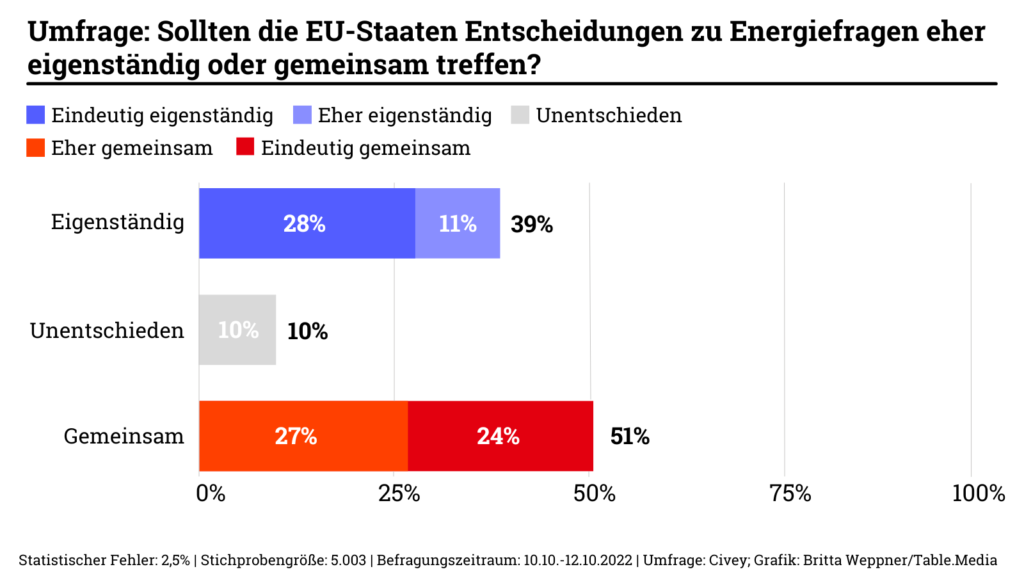
Organisieren könnten die Beschaffung über die Plattform entweder ein einzelner Käufer im Auftrag der europäischen Versorger oder aber Joint Ventures der Unternehmen, sagte die Direktorin für Verhandlungen, Monika Zsigri, vor einigen Wochen. Die Kommission werde Pilotprojekte vorschlagen, um die finanziellen Vorteile zu testen, kündigte sie bei Eurogas an.
Bruegel hat für LNG-Importe Auktionen untersucht. Eine Herausforderung werde es allerdings, sich wirklich zusätzliche Mengen zu sichern und nicht einfach vorhandene europäische Käufer auszustechen. Absprachen könnten auch mit Großbritannien nötig werden, das sowohl über LNG-Importterminals als auch über Gasleitungen in die EU verfügt.
Gemeinsame Beschaffung war nach dem REPowerEU-Plan der Kommission vom Mai allerdings erst als zweiter Schritt für die Energieplattform gedacht. Ein Vorteil wäre demnach schon das Bündeln der Nachfrage. Dafür solle die Plattform zunächst einmal Daten darüber sammeln, welche Langfristverträge wann auslaufen und welche noch ungenutzte Optionen für zusätzliche Lieferungen beinhalten.
Unterstützen sollen die Koordinierung fünf regionale Task-Forces, von denen sich bisher zwei gebildet haben. Deutschland ist in einer Gruppe mit acht weiteren Staaten von Polen bis zu Kroatien und Italien.
Wie Energiekommissarin Kadri Simson in Prag sagte, soll der neue Fokus der Plattform aber wie von Ursula von der Leyen angekündigt auf einem koordinierten Befüllen der Speicher im nächsten Frühjahr und Sommer liegen. Bruegel hat dazu untersucht, wie das deutsche Modell der Strategic Storage Based Options (SSBO) auf die ganze EU übertragen werden könnte. Dabei würde ein Marktgebietsverantwortlicher wie die Trading Hub Europe (THE) der deutschen Netzbetreiber Speicheroptionen versteigern und das gespeicherte Gas im Krisenfall selbst verkaufen.
Allerdings würde dieses System weiter unterschiedliche Gaspreise innerhalb Europas voraussetzen und nachträgliche Hilfen für finanzschwächere Staaten. Die 17er-Gruppe um Frankreich, Spanien, Italien und Polen befürwortet dagegen einen engen Preiskorridor für alle Mitgliedstaaten. Auf den nächsten europäischen Gipfeln gibt es also noch einige Fragen rund um die Energieplattform zu lösen.
Die EU-Abgeordnete Katarina Barley (SPD) steigt in der europäischen Parteienfamilie der Sozialisten (PES) auf. Wenn die PES an diesem Freitag bei ihrem Kongress in Berlin die neue Spitze wählt, wird Barley Stellvertreterin von Stefan Löfven. Der neue Parteichef Löfven ist ehemaliger Ministerpräsident von Schweden.
Barley verschafft sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Europawahlen 2024. Die Frauen in der PES wollten in der Partei eigentlich eine Doppelspitze durchsetzen, scheiterten aber am Widerstand aus den Mitgliedsparteien. Der Kompromiss ist, dass der Vorstand der PES von vier auf acht Sitze verdoppelt wird. Zugleich haben die PES-Frauen das Recht durchgesetzt, unabhängig von der Postenverteilung nach Länderproporz eine Kandidatin in den Vorstand zu berufen. Diese Kandidatin ist Barley.
Andernfalls hätte Achim Post, Bundestagsabgeordneter aus NRW, wohl sein Amt als Generalsekretär der PES abgeben müssen. Wenn Barley nicht auf dem “Frauen-Ticket” Partei-Vize geworden wäre, wäre die Ämterhäufung bei den deutschen Sozialdemokraten in der Parteienfamilie nicht durchgegangen. Im Hinblick auf das enttäuschende Wahlergebnis 2019 mahnt ein einflussreicher deutscher Sozialdemokrat auch die Schärfung des inhaltlichen Profils an: “Nur auf neue Köpfe zu setzen, reicht nicht. Die Parteienfamilie muss auch an ihren Positionen arbeiten und die Kräfte bündeln.”
Führende Sozialdemokraten kritisieren die Strukturen beim Kongress der PES, wie der Parteitag in der sozialistischen Parteienfamilie genannt wird. Die Delegierten seien nicht nach den üblichen Regeln der innerparteilichen Demokratie bestimmt worden. Die wahlberechtigten Teilnehmer des Treffens seien vielmehr “wild zusammengesetzt” worden. Ein Teilnehmer spricht von einem “interessant ausgewählten Delegiertenkörper”.
Gewählt wird bei dem Treffen auch nur der Vorsitzende. Die Besetzung der acht Stellvertreterposten wurde zuvor unter den großen europäischen Parteien ausgehandelt sowie im Fall von Barley von den PES-Frauen durchgesetzt. Ein Teilnehmer bezeichnet denn auch die neue Führungsspitze nicht als Parteivorstand, sondern spöttisch als “sozialdemokratischen Aufsichtsrat”.
In der deutschen SPD ist Barley bereits die europapolitische Nummer eins. Sie ist Europabeauftragte im SPD-Parteivorstand. Ein Amt, das seinerzeit für Martin Schulz geschaffen wurde und auf der Hierarchiestufe der Vizeparteichefs steht. Sie steuert die europapolitische Ausrichtung der SPD. Sie leitet einen informellen Strategiekreis, in dem sich sechs einflussreiche Sozialdemokraten regelmäßig abstimmen. Mit dabei sind unter anderem der Fraktionsvorsitzende Ralf Mützenich und der Staatssekretär im Kanzleramt, Jörg Kukies.
Barley, in der schwarz-roten Koalition einst Justizministerin, war bei der Europawahl 2019 auf Listenplatz eins ins Straßburger Parlament eingezogen. Sie ist eine von 14 Vize-Präsidentinnen und -Präsidenten im EU-Parlament. Und sie wurde von Parteichefin Saskia Esken bereits als Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokraten bei der nächsten Europawahl 2024 benannt. Von der Ankündigung wurden Jens Geier, der die Gruppe der 16 deutschen EU-Abgeordneten führt, sowie der ehemalige Fraktionschef im EU-Parlament, Udo Bullmann, kalt erwischt.
Mit der Resolution, die der PES-Kongress in Berlin beschließt, bekennt sich die PES zum Spitzenkandidaten-Prinzip. Wie 2014 und 2019 wird sie also einen europäischen Spitzenkandidaten benennen. Die Parteienfamilien wollen gegenüber den Staats- und Regierungschefs den Spitzenkandidaten, der bei der Wahl die meisten Stimmen holt, als nächsten Kommissionspräsidenten durchsetzen.
Vier Jahre lang war die sozialistische Parteienfamilie wegen der Pandemie nicht mehr zusammengekommen. Beim Kongress in Berlin begannen jetzt die Sondierungen, wer der nächste Spitzenkandidat und damit das Gesicht der PES bei der nächsten Europawahl werden soll. Gehandelt werden der neue Parteichef Löfven sowie Portugals Ministerpräsident António Costa. Vielleicht versucht es auch Frans Timmermans noch einmal, der beim letzten Mal knapp vor dem Einzug in die oberste Etage im Berlaymont abgefangen wurde.
Die Frauen bringen bereits Katarina Barley und Iratxe García Pérez ins Gespräch. Wobei García Pérez, die Fraktionschefin, bei vielen EU-Abgeordneten keinen guten Stand hat. Sie werfen ihr vor, zu sehr am Gängelband von Pedro Sánchez zu sein, dem sozialistischen Ministerpräsidenten von Spanien. Mit Till Hoppe
Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei
17.10.-18.10.2022
Themen: Informationen der Kommission zu handelsbezogenen landwirtschaftlichen Fragen, Informationen der Kommission zur Marktsituation, insbesondere nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.
Vorläufige Tagesordnung
Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten
17.10.2022 09:30 Uhr
Themen: Gedankenaustausch zur russischen Aggression gegen die Ukraine, Gedankenaustausch zu China.
Vorläufige Tagesordnung
Plenartagung des EU-Parlaments: COP27, alternative Kraftstoffe, beschäftigungspolitische Maßnahmen
17.10.2022 17:00-22:00 Uhr
Themen: Aussprache zur Klimaschutzkonferenz 2022 der Vereinten Nationen (COP27), Aussprache zu alternativen Kraftstoffen, Aussprache zu den Leitlinien für die beschäftigungspolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten.
Vorläufige Tagesordnung
Wöchentliche Kommissionssitzung
18.10.2022
Themen: Arbeitsprogramm der EU-Kommission für das Jahr 2023.
Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz 15 Uhr
Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten
18.10.2022 10:00 Uhr
Themen: Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rats am 20. und 21. Oktober 2022, Folgemaßnahmen zur Konferenz über die Zukunft Europas, Sachstand zur Rechtsstaatlichkeit in Polen.
Vorläufige Tagesordnung
Plenartagung des EU-Parlaments: Folgen des Ukraine-Kriegs, Erweiterung Schengen-Raum, Arbeitsprogramm der Kommission
18.10.2022 09:00-22:00 Uhr
Themen: Aussprache zu den sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, Abstimmung zum Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum, Aussprache zum Arbeitsprogramm der Kommission 2023.
Vorläufige Tagesordnung
Dreigliedriger Sozialgipfel
19.10.2022
Themen: Die Regierungschefs, die EU-Kommission und die europäischen Sozialpartner beraten zur Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Infos
Plenartagung des EU-Parlaments: Europäischer Rat, Ansprache Čaputová, Gesamthaushaltsplan 2023
19.10.2022 09:00-22:00 Uhr
Themen: Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rats vom 20./21. Oktober, Ansprache von Zuzana Čaputová (Präsidentin der Slowakischen Republik), Abstimmung zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der EU für das Haushaltsjahr 2023.
Vorläufige Tagesordnung
Europäischer Rat
20.10.-21.10.2022
Themen: Ukraine, Energie, Fragen der Wirtschaft, Außenbeziehungen.
Vorläufige Tagesordnung
Informelle Ministertagung Verkehr
20.10.-21.10.2022
Themen: Die Verkehrsminister kommen zu Beratungen zusammen.
Infos
Die EU bereitet sich auf die Zahlung von direkten und permanenten Budgethilfen für die Ukraine vor. Sie sollen sich an den angekündigten US-Zahlungen in Höhe von monatlich 1,5 Milliarden Dollar orientieren, heißt es in Brüsseler EU-Kreisen. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, betont die EU-Kommission, die mit Hochdruck an einem Vorschlag arbeitet. Der Entwurf der Brüsseler Behörde wird am kommenden Dienstag erwartet.
Hintergrund ist die anhaltende und existenzbedrohende Finanzierungslücke im ukrainischen Staatshaushalt. Sein Land brauche im kommenden Jahr 55 Milliarden US-Dollar zur Deckung der Budgetlücke und für den Wiederaufbau, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte bei der IWF-Tagung der Finanzminister am Mittwoch in New York. Den monatlichen Finanzbedarf bezifferte er auf zwei bis vier Milliarden Dollar.
Je mehr Hilfe die Ukraine bekomme, desto schneller könne sie den Krieg mit Russland beenden und mit dem Wiederaufbau beginnen, sagte Selenskyj. Nötig sei auch ein neues, ständiges Format mit den Geberländern nach dem Vorbild der internationalen Waffenhilfe. Sie wird von den USA im sogenannten Ramstein-Format organisiert und umfasst 50 Staaten und Organisationen.
Die USA stellten sich hinter Selenskyjs Forderungen – und machen nun Druck auf die EU. Brüssel könnte künftig, ähnlich wie Washington, monatlich 1,5 Milliarden Euro an die Staatskasse in Kiew überweisen. Die genaue Zahl sei noch offen, allerdings werde an “strukturierter Hilfe” für die Ukraine gearbeitet, sagte ein EU-Diplomat. Ähnlich äußerte sich die EU-Kommission, die sich auch noch nicht auf eine bestimmte Summe festlegen will.
Es sei wichtig, mit den internationalen Partnern einen Weg zu finden, wie man die Ukraine auch nach 2022 unterstützen könne, “und zwar in einer Weise, die vorhersehbare und stabile Finanzströme in die Ukraine gewährleistet und eine internationale Lastenteilung vorsieht”, sagt ein Kommissionssprecher auf Anfrage von Europe.Table.
Neben der Höhe der Finanzhilfen steht auch zur Debatte, ob sie als Kredite oder als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden sollen. Deutschland hatte im Sommer eine Milliarde Euro als Zuschuss gewährt und die EU-Partner aufgefordert, ebenso zu verfahren. Allerdings verhallte der Ruf ungehört. Die Finanzminister haben Ende September fünf Milliarden Euro als zusätzliche Makrofinanzhilfe bewilligt. Sie wird in Form von langfristigen Darlehen zu besonders günstigen Bedingungen gewährt.
Insgesamt hat das “Team Europa” der Ukraine nach Angaben der EU-Kommission bis Mitte September bereits 19 Milliarden Euro an Finanzhilfen gewährt. Direkte monatliche Budgethilfen an ein EU-Kandidatenland im Krieg hat es bisher noch nicht gegeben; auch deswegen gestalten sich die Beratungen in Brüssel schwierig.
Eine Einigung wurde dagegen bereits in der Frage einer EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten erzielt. In einem ersten Schritt will die EU rund 15.000 ukrainische Soldaten ausbilden. Neben Deutschland will auch Polen ein Hauptquartier einrichten. Er erwarte einen Beschluss beim nächsten Treffen der EU-Außenminister am Montag, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.
Die ungarische Regierung erhält mehr Zeit, um die drohende Sperrung von EU-Geldern wegen rechtsstaatlicher Defizite abzuwenden. Die Mitgliedstaaten beschlossen am Donnerstag, die Frist für Budapest um zwei Monate bis zum 19. Dezember zu verlängern. Die rechtspopulistische Regierung von Premier Viktor Orbán muss 17 Maßnahmen umsetzen, damit die insgesamt 7,5 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln fließen.
Orbán hat der EU-Kommission zugesichert, die 17 Maßnahmen zum Kampf gegen Korruption und mehr Transparenz nach einem festen Zeitplan umzusetzen. Dies soll in den kommenden Wochen geschehen. Die Kommission soll die Fortschritte beurteilen, auf Basis der Bewertung wird der Rat dann spätestens vor Weihnachten über die Freigabe der Milliarden aus Brüssel entscheiden.
Viele Regierungen misstrauen Orbáns Zusicherungen, den Kampf gegen die Korruption endlich ernsthaft aufzunehmen. Um sicherzustellen, dass die Reformen auch umgesetzt würden, sei ein “sehr scharfes Monitoring” nötig, sagte die deutsche Europastaatsministerin Anna Lührmann. Eine Anfrage für eine Stellungnahme ließ die ungarische Regierung bis Redaktionsschluss unbeantwortet. tho/hps
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat seine Eckpunkte für das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz ausgearbeitet. In Kürze werde man die Abstimmung mit den Sicherheitsressorts der Bundesregierung einleiten, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen.
Im Koalitionsvertrag hatte die Regierung eine “restriktive Rüstungsexportpolitik” mit “verbindlicheren Regeln” angekündigt. Diese sollen erstmalig in einem nationalen Gesetz festgeschrieben werden. Zugleich will die Bundesregierung eine gemeinsame Verordnung mit den EU-Partnern abstimmen.
Die neuen Kriterien leiten sich aus der bisherigen EU- und Bundespolitik ab, sollen nun aber auch menschenrechtliche Risiken stärker berücksichtigen, heißt es in einem Papier, das Table.Media vorliegt.
Die Eckpunkte sehen vor, dass NATO- und EU-Länder einen privilegierten Zugang zu deutschen Waffen gesetzlich verankert bekommen. Für alle anderen Länder – sogenannte Drittstaaten – gilt das Prinzip der Einzelfallprüfung. Mehrere neue Länder – Südkorea, Singapur, Chile und Uruguay – sollen ebenfalls als NATO-gleichwertig eingestuft werden, heißt es.
Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte im September Kritik von Grünen-Politikern geerntet, als sie sich gegen strenge Exportregeln aussprach. Das von Grünen-Politiker Robert Habeck geleitete BMWK ist federführend für das neue Gesetz.
In Europa gelten die deutschen Exportregeln als relativ streng, was nach Ansicht von Kritikern gemeinsame EU-Rüstungsprojekte erschwert. Dennoch bleibt das Land einer der größten Exporteure der Welt. Im Jahr 2021 wurden Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von rund 9,4 Milliarden Euro aus Deutschland erteilt, wie das BMKW im August mitteilte. Dieser historische Höchststand sei bedeutenden Lieferungen an Ägypten zu bedanken.
Kritiker wie Greenpeace fordern ein ausnahmsloses Rüstungsexportverbot in nicht-EU Länder. “Deutsche Gewehre sind im Jemen in den Händen von Huthi-Rebellen gesichtet worden, bei Drogenkonflikten im mexikanischen Chihuahua, waren an Massakern im Sudan beteiligt, an den Bürgerkriegen in Somalia, Libyen und Myanmar – obwohl sie überall dort gar nicht sein dürften”, schreibt die Umwelt- und Friedensorganisation auf ihre Webseite. joy
Im Zuge der Abstimmung zur Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) hat Berichterstatter Ismail Ertug (S&D) erneut einen Änderungsantrag für die Einführung eines Sanktionsmechanismus eingereicht. Ein identischer Vorschlag zur Durchsetzung der Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur unter Androhung von Strafen für Mitgliedstaaten oder Betreibern von Ladepunkten war im Verkehrsausschuss gescheitert.
Ertug hofft, im Plenum eine breitere Zustimmung zu erhalten, indem er die Notwendigkeit eines Sanktionsmechanismus “besser erklärt”. Man brauche den Druck auf die Mitgliedstaaten, die Ladeinfrastruktur auch tatsächlich aufzubauen, begründete er seine Forderung. Unterstützung kommt von den Grünen, Widerstand dagegen von EVP und Renew.
Die Debatte zur AFIR finden Montagabend (17.10) statt, die Abstimmung im Plenum am Mittwoch (19.10). Die anschließenden Triloge sind ebenfalls bereits teilweise terminiert. Am 27.10 wollen die Verhandlungsparteien erstmals zusammenkommen, am 29.11 zur zweiten Trilogrunde. luk
In die Gespräche über eine Milliardeninvestition des Chipherstellers TSMC in Deutschland kommt Bewegung. Das Magazin Capital berichtet, dass noch im Oktober eine Delegation des Unternehmens aus Taiwan nach Dresden reist, um sich über den Standort zu informieren. Table.Media hat bereits im vergangenen Monat über eine mögliche TSMC-Fabrik in Dresden berichtet.
TSMC scheut sich indes, auf eigene Faust eine Chip-Fabrik in Deutschland zu eröffnen und wirbt um Partner und öffentliche Förderung. Das Unternehmen hat außerhalb Taiwans erst zwei Werke errichtet, in Japan und den USA. Die Kosten für das neue Werk in Arizona, das in einigen Wochen eröffnet werden soll, seien doppelt so hoch ausgefallen wie in Taiwan, sagte Maria Marced, Präsidentin für Europa bei TSMC, am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Brüssel.
Das Unternehmen besitze zudem noch keine Erfahrung mit Geschäftstätigkeit in Europa. “Deshalb brauchen wir Hilfe: um die potenzielle Fabrik wettbewerbsfähig zu machen, um die nötigen Mitarbeiter zu finden, für den optimalen Betrieb”, sagte Marced. Als mögliche Partner einer Fabrik in Dresden gelten unter anderem NXP, Bosch und Infineon. tho/fmk
Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union bereiten Insidern zufolge eine weitere Klage gegen Google vor. Dabei soll es um das digitale Werbegeschäft der Alphabet-Tochter gehen. Die Klage könnte Anfang kommenden Jahres eingereicht werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Damit droht dem Unternehmen die vierte Geldstrafe in der EU in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro.
Die EU sei frustriert über die schleppenden Vergleichsverhandlungen. Sie wirft dem Suchmaschinen-Betreiber vor, seine Technologie zur Platzierung von Online-Werbung zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die Ermittlungen laufen seit Juni vergangenen Jahres. Das Anzeigengeschäft von Google, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 100 Milliarden Dollar erwirtschaftete, ist Alphabets größter Geldbringer. Es macht etwa 80 Prozent des Jahresumsatzes aus.
Die EU-Kommission wollte sich zu dem Thema nicht äußern, Google konnte zunächst nichts dazu sagen. Vor einigen Wochen hatte das Gericht der Europäischen Union eine Milliardenstrafe gegen das Unternehmen wegen illegaler Praktiken im Zusammenhang mit dem Handy-Betriebssystem Android bestätigt. rtr

Es ist wieder so weit: Nächste Woche ist Plenarsitzung in Straßburg. Es wird unter anderem um Geld und Gebäude debattiert und abgestimmt. In den Korridoren des Brüsseler EP-Gebäudes stehen schon die dunkelgrünen Koffer bereit.
Worum geht es? Um einen Änderungsantrag, den der Abgeordnete Nils Ušakovs von der S&D-Fraktion eingebracht hat. Der Antrag richtet sich gegen die Annahme des Vorschlags, über den nächste Woche abgestimmt werden soll, nämlich den Erwerb des Osmose-Gebäudes für das Europäische Parlament in Straßburg. Frankreich bietet dem Parlament diese Immobilie zum Kauf an. Im Gegenzug könnte das Parlament das Madariaga-Gebäude abstoßen – ein furchterregendes Labyrinth mit 80er-Jahre-Charme, das das Parlament beherbergt. Das Gebäude könnte in ein Hotel für die Abgeordneten umgewandelt werden.
Für Ušakovs würde ein solcher Austausch zu einer unvernünftigen Ausgabe von Steuergeldern führen, “besonders zu einer Zeit, in der die europäischen Bürger mit steigenden Energiepreisen und Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben”. Der Fall wäre relativ einfach, wenn das EU-Parlament nur einen Sitz hätte. Das Gebäude, in dem das Parlament in Brüssel untergebracht ist, befindet sich jedoch ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand. Der von Nils Ušakovs eingereichte Änderungsantrag fordert, “die Pläne für die Zukunft des Spaak-Gebäudes in Brüssel vollständig zu überdenken”. Denn auch hier erfordert der Zustand des Gebäudes eine Entscheidung, und zwar eine schnelle.
Das 1993 eröffnete Gebäude, das 303 Millionen Euro gekostet hat, soll Lecks, Stabilitätsprobleme sowie Mängel bei der Klimaanlage und der Isolierung aufweisen. Im Jahr 2012 musste das Gebäude vorübergehend geschlossen werden, nachdem in den Balken über dem Plenarsaal Risse entdeckt worden waren. Man befürchtete, dass sich der Vorfall wiederholen könnte, der sich vier Jahre zuvor im anderen Parlamentsgebäude in Straßburg, also eben dem Madariaga-Gebäude, ereignet hatte.
Abreißen und neu bauen oder komplett renovieren? Diese Frage ist noch offen und drängt in das politische Leben der Stadt Brüssel. Denn die Annahme, ein sehr umstrittenes Gebäude abzureißen, für das zuvor ein ganzes Wohnviertel weichen musste, würde die schlechte Stimmung in der Umgebung möglicherweise noch verschlimmern. Außerdem muss mit der Region Brüssel und den beiden betroffenen Stadtverwaltungen (Brüssel-Stadt und Ixelles) verhandelt werden, die heute etwas eifriger für ein weniger größenwahnsinniges Architekturprojekt eintreten, das die Stadt und ihre Bewohner besser respektiert.
Inzwischen steht immerhin fest, wer den internationalen Architekturwettbewerb zur Neugestaltung gewonnen hat. In der letzten Sitzungswoche im Juli hat die international besetzte unabhängige Jury des Wettbewerbs die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola informiert, welche Architektenentwürfe es auf die ersten fünf Plätze geschafft haben und damit in die nähere Auswahl kommen. Noch ist die Jury-Entscheidung aber geheim.
In die Debatte um die Gebäude mischt sich der nie ganz ausgestandene Streit über den Standort des Hauptsitzes – Brüssel oder Straßburg – und der faule Kompromiss, der drei Wochen in der belgischen Hauptstadt und eine Woche in der französischen Stadt vorsieht. Dieser Kompromiss führt zu einem monatlichen Umzug, dessen Kosten laut Nils Ušakovs auf rund 160 Millionen Euro pro Jahr geschätzt werden. Der vorsichtige lettische Europaabgeordnete plädiert dafür, das Hin und Her zwischen Brüssel und Straßburg “zumindest” während der Energiekrise auszusetzen, “so wie wir es während der Pandemie getan haben”.
Denn es ist bekannt, dass Frankreich seinen Sitz in Straßburg mit Zähnen und Klauen verteidigt. Im Parlament kann Paris insbesondere auf den Einfluss der französischen Europaabgeordneten in der Renew-Fraktion zählen. Darüber hinaus bildet die Wahl der Europaabgeordneten Fabienne Keller (Renew), ehemalige Bürgermeisterin von Straßburg und ehemalige Senatorin des Bas-Rhin, zur Quästorin ein einflussreiches französisches “Pro Straßburg”-Tandem mit ihrer Kollegin Anne Sander (EVP), die seit 2019 erste Quästorin ist.
