wenn China etwas anpackt, dann verändert es sich nachhaltig – das gilt derzeit auch für den Fußball. Im CEO-Talk mit dem China.Table berichtet der dortige Landeschef des BVB von den Interessen der Dortmund-Fans in China. Diese werden auch für einen deutschen Traditionsverein ökonomisch immer wichtiger. Benjamin Wahl erklärt uns: In China wie in Deutschland ist es die besondere emotionale Bindung an den Verein, die seinen Erfolg ausmacht. Doch auch wenn China selbst genug ehemalige Stahl- und Kohleregionen hat, ist die Klientel dort eine ganz andere als im Ruhrpott, sie ist internationaler und weiblicher. Wahl schätzt für uns auch die Erfolgsaussichten des chinesischen Fußballs ein. Außerdem erzählt er von den unterschiedlichen Trainingsmethoden in einem Land, in dem Lehrer noch echte Respektspersonen sind.
Xi Jinping hat derweil in kurzer Folge mit Joe Biden und Angela Merkel telefoniert. Zu den Themen gehörten in beiden Chef-Gesprächen Afghanistan, Corona, Klimaschutz und Handel. Alle Beteiligten kennen sich. Als Vizepräsident unter Obama war Biden bei Treffen mit Xi dabei, solange sich deren Präsidentschaften überschnitten haben – zuletzt 2015.
Doch bei der langjährigen China-Erfahrung enden die Gemeinsamkeiten derzeit auch schon. Merkel hat sich eine grundsätzlich positive Einstellung zu China bewahrt und in den Jahren ein gewisses Verständnis für die dortigen Verhältnisse entwickelt. Sie hat dabei immer wieder zu verstehen gegeben, wie schwierig sie es sich vorstellt, ein so großes und diverses Land effektiv zu verwalten. Biden wiederum setzt derzeit den Kurs seines Vorgängers fort und positioniert sich als Gegenspieler Chinas. Seine lange Erfahrung hat nicht das Verständnis wachsen lassen, sondern die Frustration.
Ein wenig erinnert das an Bidens Umgang mit Afghanistan, das er aufgrund seiner Erfahrungen vor Ort als hoffnungslosen Fall abgeschrieben hat. Er gab sich daher auch keine Mühe, die Sache doch noch zu einem Erfolg zu drehen. China wiederum hat sich durch freien Welthandel nicht wie erhofft zum demokratischen Partner der USA gewandelt; es ist seinem System treu geblieben und verteidigt es offensiver denn je. All das hat Biden als aktiver Politiker miterlebt. Jetzt ist seine Enttäuschung groß, und die US-Politik schwenkt endgültig ins Gegenteil des amerikanischen Kurses vor Trump: Auch bei Biden herrscht eine Neigung zu Protektionismus und Misstrauen vor. Leider tritt Merkel nun als Gegengewicht zu so einem Kurs von der Weltbühne ab.
Einen starken Start in die Woche wünscht


Benjamin Wahl, 39, ist im Grunde der Landeschef eines deutschen Mittelständlers mit 450 Millionen Euro Umsatz. Keines Hidden Champions, sondern eines höchst sichtbaren Champions, den fast jedes Kind in Deutschland kennt. Das Firmenlogo ist gelb-schwarz. Das Unternehmen hat Mitarbeiter aus den USA, Brasilien, Norwegen oder Portugal, aber leider noch nicht aus China. Dennoch gehört die Firma zur Weltspitze: Es findet sich unter den Top Ten der UEFA-Rangliste. Es hat vergangene Saison den DFB-Pokal geholt und den 3. Platz in der Bundesliga: Borussia Dortmund (BVB).
Wahl wurde in eine schwarz-gelb geprägte Familie aus Schwelm bei Dortmund hineingeboren und hat Wirtschaftsinformatik in Gießen und den USA studiert. Danach ist er zehn Jahre fremdgegangen: Er war in China der Vertreter von Bayer Leverkusen, bis er 2017 vom BVB abgeworben wurde. Transfersumme unbekannt. Seitdem lebt er mit seiner Familie in Shanghai und hilft, den chinesischen Fußball zu entwickeln und den BVB bekannter zu machen.
Wie viel westliche Entwicklungshilfe braucht der chinesische Fußball?
Auf jeden Fall ist China offen für internationale Kooperationen. Es ist ein staatliches Ziel, Fußball-Weltmacht zu werden. Daher ist der Fußball ein Riesenthema. Die Regierung will 70 000 Fußballplätze bis 2025 bauen. Fußball wird in Grund-, Mittel- und weiterführenden Schulen Pflicht. Bis 2030 möchte man erfolgreich an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Und bis 2050 schließlich soll China zu den führenden Fußballnationen der Welt aufschießen.
Kann man das so einfach planen wie den Einstieg in die E-Mobilität?
Das ist die große Frage. Immerhin ist die Erfahrung der vergangenen Fünf-Jahres-Pläne, dass China meist hinbekommt, was es sich vorgenommen hat. Aber Sie haben natürlich recht: Fußball ist etwas Besonderes. Einfach wird es jedenfalls nicht: Das ist ein Generationenthema und der systematischen Jugendförderung. Da gibt es keine Abkürzung und die Chinesen sind erst seit einigen Jahren dabei. Bisher jedenfalls ist der chinesische Fußball auf einem guten Weg, aber eben noch nicht dort, wo er sein möchte.
Gibt es Hoffnungsschimmer?
Keine Frage: Die Kurve zeigt bereits steil nach oben. Die chinesische Liga wurde restrukturiert. Nun haben junge Fußballer bessere Chancen. Und wichtig: Wer gut im Fußball ist, wer es in den Turnieren und den Trainingscamps ganz nach oben schafft, bekommt Extrapunkte für den Gaokao, die Hochschulzulassungsprüfung, die größte Hürde in einem Schülerleben. Die Prüfung wird landesweit am gleichen Tag durchgeführt. Da hält China gewissermaßen den Atem an. Das zeigt deutlich, wie wichtig der Politik das Thema Fußball inzwischen ist.
Kein Chinese hat es allerdings bisher als regelmäßiger, beachteter Spieler in die Bundesliga geschafft. Die Chinesen sind noch nicht in Europa, dem Mekka des Weltfußballs angekommen. Ist das nicht erstaunlich, bei einem Pool von 1,4 Milliarden Menschen?
Nicht unbedingt. Selbst Ausnahmetalente müssen viel trainieren. Wenn sie dazu keine Möglichkeiten haben, dann wird das nichts. Fußball lag lange nicht im Blickfeld. Der populärste Sport war Basketball. Jeder Kindergarten, jede Uni und jedes Firmengelände hat einen Basketballplatz. Und NBA-Stars wie Yao Ming haben daraus einen Boom werden lassen. Wichtig ist nun, den Fußball ins Curriculum einzubauen. Dass die Schüler nun weniger Hausaufgaben machen müssen, wie jüngst beschlossen wurde, schafft den Spielraum dafür. Peking möchte nun die teuren privaten Fußballschulen zurückdrängen und stattdessen den staatlichen Schulsport ausbauen. Das wird helfen.
Braucht man nicht beides in China?
Ich glaube ja. Aber der Sektor des privaten Sports ist schon ein großes und profitables Geschäftsfeld. Allerdings schaffen es dort nicht unbedingt die Besten, sondern auch die mit mehr Geld, die sich die teuren Trainings leisten können. Deshalb ist das staatliche Element so wichtig.
Wie passt der BVB als privater deutscher Fußballverein in diese Entwicklung?
Wir sind seit 2017 hier. Wir haben 2014 das erste Office in Asien eröffnet, in Singapur. Damals haben sich die Kollegen von dort um China gekümmert und haben anhand unabhängiger Marktforschung schnell herausgefunden: 80 Millionen Chinesen kennen den BVB. Wir wollten und wollen weiterhin global eine besondere Nähe zu unseren Fans haben. Daher wurde 2017 das Office in Shanghai eröffnet.
80 Millionen Menschen sind so viele wie Deutschland Einwohner hat. Aber das sind nicht alles BVB Fans, oder?
Nein. Die laufen natürlich nicht alle im schwarz-gelben Schal hier herum. Aber sie kennen und identifizieren sich mit der Marke. Rund drei Millionen Fans haben wir allein auf Weibo, dem chinesischen Mix aus Twitter und Facebook. Unser Schwerpunkt in China liegt deshalb auf der Fanarbeit. Wir gründen Fanclubs, wir fahren zu ihnen und organisieren Partys für unsere Fans. Wir schaffen einmalige Erlebnisse. Und wir pflegen die Social-Media-Accounts und bauen sie aus. Gleichzeitig bieten wir unser Know-how an. Borussia Dortmund ist weltbekannt für seinen erfolgreichen Jugendfußball. Da können wir helfen und haben deshalb auch zahlreiche Coaches hier im Land.
Wie wird das Angebot angenommen?
Sehr gut. Es ist so, dass die Frage kommt, könnt ihr nicht noch mal 500 Trainer schicken. Aber das schaffen wir natürlich nicht.
Und Eure Trainer suchen dann nebenbei den ersten Top-Spieler für die Bundesliga, oder?
Dies wäre für jeden Verein ein riesen Asset in Hinblick auf Reichweite und Vermarktung. Man hat dies bei Wu Lei gesehen, der ein paar Jahre bei Espanyol Barcelona gespielt hat und von dem hunderttausende Trikots in China verkauft wurden.
Am Ende saß er dann doch viel auf der Bank.
Seine Karriere habe ich nicht bis zuletzt ins Detail verfolgt. Einen Spieler rein aus Marketing-Zwecken zu verpflichten und ihn dann auf die Bank zu setzen ist nicht der Ansatz des BVB. Wir scouten weltweit junge, hoffnungsvolle Talente.
Und haben Sie schon jemanden in der Pipeline?
Vor zwei Jahren waren wir mit einem ganz jungen Spieler im intensiven Gespräch. Unserer Philosophie folgend würden wir keinen Spieler holen, der sich dem Ende seiner Karriere nähert. Leider haben sich die Gespräche durch eine Olympiateilnahme dann zerschlagen. Es würde mich freuen, ein “Chinese Talent” in Dortmund begrüßen zu können.
Wie unterscheiden sich die chinesischen Fans von den BVB-Fans, die ja wiederum in Deutschland ganz spezielle Fans sind?
Die große Gemeinsamkeit ist erst einmal, dass jeder Fan eine eigene Geschichte hat, warum er Fan geworden ist – egal ob er Deutscher oder Chinese ist. Diesen Geschichten muss man Raum geben. Deshalb suchen wir die Nähe zu den chinesischen Fans und das wird auch belohnt. Die sagen uns dann: Die Spieler anderer Vereine haben auf ihrer China-Tour noch nicht einmal gewunken, sondern nur ihr Spiel abgespult. Das war beim BVB anders, die gehen in die Fan-Ecke, da gibt es Autogramme. Spieler zum Anfassen.
Die kommen aber nur selten. Und derzeit wegen Corona gar nicht.
Ja und deshalb fahren mein Team und ich jedes zweite Wochenende in eine andere Stadt und besuchen dort die Fans. Wir veranstalten ein Fußballturnier. Feiern zusammen. Lernen uns kennen. Und samstagabends schauen wir uns das Spiel per Livestream zusammen an. Mit der Zeitverschiebung meist pünktlich um 21:30 Uhr.
So dauert es aber sehr lange, bis man die 80 Millionen Fans versorgt hat.
Nicht, wenn man ein Kamerateam dabeihat und die Erlebnisse gleichzeitig streamt. Der BVB hat allein in China auf Social Media eine Reichweite von fünf Millionen Fans. Tendenz stark steigend.
Was aber so oder so fehlt, vor Ort oder digital, ist das Ruhrpott-Gefühl, die Heimatverbundenheit. Doch davon lebt der BVB. Das lässt sich kaum internationalisieren.
Das stimmt. Wir müssen deshalb andere Formen der Bindung finden, die sich digital transportieren lassen. Dass wir sie gefunden haben, sieht man an der Fanstruktur in China. Denn anders als in Deutschland, wo wir 80 Prozent männliche Fans und 20 Prozent weibliche Fans haben, sind in China etwa die Hälfte der Fans weiblich.
Warum?
Wir bieten, neben spannendem, schnellem und im besten Falle sehr erfolgreichem Fußball, auch Eindrücke “Behind-the-Scenes” und Lifestyle-Geschichten unserer jungen Mannschaft. Diese Art der Fan-Kultur lässt sich auch über große Distanzen digital transportieren: Welcher Spieler hat eine neue Freundin? Wer geht da mit seinem neuen Hund spazieren? Was macht er zum Valentinstag? Welche neuen Klamotten trägt er. Erling Haaland hat kürzlich ein Selfie mit sehr fancy Klamotten an einem norwegischen Fjord gepostet. So entsteht auch eine Art Zugehörigkeit….
…allerdings viel verspielter und mit mehr Popkultur…
…ja, so kann man es zusammenfassen. Dazu passt auch Biene Emma, unser Maskottchen. Sie hat einen eigenen Weibo-Account und mittlerweile einige zehntausend Follower. Wir sind jung, frisch, ein Stück weit anders als andere Clubs auf Social Media vertreten. Unsere sehr junge Fangemeinschaft in China – 70 Prozent unserer Fans sind unter 30 – schätzt sehr, dass wir auch viel Content auf Douyin (der chinesischen Version von Tiktok) ausspielen.
Allerdings sind Vereine wie Manchester United oder der FC Barcelona schon viel länger im chinesischen Markt unterwegs. Die Deutschen sind bei diesem Thema ja Nachzügler. Wie wollen Sie diesen Vorsprung aufholen?
Manchester United ist seit 25 Jahren hier. Sie sind eine unglaublich starke Marke, auch, wenn sie einige Jahre keine Titel mehr geholt haben. Umso authentischer müssen wir sein. Das ist der einzige Weg. Es sind die Emotionen, Erinnerungen, gemeinsame Feste, gemeinsame Niederlagen, die die Fans mit uns verbindet. Die vollen Stadien in der Bundesliga, die Fan-Kultur, die großen Gruppen an Auswärtsfans, sind etwas Besonderes in Deutschland: Zu einem Auswärtsspiel an einem Wochenende fahren schon mal zehn oder 20.000 Fans von Dortmund nach Berlin. Wir haben jeden Spieltag über 80.000 Fans im Stadion. Obwohl wir vom Fassungsvermögen nicht das größte Stadion in Europa haben, haben wir die höchste Auslastung im Fußball weltweit.
Der Signal Iduna Park ist immer ausverkauft. Das sind viele anderen Stadien im Ausland nicht. Unsere Fan-Kultur in Deutschland und besonders in Dortmund ist etwas Besonderes und sehr intensiv. Auch ein Grund, dass im Schnitt rund 1.000 englische Fans am Spieltag in Dortmund zu Gast sind. Die haben ihren englischen Club, kommen aber, weil wir akzeptable Ticketpreise haben, es eine einzigartige Stimmung gibt, das Bier noch preiswert ist und wir natürlich tollen Fußball spielen. Vor allem England steht inzwischen für ein hohes Maß an Kommerzialisierung des Fußballs. Diese Entwicklung haben wir in gesamten Fußballumfeld. Wir haben es in Deutschland geschafft, eine vernünftige Balance zu halten. Und das bleibt den Chinesen nicht verborgen.
Allerdings wird die Stimmung in chinesischen Stadien auch immer besser.
China hat seit Jahrzehnten ebenfalls eine klasse Fußball Fankultur. Ich gehe oft in Shanghai ins Stadion. Da ist Atmosphäre. Da wird gesungen. Da wird hinterher in der U-Bahn getanzt. Gänsehaut-Momente. Hier in Peking laufen die Fans mit grün-weißen mit Trommeln durch die Straßen. Die Auslastung variiert stark von Verein zu Verein, aber zu Shanghai Shenhua, Shandong Taishan oder Beijing Guoan kommen ebenfalls circa 40.000 Zuschauer pro Spiel.
Um mehr Menschen für Fußball zu begeistern, hat man eine Weile versucht, besonders teure Spieler im Westen zu kaufen, um das Niveau der Mannschaften zu pushen
Das hat nicht funktioniert und man hat zuletzt stark dagegen gesteuert. Jetzt liegen 100 Prozent Steuern auf jedem Transfer, die in den Jugendfußball investiert werden. Die alten, satten und manchmal schon leicht übergewichtigen Spieler haben in China nicht die gewünschten Impulse gegeben. Dies waren auch Exzesse, Einzelfälle, aus denen man schnell gelernt hat. Einige Spieler wurden zuvor für extreme hohe Summen nach China transferiert
…ja zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Und jetzt heißt es junge Chinesen langsam aufbauen. Was sind Probleme dabei für Trainer des BVB?
Wir kommen mit einem ganzheitlichen Anspruch. Neben den taktischen und technischen Fähigkeiten geht es darum, starke Charaktere zu entwickeln, um Ernährung, um Vorbildfunktion. Spieler zu fördern, die selbst kreative Entscheidung auf dem Platz treffen. Unser größtes Problem dabei ist die Sprache. Ein Übersetzer ist immer dazwischen. Doch gute Fußball-Dolmetscher zu finden ist nicht einfach. Wichtig ist zudem, dass die Kinder Spaß am Fußball haben. Dies darf nicht von außen erzwungen werden.
Warum will die chinesische Politik mehr Fußball, mal abgesehen davon, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping als Fußballfan gilt?
Kinder früh zum Sport zu erziehen und vor allem zu einem Sport, bei dem man nicht nur etwas abspult, sondern der auch Spaß macht und bei dem man taktisch klug handeln muss, hilft diesen Kindern natürlich später besser durchs Leben zu kommen. Gesunde Ernährung bei Kindern und viel Sport sind wichtig. Sie belasten das Gesundheitssystem später viel weniger.
Was fehlt noch am meisten?
Mehr Fußballplätze. Wenn ich eine Stunde fahren muss, um zu einem Platz zu kommen, dann ist das eine zu hohe Hürde. Zweitens: Es fehlt die Regelmäßigkeit. In vielen Clubs wird trainiert, es findet aber nur einmal im Monat ein Turnier statt. Das ist zu wenig. Das muss jedes Wochenende stattfinden. Die Kinder lieben den Wettbewerb. Aufsteigen. Absteigen. Kämpfen. Siegen und verlieren.
Trainieren Chinesen anders als Deutsche?
Das gesamte Bildungssystem funktioniert anders. Die Autorität eines Lehrers oder der Trainer ist in China extrem hoch. In Europa lassen wir die Kinder oft erst einmal spielen, lassen sie selbst entscheiden, gehen sie links oder rechtsherum. Danach geben wir ihnen ein Feedback. Die Situationen im Fußball sind sehr variabel, weniger einzustudieren als in anderen Sportarten. Daher versuchen wir diese Flexibilität und Kreativität zu fördern. Ich sage allerdings nicht, dass unser Ansatz der absolut und einzige richtige ist: Wir tauschen uns eng mit den chinesischen Trainer Kollegen aus. Zeigen was bei uns gut funktioniert und versuchen dies gemeinsam mit den lokalen Besonderheiten zu verknüpfen und in ein erfolgreiches Modell zu überführen.

Der “Flugzeugträger-Killer” ist ein heimisches Produkt, er stammt aus der taiwanischen Werft Lung Teh Shipbuilding. Das ist Grund genug für Präsidentin Tsai Ing-wen, zur Indienststellung des neuen Kriegsschiffs in die kleine Hafenstadt Su’ao an der Ostküste der Insel zu reisen und eine kurze Rede zur Verteidigungsfähigkeit ihres Landes zu halten. “Wir sind auf bestem Weg, im Bereich der nationalen Verteidigung unabhängig zu werden”, zitieren Nachrichtenagenturen die Präsidentin. Das sind starke Worte. Nach allgemeiner Wahrnehmung hängt die Sicherheit Taiwans vor allem vom Schutz durch die USA ab. Doch Tsai will die Eigenständigkeit nun zumindest deutlich stärken.
Diese Tendenz zur Zweigleisigkeit mit mehr Anbindung an den großen Bündnispartner und zugleich mehr Eigenentwicklungen spricht auch aus dem Bericht zur Verteidigungsfähigkeit Taiwans der Regierung in Taipeh, der nur alle vier Jahre erscheint. Aus dem zweiten “Quadrennial Defense Review (QDR)” gehen mehrere interessante Fakten hervor:
Analysten zufolge macht Taiwan sich nun an die Umsetzung der Schlussfolgerungen aus dem Verteidigungsbericht. “Im Jahr 2021 hat Taiwan angefangen, die Militärhardware zu beschaffen, die der QDR verlangt”, schreibt Thomas J. Shattuk vom Foreign Policy Research Institute in Philadelphia. “Taiwan muss seine militärischen Fähigkeiten schon heute aufbauen, nicht erst 2025.” Denn die immer bessere Ausstattung der Volksbefreiungsarmee schafft eine Abwehrlücke, die mit jedem Jahr größer wird. Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng hat entsprechende Forschungsaufträge an das National Chung-Shan Institute of Science and Technology vergeben.
Die neue Korvette mit dem Spitznamen “Flugzeugträger-Killer” ist ein wichtiger Baustein des neuen Konzepts. Offiziell handelt es sich um die Tuo-Chiang-Klasse 沱江 von Kriegsschiffen. Sie sind mit 60 Metern Länge kleiner als Fregatten, aber bis oben hin voll mit moderner Technik. Das keilförmige Schiff versteckt sich durch seine Form vor Radar. Vor allem aber ist es mit Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Hsing Feng III ausgestattet, die sich auch von Flugzeugträgerverbänden nur schwer abwehren lassen. Die von Tsai am Donnerstag in Dienst gestellte Ta Chiang 塔江 ist das zweite Exemplar dieser Klasse. Vier weitere sollen folgen.
Die Tendenz zur Aufrüstung ist verständlich. Taiwan in seiner heutigen politischen Form ist akut in seiner Existenz bedroht. Die Volksrepublik spricht ihr den Status als unabhängiger Staat ab. Sie behandelt die Insel nicht nur rhetorisch, sondern auch in praktischen Belangen als Teil ihres Gebiets.
Die Sorgen werden durch Militärmanöver und routinemäßige Provokationen verstärkt, die China – entsprechend seinen wachsenden militärischen Fähigkeiten – mit immer besserem Gerät ausführt. Eine aktuelle Studie des militärnahen US-Thinktanks Project 2049 beschäftigt sich mit der Frage, wie eine Invasion Taiwans in der Praxis aussehen könnte. Die Autoren unterstellen, dass die chinesische Armee Tausende von zivilen Schiffen in den Dienst ziehen will, um Millionen von Soldaten nach Taiwan zu transportieren.
Die Zahlen zeigen aber auch, wie schwierig und letztlich unwahrscheinlich so eine Invasion ist. Ginge es um den bloßen Sieg gegen ein feindliches Land, wäre der Fall klar: Die Volksbefreiungsarmee hätte mit Bomben und Raketen schnell die militärische Hoheit. Doch ein Angriff mit schweren Geschützen verbietet sich: Die Bewohner der Insel gelten nach Lesart der Volksrepublik als eigene Bürger. Sie stehen nach dieser Logik genauso unter dem Schutz der kommunistischen Regierung wie die Bewohner des Festlands. Zumindest den Zivilisten sollte also nur wenig passieren.
Eine Eroberung muss daher mit Fußsoldaten erfolgen – Straße für Straße, Haus für Haus. Und das in einem Land, in dem fast alle erwachsenen Männer Wehrdienst geleistet haben und kaum jemand unter chinesischer Herrschaft leben will. Allein das Vorhaben, die “feindlichen Häfen” (so der Name der Studie von Project 2049) des Landes unter Kontrolle zu bringen, dürfte die Admiralität der Volksbefreiungsarmee vor erhebliche Probleme stellen. Da hilft es nichts, dass die chinesischen Truppen die taiwanische Luftwaffe und große Teile der dortigen Marine vergleichsweise schnell ausschalten könnten.
Präsidentin Tsai und Taiwans Verbündete wissen zugleich, dass sie es China keinesfalls einfach machen dürfen. Zeichen von Schwäche würden das bestehende Gleichgewicht genauso stören wie übertriebene Drohgebärden. Eine Lücke in der taiwanischen Abwehr würde Xi geradezu zwingen, die sich bietende Gelegenheit zu nutzen. Schließlich drängen einige Hardliner in Volk und Führung durchaus darauf, die vermeintliche Schande der Spaltung zu korrigieren.
Ein Gleichgewicht der Kräfte ist also auch für diejenigen wichtig, die auf der Seite der Volksrepublik zwar mit dem Säbel rasseln, einen echten Krieg aber vermeiden wollen. Da China jedoch ungefähr im Gleichschritt mit seiner technischen und wirtschaftlichen Entwicklung aufrüstet, braucht auch Taiwan mehr und modernere Waffen. Analysten fällt daher schon länger eine gewisse Verbindung zwischen dem Anstieg des chinesischen Verteidigungsetats und US-Waffenlieferungen an Taiwan auf.
Die Indienststellung der neuen Tarn-Korvette Ta Chiang ist nach dieser Logik nur folgerichtig. Schließlich lässt China mehrere eigene Flugzeugträger auf Kiel legen. Derzeit befindet sich das dritte und bislang größte der Schiffe im Bau. Wenn die Gegenseite einen neuen Flugzeugträger auffährt, schickt Tsai eben einen neuen Flugzeugträger-Killer aufs Wasser.
Das heißt leider nicht, dass ein sonderlich stabiles Gleichgewicht besteht. Derzeit ist weltpolitisch zu viel in Bewegung, und das betrifft auch Taiwan:
Doch selbst die Falken vom amerikanischen RAND-Forschungsinstitut rufen nicht zu einer übermäßigen Aufrüstung auf. Auch sie raten dazu, bei Chinas steigenden Fähigkeiten mitzuziehen, nicht etwa, sie zu übertreffen.
Taiwan muss es jetzt gelingen, folgende Punkte glaubwürdig zu machen:
Bisher sind alle drei Punkte gegeben. Auch Japan hat in den vergangenen Wochen seine Solidaritätsbekundungen heraufgefahren. Verteidigungsminister Nobuo Kishi hat klargemacht, dass die Sicherheit Taiwans zu Japans ureigenen Interessen gehöre. So klare Worte spricht Tokio meist in Abstimmung mit Washington.
All das lässt Spekulationen von Analysten in Amerika und Taiwan über Xi als Angreifer erst einmal unrealistisch erscheinen. Auch der starke Mann kann seiner Partei gegenüber die Logik eines Angriffs nicht überzeugend darstellen. Voraussetzung ist aber, dass die Drohkulisse glaubwürdig bleibt. Dazu dienen die neuen Killer-Schiffe, Lenkraketen und Drohnen.
In Analysen zu Taiwan verwenden wir gegebenenfalls die ortsübliche Umschrift, die an Wade-Giles angelehnt ist, statt Pinyin.
Der chinesische Außenminister Wang Yi hat am Samstag einen Besuch in Vietnam abgeschlossen und ist zu Gesprächen in Kambodscha am Sonntag und Montag weitergereist. In Phnom Penh wird er Premier Hu Sen treffen. Danach geht es nach Singapur weiter. Die Länder Südostasiens haben derzeit ein gespaltenes Verhältnis zu China. Es ist meist größter Handelspartner und als Partner eine Alternative zu EU und USA. Wang verspricht zudem Impfstofflieferungen: Er hat Vietnam drei Millionen kostenlose Dosen versprochen. Zugleich sind die Beziehungen durch Gebietsstreit im Südchinesischen Meer und ein allgemeines Vormachtstreben Chinas belastet. fin
Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat am Freitag in zwei Telefonaten mit US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel die Weltlage besprochen. Die Bundeskanzlerin habe mit Xi insbesondere die Entwicklung in Afghanistan diskutiert, teilte die Bundesregierung mit. Außerdem tauschten sich die zwei Regierungschefs über die Pandemie-Situation aus. Im Hinblick auf die bevorstehende Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow im November stimmten sie ihre aktuellen Positionen ab. Auch Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wurden erörtert.
Mit Biden sprach der chinesische Staatspräsident über ähnliche Themen: Handel, Klima und Corona. Es war erst das zweite Telefonat dieser Art seit Bidens Amtsantritt im Januar. Das Gespräch dauerte anderthalb Stunden. Die amerikanische Wiedergabe der Gesprächsergebnisse wichen von denen der chinesischen Seite ab. Nach Darstellung von Xinhua hielt Xi seinem US-Kollegen einen Vortrag über die große Verantwortung, die die Führung einer Weltmacht mit sich bringt. In der Version von Bloomberg belehrte Biden seinen chinesischen Kollegen, dass dieser mehr Ernsthaftigkeit und Kompromissbereitschaft in den Dialog mit den USA einbringen müsse. fin
Die EU-Strategie für den Indopazifik, mit der Brüssel seine Allianzen in der Region gegen China stärken will, könnte es einer Umfrage zufolge in den Mitgliedsstaaten schwer haben. Die Befragung des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR) zeigt große Differenzen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten: “In Europa herrscht keine Einigkeit darüber, in welchen Bereichen die EU sich stärker in die Region einbringen sollte oder welchen geografischen Raum durch den Begriff ‘Indopazifik’ überhaupt abgedeckt wird”, erklärt die Koordinatorin des ECFR-Asien-Programms, Manisha Reuter, gegenüber China.Table. “Trotz der wachsenden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der Region besteht in weiten Teilen der EU-Mitgliedstaaten weiterhin ein Mangel an Interesse.”
Die Umfrage und ein begleitender Bericht wurden am Montag vorgestellt. ECFR hatte dafür hochrangige politische Akteure der EU-Mitgliedsstaaten befragt. Die EU-Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) werden am Dienstag ihre erweiterte Strategie für die Region präsentieren. Diese soll unter anderem Partnerschaften im Digital-Bereich mit Japan, Südkorea und Singapur zum Ziel haben (China.Table berichtete).
Dass die Debatte in den einzelnen Mitgliedsländern jedoch “wenig ausgeprägt” sei, könnte letztlich die Effektivität der Strategie begrenzen, warnt Reuter. Sie sieht Nachholbedarf vonseiten Brüssels: “Diejenigen, die die Debatte in Europa antreiben, müssen überzeugend darlegen, warum Europa im Indopazifik aktiv sein sollte. Dabei geht es auch um ein legitimes strategisches Interesse an der Region jenseits von wirtschaftlicher Diversifizierung, welches die EU klar formulieren sollte.” Generell sei die Neuausrichtung von Europas Rolle im Indo-Pazifik-Raum aber ein wichtiger Baustein, so Reuter.
Die EU arbeitet derzeit an mehreren Ecken an Strategien auf die Präsenz Chinas in Asien und entlang der Neuen Seidenstraße (BRI). Die EU-Außenminister hatten zuletzt im Juli den Druck auf die EU-Kommission erhöht, eine attraktive und nachhaltige Alternative zur BRI zu schaffen (China.Table berichtete). ari
Ein Sprecher der afghanischen Taliban hat die Erwartung geäußert, dem pakistanisch-chinesischen Wirtschaftskorridor beitreten zu können. Das berichtet die Wirtschaftszeitung Nikkei. China sei der Idee nicht abgeneigt, unterstellt eine anonyme Quelle gegenüber dem Blatt. China hat Afghanistan bereits Soforthilfe in Höhe von rund 26 Millionen Euro versprochen (China.Table berichtete). Der pakistanisch-chinesischen Wirtschaftskorridor ist ein Kernprojekt der neuen Seidenstraße (Belt and Road Inititative, BRI). Die Aussichten eines religiös-fundamentalistisch geführten Afghanistan als Teil des chinesischen Wirtschaftsnetzwerks sind einerseits ungewiss, andererseits geht China höchst pragmatisch an den Umgang mit den neuen Nachbarn heran (China.Table berichtete). fin
Der Handy- und Hausgeräteanbieter Xiaomi will offenbar schon 2024 ein erstes Modell auf den Markt bringen. Die Nachrichtenplattform 36kr berichtet aus Firmenkreisen, dass das Unternehmen danach alle drei Jahre ein neues Modell herausbringen wolle. Der jährliche Absatz soll anfangs rund 300.000 Stück betragen. Firmenchef Lei Jun hatte im März angekündigt, ins Geschäft mit smarten, vernetzten E-Autos einsteigen zu wollen (China.Table berichtete). Die Nachricht wurde sowohl in der Fahrzeug- als auch in der Elektronikbranche mit großem Interesse registriert.
Xiaomi war nach seiner Gründung aus dem Stand auf einen der Spitzenplätze am Handymarkt gesprungen und hat danach durch geschicktes Marketing den Markt für Elektronik und Hausgeräte aufgerollt. Erfolgsfaktoren sind gutes Design, funktionierende Vernetzung und günstiger Preis – Eigenschaften, die vermutlich auch das “Mi Auto” haben wird. fin
Am Mittwoch (15.9.) hält die Chinesische Handelskammer in Deutschland (CHKD) ihren China Day ab. Der Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) beteiligen sich als Kooperationspartner. Das Thema der Online-Veranstaltung lautet “Krise als Chance?” Hauptthema ist das Investitionsklima in China und in Deutschland, mit dem Geschäftsleute beider Seiten derzeit unzufrieden sind. Es sprechen unter anderem Duan Wei, Hauptgeschäftsführer der CHKD, Wolfgang Niedermark vom BDI sowie Volker Treier, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung. fin

Evelyne Gebhardt ist eine waschechte Europäerin. Das merkt die Besucherin schon bei der Begrüßung. Die 67-Jährige spricht ein perfektes Deutsch – mit einem unverwechselbar französischen Akzent. Die Liebe zur Germanistik und zu einem deutschen Mann führte sie schon als sehr junge Frau von der Île-de-France nach Baden-Württemberg. Und dieser europäische Geist ist es, der auch ihr politisches Engagement für Menschenrechte trägt.
“Die Bürgerrechte, die Grenzenlosigkeit, die Überwindung von Krieg haben mich schon immer sehr beschäftigt”, erklärt die Politikerin, die in Schwäbisch Hall lebt. Das sei der Grund, warum sie überhaupt Europaabgeordnete geworden sei: “Die Grundrechte machen unsere europäische Identität aus und ich möchte, dass auch Menschen in anderen Staaten die Freiheiten genießen können, die sich daraus ergeben. Wenn uns die chinesische Regierung sagt, die Menschenrechte in China gehen uns nichts an, dann sage ich also klar, dass das nicht stimmt. Wir müssen uns da einmischen.”
Als die China-Delegation vor rund drei Jahren zuletzt ins Reich der Mitte reiste, war Gebhardt nicht dabei. Ihr letzter China-Besuch liegt deshalb, so erzählt sie, schon acht bis neun Jahre zurück. “Das Land hat eine faszinierende Geschichte mit einer großen Friedensdividende. Ich finde es schade, dass China dies nicht weitertreibt, sondern auf eine harte Art gegen die eigenen Menschen vorgeht”, sagt die SPD-Politikerin und nennt einige Beispiele: “Die inakzeptablen Camps, in denen die Uiguren gezwungen werden sollen, ihre Religion und ihre eigene Lebensweise aufzugeben. Das nationale Sicherheitsgesetz aus Peking, dass das zweite System in Hongkong praktisch ad acta legt. Die Aggressivität, mit der die Regierung Xi Jinping derzeit gegen Taiwan vorgeht.”
Deshalb, ist Evelyne Gebhardt überzeugt, waren die Beziehungen zu China nie so schlecht wie jetzt. Und wer soll das besser einschätzen können als sie, die seit 1994 im Europaparlament sitzt? “Die Zusammenarbeit hat sich natürlich verschlechtert”, sagt sie. Und aktuell sei der Versuch, als Europaabgeordnete dorthin zu reisen, “nicht opportun”. Dabei wäre es so wichtig, gute Beziehungen zu diesem Global Player zu haben – das merkt Gebhardt auch in ihrer täglichen Arbeit im Binnenmarktausschuss des Europaparlaments.
“China hat große Initiativen wie die Seidenstraße oder ihr Engagement in Afrika. Es ist wichtig, dass wir das begleiten und unsere eigenen Strategien in dieser Beziehung gestalten”. Gebhardt führt also tagtäglich Gespräche mit Experten und Expertinnen, Menschenrechtlern und Menschenrechtlerinnen, Journalisten und Journalistinnen, die über die Situation in China berichten. Und sie appelliert an die Regierung, wieder mit dem Europäischen Parlament in Kontakt zu treten: “Peking muss die Sanktionen gegen Europaabgeordnete und den Menschenrechtsausschuss des Europäischen Parlaments aufheben.” Janna Degener-Storr
Marcel Wiedmann geht für den Autozulieferer Hella nach Shanghai. Er wird das Hella Corporate Center China leiten und erhält zugleich den Posten eines Executive Vice President Finance & Controlling. Wiedmann war bisher am Standort Lippstadt in den Bereichen Logistik und Qualitätssicherung tätig.
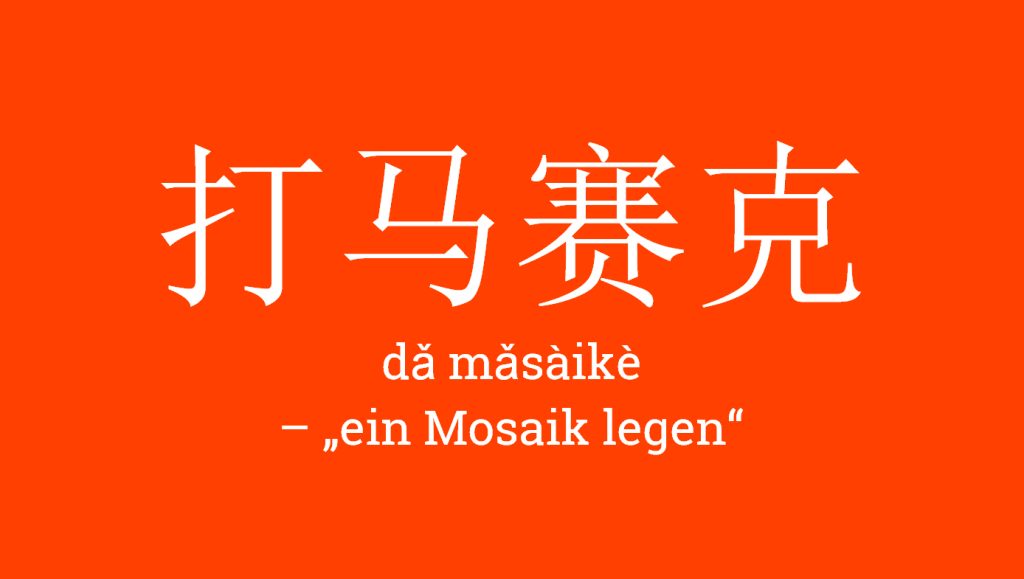
Was gibt tiefste Einblicke in die Seele einer Nation? Genau – das Unterhaltungsfernsehen. Und wer das in China anknipst, wird sich nach einer Weile sicherlich verdutzt die Augen reiben und an seiner Sehschärfe zweifeln. Denn in chinesischen Lifestyle-, Entertainment- und Reality-Formaten wird es in jüngster Zeit immer häufiger verschwommen. Nein, hier hat niemand mit Fettfingern auf die Kameralinse gegrapscht und es ist auch kein grauer Star im Anflug. Die unscharfen Stellen gehören sich so. Es handelt sich um ein fachmännisch gelegtes Medienmosaik chinesischer Prägung. 打马赛克dǎ mǎsàikè – wörtlich “ein Mosaik schlagen/legen” – nennt man das Ganze. Auf Deutsch übersetzt einfach “verpixeln”. Und gepixelt wird in Chinas Unterhaltsindustrie mittlerweile was das Zeug hält.
Nummer 1: 纹身 wénshēn – “Tattoos”. Tätowierungen und andere unerwünschte Körperverzierungen, die das Publikum auf dumme Gedanken bringen könnten, werden in China in der Nachbearbeitung neuerdings fein säuberlich rausgepixelt. “Mosaike” kommen dabei zum Beispiel auch über punkige Ohrringe (耳环 ěrhuán), die das Ohrläppchen stark aufdehnen, oder religiöse Symbole jeder Art (z. B. Kreuzkettchen). Wer als Showteilnehmer Mitleid mit den emsigen Bienchen der Postproduktion hat, verdeckt Hautverzierungen und Ähnliches in vorauseilendem Gehorsam freundlicherweise gleich selbst, z. B. durch langes Beinkleid, großflächige Pflaster oder hautfarbene Armüberzieher. (Auch über all dies also bitte nicht wundern.)
Nummer 2: 品牌 pǐnpái – “Produktmarken“. T-Shirts, Schuhe und Kopfbedeckungen mit deutlich erkennbarem Firmenlogo? Auch das ist ein Fall für Chinas Pixel-Polizei! Denn Bildschirmpräsenz gibt es natürlich nur gegen Bares. Ansonsten wird digital nachgepflastert.
Nummer 3: 赞助商 zànzhùshāng – “Sponsoren“. Moment mal, die haben doch bezahlt! Ja, aber eben vielleicht nicht für alle Sendelagen. Schließlich werden Showformate von den Produktionsfirmen in Zeiten von Multimedia natürlich über unterschiedliche Kanäle verwurstet (z. B. Fernsehen, zahlungspflichtige Streamingdienste, kostenlose Videos im Netz etc.). Und jedes Ausstrahlungsformat lassen sich die Firmen üppig extra vergüten. Nur wer also die gesamte “Werbeflatrate” bucht, darf auch überall sein Logo in die Kamera halten. Ansonsten gilt auch hier: sorry, Pixelschwamm drüber.
Nummer 4: 工作人员 gōngzuò rényuán – “Mitarbeiter“. Zwar geht hinter den Kulissen ohne sie nichts, aber in der Kulisse sollten Techniker, Kameraleute, Visagisten, Assistenten, Berater und Co. dann bitte doch nicht auftauchen. Wabert also eine geistermäßig-verschwommene Personenwolke durchs Bild, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen nachträglich rausgepixelten Mitarbeiter. Oder…
Nummer 5: 翻车的人 fānchē de rén – “in Ungnade Gefallene“. Treue Leser werden sich noch an Kolumne 19 erinnern, in der wir den Ausdruck 翻车 fānchē “etwas an die Wand fahren” beleuchtet haben (wörtl. “der Wagen überschlägt sich”). In jüngster Zeit purzeln immer häufiger und rascher Stars und Sternchen aus dem chinesischen Promi-Himmel in die Shitstorm-Hölle, indem sie ihre Karriere aus verschiedensten Gründen an die Wand fahren. Das geschieht manchmal so schnell und unerwartet, dass Entertainmentformate mit dem konsequenten Herausschneiden oder gar einer Neubesetzung der in Ungnade gefallenen Celebrities nicht hinterherkommen. Da hilft als Lastminute-Lösung nur ein modisches Ganzkörper-Pixelkleid. Aber Mosaik ist ja, wie wir gesehen haben, auf chinesischen Bildschirmen derzeit groß in Mode.
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.
wenn China etwas anpackt, dann verändert es sich nachhaltig – das gilt derzeit auch für den Fußball. Im CEO-Talk mit dem China.Table berichtet der dortige Landeschef des BVB von den Interessen der Dortmund-Fans in China. Diese werden auch für einen deutschen Traditionsverein ökonomisch immer wichtiger. Benjamin Wahl erklärt uns: In China wie in Deutschland ist es die besondere emotionale Bindung an den Verein, die seinen Erfolg ausmacht. Doch auch wenn China selbst genug ehemalige Stahl- und Kohleregionen hat, ist die Klientel dort eine ganz andere als im Ruhrpott, sie ist internationaler und weiblicher. Wahl schätzt für uns auch die Erfolgsaussichten des chinesischen Fußballs ein. Außerdem erzählt er von den unterschiedlichen Trainingsmethoden in einem Land, in dem Lehrer noch echte Respektspersonen sind.
Xi Jinping hat derweil in kurzer Folge mit Joe Biden und Angela Merkel telefoniert. Zu den Themen gehörten in beiden Chef-Gesprächen Afghanistan, Corona, Klimaschutz und Handel. Alle Beteiligten kennen sich. Als Vizepräsident unter Obama war Biden bei Treffen mit Xi dabei, solange sich deren Präsidentschaften überschnitten haben – zuletzt 2015.
Doch bei der langjährigen China-Erfahrung enden die Gemeinsamkeiten derzeit auch schon. Merkel hat sich eine grundsätzlich positive Einstellung zu China bewahrt und in den Jahren ein gewisses Verständnis für die dortigen Verhältnisse entwickelt. Sie hat dabei immer wieder zu verstehen gegeben, wie schwierig sie es sich vorstellt, ein so großes und diverses Land effektiv zu verwalten. Biden wiederum setzt derzeit den Kurs seines Vorgängers fort und positioniert sich als Gegenspieler Chinas. Seine lange Erfahrung hat nicht das Verständnis wachsen lassen, sondern die Frustration.
Ein wenig erinnert das an Bidens Umgang mit Afghanistan, das er aufgrund seiner Erfahrungen vor Ort als hoffnungslosen Fall abgeschrieben hat. Er gab sich daher auch keine Mühe, die Sache doch noch zu einem Erfolg zu drehen. China wiederum hat sich durch freien Welthandel nicht wie erhofft zum demokratischen Partner der USA gewandelt; es ist seinem System treu geblieben und verteidigt es offensiver denn je. All das hat Biden als aktiver Politiker miterlebt. Jetzt ist seine Enttäuschung groß, und die US-Politik schwenkt endgültig ins Gegenteil des amerikanischen Kurses vor Trump: Auch bei Biden herrscht eine Neigung zu Protektionismus und Misstrauen vor. Leider tritt Merkel nun als Gegengewicht zu so einem Kurs von der Weltbühne ab.
Einen starken Start in die Woche wünscht


Benjamin Wahl, 39, ist im Grunde der Landeschef eines deutschen Mittelständlers mit 450 Millionen Euro Umsatz. Keines Hidden Champions, sondern eines höchst sichtbaren Champions, den fast jedes Kind in Deutschland kennt. Das Firmenlogo ist gelb-schwarz. Das Unternehmen hat Mitarbeiter aus den USA, Brasilien, Norwegen oder Portugal, aber leider noch nicht aus China. Dennoch gehört die Firma zur Weltspitze: Es findet sich unter den Top Ten der UEFA-Rangliste. Es hat vergangene Saison den DFB-Pokal geholt und den 3. Platz in der Bundesliga: Borussia Dortmund (BVB).
Wahl wurde in eine schwarz-gelb geprägte Familie aus Schwelm bei Dortmund hineingeboren und hat Wirtschaftsinformatik in Gießen und den USA studiert. Danach ist er zehn Jahre fremdgegangen: Er war in China der Vertreter von Bayer Leverkusen, bis er 2017 vom BVB abgeworben wurde. Transfersumme unbekannt. Seitdem lebt er mit seiner Familie in Shanghai und hilft, den chinesischen Fußball zu entwickeln und den BVB bekannter zu machen.
Wie viel westliche Entwicklungshilfe braucht der chinesische Fußball?
Auf jeden Fall ist China offen für internationale Kooperationen. Es ist ein staatliches Ziel, Fußball-Weltmacht zu werden. Daher ist der Fußball ein Riesenthema. Die Regierung will 70 000 Fußballplätze bis 2025 bauen. Fußball wird in Grund-, Mittel- und weiterführenden Schulen Pflicht. Bis 2030 möchte man erfolgreich an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Und bis 2050 schließlich soll China zu den führenden Fußballnationen der Welt aufschießen.
Kann man das so einfach planen wie den Einstieg in die E-Mobilität?
Das ist die große Frage. Immerhin ist die Erfahrung der vergangenen Fünf-Jahres-Pläne, dass China meist hinbekommt, was es sich vorgenommen hat. Aber Sie haben natürlich recht: Fußball ist etwas Besonderes. Einfach wird es jedenfalls nicht: Das ist ein Generationenthema und der systematischen Jugendförderung. Da gibt es keine Abkürzung und die Chinesen sind erst seit einigen Jahren dabei. Bisher jedenfalls ist der chinesische Fußball auf einem guten Weg, aber eben noch nicht dort, wo er sein möchte.
Gibt es Hoffnungsschimmer?
Keine Frage: Die Kurve zeigt bereits steil nach oben. Die chinesische Liga wurde restrukturiert. Nun haben junge Fußballer bessere Chancen. Und wichtig: Wer gut im Fußball ist, wer es in den Turnieren und den Trainingscamps ganz nach oben schafft, bekommt Extrapunkte für den Gaokao, die Hochschulzulassungsprüfung, die größte Hürde in einem Schülerleben. Die Prüfung wird landesweit am gleichen Tag durchgeführt. Da hält China gewissermaßen den Atem an. Das zeigt deutlich, wie wichtig der Politik das Thema Fußball inzwischen ist.
Kein Chinese hat es allerdings bisher als regelmäßiger, beachteter Spieler in die Bundesliga geschafft. Die Chinesen sind noch nicht in Europa, dem Mekka des Weltfußballs angekommen. Ist das nicht erstaunlich, bei einem Pool von 1,4 Milliarden Menschen?
Nicht unbedingt. Selbst Ausnahmetalente müssen viel trainieren. Wenn sie dazu keine Möglichkeiten haben, dann wird das nichts. Fußball lag lange nicht im Blickfeld. Der populärste Sport war Basketball. Jeder Kindergarten, jede Uni und jedes Firmengelände hat einen Basketballplatz. Und NBA-Stars wie Yao Ming haben daraus einen Boom werden lassen. Wichtig ist nun, den Fußball ins Curriculum einzubauen. Dass die Schüler nun weniger Hausaufgaben machen müssen, wie jüngst beschlossen wurde, schafft den Spielraum dafür. Peking möchte nun die teuren privaten Fußballschulen zurückdrängen und stattdessen den staatlichen Schulsport ausbauen. Das wird helfen.
Braucht man nicht beides in China?
Ich glaube ja. Aber der Sektor des privaten Sports ist schon ein großes und profitables Geschäftsfeld. Allerdings schaffen es dort nicht unbedingt die Besten, sondern auch die mit mehr Geld, die sich die teuren Trainings leisten können. Deshalb ist das staatliche Element so wichtig.
Wie passt der BVB als privater deutscher Fußballverein in diese Entwicklung?
Wir sind seit 2017 hier. Wir haben 2014 das erste Office in Asien eröffnet, in Singapur. Damals haben sich die Kollegen von dort um China gekümmert und haben anhand unabhängiger Marktforschung schnell herausgefunden: 80 Millionen Chinesen kennen den BVB. Wir wollten und wollen weiterhin global eine besondere Nähe zu unseren Fans haben. Daher wurde 2017 das Office in Shanghai eröffnet.
80 Millionen Menschen sind so viele wie Deutschland Einwohner hat. Aber das sind nicht alles BVB Fans, oder?
Nein. Die laufen natürlich nicht alle im schwarz-gelben Schal hier herum. Aber sie kennen und identifizieren sich mit der Marke. Rund drei Millionen Fans haben wir allein auf Weibo, dem chinesischen Mix aus Twitter und Facebook. Unser Schwerpunkt in China liegt deshalb auf der Fanarbeit. Wir gründen Fanclubs, wir fahren zu ihnen und organisieren Partys für unsere Fans. Wir schaffen einmalige Erlebnisse. Und wir pflegen die Social-Media-Accounts und bauen sie aus. Gleichzeitig bieten wir unser Know-how an. Borussia Dortmund ist weltbekannt für seinen erfolgreichen Jugendfußball. Da können wir helfen und haben deshalb auch zahlreiche Coaches hier im Land.
Wie wird das Angebot angenommen?
Sehr gut. Es ist so, dass die Frage kommt, könnt ihr nicht noch mal 500 Trainer schicken. Aber das schaffen wir natürlich nicht.
Und Eure Trainer suchen dann nebenbei den ersten Top-Spieler für die Bundesliga, oder?
Dies wäre für jeden Verein ein riesen Asset in Hinblick auf Reichweite und Vermarktung. Man hat dies bei Wu Lei gesehen, der ein paar Jahre bei Espanyol Barcelona gespielt hat und von dem hunderttausende Trikots in China verkauft wurden.
Am Ende saß er dann doch viel auf der Bank.
Seine Karriere habe ich nicht bis zuletzt ins Detail verfolgt. Einen Spieler rein aus Marketing-Zwecken zu verpflichten und ihn dann auf die Bank zu setzen ist nicht der Ansatz des BVB. Wir scouten weltweit junge, hoffnungsvolle Talente.
Und haben Sie schon jemanden in der Pipeline?
Vor zwei Jahren waren wir mit einem ganz jungen Spieler im intensiven Gespräch. Unserer Philosophie folgend würden wir keinen Spieler holen, der sich dem Ende seiner Karriere nähert. Leider haben sich die Gespräche durch eine Olympiateilnahme dann zerschlagen. Es würde mich freuen, ein “Chinese Talent” in Dortmund begrüßen zu können.
Wie unterscheiden sich die chinesischen Fans von den BVB-Fans, die ja wiederum in Deutschland ganz spezielle Fans sind?
Die große Gemeinsamkeit ist erst einmal, dass jeder Fan eine eigene Geschichte hat, warum er Fan geworden ist – egal ob er Deutscher oder Chinese ist. Diesen Geschichten muss man Raum geben. Deshalb suchen wir die Nähe zu den chinesischen Fans und das wird auch belohnt. Die sagen uns dann: Die Spieler anderer Vereine haben auf ihrer China-Tour noch nicht einmal gewunken, sondern nur ihr Spiel abgespult. Das war beim BVB anders, die gehen in die Fan-Ecke, da gibt es Autogramme. Spieler zum Anfassen.
Die kommen aber nur selten. Und derzeit wegen Corona gar nicht.
Ja und deshalb fahren mein Team und ich jedes zweite Wochenende in eine andere Stadt und besuchen dort die Fans. Wir veranstalten ein Fußballturnier. Feiern zusammen. Lernen uns kennen. Und samstagabends schauen wir uns das Spiel per Livestream zusammen an. Mit der Zeitverschiebung meist pünktlich um 21:30 Uhr.
So dauert es aber sehr lange, bis man die 80 Millionen Fans versorgt hat.
Nicht, wenn man ein Kamerateam dabeihat und die Erlebnisse gleichzeitig streamt. Der BVB hat allein in China auf Social Media eine Reichweite von fünf Millionen Fans. Tendenz stark steigend.
Was aber so oder so fehlt, vor Ort oder digital, ist das Ruhrpott-Gefühl, die Heimatverbundenheit. Doch davon lebt der BVB. Das lässt sich kaum internationalisieren.
Das stimmt. Wir müssen deshalb andere Formen der Bindung finden, die sich digital transportieren lassen. Dass wir sie gefunden haben, sieht man an der Fanstruktur in China. Denn anders als in Deutschland, wo wir 80 Prozent männliche Fans und 20 Prozent weibliche Fans haben, sind in China etwa die Hälfte der Fans weiblich.
Warum?
Wir bieten, neben spannendem, schnellem und im besten Falle sehr erfolgreichem Fußball, auch Eindrücke “Behind-the-Scenes” und Lifestyle-Geschichten unserer jungen Mannschaft. Diese Art der Fan-Kultur lässt sich auch über große Distanzen digital transportieren: Welcher Spieler hat eine neue Freundin? Wer geht da mit seinem neuen Hund spazieren? Was macht er zum Valentinstag? Welche neuen Klamotten trägt er. Erling Haaland hat kürzlich ein Selfie mit sehr fancy Klamotten an einem norwegischen Fjord gepostet. So entsteht auch eine Art Zugehörigkeit….
…allerdings viel verspielter und mit mehr Popkultur…
…ja, so kann man es zusammenfassen. Dazu passt auch Biene Emma, unser Maskottchen. Sie hat einen eigenen Weibo-Account und mittlerweile einige zehntausend Follower. Wir sind jung, frisch, ein Stück weit anders als andere Clubs auf Social Media vertreten. Unsere sehr junge Fangemeinschaft in China – 70 Prozent unserer Fans sind unter 30 – schätzt sehr, dass wir auch viel Content auf Douyin (der chinesischen Version von Tiktok) ausspielen.
Allerdings sind Vereine wie Manchester United oder der FC Barcelona schon viel länger im chinesischen Markt unterwegs. Die Deutschen sind bei diesem Thema ja Nachzügler. Wie wollen Sie diesen Vorsprung aufholen?
Manchester United ist seit 25 Jahren hier. Sie sind eine unglaublich starke Marke, auch, wenn sie einige Jahre keine Titel mehr geholt haben. Umso authentischer müssen wir sein. Das ist der einzige Weg. Es sind die Emotionen, Erinnerungen, gemeinsame Feste, gemeinsame Niederlagen, die die Fans mit uns verbindet. Die vollen Stadien in der Bundesliga, die Fan-Kultur, die großen Gruppen an Auswärtsfans, sind etwas Besonderes in Deutschland: Zu einem Auswärtsspiel an einem Wochenende fahren schon mal zehn oder 20.000 Fans von Dortmund nach Berlin. Wir haben jeden Spieltag über 80.000 Fans im Stadion. Obwohl wir vom Fassungsvermögen nicht das größte Stadion in Europa haben, haben wir die höchste Auslastung im Fußball weltweit.
Der Signal Iduna Park ist immer ausverkauft. Das sind viele anderen Stadien im Ausland nicht. Unsere Fan-Kultur in Deutschland und besonders in Dortmund ist etwas Besonderes und sehr intensiv. Auch ein Grund, dass im Schnitt rund 1.000 englische Fans am Spieltag in Dortmund zu Gast sind. Die haben ihren englischen Club, kommen aber, weil wir akzeptable Ticketpreise haben, es eine einzigartige Stimmung gibt, das Bier noch preiswert ist und wir natürlich tollen Fußball spielen. Vor allem England steht inzwischen für ein hohes Maß an Kommerzialisierung des Fußballs. Diese Entwicklung haben wir in gesamten Fußballumfeld. Wir haben es in Deutschland geschafft, eine vernünftige Balance zu halten. Und das bleibt den Chinesen nicht verborgen.
Allerdings wird die Stimmung in chinesischen Stadien auch immer besser.
China hat seit Jahrzehnten ebenfalls eine klasse Fußball Fankultur. Ich gehe oft in Shanghai ins Stadion. Da ist Atmosphäre. Da wird gesungen. Da wird hinterher in der U-Bahn getanzt. Gänsehaut-Momente. Hier in Peking laufen die Fans mit grün-weißen mit Trommeln durch die Straßen. Die Auslastung variiert stark von Verein zu Verein, aber zu Shanghai Shenhua, Shandong Taishan oder Beijing Guoan kommen ebenfalls circa 40.000 Zuschauer pro Spiel.
Um mehr Menschen für Fußball zu begeistern, hat man eine Weile versucht, besonders teure Spieler im Westen zu kaufen, um das Niveau der Mannschaften zu pushen
Das hat nicht funktioniert und man hat zuletzt stark dagegen gesteuert. Jetzt liegen 100 Prozent Steuern auf jedem Transfer, die in den Jugendfußball investiert werden. Die alten, satten und manchmal schon leicht übergewichtigen Spieler haben in China nicht die gewünschten Impulse gegeben. Dies waren auch Exzesse, Einzelfälle, aus denen man schnell gelernt hat. Einige Spieler wurden zuvor für extreme hohe Summen nach China transferiert
…ja zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Und jetzt heißt es junge Chinesen langsam aufbauen. Was sind Probleme dabei für Trainer des BVB?
Wir kommen mit einem ganzheitlichen Anspruch. Neben den taktischen und technischen Fähigkeiten geht es darum, starke Charaktere zu entwickeln, um Ernährung, um Vorbildfunktion. Spieler zu fördern, die selbst kreative Entscheidung auf dem Platz treffen. Unser größtes Problem dabei ist die Sprache. Ein Übersetzer ist immer dazwischen. Doch gute Fußball-Dolmetscher zu finden ist nicht einfach. Wichtig ist zudem, dass die Kinder Spaß am Fußball haben. Dies darf nicht von außen erzwungen werden.
Warum will die chinesische Politik mehr Fußball, mal abgesehen davon, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping als Fußballfan gilt?
Kinder früh zum Sport zu erziehen und vor allem zu einem Sport, bei dem man nicht nur etwas abspult, sondern der auch Spaß macht und bei dem man taktisch klug handeln muss, hilft diesen Kindern natürlich später besser durchs Leben zu kommen. Gesunde Ernährung bei Kindern und viel Sport sind wichtig. Sie belasten das Gesundheitssystem später viel weniger.
Was fehlt noch am meisten?
Mehr Fußballplätze. Wenn ich eine Stunde fahren muss, um zu einem Platz zu kommen, dann ist das eine zu hohe Hürde. Zweitens: Es fehlt die Regelmäßigkeit. In vielen Clubs wird trainiert, es findet aber nur einmal im Monat ein Turnier statt. Das ist zu wenig. Das muss jedes Wochenende stattfinden. Die Kinder lieben den Wettbewerb. Aufsteigen. Absteigen. Kämpfen. Siegen und verlieren.
Trainieren Chinesen anders als Deutsche?
Das gesamte Bildungssystem funktioniert anders. Die Autorität eines Lehrers oder der Trainer ist in China extrem hoch. In Europa lassen wir die Kinder oft erst einmal spielen, lassen sie selbst entscheiden, gehen sie links oder rechtsherum. Danach geben wir ihnen ein Feedback. Die Situationen im Fußball sind sehr variabel, weniger einzustudieren als in anderen Sportarten. Daher versuchen wir diese Flexibilität und Kreativität zu fördern. Ich sage allerdings nicht, dass unser Ansatz der absolut und einzige richtige ist: Wir tauschen uns eng mit den chinesischen Trainer Kollegen aus. Zeigen was bei uns gut funktioniert und versuchen dies gemeinsam mit den lokalen Besonderheiten zu verknüpfen und in ein erfolgreiches Modell zu überführen.

Der “Flugzeugträger-Killer” ist ein heimisches Produkt, er stammt aus der taiwanischen Werft Lung Teh Shipbuilding. Das ist Grund genug für Präsidentin Tsai Ing-wen, zur Indienststellung des neuen Kriegsschiffs in die kleine Hafenstadt Su’ao an der Ostküste der Insel zu reisen und eine kurze Rede zur Verteidigungsfähigkeit ihres Landes zu halten. “Wir sind auf bestem Weg, im Bereich der nationalen Verteidigung unabhängig zu werden”, zitieren Nachrichtenagenturen die Präsidentin. Das sind starke Worte. Nach allgemeiner Wahrnehmung hängt die Sicherheit Taiwans vor allem vom Schutz durch die USA ab. Doch Tsai will die Eigenständigkeit nun zumindest deutlich stärken.
Diese Tendenz zur Zweigleisigkeit mit mehr Anbindung an den großen Bündnispartner und zugleich mehr Eigenentwicklungen spricht auch aus dem Bericht zur Verteidigungsfähigkeit Taiwans der Regierung in Taipeh, der nur alle vier Jahre erscheint. Aus dem zweiten “Quadrennial Defense Review (QDR)” gehen mehrere interessante Fakten hervor:
Analysten zufolge macht Taiwan sich nun an die Umsetzung der Schlussfolgerungen aus dem Verteidigungsbericht. “Im Jahr 2021 hat Taiwan angefangen, die Militärhardware zu beschaffen, die der QDR verlangt”, schreibt Thomas J. Shattuk vom Foreign Policy Research Institute in Philadelphia. “Taiwan muss seine militärischen Fähigkeiten schon heute aufbauen, nicht erst 2025.” Denn die immer bessere Ausstattung der Volksbefreiungsarmee schafft eine Abwehrlücke, die mit jedem Jahr größer wird. Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng hat entsprechende Forschungsaufträge an das National Chung-Shan Institute of Science and Technology vergeben.
Die neue Korvette mit dem Spitznamen “Flugzeugträger-Killer” ist ein wichtiger Baustein des neuen Konzepts. Offiziell handelt es sich um die Tuo-Chiang-Klasse 沱江 von Kriegsschiffen. Sie sind mit 60 Metern Länge kleiner als Fregatten, aber bis oben hin voll mit moderner Technik. Das keilförmige Schiff versteckt sich durch seine Form vor Radar. Vor allem aber ist es mit Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Hsing Feng III ausgestattet, die sich auch von Flugzeugträgerverbänden nur schwer abwehren lassen. Die von Tsai am Donnerstag in Dienst gestellte Ta Chiang 塔江 ist das zweite Exemplar dieser Klasse. Vier weitere sollen folgen.
Die Tendenz zur Aufrüstung ist verständlich. Taiwan in seiner heutigen politischen Form ist akut in seiner Existenz bedroht. Die Volksrepublik spricht ihr den Status als unabhängiger Staat ab. Sie behandelt die Insel nicht nur rhetorisch, sondern auch in praktischen Belangen als Teil ihres Gebiets.
Die Sorgen werden durch Militärmanöver und routinemäßige Provokationen verstärkt, die China – entsprechend seinen wachsenden militärischen Fähigkeiten – mit immer besserem Gerät ausführt. Eine aktuelle Studie des militärnahen US-Thinktanks Project 2049 beschäftigt sich mit der Frage, wie eine Invasion Taiwans in der Praxis aussehen könnte. Die Autoren unterstellen, dass die chinesische Armee Tausende von zivilen Schiffen in den Dienst ziehen will, um Millionen von Soldaten nach Taiwan zu transportieren.
Die Zahlen zeigen aber auch, wie schwierig und letztlich unwahrscheinlich so eine Invasion ist. Ginge es um den bloßen Sieg gegen ein feindliches Land, wäre der Fall klar: Die Volksbefreiungsarmee hätte mit Bomben und Raketen schnell die militärische Hoheit. Doch ein Angriff mit schweren Geschützen verbietet sich: Die Bewohner der Insel gelten nach Lesart der Volksrepublik als eigene Bürger. Sie stehen nach dieser Logik genauso unter dem Schutz der kommunistischen Regierung wie die Bewohner des Festlands. Zumindest den Zivilisten sollte also nur wenig passieren.
Eine Eroberung muss daher mit Fußsoldaten erfolgen – Straße für Straße, Haus für Haus. Und das in einem Land, in dem fast alle erwachsenen Männer Wehrdienst geleistet haben und kaum jemand unter chinesischer Herrschaft leben will. Allein das Vorhaben, die “feindlichen Häfen” (so der Name der Studie von Project 2049) des Landes unter Kontrolle zu bringen, dürfte die Admiralität der Volksbefreiungsarmee vor erhebliche Probleme stellen. Da hilft es nichts, dass die chinesischen Truppen die taiwanische Luftwaffe und große Teile der dortigen Marine vergleichsweise schnell ausschalten könnten.
Präsidentin Tsai und Taiwans Verbündete wissen zugleich, dass sie es China keinesfalls einfach machen dürfen. Zeichen von Schwäche würden das bestehende Gleichgewicht genauso stören wie übertriebene Drohgebärden. Eine Lücke in der taiwanischen Abwehr würde Xi geradezu zwingen, die sich bietende Gelegenheit zu nutzen. Schließlich drängen einige Hardliner in Volk und Führung durchaus darauf, die vermeintliche Schande der Spaltung zu korrigieren.
Ein Gleichgewicht der Kräfte ist also auch für diejenigen wichtig, die auf der Seite der Volksrepublik zwar mit dem Säbel rasseln, einen echten Krieg aber vermeiden wollen. Da China jedoch ungefähr im Gleichschritt mit seiner technischen und wirtschaftlichen Entwicklung aufrüstet, braucht auch Taiwan mehr und modernere Waffen. Analysten fällt daher schon länger eine gewisse Verbindung zwischen dem Anstieg des chinesischen Verteidigungsetats und US-Waffenlieferungen an Taiwan auf.
Die Indienststellung der neuen Tarn-Korvette Ta Chiang ist nach dieser Logik nur folgerichtig. Schließlich lässt China mehrere eigene Flugzeugträger auf Kiel legen. Derzeit befindet sich das dritte und bislang größte der Schiffe im Bau. Wenn die Gegenseite einen neuen Flugzeugträger auffährt, schickt Tsai eben einen neuen Flugzeugträger-Killer aufs Wasser.
Das heißt leider nicht, dass ein sonderlich stabiles Gleichgewicht besteht. Derzeit ist weltpolitisch zu viel in Bewegung, und das betrifft auch Taiwan:
Doch selbst die Falken vom amerikanischen RAND-Forschungsinstitut rufen nicht zu einer übermäßigen Aufrüstung auf. Auch sie raten dazu, bei Chinas steigenden Fähigkeiten mitzuziehen, nicht etwa, sie zu übertreffen.
Taiwan muss es jetzt gelingen, folgende Punkte glaubwürdig zu machen:
Bisher sind alle drei Punkte gegeben. Auch Japan hat in den vergangenen Wochen seine Solidaritätsbekundungen heraufgefahren. Verteidigungsminister Nobuo Kishi hat klargemacht, dass die Sicherheit Taiwans zu Japans ureigenen Interessen gehöre. So klare Worte spricht Tokio meist in Abstimmung mit Washington.
All das lässt Spekulationen von Analysten in Amerika und Taiwan über Xi als Angreifer erst einmal unrealistisch erscheinen. Auch der starke Mann kann seiner Partei gegenüber die Logik eines Angriffs nicht überzeugend darstellen. Voraussetzung ist aber, dass die Drohkulisse glaubwürdig bleibt. Dazu dienen die neuen Killer-Schiffe, Lenkraketen und Drohnen.
In Analysen zu Taiwan verwenden wir gegebenenfalls die ortsübliche Umschrift, die an Wade-Giles angelehnt ist, statt Pinyin.
Der chinesische Außenminister Wang Yi hat am Samstag einen Besuch in Vietnam abgeschlossen und ist zu Gesprächen in Kambodscha am Sonntag und Montag weitergereist. In Phnom Penh wird er Premier Hu Sen treffen. Danach geht es nach Singapur weiter. Die Länder Südostasiens haben derzeit ein gespaltenes Verhältnis zu China. Es ist meist größter Handelspartner und als Partner eine Alternative zu EU und USA. Wang verspricht zudem Impfstofflieferungen: Er hat Vietnam drei Millionen kostenlose Dosen versprochen. Zugleich sind die Beziehungen durch Gebietsstreit im Südchinesischen Meer und ein allgemeines Vormachtstreben Chinas belastet. fin
Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat am Freitag in zwei Telefonaten mit US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel die Weltlage besprochen. Die Bundeskanzlerin habe mit Xi insbesondere die Entwicklung in Afghanistan diskutiert, teilte die Bundesregierung mit. Außerdem tauschten sich die zwei Regierungschefs über die Pandemie-Situation aus. Im Hinblick auf die bevorstehende Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow im November stimmten sie ihre aktuellen Positionen ab. Auch Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wurden erörtert.
Mit Biden sprach der chinesische Staatspräsident über ähnliche Themen: Handel, Klima und Corona. Es war erst das zweite Telefonat dieser Art seit Bidens Amtsantritt im Januar. Das Gespräch dauerte anderthalb Stunden. Die amerikanische Wiedergabe der Gesprächsergebnisse wichen von denen der chinesischen Seite ab. Nach Darstellung von Xinhua hielt Xi seinem US-Kollegen einen Vortrag über die große Verantwortung, die die Führung einer Weltmacht mit sich bringt. In der Version von Bloomberg belehrte Biden seinen chinesischen Kollegen, dass dieser mehr Ernsthaftigkeit und Kompromissbereitschaft in den Dialog mit den USA einbringen müsse. fin
Die EU-Strategie für den Indopazifik, mit der Brüssel seine Allianzen in der Region gegen China stärken will, könnte es einer Umfrage zufolge in den Mitgliedsstaaten schwer haben. Die Befragung des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR) zeigt große Differenzen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten: “In Europa herrscht keine Einigkeit darüber, in welchen Bereichen die EU sich stärker in die Region einbringen sollte oder welchen geografischen Raum durch den Begriff ‘Indopazifik’ überhaupt abgedeckt wird”, erklärt die Koordinatorin des ECFR-Asien-Programms, Manisha Reuter, gegenüber China.Table. “Trotz der wachsenden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der Region besteht in weiten Teilen der EU-Mitgliedstaaten weiterhin ein Mangel an Interesse.”
Die Umfrage und ein begleitender Bericht wurden am Montag vorgestellt. ECFR hatte dafür hochrangige politische Akteure der EU-Mitgliedsstaaten befragt. Die EU-Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) werden am Dienstag ihre erweiterte Strategie für die Region präsentieren. Diese soll unter anderem Partnerschaften im Digital-Bereich mit Japan, Südkorea und Singapur zum Ziel haben (China.Table berichtete).
Dass die Debatte in den einzelnen Mitgliedsländern jedoch “wenig ausgeprägt” sei, könnte letztlich die Effektivität der Strategie begrenzen, warnt Reuter. Sie sieht Nachholbedarf vonseiten Brüssels: “Diejenigen, die die Debatte in Europa antreiben, müssen überzeugend darlegen, warum Europa im Indopazifik aktiv sein sollte. Dabei geht es auch um ein legitimes strategisches Interesse an der Region jenseits von wirtschaftlicher Diversifizierung, welches die EU klar formulieren sollte.” Generell sei die Neuausrichtung von Europas Rolle im Indo-Pazifik-Raum aber ein wichtiger Baustein, so Reuter.
Die EU arbeitet derzeit an mehreren Ecken an Strategien auf die Präsenz Chinas in Asien und entlang der Neuen Seidenstraße (BRI). Die EU-Außenminister hatten zuletzt im Juli den Druck auf die EU-Kommission erhöht, eine attraktive und nachhaltige Alternative zur BRI zu schaffen (China.Table berichtete). ari
Ein Sprecher der afghanischen Taliban hat die Erwartung geäußert, dem pakistanisch-chinesischen Wirtschaftskorridor beitreten zu können. Das berichtet die Wirtschaftszeitung Nikkei. China sei der Idee nicht abgeneigt, unterstellt eine anonyme Quelle gegenüber dem Blatt. China hat Afghanistan bereits Soforthilfe in Höhe von rund 26 Millionen Euro versprochen (China.Table berichtete). Der pakistanisch-chinesischen Wirtschaftskorridor ist ein Kernprojekt der neuen Seidenstraße (Belt and Road Inititative, BRI). Die Aussichten eines religiös-fundamentalistisch geführten Afghanistan als Teil des chinesischen Wirtschaftsnetzwerks sind einerseits ungewiss, andererseits geht China höchst pragmatisch an den Umgang mit den neuen Nachbarn heran (China.Table berichtete). fin
Der Handy- und Hausgeräteanbieter Xiaomi will offenbar schon 2024 ein erstes Modell auf den Markt bringen. Die Nachrichtenplattform 36kr berichtet aus Firmenkreisen, dass das Unternehmen danach alle drei Jahre ein neues Modell herausbringen wolle. Der jährliche Absatz soll anfangs rund 300.000 Stück betragen. Firmenchef Lei Jun hatte im März angekündigt, ins Geschäft mit smarten, vernetzten E-Autos einsteigen zu wollen (China.Table berichtete). Die Nachricht wurde sowohl in der Fahrzeug- als auch in der Elektronikbranche mit großem Interesse registriert.
Xiaomi war nach seiner Gründung aus dem Stand auf einen der Spitzenplätze am Handymarkt gesprungen und hat danach durch geschicktes Marketing den Markt für Elektronik und Hausgeräte aufgerollt. Erfolgsfaktoren sind gutes Design, funktionierende Vernetzung und günstiger Preis – Eigenschaften, die vermutlich auch das “Mi Auto” haben wird. fin
Am Mittwoch (15.9.) hält die Chinesische Handelskammer in Deutschland (CHKD) ihren China Day ab. Der Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) beteiligen sich als Kooperationspartner. Das Thema der Online-Veranstaltung lautet “Krise als Chance?” Hauptthema ist das Investitionsklima in China und in Deutschland, mit dem Geschäftsleute beider Seiten derzeit unzufrieden sind. Es sprechen unter anderem Duan Wei, Hauptgeschäftsführer der CHKD, Wolfgang Niedermark vom BDI sowie Volker Treier, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung. fin

Evelyne Gebhardt ist eine waschechte Europäerin. Das merkt die Besucherin schon bei der Begrüßung. Die 67-Jährige spricht ein perfektes Deutsch – mit einem unverwechselbar französischen Akzent. Die Liebe zur Germanistik und zu einem deutschen Mann führte sie schon als sehr junge Frau von der Île-de-France nach Baden-Württemberg. Und dieser europäische Geist ist es, der auch ihr politisches Engagement für Menschenrechte trägt.
“Die Bürgerrechte, die Grenzenlosigkeit, die Überwindung von Krieg haben mich schon immer sehr beschäftigt”, erklärt die Politikerin, die in Schwäbisch Hall lebt. Das sei der Grund, warum sie überhaupt Europaabgeordnete geworden sei: “Die Grundrechte machen unsere europäische Identität aus und ich möchte, dass auch Menschen in anderen Staaten die Freiheiten genießen können, die sich daraus ergeben. Wenn uns die chinesische Regierung sagt, die Menschenrechte in China gehen uns nichts an, dann sage ich also klar, dass das nicht stimmt. Wir müssen uns da einmischen.”
Als die China-Delegation vor rund drei Jahren zuletzt ins Reich der Mitte reiste, war Gebhardt nicht dabei. Ihr letzter China-Besuch liegt deshalb, so erzählt sie, schon acht bis neun Jahre zurück. “Das Land hat eine faszinierende Geschichte mit einer großen Friedensdividende. Ich finde es schade, dass China dies nicht weitertreibt, sondern auf eine harte Art gegen die eigenen Menschen vorgeht”, sagt die SPD-Politikerin und nennt einige Beispiele: “Die inakzeptablen Camps, in denen die Uiguren gezwungen werden sollen, ihre Religion und ihre eigene Lebensweise aufzugeben. Das nationale Sicherheitsgesetz aus Peking, dass das zweite System in Hongkong praktisch ad acta legt. Die Aggressivität, mit der die Regierung Xi Jinping derzeit gegen Taiwan vorgeht.”
Deshalb, ist Evelyne Gebhardt überzeugt, waren die Beziehungen zu China nie so schlecht wie jetzt. Und wer soll das besser einschätzen können als sie, die seit 1994 im Europaparlament sitzt? “Die Zusammenarbeit hat sich natürlich verschlechtert”, sagt sie. Und aktuell sei der Versuch, als Europaabgeordnete dorthin zu reisen, “nicht opportun”. Dabei wäre es so wichtig, gute Beziehungen zu diesem Global Player zu haben – das merkt Gebhardt auch in ihrer täglichen Arbeit im Binnenmarktausschuss des Europaparlaments.
“China hat große Initiativen wie die Seidenstraße oder ihr Engagement in Afrika. Es ist wichtig, dass wir das begleiten und unsere eigenen Strategien in dieser Beziehung gestalten”. Gebhardt führt also tagtäglich Gespräche mit Experten und Expertinnen, Menschenrechtlern und Menschenrechtlerinnen, Journalisten und Journalistinnen, die über die Situation in China berichten. Und sie appelliert an die Regierung, wieder mit dem Europäischen Parlament in Kontakt zu treten: “Peking muss die Sanktionen gegen Europaabgeordnete und den Menschenrechtsausschuss des Europäischen Parlaments aufheben.” Janna Degener-Storr
Marcel Wiedmann geht für den Autozulieferer Hella nach Shanghai. Er wird das Hella Corporate Center China leiten und erhält zugleich den Posten eines Executive Vice President Finance & Controlling. Wiedmann war bisher am Standort Lippstadt in den Bereichen Logistik und Qualitätssicherung tätig.
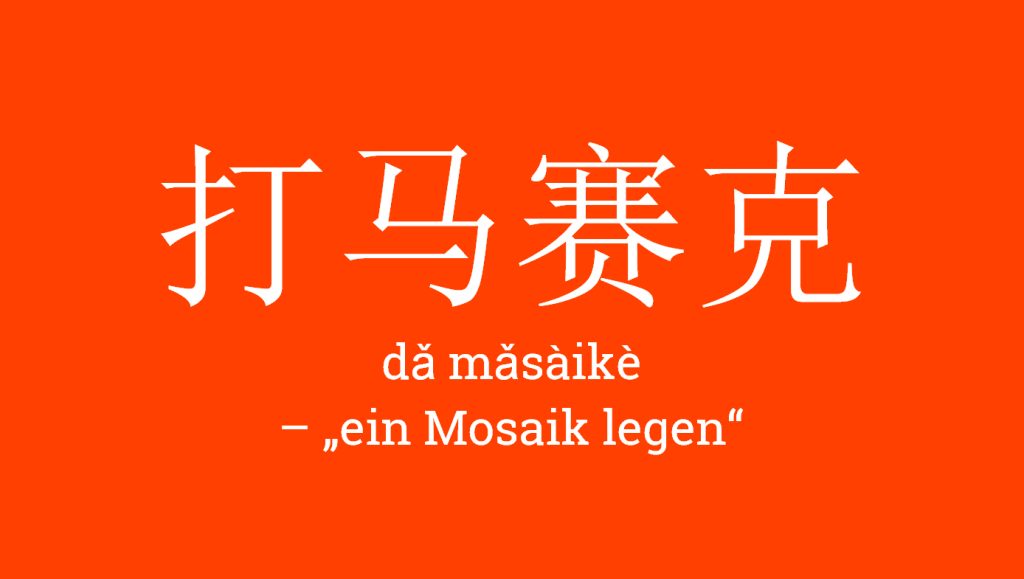
Was gibt tiefste Einblicke in die Seele einer Nation? Genau – das Unterhaltungsfernsehen. Und wer das in China anknipst, wird sich nach einer Weile sicherlich verdutzt die Augen reiben und an seiner Sehschärfe zweifeln. Denn in chinesischen Lifestyle-, Entertainment- und Reality-Formaten wird es in jüngster Zeit immer häufiger verschwommen. Nein, hier hat niemand mit Fettfingern auf die Kameralinse gegrapscht und es ist auch kein grauer Star im Anflug. Die unscharfen Stellen gehören sich so. Es handelt sich um ein fachmännisch gelegtes Medienmosaik chinesischer Prägung. 打马赛克dǎ mǎsàikè – wörtlich “ein Mosaik schlagen/legen” – nennt man das Ganze. Auf Deutsch übersetzt einfach “verpixeln”. Und gepixelt wird in Chinas Unterhaltsindustrie mittlerweile was das Zeug hält.
Nummer 1: 纹身 wénshēn – “Tattoos”. Tätowierungen und andere unerwünschte Körperverzierungen, die das Publikum auf dumme Gedanken bringen könnten, werden in China in der Nachbearbeitung neuerdings fein säuberlich rausgepixelt. “Mosaike” kommen dabei zum Beispiel auch über punkige Ohrringe (耳环 ěrhuán), die das Ohrläppchen stark aufdehnen, oder religiöse Symbole jeder Art (z. B. Kreuzkettchen). Wer als Showteilnehmer Mitleid mit den emsigen Bienchen der Postproduktion hat, verdeckt Hautverzierungen und Ähnliches in vorauseilendem Gehorsam freundlicherweise gleich selbst, z. B. durch langes Beinkleid, großflächige Pflaster oder hautfarbene Armüberzieher. (Auch über all dies also bitte nicht wundern.)
Nummer 2: 品牌 pǐnpái – “Produktmarken“. T-Shirts, Schuhe und Kopfbedeckungen mit deutlich erkennbarem Firmenlogo? Auch das ist ein Fall für Chinas Pixel-Polizei! Denn Bildschirmpräsenz gibt es natürlich nur gegen Bares. Ansonsten wird digital nachgepflastert.
Nummer 3: 赞助商 zànzhùshāng – “Sponsoren“. Moment mal, die haben doch bezahlt! Ja, aber eben vielleicht nicht für alle Sendelagen. Schließlich werden Showformate von den Produktionsfirmen in Zeiten von Multimedia natürlich über unterschiedliche Kanäle verwurstet (z. B. Fernsehen, zahlungspflichtige Streamingdienste, kostenlose Videos im Netz etc.). Und jedes Ausstrahlungsformat lassen sich die Firmen üppig extra vergüten. Nur wer also die gesamte “Werbeflatrate” bucht, darf auch überall sein Logo in die Kamera halten. Ansonsten gilt auch hier: sorry, Pixelschwamm drüber.
Nummer 4: 工作人员 gōngzuò rényuán – “Mitarbeiter“. Zwar geht hinter den Kulissen ohne sie nichts, aber in der Kulisse sollten Techniker, Kameraleute, Visagisten, Assistenten, Berater und Co. dann bitte doch nicht auftauchen. Wabert also eine geistermäßig-verschwommene Personenwolke durchs Bild, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen nachträglich rausgepixelten Mitarbeiter. Oder…
Nummer 5: 翻车的人 fānchē de rén – “in Ungnade Gefallene“. Treue Leser werden sich noch an Kolumne 19 erinnern, in der wir den Ausdruck 翻车 fānchē “etwas an die Wand fahren” beleuchtet haben (wörtl. “der Wagen überschlägt sich”). In jüngster Zeit purzeln immer häufiger und rascher Stars und Sternchen aus dem chinesischen Promi-Himmel in die Shitstorm-Hölle, indem sie ihre Karriere aus verschiedensten Gründen an die Wand fahren. Das geschieht manchmal so schnell und unerwartet, dass Entertainmentformate mit dem konsequenten Herausschneiden oder gar einer Neubesetzung der in Ungnade gefallenen Celebrities nicht hinterherkommen. Da hilft als Lastminute-Lösung nur ein modisches Ganzkörper-Pixelkleid. Aber Mosaik ist ja, wie wir gesehen haben, auf chinesischen Bildschirmen derzeit groß in Mode.
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.
