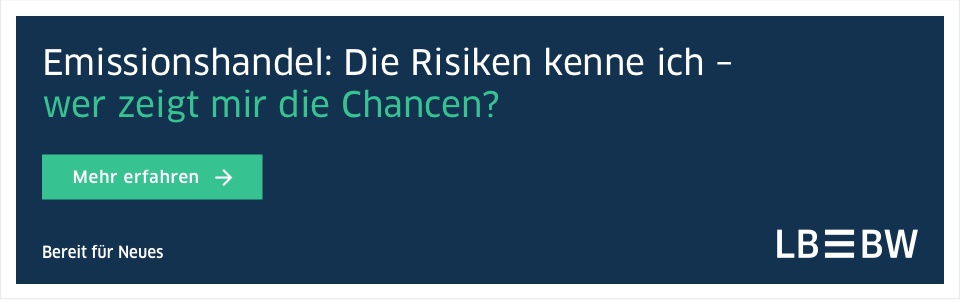morgen kommen die Energieminister der EU in Prag zu einem informellen Treffen zusammen. Die Mitgliedstaaten müssen schnell auf einen Nenner kommen – beim gemeinsamen Gaseinkauf, bei der Einsparverpflichtung, bei der Deckelung des Gaspreises und nicht zuletzt bei der Entkopplung der Strom- und Gaspreise. Bei einigen dieser Agendapunkte scheint sich ein Konsens anzubahnen. Das Thema der Finanzierung allerdings dürfte noch für viel Diskussionsstoff sorgen, schreiben Claire Stam, Manuel Berkel und Till Hoppe.
Die Energiekrise macht auch der Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Nicht unbedingt nur aufgrund hoher Energiepreise, sondern weil ein Kreislauf in sich geschlossen sein muss, um zu funktionieren. Unterbrechungen drohen aber derzeit in der Papierindustrie. Die Nachfrage nach gewissen Papiersorten ist eingebrochen, die Papierproduktion stockt mancherorts. Welche neuen Probleme das mit sich bringt, erklärt meine Kollegin Leonie Düngefeld.
Angekündigt hatten es mehrere, getan bisher nur eine: Die österreichische Regierung hat gegen die Entscheidung der EU-Kommission, Erdgas und Atomkraft in die “grüne” Taxonomie aufzunehmen, Klage beim Gericht der Europäischen Union eingereicht, wie Leonore Gewessler (Grüne) gestern bekanntgab.
Gewesslers Kollegin und Fraktionschefin der Grünen in Österreich, Sigrid Maurer, porträtieren wir im heutigen Europe.Table. Die 37-jährige Tirolerin hat die Klimakrise fest im Blick und sieht die aktuellen Herausforderungen als Chance für den nötigen Wandel.
Ich wünsche eine spannende Lektüre!

“Es handelt sich um einen informellen Rat, was bedeutet, dass über rechtliche Aspekte nicht verhandelt werden kann”, erklärt ein Diplomat. Die Diskussionen werden deshalb am 20. und 21. Oktober auf einem formellen EU-Gipfel fortgesetzt, gefolgt von einer ersten Gesprächsrunde unter den Ministern beim Energierat am 25. Oktober. Verabschiedet werden soll der Gesetzesvorschlag auf einem außerordentlichen Energierat im November – dem vierten außerordentlichen Rat seit Beginn der tschechischen Ratspräsidentschaft am 1. Juli.
Unter den Mitgliedstaaten zeichnet sich ein Konsens über die Frage des gemeinsamen Gaseinkaufs ab. Dies bedeutet eine Kehrtwende, nachdem die im Sommer eingerichtete Energieplattform lange keine echte politische Unterstützung von den Mitgliedstaaten erhalten hatte. “Die Mitgliedstaaten wollen jetzt schneller vorankommen und erwarten von Kommissarin Kadri Simson, dass sie einen detaillierten Plan zu diesem Thema vorlegt”, bestätigte der Diplomat und erklärte, dass die Details beim nächsten Energierat am 25. Oktober diskutiert werden.
In Berlin wies Sven Giegold, grüner Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, gestern auf einer Veranstaltung der Europäischen Bewegung Deutschland die Kritik aus einer Reihe von Mitgliedstaaten zurück, dass die Bundesrepublik gegen den gemeinsamen Gaseinkauf sei. “Europa als Ganzes wird diese hohen Gaspreise ökonomisch weder auf staatlicher Ebene noch auf privater Ebene aushalten”, stellte er fest. “Deshalb müssen wir die europäische Einkaufsmacht bündeln und nutzen. Die Bundesregierung lehnt es nicht ab, gemeinsam einzukaufen”.
Letztendlich waren es die Partner der EU-Gaslieferanten, wie die LNG-Exporteure USA und Katar, aber auch Norwegen, die zur Belebung der Debatte beitrugen, indem sie betonten, dass sie lieber mit einem EU-Vertreter verhandeln würden, als separat mit einzelnen Mitgliedstaaten zu sprechen. “Dieser Aspekt hat dazu beigetragen, die Diskussion über die Einrichtung einer solchen Plattform unter den EU-Ländern voranzutreiben”, berichtet der Diplomat.
Außerdem wird den Mitgliedstaaten immer klarer, dass ein gemeinsamer Einkauf zu einem günstigeren Gaspreis führt, fügt er hinzu. Oder wie Giegold das Ziel formulierte: damit “wir mit unseren Freunden und denen, die es vielleicht noch werden, klar über die Gaspreiskonditionen verhandeln. Und uns eben nicht mehr gegenseitig national ausspielen lassen”.
Überraschend sprach sich Giegold gestern auch dafür aus, die europäischen Einsparverpflichtungen zu stärken. Im Sommer hatten die Mitgliedstaaten beschlossen, den Gasverbrauch von August bis März um 15 Prozent zu senken. Verpflichtend werden soll das Ziel allerdings nur durch einen erneuten Beschluss des Rates. “Dabei ist Deutschland bereit, einen seiner Leistungsfähigkeit angemessenen höheren Anteil zu übernehmen”, sagte der Staatssekretär. Deutschland würde damit den EU-Partnern entgegenkommen, denn viele machen die Bundesrepublik mit ihrer hohen Abhängigkeit von einst günstigem russischen Gas für die aktuelle Misere verantwortlich.
Die EU brauche außerdem eine Stärkung der Speicherpflichten, sagte Giegold. Im kommenden Jahr müsse früher mit der Befüllung der Speicher begonnen werden. Gestern mahnte die von der Bundesregierung eingesetzte Gaskommission, dass die Herausforderungen im Winter 2023/24 wahrscheinlich noch größer werden als in diesem. Erst vor wenigen Wochen hatte die Bundesregierung nach Brüssel gemeldet, dass die deutschen Gasspeicher 2023 wahrscheinlich leerer sein werden als in diesem Jahr.
In ihren Bemühungen, die Gaspreise zu senken, fordert eine Mehrheit der Mitgliedstaaten außerdem, dass die Strompreise von den Gaspreisen abgekoppelt werden. “Die Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis und die Einrichtung einer Plattform für den gemeinsamen Einkauf von Gas sind zwei Maßnahmen, die für die Mitgliedstaaten den Vorteil haben, dass sie schnell umgesetzt werden können”, behauptet der Diplomat weiter – wobei Politiker aus der Ampelkoalition weiter skeptisch sind, ob die Einkaufsplattform schnell an den Start gehen kann.
Für den Diplomaten muss es aber erstmal spezifischer werden. “Die Mitgliedstaaten müssen sich zunächst auf eine gemeinsame Definition dessen einigen, was eine Gaspreisobergrenze ist. Alle Mitgliedstaaten sprechen von Gaspreisobergrenzen, meinen aber nicht unbedingt das Gleiche”, sagte er.
Die Europäische Kommission hat ihrerseits in einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der EU eine vorübergehende Begrenzung der Gaspreise im Großhandel in Betracht gezogen, um die Energiekrise zu bewältigen. “Diese Obergrenze sollte auf einem Niveau festgelegt werden, das die Gasversorgung Europas weiterhin sicherstellt, aber auch zeigt, dass die EU nicht bereit ist, jeden Preis für Gas zu zahlen”, schrieb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die EU-Staats- und Regierungschefs vor ihrem informellen Gipfel am Freitag.
Eine solche Obergrenze müsste mit anderen Maßnahmen einhergehen, einschließlich EU-weiter Auktionen zur weiteren Senkung der Nachfrage und verbindlicher Vereinbarungen zwischen den EU-Ländern zur gegenseitigen Unterstützung. Die Kommission argumentiert außerdem, dass der europäische Leitindex TTF zu eng an Pipeline-Gasimporte gekoppelt und daher nicht repräsentativ für einen Markt mit wachsendem LNG-Importanteil ist.
In Berlin unterstützt man die Idee, einen neuen Leitindex einzuführen. “Wir brauchen auch einen alternativen Benchmark für die Langfristverträge, damit diese sich von den hohen Spotmarktpreisen ein Stück weit lösen können”, sagte Giegold gestern.
Es bleibt die Frage der Finanzierung dieser Maßnahmen. “Dies ist ein Punkt, den die Mitgliedstaaten diskutieren müssen”, berichtet der Diplomat. Einige Mitgliedstaaten sagen, dass sie selbst zahlen können, während andere sagen, dass es sinnvoll wäre, die Covid-Fonds zu nutzen. “Im Moment gibt es keinen Konsens, beide Seiten diskutieren noch”, sagt der Diplomat. Immerhin wird die Finanzfrage auch auf der Tagesordnung des Ministertreffens stehen, mit einer Rede des Vizepräsidenten der EIB, Thomas Östros. mit Till Hoppe und Manuel Berkel
Auf allen Ebenen soll gerade die Kreislaufwirtschaft vorangebracht werden: Die EU-Kommission stellt Ende November ihr zweites Gesetzespaket vor und das Bundesumweltministerium arbeitet an Eckpunkten für eine deutsche Strategie. Dass ein funktionierender Produktkreislauf von mehr als Ökodesign und Produktlabels abhängt, wird zurzeit durch die Energiekrise deutlich: vor allem nämlich von einer funktionierenden Industrie. Für den Bereich des Altpapiers sprechen Verbände der Entsorgungsindustrie bereits von einer Bedrohung der Kreislaufwirtschaft. Gleiches könnte bald auch für Glas und Leichtverpackungen eintreten.
Was die direkten Auswirkungen betrifft, gehört die Kreislaufwirtschaft zu den weniger betroffenen Branchen, erklärt Peter Kurth, der Präsident des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Sowohl in der Logistik als auch in den Anlagen sei es gelungen, den Erdgasbedarf teilweise durch andere Energieträger zu substituieren. Recycling-Verfahren sind zudem in der Regel weniger energieintensiv als die Produktion von Primärrohstoffen.
Die Kreislaufwirtschaft sei vor allem indirekt von der Energiekrise betroffen, denn sie bedingt, dass Sekundärrohstoffe zurück in die Industrie gelangen. “Wenn wir Materialien getrennt sammeln, müssen wir diese auch in der Industrie oder bei anderen Anlagen platzieren können.” Eine getrennte Papiersammlung etwa setze voraus, dass es eine Papierindustrie gibt, die das recycelte Papier abnimmt. Ansonsten sei die getrennte Sammlung von Papierabfällen überflüssig. “Ein Kreislauf muss in sich geschlossen sein”, sagt Kurth. “Wenn eine Stelle herausbricht, funktioniert er nicht mehr.”
Neben den hohen Kosten sorgt derzeit auch ein Einbruch in der Nachfrage einiger Papiersorten dafür, dass europäische Papierwerke die Produktion unterbrechen und Kurzarbeit anmelden. In Deutschland beantragte etwa der Hygienepapierhersteller Hakle Anfang September ein Insolvenzverfahren. Weitere Werke in Deutschland, Österreich und Italien drosselten, unterbrachen oder beendeten die Produktion.
Die Papierproduktion ist besonders energieintensiv, da das Zellmaterial erhitzt und getrocknet werden muss. Der gesamte Sektor, insbesondere die Produktion von Hygienepapier, ist stark von Erdgas als Brennstoff abhängig – in Deutschland zu 58 Prozent. Gleichzeitig ist es den Fabriken derzeit kaum möglich, den Gasbezug zu substituieren. Laut einer Umfrage des Verbands Die Papierindustrie blieben im Falle einer Unterbrechung der Gasversorgung lediglich zehn bis zwölf Prozent der Papiererzeugung in Deutschland übrig.
Dabei ist der Produktzyklus von Papier ein Vorbild der Kreislaufwirtschaft: Die Recyclingrate von Papier in Europa (EU, Norwegen, Schweiz und Großbritannien) beträgt über 70 Prozent. In Deutschland, dem größten Papierproduzenten der EU, lag sie 2020 bei 79 Prozent. Hier werden täglich 50.000 Tonnen Altpapier zur Herstellung von Verpackungen und neuem Papier eingesetzt.
Zuletzt sind die Preise für Altpapier enorm gesunken. “Wir rechnen damit, dass die jetzt schon bestehenden Schwierigkeiten, Altpapier gegen einen Preis abzusetzen, in den nächsten Wochen ein zentrales Problem werden”, sagt Kurth.
Dies hätte weitreichende Folgen: “Eine Unterbrechung des Papierrecyclings würde sich insbesondere auf Transportverpackungen auswirken, was eine ernste Gefahr für den EU-Binnenmarkt bedeutet, und sie würde erhebliche Folgen für die Lebensmittellogistik haben”, erklärt Jori Ringman, Geschäftsführer des europäischen Verbands der Papierindustrie, Cepi.
Als Übergangslösung wollen die Verbände das Altpapier zwischenlagern. In einem Schreiben an die deutsche Umweltministerkonferenz forderte der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE), Genehmigungsverfahren für Zwischenlager zu vereinfachen. Komme die Abnahme von Sekundärrohstoffen zu einem Stillstand, sei “ein immenser Platz- und Finanzierungsbedarf für Zwischenlager” zu erwarten, heißt es in dem Schreiben. Unter der Lagerung leidet zwar die Qualität des Papiers und die Brandgefahr steigt mit der gelagerten Menge. Ansonsten muss das Altpapier jedoch absichtlich verbrannt werden – auf Müllverbrennungsanlagen.
Hier besteht zurzeit ein weiteres Problem für die Entsorgungsindustrie: Versorgungsengpässe bei Erdgas schränken auch die Produktion von Ammoniak ein. Dieses wird in Müllverbrennungsanlagen zur Rauchgasreinigung eingesetzt. In den Filteranlagen reagiert es mit giftigen Stickoxiden zu ungefährlichem Stickstoff und Wasser. In Deutschland gibt es nur wenige Produzenten, aus dem Ausland ist der Zusatzstoff auch nicht beliebig verfügbar.
Bricht die Ammoniakproduktion weiter ein, droht die Wahl zwischen Pest und Cholera, erklärt Peter Kurth: Entweder müssen die Verbrennungsanlagen stillstehen, was irgendwann zum Entsorgungsnotstand führen würde – oder sie laufen weiter und blasen giftige Stickoxide in die Luft. Ein Stillstand hätte zudem Auswirkungen auf die Fernwärmeleistung: Die Verbrennungsanlagen liefern in städtischen Ballungszentren bis zu 20 Prozent der Fernwärme.
Bislang handelt es sich lediglich um Warnungen. Ob sich der Dominoeffekt der Energiekrise für die Abfall- und Kreislaufwirtschaft durch den sogenannten Abwehrschirm der Bundesregierung abmildern lässt, ist abzuwarten.
12.10.-14.10.2022, Herrenhausen
VWS, Conference AI and the Future of Societies
The Volkswagen Stiftung (VWS) discusses how all parts of society can participate in the benefits of AI. INFOS & REGISTRATION
12.10.-13.10.2022, Berlin/online
HBS, Podiumsdiskussion Ukraine im Krieg: Deutsch-Ukrainische Beziehungen auf dem Prüfstand
Die Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert die Frage, wie eine glaubwürdige Zeitenwende politisch gestaltet werden kann. INFOS & ANMELDUNG
12.10.2022 – 08:30-16:00 Uhr, Erlangen/online
Frauenhofer-Institut, Konferenz Team-X: Tagung mit Health-X and Gaia-X – Die Gesundheitsversorgung der Zukunft
Das Frauenhofer-Institut beleuchtet den Weg hin zu mehr Datensouveränität. INFOS & ANMELDUNG
12.10.2022 – 10:00-15:00 Uhr, Berlin
Initiative D21, Konferenz GovTalk 2022 – Das Netzwerkevent zum Digitalen Staat
Die Initiative D21 thematisiert die Fortschritte und Herausforderungen des digitalen Staats. INFOS & ANMELDUNG
12.10.2022 – 18:00-22:00 Uhr, Brüssel (Belgien)
Bayerische Landesvertretung bei der EU, Diskussion Welche aktuellen Herausforderungen stellen sich den regionalen Betrieben in Europa?
Die Bayerische Landesvertretung bei der EU beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Energie-, Umwelt-, Steuer-, Industrie-, Arbeitsmarkt- und Handelspolitik der EU auf Betriebe in Europa. INFOS & ANMELDUNG
13.10.-14.10.2022, Brüssel (Belgien)
CRE, Conference An Industry for the European Circular Economy
Chemical Recycling Europe (CRE) addresses the latest topics around the chemical recycling industry and its role in the European Circular Economy. INFOS & REGISTRATION
13.10.2022 – 09:00-17:30 Uhr, online
EIT, Conference Innovation Factory 2022 Brokerage Event
The European Institute of Innovation & Technology (EIT) supports the next generation of digital companies that can impact Europe and the world’s challenges. INFOS & REGISTRATION
13.10.2022 – 14:00-16:15 Uhr, online
Eurogas, Conference European Gas Tech: Delivering On 2050
Eurogas discusses how innovative renewable and decarbonised gas technologies are contributing to the decarbonisation of Europe. INFOS & REGISTRATION
13.10.2022 – 18:00-20:00 Uhr, Leipzig
FES, Podiumsdiskussion Tax-Talks: Klima und Wirtschaft – Die Lenkungswirkung von Steuern für eine klimagerechte Wirtschaftspolitik
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) beschäftigt sich mit der Frage, wie Steuern unsere Gesellschaft gerechter machen können. INFOS & ANMELDUNG
In der Bundesregierung wird weiter über die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplante Einsatzreserve der beiden Atomkraftwerke Isar II und Neckarwestheim gestritten. Entgegen Habecks Plänen und einer Vereinbarung in der Koalition gab die Bundesregierung am Montag noch kein grünes Licht für den Gesetzentwurf, wie eine Ministeriumssprecherin der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Sie begründete dies mit “politischen Unstimmigkeiten”. Das Vorhaben gerät somit offenbar ins Wanken. “Damit ist der enge Zeitplan für das Verfahren nicht zu halten, was den Betreibern heute mitgeteilt wurde”, sagte die Sprecherin. “Diese Verzögerung ist ein Problem, wenn man will, dass Isar 2 im Jahr 2023 noch Strom produziert.”
In Koalitionskreisen hieß es ergänzend, die Verzögerung gehe auf Einwände aus dem Bundesfinanzministerium zurück. “Es gab dazu eine klare Verständigung mit den Koalitionspartnern, trotz unterschiedlicher Perspektiven diesen Gesetzentwurf zur Einsatzreserve am heutigen Montag durchs Kabinett zu bringen, so dass er im parlamentarischen Verfahren behandelt werden kann”, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. “Aufgrund politischer Unstimmigkeiten wurde aber von dieser Verständigung abgerückt.”
Die Sprecherin unterstrich, das Ministerium wolle, dass die süddeutschen Atomkraftwerke auch nach dem Jahreswechsel laufen und so bei Bedarf einen Beitrag zur Stabilität im Stromsystem leisten könnten. Dazu seien die notwendigen Vereinbarungen mit den Atomkraftwerksbetreibern getroffen worden. Es müssten aber zeitnah die Reparaturen am Atomkraftwerk Isar II vorgenommen werden, die Atomkraftwerksbetreiber bräuchten Klarheit. Das Ministerium setze sich weiter für Lösungen ein: “Sonst steht man wegen Verzögerungen ohne Isar 2 da.” rtr
Österreich hat seine angekündigte Klage gegen die Entscheidung der EU-Kommission, Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie aufzunehmen, beim Gericht der Europäischen Union eingereicht. Gestern endete die Frist für Klagen gegen den Delegierten Rechtsakt. Die Nichtigkeitsklage enthalte insgesamt 16 Klagepunkte, gab die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestern auf einer Pressekonferenz bekannt. Den Delegierten Rechtsakt bezeichnete sie als verantwortungslos, unvernünftig und nicht rechtens.
Die Klagepunkte betreffen sowohl die Inhalte des Rechtsaktes der Kommission als auch den gesetzgeberischen Prozess. Ein Argument lautet, der Rechtsakt widerspreche der Taxonomie-Verordnung selbst: Die darin enthaltene Liste mit Wirtschaftsaktivitäten habe sich im Energiebereich auf Erneuerbare Energien beschränkt und Atomkraft- und Erdgasaktivitäten bewusst ausgeschlossen, erklärte Simone Lünenbürger, Rechtsanwältin der beauftragten Kanzlei, auf der Pressekonferenz.
Als sogenannte Übergangstechnologien wiederum seien lediglich Aktivitäten genannt worden, für die es keine bessere Alternative gebe. Dies treffe auf keine der beiden Technologien zu. Für Atomkraft stehe zudem der Verdacht im Raum, sie sei als Dauerlösung für Europa gedacht und solle mittels der Taxonomie mit langfristigen Investitionen gesichert werden. Hier verstoße der Rechtsakt gegen das Vorsorge-Prinzip, das künftige Generationen einbeziehe und auch in der Taxonomie-Verordnung verankert sei.
Laut der EU-Taxonomie gelten Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig, wenn sie in einem der sechs Umweltziele einen wesentlichen Beitrag leisten und keines der anderen Ziele erheblich beeinträchtigen. “Mit dem von Österreich angegriffenen Rechtsakt hat die Kommission festgestellt, dass Kernenergie und fossiles Gas unter bestimmten Bedingungen das Klima schützen, jedenfalls als sogenannte Übergangstechnologien, und zugleich sichergestellt ist, dass sie keine der anderen Umweltziele erheblich beeinträchtigen”, erklärte Lünenbürger.
“Diese Feststellung halten wir für unionsrechtswidrig.” Laut der Anwältin könne und müsse man für die Kernkraft im Hinblick auf mögliche Unfälle und auf die Frage der Endlager eine erhebliche Beeinträchtigung von Zielen wie der Abfallvermeidung und des Schutzes von Biodiversität, Meeren und Ökosystemen feststellen.
Weiter liegen die laut dem Rechtsakt zugelassenen Emissionswerte für Erdgasaktivitäten weit oberhalb der Grenzwerte, die die Experten der EU-Kommission für noch mit den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens und dem Klimagesetz der EU vereinbar halten.
Die Einreichung der Klage hat keine aufschiebende Wirkung, sodass der Rechtsakt laut Plan zum 1. Januar 2023 in Kraft treten wird. Eine Entscheidung des Gerichts und in zweiter Instanz auch der Europäischen Gerichtshofs könnte zu einer Änderung der Rechtslage führen. Dies ist das Ziel der österreichischen Klage. Das Verfahren werde “aufgrund seiner rechtlichen und fachlichen Komplexität” vermutlich länger dauern als durchschnittliche EU-Rechtsverfahren, sagte Lünenbürger. Sie schätzt die Dauer auf etwa zwei Jahre.
Die Taxonomie-Verordnung halte sie für ein wesentliches Instrument, das Greenwashing verhindere und zum Erreichen der EU-Klimaziele beitrage, stellte Gewessler klar. Die österreichische Regierung unterstütze die Verordnung. Mit der Klage wolle sie den Versuch verhindern, “über eine Hintertür Atomkraft und Gas grünzuwaschen”. In Österreich bestehe zudem ein breiter Konsens in dieser Frage. Die Beschlüsse im Nationalrat seien einstimmig gefasst worden, die Klage werde unabhängig von Wahlen fortgeführt, sagte Gewessler.
Luxemburg wird sich mit weiteren Argumenten der Klage anschließen. Mit mehreren anderen EU-Mitgliedstaaten sei Österreich weiterhin im Gespräch, so Gewessler. Auch mehrere Umweltorganisationen wie Greenpeace haben Rechtsklagen angekündigt. leo
Deutschland und Frankreich wollen beim bilateralen Ministerrat am 26. Oktober über einen gemeinsamen Vorstoß zur Reform der EU verhandeln. Bei dem hochrangigen Treffen in Rouen müssten die beiden Regierungen sagen, “ob sie den Mut haben, gemeinsam Europa einen Schritt nach vorne zu bringen”, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold am Montag. Frankreich und Deutschland sollten gemeinsame Vorschläge im Tandem und in enger Koordinierung mit anderen Mitgliedstaaten einbringen.
Es gehe darum, die Leistungsfähigkeit der EU etwa in der Außenpolitik, der Verteidigung, bei Steuerfragen und gemeinsamen fiskalische Kapazitäten zu stärken, sagte der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung der Europäischen Bewegung Deutschland. Giegold plädierte dafür, in diesen Bereichen von der Einstimmigkeit zu Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit (QMV) überzugehen und das Europaparlament zu stärken. Gegen die Abkehr von der Einstimmigkeit wehren sich bislang vor allem kleinere Länder: Sie befürchten, sonst in politisch hochsensiblen Bereichen Einflussmöglichkeiten zu verlieren.
Die Europastaatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann, sagte, viele Mitgliedstaaten hätten Angst, dass dadurch die “Philosophie des Konsenses” verloren gehe. Daher gelte es, in Gesprächen mit den Regierungen zunächst Vertrauen zu schaffen. Eine Gruppe von Ländern unterstütze eine Reform und arbeite bereits an Vorschlägen, die die Einwände berücksichtigen sollten.
Diskutiert werde etwa ein freiwilliger Veto-Verzicht williger Staaten, höhere Zustimmungshürden als beim QMV oder das Festhalten am Vetorecht in festgelegten, besonders heiklen Politbereichen. Ziel der tschechischen Ratspräsidentschaft sei, bis Jahresende die Umrisse eines möglichen Kompromisses zu identifizieren. tho
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Berliner Kanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs sollten nach Angaben von deutscher Seite die Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Orbán bezeichnete das Gespräch am Abend als “furchtbar”. “Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er (Scholz) noch lebt. Ich ebenfalls”, sagte er nach dem Treffen, das nach seinen Angaben zwei Stunden dauerte. Beide Seiten könnten zufrieden mit dem Treffen sein. Es seien alle schwierigen Themen angesprochen worden. Einzelheiten nannte Orbán aber nicht.
Der rechtsnationale ungarische Regierungschef wettert seit Monaten gegen die Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat. Trotzdem stimmte sein Land bisher immer für die Strafmaßnahmen, die einstimmig beschlossen werden müssen. Vor wenigen Tagen hatte Orbán eine Volksbefragung in Ungarn zu den Sanktionen angekündigt.
Eine Pressekonferenz mit Scholz war ungewöhnlicherweise nicht geplant. Bei Besuchen von Regierungschefs aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist das eigentlich die Regel. Es gibt aber Ausnahmen.
Vom Kanzleramt gab es keine Mitteilung zu dem Gespräch. Orbán äußerte sich bei einem Wirtschaftsforum des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Bereits am Sonntag hatte er die frühere Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und den früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und jetzigen CDU-Außenpolitiker im Bundestag, Armin Laschet, getroffen. dpa
Der Handelsausschuss des Europaparlaments hat seinen Entwurf für ein Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang mit großer Mehrheit durchgewunken. Damit hat das sogenannte Anti-Coercion-Instrument, das vor allem gegen China zum Einsatz kommen könnte, am Montag eine wichtige Hürde genommen. Die Abgeordneten des Ausschusses stimmten zudem für eine sofortige Aufnahme von Trilog-Gesprächen mit der EU-Kommission und dem Rat der Mitgliedsländer, um das Handelsinstrument schneller voranzubringen. Eine Abstimmung im Europaparlament entfällt damit.
Die EU-Abgeordneten wollen den Kommissionsvorschlag an einigen Stellen verschärfen: Schon die Androhung von Zwangsmaßnahmen durch Drittstaaten soll nach dem Willen der EU-Abgeordneten ausreichen, damit die EU-Kommission tätig werden kann. Außerdem fordern die EU-Parlamentarier weiterreichende Maßnahmen, um den entstandenen Schaden in einem EU-Land zu kompensieren. Wehren können soll sich die EU gegen aggressiv auftretende Ländern mit höheren Zöllen oder indem deren Unternehmen von öffentlichen Aufträgen in der EU ausgeschlossen werden.
“Wenn Drittstaaten versuchen, durch gezielte Handelsrestriktionen Einfluss auf politische Entscheidungen von Mitgliedstaaten zu nehmen, darf die EU nicht am kürzeren Hebel sitzen”, sagte CDU-Europapolitiker Daniel Caspary. “Auf Handelsblockaden, wie China sie wegen der Eröffnung der Vertretung Taiwans gegen Litauen verhängt hat, kann die EU in Zukunft robust reagieren und Gegenmaßnahmen verhängen.” Eine Einigung des Europaparlaments, der EU-Kommission und des EU-Rats in der Sache wird noch für dieses Jahr erwartet. ari
Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich gestern zum ersten Mal über seine Stellungnahme zum EU-Lieferkettengesetz ausgetauscht. Der Berichterstatter Tiemo Wölken (S&D) stellte erste Punkte für die Stellungnahme vor, die vor allem Klima- und Umweltschutzverpflichtungen für Unternehmen umfassen. Federführend ist der Rechtsausschuss, während mehrere andere Ausschüsse wie der ENVI-Ausschuss mitberatend sind.
In den Klima- und Umwelt-Fragen müsse der Kommissionsvorschlag noch deutlich nachgebessert werden, erklärte Wölken. Insbesondere fehle es an verbindlichen Emissionszielen für Unternehmen in ihren Lieferketten. Er schlägt deshalb eine Pflicht für Unternehmen vor, konkrete Klimapläne anhand wirtschaftlicher Kriterien vorzulegen. “Dazu gehören auch Etappenziele für die Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes entlang der Lieferkette ab 2030 in 5-Jahres-Schritten bis 2050 im Sinne des europäischen Klimagesetzes.” Mit starken Klimaregelungen im Sorgfaltspflichtengesetz könne man aus Europa heraus auch global den Kampf gegen den Klimawandel beschleunigen.
Auch die im Kommissionsentwurf enthaltene Liste der von den Unternehmen einzuhaltenden internationalen Umweltkonventionen sei bruchstückhaft und vage, viele der möglichen negativen Umwelteinflüsse seien nicht erwähnt. Wölken schlägt vor, die Definition dieser Einflüsse anzupassen und eine konkrete Liste mit Umweltvergehen zu erstellen, die etwa die Beeinträchtigung von Wasser- und Luftqualität, die Erosion der Biodiversität und die Gefährdung der menschlichen Gesundheit einschließen.
Die Einbeziehung von kleinen und mittelständischen Unternehmen ist auch im Umweltausschuss weiterhin ein Streitpunkt, wie die Stellungnahmen der Schattenberichterstatterinnen zeigte. Wölken schlägt ihre Einbeziehung durch eine Ausweitung des Anwendungsbereiches und einen risikobasierten Ansatz für die Sorgfaltspflichten vor. Unternehmen solle es möglich sein, Priorisierungen nach klaren Kriterien wie der Größe ihres Einflussvermögens, der Höhe ihres Risikos und dem Verursachungsbeitrag vorzunehmen. Ein Abwälzen der Pflichten auf Vertragspartner solle nicht länger möglich sein. Dadurch würden auch kleinere Unternehmen weniger von den Anforderungen überfordert.
Wölken lobt den Vorschlag in Bezug auf die Einführung eines zivilrechtlichen Handlungsregimes für Unternehmen bei Missachtung der Sorgfaltspflichten. Dies sei ein echter Erfolg, jedoch reiche dies nicht aus. “Wir brauchen die Beweislastumkehr, in der Unternehmen belegen müssen, dass sie ihre Pflichten auch erfüllt haben”, sagte er. “Betroffenen diese Pflicht aufzuerlegen ist nicht verantwortlich.”
Darüber hinaus will Wölken den Kommissionsentwurf im Hinblick auf die Verantwortung der Unternehmensleitung nachschärfen und damit den Anspruch des Initiativberichtes des Parlaments erfüllen.
Bis zum 17. Oktober können Änderungsanträge für die Stellungnahme eingereicht werden. Die Abstimmung findet im Februar statt. leo
Beim zweiten ETS-Trilog konnten laut den Parlamentsberichterstattern Michael Bloss (Greens/EFA) und Peter Liese (EVP) nur kleine Fortschritte gemacht werden. Nach vierstündigen Verhandlungen am Montagmorgen sei man nicht in der Lage gewesen, sich “auf irgendetwas zu einigen”, sagte Bloss und kritisierte insbesondere die tschechische Ratspräsidentschaft.
Er sei sehr enttäuscht, da die Mitgliedstaaten den Verhandlern kein Mandat erteilt hätten, irgendwelche offenen Punkte zu finalisieren, so Bloss. Er fürchte, dass die Tschechen den Trilog absichtlich verschleppen und der kommenden Ratspräsidentschaft aus Schweden überlassen wollen. Auch die Kommission würde zu wenig Druck ausüben, kritisierte der Schattenberichterstatter der Grünen.
Sein Counterpart von der CDU, Peter Liese, präsentierte zwar ebenfalls nur minimale Fortschritte, zeigte jedoch Verständnis für die tschechische Ratspräsidentschaft. Deren Verhandler hätten ein mächtiges Programm mit den Trilogen zum Fit-for-55-Paket vor der Brust. Sie hätten die Priorität auf die Effort Sharing Regulation, LULUCF und die CO2-Flottenstandards für Pkw gelegt und wollen diese bis zur COP27 fertigstellen, um dort etwas präsentieren zu können, erklärte er. ETS und CBAM sollten dagegen bis Weihnachten fertiggestellt werden.
Über die großen Themen des Ambitionsniveaus, ETS 2 und Freizuteilungen für die Industrie sei zwar gesprochen worden, bestätigten sowohl Bloss als auch Liese. Einigungen gab es jedoch nicht. Ohnehin glaube er nicht, dass diese Themen vor dem allerletzten Trilog gelöst werden können, sagte Liese.
Vom Tisch seien dagegen die Vorschläge der Kommission, die Benchmarks für die Stahlindustrie anzuheben. Diese hätten dafür gesorgt, dass noch mehr Stahlindustrieanlagen, welche die Benchmarks nicht erfüllen, zusätzlich zum linearen Reduktionsfaktor kostenlose Emissionszertifikate verlieren. Laut Liese bleiben die Benchmarks nun jedoch, wie sie sind. Zudem soll auch die Strompreiskompensation für indirekte Emissionen bestehen bleiben, berichtete Liese. Dies sei wichtig, um weitere Preisschocks im Zuge der Energiekrise zu vermeiden.
Die nächste Trilogrunde ist für den 10. November vorgesehen. Bis dahin werden weiterhin sogenannte technische Verhandlungen zu Detailfragen stattfinden. luk
Die EU-Kommission legt ihren Vorschlag für CO2-Flottenziele bei Lastwagen nicht wie geplant am 30. November vor. Der Punkt wurde von der Liste der vorgesehenen Punkte auf der Agenda der künftigen Kommissionssitzungen gestrichen. Nun wird damit gerechnet, dass der Vorschlag in den ersten Monaten 2023 kommt. Die Kommission hat noch kein neues Datum genannt.
Der Vorschlag wird eine weitere Minderung des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes von neuen Lastwagen jedes Herstellers anregen. Hersteller, die die Flottenziele nicht einhalten, müssen mit Strafen rechnen. Es wird damit gerechnet, dass die Kommission auch dem Verbrenner bei Nutzfahrzeugen ein Enddatum setzt. Es könnte bei 2040 liegen. Auch bei Lastwagen stellt sich die Frage, ob die Kommission die Anrechnung von CO2-neutral hergestellten synthetischen Kraftstoffen im Rahmen der C02-Flottengrenzwerte zulässt. Beobachter rechnen nicht damit. mgr

Viel Zeit hat Sigrid “Sigi” Maurer heute nicht fürs Gespräch. Auf der Tagesordnung stehen Telefonat um Telefonat zum Unfall bei der OMV im Sommer (war es doch Sabotage?), Verhandlungen mit dem Koalitionspartner ÖVP über die steigenden Energiepreise, abends eine Parteisitzung und der Tag der Industrie. Als Fraktionsvorsitzende des Grünen Parlamentsklubs im österreichischen Nationalrat hat Maurer viel zu organisieren, koordinieren und zu verhandeln.
Ob die Unruhe beim Koalitionspartner ÖVP da die Arbeit erschwert – immerhin gab es dort seit der Regierungsbildung im Januar 2020 acht Wechsel auf Minister- bzw. Kanzlerposten? “Für ihre Personalpolitik ist die ÖVP selbst verantwortlich. Es ist natürlich schwierig, wenn das Gegenüber nicht ganz stabil ist, aber das hat sich ja inzwischen beruhigt”, sagt Maurer und lässt sich, wie bei allem, nicht zu sehr in die Karten schauen.
Überhaupt ist Maurer rhetorisch ganz die Politikerin mit der Gabe, Fragen unbeantwortet zu lassen, dabei das Thema aber auf das – in ihren Augen – Wesentliche zu lenken. Provozieren lässt sie sich auch bei kritischen Fragen zum aktuellen Tiefflug der Umfragewerte der Regierung nicht, sondern gibt sich “in der Defensive erstaunlich aggressiv“, wie das österreichische Nachrichtenmagazin Profil schreibt.
Selbst provozieren kann sie aber auch: Als sie 2017 nach einer Talkshow zum Thema sexueller Belästigung viele Hassnachrichten bekommt, postet sie ein Foto auf Instagram, die Mittelfinger erhoben, mit den Worten “to the haters with love”. 2010, recht zu Beginn ihrer politischen Laufbahn, wirft sie von der Besuchergalerie Flugblätter in den Plenarsaal des Nationalrates und wird rausgeworfen. 18 Monate Hausverbot für Maurer.
Zur Politik kommt die 37-jährige Tirolerin während ihres Studiums der Musikwissenschaften und Politikwissenschaften. Als der Studiengang Musikwissenschaften abgeschafft werden sollte, beginnt sie sich in der Österreichischen Hochschülerschaft zu engagieren. Von 2009 bis 2011 ist sie deren Vorsitzende und unterstützt die Studierendenproteste 2009/2010. Eine gute Vorbereitung auf die Bundespolitik: 2013, noch während ihres zweiten Studiums der Soziologie, zieht sie als Grünen-Abgeordnete in den Nationalrat ein, mit 28 Jahren.
Seit der Wahl 2019 bilden die Grünen zusammen mit der ÖVP eine türkis-grüne Koalition. Maurer erbt Anfang 2020 den Fraktionsvorsitz von Werner Kogler, als dieser Vizekanzler wird. Seither herrscht mit der Pandemie und russischem Angriffskrieg Dauerkrisen-Zustand. Das quittiert Maurer aber nur mit einem trockenen: “Man muss die Krisen so nehmen, wie sie kommen und sie als Chance verstehen.”
Insbesondere in der Frage der Energiekrise sei das, was die Grünen seit Jahrzehnten predigten, jetzt Staatsräson. “Es haben jetzt sogar die Konservativsten der Konservativen verstanden, dass wir die Energiewende brauchen und dass die Klimakrise nicht mehr weggeht.”
Trotzdem müssten auch die Grünen, genau wie in Deutschland, derzeit Entscheidungen treffen, die man von ihnen nie erwartet hätte. Darunter falle zum Beispiel die Umrüstung bestimmter Kraftwerke auf fossile Brennstoffe, um für den Notfall gerüstet zu sein. “Gleichzeitig zu diesen Notfallmaßnahmen ist es jetzt aber wichtig, weiter unabhängig zu werden, nicht nur von russischem Gas, sondern von Gas insgesamt und auf erneuerbare Energien zu setzen”, sagt Maurer. Ein Schritt dahin sei das Verbot von Gasheizungen in Neubauten ab Januar 2023.
Ganz besonders am Herzen liegt der Vielpendlerin die Umsetzung des Klimatickets, einem Ticket für den gesamten regionalen und bundesweiten öffentlichen Nahverkehr. “Das Ticket steht seit Jahrzehnten in verschiedenen Parteiprogrammen, jetzt wurde es endlich umgesetzt”, freut sie sich. Lisa-Martina Klein
morgen kommen die Energieminister der EU in Prag zu einem informellen Treffen zusammen. Die Mitgliedstaaten müssen schnell auf einen Nenner kommen – beim gemeinsamen Gaseinkauf, bei der Einsparverpflichtung, bei der Deckelung des Gaspreises und nicht zuletzt bei der Entkopplung der Strom- und Gaspreise. Bei einigen dieser Agendapunkte scheint sich ein Konsens anzubahnen. Das Thema der Finanzierung allerdings dürfte noch für viel Diskussionsstoff sorgen, schreiben Claire Stam, Manuel Berkel und Till Hoppe.
Die Energiekrise macht auch der Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Nicht unbedingt nur aufgrund hoher Energiepreise, sondern weil ein Kreislauf in sich geschlossen sein muss, um zu funktionieren. Unterbrechungen drohen aber derzeit in der Papierindustrie. Die Nachfrage nach gewissen Papiersorten ist eingebrochen, die Papierproduktion stockt mancherorts. Welche neuen Probleme das mit sich bringt, erklärt meine Kollegin Leonie Düngefeld.
Angekündigt hatten es mehrere, getan bisher nur eine: Die österreichische Regierung hat gegen die Entscheidung der EU-Kommission, Erdgas und Atomkraft in die “grüne” Taxonomie aufzunehmen, Klage beim Gericht der Europäischen Union eingereicht, wie Leonore Gewessler (Grüne) gestern bekanntgab.
Gewesslers Kollegin und Fraktionschefin der Grünen in Österreich, Sigrid Maurer, porträtieren wir im heutigen Europe.Table. Die 37-jährige Tirolerin hat die Klimakrise fest im Blick und sieht die aktuellen Herausforderungen als Chance für den nötigen Wandel.
Ich wünsche eine spannende Lektüre!

“Es handelt sich um einen informellen Rat, was bedeutet, dass über rechtliche Aspekte nicht verhandelt werden kann”, erklärt ein Diplomat. Die Diskussionen werden deshalb am 20. und 21. Oktober auf einem formellen EU-Gipfel fortgesetzt, gefolgt von einer ersten Gesprächsrunde unter den Ministern beim Energierat am 25. Oktober. Verabschiedet werden soll der Gesetzesvorschlag auf einem außerordentlichen Energierat im November – dem vierten außerordentlichen Rat seit Beginn der tschechischen Ratspräsidentschaft am 1. Juli.
Unter den Mitgliedstaaten zeichnet sich ein Konsens über die Frage des gemeinsamen Gaseinkaufs ab. Dies bedeutet eine Kehrtwende, nachdem die im Sommer eingerichtete Energieplattform lange keine echte politische Unterstützung von den Mitgliedstaaten erhalten hatte. “Die Mitgliedstaaten wollen jetzt schneller vorankommen und erwarten von Kommissarin Kadri Simson, dass sie einen detaillierten Plan zu diesem Thema vorlegt”, bestätigte der Diplomat und erklärte, dass die Details beim nächsten Energierat am 25. Oktober diskutiert werden.
In Berlin wies Sven Giegold, grüner Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, gestern auf einer Veranstaltung der Europäischen Bewegung Deutschland die Kritik aus einer Reihe von Mitgliedstaaten zurück, dass die Bundesrepublik gegen den gemeinsamen Gaseinkauf sei. “Europa als Ganzes wird diese hohen Gaspreise ökonomisch weder auf staatlicher Ebene noch auf privater Ebene aushalten”, stellte er fest. “Deshalb müssen wir die europäische Einkaufsmacht bündeln und nutzen. Die Bundesregierung lehnt es nicht ab, gemeinsam einzukaufen”.
Letztendlich waren es die Partner der EU-Gaslieferanten, wie die LNG-Exporteure USA und Katar, aber auch Norwegen, die zur Belebung der Debatte beitrugen, indem sie betonten, dass sie lieber mit einem EU-Vertreter verhandeln würden, als separat mit einzelnen Mitgliedstaaten zu sprechen. “Dieser Aspekt hat dazu beigetragen, die Diskussion über die Einrichtung einer solchen Plattform unter den EU-Ländern voranzutreiben”, berichtet der Diplomat.
Außerdem wird den Mitgliedstaaten immer klarer, dass ein gemeinsamer Einkauf zu einem günstigeren Gaspreis führt, fügt er hinzu. Oder wie Giegold das Ziel formulierte: damit “wir mit unseren Freunden und denen, die es vielleicht noch werden, klar über die Gaspreiskonditionen verhandeln. Und uns eben nicht mehr gegenseitig national ausspielen lassen”.
Überraschend sprach sich Giegold gestern auch dafür aus, die europäischen Einsparverpflichtungen zu stärken. Im Sommer hatten die Mitgliedstaaten beschlossen, den Gasverbrauch von August bis März um 15 Prozent zu senken. Verpflichtend werden soll das Ziel allerdings nur durch einen erneuten Beschluss des Rates. “Dabei ist Deutschland bereit, einen seiner Leistungsfähigkeit angemessenen höheren Anteil zu übernehmen”, sagte der Staatssekretär. Deutschland würde damit den EU-Partnern entgegenkommen, denn viele machen die Bundesrepublik mit ihrer hohen Abhängigkeit von einst günstigem russischen Gas für die aktuelle Misere verantwortlich.
Die EU brauche außerdem eine Stärkung der Speicherpflichten, sagte Giegold. Im kommenden Jahr müsse früher mit der Befüllung der Speicher begonnen werden. Gestern mahnte die von der Bundesregierung eingesetzte Gaskommission, dass die Herausforderungen im Winter 2023/24 wahrscheinlich noch größer werden als in diesem. Erst vor wenigen Wochen hatte die Bundesregierung nach Brüssel gemeldet, dass die deutschen Gasspeicher 2023 wahrscheinlich leerer sein werden als in diesem Jahr.
In ihren Bemühungen, die Gaspreise zu senken, fordert eine Mehrheit der Mitgliedstaaten außerdem, dass die Strompreise von den Gaspreisen abgekoppelt werden. “Die Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis und die Einrichtung einer Plattform für den gemeinsamen Einkauf von Gas sind zwei Maßnahmen, die für die Mitgliedstaaten den Vorteil haben, dass sie schnell umgesetzt werden können”, behauptet der Diplomat weiter – wobei Politiker aus der Ampelkoalition weiter skeptisch sind, ob die Einkaufsplattform schnell an den Start gehen kann.
Für den Diplomaten muss es aber erstmal spezifischer werden. “Die Mitgliedstaaten müssen sich zunächst auf eine gemeinsame Definition dessen einigen, was eine Gaspreisobergrenze ist. Alle Mitgliedstaaten sprechen von Gaspreisobergrenzen, meinen aber nicht unbedingt das Gleiche”, sagte er.
Die Europäische Kommission hat ihrerseits in einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der EU eine vorübergehende Begrenzung der Gaspreise im Großhandel in Betracht gezogen, um die Energiekrise zu bewältigen. “Diese Obergrenze sollte auf einem Niveau festgelegt werden, das die Gasversorgung Europas weiterhin sicherstellt, aber auch zeigt, dass die EU nicht bereit ist, jeden Preis für Gas zu zahlen”, schrieb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die EU-Staats- und Regierungschefs vor ihrem informellen Gipfel am Freitag.
Eine solche Obergrenze müsste mit anderen Maßnahmen einhergehen, einschließlich EU-weiter Auktionen zur weiteren Senkung der Nachfrage und verbindlicher Vereinbarungen zwischen den EU-Ländern zur gegenseitigen Unterstützung. Die Kommission argumentiert außerdem, dass der europäische Leitindex TTF zu eng an Pipeline-Gasimporte gekoppelt und daher nicht repräsentativ für einen Markt mit wachsendem LNG-Importanteil ist.
In Berlin unterstützt man die Idee, einen neuen Leitindex einzuführen. “Wir brauchen auch einen alternativen Benchmark für die Langfristverträge, damit diese sich von den hohen Spotmarktpreisen ein Stück weit lösen können”, sagte Giegold gestern.
Es bleibt die Frage der Finanzierung dieser Maßnahmen. “Dies ist ein Punkt, den die Mitgliedstaaten diskutieren müssen”, berichtet der Diplomat. Einige Mitgliedstaaten sagen, dass sie selbst zahlen können, während andere sagen, dass es sinnvoll wäre, die Covid-Fonds zu nutzen. “Im Moment gibt es keinen Konsens, beide Seiten diskutieren noch”, sagt der Diplomat. Immerhin wird die Finanzfrage auch auf der Tagesordnung des Ministertreffens stehen, mit einer Rede des Vizepräsidenten der EIB, Thomas Östros. mit Till Hoppe und Manuel Berkel
Auf allen Ebenen soll gerade die Kreislaufwirtschaft vorangebracht werden: Die EU-Kommission stellt Ende November ihr zweites Gesetzespaket vor und das Bundesumweltministerium arbeitet an Eckpunkten für eine deutsche Strategie. Dass ein funktionierender Produktkreislauf von mehr als Ökodesign und Produktlabels abhängt, wird zurzeit durch die Energiekrise deutlich: vor allem nämlich von einer funktionierenden Industrie. Für den Bereich des Altpapiers sprechen Verbände der Entsorgungsindustrie bereits von einer Bedrohung der Kreislaufwirtschaft. Gleiches könnte bald auch für Glas und Leichtverpackungen eintreten.
Was die direkten Auswirkungen betrifft, gehört die Kreislaufwirtschaft zu den weniger betroffenen Branchen, erklärt Peter Kurth, der Präsident des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Sowohl in der Logistik als auch in den Anlagen sei es gelungen, den Erdgasbedarf teilweise durch andere Energieträger zu substituieren. Recycling-Verfahren sind zudem in der Regel weniger energieintensiv als die Produktion von Primärrohstoffen.
Die Kreislaufwirtschaft sei vor allem indirekt von der Energiekrise betroffen, denn sie bedingt, dass Sekundärrohstoffe zurück in die Industrie gelangen. “Wenn wir Materialien getrennt sammeln, müssen wir diese auch in der Industrie oder bei anderen Anlagen platzieren können.” Eine getrennte Papiersammlung etwa setze voraus, dass es eine Papierindustrie gibt, die das recycelte Papier abnimmt. Ansonsten sei die getrennte Sammlung von Papierabfällen überflüssig. “Ein Kreislauf muss in sich geschlossen sein”, sagt Kurth. “Wenn eine Stelle herausbricht, funktioniert er nicht mehr.”
Neben den hohen Kosten sorgt derzeit auch ein Einbruch in der Nachfrage einiger Papiersorten dafür, dass europäische Papierwerke die Produktion unterbrechen und Kurzarbeit anmelden. In Deutschland beantragte etwa der Hygienepapierhersteller Hakle Anfang September ein Insolvenzverfahren. Weitere Werke in Deutschland, Österreich und Italien drosselten, unterbrachen oder beendeten die Produktion.
Die Papierproduktion ist besonders energieintensiv, da das Zellmaterial erhitzt und getrocknet werden muss. Der gesamte Sektor, insbesondere die Produktion von Hygienepapier, ist stark von Erdgas als Brennstoff abhängig – in Deutschland zu 58 Prozent. Gleichzeitig ist es den Fabriken derzeit kaum möglich, den Gasbezug zu substituieren. Laut einer Umfrage des Verbands Die Papierindustrie blieben im Falle einer Unterbrechung der Gasversorgung lediglich zehn bis zwölf Prozent der Papiererzeugung in Deutschland übrig.
Dabei ist der Produktzyklus von Papier ein Vorbild der Kreislaufwirtschaft: Die Recyclingrate von Papier in Europa (EU, Norwegen, Schweiz und Großbritannien) beträgt über 70 Prozent. In Deutschland, dem größten Papierproduzenten der EU, lag sie 2020 bei 79 Prozent. Hier werden täglich 50.000 Tonnen Altpapier zur Herstellung von Verpackungen und neuem Papier eingesetzt.
Zuletzt sind die Preise für Altpapier enorm gesunken. “Wir rechnen damit, dass die jetzt schon bestehenden Schwierigkeiten, Altpapier gegen einen Preis abzusetzen, in den nächsten Wochen ein zentrales Problem werden”, sagt Kurth.
Dies hätte weitreichende Folgen: “Eine Unterbrechung des Papierrecyclings würde sich insbesondere auf Transportverpackungen auswirken, was eine ernste Gefahr für den EU-Binnenmarkt bedeutet, und sie würde erhebliche Folgen für die Lebensmittellogistik haben”, erklärt Jori Ringman, Geschäftsführer des europäischen Verbands der Papierindustrie, Cepi.
Als Übergangslösung wollen die Verbände das Altpapier zwischenlagern. In einem Schreiben an die deutsche Umweltministerkonferenz forderte der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE), Genehmigungsverfahren für Zwischenlager zu vereinfachen. Komme die Abnahme von Sekundärrohstoffen zu einem Stillstand, sei “ein immenser Platz- und Finanzierungsbedarf für Zwischenlager” zu erwarten, heißt es in dem Schreiben. Unter der Lagerung leidet zwar die Qualität des Papiers und die Brandgefahr steigt mit der gelagerten Menge. Ansonsten muss das Altpapier jedoch absichtlich verbrannt werden – auf Müllverbrennungsanlagen.
Hier besteht zurzeit ein weiteres Problem für die Entsorgungsindustrie: Versorgungsengpässe bei Erdgas schränken auch die Produktion von Ammoniak ein. Dieses wird in Müllverbrennungsanlagen zur Rauchgasreinigung eingesetzt. In den Filteranlagen reagiert es mit giftigen Stickoxiden zu ungefährlichem Stickstoff und Wasser. In Deutschland gibt es nur wenige Produzenten, aus dem Ausland ist der Zusatzstoff auch nicht beliebig verfügbar.
Bricht die Ammoniakproduktion weiter ein, droht die Wahl zwischen Pest und Cholera, erklärt Peter Kurth: Entweder müssen die Verbrennungsanlagen stillstehen, was irgendwann zum Entsorgungsnotstand führen würde – oder sie laufen weiter und blasen giftige Stickoxide in die Luft. Ein Stillstand hätte zudem Auswirkungen auf die Fernwärmeleistung: Die Verbrennungsanlagen liefern in städtischen Ballungszentren bis zu 20 Prozent der Fernwärme.
Bislang handelt es sich lediglich um Warnungen. Ob sich der Dominoeffekt der Energiekrise für die Abfall- und Kreislaufwirtschaft durch den sogenannten Abwehrschirm der Bundesregierung abmildern lässt, ist abzuwarten.
12.10.-14.10.2022, Herrenhausen
VWS, Conference AI and the Future of Societies
The Volkswagen Stiftung (VWS) discusses how all parts of society can participate in the benefits of AI. INFOS & REGISTRATION
12.10.-13.10.2022, Berlin/online
HBS, Podiumsdiskussion Ukraine im Krieg: Deutsch-Ukrainische Beziehungen auf dem Prüfstand
Die Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert die Frage, wie eine glaubwürdige Zeitenwende politisch gestaltet werden kann. INFOS & ANMELDUNG
12.10.2022 – 08:30-16:00 Uhr, Erlangen/online
Frauenhofer-Institut, Konferenz Team-X: Tagung mit Health-X and Gaia-X – Die Gesundheitsversorgung der Zukunft
Das Frauenhofer-Institut beleuchtet den Weg hin zu mehr Datensouveränität. INFOS & ANMELDUNG
12.10.2022 – 10:00-15:00 Uhr, Berlin
Initiative D21, Konferenz GovTalk 2022 – Das Netzwerkevent zum Digitalen Staat
Die Initiative D21 thematisiert die Fortschritte und Herausforderungen des digitalen Staats. INFOS & ANMELDUNG
12.10.2022 – 18:00-22:00 Uhr, Brüssel (Belgien)
Bayerische Landesvertretung bei der EU, Diskussion Welche aktuellen Herausforderungen stellen sich den regionalen Betrieben in Europa?
Die Bayerische Landesvertretung bei der EU beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Energie-, Umwelt-, Steuer-, Industrie-, Arbeitsmarkt- und Handelspolitik der EU auf Betriebe in Europa. INFOS & ANMELDUNG
13.10.-14.10.2022, Brüssel (Belgien)
CRE, Conference An Industry for the European Circular Economy
Chemical Recycling Europe (CRE) addresses the latest topics around the chemical recycling industry and its role in the European Circular Economy. INFOS & REGISTRATION
13.10.2022 – 09:00-17:30 Uhr, online
EIT, Conference Innovation Factory 2022 Brokerage Event
The European Institute of Innovation & Technology (EIT) supports the next generation of digital companies that can impact Europe and the world’s challenges. INFOS & REGISTRATION
13.10.2022 – 14:00-16:15 Uhr, online
Eurogas, Conference European Gas Tech: Delivering On 2050
Eurogas discusses how innovative renewable and decarbonised gas technologies are contributing to the decarbonisation of Europe. INFOS & REGISTRATION
13.10.2022 – 18:00-20:00 Uhr, Leipzig
FES, Podiumsdiskussion Tax-Talks: Klima und Wirtschaft – Die Lenkungswirkung von Steuern für eine klimagerechte Wirtschaftspolitik
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) beschäftigt sich mit der Frage, wie Steuern unsere Gesellschaft gerechter machen können. INFOS & ANMELDUNG
In der Bundesregierung wird weiter über die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplante Einsatzreserve der beiden Atomkraftwerke Isar II und Neckarwestheim gestritten. Entgegen Habecks Plänen und einer Vereinbarung in der Koalition gab die Bundesregierung am Montag noch kein grünes Licht für den Gesetzentwurf, wie eine Ministeriumssprecherin der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Sie begründete dies mit “politischen Unstimmigkeiten”. Das Vorhaben gerät somit offenbar ins Wanken. “Damit ist der enge Zeitplan für das Verfahren nicht zu halten, was den Betreibern heute mitgeteilt wurde”, sagte die Sprecherin. “Diese Verzögerung ist ein Problem, wenn man will, dass Isar 2 im Jahr 2023 noch Strom produziert.”
In Koalitionskreisen hieß es ergänzend, die Verzögerung gehe auf Einwände aus dem Bundesfinanzministerium zurück. “Es gab dazu eine klare Verständigung mit den Koalitionspartnern, trotz unterschiedlicher Perspektiven diesen Gesetzentwurf zur Einsatzreserve am heutigen Montag durchs Kabinett zu bringen, so dass er im parlamentarischen Verfahren behandelt werden kann”, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. “Aufgrund politischer Unstimmigkeiten wurde aber von dieser Verständigung abgerückt.”
Die Sprecherin unterstrich, das Ministerium wolle, dass die süddeutschen Atomkraftwerke auch nach dem Jahreswechsel laufen und so bei Bedarf einen Beitrag zur Stabilität im Stromsystem leisten könnten. Dazu seien die notwendigen Vereinbarungen mit den Atomkraftwerksbetreibern getroffen worden. Es müssten aber zeitnah die Reparaturen am Atomkraftwerk Isar II vorgenommen werden, die Atomkraftwerksbetreiber bräuchten Klarheit. Das Ministerium setze sich weiter für Lösungen ein: “Sonst steht man wegen Verzögerungen ohne Isar 2 da.” rtr
Österreich hat seine angekündigte Klage gegen die Entscheidung der EU-Kommission, Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie aufzunehmen, beim Gericht der Europäischen Union eingereicht. Gestern endete die Frist für Klagen gegen den Delegierten Rechtsakt. Die Nichtigkeitsklage enthalte insgesamt 16 Klagepunkte, gab die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestern auf einer Pressekonferenz bekannt. Den Delegierten Rechtsakt bezeichnete sie als verantwortungslos, unvernünftig und nicht rechtens.
Die Klagepunkte betreffen sowohl die Inhalte des Rechtsaktes der Kommission als auch den gesetzgeberischen Prozess. Ein Argument lautet, der Rechtsakt widerspreche der Taxonomie-Verordnung selbst: Die darin enthaltene Liste mit Wirtschaftsaktivitäten habe sich im Energiebereich auf Erneuerbare Energien beschränkt und Atomkraft- und Erdgasaktivitäten bewusst ausgeschlossen, erklärte Simone Lünenbürger, Rechtsanwältin der beauftragten Kanzlei, auf der Pressekonferenz.
Als sogenannte Übergangstechnologien wiederum seien lediglich Aktivitäten genannt worden, für die es keine bessere Alternative gebe. Dies treffe auf keine der beiden Technologien zu. Für Atomkraft stehe zudem der Verdacht im Raum, sie sei als Dauerlösung für Europa gedacht und solle mittels der Taxonomie mit langfristigen Investitionen gesichert werden. Hier verstoße der Rechtsakt gegen das Vorsorge-Prinzip, das künftige Generationen einbeziehe und auch in der Taxonomie-Verordnung verankert sei.
Laut der EU-Taxonomie gelten Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig, wenn sie in einem der sechs Umweltziele einen wesentlichen Beitrag leisten und keines der anderen Ziele erheblich beeinträchtigen. “Mit dem von Österreich angegriffenen Rechtsakt hat die Kommission festgestellt, dass Kernenergie und fossiles Gas unter bestimmten Bedingungen das Klima schützen, jedenfalls als sogenannte Übergangstechnologien, und zugleich sichergestellt ist, dass sie keine der anderen Umweltziele erheblich beeinträchtigen”, erklärte Lünenbürger.
“Diese Feststellung halten wir für unionsrechtswidrig.” Laut der Anwältin könne und müsse man für die Kernkraft im Hinblick auf mögliche Unfälle und auf die Frage der Endlager eine erhebliche Beeinträchtigung von Zielen wie der Abfallvermeidung und des Schutzes von Biodiversität, Meeren und Ökosystemen feststellen.
Weiter liegen die laut dem Rechtsakt zugelassenen Emissionswerte für Erdgasaktivitäten weit oberhalb der Grenzwerte, die die Experten der EU-Kommission für noch mit den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens und dem Klimagesetz der EU vereinbar halten.
Die Einreichung der Klage hat keine aufschiebende Wirkung, sodass der Rechtsakt laut Plan zum 1. Januar 2023 in Kraft treten wird. Eine Entscheidung des Gerichts und in zweiter Instanz auch der Europäischen Gerichtshofs könnte zu einer Änderung der Rechtslage führen. Dies ist das Ziel der österreichischen Klage. Das Verfahren werde “aufgrund seiner rechtlichen und fachlichen Komplexität” vermutlich länger dauern als durchschnittliche EU-Rechtsverfahren, sagte Lünenbürger. Sie schätzt die Dauer auf etwa zwei Jahre.
Die Taxonomie-Verordnung halte sie für ein wesentliches Instrument, das Greenwashing verhindere und zum Erreichen der EU-Klimaziele beitrage, stellte Gewessler klar. Die österreichische Regierung unterstütze die Verordnung. Mit der Klage wolle sie den Versuch verhindern, “über eine Hintertür Atomkraft und Gas grünzuwaschen”. In Österreich bestehe zudem ein breiter Konsens in dieser Frage. Die Beschlüsse im Nationalrat seien einstimmig gefasst worden, die Klage werde unabhängig von Wahlen fortgeführt, sagte Gewessler.
Luxemburg wird sich mit weiteren Argumenten der Klage anschließen. Mit mehreren anderen EU-Mitgliedstaaten sei Österreich weiterhin im Gespräch, so Gewessler. Auch mehrere Umweltorganisationen wie Greenpeace haben Rechtsklagen angekündigt. leo
Deutschland und Frankreich wollen beim bilateralen Ministerrat am 26. Oktober über einen gemeinsamen Vorstoß zur Reform der EU verhandeln. Bei dem hochrangigen Treffen in Rouen müssten die beiden Regierungen sagen, “ob sie den Mut haben, gemeinsam Europa einen Schritt nach vorne zu bringen”, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold am Montag. Frankreich und Deutschland sollten gemeinsame Vorschläge im Tandem und in enger Koordinierung mit anderen Mitgliedstaaten einbringen.
Es gehe darum, die Leistungsfähigkeit der EU etwa in der Außenpolitik, der Verteidigung, bei Steuerfragen und gemeinsamen fiskalische Kapazitäten zu stärken, sagte der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung der Europäischen Bewegung Deutschland. Giegold plädierte dafür, in diesen Bereichen von der Einstimmigkeit zu Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit (QMV) überzugehen und das Europaparlament zu stärken. Gegen die Abkehr von der Einstimmigkeit wehren sich bislang vor allem kleinere Länder: Sie befürchten, sonst in politisch hochsensiblen Bereichen Einflussmöglichkeiten zu verlieren.
Die Europastaatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann, sagte, viele Mitgliedstaaten hätten Angst, dass dadurch die “Philosophie des Konsenses” verloren gehe. Daher gelte es, in Gesprächen mit den Regierungen zunächst Vertrauen zu schaffen. Eine Gruppe von Ländern unterstütze eine Reform und arbeite bereits an Vorschlägen, die die Einwände berücksichtigen sollten.
Diskutiert werde etwa ein freiwilliger Veto-Verzicht williger Staaten, höhere Zustimmungshürden als beim QMV oder das Festhalten am Vetorecht in festgelegten, besonders heiklen Politbereichen. Ziel der tschechischen Ratspräsidentschaft sei, bis Jahresende die Umrisse eines möglichen Kompromisses zu identifizieren. tho
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Berliner Kanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs sollten nach Angaben von deutscher Seite die Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Orbán bezeichnete das Gespräch am Abend als “furchtbar”. “Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er (Scholz) noch lebt. Ich ebenfalls”, sagte er nach dem Treffen, das nach seinen Angaben zwei Stunden dauerte. Beide Seiten könnten zufrieden mit dem Treffen sein. Es seien alle schwierigen Themen angesprochen worden. Einzelheiten nannte Orbán aber nicht.
Der rechtsnationale ungarische Regierungschef wettert seit Monaten gegen die Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat. Trotzdem stimmte sein Land bisher immer für die Strafmaßnahmen, die einstimmig beschlossen werden müssen. Vor wenigen Tagen hatte Orbán eine Volksbefragung in Ungarn zu den Sanktionen angekündigt.
Eine Pressekonferenz mit Scholz war ungewöhnlicherweise nicht geplant. Bei Besuchen von Regierungschefs aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist das eigentlich die Regel. Es gibt aber Ausnahmen.
Vom Kanzleramt gab es keine Mitteilung zu dem Gespräch. Orbán äußerte sich bei einem Wirtschaftsforum des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Bereits am Sonntag hatte er die frühere Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und den früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und jetzigen CDU-Außenpolitiker im Bundestag, Armin Laschet, getroffen. dpa
Der Handelsausschuss des Europaparlaments hat seinen Entwurf für ein Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang mit großer Mehrheit durchgewunken. Damit hat das sogenannte Anti-Coercion-Instrument, das vor allem gegen China zum Einsatz kommen könnte, am Montag eine wichtige Hürde genommen. Die Abgeordneten des Ausschusses stimmten zudem für eine sofortige Aufnahme von Trilog-Gesprächen mit der EU-Kommission und dem Rat der Mitgliedsländer, um das Handelsinstrument schneller voranzubringen. Eine Abstimmung im Europaparlament entfällt damit.
Die EU-Abgeordneten wollen den Kommissionsvorschlag an einigen Stellen verschärfen: Schon die Androhung von Zwangsmaßnahmen durch Drittstaaten soll nach dem Willen der EU-Abgeordneten ausreichen, damit die EU-Kommission tätig werden kann. Außerdem fordern die EU-Parlamentarier weiterreichende Maßnahmen, um den entstandenen Schaden in einem EU-Land zu kompensieren. Wehren können soll sich die EU gegen aggressiv auftretende Ländern mit höheren Zöllen oder indem deren Unternehmen von öffentlichen Aufträgen in der EU ausgeschlossen werden.
“Wenn Drittstaaten versuchen, durch gezielte Handelsrestriktionen Einfluss auf politische Entscheidungen von Mitgliedstaaten zu nehmen, darf die EU nicht am kürzeren Hebel sitzen”, sagte CDU-Europapolitiker Daniel Caspary. “Auf Handelsblockaden, wie China sie wegen der Eröffnung der Vertretung Taiwans gegen Litauen verhängt hat, kann die EU in Zukunft robust reagieren und Gegenmaßnahmen verhängen.” Eine Einigung des Europaparlaments, der EU-Kommission und des EU-Rats in der Sache wird noch für dieses Jahr erwartet. ari
Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich gestern zum ersten Mal über seine Stellungnahme zum EU-Lieferkettengesetz ausgetauscht. Der Berichterstatter Tiemo Wölken (S&D) stellte erste Punkte für die Stellungnahme vor, die vor allem Klima- und Umweltschutzverpflichtungen für Unternehmen umfassen. Federführend ist der Rechtsausschuss, während mehrere andere Ausschüsse wie der ENVI-Ausschuss mitberatend sind.
In den Klima- und Umwelt-Fragen müsse der Kommissionsvorschlag noch deutlich nachgebessert werden, erklärte Wölken. Insbesondere fehle es an verbindlichen Emissionszielen für Unternehmen in ihren Lieferketten. Er schlägt deshalb eine Pflicht für Unternehmen vor, konkrete Klimapläne anhand wirtschaftlicher Kriterien vorzulegen. “Dazu gehören auch Etappenziele für die Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes entlang der Lieferkette ab 2030 in 5-Jahres-Schritten bis 2050 im Sinne des europäischen Klimagesetzes.” Mit starken Klimaregelungen im Sorgfaltspflichtengesetz könne man aus Europa heraus auch global den Kampf gegen den Klimawandel beschleunigen.
Auch die im Kommissionsentwurf enthaltene Liste der von den Unternehmen einzuhaltenden internationalen Umweltkonventionen sei bruchstückhaft und vage, viele der möglichen negativen Umwelteinflüsse seien nicht erwähnt. Wölken schlägt vor, die Definition dieser Einflüsse anzupassen und eine konkrete Liste mit Umweltvergehen zu erstellen, die etwa die Beeinträchtigung von Wasser- und Luftqualität, die Erosion der Biodiversität und die Gefährdung der menschlichen Gesundheit einschließen.
Die Einbeziehung von kleinen und mittelständischen Unternehmen ist auch im Umweltausschuss weiterhin ein Streitpunkt, wie die Stellungnahmen der Schattenberichterstatterinnen zeigte. Wölken schlägt ihre Einbeziehung durch eine Ausweitung des Anwendungsbereiches und einen risikobasierten Ansatz für die Sorgfaltspflichten vor. Unternehmen solle es möglich sein, Priorisierungen nach klaren Kriterien wie der Größe ihres Einflussvermögens, der Höhe ihres Risikos und dem Verursachungsbeitrag vorzunehmen. Ein Abwälzen der Pflichten auf Vertragspartner solle nicht länger möglich sein. Dadurch würden auch kleinere Unternehmen weniger von den Anforderungen überfordert.
Wölken lobt den Vorschlag in Bezug auf die Einführung eines zivilrechtlichen Handlungsregimes für Unternehmen bei Missachtung der Sorgfaltspflichten. Dies sei ein echter Erfolg, jedoch reiche dies nicht aus. “Wir brauchen die Beweislastumkehr, in der Unternehmen belegen müssen, dass sie ihre Pflichten auch erfüllt haben”, sagte er. “Betroffenen diese Pflicht aufzuerlegen ist nicht verantwortlich.”
Darüber hinaus will Wölken den Kommissionsentwurf im Hinblick auf die Verantwortung der Unternehmensleitung nachschärfen und damit den Anspruch des Initiativberichtes des Parlaments erfüllen.
Bis zum 17. Oktober können Änderungsanträge für die Stellungnahme eingereicht werden. Die Abstimmung findet im Februar statt. leo
Beim zweiten ETS-Trilog konnten laut den Parlamentsberichterstattern Michael Bloss (Greens/EFA) und Peter Liese (EVP) nur kleine Fortschritte gemacht werden. Nach vierstündigen Verhandlungen am Montagmorgen sei man nicht in der Lage gewesen, sich “auf irgendetwas zu einigen”, sagte Bloss und kritisierte insbesondere die tschechische Ratspräsidentschaft.
Er sei sehr enttäuscht, da die Mitgliedstaaten den Verhandlern kein Mandat erteilt hätten, irgendwelche offenen Punkte zu finalisieren, so Bloss. Er fürchte, dass die Tschechen den Trilog absichtlich verschleppen und der kommenden Ratspräsidentschaft aus Schweden überlassen wollen. Auch die Kommission würde zu wenig Druck ausüben, kritisierte der Schattenberichterstatter der Grünen.
Sein Counterpart von der CDU, Peter Liese, präsentierte zwar ebenfalls nur minimale Fortschritte, zeigte jedoch Verständnis für die tschechische Ratspräsidentschaft. Deren Verhandler hätten ein mächtiges Programm mit den Trilogen zum Fit-for-55-Paket vor der Brust. Sie hätten die Priorität auf die Effort Sharing Regulation, LULUCF und die CO2-Flottenstandards für Pkw gelegt und wollen diese bis zur COP27 fertigstellen, um dort etwas präsentieren zu können, erklärte er. ETS und CBAM sollten dagegen bis Weihnachten fertiggestellt werden.
Über die großen Themen des Ambitionsniveaus, ETS 2 und Freizuteilungen für die Industrie sei zwar gesprochen worden, bestätigten sowohl Bloss als auch Liese. Einigungen gab es jedoch nicht. Ohnehin glaube er nicht, dass diese Themen vor dem allerletzten Trilog gelöst werden können, sagte Liese.
Vom Tisch seien dagegen die Vorschläge der Kommission, die Benchmarks für die Stahlindustrie anzuheben. Diese hätten dafür gesorgt, dass noch mehr Stahlindustrieanlagen, welche die Benchmarks nicht erfüllen, zusätzlich zum linearen Reduktionsfaktor kostenlose Emissionszertifikate verlieren. Laut Liese bleiben die Benchmarks nun jedoch, wie sie sind. Zudem soll auch die Strompreiskompensation für indirekte Emissionen bestehen bleiben, berichtete Liese. Dies sei wichtig, um weitere Preisschocks im Zuge der Energiekrise zu vermeiden.
Die nächste Trilogrunde ist für den 10. November vorgesehen. Bis dahin werden weiterhin sogenannte technische Verhandlungen zu Detailfragen stattfinden. luk
Die EU-Kommission legt ihren Vorschlag für CO2-Flottenziele bei Lastwagen nicht wie geplant am 30. November vor. Der Punkt wurde von der Liste der vorgesehenen Punkte auf der Agenda der künftigen Kommissionssitzungen gestrichen. Nun wird damit gerechnet, dass der Vorschlag in den ersten Monaten 2023 kommt. Die Kommission hat noch kein neues Datum genannt.
Der Vorschlag wird eine weitere Minderung des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes von neuen Lastwagen jedes Herstellers anregen. Hersteller, die die Flottenziele nicht einhalten, müssen mit Strafen rechnen. Es wird damit gerechnet, dass die Kommission auch dem Verbrenner bei Nutzfahrzeugen ein Enddatum setzt. Es könnte bei 2040 liegen. Auch bei Lastwagen stellt sich die Frage, ob die Kommission die Anrechnung von CO2-neutral hergestellten synthetischen Kraftstoffen im Rahmen der C02-Flottengrenzwerte zulässt. Beobachter rechnen nicht damit. mgr

Viel Zeit hat Sigrid “Sigi” Maurer heute nicht fürs Gespräch. Auf der Tagesordnung stehen Telefonat um Telefonat zum Unfall bei der OMV im Sommer (war es doch Sabotage?), Verhandlungen mit dem Koalitionspartner ÖVP über die steigenden Energiepreise, abends eine Parteisitzung und der Tag der Industrie. Als Fraktionsvorsitzende des Grünen Parlamentsklubs im österreichischen Nationalrat hat Maurer viel zu organisieren, koordinieren und zu verhandeln.
Ob die Unruhe beim Koalitionspartner ÖVP da die Arbeit erschwert – immerhin gab es dort seit der Regierungsbildung im Januar 2020 acht Wechsel auf Minister- bzw. Kanzlerposten? “Für ihre Personalpolitik ist die ÖVP selbst verantwortlich. Es ist natürlich schwierig, wenn das Gegenüber nicht ganz stabil ist, aber das hat sich ja inzwischen beruhigt”, sagt Maurer und lässt sich, wie bei allem, nicht zu sehr in die Karten schauen.
Überhaupt ist Maurer rhetorisch ganz die Politikerin mit der Gabe, Fragen unbeantwortet zu lassen, dabei das Thema aber auf das – in ihren Augen – Wesentliche zu lenken. Provozieren lässt sie sich auch bei kritischen Fragen zum aktuellen Tiefflug der Umfragewerte der Regierung nicht, sondern gibt sich “in der Defensive erstaunlich aggressiv“, wie das österreichische Nachrichtenmagazin Profil schreibt.
Selbst provozieren kann sie aber auch: Als sie 2017 nach einer Talkshow zum Thema sexueller Belästigung viele Hassnachrichten bekommt, postet sie ein Foto auf Instagram, die Mittelfinger erhoben, mit den Worten “to the haters with love”. 2010, recht zu Beginn ihrer politischen Laufbahn, wirft sie von der Besuchergalerie Flugblätter in den Plenarsaal des Nationalrates und wird rausgeworfen. 18 Monate Hausverbot für Maurer.
Zur Politik kommt die 37-jährige Tirolerin während ihres Studiums der Musikwissenschaften und Politikwissenschaften. Als der Studiengang Musikwissenschaften abgeschafft werden sollte, beginnt sie sich in der Österreichischen Hochschülerschaft zu engagieren. Von 2009 bis 2011 ist sie deren Vorsitzende und unterstützt die Studierendenproteste 2009/2010. Eine gute Vorbereitung auf die Bundespolitik: 2013, noch während ihres zweiten Studiums der Soziologie, zieht sie als Grünen-Abgeordnete in den Nationalrat ein, mit 28 Jahren.
Seit der Wahl 2019 bilden die Grünen zusammen mit der ÖVP eine türkis-grüne Koalition. Maurer erbt Anfang 2020 den Fraktionsvorsitz von Werner Kogler, als dieser Vizekanzler wird. Seither herrscht mit der Pandemie und russischem Angriffskrieg Dauerkrisen-Zustand. Das quittiert Maurer aber nur mit einem trockenen: “Man muss die Krisen so nehmen, wie sie kommen und sie als Chance verstehen.”
Insbesondere in der Frage der Energiekrise sei das, was die Grünen seit Jahrzehnten predigten, jetzt Staatsräson. “Es haben jetzt sogar die Konservativsten der Konservativen verstanden, dass wir die Energiewende brauchen und dass die Klimakrise nicht mehr weggeht.”
Trotzdem müssten auch die Grünen, genau wie in Deutschland, derzeit Entscheidungen treffen, die man von ihnen nie erwartet hätte. Darunter falle zum Beispiel die Umrüstung bestimmter Kraftwerke auf fossile Brennstoffe, um für den Notfall gerüstet zu sein. “Gleichzeitig zu diesen Notfallmaßnahmen ist es jetzt aber wichtig, weiter unabhängig zu werden, nicht nur von russischem Gas, sondern von Gas insgesamt und auf erneuerbare Energien zu setzen”, sagt Maurer. Ein Schritt dahin sei das Verbot von Gasheizungen in Neubauten ab Januar 2023.
Ganz besonders am Herzen liegt der Vielpendlerin die Umsetzung des Klimatickets, einem Ticket für den gesamten regionalen und bundesweiten öffentlichen Nahverkehr. “Das Ticket steht seit Jahrzehnten in verschiedenen Parteiprogrammen, jetzt wurde es endlich umgesetzt”, freut sie sich. Lisa-Martina Klein