wieder und wieder tauchen neue Berichte über die schreckliche Situation in den Lagern in Xinjiang auf. Am Dienstag veröffentlichte ein internationaler Medienverbund neues, brisantes Material. Dazu gehören Tausende Häftlingsfotos und authentische Aufnahmen aus den Gefängnissen, aber auch Details zum Schießbefehl und den Folterwerkzeugen. Das Leak belegt auch: Der Betrieb der Lager ist von Peking aus angeordnet und nicht etwa eine Idee örtlicher Kader.
Es folgte ein Aufschrei besorgter Bundespolitiker: Außenministerin Annalena Baerbock forderte von China eine Aufklärung der “schwersten Menschenrechtsverletzungen”. “Samtpfötigkeit” aufgrund unserer wirtschaftlichen Interessen dürfe es nicht geben, sagte Finanzminister Christian Lindner. Er mahnt dazu, die KP mehr auf die Menschenrechtslage anzusprechen.
Doch reicht das? Während die Merkel-Regierungen sich rühmten, die Probleme hinter den Kulissen ernsthaft “anzusprechen”, wurden die Lager überhaupt erst errichtet. In Xinjiang wird heute nach allem, was wir wissen, eine komplette Bevölkerungsgruppe total überwacht, große Teile werden zur Umerziehung in Lager gesteckt. Die Uiguren dürfen keine Uiguren mehr sein, so die fixe Idee der Verantwortlichen in Peking. Die mahnenden Worte westlicher Politiker haben sie nicht von ihrer Umsetzung abgehalten.
Neben der Diplomatie gibt es andere Anstrengungen, um Menschenrechte durchzusetzen. Doch auch die geplanten Lieferketten-Gesetze werden kaum wirken. Chinesische Solar-Unternehmen verlagern ihre Produktion zunehmend in Regionen außerhalb Xinjiangs. Die Exporte und internationalen Lieferketten wären also scheinbar sauber. Für den Heimatmarkt greifen die Solar-Hersteller Experten zufolge jedoch weiterhin auf Vorprodukte aus Xinjiang zurück, die Berichten zufolge von uigurischen Zwangsarbeitern hergestellt werden.
Die große Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China sei vor dem Hintergrund der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang “besonders bedrückend”, sagt Christian Lindner. Mindestens genauso bedrückend: wie spät die deutsche Politik ihr Umdenken gegenüber China einleitet. Eine frühe Verringerung der Abhängigkeit hätte vielleicht kurzfristig manchen Milliardengewinn eines Dax-Konzerns gedämpft. Dafür hätte sich aber langfristig ein Teil der Abhängigkeit gar nicht herausgebildet, die jetzt unternehmerisch und geopolitisch zur Belastung wird.


Zum Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hatten sich die chinesischen Gastgeber ein besonders spitzfindiges Geschenk ausgedacht. Außenminister Wang Yi überreichte der Chilenin eine englischsprachige Fassung von Staatschef Xi Jinpings “Respekt und Schutz der Menschenrechte” – eine Sammlung von Reden und Essays des Parteichefs. Die medial in Szene gesetzte Übergabe, die das Außenamt plakativ über soziale Medien in der Welt verbreitete, bekam nur wenige Stunden später eine hochgradig zynische Fußnote.
Kaum hatte Bachelet die Gelegenheit, in dem Werk zu blättern, da veröffentlichte ein Konsortium von 14 internationalen Medien aus elf Ländern, darunter das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und der Bayerische Rundfunk, das Resultat einer wochenlangen Recherche namens Xinjiang Police Files. Tausende Fotos, vertrauliche Dokumente und umfangreiche Datensätze liefern darin neue Beweise für das brutale Vorgehen chinesischer Behörden gegen muslimische Uiguren in der autonomen Region Xinjiang.
Die Dateien werfen ein Licht auf die Kriminalisierung und Folterungen von Uiguren in Internierungslagern. Sie entlarven die chinesische Darstellung der Camps als Ausbildungszentren, die freiwillig besucht würden, als falsch. Fotos zeigen Gefangene, die in Handschellen und Fußfesseln durch die Gänge eines Lagers laufen. Zudem offenbaren als vertraulich klassifizierte Reden von hochrangigen Politikern aus dem Staatsrat und der Provinz die unmittelbare Verstrickung des engsten chinesischen Führungszirkels in den Aufbau eines Systems der Umerziehung, das mit Waffengewalt und dauerhaften Verletzungen von Menschenrechten durchgesetzt wird.
Die Dokumente, die von Polizeiservern in Xinjiang stammen und dort gehackt wurden, waren zunächst dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz zugespielt worden. Zenz offenbarte bereits in der Vergangenheit mit “innovativer Pionierarbeit” das Ausmaß der vermeintlichen Anti-Terror-Kampagne. Die beteiligten Medien prüften in der Folge in Kleinarbeit die Echtheit der Dokumente.
“Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Dokumente authentisch sind. Dass es sich angesichts des Umfangs um einen sogenannten Deep Fake handelt, ist sehr unwahrscheinlich”, sagt der Sinologe Björn Alpermann von der Universität Würzburg, der seinerseits zu den Vorgängen in Xinjiang forscht. Alpermann hält die Dateien für einen wichtigen Baustein, um die Vorgänge in Xinjiang beurteilen zu können. Sie bestärken zahlreiche Augenzeugenberichte von ehemaligen Inhaftierten.
Besondere Relevanz erhalten die Abschriften von Reden des Ministers für Staatssicherheit, Zhao Kezhi, aus dem Jahr 2018, und dem früheren Parteisekretär in Xinjiang, Chen Quanguo, von 2017. Daraus ergibt sich nachweislich die unmittelbare Kenntnis und Verstrickung der Parteispitze um Xi Jinping in den signifikanten Ausbau von Hafteinrichtungen auf eine große Kapazität. Mehrere Millionen Menschen könnten in den Lagern Platz finden.
Es zeigt zudem auf, dass Rechtsstaatlichkeit bei der Inhaftierung keine Rolle spielt. Zhao sagte beispielsweise, dass für Manche fünf Jahre Haft nicht ausreichen würden für die Umerziehung. “Sobald sie wieder rausgelassen werden, tauchen die Probleme wieder auf. Das ist die Realität in Xinjiang.” Chen seinerseits forderte die Wachen in den Lagern dazu auf, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, wenn jemand versuche zu fliehen.
Entsprechend umfangreich fallen die Strafen gegen Uiguren aus, wie die Police Files belegen. Für Verdachtsmomente, die nicht einmal eine Straftat bedeuten, wie das Lesen religiöser Schriften, das Tragen eines Bartes oder das Predigen muslimischer Glaubenssätze, wurden Urteile von weit über zehn Jahren ausgesprochen. Rechtlich verurteilte Uiguren oder Mitglieder anderer muslimischer Minderheiten sind jedoch in regulären Haftanstalten untergebracht, nicht in den Internierungslagern.
Weil die Haftgründe vornehmlich auf dem Misstrauen und der Willkür chinesischer Sicherheitskräfte beruhen (China.Table berichtete), war der Bedarf an Lagerplätzen und Gefängniszellen teilweise deutlich größer als der Bestand. Auch diesen Aspekt brachte Minister Zhao in seiner Rede zur Sprache. Es sei Xi Jinpings “wichtigen Anweisungen” zu verdanken, dass mit entsprechender Finanzierung neue Einrichtungen gebaut oder bestehende ausgebaut werden könnten. “Die Dokumente belegen einen direkten Bezug zum Ständigen Ausschuss des Politbüros und zum Parteichef. Unter diesen Umständen ist ein Abstreiten von chinesischer Seite nicht glaubwürdig”, sagt Sinologe Alpermann.
Außenminister Wang hatte bei seinem Treffen mit UN-Kommissarin Bachelet noch die Hoffnung geäußert, der Besuch der Menschenrechtsbeauftragten könnte helfen, vermeintliche “Falschinformationen” über Xinjiang als solche zu entlarven. Er warf “ausländischen Kräften” eine “Schmierkampagne” gegen seine Regierung vor. Die Veröffentlichung der Xinjiang Police Files dürfte deshalb nicht ganz zufällig pünktlich zum Besuch Bachelets in China geschehen sein. Sie vermindert die Wirkungskraft chinesischer Propaganda, die versuchen wird, die Reise der UN-Kommissarin als Beleg für die vermeintlichen Falschinformationen zu instrumentalisieren.
Dass China stattdessen seine Strategie des Abstreitens wird justieren müssen, lassen erste Reaktionen auf die neuen Beweise erahnen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verlangte Aufklärung von China, ebenso Finanzminister Christian Lindner (FDP), der zudem über Twitter forderte: “Samtpfötigkeit aufgrund unserer wirtschaftlichen Interessen darf es nicht geben.”
Der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer brachte ebenso wie die frühere menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Margarete Bause, weitere Sanktionen gegen die Volksrepublik ins Spiel. “Es braucht jetzt weitere EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen dieser Verbrechen und einen grundlegenden Kurswechsel in der deutschen Chinapolitik”, so Bause. Michael Brand, menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, findet deutliche Worte: “Das Regime in China hat endgültig sein Gesicht verloren. Wenn wir nur zuschauen, werden wir mitschuldig an der langsamen Auslöschung eines Volkes. Es braucht klare Signale, und das sind Sanktionen”.
Auch die Trägerin des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises, Sayragul Sauytbay, wendete sich mit Sanktionsforderungen an die internationale Gemeinschaft. “Neben Augenzeugenberichten ist dieses Material eine zweite wichtige Beweisquelle. Sie reichen aus, um die Verbrechen der KPCh gegen die Menschlichkeit zu beweisen. Wenn die internationale Gemeinschaft diesen Völkermord wirklich stoppen will, ist dies der Auslöser für ihr wirksames Handeln”, sagte sie zu China.Table. Sie sei überzeugt, dass die Xinjiang Police Files die politischen Entscheidungen beeinflussen werden.

Vergangene Woche hat das von der Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) entwickelte Zivil-Großflugzeug C919 einen wichtigen bemannten Test bestanden. Während des dreistündigen Fluges seien alle geplanten Aufgaben ausgeführt worden. Das Flugzeug war “voll leistungsfähig” und sei sicher gelandet, schreiben die Staatsmedien.
Ihren Jungfernflug hatte die C919 bereits im März 2017. Bislang wurde das Flugzeug von der chinesischen Civil Aviation Administration of China (CAAC) aber noch nicht als einwandfrei flugfähig eingestuft. Nach der jüngsten Testflug-Zertifizierung soll dieses Ziel nun aber in greifbare Nähe gerückt sein. Bislang wurden sechs C919 hergestellt, die nun in die finale Testflugphase eintreten.
Laut Wu Yongliang, dem stellvertretenden Generaldirektor von Comac, könnte der Flieger bereits dieses Jahr an Kunden ausgeliefert werden. Immerhin 815 Bestellungen seien bereits bei dem Flugzeugbauer eingegangen, meldet das Unternehmen. Der Großteil davon stammt aus China.
Im März 2021 hatte China Eastern den weltweit ersten Auftrag zum Kauf von fünf C919 erteilt, die auf mehreren inländischen Routen wie Peking, Guangzhou und Shenzhen eingesetzt werden sollen. Aber es gibt auch Interesse aus dem Ausland. Ryanair-Chef Michael O’Leary hatte bereits vor zehn Jahren verkündet, dass er an einer Zusammenarbeit mit Comac interessiert sei. Dass das Passagierflugzeug ein ernstzunehmender Konkurrent für Airbus und Boeing wird, bezweifelt kaum ein Luftfahrt-Experte. Peking wird alles Nötige tun, um die heimische Firma in den Markt zu hieven.
China setzt große Hoffnungen in sein erstes selbst entwickeltes Verkehrsflugzeug, das über 158 bis 168 Sitzplätze verfügt und 4.075 Kilometer weit fliegen kann. Doch die Entwicklung hin zur Marktreife, die bereits 2008 begann, geht nach wie vor nur schleppend voran. Der Auslieferungsstart war zunächst für 2016 angekündigt, dann für 2021. Und wie nun bekannt wurde, wird das Flugzeug doppelt so viel kosten wie eigentlich geplant.
Aus einer am Dienstag an der Shanghaier Börse eingereichten Meldung geht hervor, dass jeder Jet für einen Preis von 653 Millionen Yuan (99 Millionen US-Dollar) Listenpreis angeboten wird. Damit liegt der eigentlich als günstige Alternative angekündigte C919 fast in der gleichen Größenordnung wie der Airbus A320neo mit einem Listenpreis von 111 Millionen US-Dollar und die Boeing 737 Max mit einem Listenpreis von 117 Millionen US-Dollar.
Dabei wollte Comac vor allem mit dem Preis das internationale Duopol von Airbus und Boeing brechen. Allerdings ist es viel zu früh, um den realen Marktpreis des C919 mit ihren Wettbewerbern zu vergleichen. Nachlässe und günstige Finanzierungen können den realen Kaufpreis noch verändern. Die Stunde der Wahrheit kommt vor allem dann, wenn die ersten Secondhand-Maschinen gehandelt werden.
Klar ist aber: Da der Comac-Flieger nicht fortschrittlicher ist als seine Wettbewerber, und da Comac noch nicht als Marke etabliert ist, muss die Maschine über einen günstigen Preis verkauft werden. Das gilt vor allem für den Erfolg auf dem internationalen Markt. In China selbst kann der Staat verordnen: Chinesen kaufen chinesisch. So wie das jüngst bei Computern gemacht wurde (China.Table berichtete). Da die Fluglinien des Landes sich mehrheitlich in Staatshand befinden, hat Peking hier erheblichen Einfluss.
Die Preisnachlässe haben allerdings Grenzen, da die chinesischen Flugzeuge noch immer stark von ausländischen Zulieferern abhängig sind. Die Triebwerke stammen etwa vom französisch-amerikanischen Hersteller CFM. Laut einem Bericht des Center for Strategic & International Studies, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, sollen sogar 60 Prozent der Hauptlieferanten des C919 amerikanische Unternehmen wie General Electric und Honeywell sein.
Weitere wichtige Zulieferer sind Liebherr-Aerospace oder der österreichische Hersteller FACC. Er ist seit 2009 im Besitz des chinesischen Flugzeugbauers Xi’an Aircraft Industrial Corporation (XAC) und produziert Kunststoff-Leichtbaukomponenten. Sogar Boeing und Airbus liefern zu.
Die internationale Verflechtung macht Comac anfällig für Sanktionen. Laut einem Bericht der South China Morning Post haben Trumps verschärfte Exportkontrollen gegenüber chinesischen Unternehmen massiv zu den Verspätungen in der Entwicklung beigetragen.
China ist der größte Flugzeugmarkt der Welt. Experten schätzen, dass die Volksrepublik in den kommenden beiden Jahrzehnten 4.300 neue Flugzeuge im Wert von 480 Milliarden US-Dollar benötigt. Das klingt zunächst nach einer guten Nachricht für Airbus und Boeing. Im Frühjahr 2018 beschloss Peking zudem, die Begrenzung für ausländische Beteiligungen beim Bau von Flugzeugen in China fallen zu lassen. Ein kluger Schachzug. Damit lockt China die ausländischen Hersteller noch tiefer in seinen Markt und macht sie noch abhängiger.
Allein 2021 hat Airbus 142 neue Flugzeuge an China geliefert. An dem Tag, an dem Peking in der Lage ist, Boeing- und Airbus-Flugzeuge in China in großen Stückzahlen durch die C919 zu ersetzen, wird sich das Spiel drehen. Vielleicht werden Boeing und Airbus dann immer noch Rekordabsätze verzeichnen, weil der chinesische Markt so rasant wächst. Ihre Marktanteile und Margen werden jedoch schrumpfen.
Das werden dann auch die Mitarbeiter in Hamburg merken. Dort befindet sich neben Toulouse der wichtigste Airbus-Standort in Europa. Wie die neue Welt in der Flugzeugindustrie aussieht, konnte man bereits Mitte Mai beobachten: China Eastern kündigte an, neues Kapital aufzunehmen, um Flugzeuge im Wert von einem Listenpreis von rund 4,38 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Auf der Shoppingliste stehen: vier Comac C919, 24 Comac ARJ21-700 Regional-Jets, sechs Airbus A350-900 und nur vier Boeing 787-9. Die Bestellungen im Inland überwiegen hier also zahlenmäßig schon bei Weitem.
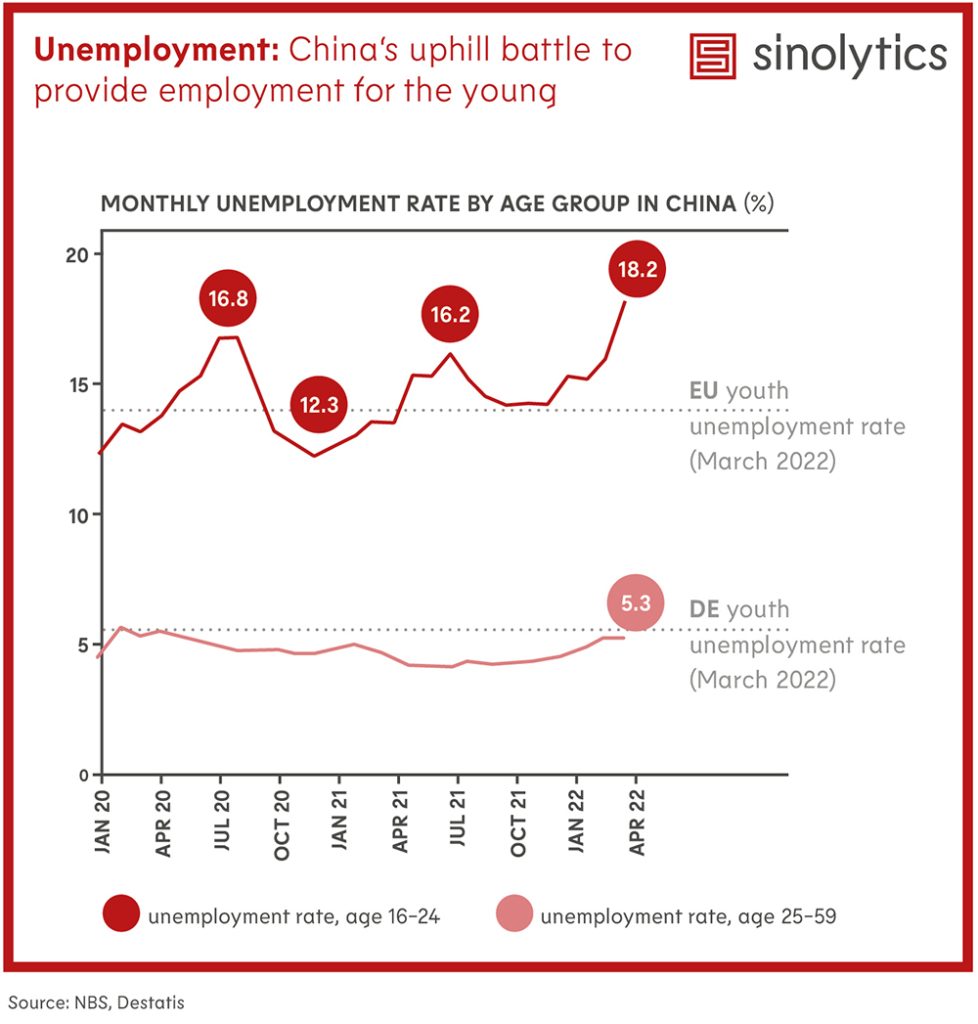
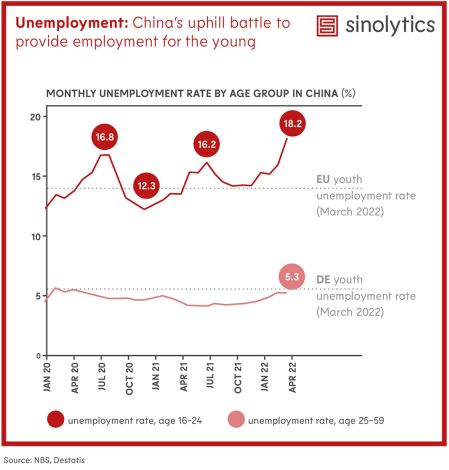
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.
30.05.2022, 9:00-12:00 Uhr (MEZ)
Hannover Messe / Hybrid: Eröffnung Messestand “Invest in China” + Forum Deutsch-Chinesische Intelligente Produktion Mehr
30.05.2022, 9:00-16:30 Uhr (MEZ)
Rödl & Partner / Seminar: Arbeitsrecht China Mehr
30.05.2022, 10:00-11:00 Uhr (MEZ) 16:00-17:00 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: Tax Updates for SMEs: 2022 Tax Regulations and Profit Repatriation Strategies Mehr
30.-31.05.2022, 9:00-17:30 Uhr (MEZ) / 9:00-13:30 Uhr (MEZ)
Leibniz Association / Hybrid/ Präsenz: Managing Tech Cooperation with Chinese Partners: Challenges and Responses Mehr
31.05.2022, 9:00-10:30 Uhr (MEZ)
China Team / Webinar: Von Whistleblowern und Hinweisgebersystemen Mehr
31.05.2022, 9.30 Uhr (MEZ) / 15:30 Uhr Beijing Time
Dezan Shira / Webinar: Training Program on IP Protection Through Customs Mehr
31.05.2022, 9:30-12:00 Uhr (MEZ)
CIPA / Hybrid: Ningbo (Germany) Special Investment Cooperation and Exchange Meeting Mehr
31.05.2022, 10:00-11:30 Uhr (MEZ) / 16:00-17:30 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: China’s Machinery Sector: Entry Strategy, Localisation Trend and Talent Recruitment Mehr
31.05.2022, 19:00-20:00 Uhr (MEZ)
Konfuzius Institut Heidelberg / Vortrag: Early Chinese Periodicals Online (ECPO) – ein Projekt stellt sich vor Mehr
01.06.2022, 18:30-19:30 Uhr (MEZ) Historisches Kaufhaus Freiburg
Konfuzius-Institut Freiburg / Präsenz: Wandel durch Handel? Die schwierige Existenz chinesischer Händler in afrikanischen Gesellschaften Mehr
01.-02.06.2022; 9:00-17:00 Uhr (MEZ) Zeppelin-Univeristät
CIDW / Seminar: Erfolgreiche Geschäfte machen in China Anmeldung
Tesla will Tausende Arbeiter in stillgelegten Fabriken und einem alten Militärlager in der Nähe der Tesla-Fabrik in Shanghai isolieren. Die Arbeiter werden von der Außenwelt abgeschnitten, um Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern. Die Maßnahme dient dazu, eine zweite Arbeitsschicht in der Fabrik zu etablieren. Aus Platzmangel werden sich die Arbeiter in den behelfsmäßigen Schlafsälen jedoch die Betten teilen müssen, wie Bloomberg berichtet. Während die Tagschicht arbeitet, soll die Nachtschicht schlafen. Nachts soll dann die Tagschicht in den gleichen Betten übernachten, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren hat.
Zuvor gab es Berichte, dass Tesla leerstehende staatliche Isolationszentren nutzen wolle, um die Arbeiter unterzubringen. Die stillgelegten Fabriken und das militärische Trainingslager seien aber praktikabler, so eine der Quellen gegenüber Bloomberg.
In China arbeiten derzeit zahlreiche Unternehmen in sogenannten Closed Loop-Systemen. Trotz der Bemühungen, Ansteckungen zu verhindern, kam es innerhalb der isolierten Arbeiterschaft in wiederholten Fällen zu Ansteckungen. Teilweise wurden die infizierten Arbeiter dabei nicht voneinander isoliert. Zudem gab es Berichte, dass Tesla 12-Stunden-Schichten an sechs Tagen die Woche verordnet hatte. Auch in China widersprechen solche Bedingungen dem Arbeitsrecht. Laut Experten der Arbeitsrechtsorganisation China Labour Bulletin haben die Behörden das Arbeitsrecht für die Closed Loop Systeme jedoch ausgesetzt (China.Table berichtete). nib
Der Aktivist und ehemalige Hongkonger Rechtsprofessor Benny Tai wurde am Dienstag wegen illegaler Wahlausgaben zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Dem 57-jährigen wird vorgeworfen, im Jahr 2016 mit einem Betrag von 253.000 Hongkong-Dollar (32.200 US-Dollar) mehrere Zeitungsanzeigen in Auftrag gegeben zu haben, die pro-demokratische Wahlkandidaten unterstützten.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Anzeigen gegen Hongkonger Wahlgesetze verstießen, und die Wahl unangemessen beeinflusst hätten, da Tai selbst kein Kandidat war. Tai erklärte sich schuldig, wodurch die Strafe von 18 auf zehn Monate verkürzt wurde. Bereits im April hatte Tais Anwalt erklärt, dass es sich um eine transparente Wahlstrategie gehandelt habe.
Laut einem neuen Bericht des Hong Kong Democracy Council wurden seit 2019 rund 10.200 Menschen in der Sonderverwaltungszone wegen politischer Verbrechen festgenommen, und fast 3.000 strafrechtlich verfolgt. Mitte Mai befanden sich 1.014 politische Gefangene in Hongkonger Gefängnissen, darunter Demonstranten, Journalisten, Lehrer, Anwälte und Gewerkschaftsführer. Nur noch in Belarus, Burma und Kuba wachse die Zahl politischer Gefangener derart schnell, so der Bericht. fpe
Airbnb will ab dem 30. Juli in China keine Unterkünfte oder “Experiences” mehr anbieten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das 2008 in San Francisco gegründete Unternehmen war seit 2015 in China aktiv. Seitdem bediente Airbnb dort um die 25 Millionen Kunden. Buchungen in der Volksrepublik machten zuletzt aber nur ein Prozent der weltweiten Buchungen aus. Als Grund gilt neben der Pandemie auch eine wachsende Zahl heimischer Konkurrenten, allen voran die Anbieter Tujia und Xiaozhu.
Im Mai 2020 hatte AirBnb etwa 25 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen müssen, da die weltweite Nachfrage nach Unterkünften drastisch gesunken war. 150.000 gelistete Wohnungsangebote werden nun von AirBnb in China gelöscht. Nutzer aus China sollen jedoch weiterhin über die Plattform Unterkünfte im Ausland buchen können. Der Outbound-Tourismus verspreche durch speziell auf chinesische Kunden zugeschnittene Angebote höhere Umsätze, erklärt das Unternehmen. Ein Büro in Peking soll das Geschäft weiter koordinieren. fpe
Die USA, Japan, Indien und Australien wollen ihre Kooperation mit pazifischen Inselstaaten ausbauen. Die sogenannte Quad-Gruppe beschloss am Dienstag auf einem Gipfeltreffen, die Zusammenarbeit in ökonomischen Fragen, bei der maritimen Sicherheit und der Anpassung an den Klimawandel zu verstärken. Konkret wurde beispielsweise eine satellitengestützte Initiative beschlossen, um gegen illegale Fischerei und chinesische Seemilizen vorzugehen, wie die Financial Times berichtet. Es gehe darum, die Fähigkeiten der Anrainer zu verbessern, damit sie “wissen, was in den Hoheitsgewässern und den ausschließlichen Wirtschaftszonen geschieht”, wird ein US-Beamter zitiert.
Derweil hat Chinas Außenministerium Besuche des Außenministers in einige Länder der Region angekündigt. Zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juni wird Wang Yi acht pazifische Inselstaaten besuchen. Dazu gehören die Salomonen, mit denen China kürzlich einen Sicherheitspakt geschlossen hat. Ebenso sind Besuche in Papua-Neuguinea, Ost-Timor, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga und Vanuatu geplant. Laut Berichten der Financial Times plant China auch ein Sicherheitsbündnis mit Kiribati.
Die USA verstärken parallel ihre Kommunikationsoffensive bezüglich China. Am Donnerstag will Außenminister Antony Blinken die China-Strategie seines Landes in einer Rede auf einer Veranstaltung der Asia Society darlegen. Eigentlich wollte Blinken die Rede schon Anfang Mai halten, doch er zog sich Covid-19 zu. nib
Die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt werden sich Ökonomen zufolge in diesem Jahr verschärfen. Die durchschnittlichen Immobilienpreise dürften im ersten Halbjahr um 1,3 Prozent fallen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Reuters-Umfrage unter Analysten und Ökonomen hervorgeht. Für das gesamte Jahr sehen sie eine Stagnation voraus. Die Immobilienverkäufe dürften demnach 2022 um zehn Prozent einbrechen. Zugleich gehen die Experten davon aus, dass die Investitionen in der Branche um 2,5 Prozent fallen werden.
Der einst boomende Immobilienmarkt hat jahrelang den Aufschwung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gestützt. Probleme tauchten bereits im vergangenen Jahr auf, als die Krise um den hoch verschuldeten Immobilien-Konzern Evergrande akuter wurde und die Behörden die Kreditaufnahme von Bauträgern einschränkte. Seit Anfang dieses Jahres haben mehr als 100 Städte Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage ergriffen – etwa durch niedrigere Hypothekenzinsen, geringere Anzahlungen und Subventionen.
Ob das ausreicht, um den Markt wieder in Schwung zu bringen, ist ungewiss. Viele der großen Immobilienentwickler sind überschuldet und haben um Aufschub bei der Zahlung von Anleihen im In- und Ausland gebeten. Auch die Corona-Lockdowns in Metropolen wie der Hauptstadt Peking und dem Wirtschaftszentrum Shanghai drücken die Nachfrage. Peking verlängerte für viele seiner 22 Millionen Einwohner die Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus. Restaurants und Fitnessstudios wurden in der Hauptstadt bereits geschlossen. Shanghai will den zweimonatigen Lockdown in der ersten Junihälfte aufheben.
Die Pandemie hat sich auf den Immobilienmarkt von Shanghai ausgewirkt, da Bauträger und Makler ihre Aktivitäten einstellten und viele Einwohner unter Quarantäne standen, sagt Analyst Wang Xiaoqiang vom Immobiliendatenanbieter Zhuge House Hunter. Das habe zu einem starken Rückgang der Immobilienverkäufe geführt. Nur landesweite Maßnahmen zur Lockerung der Finanzierungsbeschränkungen und Maßnahmen wie die Sanierung von heruntergekommenen Vierteln könnten den Immobilienmarkt stabilisieren, sagte Liu Yuan, der Leiter der Forschungsabteilung bei Chinas größtem Immobilienmakler Centaline. rtr/nib
Aufgrund hoher Rohstoffpreise und der Einhaltung der Klimaziele haben zwei Provinzen die Strompreise für Industriebetriebe erhöht. In Jiangsu sind 30 Unternehmen betroffen, die ihre Energie-Effizienz-Ziele nicht erreicht oder altes Equipment benutzt haben. Sie müssen bald sieben Cent pro Kilowattstunde mehr zahlen. In Zhejiang sollen 600 Unternehmen aus Energie-intensiven Branchen wie Zement, Metalle und Glas umgerechnet circa 2,5 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen. Die Erhöhung ist laut Bloomberg erforderlich, um die steigenden Kosten der Gas-Kraftwerke der Provinz zu decken.
Durch den Anstieg der Energiepreise auf dem Weltmarkt könnten Kraftwerke in China in naher Zukunft wieder in finanzielle Notlage geraten. Schon im letzten Jahr konnten viele Kohlekraftwerke nicht mehr profitabel wirtschaften. Der Preis für Kohle war zu hoch und da die Strompreise staatlich festgelegt waren, hatten die Kraftwerke Verluste eingefahren. Es kam zu einer Stromkrise, die Monate anhielt. Danach wurde der staatliche Strompreis angepasst, sodass die Provinzen ihn in gewissem Rahmen erhöhen dürfen.
Um die Klimaziele des Landes erreichen zu können, wurden einige Preisobergrenzen komplett aufgehoben. Die größten Klima-Verschmutzer könnten in naher Zukunft mit starken Preisanstiegen zu rechnen haben. Ob weitere Provinzen den Beispielen folgen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Nach der Stromkrise des letzten Jahres hat China die einheimische Kohleförderung ausgeweitet und die Kraftwerke aufgerufen, die Lager frühzeitig zu füllen. Aufgrund von Umweltregulierungen und Minenunglücken ist es jedoch unwahrscheinlich, dass China die selbstgesteckten Ziele zur Ausweitung der Kohleproduktion erreicht. nib
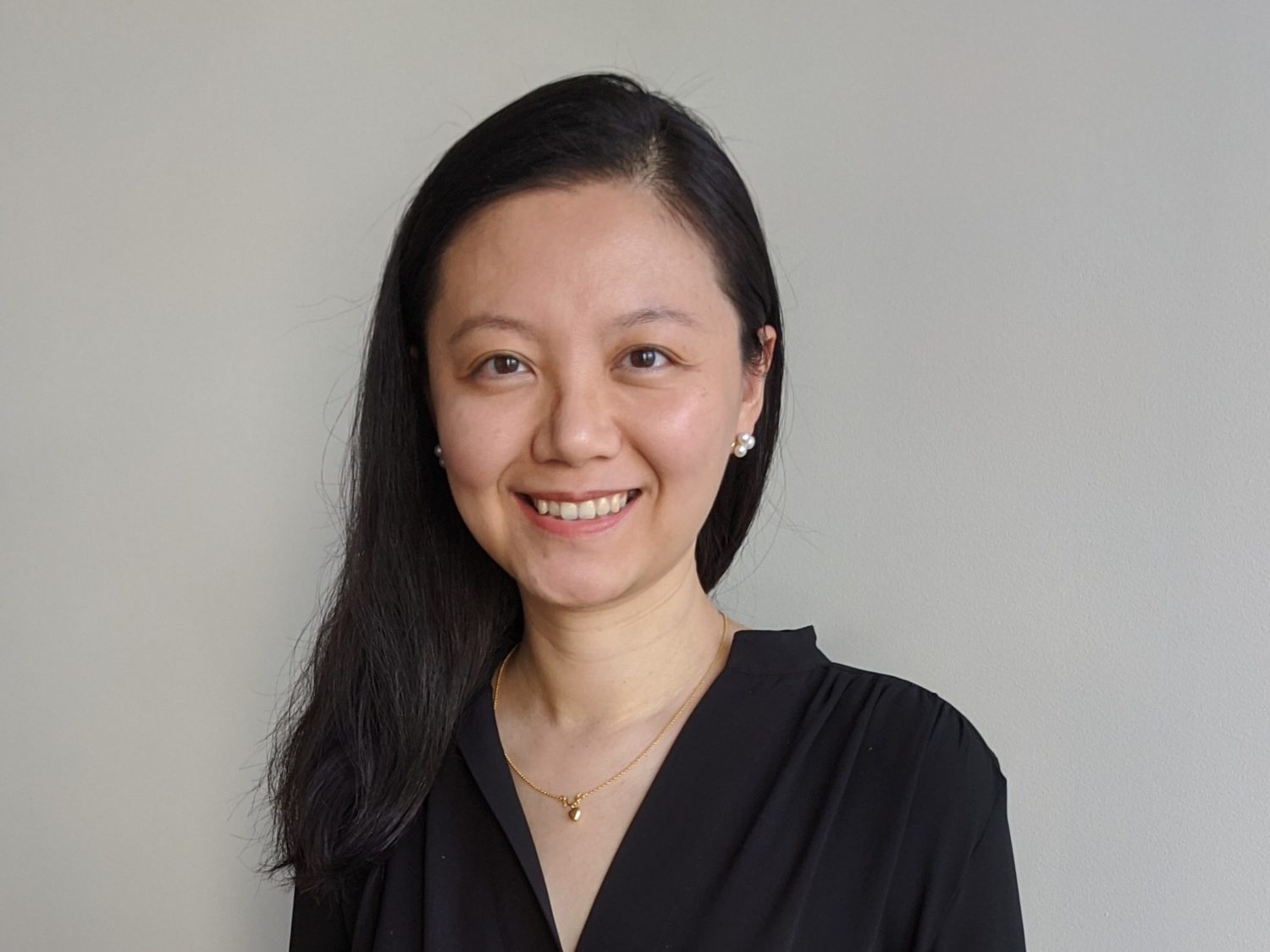
Bonny Lin will Leben retten. Nach der High School hatte die US-Amerikanerin eigentlich geplant, Ärztin zu werden. Stattdessen wurde sie China-Analystin – einen Widerspruch sieht sie darin nicht: “Als Ärztin kannst du zwei bis drei Leben pro Tag retten. Aber schon kleine Änderungen in der Politik können das Leben von tausenden Menschen verändern”, erklärt sie gegenüber China.Table.
Lin leitet mit dem China Power Projekt ein weltweit renommiertes Institut für Chinaforschung, das dazu beitragen will, die technologische, kulturelle, wirtschaftliche, militärische und soziale Macht Chinas zu verstehen. Das Projekt ist am Center for Strategic and International Studies in Washington angesiedelt, einem führenden US-Thinktank. Lin setzt sich dort vehement für ein fakten- und datenbasiertes Chinaverständnis ein. Das verlange der ethische Anspruch, den sie ihrer Arbeit zugrundelegt.
Wie die Qualität des Wissens tatsächlich Leben retten oder gefährden kann, zeigt derzeit der Krieg in der Ukraine. Westliche Russland-Beobachter hatten die Absichten des Kremls vielfach falsch eingeschätzt. Die Politik in Europa und den USA war in keiner Weise auf einen Angriff dieser Größenordnung vorbereitet.
Auch ein allzu vereinfachtes Chinabild führe zu Unverständnis in der Wissenschaft und Unvermögen in der Politik, so Lin. Ein Beispiel: Nicht wenige haben nach Russlands Einmarsch in der Ukraine nur die Tage gezählt, bis China gewaltsam Taiwan erobert. Für Lin eine undifferenzierte Schlussfolgerung. Denn Chinas Politik gegenüber Taiwan richte sich zunächst nur nach der Situation vor Ort. Und da zeigt sich derzeit keine Konstellation, die einen Einmarsch vereinfachen würde.
Dennoch betont Lin: China beobachte den Krieg in der Ukraine genau und zieht seine Schlüsse. Eine genaue Beobachtung der Lage in Taiwan täte dabei auch den Außenpolitikern in westlichen Hauptstädten gut. Auch das ist Teil eines realistischen Verständnisses der Lage. “Wir dürfen die Widerstandskraft der Taiwaner nicht unterschätzen und sollten mehr für deren Verteidigung und Ausbildung tun”, so Lin.
Lin stammt aus Beverly Hills – allerdings aus einem Ort dieses Namens im US-Bundesstaat Michigan im Norden der USA, nicht aus der ungleich berühmteren Stadt in Kalifornien. China spielte in ihrem Leben schon früh eine Rolle: Die amerikanische Autoindustrie in der Region hat viel nach China exportiert – und ihr Vater hat dabei mitgeholfen. Mit Michigans wirtschaftlichem Niedergang verschwanden jedoch auch die Verbindungen zum chinesischen Markt.
Das Handwerk als China-Beobachterin hat Lin von Grund auf gelernt. Nach Studium und Promotion machte sie sich zunächst bei der Rand Corporation einen Namen, einer Denkfabrik des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Ihr Fachgebiet waren da bereits die Geostrategien rund um China und Taiwan.
Wegen Chinas aggressiverem, außenpolitischen Kurs unter Xi Jinping ist Lins Expertise gefragter denn je. Sie sammelt und filtert Informationen und erstellt daraus Analysen und Prognosen. Lin glaubt: Wer das Handeln des Landes vorausahnen will, muss sich in Chinas Rolle hineinversetzen. Ein Ansatz, der aus der Erstellung von Kriegs-Szenarien kommt und zusammen mit einem guten Verständnis für die Geschichte des Landes und aktuellen Daten zuweilen erstaunlich exakte Erkenntnisse liefert.
Bezogen auf die Ukraine hat sich Lin bereits ein klares Urteil gebildet: “China wollte diesen Krieg nicht, konnte ihn aber auch nicht verhindern. Jetzt versucht China, die eigenen Kosten zu senken.” Peking müsse sich jedoch mittelfristig zwischen dem Westen und Russland entscheiden, ob es wolle oder nicht. Die Chinesen fürchten sich durchaus vor westlichen Sanktionen. Und China lerne am Beispiel Russlands, dass Macht allein nicht ausreicht, um eine Weltmacht zu sein. Denn dafür braucht man nicht nur Stärke, sondern auch Respekt, Legitimität und Anerkennung. Nach innen wie nach außen. Jonathan Lehrer
Martin Kruessmann ist seit Mai Senior VP Project Manager China bei Bosch Rexroth. Der promovierte Maschinenbauingenieur verfügt über China-Erfahrung im internationalen F+E-Management. Zuvor war er als Senior VP Engineering & Board Member Mobile Hydraulic für Bosch Rexroth in Ulm-Elchingen tätig.
Wang Liang wurde nun endgültig zum neuen Chef der China Merchants Bank ernannt. Er hat den Chefposten seit April kommissarisch geführt, nachdem sein Vorgänger, Tian Huiyu, wegen Korruptionsgerüchten von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Die Luftstreitkräfte Chinas und Russlands haben am Dienstag eine gemeinsame Luftpatrouille über dem Japanischen und Ostchinesischen Meer sowie dem Westpazifik durchgeführt. Zum Einsatz kamen auch Langstreckenbomber. Es handelt sich um die erste gemeinsame Militärübung seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine. Auch in den vergangenen drei Jahren wurden solche Patrouillen durchgeführt, allerdings zu späteren Zeitpunkten im Jahr.
wieder und wieder tauchen neue Berichte über die schreckliche Situation in den Lagern in Xinjiang auf. Am Dienstag veröffentlichte ein internationaler Medienverbund neues, brisantes Material. Dazu gehören Tausende Häftlingsfotos und authentische Aufnahmen aus den Gefängnissen, aber auch Details zum Schießbefehl und den Folterwerkzeugen. Das Leak belegt auch: Der Betrieb der Lager ist von Peking aus angeordnet und nicht etwa eine Idee örtlicher Kader.
Es folgte ein Aufschrei besorgter Bundespolitiker: Außenministerin Annalena Baerbock forderte von China eine Aufklärung der “schwersten Menschenrechtsverletzungen”. “Samtpfötigkeit” aufgrund unserer wirtschaftlichen Interessen dürfe es nicht geben, sagte Finanzminister Christian Lindner. Er mahnt dazu, die KP mehr auf die Menschenrechtslage anzusprechen.
Doch reicht das? Während die Merkel-Regierungen sich rühmten, die Probleme hinter den Kulissen ernsthaft “anzusprechen”, wurden die Lager überhaupt erst errichtet. In Xinjiang wird heute nach allem, was wir wissen, eine komplette Bevölkerungsgruppe total überwacht, große Teile werden zur Umerziehung in Lager gesteckt. Die Uiguren dürfen keine Uiguren mehr sein, so die fixe Idee der Verantwortlichen in Peking. Die mahnenden Worte westlicher Politiker haben sie nicht von ihrer Umsetzung abgehalten.
Neben der Diplomatie gibt es andere Anstrengungen, um Menschenrechte durchzusetzen. Doch auch die geplanten Lieferketten-Gesetze werden kaum wirken. Chinesische Solar-Unternehmen verlagern ihre Produktion zunehmend in Regionen außerhalb Xinjiangs. Die Exporte und internationalen Lieferketten wären also scheinbar sauber. Für den Heimatmarkt greifen die Solar-Hersteller Experten zufolge jedoch weiterhin auf Vorprodukte aus Xinjiang zurück, die Berichten zufolge von uigurischen Zwangsarbeitern hergestellt werden.
Die große Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China sei vor dem Hintergrund der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang “besonders bedrückend”, sagt Christian Lindner. Mindestens genauso bedrückend: wie spät die deutsche Politik ihr Umdenken gegenüber China einleitet. Eine frühe Verringerung der Abhängigkeit hätte vielleicht kurzfristig manchen Milliardengewinn eines Dax-Konzerns gedämpft. Dafür hätte sich aber langfristig ein Teil der Abhängigkeit gar nicht herausgebildet, die jetzt unternehmerisch und geopolitisch zur Belastung wird.


Zum Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hatten sich die chinesischen Gastgeber ein besonders spitzfindiges Geschenk ausgedacht. Außenminister Wang Yi überreichte der Chilenin eine englischsprachige Fassung von Staatschef Xi Jinpings “Respekt und Schutz der Menschenrechte” – eine Sammlung von Reden und Essays des Parteichefs. Die medial in Szene gesetzte Übergabe, die das Außenamt plakativ über soziale Medien in der Welt verbreitete, bekam nur wenige Stunden später eine hochgradig zynische Fußnote.
Kaum hatte Bachelet die Gelegenheit, in dem Werk zu blättern, da veröffentlichte ein Konsortium von 14 internationalen Medien aus elf Ländern, darunter das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und der Bayerische Rundfunk, das Resultat einer wochenlangen Recherche namens Xinjiang Police Files. Tausende Fotos, vertrauliche Dokumente und umfangreiche Datensätze liefern darin neue Beweise für das brutale Vorgehen chinesischer Behörden gegen muslimische Uiguren in der autonomen Region Xinjiang.
Die Dateien werfen ein Licht auf die Kriminalisierung und Folterungen von Uiguren in Internierungslagern. Sie entlarven die chinesische Darstellung der Camps als Ausbildungszentren, die freiwillig besucht würden, als falsch. Fotos zeigen Gefangene, die in Handschellen und Fußfesseln durch die Gänge eines Lagers laufen. Zudem offenbaren als vertraulich klassifizierte Reden von hochrangigen Politikern aus dem Staatsrat und der Provinz die unmittelbare Verstrickung des engsten chinesischen Führungszirkels in den Aufbau eines Systems der Umerziehung, das mit Waffengewalt und dauerhaften Verletzungen von Menschenrechten durchgesetzt wird.
Die Dokumente, die von Polizeiservern in Xinjiang stammen und dort gehackt wurden, waren zunächst dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz zugespielt worden. Zenz offenbarte bereits in der Vergangenheit mit “innovativer Pionierarbeit” das Ausmaß der vermeintlichen Anti-Terror-Kampagne. Die beteiligten Medien prüften in der Folge in Kleinarbeit die Echtheit der Dokumente.
“Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Dokumente authentisch sind. Dass es sich angesichts des Umfangs um einen sogenannten Deep Fake handelt, ist sehr unwahrscheinlich”, sagt der Sinologe Björn Alpermann von der Universität Würzburg, der seinerseits zu den Vorgängen in Xinjiang forscht. Alpermann hält die Dateien für einen wichtigen Baustein, um die Vorgänge in Xinjiang beurteilen zu können. Sie bestärken zahlreiche Augenzeugenberichte von ehemaligen Inhaftierten.
Besondere Relevanz erhalten die Abschriften von Reden des Ministers für Staatssicherheit, Zhao Kezhi, aus dem Jahr 2018, und dem früheren Parteisekretär in Xinjiang, Chen Quanguo, von 2017. Daraus ergibt sich nachweislich die unmittelbare Kenntnis und Verstrickung der Parteispitze um Xi Jinping in den signifikanten Ausbau von Hafteinrichtungen auf eine große Kapazität. Mehrere Millionen Menschen könnten in den Lagern Platz finden.
Es zeigt zudem auf, dass Rechtsstaatlichkeit bei der Inhaftierung keine Rolle spielt. Zhao sagte beispielsweise, dass für Manche fünf Jahre Haft nicht ausreichen würden für die Umerziehung. “Sobald sie wieder rausgelassen werden, tauchen die Probleme wieder auf. Das ist die Realität in Xinjiang.” Chen seinerseits forderte die Wachen in den Lagern dazu auf, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, wenn jemand versuche zu fliehen.
Entsprechend umfangreich fallen die Strafen gegen Uiguren aus, wie die Police Files belegen. Für Verdachtsmomente, die nicht einmal eine Straftat bedeuten, wie das Lesen religiöser Schriften, das Tragen eines Bartes oder das Predigen muslimischer Glaubenssätze, wurden Urteile von weit über zehn Jahren ausgesprochen. Rechtlich verurteilte Uiguren oder Mitglieder anderer muslimischer Minderheiten sind jedoch in regulären Haftanstalten untergebracht, nicht in den Internierungslagern.
Weil die Haftgründe vornehmlich auf dem Misstrauen und der Willkür chinesischer Sicherheitskräfte beruhen (China.Table berichtete), war der Bedarf an Lagerplätzen und Gefängniszellen teilweise deutlich größer als der Bestand. Auch diesen Aspekt brachte Minister Zhao in seiner Rede zur Sprache. Es sei Xi Jinpings “wichtigen Anweisungen” zu verdanken, dass mit entsprechender Finanzierung neue Einrichtungen gebaut oder bestehende ausgebaut werden könnten. “Die Dokumente belegen einen direkten Bezug zum Ständigen Ausschuss des Politbüros und zum Parteichef. Unter diesen Umständen ist ein Abstreiten von chinesischer Seite nicht glaubwürdig”, sagt Sinologe Alpermann.
Außenminister Wang hatte bei seinem Treffen mit UN-Kommissarin Bachelet noch die Hoffnung geäußert, der Besuch der Menschenrechtsbeauftragten könnte helfen, vermeintliche “Falschinformationen” über Xinjiang als solche zu entlarven. Er warf “ausländischen Kräften” eine “Schmierkampagne” gegen seine Regierung vor. Die Veröffentlichung der Xinjiang Police Files dürfte deshalb nicht ganz zufällig pünktlich zum Besuch Bachelets in China geschehen sein. Sie vermindert die Wirkungskraft chinesischer Propaganda, die versuchen wird, die Reise der UN-Kommissarin als Beleg für die vermeintlichen Falschinformationen zu instrumentalisieren.
Dass China stattdessen seine Strategie des Abstreitens wird justieren müssen, lassen erste Reaktionen auf die neuen Beweise erahnen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verlangte Aufklärung von China, ebenso Finanzminister Christian Lindner (FDP), der zudem über Twitter forderte: “Samtpfötigkeit aufgrund unserer wirtschaftlichen Interessen darf es nicht geben.”
Der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer brachte ebenso wie die frühere menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Margarete Bause, weitere Sanktionen gegen die Volksrepublik ins Spiel. “Es braucht jetzt weitere EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen dieser Verbrechen und einen grundlegenden Kurswechsel in der deutschen Chinapolitik”, so Bause. Michael Brand, menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, findet deutliche Worte: “Das Regime in China hat endgültig sein Gesicht verloren. Wenn wir nur zuschauen, werden wir mitschuldig an der langsamen Auslöschung eines Volkes. Es braucht klare Signale, und das sind Sanktionen”.
Auch die Trägerin des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises, Sayragul Sauytbay, wendete sich mit Sanktionsforderungen an die internationale Gemeinschaft. “Neben Augenzeugenberichten ist dieses Material eine zweite wichtige Beweisquelle. Sie reichen aus, um die Verbrechen der KPCh gegen die Menschlichkeit zu beweisen. Wenn die internationale Gemeinschaft diesen Völkermord wirklich stoppen will, ist dies der Auslöser für ihr wirksames Handeln”, sagte sie zu China.Table. Sie sei überzeugt, dass die Xinjiang Police Files die politischen Entscheidungen beeinflussen werden.

Vergangene Woche hat das von der Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) entwickelte Zivil-Großflugzeug C919 einen wichtigen bemannten Test bestanden. Während des dreistündigen Fluges seien alle geplanten Aufgaben ausgeführt worden. Das Flugzeug war “voll leistungsfähig” und sei sicher gelandet, schreiben die Staatsmedien.
Ihren Jungfernflug hatte die C919 bereits im März 2017. Bislang wurde das Flugzeug von der chinesischen Civil Aviation Administration of China (CAAC) aber noch nicht als einwandfrei flugfähig eingestuft. Nach der jüngsten Testflug-Zertifizierung soll dieses Ziel nun aber in greifbare Nähe gerückt sein. Bislang wurden sechs C919 hergestellt, die nun in die finale Testflugphase eintreten.
Laut Wu Yongliang, dem stellvertretenden Generaldirektor von Comac, könnte der Flieger bereits dieses Jahr an Kunden ausgeliefert werden. Immerhin 815 Bestellungen seien bereits bei dem Flugzeugbauer eingegangen, meldet das Unternehmen. Der Großteil davon stammt aus China.
Im März 2021 hatte China Eastern den weltweit ersten Auftrag zum Kauf von fünf C919 erteilt, die auf mehreren inländischen Routen wie Peking, Guangzhou und Shenzhen eingesetzt werden sollen. Aber es gibt auch Interesse aus dem Ausland. Ryanair-Chef Michael O’Leary hatte bereits vor zehn Jahren verkündet, dass er an einer Zusammenarbeit mit Comac interessiert sei. Dass das Passagierflugzeug ein ernstzunehmender Konkurrent für Airbus und Boeing wird, bezweifelt kaum ein Luftfahrt-Experte. Peking wird alles Nötige tun, um die heimische Firma in den Markt zu hieven.
China setzt große Hoffnungen in sein erstes selbst entwickeltes Verkehrsflugzeug, das über 158 bis 168 Sitzplätze verfügt und 4.075 Kilometer weit fliegen kann. Doch die Entwicklung hin zur Marktreife, die bereits 2008 begann, geht nach wie vor nur schleppend voran. Der Auslieferungsstart war zunächst für 2016 angekündigt, dann für 2021. Und wie nun bekannt wurde, wird das Flugzeug doppelt so viel kosten wie eigentlich geplant.
Aus einer am Dienstag an der Shanghaier Börse eingereichten Meldung geht hervor, dass jeder Jet für einen Preis von 653 Millionen Yuan (99 Millionen US-Dollar) Listenpreis angeboten wird. Damit liegt der eigentlich als günstige Alternative angekündigte C919 fast in der gleichen Größenordnung wie der Airbus A320neo mit einem Listenpreis von 111 Millionen US-Dollar und die Boeing 737 Max mit einem Listenpreis von 117 Millionen US-Dollar.
Dabei wollte Comac vor allem mit dem Preis das internationale Duopol von Airbus und Boeing brechen. Allerdings ist es viel zu früh, um den realen Marktpreis des C919 mit ihren Wettbewerbern zu vergleichen. Nachlässe und günstige Finanzierungen können den realen Kaufpreis noch verändern. Die Stunde der Wahrheit kommt vor allem dann, wenn die ersten Secondhand-Maschinen gehandelt werden.
Klar ist aber: Da der Comac-Flieger nicht fortschrittlicher ist als seine Wettbewerber, und da Comac noch nicht als Marke etabliert ist, muss die Maschine über einen günstigen Preis verkauft werden. Das gilt vor allem für den Erfolg auf dem internationalen Markt. In China selbst kann der Staat verordnen: Chinesen kaufen chinesisch. So wie das jüngst bei Computern gemacht wurde (China.Table berichtete). Da die Fluglinien des Landes sich mehrheitlich in Staatshand befinden, hat Peking hier erheblichen Einfluss.
Die Preisnachlässe haben allerdings Grenzen, da die chinesischen Flugzeuge noch immer stark von ausländischen Zulieferern abhängig sind. Die Triebwerke stammen etwa vom französisch-amerikanischen Hersteller CFM. Laut einem Bericht des Center for Strategic & International Studies, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, sollen sogar 60 Prozent der Hauptlieferanten des C919 amerikanische Unternehmen wie General Electric und Honeywell sein.
Weitere wichtige Zulieferer sind Liebherr-Aerospace oder der österreichische Hersteller FACC. Er ist seit 2009 im Besitz des chinesischen Flugzeugbauers Xi’an Aircraft Industrial Corporation (XAC) und produziert Kunststoff-Leichtbaukomponenten. Sogar Boeing und Airbus liefern zu.
Die internationale Verflechtung macht Comac anfällig für Sanktionen. Laut einem Bericht der South China Morning Post haben Trumps verschärfte Exportkontrollen gegenüber chinesischen Unternehmen massiv zu den Verspätungen in der Entwicklung beigetragen.
China ist der größte Flugzeugmarkt der Welt. Experten schätzen, dass die Volksrepublik in den kommenden beiden Jahrzehnten 4.300 neue Flugzeuge im Wert von 480 Milliarden US-Dollar benötigt. Das klingt zunächst nach einer guten Nachricht für Airbus und Boeing. Im Frühjahr 2018 beschloss Peking zudem, die Begrenzung für ausländische Beteiligungen beim Bau von Flugzeugen in China fallen zu lassen. Ein kluger Schachzug. Damit lockt China die ausländischen Hersteller noch tiefer in seinen Markt und macht sie noch abhängiger.
Allein 2021 hat Airbus 142 neue Flugzeuge an China geliefert. An dem Tag, an dem Peking in der Lage ist, Boeing- und Airbus-Flugzeuge in China in großen Stückzahlen durch die C919 zu ersetzen, wird sich das Spiel drehen. Vielleicht werden Boeing und Airbus dann immer noch Rekordabsätze verzeichnen, weil der chinesische Markt so rasant wächst. Ihre Marktanteile und Margen werden jedoch schrumpfen.
Das werden dann auch die Mitarbeiter in Hamburg merken. Dort befindet sich neben Toulouse der wichtigste Airbus-Standort in Europa. Wie die neue Welt in der Flugzeugindustrie aussieht, konnte man bereits Mitte Mai beobachten: China Eastern kündigte an, neues Kapital aufzunehmen, um Flugzeuge im Wert von einem Listenpreis von rund 4,38 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Auf der Shoppingliste stehen: vier Comac C919, 24 Comac ARJ21-700 Regional-Jets, sechs Airbus A350-900 und nur vier Boeing 787-9. Die Bestellungen im Inland überwiegen hier also zahlenmäßig schon bei Weitem.
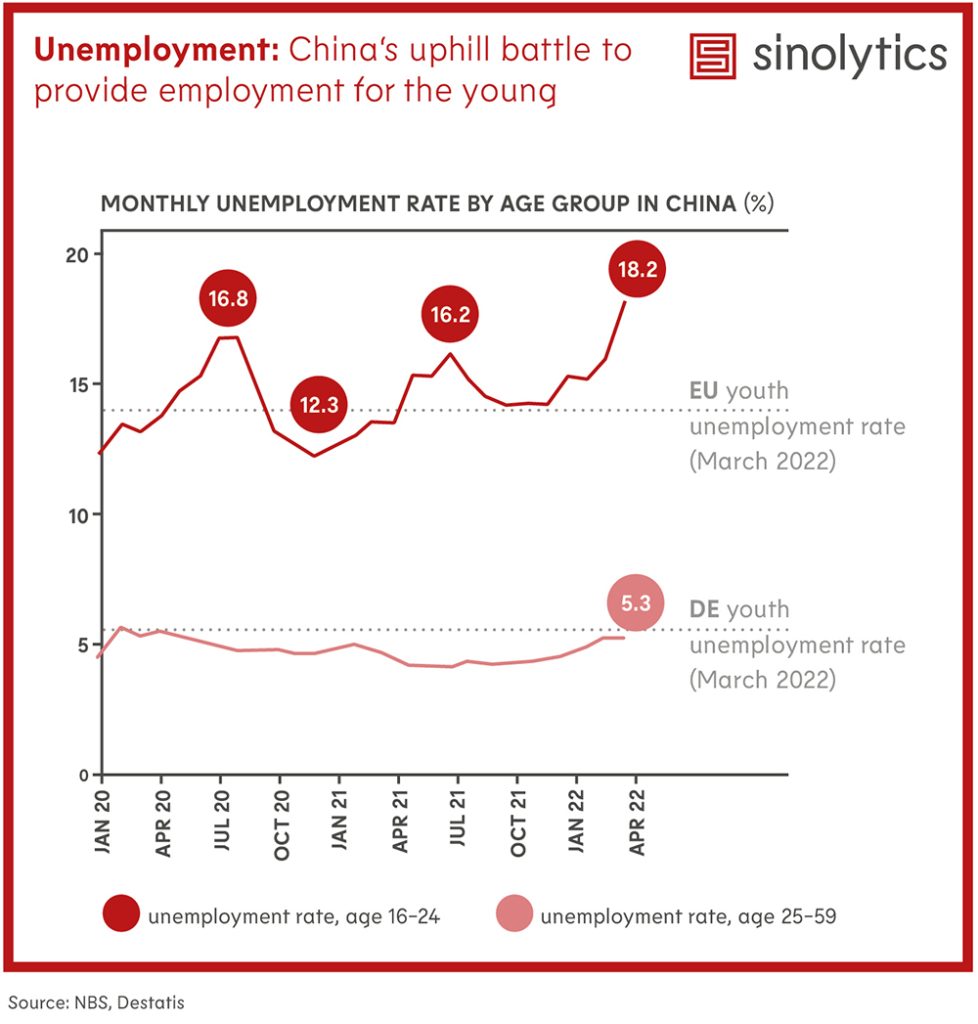
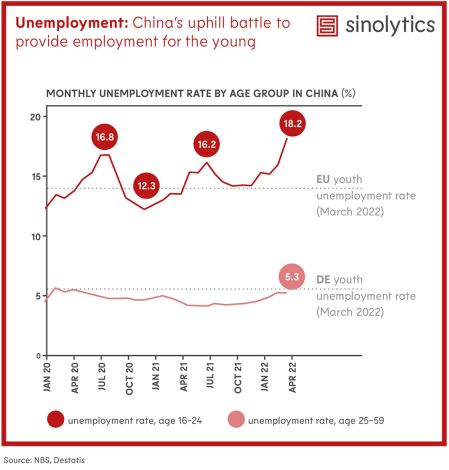
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.
30.05.2022, 9:00-12:00 Uhr (MEZ)
Hannover Messe / Hybrid: Eröffnung Messestand “Invest in China” + Forum Deutsch-Chinesische Intelligente Produktion Mehr
30.05.2022, 9:00-16:30 Uhr (MEZ)
Rödl & Partner / Seminar: Arbeitsrecht China Mehr
30.05.2022, 10:00-11:00 Uhr (MEZ) 16:00-17:00 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: Tax Updates for SMEs: 2022 Tax Regulations and Profit Repatriation Strategies Mehr
30.-31.05.2022, 9:00-17:30 Uhr (MEZ) / 9:00-13:30 Uhr (MEZ)
Leibniz Association / Hybrid/ Präsenz: Managing Tech Cooperation with Chinese Partners: Challenges and Responses Mehr
31.05.2022, 9:00-10:30 Uhr (MEZ)
China Team / Webinar: Von Whistleblowern und Hinweisgebersystemen Mehr
31.05.2022, 9.30 Uhr (MEZ) / 15:30 Uhr Beijing Time
Dezan Shira / Webinar: Training Program on IP Protection Through Customs Mehr
31.05.2022, 9:30-12:00 Uhr (MEZ)
CIPA / Hybrid: Ningbo (Germany) Special Investment Cooperation and Exchange Meeting Mehr
31.05.2022, 10:00-11:30 Uhr (MEZ) / 16:00-17:30 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: China’s Machinery Sector: Entry Strategy, Localisation Trend and Talent Recruitment Mehr
31.05.2022, 19:00-20:00 Uhr (MEZ)
Konfuzius Institut Heidelberg / Vortrag: Early Chinese Periodicals Online (ECPO) – ein Projekt stellt sich vor Mehr
01.06.2022, 18:30-19:30 Uhr (MEZ) Historisches Kaufhaus Freiburg
Konfuzius-Institut Freiburg / Präsenz: Wandel durch Handel? Die schwierige Existenz chinesischer Händler in afrikanischen Gesellschaften Mehr
01.-02.06.2022; 9:00-17:00 Uhr (MEZ) Zeppelin-Univeristät
CIDW / Seminar: Erfolgreiche Geschäfte machen in China Anmeldung
Tesla will Tausende Arbeiter in stillgelegten Fabriken und einem alten Militärlager in der Nähe der Tesla-Fabrik in Shanghai isolieren. Die Arbeiter werden von der Außenwelt abgeschnitten, um Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern. Die Maßnahme dient dazu, eine zweite Arbeitsschicht in der Fabrik zu etablieren. Aus Platzmangel werden sich die Arbeiter in den behelfsmäßigen Schlafsälen jedoch die Betten teilen müssen, wie Bloomberg berichtet. Während die Tagschicht arbeitet, soll die Nachtschicht schlafen. Nachts soll dann die Tagschicht in den gleichen Betten übernachten, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren hat.
Zuvor gab es Berichte, dass Tesla leerstehende staatliche Isolationszentren nutzen wolle, um die Arbeiter unterzubringen. Die stillgelegten Fabriken und das militärische Trainingslager seien aber praktikabler, so eine der Quellen gegenüber Bloomberg.
In China arbeiten derzeit zahlreiche Unternehmen in sogenannten Closed Loop-Systemen. Trotz der Bemühungen, Ansteckungen zu verhindern, kam es innerhalb der isolierten Arbeiterschaft in wiederholten Fällen zu Ansteckungen. Teilweise wurden die infizierten Arbeiter dabei nicht voneinander isoliert. Zudem gab es Berichte, dass Tesla 12-Stunden-Schichten an sechs Tagen die Woche verordnet hatte. Auch in China widersprechen solche Bedingungen dem Arbeitsrecht. Laut Experten der Arbeitsrechtsorganisation China Labour Bulletin haben die Behörden das Arbeitsrecht für die Closed Loop Systeme jedoch ausgesetzt (China.Table berichtete). nib
Der Aktivist und ehemalige Hongkonger Rechtsprofessor Benny Tai wurde am Dienstag wegen illegaler Wahlausgaben zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Dem 57-jährigen wird vorgeworfen, im Jahr 2016 mit einem Betrag von 253.000 Hongkong-Dollar (32.200 US-Dollar) mehrere Zeitungsanzeigen in Auftrag gegeben zu haben, die pro-demokratische Wahlkandidaten unterstützten.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Anzeigen gegen Hongkonger Wahlgesetze verstießen, und die Wahl unangemessen beeinflusst hätten, da Tai selbst kein Kandidat war. Tai erklärte sich schuldig, wodurch die Strafe von 18 auf zehn Monate verkürzt wurde. Bereits im April hatte Tais Anwalt erklärt, dass es sich um eine transparente Wahlstrategie gehandelt habe.
Laut einem neuen Bericht des Hong Kong Democracy Council wurden seit 2019 rund 10.200 Menschen in der Sonderverwaltungszone wegen politischer Verbrechen festgenommen, und fast 3.000 strafrechtlich verfolgt. Mitte Mai befanden sich 1.014 politische Gefangene in Hongkonger Gefängnissen, darunter Demonstranten, Journalisten, Lehrer, Anwälte und Gewerkschaftsführer. Nur noch in Belarus, Burma und Kuba wachse die Zahl politischer Gefangener derart schnell, so der Bericht. fpe
Airbnb will ab dem 30. Juli in China keine Unterkünfte oder “Experiences” mehr anbieten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das 2008 in San Francisco gegründete Unternehmen war seit 2015 in China aktiv. Seitdem bediente Airbnb dort um die 25 Millionen Kunden. Buchungen in der Volksrepublik machten zuletzt aber nur ein Prozent der weltweiten Buchungen aus. Als Grund gilt neben der Pandemie auch eine wachsende Zahl heimischer Konkurrenten, allen voran die Anbieter Tujia und Xiaozhu.
Im Mai 2020 hatte AirBnb etwa 25 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen müssen, da die weltweite Nachfrage nach Unterkünften drastisch gesunken war. 150.000 gelistete Wohnungsangebote werden nun von AirBnb in China gelöscht. Nutzer aus China sollen jedoch weiterhin über die Plattform Unterkünfte im Ausland buchen können. Der Outbound-Tourismus verspreche durch speziell auf chinesische Kunden zugeschnittene Angebote höhere Umsätze, erklärt das Unternehmen. Ein Büro in Peking soll das Geschäft weiter koordinieren. fpe
Die USA, Japan, Indien und Australien wollen ihre Kooperation mit pazifischen Inselstaaten ausbauen. Die sogenannte Quad-Gruppe beschloss am Dienstag auf einem Gipfeltreffen, die Zusammenarbeit in ökonomischen Fragen, bei der maritimen Sicherheit und der Anpassung an den Klimawandel zu verstärken. Konkret wurde beispielsweise eine satellitengestützte Initiative beschlossen, um gegen illegale Fischerei und chinesische Seemilizen vorzugehen, wie die Financial Times berichtet. Es gehe darum, die Fähigkeiten der Anrainer zu verbessern, damit sie “wissen, was in den Hoheitsgewässern und den ausschließlichen Wirtschaftszonen geschieht”, wird ein US-Beamter zitiert.
Derweil hat Chinas Außenministerium Besuche des Außenministers in einige Länder der Region angekündigt. Zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juni wird Wang Yi acht pazifische Inselstaaten besuchen. Dazu gehören die Salomonen, mit denen China kürzlich einen Sicherheitspakt geschlossen hat. Ebenso sind Besuche in Papua-Neuguinea, Ost-Timor, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga und Vanuatu geplant. Laut Berichten der Financial Times plant China auch ein Sicherheitsbündnis mit Kiribati.
Die USA verstärken parallel ihre Kommunikationsoffensive bezüglich China. Am Donnerstag will Außenminister Antony Blinken die China-Strategie seines Landes in einer Rede auf einer Veranstaltung der Asia Society darlegen. Eigentlich wollte Blinken die Rede schon Anfang Mai halten, doch er zog sich Covid-19 zu. nib
Die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt werden sich Ökonomen zufolge in diesem Jahr verschärfen. Die durchschnittlichen Immobilienpreise dürften im ersten Halbjahr um 1,3 Prozent fallen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Reuters-Umfrage unter Analysten und Ökonomen hervorgeht. Für das gesamte Jahr sehen sie eine Stagnation voraus. Die Immobilienverkäufe dürften demnach 2022 um zehn Prozent einbrechen. Zugleich gehen die Experten davon aus, dass die Investitionen in der Branche um 2,5 Prozent fallen werden.
Der einst boomende Immobilienmarkt hat jahrelang den Aufschwung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gestützt. Probleme tauchten bereits im vergangenen Jahr auf, als die Krise um den hoch verschuldeten Immobilien-Konzern Evergrande akuter wurde und die Behörden die Kreditaufnahme von Bauträgern einschränkte. Seit Anfang dieses Jahres haben mehr als 100 Städte Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage ergriffen – etwa durch niedrigere Hypothekenzinsen, geringere Anzahlungen und Subventionen.
Ob das ausreicht, um den Markt wieder in Schwung zu bringen, ist ungewiss. Viele der großen Immobilienentwickler sind überschuldet und haben um Aufschub bei der Zahlung von Anleihen im In- und Ausland gebeten. Auch die Corona-Lockdowns in Metropolen wie der Hauptstadt Peking und dem Wirtschaftszentrum Shanghai drücken die Nachfrage. Peking verlängerte für viele seiner 22 Millionen Einwohner die Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus. Restaurants und Fitnessstudios wurden in der Hauptstadt bereits geschlossen. Shanghai will den zweimonatigen Lockdown in der ersten Junihälfte aufheben.
Die Pandemie hat sich auf den Immobilienmarkt von Shanghai ausgewirkt, da Bauträger und Makler ihre Aktivitäten einstellten und viele Einwohner unter Quarantäne standen, sagt Analyst Wang Xiaoqiang vom Immobiliendatenanbieter Zhuge House Hunter. Das habe zu einem starken Rückgang der Immobilienverkäufe geführt. Nur landesweite Maßnahmen zur Lockerung der Finanzierungsbeschränkungen und Maßnahmen wie die Sanierung von heruntergekommenen Vierteln könnten den Immobilienmarkt stabilisieren, sagte Liu Yuan, der Leiter der Forschungsabteilung bei Chinas größtem Immobilienmakler Centaline. rtr/nib
Aufgrund hoher Rohstoffpreise und der Einhaltung der Klimaziele haben zwei Provinzen die Strompreise für Industriebetriebe erhöht. In Jiangsu sind 30 Unternehmen betroffen, die ihre Energie-Effizienz-Ziele nicht erreicht oder altes Equipment benutzt haben. Sie müssen bald sieben Cent pro Kilowattstunde mehr zahlen. In Zhejiang sollen 600 Unternehmen aus Energie-intensiven Branchen wie Zement, Metalle und Glas umgerechnet circa 2,5 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen. Die Erhöhung ist laut Bloomberg erforderlich, um die steigenden Kosten der Gas-Kraftwerke der Provinz zu decken.
Durch den Anstieg der Energiepreise auf dem Weltmarkt könnten Kraftwerke in China in naher Zukunft wieder in finanzielle Notlage geraten. Schon im letzten Jahr konnten viele Kohlekraftwerke nicht mehr profitabel wirtschaften. Der Preis für Kohle war zu hoch und da die Strompreise staatlich festgelegt waren, hatten die Kraftwerke Verluste eingefahren. Es kam zu einer Stromkrise, die Monate anhielt. Danach wurde der staatliche Strompreis angepasst, sodass die Provinzen ihn in gewissem Rahmen erhöhen dürfen.
Um die Klimaziele des Landes erreichen zu können, wurden einige Preisobergrenzen komplett aufgehoben. Die größten Klima-Verschmutzer könnten in naher Zukunft mit starken Preisanstiegen zu rechnen haben. Ob weitere Provinzen den Beispielen folgen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Nach der Stromkrise des letzten Jahres hat China die einheimische Kohleförderung ausgeweitet und die Kraftwerke aufgerufen, die Lager frühzeitig zu füllen. Aufgrund von Umweltregulierungen und Minenunglücken ist es jedoch unwahrscheinlich, dass China die selbstgesteckten Ziele zur Ausweitung der Kohleproduktion erreicht. nib
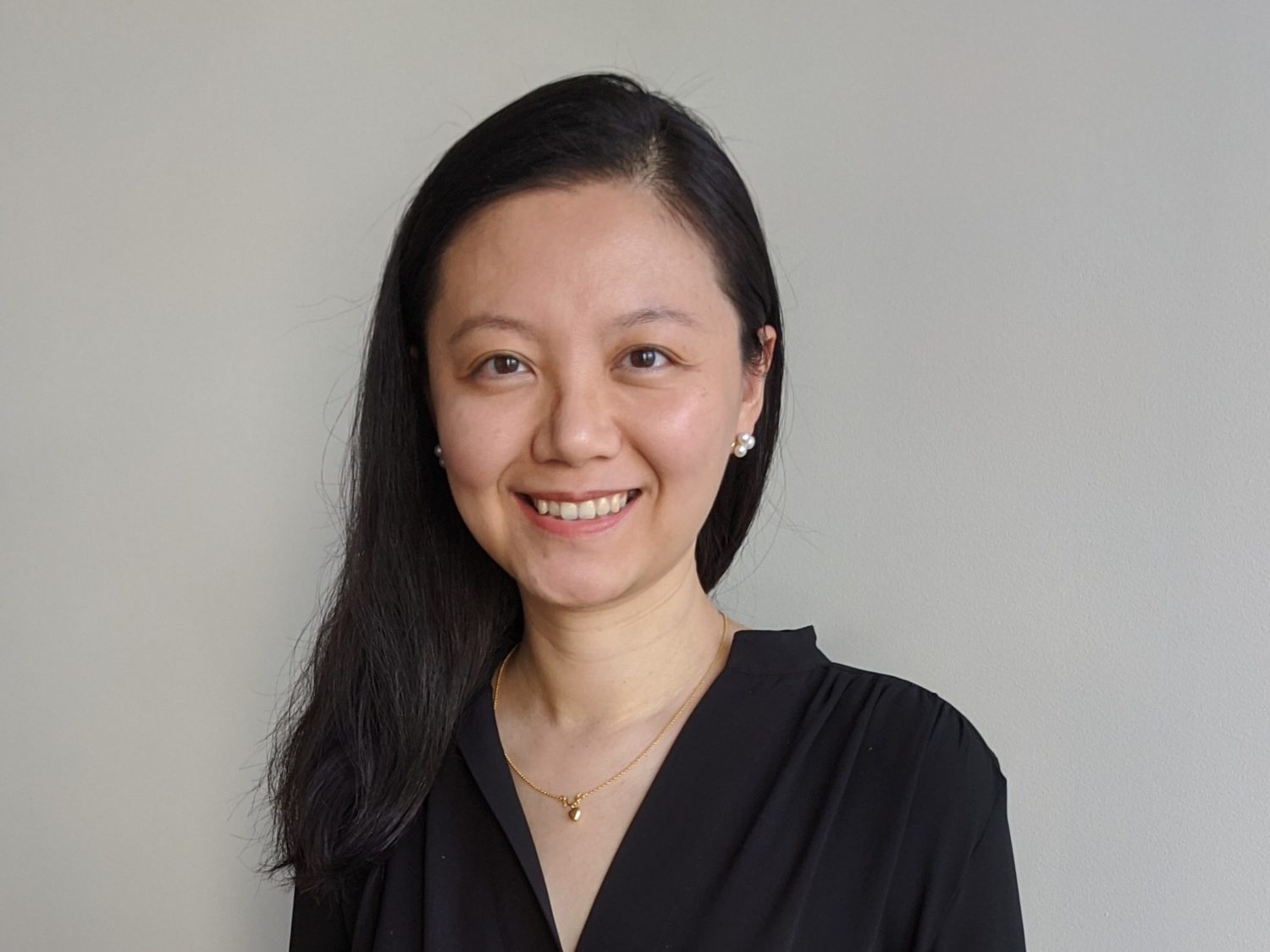
Bonny Lin will Leben retten. Nach der High School hatte die US-Amerikanerin eigentlich geplant, Ärztin zu werden. Stattdessen wurde sie China-Analystin – einen Widerspruch sieht sie darin nicht: “Als Ärztin kannst du zwei bis drei Leben pro Tag retten. Aber schon kleine Änderungen in der Politik können das Leben von tausenden Menschen verändern”, erklärt sie gegenüber China.Table.
Lin leitet mit dem China Power Projekt ein weltweit renommiertes Institut für Chinaforschung, das dazu beitragen will, die technologische, kulturelle, wirtschaftliche, militärische und soziale Macht Chinas zu verstehen. Das Projekt ist am Center for Strategic and International Studies in Washington angesiedelt, einem führenden US-Thinktank. Lin setzt sich dort vehement für ein fakten- und datenbasiertes Chinaverständnis ein. Das verlange der ethische Anspruch, den sie ihrer Arbeit zugrundelegt.
Wie die Qualität des Wissens tatsächlich Leben retten oder gefährden kann, zeigt derzeit der Krieg in der Ukraine. Westliche Russland-Beobachter hatten die Absichten des Kremls vielfach falsch eingeschätzt. Die Politik in Europa und den USA war in keiner Weise auf einen Angriff dieser Größenordnung vorbereitet.
Auch ein allzu vereinfachtes Chinabild führe zu Unverständnis in der Wissenschaft und Unvermögen in der Politik, so Lin. Ein Beispiel: Nicht wenige haben nach Russlands Einmarsch in der Ukraine nur die Tage gezählt, bis China gewaltsam Taiwan erobert. Für Lin eine undifferenzierte Schlussfolgerung. Denn Chinas Politik gegenüber Taiwan richte sich zunächst nur nach der Situation vor Ort. Und da zeigt sich derzeit keine Konstellation, die einen Einmarsch vereinfachen würde.
Dennoch betont Lin: China beobachte den Krieg in der Ukraine genau und zieht seine Schlüsse. Eine genaue Beobachtung der Lage in Taiwan täte dabei auch den Außenpolitikern in westlichen Hauptstädten gut. Auch das ist Teil eines realistischen Verständnisses der Lage. “Wir dürfen die Widerstandskraft der Taiwaner nicht unterschätzen und sollten mehr für deren Verteidigung und Ausbildung tun”, so Lin.
Lin stammt aus Beverly Hills – allerdings aus einem Ort dieses Namens im US-Bundesstaat Michigan im Norden der USA, nicht aus der ungleich berühmteren Stadt in Kalifornien. China spielte in ihrem Leben schon früh eine Rolle: Die amerikanische Autoindustrie in der Region hat viel nach China exportiert – und ihr Vater hat dabei mitgeholfen. Mit Michigans wirtschaftlichem Niedergang verschwanden jedoch auch die Verbindungen zum chinesischen Markt.
Das Handwerk als China-Beobachterin hat Lin von Grund auf gelernt. Nach Studium und Promotion machte sie sich zunächst bei der Rand Corporation einen Namen, einer Denkfabrik des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Ihr Fachgebiet waren da bereits die Geostrategien rund um China und Taiwan.
Wegen Chinas aggressiverem, außenpolitischen Kurs unter Xi Jinping ist Lins Expertise gefragter denn je. Sie sammelt und filtert Informationen und erstellt daraus Analysen und Prognosen. Lin glaubt: Wer das Handeln des Landes vorausahnen will, muss sich in Chinas Rolle hineinversetzen. Ein Ansatz, der aus der Erstellung von Kriegs-Szenarien kommt und zusammen mit einem guten Verständnis für die Geschichte des Landes und aktuellen Daten zuweilen erstaunlich exakte Erkenntnisse liefert.
Bezogen auf die Ukraine hat sich Lin bereits ein klares Urteil gebildet: “China wollte diesen Krieg nicht, konnte ihn aber auch nicht verhindern. Jetzt versucht China, die eigenen Kosten zu senken.” Peking müsse sich jedoch mittelfristig zwischen dem Westen und Russland entscheiden, ob es wolle oder nicht. Die Chinesen fürchten sich durchaus vor westlichen Sanktionen. Und China lerne am Beispiel Russlands, dass Macht allein nicht ausreicht, um eine Weltmacht zu sein. Denn dafür braucht man nicht nur Stärke, sondern auch Respekt, Legitimität und Anerkennung. Nach innen wie nach außen. Jonathan Lehrer
Martin Kruessmann ist seit Mai Senior VP Project Manager China bei Bosch Rexroth. Der promovierte Maschinenbauingenieur verfügt über China-Erfahrung im internationalen F+E-Management. Zuvor war er als Senior VP Engineering & Board Member Mobile Hydraulic für Bosch Rexroth in Ulm-Elchingen tätig.
Wang Liang wurde nun endgültig zum neuen Chef der China Merchants Bank ernannt. Er hat den Chefposten seit April kommissarisch geführt, nachdem sein Vorgänger, Tian Huiyu, wegen Korruptionsgerüchten von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Die Luftstreitkräfte Chinas und Russlands haben am Dienstag eine gemeinsame Luftpatrouille über dem Japanischen und Ostchinesischen Meer sowie dem Westpazifik durchgeführt. Zum Einsatz kamen auch Langstreckenbomber. Es handelt sich um die erste gemeinsame Militärübung seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine. Auch in den vergangenen drei Jahren wurden solche Patrouillen durchgeführt, allerdings zu späteren Zeitpunkten im Jahr.
