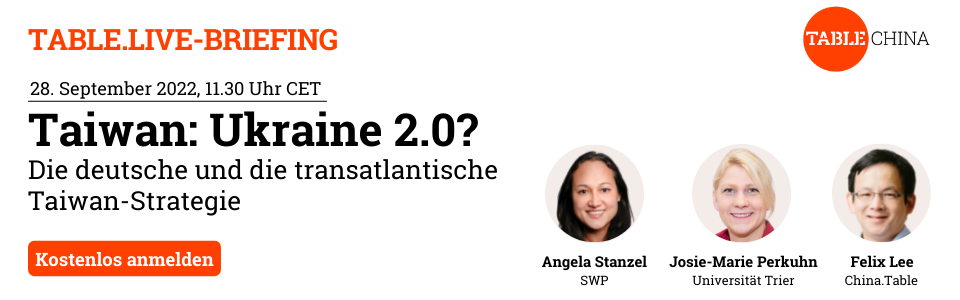die Treue Chinas zu Russlands war ohnehin wacklig. Statt handfester Unterstützung gab es aus Peking für Putin eher aufmunternde Worte. Sein Krieg soll den Westen ebenso schwächen wie Russland selbst, das sich zum Vasallen Chinas gemacht hat. Putin ist für Xi eben vor allem ein nützlicher Krawallmacher.
Doch am Samstag vor der UN-Hauptversammlung hat Außenminister Wang die russischen Verbündeten unverhohlen zur Mäßigung gemahnt. Der Hintergrund: Peking befürchtet ein Übergreifen der Instabilität auf die eigene Interessensphäre in Zentralasien, wenn Russland immer heftiger agiert. Außerdem werden die Kriegsfolgen wirtschaftlich immer schmerzhafter, berichtet Felix Lee.
In der vergangenen Woche liefen von Mittwoch bis Freitag Meldungen von sechs Verurteilungen hoher KP-Kader zu langen Haftstrafen auf Chinas Nachrichtenseiten. Jede einzelne davon liest sich wie Routine in der endlosen Antikorruptionskampagne, doch im Gesamtbild zeigt sich ein besonderes Muster: Alle sechs Männer standen einst an der Spitze des chinesischen Sicherheitsapparats. Die Propaganda unterstellt ihnen nicht nur Korruption, sondern ein Komplott; an der Spitze der Verschwörung soll Sun Lijun gestanden haben, der am Freitag zum Tode verurteilt wurde. Machthaber Xi Jinping säubert vor dem Parteikongress im Oktober sein Haus. Wer nicht bedingungslos loyal ist, muss um seine Freiheit fürchten.
Ein geradezu sensationelles Zeichen der Öffnung kommt aus Hongkong. Ankommende Reisende müssen nicht mehr in Quarantäne, sondern sollen selbstständig auf Krankheitszeichen achten. Verwaltungschef John Lee ist es offenbar gelungen, zumindest hier ein Stück Eigenständigkeit zu erkämpfen. Es bleibt das sehnsüchtige Hoffen auf eine Öffnung des Festlands.
Auf Twitter trendete in unserer Blase am Sonntag ein angeblicher Putsch gegen Xi Jinping. Es gibt jedoch nicht den geringsten seriösen Beleg, dass an diesem Gerücht etwas dran ist. Stattdessen folgen die angeblichen Beweise dem üblichen Skript einer Verschwörungstheorie. Auch 2012 gab es übrigens wilde Putschgerüchte vor dem Parteikongress, auf dem Xi Jinping dann wie angekündigt die Kontrolle übernahm. Im Oktober wird er aller Voraussicht nach in seiner Position bestätigt. Die neue Welle von Falschmeldungen zeigen nun vor allem, dass vor dem Polit-Großereignis die Nerven blank liegen.


Geschlossenheit gibt es nur selten bei den Vereinten Nationen. Und auch wenn die westlichen Verbündeten seit Monaten nicht müde werden zu erklären, Russland stehe mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine weitgehend isoliert dar – letztendlich war das wenig mehr als Wunschdenken (China.Table berichtete). Brasilien, Indien, die Staaten des Nahen Ostens, aber auch viele Staaten Afrikas und Lateinamerikas haben die russische Invasion zu keinem Zeitpunkt klar verurteilt. Im Gegenteil: Die chinesische Führung in Peking hat stattdessen die Schuld für die Eskalation gar den USA und ihren Verbündeten gegeben.
Bei der UN-Generaldebatte, die an diesem Wochenende in New York zu Ende gegangen ist, ergab überraschend ein anderes Bild. Selbst China stimmt gegenüber Putin andere Töne an. Chinas Außenminister Wang Yi hat am Samstag bei seiner Rede der UN-Generaldebatte Russland und die Ukraine vor einer Ausweitung des Krieges gewarnt. “Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, ein Übergreifen der Krise zu verhindern und die legitimen Rechte und Interessen der Entwicklungsländer zu schützen“, sagte Wang. Er forderte die beiden Länder zu Verhandlungen auf. Notwendig seien “faire und pragmatische” Friedensgespräche, sagte der chinesische Außenminister. Die “legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien” müssten berücksichtigt werden.
Wie schon Bundeskanzler Olaf Scholz zu Beginn der Generalversammlung am Montag brachte auch Wang Yi seine Sorge zum Ausdruck: Die Konzepte von Souveränität und territorialer Integrität seien bedroht. Die Vollversammlung ist der richtige Ort für solche Mahnungen, denn beide Ideen sind in der UN-Charta verankert.
Als es Mitte der vergangenen Woche darum ging, ob der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj seine Rede per Videoschalte halten darf, stimmte eine überwältigende Mehrheit der Mitglieder dieser Ausnahme zu, darunter auch China. Dabei gilt normalerweise die eherne Regel, dass die Redner in New York anwesend sein müssen. Russland hatte noch versucht, das Entgegenkommen gegenüber der Ukraine zu verhindern.
Schon vor Wang Yis Rede am Samstag hatte es auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) unter anderem mit Russland, China, Indien und Kasachstan in der usbekischen Hauptstadt Samarkand nicht die erwartete Eintracht gegeben (China.Table berichtete). “Wir befänden uns nicht in einem Zeitalter, in dem Krieg geführt werden sollte”, sagte Indiens Premierminister Narendra Modi Putin direkt ins Gesicht.
Der ebenfalls in Samarkand anwesende chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping äußerte erstmals öffentlich “seine Sorgen” über die Situation in der Ukraine. Vorher hatte sich Xi mit Kritik noch (weitgehend) zurückgehalten, weswegen Putin sich bei ihm auch für die die “ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde” in der Ukraine-Krise bedankte.
Mit dieser verhaltenen Kehrtwende hat sich Xi zwar auch weiterhin nicht eindeutig gegen Putin gestellt. Und gegen die westlichen Sanktionen wettern die chinesischen Staatsmedien auch heftig weiter. Zumindest aber kann sich Russlands Präsident Wladimir Putin nun auch nicht mehr China als Partner verlassen.
Putin hatte wohl erwartet, dass ihm die anwesenden Staats- und Regierungschefs der zumeist ebenfalls autoritären SCO-Staaten in Samarkand den Rücken stärken. Sonst wäre er gar nicht zu dem Gipfel geflogen. Negativschlagzeilen kann sich Putin nicht zuletzt angesichts seiner “Teilmobilmachung” im eigenen Land derzeit nicht leisten.
Doch woher kommen Chinas plötzliche Zweifel an Moskaus Vorgehen? Können wir von einem Sinneswandel in Peking sprechen? Oder handelt es sich um eine Fortsetzung des bereits eingeübten Wechselspiels aus vorsichtiger Kritik und substanzloser Zustimmung (China.Table berichtete)?
Als Putin kurz vor Beginn seines Angriffskriegs im Februar zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele nach Peking flog und Xi über seine Vorhaben informierte, überwog in Peking offenbar die Einschätzung, Kiew werde rasch fallen. Bis kurz vor Kriegsbeginn pflegte Chinas zwar auch Beziehungen zur ukrainischen Regierung. Die Ukraine war wichtiger Teil der Seidenstraßen-Initiative, die neue Handelswege zwischen dem Reich der Mitte und Europa unter Chinas Führung erschließen sollte. Der Schaden wäre überschaubar geblieben – sofern die Annexion der Ukraine rasch vonstattengehen würde. Dieses Kalkül ist nun rein gar nicht aufgegangen. Der Krieg geht in den siebten Monat, die Front wogt hin- und her.
Mehr noch: Die Spannungen in anderen zentralasiatischen Ländern nehmen bereits zu, wie bereits im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan. Xi fürchtet inzwischen um die Stabilität in Zentralasien. Der Balanceakt wird also noch schwieriger (China.Table berichtete). Und auch wirtschaftlich könnte der anfängliche Nutzen Chinas des Ukraine-Kriegs ins Gegenteil verkehren.
Bis vor Kurzem schien China Nutznießer der westlichen Sanktionen gegen Russland sein. Was Moskau an Gas, Erdöl und Kohle nicht mehr an den Westen verkaufte, nahm China ab – und zwar deutlich unter den derzeit horrend hohen Weltmarktpreisen. Doch inzwischen droht die gesamte Weltwirtschaft so großen Schaden anzunehmen, dass auch die Wirtschaftsstrategen im Pekinger Regierungsviertel nervös werden. Immer mehr Exportmärkte der weltgrößten Exportnation brechen angesichts der massiv steigenden Preise im Zuge der Energiekrise ein. Wegen der Inflation halten die Konsumenten das Geld zusammen.
Und auch wenn China offiziell die westlichen Sanktionen gegen Russland ablehnt und sich als “strategischer Partner” Moskau betrachtet, haben auch zahlreiche chinesische Unternehmen und Finanzinstitute die Zusammenarbeit mit Russland ausgesetzt – aus Angst, vom Westen mit sanktioniert zu werden (China.Table berichtete). Die westlichen Handelspartner sind ihnen für ihre Geschäfte immer noch wichtiger als die russischen.
Putins Probleme sind wegen des anfänglichen Schulterschlusses nun eben auch Xis Probleme. “Die Tatsache, dass Russland seit sieben Monaten Krieg führt und nicht siegreich war, ist für Xi peinlich”, sagt der russische Ökonom Andrei Illarionov im Interview mit der Deutschen Welle. Illarionov hat zwischen 2000 und 2005 auch Putin beraten, gehört nun aber zu seinen Kritikern.
Kurz vor dem großen Parteikongress, bei dem Xi zum dritten Mal zum Staats- und Parteichef ernannt wird, lasse Moskaus Versagen Xi “vor dem wichtigsten Ereignis in seinem Leben schwach aussehen”. Aber Xi könne es sich nicht erlauben, schwach auszusehen. Entsprechend habe Xi in Samarkand Druck auf Putin gemacht, den Krieg möglichst rasch zu beenden.
Vor Samarkand sei Putin bereit gewesen, einen langfristigen Zermürbungskrieg fortzusetzen – notfalls jahrelang, schätzt der Putin-Berater Illarionov die Lage ein. Durch die Entscheidungen der letzten Tage habe Putin seine Strategie radikal geändert. “Dies sind keine Zeichen seiner Schwäche oder Niederlage; das sind Zeichen seiner Abhängigkeit von Xi.”

Kurz vor dem Parteikongress im Oktober räumt Xi Jinping im Polizeiapparat auf. Am Freitag wurde der ehemalige Vizeminister Sun Lijun zum Tode verurteilt; die Vollstreckung wird jedoch ausgesetzt, sodass er lebenslang ins Gefängnis muss. Suns Verurteilung ist Teil eines größeren Bildes. Am Donnerstag wurden Fu Zhenghua, ebenfalls ein Ex-Vizeminister, und als Komplize der rangniedrigere Wang Like zu der gleichen harten Strafe verurteilt (China.Table berichtete).
Xi lässt eine ganze Generation von Führungspersönlichkeiten des Sicherheitsapparats ins Gefängnis schicken, die offenbar ihm gegenüber nicht loyal genug waren. Wer in den Polizeibehörden gut vernetzt ist, gilt ihm offenbar bereits als politisches Risiko.
Sun wird dabei in Chinas Medien konsequent als Anführer eines “kleinen Kreises” von korrupten Komplizen dargestellt. Fu, Gong, Deng und Liu sind demnach seine “vier Tiger“, die nun ebenfalls von den Anti-Korruptionsjägern erlegt wurden. “Tiger” sind im chinesischen Sprachgebrauch hohe Beamte, die der Bestechlichkeit überführt wurden.
Die chinesische Berichterstattung macht hier einen Zweisprung. Offiziell ergingen die Urteile wegen Korruption, und auf dieser Schiene wird auch Empörung gegen die gefallenen Kader geschürt. Zugleich erfolgen aber auch Anspielungen auf ein politisches Komplott der Gruppe. Gegen wen und mit welchem Ziel? Das wird nicht ausgesprochen.
Die Ermittlungen gegen die vermeintliche Sun-Clique begannen 2020, jetzt folgten die Verurteilungen Schlag auf Schlag. Ob diese Männer wirklich eine Art Vereinigung gebildet haben, ist unter praktischen Gesichtspunkten irrelevant. Xi hat sie als Bedrohung für seine Machtbasis wahrgenommen. Der Staatschef will das Haus vor dem wichtigen 20. Parteitag (China.Table berichtete) sauber haben und lässt alle Abweichler ausschalten. Die sechs verurteilten Männer waren zwar längst entmachtet. Doch ihre Verurteilung kann immer noch abschreckend auf andere Kader wirken, die Xi nicht absolut ergeben sind. Eine populäre chinesische Website traut der Verurteilungswelle “starke Abschreckung” zu. Gemeint ist hier vordergründig die Korruption, doch in Xis Kampagnen geht es immer auch um Loyalität.

Die Geheimdienstleute sind für Xi schwierigere Fälle als Wirtschaftsbosse oder Militärs. In autoritären Regimen droht den Machthabern die Gefahr oft entweder von der Armee oder den Geheimdiensten. Die Generäle hat Xi längst alle ausgewechselt und weiß die nun Amtierenden sicher auf seiner Seite. Chinas undurchsichtig ineinander verwobenes Geheimdienst- und Polizeiwesen hat jedoch ein erhebliches Beharrungsvermögen. Vor allem aber haben die verurteilten Männer enge Verbindung zum Shanghai-Netzwerk von KP-Kadern um Ex-Präsident Jiang Zemin. Aus Xis Sicht müssen sie dadurch besonders unzuverlässig erscheinen, schließlich handelt es sich um eine potenziell rivalisierende Gruppierung. In einem Polizeistaat wie China sind die Dienste zudem überproportional mächtig. Jeder kann plötzlich “verschwinden”, gegen jeden finden sich Beweise.
Das bekommen die fünf Herren nun am eigenen Leib zu spüren. Die Zentrale Disziplinarkommission, ein Parteiorgan, konnte ihnen recht mühelos Korruption nachweisen. Ob sie tatsächlich die exorbitanten Summen angenommen haben oder nicht, wird wohl nie jemand erfahren. Vermutlich waren sie in irgendeiner Form bestechlich. Entscheidend, ist, wer im derzeitigen China nicht wegen Korruption angeklagt wird: Xis Getreue, die er derzeit an den entscheidenden Stellen platziert.
Xi stützt sich unter anderem auf zwei Gefolgsleute, um die Geheimpolizei unter seine Kontrolle zu bringen. Beide gelten als loyal und zuverlässig:
Die gefällten Kader waren dabei Teil der Welt des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (Ministry for Public Security, PSB, 公安部) und der entsprechenden Parteiinstitutionen. Diese kontrollieren vor allem die nationale Polizei, die durchaus auch Geheimdienstaufgaben hat.
Vom wesentlich verdeckter arbeitenden Ministerium für Staatssicherheit 国家安全部 war zuletzt weniger zu hören. Dieses wird von Chen Wenqing 陈文清, 62, seit 2016 vergleichsweise geräuschlos verwaltet. Vor vier Jahren kursierten Gerüchte, der loyalere Wang Xiaohong solle Chen als Geheimdienstminister ablösen. Diese erwiesen sich jedoch als falsch. Chen scheint stattdessen weiterhin das Vertrauen des starken Mannes zu genießen.
Die Kette von Todesurteilen wurden am Wochenende auch Teil einer Verschwörungstheorie um einen angeblichen Staatsstreich, bei dem Xi Jinping entmachtet worden sei. Die Urteile gegen die vermeintlichen Verschwörer um Sun Lijun habe Militärs und hohe Parteikader auf den Plan gerufen, die Xi nach der Rückkehr seiner Zentralasien-Reise festgesetzt und die Macht übernommen hätten, lauteten die Gerüchte auf Sozialmedien. Diese verbreiteten sich ausgehend von indischen Twitter-Accounts im Laufe des Sonntags in allen Sprachen und vielen Varianten.
Als Belege wurden Fotos der sechs Verurteilten ebenso herangezogen wie Berichte über eine Sitzung der Militärkommission, an der Xi angeblich nicht teilgenommen habe – dafür aber einer der Generäle, die hinter dem Coup stecken sollen. Ein weiterer “Beweis” bestand aus Videoaufnahmen von Militärfahrzeugen auf einer Autobahn.
Solche Bilder kursieren jedoch tausendfach im Netz; ihre Aussagekraft ist gleich null. Die völlige Abwesenheit seriöser Berichte über Unregelmäßigkeiten in der Führung wurden freilich auf Sozialmedien – wie bei Verschwörungstheorien üblich – als zusätzlicher Beleg für deren Richtigkeit gewertet. Völlig falsch, und besonders leicht zu überprüfen, war die Behauptung, der Zug- und Flugverkehr in die Hauptstadt sei eingestellt.
Fakt ist, dass die hohe KP-Führung nur noch aus Xi-treuen Kadern besteht. Auch die ehemaligen Polizeiminister, die nun verurteilt wurden, befanden sich schon seit mindestens zwei Jahren nicht mehr auf einflussreichen Posten, ihre Netzwerke sind aufgelöst. Es gibt zwar Dissenz in der KP China, doch dieser wird unter dem Deckel gehalten. Ein Militärputsch unter Einnahme der Medienhäuser würde auch nicht verschwiegen, sondern sofort landesweit mitgeteilt, damit das etablierte Lager sich nicht zum Gegenschlag sammeln kann. Einwohner Pekings und Journalisten vor Ort berichten derweil: alles normal in der Hauptstadt.
Vom 26. September an wird Hongkong die Hotel-Quarantäne für Einreisende abschaffen. Das gaben die Behörden am Freitag bekannt. Nach zweieinhalb Jahren fällt somit eine der größten Covid-Restriktionen für Reisende. Stattdessen müssen diese sich nach ihrer Ankunft für drei Tage selbst auf Covid-Anzeichen überwachen. Während dieser Zeit dürfen sie zur Arbeit und zur Schule, lediglich einige Freizeitaktivitäten wie Restaurant- und Barbesuche bleiben eingeschränkt. Auch der PCR-Test, der bisher 48 Stunden vor Flugantritt absolviert werden musste, fällt weg. Für den Reiseantritt reicht ein Schnelltest.
Bisher mussten sich international Reisende drei Tage in einem selbst bezahlten Hotel isolieren und im Anschluss vier Tage selbst überwachen. Zwischenzeitlich betrug die Hotel-Quarantäne sogar drei Wochen. Andere Coronavirus-Bestimmungen bleiben bestehen. Es bleibt weiterhin verboten, sich in Gruppen von mehr als vier Personen in der Öffentlichkeit zu versammeln. Die Maskenpflicht bleibt erhalten – auch Kinder ab zwei Jahren müssen Masken tragen. nib
Eine tschechische Delegation hat mit Taiwan ein Abkommen über eine mögliche Kooperation bei der Entwicklung von Mikrochips unterzeichnet. “Wir sind gekommen, um Türen zu öffnen,” sagte Senator Jiří Drahoš als Delegationsleiter am Freitag in Taipeh. Seit dem 18. September war eine 14-köpfige Abordnung von Politikern und Akademikern aus der Tschechischen Republik in Taiwan; sie ist am Freitag nach ihrer Pressekonferenz wieder abgereist. Deutsche Abgeordnete planen im Oktober gleich zwei Delegationsreisen auf die Insel.
Taiwan wolle das zentraleuropäische Land beim Aufbau eines Halbleiter-Forschungszentrums zu unterstützen, teilte die Regierung in Taipeh mit. Ende Oktober soll eine Delegation taiwanischer Hochschulvertreter nach Tschechien reisen, um internationale Studierende für Taiwans Halbleiter-Studienprogramme anzuwerben.
China fasst hochrangig besetzte Delegation in Taipeh derzeit als Provokationen auf. Prag wiederum nimmt derzeit auf mehreren Feldern die Konfrontation mit Peking in Kauf und unterstützt Litauen im Streit mit der asiatischen Großmacht (China.Table berichtete). Das Verhältnis zu China gilt derzeit insgesamt als schwierig (China.Table berichtete).
Delegationsleiter Drahoš erinnerte außerdem an seinen vorigen Besuch in Taiwan vor 25 Jahren. Viel habe sich seitdem verändert. “Ich weiß wirklich zu schätzen, wie sich Taiwan zu einer vollwertigen Demokratie entwickelt hat, einer Demokratie, die Wert auf Attribute wie Freiheit, Freiheit und den Schutz der Menschenrechte legt”, erklärte Dahoš. David Demes
Der Wasserstand von Chinas größtem Süßwassersee ist auf ein Rekordtief gesunken. Die Behörden in Jiangxi haben erstmals die höchste Warnstufe für die Wasserversorgung ausgesprochen, wie Reuters berichtet. Der Wasserstand an einer wichtigen Messstelle des Poyang ist demnach in den letzten drei Monaten von über 19 auf knapp sieben Meter gesunken. Die Dürre in Jiangxi hält schon mehr als 70 Tage an, während es im Südwesten der Volksrepublik wieder starke Regenfälle gab. “Die extreme Dürre hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, die landwirtschaftliche Produktion und die Ökologie”, sagte Wang Chun, Direktor des Büros für Wasserressourcen in der Provinz Jiangxi, letzte Woche, so die South China Morning Post. Laut Behörden waren seit Ende Juni 17.000 Menschen von Trinkwasserproblemen betroffen.

Die Dürre in Zentral- und Teilen Südchinas dauert schon seit über dreißig aufeinanderfolgenden Tagen an. 13 Provinzen und Regionen sind laut der Beratungsagentur Trivium China betroffen, darunter wichtige Getreide produzierende Provinzen wie Anhui, Henan, Jiangxi und Hunan. In den Hauptstädten von Jiangxi und Hunan sei im September noch kein Tropfen Regen gefallen.
Laut Behördenangaben haben die Dürren allerdings nur einen geringen Einfluss auf die Herbsternte. Auch das US-Landwirtschaftsministerium hält die Schäden für nicht allzu gravierend, wie Satellitendaten laut Trivium zeigen. Dennoch bedeuten diese Nachrichten keine Entwarnung. Denn in wenigen Wochen wird die Herbst- und Wintersaat ausgebracht. “Wenn die Dürre in den nächsten ein oder zwei Monaten kein Ende findet, kann kein Geldbetrag die Ernte im nächsten Frühjahr retten”, schreiben die Trivium-Analysten. nib
Daimler Truck hat mit dem Bau von Lastwagen unter der Marke Mercedes-Benz in China begonnen. Die ersten Fahrzeuge liefen am Freitag im Werk des Gemeinschaftsunternehmens von Daimler Truck und Foton Motor in Peking vom Band, wie das Unternehmen mitteilte. China sei der größte Markt für schwere Lastwagen und biete ein erhebliches Wachstumspotenzial für Daimler Truck, sagte der für das Asiengeschäft zuständige Daimler-Truck-Vorstand Karl Deppen. Zu den angestrebten Stückzahlen äußerte sich Daimler Truck nicht.
2021 wurden in China laut VDA rund 1,5 Millionen schwere Lastwagen verkauft – damit ist die Volksrepublik der größte Markt weltweit und größer als die USA, Japan und Europa zusammen. Westliche Hersteller spielen jedoch dort nur eine Nebenrolle. Chinesische Spediteure achteten bei ihrer Kaufentscheidung in erster Linie auf den Preis, sagte Deppen; die Betriebskosten spielten für sie eine geringere Rolle. Inzwischen sei aber zu erkennen, dass sich die Branche professionalisiere und Aspekte wie Verbrauch oder Reparaturkosten zunehmend mit einbezogen würden. rtr
Ein Professor der Universität Texas A&M bekennt sich schuldig, China-Kontakte geheim gehalten zu haben, obwohl er mit NASA-Mitteln geforscht hat. Cheng Zhengdong hatte vom amerikanischen Staat 750.000 US-Dollar für Weltraumforschung in seinen Laboren erhalten. Einem Gesetz aus der Trump-Zeit zufolge hätte er jede Verbindung zu chinesischen Institutionen offenlegen müssen. Er hat jedoch eine Tätigkeit für eine Hochschule in Guangdong verschwiegen. Cheng wurde zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt.
Auch in Deutschland läuft derzeit eine Diskussion über Hochschulkooperationen mit China. Die “China Science Investigation” hatte ergeben, dass zahlreiche Universitäten technisches Wissen mit chinesischen Institutionen teilen, die militärische Anwendungen haben. Zugleich regt sich Kritik, die eine generelle Diffamierung sinnvoller Hochschulzusammenarbeit befürchtet. fin
Das China-Netzwerk Baden-Württemberg und die Zeppelin Universität in Friedrichshafen befragen erneut Unternehmen zu ihrer Einstellung zu China. Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt bei dem Sinologen Klaus Mühlhahn, derzeit Präsident der Zeppelin-Universität. Die Unternehmensberatung PwC ist Partner bei der anonymen Befragung. Sie läuft bis zum 23. Oktober; eine Auswertung soll bis Ende des Jahres vorliegen. Im vergangenen Jahr gab es eine vergleichbare Umfrage, sodass sich Trends nachzeichnen lassen. fin

Claus Eßers bezeichnet sich als technikaffin, wollte erst Elektrotechnik studieren, wurde dann jedoch Patentanwalt. Zum Jurastudium kam er durch seinen Vater und seinen Onkel. “Irgendwann überlegte ein Mandant von mir, wie er mit chinesischen Mittelständlern Verträge abschließen könne.” Von diesem Tag an ließ Eßers das Thema China nicht mehr los.
Im Jahr 2004 gründete er zusammen mit einem Anwaltskollegen den China-Desk, für den heute drei chinesische Rechtsanwälte tätig sind. Eßers berät sowohl chinesische Mittelständler, die sich auf dem deutschen Markt etablieren wollen, als auch deutsche Firmen, die in China investieren möchten. Neben Handelsrecht und Gesellschaftsrecht gehören Steuerrecht und komplizierte Erbrechtsfälle zu seinen Spezialgebieten. Darüber hinaus ist er Buchautor und hält Vorträge. Bereits seit 1999 ist er Partner der Anwaltskanzlei Hoffmann Liebs in Düsseldorf.
In den Dialog zu gehen, genau zuhören und sich auf seinen Gesprächspartner einstellen – das liegt Claus Eßers. Am besten gelingt das vor Ort. So war er über 60 Mal in China, zuletzt 2019, bevor die Coronavirus-Pandemie und Xi Jinpings Null-Covid-Politik dazwischenkamen. Angesichts der strengen Quarantänebestimmungen und der Abschottung ganzer Städte lautet die momentane Devise für ihn: nicht hinfliegen, sondern alles über Telefon und Internet regeln.
Eßers macht aus seinem unerschütterlichen China-Optimismus keinen Hehl. Seinen deutschen Mandanten rät Eßers zum Dableiben und Durchhalten. “Vor 2019 haben sich die Handelsbeziehungen zu China stetig verbessert, das Vertrauen wuchs. Das kommt wieder. Es wird nur überlagert durch die Pandemie und Russlands Ukraine-Krieg.” Wenn die Pandemie im Griff sei und die Schiffe wieder verladen werden, gehe “ein Ruck durch das Land”. Dann seien alle wieder mit Feuereifer dabei.
Nicht nur Vertrags-, auch Antragsverfahren in China können kompliziert sein. Das erfährt Eßers gerade am eigenen Leib: “Wir sind seit zwei Jahren dabei, in Shanghai ein eigenes Büro zu gründen. Alle Anträge liegen der chinesischen Regierung vor.” Wann diese genau genehmigt sind, sei ebenso ungewiss wie die Pandemie-Entwicklung. “Aber egal, wie lange es dauert, wir verfolgen unsere Büroeröffnung weiter.” Daniela Krause
Qiu Yong wird Leiter der Abteilung der Kommunistischen Partei der Shanghaier Börse. Der hochrangige Beamte der China Securities Regulatory Commission (CSRC) löst Huang Hongyuan ab, der nach Angaben der Börse einen anderen Posten übernehmen wird.
Andy Zhang wird CEO des Gebrauchtuhren-Händlers Watchbox China mit Sitz in Shanghai. Er war zuvor unter anderem bei dem deutschen Uhrmacherhaus A. Lange & Söhne beschäftigt. Watchbox ist auf den Weiterverkauf von Luxusuhren spezialisiert.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Was hat den Kopf eines Kamels, die Ohren eines Ochsen, die Hörner eines Hirsches, den Hals einer Schlange, den Hinterleib einer Muschel, die Klauen eines Adlers, die Tatzen eines Tigers, den schuppigen Körper eines Fisches und die feurigen Augen eines Teufels? Richtig, ein Drache. Zumindest aus der Warte der chinesischen Mythologie.
Der Drache ist quasi ein jahrhundertealter Markenbotschafter der chinesischen Kultur. Er ist zum Beispiel nicht nur in der Verbotenen Stadt – dem Kaiserpalast – allgegenwärtig, sondern poltert auch durch Souvenirkollektionen im ganzen Land. Die Chinesen verbindet eine besondere Beziehung zu den schuppigen Fabelwesen. In China gelten sie nämlich nicht als fauchend böse und feindlich, sondern als Urahnen der Menschen. Als sympathische Ungeheuer symbolisieren sie bis heute Reichtum, Glück, Güte und Intelligenz.
Solche Drachenmythologie und Kultursymbolik krallt Sie wenig und erinnert Sie nur an angestaubte Reiseführer? Dann halten Sie sich besser fest. Denn jetzt geht es auf einen teuflischen Drachenritt durch den chinesischen Alltag beziehungsweise die moderne chinesische Sprache. Denn in China sind Drachen im wahrsten Wortsinne in aller Munde und teils sogar an Orten zu finden, wo man sie kaum erwartet – zum Beispiel auf Zootouren, Speiseplänen und Stadtautobahnen, manchmal auch in der Wettervorhersage, ja sogar als “Hausdrache” in jedem Badezimmer!
In chinesischen (und deutschen) Tiergärten trifft man zum Beispiel auf “Drachenkatzen” (龙猫 lóngmāo) – besser bekannt als Chinchillas – sowie “Farbwechseldrachen” (变色龙 biànsèlóng – Chamäleons) oder die ihrem Namen wenig Ehre machenden da spindeldürren “Meerdrachen” (海龙 hǎilóng), auch Seenadeln genannt. Ausgestorben sind zum Glück “Fürchtedrachen” (恐龙 kǒnglóng), also Dinosaurier, und da allen voran der “Brutalodrache” (暴龙 bàolóng) alias Tyrannosaurus.
Zu den im Westen bekanntesten kulinarischen Drachengattungen gehören in erster Linie zwei Flüssigdrachen: der grüne “Drachenbrunnentee” (龙井茶 lóngjǐngchá) und der “Schwarzdrachentee” (乌龙茶 wūlóngchá), letzteren kennen wir als Oolong. Doch vielleicht haben Sie auch schon mal unbewusst “Drachenaugen” (龙眼 lóngyǎn) verspeist, sprich Longanfrüchte, oder standen beim ersten Restaurant-Rendezvous auf Kriegsfuß mit einer “Drachengarnele” (龙虾 lóngxiā), also einem Hummer. Das Verspeisen von “Minidrachengarnelen” (小龙虾 xiǎolóngxiā) – das ist der possierliche kleine Bruder des feuerroten Getiers, nämlich der Flusskrebs – zelebrieren die Chinesen gerne als geselliges Schalenmassaker.
Wer sich jetzt in die Gemüsewelt flüchtet, bleibt in China leider auch nicht verschont und gerät früher oder später in die Fänge der schmackhaften zackigen “Drachenbohne” (龙豆 lóngdòu). Darf’s zum Abschluss als Nachtisch noch ein “Pferdeklammerdrache” sein? Hat zum Glück nichts mit geklammerten Pferden oder gehuften Drachen zu tun, sondern ist einfach die lautliche Übertragung zuckerzarter französischer Macarons. Nicht verwechseln bitte mit dem (süßen?) französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron – der heißt auf Chinesisch “Makelong” (马克龙 Mǎkèlóng), auch nur eine lautliche Anlehnung, ließe sich aber ganz wörtlich mit “Pferdebezwingerdrache” übersetzen.
Viele chinesische Kaiser sollen sich als direkte Nachfahren der Drachen verstanden haben. Ist natürlich heute widerlegt. Trotzdem hat sich die Denke, dass besondere Persönlichkeiten es drachenmäßig drauf haben, im chinesischen Wörterbuch verfestigt. Das Wort chénglóng 成龙 “zu einem Drachen werden” bedeutet bis heute “es zu etwas bringen” beziehungsweise “groß rauskommen”. Diese Redensart inspirierte einst einen jungen Hongkonger Kampfkunstkünstler mit Nachnamen 成 dazu, sich das Künstlerpseudonym Chéng Lóng 成龙 zuzulegen. Der Name hat seinen Zweck erfüllt und der Rest ist Geschichte. Im Westen kennen wir ihn heute als Jacky Chan.
Dass Drachenmetaphorik den Chinesen auf der Zunge liegt, zeigt sich auch beim Anblick einiger weiterer Alltagsbegriffe. So schlängeln sich aus chinesischer Sicht da, wo wir im Deutschen Schlangen sehen, vielmehr Drachen: etwa im Falle von Menschenschlangen (auf Chinesisch人龙 rénlóng “Menschendrachen“) oder Autoschlangen (auf Chinesisch车龙 chēlóng “Wagendrachen”). Endlose Feierabend-Blechkarawanen oder wildes Getümmel in den Straßen kommentieren Chinesen als 车水马龙 chē shuǐ mǎ lóng – frei übersetzt: “Autos wie Wasser und Pferde wie Drachen”, sprich: hohes Verkehrsaufkommen oder heilloses Tohuwabohu.
Während uns im deutschsprachigen Raum alte Wasserleitungen mit hahnenkammartigem Drehknauf einst an Federvieh erinnert haben mögen, fließt das Nass in China nicht aus dem Wasserhahn, sondern dem “Wasserdrachenkopf” (水龙头 shuǐlóngtóu). Vielleicht lag diese Assoziation auch deshalb nahe, weil der Drache den Chinesen als Beherrscher des Wassers gilt. Er bestimmt die Jahreszeiten und die Ernte und soll im Winter in Gewässern leben und im Frühsommer in den Himmel aufsteigen. Und dort treibt er laut chinesischer Meteorologensprache sein Unwesen als “Drachenwirbelwind” (龙卷风 lóngjuǎnfēng) – das ist die Bezeichnung für Tornado.
Sogar das Wirtschaftsvokabular haben die Drachen sich gekrallt. Kein Wunder, gilt der Drache in der chinesischen Kultur schließlich als wohlstandsverheißend. Branchen- und Marktführer adelt das Putonghua deshalb als “Drachenköpfe” (龙头 lóngtóu) und spricht von “Marktdrachenköpfen” (市场龙头 shìchǎng lóngtóu = Marktführer), “Drachenkopfprodukten” (龙头产品 lóngtóu chǎnpǐn = führende Produkte) und “Drachenkopffirmen” (龙头企业 lóngtóu qǐyè = führende Unternehmen). Und wenn Sie die einst aufstrebenden ost- und südostasiatischen Wirtschaften noch als “Tigerstaaten” kannten, wird Sie auch hier das Chinesische eines Besseren belehren. Denn in China hießen Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur in diesem Zusammenhang schon immer亚洲四小龙 Yàzhōu sì xiǎolóng – die “vier Drachenbabys Asiens“.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
die Treue Chinas zu Russlands war ohnehin wacklig. Statt handfester Unterstützung gab es aus Peking für Putin eher aufmunternde Worte. Sein Krieg soll den Westen ebenso schwächen wie Russland selbst, das sich zum Vasallen Chinas gemacht hat. Putin ist für Xi eben vor allem ein nützlicher Krawallmacher.
Doch am Samstag vor der UN-Hauptversammlung hat Außenminister Wang die russischen Verbündeten unverhohlen zur Mäßigung gemahnt. Der Hintergrund: Peking befürchtet ein Übergreifen der Instabilität auf die eigene Interessensphäre in Zentralasien, wenn Russland immer heftiger agiert. Außerdem werden die Kriegsfolgen wirtschaftlich immer schmerzhafter, berichtet Felix Lee.
In der vergangenen Woche liefen von Mittwoch bis Freitag Meldungen von sechs Verurteilungen hoher KP-Kader zu langen Haftstrafen auf Chinas Nachrichtenseiten. Jede einzelne davon liest sich wie Routine in der endlosen Antikorruptionskampagne, doch im Gesamtbild zeigt sich ein besonderes Muster: Alle sechs Männer standen einst an der Spitze des chinesischen Sicherheitsapparats. Die Propaganda unterstellt ihnen nicht nur Korruption, sondern ein Komplott; an der Spitze der Verschwörung soll Sun Lijun gestanden haben, der am Freitag zum Tode verurteilt wurde. Machthaber Xi Jinping säubert vor dem Parteikongress im Oktober sein Haus. Wer nicht bedingungslos loyal ist, muss um seine Freiheit fürchten.
Ein geradezu sensationelles Zeichen der Öffnung kommt aus Hongkong. Ankommende Reisende müssen nicht mehr in Quarantäne, sondern sollen selbstständig auf Krankheitszeichen achten. Verwaltungschef John Lee ist es offenbar gelungen, zumindest hier ein Stück Eigenständigkeit zu erkämpfen. Es bleibt das sehnsüchtige Hoffen auf eine Öffnung des Festlands.
Auf Twitter trendete in unserer Blase am Sonntag ein angeblicher Putsch gegen Xi Jinping. Es gibt jedoch nicht den geringsten seriösen Beleg, dass an diesem Gerücht etwas dran ist. Stattdessen folgen die angeblichen Beweise dem üblichen Skript einer Verschwörungstheorie. Auch 2012 gab es übrigens wilde Putschgerüchte vor dem Parteikongress, auf dem Xi Jinping dann wie angekündigt die Kontrolle übernahm. Im Oktober wird er aller Voraussicht nach in seiner Position bestätigt. Die neue Welle von Falschmeldungen zeigen nun vor allem, dass vor dem Polit-Großereignis die Nerven blank liegen.


Geschlossenheit gibt es nur selten bei den Vereinten Nationen. Und auch wenn die westlichen Verbündeten seit Monaten nicht müde werden zu erklären, Russland stehe mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine weitgehend isoliert dar – letztendlich war das wenig mehr als Wunschdenken (China.Table berichtete). Brasilien, Indien, die Staaten des Nahen Ostens, aber auch viele Staaten Afrikas und Lateinamerikas haben die russische Invasion zu keinem Zeitpunkt klar verurteilt. Im Gegenteil: Die chinesische Führung in Peking hat stattdessen die Schuld für die Eskalation gar den USA und ihren Verbündeten gegeben.
Bei der UN-Generaldebatte, die an diesem Wochenende in New York zu Ende gegangen ist, ergab überraschend ein anderes Bild. Selbst China stimmt gegenüber Putin andere Töne an. Chinas Außenminister Wang Yi hat am Samstag bei seiner Rede der UN-Generaldebatte Russland und die Ukraine vor einer Ausweitung des Krieges gewarnt. “Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, ein Übergreifen der Krise zu verhindern und die legitimen Rechte und Interessen der Entwicklungsländer zu schützen“, sagte Wang. Er forderte die beiden Länder zu Verhandlungen auf. Notwendig seien “faire und pragmatische” Friedensgespräche, sagte der chinesische Außenminister. Die “legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien” müssten berücksichtigt werden.
Wie schon Bundeskanzler Olaf Scholz zu Beginn der Generalversammlung am Montag brachte auch Wang Yi seine Sorge zum Ausdruck: Die Konzepte von Souveränität und territorialer Integrität seien bedroht. Die Vollversammlung ist der richtige Ort für solche Mahnungen, denn beide Ideen sind in der UN-Charta verankert.
Als es Mitte der vergangenen Woche darum ging, ob der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj seine Rede per Videoschalte halten darf, stimmte eine überwältigende Mehrheit der Mitglieder dieser Ausnahme zu, darunter auch China. Dabei gilt normalerweise die eherne Regel, dass die Redner in New York anwesend sein müssen. Russland hatte noch versucht, das Entgegenkommen gegenüber der Ukraine zu verhindern.
Schon vor Wang Yis Rede am Samstag hatte es auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) unter anderem mit Russland, China, Indien und Kasachstan in der usbekischen Hauptstadt Samarkand nicht die erwartete Eintracht gegeben (China.Table berichtete). “Wir befänden uns nicht in einem Zeitalter, in dem Krieg geführt werden sollte”, sagte Indiens Premierminister Narendra Modi Putin direkt ins Gesicht.
Der ebenfalls in Samarkand anwesende chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping äußerte erstmals öffentlich “seine Sorgen” über die Situation in der Ukraine. Vorher hatte sich Xi mit Kritik noch (weitgehend) zurückgehalten, weswegen Putin sich bei ihm auch für die die “ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde” in der Ukraine-Krise bedankte.
Mit dieser verhaltenen Kehrtwende hat sich Xi zwar auch weiterhin nicht eindeutig gegen Putin gestellt. Und gegen die westlichen Sanktionen wettern die chinesischen Staatsmedien auch heftig weiter. Zumindest aber kann sich Russlands Präsident Wladimir Putin nun auch nicht mehr China als Partner verlassen.
Putin hatte wohl erwartet, dass ihm die anwesenden Staats- und Regierungschefs der zumeist ebenfalls autoritären SCO-Staaten in Samarkand den Rücken stärken. Sonst wäre er gar nicht zu dem Gipfel geflogen. Negativschlagzeilen kann sich Putin nicht zuletzt angesichts seiner “Teilmobilmachung” im eigenen Land derzeit nicht leisten.
Doch woher kommen Chinas plötzliche Zweifel an Moskaus Vorgehen? Können wir von einem Sinneswandel in Peking sprechen? Oder handelt es sich um eine Fortsetzung des bereits eingeübten Wechselspiels aus vorsichtiger Kritik und substanzloser Zustimmung (China.Table berichtete)?
Als Putin kurz vor Beginn seines Angriffskriegs im Februar zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele nach Peking flog und Xi über seine Vorhaben informierte, überwog in Peking offenbar die Einschätzung, Kiew werde rasch fallen. Bis kurz vor Kriegsbeginn pflegte Chinas zwar auch Beziehungen zur ukrainischen Regierung. Die Ukraine war wichtiger Teil der Seidenstraßen-Initiative, die neue Handelswege zwischen dem Reich der Mitte und Europa unter Chinas Führung erschließen sollte. Der Schaden wäre überschaubar geblieben – sofern die Annexion der Ukraine rasch vonstattengehen würde. Dieses Kalkül ist nun rein gar nicht aufgegangen. Der Krieg geht in den siebten Monat, die Front wogt hin- und her.
Mehr noch: Die Spannungen in anderen zentralasiatischen Ländern nehmen bereits zu, wie bereits im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan. Xi fürchtet inzwischen um die Stabilität in Zentralasien. Der Balanceakt wird also noch schwieriger (China.Table berichtete). Und auch wirtschaftlich könnte der anfängliche Nutzen Chinas des Ukraine-Kriegs ins Gegenteil verkehren.
Bis vor Kurzem schien China Nutznießer der westlichen Sanktionen gegen Russland sein. Was Moskau an Gas, Erdöl und Kohle nicht mehr an den Westen verkaufte, nahm China ab – und zwar deutlich unter den derzeit horrend hohen Weltmarktpreisen. Doch inzwischen droht die gesamte Weltwirtschaft so großen Schaden anzunehmen, dass auch die Wirtschaftsstrategen im Pekinger Regierungsviertel nervös werden. Immer mehr Exportmärkte der weltgrößten Exportnation brechen angesichts der massiv steigenden Preise im Zuge der Energiekrise ein. Wegen der Inflation halten die Konsumenten das Geld zusammen.
Und auch wenn China offiziell die westlichen Sanktionen gegen Russland ablehnt und sich als “strategischer Partner” Moskau betrachtet, haben auch zahlreiche chinesische Unternehmen und Finanzinstitute die Zusammenarbeit mit Russland ausgesetzt – aus Angst, vom Westen mit sanktioniert zu werden (China.Table berichtete). Die westlichen Handelspartner sind ihnen für ihre Geschäfte immer noch wichtiger als die russischen.
Putins Probleme sind wegen des anfänglichen Schulterschlusses nun eben auch Xis Probleme. “Die Tatsache, dass Russland seit sieben Monaten Krieg führt und nicht siegreich war, ist für Xi peinlich”, sagt der russische Ökonom Andrei Illarionov im Interview mit der Deutschen Welle. Illarionov hat zwischen 2000 und 2005 auch Putin beraten, gehört nun aber zu seinen Kritikern.
Kurz vor dem großen Parteikongress, bei dem Xi zum dritten Mal zum Staats- und Parteichef ernannt wird, lasse Moskaus Versagen Xi “vor dem wichtigsten Ereignis in seinem Leben schwach aussehen”. Aber Xi könne es sich nicht erlauben, schwach auszusehen. Entsprechend habe Xi in Samarkand Druck auf Putin gemacht, den Krieg möglichst rasch zu beenden.
Vor Samarkand sei Putin bereit gewesen, einen langfristigen Zermürbungskrieg fortzusetzen – notfalls jahrelang, schätzt der Putin-Berater Illarionov die Lage ein. Durch die Entscheidungen der letzten Tage habe Putin seine Strategie radikal geändert. “Dies sind keine Zeichen seiner Schwäche oder Niederlage; das sind Zeichen seiner Abhängigkeit von Xi.”

Kurz vor dem Parteikongress im Oktober räumt Xi Jinping im Polizeiapparat auf. Am Freitag wurde der ehemalige Vizeminister Sun Lijun zum Tode verurteilt; die Vollstreckung wird jedoch ausgesetzt, sodass er lebenslang ins Gefängnis muss. Suns Verurteilung ist Teil eines größeren Bildes. Am Donnerstag wurden Fu Zhenghua, ebenfalls ein Ex-Vizeminister, und als Komplize der rangniedrigere Wang Like zu der gleichen harten Strafe verurteilt (China.Table berichtete).
Xi lässt eine ganze Generation von Führungspersönlichkeiten des Sicherheitsapparats ins Gefängnis schicken, die offenbar ihm gegenüber nicht loyal genug waren. Wer in den Polizeibehörden gut vernetzt ist, gilt ihm offenbar bereits als politisches Risiko.
Sun wird dabei in Chinas Medien konsequent als Anführer eines “kleinen Kreises” von korrupten Komplizen dargestellt. Fu, Gong, Deng und Liu sind demnach seine “vier Tiger“, die nun ebenfalls von den Anti-Korruptionsjägern erlegt wurden. “Tiger” sind im chinesischen Sprachgebrauch hohe Beamte, die der Bestechlichkeit überführt wurden.
Die chinesische Berichterstattung macht hier einen Zweisprung. Offiziell ergingen die Urteile wegen Korruption, und auf dieser Schiene wird auch Empörung gegen die gefallenen Kader geschürt. Zugleich erfolgen aber auch Anspielungen auf ein politisches Komplott der Gruppe. Gegen wen und mit welchem Ziel? Das wird nicht ausgesprochen.
Die Ermittlungen gegen die vermeintliche Sun-Clique begannen 2020, jetzt folgten die Verurteilungen Schlag auf Schlag. Ob diese Männer wirklich eine Art Vereinigung gebildet haben, ist unter praktischen Gesichtspunkten irrelevant. Xi hat sie als Bedrohung für seine Machtbasis wahrgenommen. Der Staatschef will das Haus vor dem wichtigen 20. Parteitag (China.Table berichtete) sauber haben und lässt alle Abweichler ausschalten. Die sechs verurteilten Männer waren zwar längst entmachtet. Doch ihre Verurteilung kann immer noch abschreckend auf andere Kader wirken, die Xi nicht absolut ergeben sind. Eine populäre chinesische Website traut der Verurteilungswelle “starke Abschreckung” zu. Gemeint ist hier vordergründig die Korruption, doch in Xis Kampagnen geht es immer auch um Loyalität.

Die Geheimdienstleute sind für Xi schwierigere Fälle als Wirtschaftsbosse oder Militärs. In autoritären Regimen droht den Machthabern die Gefahr oft entweder von der Armee oder den Geheimdiensten. Die Generäle hat Xi längst alle ausgewechselt und weiß die nun Amtierenden sicher auf seiner Seite. Chinas undurchsichtig ineinander verwobenes Geheimdienst- und Polizeiwesen hat jedoch ein erhebliches Beharrungsvermögen. Vor allem aber haben die verurteilten Männer enge Verbindung zum Shanghai-Netzwerk von KP-Kadern um Ex-Präsident Jiang Zemin. Aus Xis Sicht müssen sie dadurch besonders unzuverlässig erscheinen, schließlich handelt es sich um eine potenziell rivalisierende Gruppierung. In einem Polizeistaat wie China sind die Dienste zudem überproportional mächtig. Jeder kann plötzlich “verschwinden”, gegen jeden finden sich Beweise.
Das bekommen die fünf Herren nun am eigenen Leib zu spüren. Die Zentrale Disziplinarkommission, ein Parteiorgan, konnte ihnen recht mühelos Korruption nachweisen. Ob sie tatsächlich die exorbitanten Summen angenommen haben oder nicht, wird wohl nie jemand erfahren. Vermutlich waren sie in irgendeiner Form bestechlich. Entscheidend, ist, wer im derzeitigen China nicht wegen Korruption angeklagt wird: Xis Getreue, die er derzeit an den entscheidenden Stellen platziert.
Xi stützt sich unter anderem auf zwei Gefolgsleute, um die Geheimpolizei unter seine Kontrolle zu bringen. Beide gelten als loyal und zuverlässig:
Die gefällten Kader waren dabei Teil der Welt des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (Ministry for Public Security, PSB, 公安部) und der entsprechenden Parteiinstitutionen. Diese kontrollieren vor allem die nationale Polizei, die durchaus auch Geheimdienstaufgaben hat.
Vom wesentlich verdeckter arbeitenden Ministerium für Staatssicherheit 国家安全部 war zuletzt weniger zu hören. Dieses wird von Chen Wenqing 陈文清, 62, seit 2016 vergleichsweise geräuschlos verwaltet. Vor vier Jahren kursierten Gerüchte, der loyalere Wang Xiaohong solle Chen als Geheimdienstminister ablösen. Diese erwiesen sich jedoch als falsch. Chen scheint stattdessen weiterhin das Vertrauen des starken Mannes zu genießen.
Die Kette von Todesurteilen wurden am Wochenende auch Teil einer Verschwörungstheorie um einen angeblichen Staatsstreich, bei dem Xi Jinping entmachtet worden sei. Die Urteile gegen die vermeintlichen Verschwörer um Sun Lijun habe Militärs und hohe Parteikader auf den Plan gerufen, die Xi nach der Rückkehr seiner Zentralasien-Reise festgesetzt und die Macht übernommen hätten, lauteten die Gerüchte auf Sozialmedien. Diese verbreiteten sich ausgehend von indischen Twitter-Accounts im Laufe des Sonntags in allen Sprachen und vielen Varianten.
Als Belege wurden Fotos der sechs Verurteilten ebenso herangezogen wie Berichte über eine Sitzung der Militärkommission, an der Xi angeblich nicht teilgenommen habe – dafür aber einer der Generäle, die hinter dem Coup stecken sollen. Ein weiterer “Beweis” bestand aus Videoaufnahmen von Militärfahrzeugen auf einer Autobahn.
Solche Bilder kursieren jedoch tausendfach im Netz; ihre Aussagekraft ist gleich null. Die völlige Abwesenheit seriöser Berichte über Unregelmäßigkeiten in der Führung wurden freilich auf Sozialmedien – wie bei Verschwörungstheorien üblich – als zusätzlicher Beleg für deren Richtigkeit gewertet. Völlig falsch, und besonders leicht zu überprüfen, war die Behauptung, der Zug- und Flugverkehr in die Hauptstadt sei eingestellt.
Fakt ist, dass die hohe KP-Führung nur noch aus Xi-treuen Kadern besteht. Auch die ehemaligen Polizeiminister, die nun verurteilt wurden, befanden sich schon seit mindestens zwei Jahren nicht mehr auf einflussreichen Posten, ihre Netzwerke sind aufgelöst. Es gibt zwar Dissenz in der KP China, doch dieser wird unter dem Deckel gehalten. Ein Militärputsch unter Einnahme der Medienhäuser würde auch nicht verschwiegen, sondern sofort landesweit mitgeteilt, damit das etablierte Lager sich nicht zum Gegenschlag sammeln kann. Einwohner Pekings und Journalisten vor Ort berichten derweil: alles normal in der Hauptstadt.
Vom 26. September an wird Hongkong die Hotel-Quarantäne für Einreisende abschaffen. Das gaben die Behörden am Freitag bekannt. Nach zweieinhalb Jahren fällt somit eine der größten Covid-Restriktionen für Reisende. Stattdessen müssen diese sich nach ihrer Ankunft für drei Tage selbst auf Covid-Anzeichen überwachen. Während dieser Zeit dürfen sie zur Arbeit und zur Schule, lediglich einige Freizeitaktivitäten wie Restaurant- und Barbesuche bleiben eingeschränkt. Auch der PCR-Test, der bisher 48 Stunden vor Flugantritt absolviert werden musste, fällt weg. Für den Reiseantritt reicht ein Schnelltest.
Bisher mussten sich international Reisende drei Tage in einem selbst bezahlten Hotel isolieren und im Anschluss vier Tage selbst überwachen. Zwischenzeitlich betrug die Hotel-Quarantäne sogar drei Wochen. Andere Coronavirus-Bestimmungen bleiben bestehen. Es bleibt weiterhin verboten, sich in Gruppen von mehr als vier Personen in der Öffentlichkeit zu versammeln. Die Maskenpflicht bleibt erhalten – auch Kinder ab zwei Jahren müssen Masken tragen. nib
Eine tschechische Delegation hat mit Taiwan ein Abkommen über eine mögliche Kooperation bei der Entwicklung von Mikrochips unterzeichnet. “Wir sind gekommen, um Türen zu öffnen,” sagte Senator Jiří Drahoš als Delegationsleiter am Freitag in Taipeh. Seit dem 18. September war eine 14-köpfige Abordnung von Politikern und Akademikern aus der Tschechischen Republik in Taiwan; sie ist am Freitag nach ihrer Pressekonferenz wieder abgereist. Deutsche Abgeordnete planen im Oktober gleich zwei Delegationsreisen auf die Insel.
Taiwan wolle das zentraleuropäische Land beim Aufbau eines Halbleiter-Forschungszentrums zu unterstützen, teilte die Regierung in Taipeh mit. Ende Oktober soll eine Delegation taiwanischer Hochschulvertreter nach Tschechien reisen, um internationale Studierende für Taiwans Halbleiter-Studienprogramme anzuwerben.
China fasst hochrangig besetzte Delegation in Taipeh derzeit als Provokationen auf. Prag wiederum nimmt derzeit auf mehreren Feldern die Konfrontation mit Peking in Kauf und unterstützt Litauen im Streit mit der asiatischen Großmacht (China.Table berichtete). Das Verhältnis zu China gilt derzeit insgesamt als schwierig (China.Table berichtete).
Delegationsleiter Drahoš erinnerte außerdem an seinen vorigen Besuch in Taiwan vor 25 Jahren. Viel habe sich seitdem verändert. “Ich weiß wirklich zu schätzen, wie sich Taiwan zu einer vollwertigen Demokratie entwickelt hat, einer Demokratie, die Wert auf Attribute wie Freiheit, Freiheit und den Schutz der Menschenrechte legt”, erklärte Dahoš. David Demes
Der Wasserstand von Chinas größtem Süßwassersee ist auf ein Rekordtief gesunken. Die Behörden in Jiangxi haben erstmals die höchste Warnstufe für die Wasserversorgung ausgesprochen, wie Reuters berichtet. Der Wasserstand an einer wichtigen Messstelle des Poyang ist demnach in den letzten drei Monaten von über 19 auf knapp sieben Meter gesunken. Die Dürre in Jiangxi hält schon mehr als 70 Tage an, während es im Südwesten der Volksrepublik wieder starke Regenfälle gab. “Die extreme Dürre hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, die landwirtschaftliche Produktion und die Ökologie”, sagte Wang Chun, Direktor des Büros für Wasserressourcen in der Provinz Jiangxi, letzte Woche, so die South China Morning Post. Laut Behörden waren seit Ende Juni 17.000 Menschen von Trinkwasserproblemen betroffen.

Die Dürre in Zentral- und Teilen Südchinas dauert schon seit über dreißig aufeinanderfolgenden Tagen an. 13 Provinzen und Regionen sind laut der Beratungsagentur Trivium China betroffen, darunter wichtige Getreide produzierende Provinzen wie Anhui, Henan, Jiangxi und Hunan. In den Hauptstädten von Jiangxi und Hunan sei im September noch kein Tropfen Regen gefallen.
Laut Behördenangaben haben die Dürren allerdings nur einen geringen Einfluss auf die Herbsternte. Auch das US-Landwirtschaftsministerium hält die Schäden für nicht allzu gravierend, wie Satellitendaten laut Trivium zeigen. Dennoch bedeuten diese Nachrichten keine Entwarnung. Denn in wenigen Wochen wird die Herbst- und Wintersaat ausgebracht. “Wenn die Dürre in den nächsten ein oder zwei Monaten kein Ende findet, kann kein Geldbetrag die Ernte im nächsten Frühjahr retten”, schreiben die Trivium-Analysten. nib
Daimler Truck hat mit dem Bau von Lastwagen unter der Marke Mercedes-Benz in China begonnen. Die ersten Fahrzeuge liefen am Freitag im Werk des Gemeinschaftsunternehmens von Daimler Truck und Foton Motor in Peking vom Band, wie das Unternehmen mitteilte. China sei der größte Markt für schwere Lastwagen und biete ein erhebliches Wachstumspotenzial für Daimler Truck, sagte der für das Asiengeschäft zuständige Daimler-Truck-Vorstand Karl Deppen. Zu den angestrebten Stückzahlen äußerte sich Daimler Truck nicht.
2021 wurden in China laut VDA rund 1,5 Millionen schwere Lastwagen verkauft – damit ist die Volksrepublik der größte Markt weltweit und größer als die USA, Japan und Europa zusammen. Westliche Hersteller spielen jedoch dort nur eine Nebenrolle. Chinesische Spediteure achteten bei ihrer Kaufentscheidung in erster Linie auf den Preis, sagte Deppen; die Betriebskosten spielten für sie eine geringere Rolle. Inzwischen sei aber zu erkennen, dass sich die Branche professionalisiere und Aspekte wie Verbrauch oder Reparaturkosten zunehmend mit einbezogen würden. rtr
Ein Professor der Universität Texas A&M bekennt sich schuldig, China-Kontakte geheim gehalten zu haben, obwohl er mit NASA-Mitteln geforscht hat. Cheng Zhengdong hatte vom amerikanischen Staat 750.000 US-Dollar für Weltraumforschung in seinen Laboren erhalten. Einem Gesetz aus der Trump-Zeit zufolge hätte er jede Verbindung zu chinesischen Institutionen offenlegen müssen. Er hat jedoch eine Tätigkeit für eine Hochschule in Guangdong verschwiegen. Cheng wurde zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt.
Auch in Deutschland läuft derzeit eine Diskussion über Hochschulkooperationen mit China. Die “China Science Investigation” hatte ergeben, dass zahlreiche Universitäten technisches Wissen mit chinesischen Institutionen teilen, die militärische Anwendungen haben. Zugleich regt sich Kritik, die eine generelle Diffamierung sinnvoller Hochschulzusammenarbeit befürchtet. fin
Das China-Netzwerk Baden-Württemberg und die Zeppelin Universität in Friedrichshafen befragen erneut Unternehmen zu ihrer Einstellung zu China. Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt bei dem Sinologen Klaus Mühlhahn, derzeit Präsident der Zeppelin-Universität. Die Unternehmensberatung PwC ist Partner bei der anonymen Befragung. Sie läuft bis zum 23. Oktober; eine Auswertung soll bis Ende des Jahres vorliegen. Im vergangenen Jahr gab es eine vergleichbare Umfrage, sodass sich Trends nachzeichnen lassen. fin

Claus Eßers bezeichnet sich als technikaffin, wollte erst Elektrotechnik studieren, wurde dann jedoch Patentanwalt. Zum Jurastudium kam er durch seinen Vater und seinen Onkel. “Irgendwann überlegte ein Mandant von mir, wie er mit chinesischen Mittelständlern Verträge abschließen könne.” Von diesem Tag an ließ Eßers das Thema China nicht mehr los.
Im Jahr 2004 gründete er zusammen mit einem Anwaltskollegen den China-Desk, für den heute drei chinesische Rechtsanwälte tätig sind. Eßers berät sowohl chinesische Mittelständler, die sich auf dem deutschen Markt etablieren wollen, als auch deutsche Firmen, die in China investieren möchten. Neben Handelsrecht und Gesellschaftsrecht gehören Steuerrecht und komplizierte Erbrechtsfälle zu seinen Spezialgebieten. Darüber hinaus ist er Buchautor und hält Vorträge. Bereits seit 1999 ist er Partner der Anwaltskanzlei Hoffmann Liebs in Düsseldorf.
In den Dialog zu gehen, genau zuhören und sich auf seinen Gesprächspartner einstellen – das liegt Claus Eßers. Am besten gelingt das vor Ort. So war er über 60 Mal in China, zuletzt 2019, bevor die Coronavirus-Pandemie und Xi Jinpings Null-Covid-Politik dazwischenkamen. Angesichts der strengen Quarantänebestimmungen und der Abschottung ganzer Städte lautet die momentane Devise für ihn: nicht hinfliegen, sondern alles über Telefon und Internet regeln.
Eßers macht aus seinem unerschütterlichen China-Optimismus keinen Hehl. Seinen deutschen Mandanten rät Eßers zum Dableiben und Durchhalten. “Vor 2019 haben sich die Handelsbeziehungen zu China stetig verbessert, das Vertrauen wuchs. Das kommt wieder. Es wird nur überlagert durch die Pandemie und Russlands Ukraine-Krieg.” Wenn die Pandemie im Griff sei und die Schiffe wieder verladen werden, gehe “ein Ruck durch das Land”. Dann seien alle wieder mit Feuereifer dabei.
Nicht nur Vertrags-, auch Antragsverfahren in China können kompliziert sein. Das erfährt Eßers gerade am eigenen Leib: “Wir sind seit zwei Jahren dabei, in Shanghai ein eigenes Büro zu gründen. Alle Anträge liegen der chinesischen Regierung vor.” Wann diese genau genehmigt sind, sei ebenso ungewiss wie die Pandemie-Entwicklung. “Aber egal, wie lange es dauert, wir verfolgen unsere Büroeröffnung weiter.” Daniela Krause
Qiu Yong wird Leiter der Abteilung der Kommunistischen Partei der Shanghaier Börse. Der hochrangige Beamte der China Securities Regulatory Commission (CSRC) löst Huang Hongyuan ab, der nach Angaben der Börse einen anderen Posten übernehmen wird.
Andy Zhang wird CEO des Gebrauchtuhren-Händlers Watchbox China mit Sitz in Shanghai. Er war zuvor unter anderem bei dem deutschen Uhrmacherhaus A. Lange & Söhne beschäftigt. Watchbox ist auf den Weiterverkauf von Luxusuhren spezialisiert.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Was hat den Kopf eines Kamels, die Ohren eines Ochsen, die Hörner eines Hirsches, den Hals einer Schlange, den Hinterleib einer Muschel, die Klauen eines Adlers, die Tatzen eines Tigers, den schuppigen Körper eines Fisches und die feurigen Augen eines Teufels? Richtig, ein Drache. Zumindest aus der Warte der chinesischen Mythologie.
Der Drache ist quasi ein jahrhundertealter Markenbotschafter der chinesischen Kultur. Er ist zum Beispiel nicht nur in der Verbotenen Stadt – dem Kaiserpalast – allgegenwärtig, sondern poltert auch durch Souvenirkollektionen im ganzen Land. Die Chinesen verbindet eine besondere Beziehung zu den schuppigen Fabelwesen. In China gelten sie nämlich nicht als fauchend böse und feindlich, sondern als Urahnen der Menschen. Als sympathische Ungeheuer symbolisieren sie bis heute Reichtum, Glück, Güte und Intelligenz.
Solche Drachenmythologie und Kultursymbolik krallt Sie wenig und erinnert Sie nur an angestaubte Reiseführer? Dann halten Sie sich besser fest. Denn jetzt geht es auf einen teuflischen Drachenritt durch den chinesischen Alltag beziehungsweise die moderne chinesische Sprache. Denn in China sind Drachen im wahrsten Wortsinne in aller Munde und teils sogar an Orten zu finden, wo man sie kaum erwartet – zum Beispiel auf Zootouren, Speiseplänen und Stadtautobahnen, manchmal auch in der Wettervorhersage, ja sogar als “Hausdrache” in jedem Badezimmer!
In chinesischen (und deutschen) Tiergärten trifft man zum Beispiel auf “Drachenkatzen” (龙猫 lóngmāo) – besser bekannt als Chinchillas – sowie “Farbwechseldrachen” (变色龙 biànsèlóng – Chamäleons) oder die ihrem Namen wenig Ehre machenden da spindeldürren “Meerdrachen” (海龙 hǎilóng), auch Seenadeln genannt. Ausgestorben sind zum Glück “Fürchtedrachen” (恐龙 kǒnglóng), also Dinosaurier, und da allen voran der “Brutalodrache” (暴龙 bàolóng) alias Tyrannosaurus.
Zu den im Westen bekanntesten kulinarischen Drachengattungen gehören in erster Linie zwei Flüssigdrachen: der grüne “Drachenbrunnentee” (龙井茶 lóngjǐngchá) und der “Schwarzdrachentee” (乌龙茶 wūlóngchá), letzteren kennen wir als Oolong. Doch vielleicht haben Sie auch schon mal unbewusst “Drachenaugen” (龙眼 lóngyǎn) verspeist, sprich Longanfrüchte, oder standen beim ersten Restaurant-Rendezvous auf Kriegsfuß mit einer “Drachengarnele” (龙虾 lóngxiā), also einem Hummer. Das Verspeisen von “Minidrachengarnelen” (小龙虾 xiǎolóngxiā) – das ist der possierliche kleine Bruder des feuerroten Getiers, nämlich der Flusskrebs – zelebrieren die Chinesen gerne als geselliges Schalenmassaker.
Wer sich jetzt in die Gemüsewelt flüchtet, bleibt in China leider auch nicht verschont und gerät früher oder später in die Fänge der schmackhaften zackigen “Drachenbohne” (龙豆 lóngdòu). Darf’s zum Abschluss als Nachtisch noch ein “Pferdeklammerdrache” sein? Hat zum Glück nichts mit geklammerten Pferden oder gehuften Drachen zu tun, sondern ist einfach die lautliche Übertragung zuckerzarter französischer Macarons. Nicht verwechseln bitte mit dem (süßen?) französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron – der heißt auf Chinesisch “Makelong” (马克龙 Mǎkèlóng), auch nur eine lautliche Anlehnung, ließe sich aber ganz wörtlich mit “Pferdebezwingerdrache” übersetzen.
Viele chinesische Kaiser sollen sich als direkte Nachfahren der Drachen verstanden haben. Ist natürlich heute widerlegt. Trotzdem hat sich die Denke, dass besondere Persönlichkeiten es drachenmäßig drauf haben, im chinesischen Wörterbuch verfestigt. Das Wort chénglóng 成龙 “zu einem Drachen werden” bedeutet bis heute “es zu etwas bringen” beziehungsweise “groß rauskommen”. Diese Redensart inspirierte einst einen jungen Hongkonger Kampfkunstkünstler mit Nachnamen 成 dazu, sich das Künstlerpseudonym Chéng Lóng 成龙 zuzulegen. Der Name hat seinen Zweck erfüllt und der Rest ist Geschichte. Im Westen kennen wir ihn heute als Jacky Chan.
Dass Drachenmetaphorik den Chinesen auf der Zunge liegt, zeigt sich auch beim Anblick einiger weiterer Alltagsbegriffe. So schlängeln sich aus chinesischer Sicht da, wo wir im Deutschen Schlangen sehen, vielmehr Drachen: etwa im Falle von Menschenschlangen (auf Chinesisch人龙 rénlóng “Menschendrachen“) oder Autoschlangen (auf Chinesisch车龙 chēlóng “Wagendrachen”). Endlose Feierabend-Blechkarawanen oder wildes Getümmel in den Straßen kommentieren Chinesen als 车水马龙 chē shuǐ mǎ lóng – frei übersetzt: “Autos wie Wasser und Pferde wie Drachen”, sprich: hohes Verkehrsaufkommen oder heilloses Tohuwabohu.
Während uns im deutschsprachigen Raum alte Wasserleitungen mit hahnenkammartigem Drehknauf einst an Federvieh erinnert haben mögen, fließt das Nass in China nicht aus dem Wasserhahn, sondern dem “Wasserdrachenkopf” (水龙头 shuǐlóngtóu). Vielleicht lag diese Assoziation auch deshalb nahe, weil der Drache den Chinesen als Beherrscher des Wassers gilt. Er bestimmt die Jahreszeiten und die Ernte und soll im Winter in Gewässern leben und im Frühsommer in den Himmel aufsteigen. Und dort treibt er laut chinesischer Meteorologensprache sein Unwesen als “Drachenwirbelwind” (龙卷风 lóngjuǎnfēng) – das ist die Bezeichnung für Tornado.
Sogar das Wirtschaftsvokabular haben die Drachen sich gekrallt. Kein Wunder, gilt der Drache in der chinesischen Kultur schließlich als wohlstandsverheißend. Branchen- und Marktführer adelt das Putonghua deshalb als “Drachenköpfe” (龙头 lóngtóu) und spricht von “Marktdrachenköpfen” (市场龙头 shìchǎng lóngtóu = Marktführer), “Drachenkopfprodukten” (龙头产品 lóngtóu chǎnpǐn = führende Produkte) und “Drachenkopffirmen” (龙头企业 lóngtóu qǐyè = führende Unternehmen). Und wenn Sie die einst aufstrebenden ost- und südostasiatischen Wirtschaften noch als “Tigerstaaten” kannten, wird Sie auch hier das Chinesische eines Besseren belehren. Denn in China hießen Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur in diesem Zusammenhang schon immer亚洲四小龙 Yàzhōu sì xiǎolóng – die “vier Drachenbabys Asiens“.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.