China ist einer der größten Exportmärkte für den deutschen Mittelstand. Umso größer ist die Sorge über den Aufstieg der Konkurrenz aus Fernost. “Wir schützen unsere Technologie noch immer zu stiefmütterlich“, sagt der Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds, Ludwig Veltmann, im Interview mit China.Table. Marcel Grzanna sprach mit ihm über Chinas Ambitionen in Sachen Technologieführerschaft.
Der Mittelstand dürfe technisches Know-how nicht leichtfertig an die Konkurrenz aus der Volksrepublik verkaufen, sagt Veltmann. Bei Digitalisierung und Datenauswertung müsse die deutsche Wirtschaft stärker werden. Im Globalisierungswettstreit plädiert Veltmann für ein geeint auftretendes Europa und weltweit festgelegte Umwelt- und Sozialstandards. Das Lieferkettengesetz sieht er jedoch kritisch.
Um den Wettbewerb zwischen China und Deutschland geht es auch in Frank Sierens Analyse zu den Preisen von E-Autos. Das Thema trifft derzeit in Deutschland einen Nerv: Elektrofahrzeuge seien zu teuer, hieß es in einem der Trielle um die Kanzlerschaft. Eine Krankenschwester könne sich kein E-Mobil leisten, deswegen sei ein Verbrenner-Verbot unsozial. China beweist das Gegenteil. Dort sanken die Durchschnittspreise für E-Autos in den letzten zehn Jahren um fast die Hälfte – während sie in Europa und den USA stiegen. Verantwortlich dafür sind auch die Milliarden-Subventionen der Zentralregierung. Die Expansionspläne der chinesischen Konkurrenz könnten die europäischen Hersteller nun auf dem falschen Fuß treffen.
In den chaotischen letzten Tagen der Trump-Präsidentschaft rief US-General Mark Milley bei einem hochrangigen chinesischen Militär, General Li Zuocheng, an. Die Botschaft: Habt keine Sorge vor einem überraschenden US-Angriff – ich würde euch vorwarnen. Milley wollte einen versehentlichen Kriegsausbruch der Supermächte verhindern. Wer ist der General, dem der Milley-Anruf galt? Finn Mayer-Kuckuk hat sich auf Spurensuche begeben: General Li gehört zum Zentralkomitee der KP und genießt als einer der wichtigsten Militärs das Vertrauen von Präsident Xi – und international hohes Ansehen.
Einen angenehmen Wochenstart!

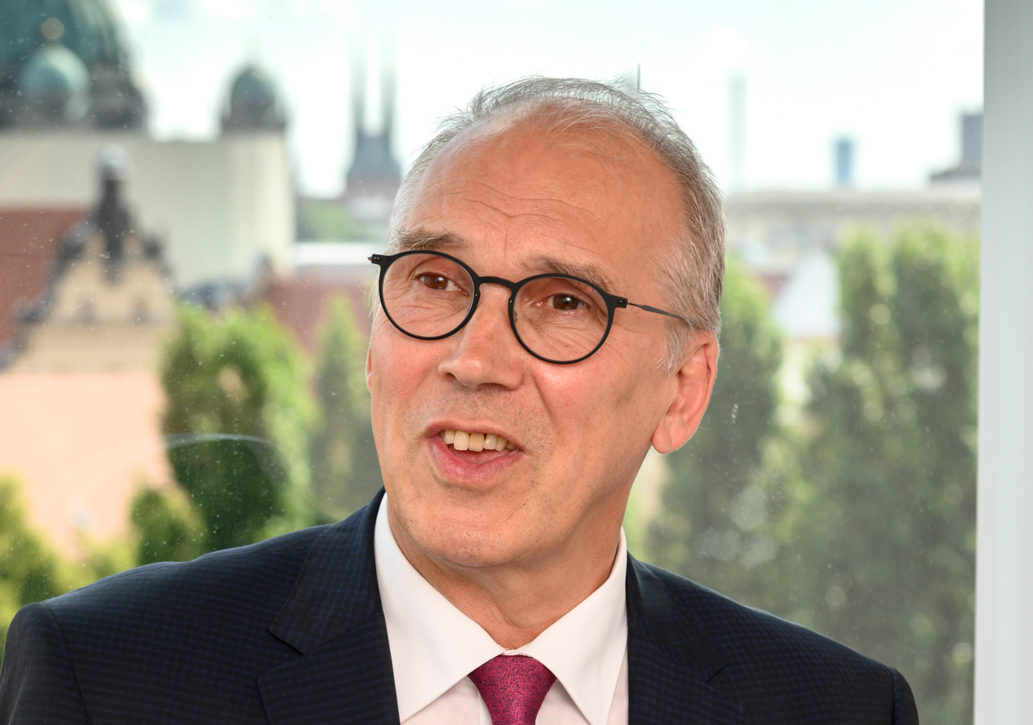
Herr Veltmann, was wäre dem deutschen Mittelstand lieber: Eine Welt unter US-amerikanischer oder chinesischer Technologieführerschaft?
Die Amerikaner sind uns lieber, solange sie keinen Präsidenten wie Trump haben. Sie sind uns kulturell deutlich näher und haben auch ein ähnliches Verständnis von Demokratie. China ist eine Autokratie. Und ein Land, das autoritär organisiert wird, ist uns grundsätzlich suspekt.
Welche Konsequenzen hätte eine chinesische Technologieführerschaft für Deutschland?
Da gibt es zwei Ebenen. Einerseits würde die Wertschöpfungstiefe hierzulande abnehmen. In manchen Technologiebranchen spielen deutsche Unternehmen heute schon keine Rolle mehr. China macht ja selbst vor Technologien nicht halt, in denen die deutsche Industrie bislang noch eine führende Rolle spielt. Wenn China Flugzeuge beispielsweise auf dem Weltmarkt verkauft, wo heute noch Airbus und Boeing den Ton angeben, wird deutlich sichtbar, wie Wertschöpfung nach China abwandert.
Und die zweite Ebene?
Das sind die politischen Implikationen. Es geht um die Frage, wie wir leben wollen. Wir sind hier sehr stolz auf unsere Demokratie und unsere Lebensweise, und sehen unsere Staatsform als die bessere auch im Hinblick auf Wachstums- und Entwicklungsperspektiven an. Nun aber kommt ein Land daher, das autokratisch geführt wird und uns mit seinem Staatskapitalismus zeigt, “was eine Harke ist”. Das könnte den einen oder anderen Technologiebegeisterten dazu bewegen, an unserer Demokratie zu zweifeln. Es könnten Stimmen aufkommen, die nach einem “starken Mann” im Land verlangen, der die mitunter lähmenden Prozeduren in demokratischen Gremien zum Anlass nimmt, Freiheitsrechte einzuschränken. Das besorgt mich.
Halten Sie es für ein reales Szenario, dass wir zur Diktatur werden, weil China wirtschaftlich erfolgreich ist?
In dem Maße, in dem unsere Unternehmen hier an der Bürokratie und langwierigen Prozesse verzweifeln, schaffen wir den Nährboden für solches Gedankengut. Ich höre immer mal wieder aus den Unternehmen, wie unkompliziert und schnell Projekte in China umgesetzt werden. Unsere Firmen dagegen befinden sich gefühlt immer in der Warteschleife für die Genehmigung hierfür oder dafür, und dabei fallen ständig satte Verwaltungsgebühren an, obwohl die Unternehmen reichlich Steuern zahlen. Diese Gesamtsituation produziert viel Frust.
Droht der deutsche Mittelstand zum Bittsteller Chinas zu werden?
Das sind wir doch teilweise jetzt schon. China schottet sich immer weiter ab und arbeitet auffällig in vielen Wirtschaftsbereichen an weitreichender Autarkie. Immer mehr deutsche Firmen, die bei potenziellen chinesischen Geschäftspartnern anklopfen, stoßen auf Probleme. Die Schikane, die Ausländer während der Coronazeit bei der Einreise ins Land erfahren, ist symptomatisch. Außerdem darf nicht mehr offen über systemkritische Vorgänge gesprochen werden. Wenn es um sensible Dinge geht, verbietet sich die chinesische Seite sofort jede Diskussion.
Wäre all das anders, wenn die US-Amerikaner das Rennen um die technologische Dominanz gewinnen?
Da gehe ich von aus. Mal abgesehen von der besseren Kompatibilität unseres politischen Systems mit dem der USA hat China eine klare Strategie formuliert. Nämlich, dass es gegen die Abhängigkeit von Zulieferungen aus dem Ausland arbeitet. Die Technologieführerschaft würde China dabei massiv helfen, sich selbst zu versorgen. Das Land wäre als Exportmarkt für deutsche Unternehmen deutlich weniger attraktiv.
Hat der Mittelstand keine Mittel, um eine drohende chinesische Technologie-Vorherrschaft zu verhindern?
Durch mehr Flexibilität können Erfindergeist und die Einsatzbereitschaft im Mittelstand noch vergrößert werden. Doch dazu muss die Politik den Rahmen schaffen. In den Sonntagsreden ist es immer ganz leicht, den Mittelstand als das Fundament der deutschen Wirtschaft zu preisen und seine Förderung anzukündigen. Am Montag wird es dann wieder schwieriger. Statt Flexibilität gibt es dann Bauauflagen, langwierige Genehmigungs- und Prüfprozesse und Restriktionen, die den Mittelstand behindern. Die auferlegte Ausweitung der Erfassung von Arbeitsstunden beispielsweise passt überhaupt nicht in die heutige Zeit und behindert Betriebe unnötig im Wettbewerb.
Ist es die Schuld der hiesigen Politik, dass China kein Level Playing Field zulässt, was einen enormen Vorteil für chinesische Unternehmen bedeutet?
Die Politik leistet nicht, was sie eigentlich leisten müsste. So könnte sie in der EU starke Allianzen schmieden. Als Europäer setzen wir ohne solche den Chinesen doch gar kein Gewicht entgegen. Wir haben nicht mal einen EU-Außenminister. Da kommt jedes Land der EU allein auf China zu – das spielt einem so großen Land natürlich in die Karten. Wir brauchen deshalb unbedingt ein stärkeres Europa.
Indem es nach dem Motto “Wie du mir, so ich dir” den Chinesen den Zugang zu Ausschreibungen verbietet?
Nein, das wird nicht ohne Weiteres gelingen, wenn wir “tit for tat” spielen. Es bedarf globaler Zusammenarbeit mit klaren Regeln durch die Welthandelsorganisation oder ähnliche Institutionen. Multilaterale Verständigungen sind im Umgang mit China der bessere Hebel als der Bilateralismus. Angesichts der Größe und Marktmacht Chinas ist es unverzichtbar, geschlossen aufzutreten, um seine Interessen gegenüber der chinesischen Regierung wirksam zu vertreten.
Sie kritisieren die Politik. Aber hätte sich der Mittelstand auch besser auf die Herausforderungen einstellen können, denen er aufgrund des Aufstiegs Chinas begegnet?
Mitte der 1980er-Jahren habe ich ein Forschungsprojekt über Kooperationen in Taiwan durchgeführt. Damals war es völlig abwegig, dass die Volksrepublik China ein maßgebliches Gewicht in der Welt bekommen würde. Im Übrigen ging ich nicht als Einziger davon aus, dass sich vielmehr Taiwan wegen seiner damaligen wirtschaftlich deutlichen Überlegenheit gegenüber der Volksrepublik im internationalen Wettbewerb besser behaupten würde. Einem kommunistischen Regime haben wir diesbezüglich dagegen nicht sehr viel zugetraut.
Die Volksrepublik China hat in den zurückliegenden Jahren aber das Gegenteil bewiesen – trotz autokratisch sozialistischer Staatsform. Längst ist das Land nicht mehr die Werkbank der Welt für Billigprodukte und Imitate westlicher Marken. Vielmehr strömten in gewaltiger Dosis Kapital und Know-how ins Land, womit die Gewichte verschoben wurden. Heute gibt es kaum eine Technologie, in der China nicht den Anspruch oder den Ehrgeiz hat, Weltspitze zu sein. Diese Absichten hätte der Mittelstand frühzeitig erkennen müssen und nicht leichtfertig technisches Spitzen-Know-how an China verkaufen dürfen.
Dafür ist es zu spät, aber schützen wir unsere Technologie wenigstens heute ausreichend?
Das tun wir immer noch zu stiefmütterlich. Ich will nicht dem Protektionismus das Wort reden. Aber wenn ein chinesisches Unternehmen ein deutsches erwirbt, um zu gucken, wie das alles so funktioniert, und dann aber das Geschäft in China für den chinesischen Markt weiterbetreibt, dann muss uns klar sein, dass wir am Ende nur allzu rasch in die Röhre gucken. Da müssen wir klüger werden.
Gibt es denn nach all den Jahren immer noch Unternehmen, die von den tiefgreifenden Veränderungen durch Chinas tragende Rolle nichts mitbekommen?
Die ehrgeizigen Ziele Chinas sind inzwischen fast jedem Unternehmen in irgendeiner Form präsent. Aber es gibt noch zu wenig strategische Pläne, dem zu begegnen, was ein paar Tausend Kilometer weiter weg geschieht.
Chinas kategorische Ablehnung jeglicher Verantwortung für die Corona-Pandemie, die Vertragsbrüche in Hongkong, die Tragödien aus Xinjiang: Hat im deutschen Mittelstand in jüngster Vergangenheit ein Prozess begonnen, darüber nachzudenken, ob es moralisch anständig ist, mit China Geschäfte zu machen?
Natürlich hat es das. Und es gibt viele Unternehmen, die daraus Konsequenzen ziehen. Es herrscht schließlich im Mittelstand grundsätzlich Zustimmung für eine Politik, die sagt: Wir achten auf Menschenrechte und Produktionsbedingungen in diesem Land. Aber es ist letztlich nicht realistisch, den Unternehmen abzuverlangen, eine Art Kontrollfunktion zu übernehmen und allein die Verantwortung dafür zu tragen, wo die internationale Politik keine Lösungen findet. Das einzelne mittelständische Unternehmen wird kaum die immer komplexeren Lieferketten nachverfolgen und für das Verhalten der Vorlieferanten oder das Handeln deren Regierungen alleinige Verantwortung übernehmen können.
Ist das menschlich oder müssen wir den Unternehmen mehr abverlangen?
Da stellt sich die Frage, wie weit man einen einzelnen Unternehmer verantwortlich machen kann. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz verlangt ja, dass die Lieferkette nur aus Akteuren mit weißen Westen besteht. Aber so arbeitsteilig, wie die Welt funktioniert, ist das doch gar nicht darstellbar. Wichtig wäre, dass Umwelt- und Sozialstandards durch die Weltgemeinschaft festgelegt werden. Darum sollte sich etwa die WTO kümmern. Dann könnten die Unternehmen viel effizienter ihre Arbeit tun und würden nicht durch kostspielige Bürokratiemonster ausgebremst.
Welche Werkzeuge bleiben dem Mittelstand jenseits politischer Forderungen?
Wenn wir es schaffen, Kreativität und Innovationen zu entfesseln und starke Marken zu schaffen oder fortzuentwickeln, dann haben wir weiterhin beste Chancen im internationalen Wettbewerb. Denn dann können wir uns als unverzichtbarer Akteur in den globalen Wertschöpfungsketten positionieren. Noch ist das Image deutscher Produkte noch sehr gut in China. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass auch das abnimmt. Der Dieselskandal hat das deutsche Auto auch in China unter Druck gesetzt, natürlich auch weil die chinesische Propaganda das für sich genutzt hat.
Vom Grad der Digitalisierung ganz zu schweigen.
Und auch da müssen wir uns fragen, weshalb wir den Zug zu verpassen drohen und ihn in vielen Bereichen leider schon verpasst haben. Digitalisierung benötigt großes Investment, aber dieses in Deutschland in der notwendigen Geschwindigkeit zu mobilisieren, ist oft schlicht nicht in gleichem Maße möglich wie etwa in den USA oder in China. Dabei kann der überfällige Transformationsprozess nur dann gelingen, wenn digitale Tools und vor allem digital gesammelte und aufbereitete Daten gezielt zum Einsatz kommen.
Für den Handel etwa ist es wichtig, die Kundenbedürfnisse genau zu kennen. Wem dies am besten gelingt, der ist im Wettbewerb ganz vorn. Wirtschaftlicher Erfolg erklärt sich heute zumeist datenbasiert. Noch hinken wir bei der Datenauswertung gewaltig hinterher. Wenn man die Vielfalt und den Nutzen der Dienstleistungen etwa auf der Handelsplattform Alibaba näher betrachtet, wird deutlich, wo die Reise im Wettbewerb hingeht.
Das klingt nach viel Arbeit in schwieriger Ausgangslage. Wie schätzen sie die Stimmung im Mittelstand ein?
Mittelständler sind Berufsoptimisten mit erheblicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das stärkt nicht nur ihre Unternehmen und schützt sie gerade in Krisenzeiten, sondern stabilisiert zugleich ganze Volkswirtschaften. Digitalisierung und die sich rapide verschärfende Debatte zum Thema Nachhaltigkeit lösen dramatische Veränderungen in den Märkten aus, denen das einzelne mittelständische Unternehmen immer weniger gewachsen ist. Der Kooperationsgedanke erfährt deshalb gerade wieder eine Renaissance, denn nur gebündelte Kräfte können die Nachteile zu kleiner Einheiten ausgleichen.
Der Mittelstandsverbund bringt hierzu seine Expertise für die Stärkung und Fortentwicklung der Unternehmen auf der Basis der genossenschaftlichen Idee konsequent bei den von ihm vertretenen 230.000 Unternehmen in 320 Unternehmensverbünden aus 45 Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbranchen ein. Hierbei gilt es, den politischen Entscheidungsträgern immer wieder den Wert der kooperativen Wirtschaftsform vor Augen zu führen und für deren Freiräume – etwa in der Kartell- und Wettbewerbspolitik – einzutreten. Als Unternehmer gut vernetzt zu sein, entfaltet sich nicht nur zunehmend als wirtschaftlicher Vorteil, es trägt auch zu einer besseren Stimmung bei.
Ludwig Veltmann, 62, lernte in den 1980er-Jahren Chinesisch und zog für Forschungsprojekte nach Taiwan und in die Volksrepublik. Seit 2001 verfolgt er als Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes den wachsenden Einfluss der Volksrepublik auf die deutsche Wirtschaft.
Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) legte Anfang September die Höhe der Subventionen offen, die die Autohersteller während der vergangenen fünf Jahre erhalten haben. Demnach gab Peking umgerechnet insgesamt 4,3 Milliarden Euro aus, um die Produktion von E-Autos anzukurbeln (China.Table berichtete). Dazu zählen rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie Hybridfahrzeuge. Während die Zahlungen pro Fahrzeug um vier Fünftel sanken, zahlte die Regierung 2020 aufgrund des Verkaufsbooms bei E-Autos mit umgerechnet fast 1,4 Milliarden Euro mehr als das Zehnfache an Subventionen als noch 2016, berichtet die Wirtschaftszeitung Caixin. Laut Analysten könnte der jährliche Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen in China bis 2025 auf 8,3 Millionen Stück steigen.
Peking war aus mehreren Gründen daran interessiert, Chinas E-Automarkt unter die Arme zu greifen. Dazu zählen die Verbesserung der Luftqualität in den Ballungsräumen sowie die Technologieführerschaft in einer sich neu entwickelnden Branche. Im Jahr 2017 beschloss Peking dennoch, die Fördergelder nach und nach zu streichen, um sie 2020 dann ganz auslaufen zu lassen. Am Ende dieser Konsolidierungsphase sollte sich der Markt selbst tragen, so der Plan. Dass viele Start-ups dabei untergingen, nahm die Regierung in Kauf. Die Coronakrise machte der Regierung jedoch einen Strich durch die Rechnung.
Pekings aktuelles Ziel ist es, alle NEV-Anreize bis Ende 2023 auslaufen zu lassen, anstatt wie ursprünglich geplant im Jahr 2020. Das gaben die zuständigen Behörden im April vergangenen Jahres bekannt.
Die Subventionen haben sich ausgezahlt: Heute sind die Autos in China billiger und wettbewerbsfähiger als in Europa. Günstige E-Autos für die breite Masse gibt es in China schon ab 3.700 Euro (China.Table berichtete). In Europa startet die Preisliste erst bei 15.700 Euro. Hier haben sich die Hersteller auf Fahrzeuge im höheren Segment fokussiert. In den USA fallen sogar 24.800 Euro für ein Einsteigermodell an. In den westlichen Märkten ist zudem der Durchschnittspreis für E-Autos in den letzten Jahren um gut ein Drittel gestiegen. Dagegen haben sich in China die Anschaffungskosten seit 2011 im Durchschnitt auf 22.100 Euro fast halbiert.
Eins ist klar: Die Abschaffung der chinesischen Subventionen bringt keine Erleichterung für die deutsche Autoindustrie. Je weniger Subventionen die chinesische Konkurrenz erhält, desto mehr ist sie gezwungen, international zu expandieren. Gelingt es den europäischen Herstellern nicht, rechtzeitig günstigere Modelle auf den Markt zu bringen, könnten die chinesischen Hersteller mit ihren preiswerten und zunehmend attraktiven E-Autos schnell große Marktanteile an sich reißen. Schon jetzt unterhalten Firmen wie Geely oder SAIC eigene Showrooms und Niederlassungen in Deutschland. Viele Hersteller planen die Expansion nach Europa (China.Table berichtete).
Das bedeutet, dass die deutschen Hersteller auf dem Heimatmarkt trotz des Rückgangs der Subventionen in China weiterhin auf Förderung angewiesen bleiben. Deutschlands Steuerzahler subventionieren E-Autos mit bis zu 20.000 Euro pro Fahrzeug. Auf absehbare Zeit können Stromer preislich nicht mit Verbrennerfahrzeugen konkurrieren und bleiben auf Subventionen angewiesen, erklärt Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer. Vor allem durch die hohen Kosten für die Batteriefertigung seien E-Autos teurer. Günstigere Elektroautos anzubieten, werde noch dauern, so Schäfer. “Wir werden günstigere Angebote mit weiterem technischen Fortschritt machen können, aber erst nach einer gewissen Übergangsphase.”
China hat in den letzten Jahren am meisten Patente für 6G-Technologien angemeldet. Das geht aus einer Untersuchung der japanischen Zeitung Nikkei und dem japanischen Forschungsunternehmen Cyber Creative Institute hervor. Die beiden Partner haben knapp 20.000 Patentanmeldungen in neun 6G-Technologiebereichen ausgewertet. Demnach haben Unternehmen und Forschungsinstitute aus China 40 Prozent der Patente in Bereichen wie Kommunikation, Quantentechnologie, Basisstationen und künstliche Intelligenz angemeldet. Die USA liegen mit 35 Prozent der Anmeldungen knapp dahinter. Europa und Japan konnten jeweils knapp unter zehn Prozent auf sich vereinen.
Huawei sowie die Staatsfirmen State Grid und China Aerospace Science and Technology gehören zu den größten Inhabern von 6G-Patenten, so Nikkei. Trotz der Tech-Sanktionen von US-Präsident Trump sei es China gelungen, seine Wettbewerbsfähigkeit im 6G-Bereich durch die Mobilisierung staatlicher Unternehmen und Universitäten zu erhalten.
Die 6G-Technologie ermögliche aufgrund ihrer Geschwindigkeit beispielsweise vollautonom fahrende Autos, Virtual-Reality Anwendungen in höchster Auflösung und Internetverbindungen selbst an abgelegensten Orten, so Nikkei. Die 6G-Technologie wird demzufolge ab 2030 kommerziell nutzbar sein. Staaten, die viele Patenten anmelden, werden die zukünftigen Industriestandards mitbestimmen. nib
Der strauchelnde Immobilienentwickler Evergrande hat am Samstag angefangen, Investoren mit verbilligten Immobilien zu entschädigen, wie Bloomberg berichtet. Das Unternehmen teilte über WeChat mit, Anleger, die an der Rückzahlung von Vermögensverwaltungsprodukten gegen Sachwerte interessiert sind, sollten sich an ihre Anlageberater oder lokale Evergrande-Niederlassungen wenden, so Reuters. Den Berichten zufolge hätten über 70.000 Anleger, darunter viele Angestellte des Unternehmens, die Vermögensprodukte gekauft. Umgerechnet circa 5,2 Milliarden Euro dieser Produkte seien nun fällig, schreibt das Wirtschaftsportal Caixin. Investoren könnten zwischen verbilligten Wohnungen, Büro- und Einzelhandelsflächen oder Parkhäusern wählen, so Reuters.
Kommenden Donnerstag muss Evergrande Zinsen in Höhe von umgerechnet 100 Millionen Euro für zwei Anleihen bezahlen. Der Termin gilt als wichtiges Zeichen dafür, ob der Konzern über genug Liquidität verfügt, um den Verpflichtungen nachzukommen, wie Bloomberg berichtet. Bei den Zahlungen gegenüber Banken und Lieferanten war der Konzern schon in Rückstand geraten (China.Table berichtete). Das Unternehmen hat ein Schuldenberg in Höhe von umgerechnet über 250 Milliarden Euro angehäuft. nib
Chinas Gesuch, Mitglied des Handelsbündnis Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) zu werden, stößt bei einigen der bisherigen Mitglieder auf Skepsis. “Wir müssen untersuchen, ob [China] bereit ist, die hohen Standards zu erfüllen“, die der Handelspakt verlangt, sagte der japanische Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie Hiroshi Kajiyama laut Nikkei Asia.
Auch Australien äußerte Zweifel. Australiens Handelsminister Dan Tehan verwies demnach auf Zölle, die China auf wichtige australische Exportgüter wie Wein und Gerste verhängt hat (China.Table berichtete), nachdem das Land eine Untersuchung des Ursprungs des Corona-Virus gefordert hatte. Nur wenige Analysten glauben, dass Chinas Mitgliedsantrag für den pazifischen Handelspakt angenommen wird. Das CPTPP hat elf Mitglieder, darunter Japan, Australien, Kanada, Mexiko, Vietnam und Peru. Auch Großbritannien hat infolge des Brexits um Aufnahme gebeten (China.Table berichtete). nib
Die größte oppositionelle Gewerkschaftskoalition Hongkongs kündigte am Sonntag Pläne für ihre Auflösung an. Die Organisation hat einen Auflösungsantrag gestellt, über den die Mitgliedsorganisationen am 3. Oktober abstimmen werden. “Wir möchten uns bei den Menschen in Hongkong entschuldigen, dass wir nicht weitermachen können”, sagte Joe Wong, Co-Vorsitzender der Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKFTU) laut Reuters unter Tränen. Einige Mitglieder hätten kürzlich Nachrichten mit Gewaltandrohungen erhalten. Die Organisation befürchtet, von der Regierung wegen angeblicher Verstöße gegen das von Peking erlassene Nationale Sicherheitsgesetz weiter verfolgt zu werden. Der Mitbegründer der Gewerkschaftskoalition, Lee Cheuk-yan, sitzt wegen seiner Rolle bei den Protesten gegen Hongkongs Regierung im Jahr 2019 im Gefängnis. Der Geschäftsführer der Organisation, Mung Siu Tat, gab kürzlich bekannt, Hongkong verlassen zu haben.
Erst im vergangenen Monat hatte sich die Lehrergewerkschaft Hong Kong Professional Teachers’ Union aufgelöst, die 100.000 Mitglieder umfasste. Der Entschluss zur Auflösung wurde gefasst, nachdem Chinas Nachrichtenagentur die Gewerkschaft als “bösartigen Tumor” bezeichnet und Hongkongs Polizeipräsident Untersuchungen gegen die Organisation angekündigt hatte, wie Bloomberg berichtet.
Laut eigenen Angaben repräsentiert die Hong Kong Confederation of Trade Unions 93 Mitgliedsorganisationen mit 145.000 Mitgliedern. Zu ihren Aufgaben gehörte es, unabhängige Gewerkschaften zu organisieren, Arbeitskonflikte zu schlichten und berufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeiter anzubieten. nib
China und Russland wollen nach eigenen Angaben nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gemeinsam für Stabilität in der Region sorgen. Bei einer Videokonferenz kündigten Chinas Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin an, künftig Geheimdienstinformationen auszutauschen und regelmäßige Gespräche über Afghanistan zu führen. Das Gespräch fand im Rahmen der China-geführten Shanghai Cooperation Organization (SCO) statt (China.Table berichtete), Putin war dem Gipfeltreffen in Tadschikistan per Video zugeschaltet. Xi Jinping sagt, die SCO-Mitgliedsstaaten sollten zu einem reibungslosen Übergang in Afghanistan beitragen und Afghanistan anleiten, eine “integrative politische Struktur” zu entwickeln, wie Staatsmedien berichteten. Außerdem rief Xi die Führung in Kabul zu einer gemäßigten Innen- und Außenpolitik auf.
“Ich hoffe, dass diese Vorschläge zu dem Ziel beitragen, gemeinsam Sicherheit in unserer Region zu erreichen”, sagte Xi demnach. Putin wiederholte Xis Aufruf an die regionalen Hauptstädte, ihre Zusammenarbeit zu verstärken und das regionale Geheimdienstnetzwerk der SCO zum Austausch von Informationen über terroristische Organisationen zu nutzen. Er schlug vor, das SCO-Mandat auch auf die Kontrolle von Waffen und organisierter Kriminalität auszuweiten.
Xi forderte “relevante Parteien” in Afghanistan auf, “terroristische Organisationen auf afghanischem Gebiet auszurotten”, und versprach, der vom Krieg zerrütteten Nation mehr Hilfe zu leisten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der chinesische Präsident kritisierte indirekt die USA: “Bestimmte Länder” sollten ihre Verantwortung für die zukünftige Entwicklung Afghanistans als “Anstifter der schwierigen Situation” übernehmen.
Die SCO besteht aus China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan. Die Organisation hat zudem mit der Aufnahme des Iran begonnen, auch Ägypten, Katar und Saudi-Arabien sind als Gesprächspartner im Zuge der Expansion hinzugekommen. ari
Eine 33-jährige Chinesin hat in Peking ein Krankenhaus verklagt, weil es ihre Eizellen nicht einfrieren wollte. Als Grund dafür habe die Klinik die nationalen Gesetze genannt, die das Einfrieren von Eizellen nur für Eheleute erlaubt, wie Bloomberg berichtete. Teresa Xu verklagte daraufhin das staatliche Pekinger Krankenhaus für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Capital Medical University. Die Verhandlung zu dem Fall wurde am Freitag nach fast zwei Jahren Pause mit einer Anhörung Xus fortgeführt.
Ein Sieg vor Gericht könnte ein wichtiger Schritt für unverheiratete Frauen in China sein, auch wenn die chinesische Justiz nicht mit Präzedenzfällen arbeitet. Sie erhoffe sich dennoch eine Signalwirkung, sagte Xu laut des Berichts. Gerade angesichts des geforderten Bevölkerungswachstums müsse alleinstehenden Frauen eine Möglichkeit zum Einfrieren der Eizellen und einer späteren Schwangerschaft gegeben werden.
Wie der jüngste Zensus der Volksrepublik zeigte, altert die Gesellschaft (China.Table berichtete). Peking rief deshalb die Drei-Kind-Politik aus. Zugang zu Reproduktionsmedizin oder Mutterschaftsgeld sind jedoch an den Ehestatus gebunden, der mit einer Heiratsurkunde nachgewiesen werden muss.
So verlangte auch der Arzt in Xus Fall 2018 das Dokument, als die Frau ihre Eizellen einfrieren lassen wollte. Seit 2019 geht sie dagegen nun gerichtlich vor. Xu sagte dem Bericht zufolge, ihre Gerichtsverhandlung sei teilweise aufgrund der Corona-Pandemie ständig verschoben worden. Wann ein Urteil gesprochen wird, stand noch nicht fest. ari

General Li Zuocheng 李作成 (68) war im ganzen Jahr 2021 eigentlich nur mit einer denkbar harmlosen Aktivität an die Öffentlichkeit getreten. Im März nahm er mit Spaten und Gießkanne an einer Baumpflanz-Aktion in der Nähe von Peking teil. Er setzte Pinien, Magnolien und Begonien im Rahmen des gigantischen Begrünungsprogramms der Regierung (China.Table berichtete).
Wenn Personen wie Li die Uniformärmel hochkrempeln und bei so einer Kampagne anpacken, ist das für die Propaganda wichtig. Denn Li ist einer der mächtigsten Männer Chinas. Er ist der General mit dem höchsten Rang und Mitglied der Militärkommission der Partei. Dabei handelt es sich um das Kontrollgremium der Volksbefreiungsarmee. Diese untersteht nicht der Regierung, sondern der KP – eine typisch chinesische Besonderheit. Die Militärkommission der Partei ist also das eigentliche Machtzentrum des Landes. Wenn sonst nichts mehr funktionierte, dann ist immerhin noch die Armee handlungsfähig.
Normalerweise ist nur ein Mitglied der Militärkommission im Westen einigermaßen bekannt: Xi Jinping. Li Zuocheng ist nun jedoch in Amerika geradezu berühmt geworden. Sein US-Kollege Mark Milley hatte ihn in den chaotischen letzten Tagen der Regierung Trump angerufen, wie das neue Buch “Peril” der Journalisten Bob Woodward und Robert Costa berichtet, das am Dienstag erscheint.
Die US-Armeeführung machte sich Sorgen, dass Donald Trump zur Ablenkung von seiner Wahlniederlage einen Krieg mit China vom Zaun brechen könnte. Milley nahm Kontakt zu seinem gleichrangigen Kollegen Li auf, um Missverständnissen vorzubeugen. “General Li, wir kennen uns seit fünf Jahren”, zitiert ihn das Buch. “Wenn wir angreifen, sage ich Ihnen vorher Bescheid.” Das war am 30. Oktober 2020.
Den US-Republikanern gilt Milley jetzt als Verräter. Schließlich hat er den Anruf hinter dem Rücken Trumps getätigt, der Oberbefehlshaber war. Doch Freunde des Generals verteidigen ihn: Er habe routinemäßig Kontakt zu Freund und Feind gehalten. Tatsächlich gehört es auch zu Lis Aufgaben, solche Kontakte zu pflegen. So unterhält er auch Beziehungen zu Russland, um die Aktivitäten des Militärs beider Länder zu koordinieren.
Milley wusste also genau, warum er gerade Li anrief. Der chinesische Top-Militär gilt als besonnen, und er ist in der aktuellen Führung bestens vernetzt: Er ist ein treuer Kommunist aus dem Lager Xi Jinpings. Li wurde 1953 in den frühen Tagen der Volksrepublik geboren. Mit 17 wurde er Soldat, mit 19 trat er der Kommunistischen Partei bei. Er kämpfte 1979 im Krieg Chinas gegen Vietnam und erlangte Auszeichnungen für Tapferkeit. Wenig später wurde er zum Divisionskommandeur befördert.
Im Jahr 1997, Li war 44 Jahre alt, wurde er Zwei-Sterne-General. Danach stagnierte seine Karriere, bis Xi ihn etwas überraschend an die Spitze der militärischen Hierarchie hob. Er machte Li in kurzer Abfolge zum Vier-Sterne-General und zum Leiter des Generalstabs. Damit rückte er auch in die Militärkommission vor. Zusätzlich zu alldem ist er seit 2017 auch noch Mitglied des Zentralkomitees der Partei. Damit gehört er zu den 205 Frauen und Männern, die die Geschicke Chinas steuern.
Li genießt ganz offensichtlich Xis Vertrauen. Andere wichtige Generäle waren beim Militär-Umbau des Staatschefs 2017 schlicht von der Bildfläche verschwunden. Vermutlich konnten sie ihre Loyalität nicht überzeugend beweisen. Zu den Verschwundenen gehörte beispielsweise Fang Fenghui, von dem man nach kurzen Ermittlungen nie wieder etwas gehört hat. Xi verkleinerte in dieser Zeit die Militärkommission von elf auf sieben Mitglieder und berief Li in das exklusive Gremium. Li soll eine kritische Haltung gegenüber Ex-Präsident Jiang Zemin gehabt haben, was seiner Karriere unter diesem geschadet, unter Xi aber genützt hat. Das berichtete seinerzeit das Blatt Apple Daily (kein Link möglich, weil die Publikation eingestellt wurde).
Wenn es darum geht, in einer angespannten geopolitischen Lage Missverständnisse zu vermeiden, dann ist Li also der General der Stunde. Vor zwei Jahren war er der Wunschkandidat der Japaner für die Teilnahme an Gesprächen zur Deeskalation eines Streits um Pazifikinseln.
Auch Milley und Li hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt. Gemeinsame Auftritte der beiden waren oft von versöhnlicher Sprache begleitet. Typisch ist das Versprechen von “produktivem Dialog”, mit dem eine “konstruktive und ergebnisorientierte Beziehung” aufgebaut werden soll.
Die guten internationalen Kontakte bedeuten jedoch nicht, dass Li ein harmloser Liberaler ist. “Wir werden alle separatistischen Umtriebe Taiwans im Keim zerschmettern”, lässt er sich zitieren. Ein Unabhängigkeitsbestreben der Insel berge “große und realistische Gefahr” für den Frieden entlang der Taiwanstraße. Li füllt hier selbstverständlich seine Rolle als Militär aus.

Doch Milley und Li kennen sich eben seit 2016 und hatten offenbar einen guten persönlichen Draht. Die beiden sehen sich sogar optisch etwas ähnlich, wenn sie in ihrer Uniform ihre jeweiligen Truppen abschreiten. In der US-Regierungskrise von 2020 war Li dann der erste Ansprechpartner für den besorgten US-Militär, wie Woodward und Costa in ihrem Buch berichten.
Dass Milley sich mit dem heiklen Anliegen eines offenbar durchgedrehten Oberbefehlshabers an Li gewandt hat, war ein echter Vertrauensbeweis. Gut, dass es diese Kontakte gibt. Ein Krieg der USA gegen China, ob versehentlich oder nicht, wäre schließlich die ultimative Katastrophe. Finn Mayer-Kuckuk
Karl Deppen (55) wird zum 1. Dezember in den Vorstand der Daimler Truck AG berufen. Deppen verantwortet dann Truck China einschließlich des Joint-Ventures Beijing Foton Daimler Automotive. Derzeit ist Deppen als Leiter Mercedes-Benz do Brasil tätig. Zuvor war er unter anderem CFO von Daimler Greater China.
Nach 35 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen im Daimler Konzern geht Hartmut Schick (59), Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich für Daimler Trucks Asia zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand.
Sebastian Wolf, Europachef des chinesischen Batteriezellenherstellers Farasis, wechselt zu VW. Wie das Manager Magazin berichtet, wird Wolf bei VW für den Aufbau der europäischen Batteriezellwerke zuständig sein.
Stefan Bergold, Head of Business Development EU & US und André Gronke, Head of Global Engineering, haben übergangsweise die Leitung von Farasis Energy Europe übernommen.
Ji Qi Gründer der Huazhu Group, eine der größten Hotelketten in China, tritt aus persönlichen Gründen von seinem Posten als CEO zum 1. Oktober zurück. Hu Jin, bisher President bei Huazhu wurde als neuer CEO bestimmt. Huazhu betreibt mehr als 7.000 Hotels in 17 Ländern und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden US-Dollar.

Von wegen Wochenstart! In China ist der heutige Montag quasi offiziell ein Samstag. Das liegt an der Arbeitskultur des “Ruhetagwechsels” – Chinas Pendant zu unserem Brückentag. 调休 tiáoxiū heißt dieses Phänomen auf Chinesisch – ganz wörtlich übersetzt “die Pause anpassen” (von 调 tiáo “anpassen” und 休 xiū “Pause, Rast; pausieren, sich ausruhen”).
Wie bei uns werden nämlich auch in China hässliche “Ferienlücken” zwischen zwei freien Tagen gerne gefüllt. Zum Beispiel, wenn staatliche Feiertage auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen, wie im Falle des morgigen Mond- oder Mittherbstfestes (中秋节 zhōngqiūjié). Anders als in Deutschland dienen als Ferienfüllmaterial jedoch nicht zusätzliche Urlaubs- oder Ferientage. Nein, in China bedient man sich einfach großzügig flankierender Wochenendtage. Sie werden zum Brückentagssteinbruch, sprich: einfach zum Werktag deklariert. Der zum Feiertag umgemünzte Brückentag muss also an einem festgelegten Sams- oder Sonntag vor- oder nachgearbeitet werden. So geschehen am vergangenen Samstag. Aus Montag mach Samstag – so einfach geht’s.
In Chinas sozialen Netzwerken sorgt die Regelung immer wieder für Diskussionsstoff und bei manchem Chinaneuling sogar für eine Art “Feiertagsjetlag”. Denn durch die Schieberegelung stehen im Vor- oder Nachgang verlängerter Wochenenden manchmal schlauchend lange Arbeitswochen an. Da ist die Kräftedividende der Feiertagspause schnell wieder aufgezehrt.
Wie man richtig relaxed, dafür bietet übrigens schon das chinesische Schriftzeichen 休 xiū eine uralte Schablone. Denn das Zeichen für “Pause” setzt sich – sinnigerweise – aus den Bestandteilen 人 “Mensch” und 木 “Baum” zusammen. Jemand, der lässig an einen Baum lehnt oder es sich in dessen Schatten bequem macht – das stand also schon bei den alten Chinesen für prototypisches Pausieren. In diesem Sinne: Frohen Wechselruhetag (für alle in China) und frohes Mittelherbstfest mit möglichst molligen Mondkuchen (für alle)!
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.
China ist einer der größten Exportmärkte für den deutschen Mittelstand. Umso größer ist die Sorge über den Aufstieg der Konkurrenz aus Fernost. “Wir schützen unsere Technologie noch immer zu stiefmütterlich“, sagt der Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds, Ludwig Veltmann, im Interview mit China.Table. Marcel Grzanna sprach mit ihm über Chinas Ambitionen in Sachen Technologieführerschaft.
Der Mittelstand dürfe technisches Know-how nicht leichtfertig an die Konkurrenz aus der Volksrepublik verkaufen, sagt Veltmann. Bei Digitalisierung und Datenauswertung müsse die deutsche Wirtschaft stärker werden. Im Globalisierungswettstreit plädiert Veltmann für ein geeint auftretendes Europa und weltweit festgelegte Umwelt- und Sozialstandards. Das Lieferkettengesetz sieht er jedoch kritisch.
Um den Wettbewerb zwischen China und Deutschland geht es auch in Frank Sierens Analyse zu den Preisen von E-Autos. Das Thema trifft derzeit in Deutschland einen Nerv: Elektrofahrzeuge seien zu teuer, hieß es in einem der Trielle um die Kanzlerschaft. Eine Krankenschwester könne sich kein E-Mobil leisten, deswegen sei ein Verbrenner-Verbot unsozial. China beweist das Gegenteil. Dort sanken die Durchschnittspreise für E-Autos in den letzten zehn Jahren um fast die Hälfte – während sie in Europa und den USA stiegen. Verantwortlich dafür sind auch die Milliarden-Subventionen der Zentralregierung. Die Expansionspläne der chinesischen Konkurrenz könnten die europäischen Hersteller nun auf dem falschen Fuß treffen.
In den chaotischen letzten Tagen der Trump-Präsidentschaft rief US-General Mark Milley bei einem hochrangigen chinesischen Militär, General Li Zuocheng, an. Die Botschaft: Habt keine Sorge vor einem überraschenden US-Angriff – ich würde euch vorwarnen. Milley wollte einen versehentlichen Kriegsausbruch der Supermächte verhindern. Wer ist der General, dem der Milley-Anruf galt? Finn Mayer-Kuckuk hat sich auf Spurensuche begeben: General Li gehört zum Zentralkomitee der KP und genießt als einer der wichtigsten Militärs das Vertrauen von Präsident Xi – und international hohes Ansehen.
Einen angenehmen Wochenstart!

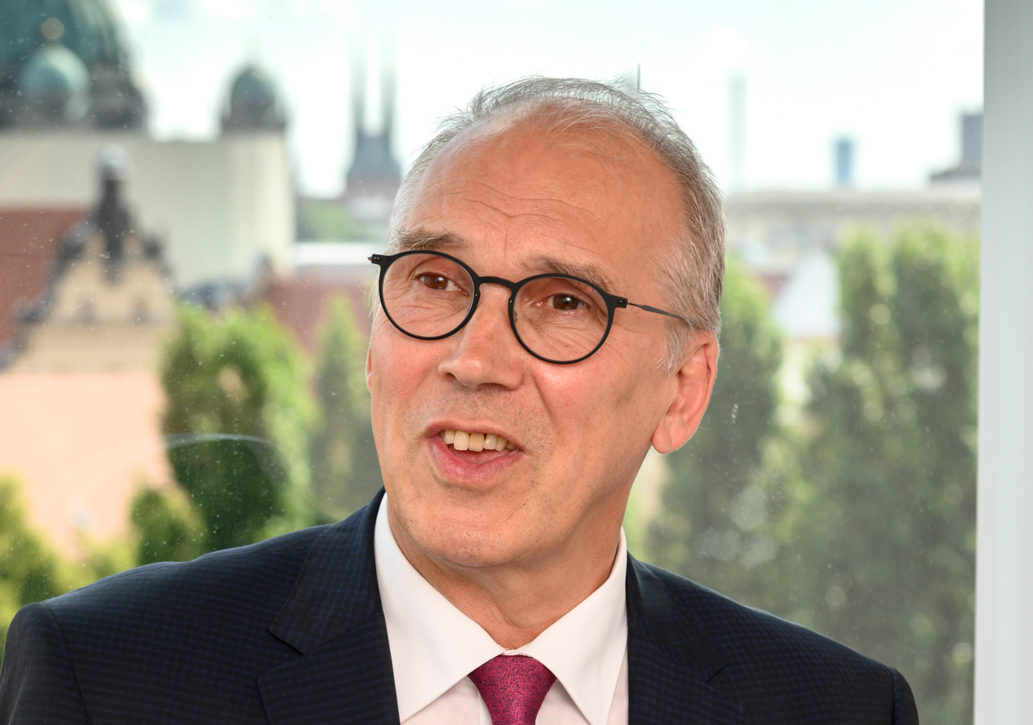
Herr Veltmann, was wäre dem deutschen Mittelstand lieber: Eine Welt unter US-amerikanischer oder chinesischer Technologieführerschaft?
Die Amerikaner sind uns lieber, solange sie keinen Präsidenten wie Trump haben. Sie sind uns kulturell deutlich näher und haben auch ein ähnliches Verständnis von Demokratie. China ist eine Autokratie. Und ein Land, das autoritär organisiert wird, ist uns grundsätzlich suspekt.
Welche Konsequenzen hätte eine chinesische Technologieführerschaft für Deutschland?
Da gibt es zwei Ebenen. Einerseits würde die Wertschöpfungstiefe hierzulande abnehmen. In manchen Technologiebranchen spielen deutsche Unternehmen heute schon keine Rolle mehr. China macht ja selbst vor Technologien nicht halt, in denen die deutsche Industrie bislang noch eine führende Rolle spielt. Wenn China Flugzeuge beispielsweise auf dem Weltmarkt verkauft, wo heute noch Airbus und Boeing den Ton angeben, wird deutlich sichtbar, wie Wertschöpfung nach China abwandert.
Und die zweite Ebene?
Das sind die politischen Implikationen. Es geht um die Frage, wie wir leben wollen. Wir sind hier sehr stolz auf unsere Demokratie und unsere Lebensweise, und sehen unsere Staatsform als die bessere auch im Hinblick auf Wachstums- und Entwicklungsperspektiven an. Nun aber kommt ein Land daher, das autokratisch geführt wird und uns mit seinem Staatskapitalismus zeigt, “was eine Harke ist”. Das könnte den einen oder anderen Technologiebegeisterten dazu bewegen, an unserer Demokratie zu zweifeln. Es könnten Stimmen aufkommen, die nach einem “starken Mann” im Land verlangen, der die mitunter lähmenden Prozeduren in demokratischen Gremien zum Anlass nimmt, Freiheitsrechte einzuschränken. Das besorgt mich.
Halten Sie es für ein reales Szenario, dass wir zur Diktatur werden, weil China wirtschaftlich erfolgreich ist?
In dem Maße, in dem unsere Unternehmen hier an der Bürokratie und langwierigen Prozesse verzweifeln, schaffen wir den Nährboden für solches Gedankengut. Ich höre immer mal wieder aus den Unternehmen, wie unkompliziert und schnell Projekte in China umgesetzt werden. Unsere Firmen dagegen befinden sich gefühlt immer in der Warteschleife für die Genehmigung hierfür oder dafür, und dabei fallen ständig satte Verwaltungsgebühren an, obwohl die Unternehmen reichlich Steuern zahlen. Diese Gesamtsituation produziert viel Frust.
Droht der deutsche Mittelstand zum Bittsteller Chinas zu werden?
Das sind wir doch teilweise jetzt schon. China schottet sich immer weiter ab und arbeitet auffällig in vielen Wirtschaftsbereichen an weitreichender Autarkie. Immer mehr deutsche Firmen, die bei potenziellen chinesischen Geschäftspartnern anklopfen, stoßen auf Probleme. Die Schikane, die Ausländer während der Coronazeit bei der Einreise ins Land erfahren, ist symptomatisch. Außerdem darf nicht mehr offen über systemkritische Vorgänge gesprochen werden. Wenn es um sensible Dinge geht, verbietet sich die chinesische Seite sofort jede Diskussion.
Wäre all das anders, wenn die US-Amerikaner das Rennen um die technologische Dominanz gewinnen?
Da gehe ich von aus. Mal abgesehen von der besseren Kompatibilität unseres politischen Systems mit dem der USA hat China eine klare Strategie formuliert. Nämlich, dass es gegen die Abhängigkeit von Zulieferungen aus dem Ausland arbeitet. Die Technologieführerschaft würde China dabei massiv helfen, sich selbst zu versorgen. Das Land wäre als Exportmarkt für deutsche Unternehmen deutlich weniger attraktiv.
Hat der Mittelstand keine Mittel, um eine drohende chinesische Technologie-Vorherrschaft zu verhindern?
Durch mehr Flexibilität können Erfindergeist und die Einsatzbereitschaft im Mittelstand noch vergrößert werden. Doch dazu muss die Politik den Rahmen schaffen. In den Sonntagsreden ist es immer ganz leicht, den Mittelstand als das Fundament der deutschen Wirtschaft zu preisen und seine Förderung anzukündigen. Am Montag wird es dann wieder schwieriger. Statt Flexibilität gibt es dann Bauauflagen, langwierige Genehmigungs- und Prüfprozesse und Restriktionen, die den Mittelstand behindern. Die auferlegte Ausweitung der Erfassung von Arbeitsstunden beispielsweise passt überhaupt nicht in die heutige Zeit und behindert Betriebe unnötig im Wettbewerb.
Ist es die Schuld der hiesigen Politik, dass China kein Level Playing Field zulässt, was einen enormen Vorteil für chinesische Unternehmen bedeutet?
Die Politik leistet nicht, was sie eigentlich leisten müsste. So könnte sie in der EU starke Allianzen schmieden. Als Europäer setzen wir ohne solche den Chinesen doch gar kein Gewicht entgegen. Wir haben nicht mal einen EU-Außenminister. Da kommt jedes Land der EU allein auf China zu – das spielt einem so großen Land natürlich in die Karten. Wir brauchen deshalb unbedingt ein stärkeres Europa.
Indem es nach dem Motto “Wie du mir, so ich dir” den Chinesen den Zugang zu Ausschreibungen verbietet?
Nein, das wird nicht ohne Weiteres gelingen, wenn wir “tit for tat” spielen. Es bedarf globaler Zusammenarbeit mit klaren Regeln durch die Welthandelsorganisation oder ähnliche Institutionen. Multilaterale Verständigungen sind im Umgang mit China der bessere Hebel als der Bilateralismus. Angesichts der Größe und Marktmacht Chinas ist es unverzichtbar, geschlossen aufzutreten, um seine Interessen gegenüber der chinesischen Regierung wirksam zu vertreten.
Sie kritisieren die Politik. Aber hätte sich der Mittelstand auch besser auf die Herausforderungen einstellen können, denen er aufgrund des Aufstiegs Chinas begegnet?
Mitte der 1980er-Jahren habe ich ein Forschungsprojekt über Kooperationen in Taiwan durchgeführt. Damals war es völlig abwegig, dass die Volksrepublik China ein maßgebliches Gewicht in der Welt bekommen würde. Im Übrigen ging ich nicht als Einziger davon aus, dass sich vielmehr Taiwan wegen seiner damaligen wirtschaftlich deutlichen Überlegenheit gegenüber der Volksrepublik im internationalen Wettbewerb besser behaupten würde. Einem kommunistischen Regime haben wir diesbezüglich dagegen nicht sehr viel zugetraut.
Die Volksrepublik China hat in den zurückliegenden Jahren aber das Gegenteil bewiesen – trotz autokratisch sozialistischer Staatsform. Längst ist das Land nicht mehr die Werkbank der Welt für Billigprodukte und Imitate westlicher Marken. Vielmehr strömten in gewaltiger Dosis Kapital und Know-how ins Land, womit die Gewichte verschoben wurden. Heute gibt es kaum eine Technologie, in der China nicht den Anspruch oder den Ehrgeiz hat, Weltspitze zu sein. Diese Absichten hätte der Mittelstand frühzeitig erkennen müssen und nicht leichtfertig technisches Spitzen-Know-how an China verkaufen dürfen.
Dafür ist es zu spät, aber schützen wir unsere Technologie wenigstens heute ausreichend?
Das tun wir immer noch zu stiefmütterlich. Ich will nicht dem Protektionismus das Wort reden. Aber wenn ein chinesisches Unternehmen ein deutsches erwirbt, um zu gucken, wie das alles so funktioniert, und dann aber das Geschäft in China für den chinesischen Markt weiterbetreibt, dann muss uns klar sein, dass wir am Ende nur allzu rasch in die Röhre gucken. Da müssen wir klüger werden.
Gibt es denn nach all den Jahren immer noch Unternehmen, die von den tiefgreifenden Veränderungen durch Chinas tragende Rolle nichts mitbekommen?
Die ehrgeizigen Ziele Chinas sind inzwischen fast jedem Unternehmen in irgendeiner Form präsent. Aber es gibt noch zu wenig strategische Pläne, dem zu begegnen, was ein paar Tausend Kilometer weiter weg geschieht.
Chinas kategorische Ablehnung jeglicher Verantwortung für die Corona-Pandemie, die Vertragsbrüche in Hongkong, die Tragödien aus Xinjiang: Hat im deutschen Mittelstand in jüngster Vergangenheit ein Prozess begonnen, darüber nachzudenken, ob es moralisch anständig ist, mit China Geschäfte zu machen?
Natürlich hat es das. Und es gibt viele Unternehmen, die daraus Konsequenzen ziehen. Es herrscht schließlich im Mittelstand grundsätzlich Zustimmung für eine Politik, die sagt: Wir achten auf Menschenrechte und Produktionsbedingungen in diesem Land. Aber es ist letztlich nicht realistisch, den Unternehmen abzuverlangen, eine Art Kontrollfunktion zu übernehmen und allein die Verantwortung dafür zu tragen, wo die internationale Politik keine Lösungen findet. Das einzelne mittelständische Unternehmen wird kaum die immer komplexeren Lieferketten nachverfolgen und für das Verhalten der Vorlieferanten oder das Handeln deren Regierungen alleinige Verantwortung übernehmen können.
Ist das menschlich oder müssen wir den Unternehmen mehr abverlangen?
Da stellt sich die Frage, wie weit man einen einzelnen Unternehmer verantwortlich machen kann. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz verlangt ja, dass die Lieferkette nur aus Akteuren mit weißen Westen besteht. Aber so arbeitsteilig, wie die Welt funktioniert, ist das doch gar nicht darstellbar. Wichtig wäre, dass Umwelt- und Sozialstandards durch die Weltgemeinschaft festgelegt werden. Darum sollte sich etwa die WTO kümmern. Dann könnten die Unternehmen viel effizienter ihre Arbeit tun und würden nicht durch kostspielige Bürokratiemonster ausgebremst.
Welche Werkzeuge bleiben dem Mittelstand jenseits politischer Forderungen?
Wenn wir es schaffen, Kreativität und Innovationen zu entfesseln und starke Marken zu schaffen oder fortzuentwickeln, dann haben wir weiterhin beste Chancen im internationalen Wettbewerb. Denn dann können wir uns als unverzichtbarer Akteur in den globalen Wertschöpfungsketten positionieren. Noch ist das Image deutscher Produkte noch sehr gut in China. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass auch das abnimmt. Der Dieselskandal hat das deutsche Auto auch in China unter Druck gesetzt, natürlich auch weil die chinesische Propaganda das für sich genutzt hat.
Vom Grad der Digitalisierung ganz zu schweigen.
Und auch da müssen wir uns fragen, weshalb wir den Zug zu verpassen drohen und ihn in vielen Bereichen leider schon verpasst haben. Digitalisierung benötigt großes Investment, aber dieses in Deutschland in der notwendigen Geschwindigkeit zu mobilisieren, ist oft schlicht nicht in gleichem Maße möglich wie etwa in den USA oder in China. Dabei kann der überfällige Transformationsprozess nur dann gelingen, wenn digitale Tools und vor allem digital gesammelte und aufbereitete Daten gezielt zum Einsatz kommen.
Für den Handel etwa ist es wichtig, die Kundenbedürfnisse genau zu kennen. Wem dies am besten gelingt, der ist im Wettbewerb ganz vorn. Wirtschaftlicher Erfolg erklärt sich heute zumeist datenbasiert. Noch hinken wir bei der Datenauswertung gewaltig hinterher. Wenn man die Vielfalt und den Nutzen der Dienstleistungen etwa auf der Handelsplattform Alibaba näher betrachtet, wird deutlich, wo die Reise im Wettbewerb hingeht.
Das klingt nach viel Arbeit in schwieriger Ausgangslage. Wie schätzen sie die Stimmung im Mittelstand ein?
Mittelständler sind Berufsoptimisten mit erheblicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das stärkt nicht nur ihre Unternehmen und schützt sie gerade in Krisenzeiten, sondern stabilisiert zugleich ganze Volkswirtschaften. Digitalisierung und die sich rapide verschärfende Debatte zum Thema Nachhaltigkeit lösen dramatische Veränderungen in den Märkten aus, denen das einzelne mittelständische Unternehmen immer weniger gewachsen ist. Der Kooperationsgedanke erfährt deshalb gerade wieder eine Renaissance, denn nur gebündelte Kräfte können die Nachteile zu kleiner Einheiten ausgleichen.
Der Mittelstandsverbund bringt hierzu seine Expertise für die Stärkung und Fortentwicklung der Unternehmen auf der Basis der genossenschaftlichen Idee konsequent bei den von ihm vertretenen 230.000 Unternehmen in 320 Unternehmensverbünden aus 45 Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbranchen ein. Hierbei gilt es, den politischen Entscheidungsträgern immer wieder den Wert der kooperativen Wirtschaftsform vor Augen zu führen und für deren Freiräume – etwa in der Kartell- und Wettbewerbspolitik – einzutreten. Als Unternehmer gut vernetzt zu sein, entfaltet sich nicht nur zunehmend als wirtschaftlicher Vorteil, es trägt auch zu einer besseren Stimmung bei.
Ludwig Veltmann, 62, lernte in den 1980er-Jahren Chinesisch und zog für Forschungsprojekte nach Taiwan und in die Volksrepublik. Seit 2001 verfolgt er als Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes den wachsenden Einfluss der Volksrepublik auf die deutsche Wirtschaft.
Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) legte Anfang September die Höhe der Subventionen offen, die die Autohersteller während der vergangenen fünf Jahre erhalten haben. Demnach gab Peking umgerechnet insgesamt 4,3 Milliarden Euro aus, um die Produktion von E-Autos anzukurbeln (China.Table berichtete). Dazu zählen rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie Hybridfahrzeuge. Während die Zahlungen pro Fahrzeug um vier Fünftel sanken, zahlte die Regierung 2020 aufgrund des Verkaufsbooms bei E-Autos mit umgerechnet fast 1,4 Milliarden Euro mehr als das Zehnfache an Subventionen als noch 2016, berichtet die Wirtschaftszeitung Caixin. Laut Analysten könnte der jährliche Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen in China bis 2025 auf 8,3 Millionen Stück steigen.
Peking war aus mehreren Gründen daran interessiert, Chinas E-Automarkt unter die Arme zu greifen. Dazu zählen die Verbesserung der Luftqualität in den Ballungsräumen sowie die Technologieführerschaft in einer sich neu entwickelnden Branche. Im Jahr 2017 beschloss Peking dennoch, die Fördergelder nach und nach zu streichen, um sie 2020 dann ganz auslaufen zu lassen. Am Ende dieser Konsolidierungsphase sollte sich der Markt selbst tragen, so der Plan. Dass viele Start-ups dabei untergingen, nahm die Regierung in Kauf. Die Coronakrise machte der Regierung jedoch einen Strich durch die Rechnung.
Pekings aktuelles Ziel ist es, alle NEV-Anreize bis Ende 2023 auslaufen zu lassen, anstatt wie ursprünglich geplant im Jahr 2020. Das gaben die zuständigen Behörden im April vergangenen Jahres bekannt.
Die Subventionen haben sich ausgezahlt: Heute sind die Autos in China billiger und wettbewerbsfähiger als in Europa. Günstige E-Autos für die breite Masse gibt es in China schon ab 3.700 Euro (China.Table berichtete). In Europa startet die Preisliste erst bei 15.700 Euro. Hier haben sich die Hersteller auf Fahrzeuge im höheren Segment fokussiert. In den USA fallen sogar 24.800 Euro für ein Einsteigermodell an. In den westlichen Märkten ist zudem der Durchschnittspreis für E-Autos in den letzten Jahren um gut ein Drittel gestiegen. Dagegen haben sich in China die Anschaffungskosten seit 2011 im Durchschnitt auf 22.100 Euro fast halbiert.
Eins ist klar: Die Abschaffung der chinesischen Subventionen bringt keine Erleichterung für die deutsche Autoindustrie. Je weniger Subventionen die chinesische Konkurrenz erhält, desto mehr ist sie gezwungen, international zu expandieren. Gelingt es den europäischen Herstellern nicht, rechtzeitig günstigere Modelle auf den Markt zu bringen, könnten die chinesischen Hersteller mit ihren preiswerten und zunehmend attraktiven E-Autos schnell große Marktanteile an sich reißen. Schon jetzt unterhalten Firmen wie Geely oder SAIC eigene Showrooms und Niederlassungen in Deutschland. Viele Hersteller planen die Expansion nach Europa (China.Table berichtete).
Das bedeutet, dass die deutschen Hersteller auf dem Heimatmarkt trotz des Rückgangs der Subventionen in China weiterhin auf Förderung angewiesen bleiben. Deutschlands Steuerzahler subventionieren E-Autos mit bis zu 20.000 Euro pro Fahrzeug. Auf absehbare Zeit können Stromer preislich nicht mit Verbrennerfahrzeugen konkurrieren und bleiben auf Subventionen angewiesen, erklärt Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer. Vor allem durch die hohen Kosten für die Batteriefertigung seien E-Autos teurer. Günstigere Elektroautos anzubieten, werde noch dauern, so Schäfer. “Wir werden günstigere Angebote mit weiterem technischen Fortschritt machen können, aber erst nach einer gewissen Übergangsphase.”
China hat in den letzten Jahren am meisten Patente für 6G-Technologien angemeldet. Das geht aus einer Untersuchung der japanischen Zeitung Nikkei und dem japanischen Forschungsunternehmen Cyber Creative Institute hervor. Die beiden Partner haben knapp 20.000 Patentanmeldungen in neun 6G-Technologiebereichen ausgewertet. Demnach haben Unternehmen und Forschungsinstitute aus China 40 Prozent der Patente in Bereichen wie Kommunikation, Quantentechnologie, Basisstationen und künstliche Intelligenz angemeldet. Die USA liegen mit 35 Prozent der Anmeldungen knapp dahinter. Europa und Japan konnten jeweils knapp unter zehn Prozent auf sich vereinen.
Huawei sowie die Staatsfirmen State Grid und China Aerospace Science and Technology gehören zu den größten Inhabern von 6G-Patenten, so Nikkei. Trotz der Tech-Sanktionen von US-Präsident Trump sei es China gelungen, seine Wettbewerbsfähigkeit im 6G-Bereich durch die Mobilisierung staatlicher Unternehmen und Universitäten zu erhalten.
Die 6G-Technologie ermögliche aufgrund ihrer Geschwindigkeit beispielsweise vollautonom fahrende Autos, Virtual-Reality Anwendungen in höchster Auflösung und Internetverbindungen selbst an abgelegensten Orten, so Nikkei. Die 6G-Technologie wird demzufolge ab 2030 kommerziell nutzbar sein. Staaten, die viele Patenten anmelden, werden die zukünftigen Industriestandards mitbestimmen. nib
Der strauchelnde Immobilienentwickler Evergrande hat am Samstag angefangen, Investoren mit verbilligten Immobilien zu entschädigen, wie Bloomberg berichtet. Das Unternehmen teilte über WeChat mit, Anleger, die an der Rückzahlung von Vermögensverwaltungsprodukten gegen Sachwerte interessiert sind, sollten sich an ihre Anlageberater oder lokale Evergrande-Niederlassungen wenden, so Reuters. Den Berichten zufolge hätten über 70.000 Anleger, darunter viele Angestellte des Unternehmens, die Vermögensprodukte gekauft. Umgerechnet circa 5,2 Milliarden Euro dieser Produkte seien nun fällig, schreibt das Wirtschaftsportal Caixin. Investoren könnten zwischen verbilligten Wohnungen, Büro- und Einzelhandelsflächen oder Parkhäusern wählen, so Reuters.
Kommenden Donnerstag muss Evergrande Zinsen in Höhe von umgerechnet 100 Millionen Euro für zwei Anleihen bezahlen. Der Termin gilt als wichtiges Zeichen dafür, ob der Konzern über genug Liquidität verfügt, um den Verpflichtungen nachzukommen, wie Bloomberg berichtet. Bei den Zahlungen gegenüber Banken und Lieferanten war der Konzern schon in Rückstand geraten (China.Table berichtete). Das Unternehmen hat ein Schuldenberg in Höhe von umgerechnet über 250 Milliarden Euro angehäuft. nib
Chinas Gesuch, Mitglied des Handelsbündnis Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) zu werden, stößt bei einigen der bisherigen Mitglieder auf Skepsis. “Wir müssen untersuchen, ob [China] bereit ist, die hohen Standards zu erfüllen“, die der Handelspakt verlangt, sagte der japanische Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie Hiroshi Kajiyama laut Nikkei Asia.
Auch Australien äußerte Zweifel. Australiens Handelsminister Dan Tehan verwies demnach auf Zölle, die China auf wichtige australische Exportgüter wie Wein und Gerste verhängt hat (China.Table berichtete), nachdem das Land eine Untersuchung des Ursprungs des Corona-Virus gefordert hatte. Nur wenige Analysten glauben, dass Chinas Mitgliedsantrag für den pazifischen Handelspakt angenommen wird. Das CPTPP hat elf Mitglieder, darunter Japan, Australien, Kanada, Mexiko, Vietnam und Peru. Auch Großbritannien hat infolge des Brexits um Aufnahme gebeten (China.Table berichtete). nib
Die größte oppositionelle Gewerkschaftskoalition Hongkongs kündigte am Sonntag Pläne für ihre Auflösung an. Die Organisation hat einen Auflösungsantrag gestellt, über den die Mitgliedsorganisationen am 3. Oktober abstimmen werden. “Wir möchten uns bei den Menschen in Hongkong entschuldigen, dass wir nicht weitermachen können”, sagte Joe Wong, Co-Vorsitzender der Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKFTU) laut Reuters unter Tränen. Einige Mitglieder hätten kürzlich Nachrichten mit Gewaltandrohungen erhalten. Die Organisation befürchtet, von der Regierung wegen angeblicher Verstöße gegen das von Peking erlassene Nationale Sicherheitsgesetz weiter verfolgt zu werden. Der Mitbegründer der Gewerkschaftskoalition, Lee Cheuk-yan, sitzt wegen seiner Rolle bei den Protesten gegen Hongkongs Regierung im Jahr 2019 im Gefängnis. Der Geschäftsführer der Organisation, Mung Siu Tat, gab kürzlich bekannt, Hongkong verlassen zu haben.
Erst im vergangenen Monat hatte sich die Lehrergewerkschaft Hong Kong Professional Teachers’ Union aufgelöst, die 100.000 Mitglieder umfasste. Der Entschluss zur Auflösung wurde gefasst, nachdem Chinas Nachrichtenagentur die Gewerkschaft als “bösartigen Tumor” bezeichnet und Hongkongs Polizeipräsident Untersuchungen gegen die Organisation angekündigt hatte, wie Bloomberg berichtet.
Laut eigenen Angaben repräsentiert die Hong Kong Confederation of Trade Unions 93 Mitgliedsorganisationen mit 145.000 Mitgliedern. Zu ihren Aufgaben gehörte es, unabhängige Gewerkschaften zu organisieren, Arbeitskonflikte zu schlichten und berufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeiter anzubieten. nib
China und Russland wollen nach eigenen Angaben nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gemeinsam für Stabilität in der Region sorgen. Bei einer Videokonferenz kündigten Chinas Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin an, künftig Geheimdienstinformationen auszutauschen und regelmäßige Gespräche über Afghanistan zu führen. Das Gespräch fand im Rahmen der China-geführten Shanghai Cooperation Organization (SCO) statt (China.Table berichtete), Putin war dem Gipfeltreffen in Tadschikistan per Video zugeschaltet. Xi Jinping sagt, die SCO-Mitgliedsstaaten sollten zu einem reibungslosen Übergang in Afghanistan beitragen und Afghanistan anleiten, eine “integrative politische Struktur” zu entwickeln, wie Staatsmedien berichteten. Außerdem rief Xi die Führung in Kabul zu einer gemäßigten Innen- und Außenpolitik auf.
“Ich hoffe, dass diese Vorschläge zu dem Ziel beitragen, gemeinsam Sicherheit in unserer Region zu erreichen”, sagte Xi demnach. Putin wiederholte Xis Aufruf an die regionalen Hauptstädte, ihre Zusammenarbeit zu verstärken und das regionale Geheimdienstnetzwerk der SCO zum Austausch von Informationen über terroristische Organisationen zu nutzen. Er schlug vor, das SCO-Mandat auch auf die Kontrolle von Waffen und organisierter Kriminalität auszuweiten.
Xi forderte “relevante Parteien” in Afghanistan auf, “terroristische Organisationen auf afghanischem Gebiet auszurotten”, und versprach, der vom Krieg zerrütteten Nation mehr Hilfe zu leisten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der chinesische Präsident kritisierte indirekt die USA: “Bestimmte Länder” sollten ihre Verantwortung für die zukünftige Entwicklung Afghanistans als “Anstifter der schwierigen Situation” übernehmen.
Die SCO besteht aus China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan. Die Organisation hat zudem mit der Aufnahme des Iran begonnen, auch Ägypten, Katar und Saudi-Arabien sind als Gesprächspartner im Zuge der Expansion hinzugekommen. ari
Eine 33-jährige Chinesin hat in Peking ein Krankenhaus verklagt, weil es ihre Eizellen nicht einfrieren wollte. Als Grund dafür habe die Klinik die nationalen Gesetze genannt, die das Einfrieren von Eizellen nur für Eheleute erlaubt, wie Bloomberg berichtete. Teresa Xu verklagte daraufhin das staatliche Pekinger Krankenhaus für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Capital Medical University. Die Verhandlung zu dem Fall wurde am Freitag nach fast zwei Jahren Pause mit einer Anhörung Xus fortgeführt.
Ein Sieg vor Gericht könnte ein wichtiger Schritt für unverheiratete Frauen in China sein, auch wenn die chinesische Justiz nicht mit Präzedenzfällen arbeitet. Sie erhoffe sich dennoch eine Signalwirkung, sagte Xu laut des Berichts. Gerade angesichts des geforderten Bevölkerungswachstums müsse alleinstehenden Frauen eine Möglichkeit zum Einfrieren der Eizellen und einer späteren Schwangerschaft gegeben werden.
Wie der jüngste Zensus der Volksrepublik zeigte, altert die Gesellschaft (China.Table berichtete). Peking rief deshalb die Drei-Kind-Politik aus. Zugang zu Reproduktionsmedizin oder Mutterschaftsgeld sind jedoch an den Ehestatus gebunden, der mit einer Heiratsurkunde nachgewiesen werden muss.
So verlangte auch der Arzt in Xus Fall 2018 das Dokument, als die Frau ihre Eizellen einfrieren lassen wollte. Seit 2019 geht sie dagegen nun gerichtlich vor. Xu sagte dem Bericht zufolge, ihre Gerichtsverhandlung sei teilweise aufgrund der Corona-Pandemie ständig verschoben worden. Wann ein Urteil gesprochen wird, stand noch nicht fest. ari

General Li Zuocheng 李作成 (68) war im ganzen Jahr 2021 eigentlich nur mit einer denkbar harmlosen Aktivität an die Öffentlichkeit getreten. Im März nahm er mit Spaten und Gießkanne an einer Baumpflanz-Aktion in der Nähe von Peking teil. Er setzte Pinien, Magnolien und Begonien im Rahmen des gigantischen Begrünungsprogramms der Regierung (China.Table berichtete).
Wenn Personen wie Li die Uniformärmel hochkrempeln und bei so einer Kampagne anpacken, ist das für die Propaganda wichtig. Denn Li ist einer der mächtigsten Männer Chinas. Er ist der General mit dem höchsten Rang und Mitglied der Militärkommission der Partei. Dabei handelt es sich um das Kontrollgremium der Volksbefreiungsarmee. Diese untersteht nicht der Regierung, sondern der KP – eine typisch chinesische Besonderheit. Die Militärkommission der Partei ist also das eigentliche Machtzentrum des Landes. Wenn sonst nichts mehr funktionierte, dann ist immerhin noch die Armee handlungsfähig.
Normalerweise ist nur ein Mitglied der Militärkommission im Westen einigermaßen bekannt: Xi Jinping. Li Zuocheng ist nun jedoch in Amerika geradezu berühmt geworden. Sein US-Kollege Mark Milley hatte ihn in den chaotischen letzten Tagen der Regierung Trump angerufen, wie das neue Buch “Peril” der Journalisten Bob Woodward und Robert Costa berichtet, das am Dienstag erscheint.
Die US-Armeeführung machte sich Sorgen, dass Donald Trump zur Ablenkung von seiner Wahlniederlage einen Krieg mit China vom Zaun brechen könnte. Milley nahm Kontakt zu seinem gleichrangigen Kollegen Li auf, um Missverständnissen vorzubeugen. “General Li, wir kennen uns seit fünf Jahren”, zitiert ihn das Buch. “Wenn wir angreifen, sage ich Ihnen vorher Bescheid.” Das war am 30. Oktober 2020.
Den US-Republikanern gilt Milley jetzt als Verräter. Schließlich hat er den Anruf hinter dem Rücken Trumps getätigt, der Oberbefehlshaber war. Doch Freunde des Generals verteidigen ihn: Er habe routinemäßig Kontakt zu Freund und Feind gehalten. Tatsächlich gehört es auch zu Lis Aufgaben, solche Kontakte zu pflegen. So unterhält er auch Beziehungen zu Russland, um die Aktivitäten des Militärs beider Länder zu koordinieren.
Milley wusste also genau, warum er gerade Li anrief. Der chinesische Top-Militär gilt als besonnen, und er ist in der aktuellen Führung bestens vernetzt: Er ist ein treuer Kommunist aus dem Lager Xi Jinpings. Li wurde 1953 in den frühen Tagen der Volksrepublik geboren. Mit 17 wurde er Soldat, mit 19 trat er der Kommunistischen Partei bei. Er kämpfte 1979 im Krieg Chinas gegen Vietnam und erlangte Auszeichnungen für Tapferkeit. Wenig später wurde er zum Divisionskommandeur befördert.
Im Jahr 1997, Li war 44 Jahre alt, wurde er Zwei-Sterne-General. Danach stagnierte seine Karriere, bis Xi ihn etwas überraschend an die Spitze der militärischen Hierarchie hob. Er machte Li in kurzer Abfolge zum Vier-Sterne-General und zum Leiter des Generalstabs. Damit rückte er auch in die Militärkommission vor. Zusätzlich zu alldem ist er seit 2017 auch noch Mitglied des Zentralkomitees der Partei. Damit gehört er zu den 205 Frauen und Männern, die die Geschicke Chinas steuern.
Li genießt ganz offensichtlich Xis Vertrauen. Andere wichtige Generäle waren beim Militär-Umbau des Staatschefs 2017 schlicht von der Bildfläche verschwunden. Vermutlich konnten sie ihre Loyalität nicht überzeugend beweisen. Zu den Verschwundenen gehörte beispielsweise Fang Fenghui, von dem man nach kurzen Ermittlungen nie wieder etwas gehört hat. Xi verkleinerte in dieser Zeit die Militärkommission von elf auf sieben Mitglieder und berief Li in das exklusive Gremium. Li soll eine kritische Haltung gegenüber Ex-Präsident Jiang Zemin gehabt haben, was seiner Karriere unter diesem geschadet, unter Xi aber genützt hat. Das berichtete seinerzeit das Blatt Apple Daily (kein Link möglich, weil die Publikation eingestellt wurde).
Wenn es darum geht, in einer angespannten geopolitischen Lage Missverständnisse zu vermeiden, dann ist Li also der General der Stunde. Vor zwei Jahren war er der Wunschkandidat der Japaner für die Teilnahme an Gesprächen zur Deeskalation eines Streits um Pazifikinseln.
Auch Milley und Li hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt. Gemeinsame Auftritte der beiden waren oft von versöhnlicher Sprache begleitet. Typisch ist das Versprechen von “produktivem Dialog”, mit dem eine “konstruktive und ergebnisorientierte Beziehung” aufgebaut werden soll.
Die guten internationalen Kontakte bedeuten jedoch nicht, dass Li ein harmloser Liberaler ist. “Wir werden alle separatistischen Umtriebe Taiwans im Keim zerschmettern”, lässt er sich zitieren. Ein Unabhängigkeitsbestreben der Insel berge “große und realistische Gefahr” für den Frieden entlang der Taiwanstraße. Li füllt hier selbstverständlich seine Rolle als Militär aus.

Doch Milley und Li kennen sich eben seit 2016 und hatten offenbar einen guten persönlichen Draht. Die beiden sehen sich sogar optisch etwas ähnlich, wenn sie in ihrer Uniform ihre jeweiligen Truppen abschreiten. In der US-Regierungskrise von 2020 war Li dann der erste Ansprechpartner für den besorgten US-Militär, wie Woodward und Costa in ihrem Buch berichten.
Dass Milley sich mit dem heiklen Anliegen eines offenbar durchgedrehten Oberbefehlshabers an Li gewandt hat, war ein echter Vertrauensbeweis. Gut, dass es diese Kontakte gibt. Ein Krieg der USA gegen China, ob versehentlich oder nicht, wäre schließlich die ultimative Katastrophe. Finn Mayer-Kuckuk
Karl Deppen (55) wird zum 1. Dezember in den Vorstand der Daimler Truck AG berufen. Deppen verantwortet dann Truck China einschließlich des Joint-Ventures Beijing Foton Daimler Automotive. Derzeit ist Deppen als Leiter Mercedes-Benz do Brasil tätig. Zuvor war er unter anderem CFO von Daimler Greater China.
Nach 35 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen im Daimler Konzern geht Hartmut Schick (59), Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich für Daimler Trucks Asia zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand.
Sebastian Wolf, Europachef des chinesischen Batteriezellenherstellers Farasis, wechselt zu VW. Wie das Manager Magazin berichtet, wird Wolf bei VW für den Aufbau der europäischen Batteriezellwerke zuständig sein.
Stefan Bergold, Head of Business Development EU & US und André Gronke, Head of Global Engineering, haben übergangsweise die Leitung von Farasis Energy Europe übernommen.
Ji Qi Gründer der Huazhu Group, eine der größten Hotelketten in China, tritt aus persönlichen Gründen von seinem Posten als CEO zum 1. Oktober zurück. Hu Jin, bisher President bei Huazhu wurde als neuer CEO bestimmt. Huazhu betreibt mehr als 7.000 Hotels in 17 Ländern und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden US-Dollar.

Von wegen Wochenstart! In China ist der heutige Montag quasi offiziell ein Samstag. Das liegt an der Arbeitskultur des “Ruhetagwechsels” – Chinas Pendant zu unserem Brückentag. 调休 tiáoxiū heißt dieses Phänomen auf Chinesisch – ganz wörtlich übersetzt “die Pause anpassen” (von 调 tiáo “anpassen” und 休 xiū “Pause, Rast; pausieren, sich ausruhen”).
Wie bei uns werden nämlich auch in China hässliche “Ferienlücken” zwischen zwei freien Tagen gerne gefüllt. Zum Beispiel, wenn staatliche Feiertage auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen, wie im Falle des morgigen Mond- oder Mittherbstfestes (中秋节 zhōngqiūjié). Anders als in Deutschland dienen als Ferienfüllmaterial jedoch nicht zusätzliche Urlaubs- oder Ferientage. Nein, in China bedient man sich einfach großzügig flankierender Wochenendtage. Sie werden zum Brückentagssteinbruch, sprich: einfach zum Werktag deklariert. Der zum Feiertag umgemünzte Brückentag muss also an einem festgelegten Sams- oder Sonntag vor- oder nachgearbeitet werden. So geschehen am vergangenen Samstag. Aus Montag mach Samstag – so einfach geht’s.
In Chinas sozialen Netzwerken sorgt die Regelung immer wieder für Diskussionsstoff und bei manchem Chinaneuling sogar für eine Art “Feiertagsjetlag”. Denn durch die Schieberegelung stehen im Vor- oder Nachgang verlängerter Wochenenden manchmal schlauchend lange Arbeitswochen an. Da ist die Kräftedividende der Feiertagspause schnell wieder aufgezehrt.
Wie man richtig relaxed, dafür bietet übrigens schon das chinesische Schriftzeichen 休 xiū eine uralte Schablone. Denn das Zeichen für “Pause” setzt sich – sinnigerweise – aus den Bestandteilen 人 “Mensch” und 木 “Baum” zusammen. Jemand, der lässig an einen Baum lehnt oder es sich in dessen Schatten bequem macht – das stand also schon bei den alten Chinesen für prototypisches Pausieren. In diesem Sinne: Frohen Wechselruhetag (für alle in China) und frohes Mittelherbstfest mit möglichst molligen Mondkuchen (für alle)!
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.
