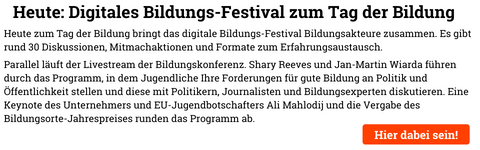jetzt geht`s los: Heute wollen die Abgeordneten des Bundestages von SPD, Grünen und FDP Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen. Danach werden die Minister seines Kabinetts vereidigt. Fortan regiert die Ampel. Nachdem die Koalitionäre zunächst “Fortschritt wagen” zu ihrem Motto erklärt haben, sagte Christian Lindner gestern bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, nun gelte, es “Fortschritt zu gestalten”.
In der Bildung, insbesondere der digitalen Bildung, haben SPD, Grüne und Liberale, viel zu tun. Beim “Tag der Bildung” können die koalitionären Bildungspolitiker heute Experten, Wissenschaftler und Praktiker treffen, die ihnen Hinweise für dringend anzufassende Themen der nächsten vier Jahre geben. Wollen auch Sie sich in das Programm des Bildungs-Tages einklinken? Weiter unten in der heutigen Ausgabe von Bildung.Table haben wir für Sie eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Thomas Sattelberger und Jens Brandenburg: Auf diese beiden FDP-Politiker gilt es in den kommenden Monaten zu achten. Als Staatssekretäre im Bildungsministerium werden sie Schlüsselfiguren bei der Umsetzung der digitalen Bildungsagenda sein. Welche Kompetenzen sie mitbringen, lesen Sie in den Portraits der beiden.
Weil aber wesentliche Änderungen im föderalen Bildungsland Deutschland ohne die Union nicht umzusetzen sind, rücken auch deren Fachleute ins Rampenlicht. Christian Füller hat mit der stellvertretenden Unions-Fraktionschefin Nadine Schön gesprochen, einer ausgewiesenen Digitalexpertin. Sie sieht ihre Oppositionsaufgabe gestaltend und kündigt in Bildung.Table an, der Ampelkoalition bei der Reform des Digitalpaktes nicht im Weg stehen zu wollen, sondern zu kooperieren – bis hin zu einer Änderung des Grundgesetzes.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,


Sie ist die wichtigste Digital-Politikerin der CDU. Jetzt hat die Bundestags-Fraktionsvize Nadine Schön, die zum Team von CDU-Kandidat Helge Braun gehört, der Ampel-Koalition Zusammenarbeit bei der digitalen Bildung signalisiert. “Von Unions-Seite besteht eine große Bereitschaft, zusammenzuarbeiten”, sagte Nadine Schön zu Bildung.Table. Dazu zähle auch, sich über eine Grundgesetz-Änderung zu verständigen. “Wir wollen Strukturen in Politik und Verwaltung verändern. Das gilt auch in der Opposition”, so Schön, deren Aufgabengebiet Digitalisierung ist. Ohne die Union kann die Ampel ihre weitreichenden Pläne zur Veränderung des Digitalpakts kaum verwirklichen.
Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag einen neuen Digitalpakt2.0 verabredet. Der soll nicht nur deutlich höher dotiert sein, sondern werde bis zum Jahr 2030 reichen. Die Pläne der Koalition gingen zwar in die richtige Richtung, sagte Schön. Die Ampel-Ideen seien aber bisher nur Stichworte. “Wir wollen mit der Ampel ins Gespräch kommen, wie man den Digitalpakt und die Kooperation in der digitalen Bildung grundsätzlich entbürokratisieren und beschleunigen kann.” Am Ende müsste auch die Länderseite einbezogen werden, “egal ob es um eine Grundgesetz-Änderung oder nur um eine Bund-Länder-Vereinbarung geht.” Die CDU-Fraktion sei für beides offen. “Wie man beim Digitalpakt gesehen hat, sind die bisherigen Verfahren zu aufwändig und zu bürokratisch. Das steht in keinem Verhältnis zum Output, den wir dabei erzielen”, sagte Schön.
Schön verwies darauf, dass die Union bereits weitreichende Pläne für eine grundlegende Staatsmodernisierung vorgelegt habe. Sie nannte die Initiative “Neustaat” und ein Papier, das der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière mit anderen für die Konrad-Adenauer-Stiftung verfasst hat. Nadine Schön gehörte der Arbeitsgruppe an. Der heutige Vorsitzende der Telekom-Stiftung hat zudem für den Bildungsföderalismus eine “große Staatsreform” vorgeschlagen. Er hat dabei detaillierte Vorstellungen entwickelt, wie man die Zusammenarbeit von Bund und Ländern für die digitale Bildung auf neue Füße stellen könnte (Bildung.Table berichtete). Die Pläne von de Maizière und Schön gehen viel weiter als die Verabredungen, welche die rot-grün-gelbe Koalition zum Thema Bildung traf.
Die Positionen zu Digitalpakt und einer möglichen Grundgesetzänderung folgen nicht den simplen Gesetzen von Parteizugehörigkeit. Schön erinnerte daran, dass der Grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, bei den bisherigen Digitalpakt-Verhandlungen nicht der Konstruktivste war. Tatsächlich hatte die Bundestagsfraktion der Grünen stets ganz andere Vorstellungen als der grüne Landesvater – der sich meistens durchsetzte. Schön, die sich kommende Woche wohl wieder zur Wahl als Bundestagsfraktions-Vize stellen wird, deutete an, dass für Fortschritte bei der Digitalisierung der Bildung auch hier eine Zusammenarbeit hilfreich sein könnte.
“Alle sind sich ja darin einig, die Verfahren bei der Beschaffung digitaler Tools und Plattformen schlanker zu machen”, meinte Schön. “Es geht aber nicht nur um Verfahren, es geht auch darum, dass jeder seine Hausaufgaben macht.” Schön verwies auf die wichtigste Trennlinie, wenn es darum geht, Schulen und Lehrern bei der digitalen Bildung schnell unter die Arme zu greifen: die zwischen Bund und Ländern. “Wir können von der Bundesseite aus viel fordern”, sagte Schön jetzt. “Aber es muss am Ende auch die Länderseite mitmachen.”

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass die Schulschließungen angesichts hoher Infektionszahlen verfassungsmäßig waren. Das hatte unter anderem nur deswegen Gültigkeit, weil Bund und Länder Distanzunterricht möglich machten. Schulische Bildung ist also ab sofort ein einklagbares Recht von Schülerinnen und Schülern. Und dazu gehört auch der Anspruch auf Distanzunterricht. Die Länder, heißt es in den Leitsätzen der Entscheidung, “haben dafür zu sorgen, dass bei einem Verbot von Präsenzunterricht nach Möglichkeit Distanzunterricht stattfindet.”
Dass damit digitaler Distanzunterricht gemeint ist, macht das Verfassungsgericht an einer Fülle von Stellen klar. “Bei guter digitaler Ausstattung von Schülern und Lehrkräften und angepassten pädagogischen Konzepten können nach sachkundiger Einschätzung zumindest Fertigkeiten und Wissen auch im Rahmen von Distanzunterricht erfolgreich vermittelt werden.” Das verblüfft Verfassungsrechtler wie Digitalisten.
Der Bielefelder Verfassungsrechtler Franz Mayer spricht von einer “Pflicht zum Distanzunterricht”, die das Verfassungsgericht den Ländern aufgetragen habe. Und Karlsruhe sei sogar einen Schritt weiter gegangen, es habe ein neues soziales Grundrecht entwickelt. “Das verdichtet sich dann auch noch zum Recht, also, wie die Juristen sagen, zum subjektiven Recht, zum Anspruch auf Distanzunterricht,” sagte Mayer im FAZ-Podcast Einspruch.
Peter Ganten vom Bundesverband digitale Souveränität zeigte sich erfreut. “Wirklich neu und wegweisend ist die daraus abgeleitete Feststellung”, sagte Ganten Bildung.Table, dass “dem gesamten Bildungssystem und vor allem Lehrern, Schulträgern und Ministerien nun verbindlich aufgelegt ist, sich auf die Möglichkeit zukünftiger Schulschließungen vorzubereiten. Sowohl in der Lehrerfortbildung als auch in Bezug auf technische Infrastruktur sind jetzt die Voraussetzungen für Distanzunterricht zu schaffen.”
In der Tat formuliert das BVerfG für den Fall, dass das neue Recht auf Schulbesuch in Präsenz ausfallen könne, weitgehende Forderungen vor allem an die zuständigen Bildungsminister:innen: “Sollten im weiteren Verlauf der Pandemie erneut Beschränkungen des Schulbetriebs in Betracht gezogen werden, wäre deren Zumutbarkeit jedenfalls auch daran zu messen, ob naheliegende Vorkehrungen wie insbesondere eine weitere Digitalisierung des Schulbetriebs ergriffen wurden, um künftige Beschränkungen des Präsenzunterrichts grundrechtsschonender ausgestalten zu können. Dies trifft Bund und Länder, soweit sie kompetenziell zuständig sind, gleichermaßen.” Diese Passage ließe sich auch so übersetzen: Wer digitales Lernen nicht vorbereitet, darf keine Schulen schließen.
Katja Hintze von der Stiftung Bildung leitet daraus einen verfassungsgerichtlich legitimierten Abschied vom Klassenzimmer ab. “Wir bereiten uns als Gesellschaft auch darauf vor, dass das wichtige Lernraum- und Lebensformat ‘in der Schule’ durch ein Recht auf digitalen Distanzunterricht standardmäßig ergänzbar ist. So können wir Bildung chancengerechter und für mögliche weitere unerwartete Veränderungen krisenfester machen”. Max Maendler von Eduki fragte beinahe ungläubig, ob Präsenz damit grundsätzlich infrage gestellt werde. “Könnte ich als Lehrerin oder Schulleiterin entscheiden, dass bei mir das Recht auf schulische Bildung zwei Wochen ohne Präsenz gewahrt wird?”
Lena Spak von der Lernplattform Scobees sagte Bildung.Table: “Mit der Entscheidung des BVerfG steht nun fest: Eltern haben ein einklagbares Recht auf einen brauchbaren Distanzunterricht. Brauchbar ist er nur dann, wenn er mit einem Unterricht in Präsenz vergleichbar ist. Sprich, nicht die Eltern sind dafür zuständig, Anleitungen, Erklärungen und Korrekturen an den schulischen Arbeiten ihrer Kinder vorzunehmen.”
Verfassungsrechtler mahnen allerdings zu Geduld. Karlsruhe habe einen neuen Rechtsgrundsatz aufgestellt. Was gerade die Kultusminister der Länder daraus konkret ableiten, bleibe abzuwarten. Wer Grundrechte säe, werde Verfassungsbeschwerden ernten. “Das ist schon sehr weitgehend“, sagte Franz Mayer zur Entscheidung. Das Gericht habe etwas formuliert, was der Bundesgesetzgeber wegen ihrer Kulturhoheit von den Ländern nicht einfordern konnte. “So etwas den Ländern vorzugeben, wäre wahrscheinlich zu weit in die Kompetenzhoheit im Bereich der Schule der Länder gegangen. Aber das Verfassungsgericht kann das.”
Auf gut siebzig Seiten begründete das Gericht in seiner einstimmig gefassten Entscheidung, warum die Schulschließungen rechtens waren. Im Kern geht es um die Abwägung zwischen zwei hohen Rechtsgütern. Auf der einen Seite stehen Leib und Leben, auf der anderen das Recht auf schulische Bildung, das die Karlsruher Richter aus den Artikeln 2 (Freie Entfaltung der Persönlichkeit) und 7 (Schulen) des Grundgesetzes herleiteten. Karlsruhe entschied, dass ein Teil des Rechts auf freie Persönlichkeitsentwicklung auch das Lernen in der Schule sei. Dieses Recht dürfe der Staat jungen Menschen nicht einfach verwehren. Er darf das selbst zum Schutz von Leib und Leben aller nicht – außer der Staat bietet eine Alternative an. Der Distanzunterricht ist in den Augen des Verfassungsgerichts also das Unterpfand, das Schulschließungen erst legal machte.
Das Urteil etabliert erstmals ein einklagbares, also subjektives Recht auf schulische Bildung. Das wirft auch Fragen hinsichtlich digitaler Bildung und der dafür nötigen Mittel auf. Der Staatsrechtler Michael Wrase aus Hildesheim widmet sich diesen im Verfassungsblog. Aus dem Recht auf schulische Bildung könnten keine einzelnen Ansprüche auf die konkrete Ausgestaltung der Schule hervorgehen. Der Schonraum, der den Kultusministern der Länder bleibe, sei dennoch klein. Denn das Gericht erkenne einen Anspruch auf Distanzunterricht genauso an, wie “deutlich stärkere Anstrengungen, vor allem bei der Digitalisierung.” Laut Wrase wird man zukünftig auch die Ausstattung der Schülerschaft mit “für den Fernunterricht notwendige[n] digitale[n] Mitteln” mindestens für bedürftige Schulpflichtige als “einklagbaren Anspruch ansehen müssen”.
Max Maendler, Gründer und Geschäftsführer von Eduki, sieht im Urteil eine Richtungsänderung: “Es dreht die Dinge in die richtige Reihenfolge. Am Anfang steht eben nicht die Präsenzpflicht, sondern das Recht auf schulische Bildung.” Präsenzunterricht sei nur ein Mittel zum Zweck. Es stehe Ländern oder einzelnen Schulen frei, mittels neuer Wege dem Recht auf Bildung Rechnung zu tragen – etwa durch Lernen außerhalb des Klassenraums. Bei Scobees sei das bereits Wirklichkeit, berichtete Lena Spak: “Sogar während des Lockdowns haben wir auch an sogenannten Brennpunktschulen keinen einzigen Schüler oder Schülerin verloren. Das gelingt vor allem unter Einsatz moderner Lernmethoden, die Kinder zu selbstständigem Lernen befähigen und Lehrkräfte als individuelle Lernbegleiter unterstützen.”
Auch Christian Büttner, Vorsitzender des Bündnis für Bildung, hob auf die Chancengleichheit ab, die das BVerfG in seiner Urteilsbegründung herausstellt. Erfolgreicher Distanzunterricht setze voraus, dass Lehrende und Lernende sich austauschen und gemeinsam lernen könnten. “Dazu ist die Verfügbarkeit einer bedarfsgerechten Ausstattung sowie Umsetzung didaktischer und pädagogischer Konzepte für ein digitales, oder hybrides Lernen notwendig, so dass alle Lernenden gleichermaßen im Präsenzunterricht und am Distanzunterricht teilnehmen können.”
Karlsruhe hat entschieden, dass digitales Lernen das Recht auf Bildung einlösen kann. Nun ist die Politik aufgefordert, Mittel, Fachwissen und Infrastruktur bereitzustellen – um möglichst jedem jungen Menschen digitale Schule zugänglich zu machen. Robert Saar mit Christian Füller

Herr Rummler, Sie haben gerade mit Kolleg:innen der Medienpädagogik ein Papier veröffentlicht, das sich kritisch mit digitaler Schule befasst. Wo wollen Sie die Digitalisierung stoppen? Wo geht sie in die falsche Richtung?
Stoppen wäre der falsche Ansatz. Was aber durchaus irritierend ist, dass sich auch die frühkindliche Bildung für digitale Vermessungs-Technologien öffnen soll. Die pauschalisierende Rede von den Potenzialen digitaler Medien beim Lernen bedarf der Demystifizierung. Die Kultusminister:innen müssen mögliche Risiken, die mit dem Einsatz digitaler Technologien in der Schule einhergehen, klarer in den Blick nehmen.
Was besorgt Sie?
Wir müssen neoliberale und ökonomisierende Tendenzen, welche die Digitalisierung mit sich bringt, viel ernster nehmen, gerade im Schulbereich. Die zunehmende Ökonomisierung der Bildung auch durch digitale Medien führt zu einer grundlegenden Veränderung des Schulsystems.
Aber Sie sind doch nicht grundsätzlich gegen Digitalisierung?
Nein, natürlich nicht. Ein Einbezug digitaler Medien in der Schule macht aus Sicht der Medienpädagogik Sinn. Digitale Medien gehören heute selbstverständlich zum Arbeitsalltag von Schüler:innen und Lehrpersonen – meist allerdings außerhalb der Schule. Das heißt, auch in die Schulen müssen endlich Arbeitsgeräte einziehen wie zum Beispiel Notebooks oder Convertibles – ich meine nicht Tablets…
… warum keine Tablets?
Tablets sind wie große Smartphones, aber keine ernstzunehmenden leistungsfähigen Arbeitsgeräte. Notebooks und Convertibles sind dagegen universell einsetzbar. Zur selbstverständlichen Ausstattung von Schulen zählen ferner, flächendeckendes WLAN an Schulen, Zugang zu online-Lernmitteln bis hin zu Hausaufgaben, die sich allein oder in Gruppen bearbeiten lassen.
Sie sind Medienpädagoge. Warum konzentrieren Sie sich so sehr auf die apparative Ausstattung der Schulen?
Ohne diese Ausstattung können Lehrer:innen die Bildung in der digitalen Welt nicht umsetzen. Im Digitalpakt geht es ja in der Praxis zunächst mal um die technische Infrastruktur der Schulen. Aber, Sie haben recht, das Hauptgeschäft der Medienpädagogik liegt im Entwickeln pädagogischer Konzepte zur Förderung der Medienkompetenz von Schüler:innen.
Man hat den Eindruck, Sie verlieren in Ihrer Kritik die Big Five, die Billionen-Dollar-Konzerne wie Google, Apple und Microsoft, aus dem Blick. Dafür fassen Sie die kleinen digitalen Bildungsanbieter umso härter an.
Nein, die Kritik an einer zunehmenden Ökonomisierung durch digitale Medien bezieht sich sowohl auf Hyperscaler als auch auf kleinere Bildungsanbietende. Zentral ist es für uns, die Entscheider für die Ambivalenzen von Digitalisierung zu sensibilisieren. Das betrifft alle Akteure von schulischer Bildung von den Schulträgern bis hin zu den Kultusminister:innen. Sie sind es, die die Weichen bei der Digitalisierung stellen – häufig, ohne die kritischen öffentlichen Reflexionen. Das kann ganz schnell gehen. Österreich und Schweiz etwa haben mit Microsoft Rahmenverträge für das gesamte Bildungssystem abgeschlossen.
Warum haben Sie gegen diese Rahmenverträge nicht interveniert?
Das haben wir, sind aber damit nicht durchgedrungen. Das Problem an diesen Prozessen ist auch die intransparente Vergabestruktur. Verschiedene Kolleg:innen der Medienpädagogik haben darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die öffentliche vergleichende Auswahl an Anbietern für digitale Schule ist. Wir müssen Lobbystrukturen aufdecken – so wie wir das zum Beispiel in Österreich getan haben. Es geht uns nicht darum, digitale Medien in der Schule zu verhindern. Aber wir brauchen endlich eine intensive öffentliche Diskussion: über deren Einsatz, die Folgen und mögliche Alternativen aus dem Open Source-Bereich. So wie es in Frankreich zum Beispiel im Fall der öffentlichen Verwaltung geschah.
Wäre es nicht ganz einfach? Schule soll Kinder durch Lernen zur Selbstbestimmung führen. Aber ohne informationelle Selbstbestimmung über ihre Daten geht das nun mal nicht.
So einfach ist es leider nicht. In der Schule haben die Kinder ohnehin nur eingeschränkte Selbstbestimmung über ihre Daten. Schulen haben schon immer Daten von Schüler:innen erzeugt, verwaltet und ausgewertet. Bei der Speicherung in digitalen Systemen wird es nun nochmal komplizierter – und weitreichender. Da darf man sich nicht so einfach den vertraglichen Beteuerungen der Anbieter hingeben. Wir müssen eine Datenanalyse etablieren, die wissenschaftlichen Kriterien standhält. Und wir müssen dies in breiter Öffentlichkeit publik machen.
Das Hauptproblem sind hier ja die Big Five, die unsere Daten grundsätzlich den US-Behörden verfügbar machen müssen. Warum aber führen dann bestimmte Teile der Medienpädagogik eine regelrechte Kampagne gegen digitale Mittelständler wie Bettermarks, Simpleclub oder Sofatutor?
Ich sehe diese Kampagne nicht. Besagte Unternehmen machen inhaltlich teilweise einen echt guten Job. Der Markt wird momentan genau durch diese neuen Player ziemlich durchgeschüttelt. Nun müssen wir erkennen, dass man auf dem Markt der Bildungsmedien gar nicht genau darauf geachtet hat, welche unternehmerischen und wirtschaftlichen Konzentrationen entstanden sind, Stichwort Schulbuchverlage. Diese Debatte müssen wir jetzt auf den gesamten Markt übertragen – gerade weil die mächtigen Big Five dort immer stärker eindringen.
Wo liegt das pädagogische Problem dieser Intervention von Technologie?
Hier geht es auch um Phänomene zunehmender Vermessung von Schüler:innen und Lehrpersonen. Und um Fragen nach Qualität – und die sind unabhängig von der Größe des jeweiligen Unternehmens. Wir sollten genau(er) hinschauen, was unter dem Deckmantel der Innovation nun die Schule betritt. Und welche Folgen das gerade für diesen sensiblen Bereich hat.
Selbst kleine Startups wie Scoolio, Learnu oder Study Smarter können sich zu Datenkraken entwickeln. Wieso erkennt die Medienpädagogik solche Fälle nicht früher?
Bei Scoolio und Learnu muss man – wie bei allen Anbietern – genau hinschauen. Einerseits gibt es – oft übertriebene – Befürchtungen aus dem Alltagsleben. Etwa die Angst, dass dunkle Mächte Daten-Abwanderungen oder gar den Verkauf persönlicher Daten inszenieren. Andererseits brauchen wir belastbare wissenschaftlich-empirische Analysen zu Datenverkehr und zum technischen Aufbau einer Bildungssoftware. Diese Anbieter bedienen übrigens den Bildungsmarkt außerhalb der Schule. Da können wir als Medienpädagogen zunächst nur an Eltern appellieren, auf den Datenschutz bei digitaler Bildung zu achten.
Nehmen wir das Beispiel GoStudent. Ein Startup, das den weltweiten Markt im Schnellverfahren erobert, ein Einhorn mit einem Wert von einer Milliarde Euro. Welche Position nimmt die Medienpädagogik da ein?
Auch GoStudent ist ein Anbieter außerhalb des Bildungssystems. Meist geraten sie erst in unseren Blick, wenn sie in das Bildungssystem integriert werden. Solche Unternehmen gewähren zudem praktisch nie Einblick in ihren Code und in die Software. So kann man beispielsweise nicht einschätzen, was eine KI dort genau macht. Daher fordern wir, dass die neuen Bildungsunternehmen sich und ihre Algorithmen für die Forschung öffnen – dann könnte man sie auch ernster nehmen.
Wie ist Ihre Haltung zu Learning Analytics? Sie ermöglichen es, die Lernbewegungen einzelner Schülerinnen und Schüler zu diagnostizieren.
Auch hier gilt es, die Ambivalenzen zwischen Förderung und Überwachung in den Blick zu nehmen. Die quantitative Vermessung von Bildungsprozessen ist nicht per se gut oder schlecht. Sie gehen mit Folgen und Nebenwirkungen einher, die Lern- und Bildungsprozessen auch schaden können. Wir warnen daher vor einem weiteren blinden Ausbau und vor allem einem blinden Vertrauen in derartige Technologien – insbesondere in der Schule.
Wie weit sind Learning Analytics (LA) verbreitet?
LA treten derzeit in sehr unterschiedlichen Formen und recht lückenhaft im Schulsystem auf. Es ist in meinen Augen derzeit noch kein durchgängiges und kein wirklich nutzbares Diagnosetool. Unser Ziel ist es, die pädagogische Diagnostik von Learning Analytics besser für Lehrpersonen verfügbar zu machen. Wichtig ist zu reflektieren: Wer hat denn am Ende eigentlich die Entscheidung über den Umgang mit den Lerndaten inne? Treffen Lehrpersonen die pädagogische Entscheidung? Oder ist es alleine das System, das über Noten, Leistungsniveau oder über den Schulübertritt entscheidet?
Wie kann denn der Umgang mit Learning Analytics durch Schulen so gestaltet werden, dass Kinder nicht zum gläsernen Schüler werden?
Da muss ich schmunzeln. Der viel beschworene gläserne Patient stellte sich nach Einführung der Krankenkassenkarte noch als das geringste Problem heraus.
Was ist beim digitalen Lernen das Problem?
Mit der Digitalisierung geraten wir derzeit in eine riesige gesellschaftliche Aushandlungsdebatte: Welche Daten von uns wollen wir sichtbar machen? Welche sollen wenigstens halbwegs unsichtbar, aber längerfristig übertragbar sein? Und gibt es Daten, die wir keinesfalls gespeichert wissen wollen?
Wieso kommt Ihr Papier eigentlich so spät?
Die Medienpädagogik hätte bereits im Frühjahr 2021 zur weiteren Entwicklung des Strategiepapiers “Bildung in der digitalen Welt” Stellung nehmen sollen. Die KMK hat das jedoch abgelehnt und stattdessen die eigene Ständige Wissenschaftskommission damit beauftragt. Dort sind aber keine Medienspezialisten vertreten, die den jetzigen Stand wirklich einordnen können. Daher wollten wir mit Blick auf die KMK-Sitzung am 9. Dezember dieses kritische Positionspapier bekannt machen.
Dr. Klaus Rummler ist Senior Researcher an der Pädagogischen Hochschule Zürich, Vorsitzender der Sektion Medienpädagogik (der Gesellschaft für Erziehungswissenschaften) und geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift MedienPädagogik.

Gastbeitrag von Sabine Bösl
Die zusätzlichen Aufgaben für uns Schulleiter und der immens gestiegene Organisationsaufwand in unseren Schulen nehmen kein Ende mehr. Wir müssen ständig in Rekordgeschwindigkeit neue Konzepte für das Lernen unter Pandemiebedingungen erstellen. Wir versuchen, alles möglich zu machen, damit der Unterricht läuft. Aber wir sind doch weit über unsere Belastungsgrenze hinausgegangen – seit über eineinhalb Jahren. Wir machen das für die Kinder, die uns am Herzen liegen, und für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen niemanden im Stich lassen. Aber trotzdem müssen viele Schulleiterinnen und Schulleiter erkennen, dass sie nicht mehr können und sich völlig überlastet fühlen. Ich arbeite in der Pandemie wegen der enormen Fülle an Aufgaben oft bis in die Nacht hinein – begleitet von immer neuen Schreiben aus dem Kultusministerium.
Wir kommen kaum mehr hinterher, um alles an unseren Schulen zu schaffen. Wir müssen nicht nur die Verwaltung und die ganze Organisation rund um Corona stemmen. Gerade an den Grundschulen müssen wir gleichzeitig sehr viele Unterrichtsstunden halten, weil wir aus meiner Sicht viel zu wenig Leitungszeit haben. Das ist ein enormes Pensum, und ich habe das Gefühl, ich kann den Kindern im Unterricht dann nicht mehr gerecht werden. Das ist schon in normalen Zeiten für einen Schulleiter kaum zu schaffen – in einer Pandemie wird es noch schwieriger. Aber trotzdem halten wir durch, halten wir noch durch. Obwohl viele von uns schon längst das Handtuch geschmissen hätten. Wie lange soll das noch gut gehen? Wie lange ignoriert die Politik noch unsere Sorgen?
Wir fordern eine bessere und schnellere Kommunikation durch das Kultusministerium an die Schulen. Es kann doch nicht sein, dass wir Schulleiterinnen und Schulleiter Informationen der Presse entnehmen müssen, weil das Schreiben aus dem Kultusministerium erst Tage später verschickt wird. Eltern können das nicht mehr nachvollziehen, warum ihre Schulleiter nicht kompetent Auskunft geben können – wenn bereits Tage zuvor die Pressekonferenz war und in der Zeitung längst alles stand. Ich informiere mich aus der Presse. Die kultusministeriellen Schreiben erreichen uns immer häufiger am Freitagnachmittag oder Abend. Umgesetzt werden müssen diese beschriebenen Maßnahmen natürlich umgehend. Dann arbeiten wir die Wochenenden durch. Diese Informationspolitik führt in den Schulen zu großem Unmut; bei den Schulleitungen und bei den Kolleginnen und Kollegen.
Wir Schulleiterinnen und Schulleiter müssen schauen, wie wir die Löcher stopfen. Ich muss gucken, wie ich vor Ort noch alles irgendwie aufrechterhalte: den normalen Unterricht trotz extremer Personalknappheit, die zusätzlichen Aufgaben der Pandemie mit Kontrollieren, Testen und Nachverfolgen des Infektionsgeschehens und und und. Ich fühle mich im Stich gelassen wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen.
Wir brauchen Rückendeckung und Beistand von unserem Dienstherrn, gerade jetzt, in dieser Situation. Ehrlichkeit ist gefragt. Und nicht ein Schönreden der Wirklichkeit. Wir brauchen eine Politik, die uns öffentlich den Rücken stärkt. Und die uns das Vertrauen ausspricht. Und die uns nicht unter Druck setzt mit völlig unrealistischen Zeitabläufen, die kein Mensch mehr schaffen kann.
Verbale Angriffe von Eltern nehmen nach meiner Erfahrung als Schulleiterin zu, das ist durchaus zu beobachten. Die Eltern stehen unter enormem Druck, und je länger die Pandemie geht, desto deutlicher wird das spürbar. Auch den Eltern geht die Luft aus. Die Erwartungen sind von Elternseite oftmals so hoch, dass wir das in unserer schulischen Realität nicht mehr erfüllen können. Wenn Kolleginnen erkranken und der Lehrermangel dermaßen durchschlägt, dass ich als Schulleiterin für Klassen keine Lehrerin mehr habe und Eltern das nicht verstehen können, dann kommt es manchmal auch zu verbalen Entgleisungen.
Die unterschiedlichen Meinungen in der Gesellschaft spiegeln sich in unserer Elternschaft wider. Es gibt Eltern, die meinen, unsere Regeln an der Schule seien viel zu streng. Es könne doch nicht sein, dass Kinder z. B. derzeit die Maske tragen müssen im Sportunterricht. Und es gibt Eltern, die fordern von mir als Schulleiterin ein, ich müsste doch viel strenger alle Maßnahmen umsetzen. Wir sind da hin- und hergerissen – wie es auch unsere gesamte Gesellschaft ist. Da erkennen manche Eltern die Grenze nicht mehr und greifen uns Schulleiter:innen oder die Klassenlehrkräfte an.
Viele von uns Schulleiterinnen und Schulleitern können nicht mehr. Ich höre das täglich im Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Meiner Meinung nach darf die Politik nicht mehr länger zuschauen, sonst laufen wir sehenden Auges in die Katastrophe. Nun ist unser Dienstherr gefragt, seine Fürsorge für uns unter Beweis zu stellen. Hinter uns zu stehen, Vertrauen zu zeigen und uns zu schützen.
Sabine Bösl ist Leiterin einer Grundschule und stellvertretende Leiterin der Abteilung Schul- und Bildungspolitik im BLLV. Der Lehrerverband ließ fünf Schuleiter:innen ihre Situation schildern.
Soziale Innovationen sind in Deutschland zu dürftig finanziert. Zu diesem Schluss kommt die Vodafone Stiftung in einem neuen Policy Paper. Die Studie hat sich die beiden Bildungs-Hackathons der Coronazeit vorgenommen, #WirVsVirus und #wirfürschule. Beide Projekte erfuhren anfangs einen Hype, verschwanden aber bald vom Radar. Der Grund ist laut der Forscher einfach: “Die Förderungs- und Finanzierungslandschaft für soziale Innovationsprojekte ist in Deutschland lückenhaft.” Es fehle an langfristiger finanzieller Absicherung.
Das Paper macht entsprechend seinem Titel Vorschläge, wie sich “die Wirkung sozialer Innovationen im Bildungsbereich stärken” lässt. Da könne die Bildungspolitik im Falle der beiden Hackathons einiges besser machen. Die starteten als Formate, um ein weites Feld gesellschaftlicher Akteure zur Ideenfindung zusammenzubringen. Es ging darum, die pandemiebedingten Schulschließungen zu nutzen, um Bildung als Ganzes soweit nach vorn zu bringen, wie es im laufenden Betrieb schwer möglich ist. Aus diesem Anfangsschwung sind einige Ideen und Projekte für die Verbesserung von Bildungschancen entstanden. “Es konnten nur wenige dieser Projekte bislang eine größere Wirkung entfalten”, schreiben die Macher der Studie. Es fehlte der lange Atem. Nur wenige der Projekte blieben lange genug bestehen. “Neues zu etablieren, gerade in einem strukturkonservativen Bildungssystem, ist jedoch eine Mammutaufgabe.”
Die Hackathons als Methode der offenen sozialen Innovation scheiterten laut Studie an den Strukturen im Bildungssystem mit seinen ungünstigen Rahmenbedingungen für Bottom-up-Initiativen von außen. So blieben etwa die 15 ausgewählten Projekte, die das Rennen bei #wirfürschule machten, weitgehend auf der Strecke. Man begleitete sie im Anschluss zwar, aber offenbar nicht lange genug. Den Projekten ging nicht nur das Geld aus, sondern auch die öffentliche Aufmerksamkeit. Kleine ehrenamtliche Teams verfügen weder über die Mittel noch über das Marketing, um mit ihren Ideen an den entscheidenden Stellen anzukommen.
Wird dagegen ein Projekt von einem Kultusministerium unterstützt oder auch offiziell als Lernmittel anerkannt, gehe das oft mit finanziellen Ressourcen und einer größeren Sichtbarkeit einher. In der Pflicht sieht die Vodafone Stiftung indes den Bund. Dem Bundesbildungsministerium legt das 16 Seiten lange Paper nahe, mit einem über mehrere Jahre geförderten Programm den Erfolg künftiger Hackathons zu unterstützen – und gleichzeitig für eine Evaluation und bundesweite Vernetzung zu sorgen. Christine Keilholz
Das Verwaltungsgericht Wiesbaden geht gegen die Hochschule RheinMain vor, weil sie die Cookie-Software “Cookiebot” einsetzt. Die Hochschule darf den Dienst Cookiebot per einstweiliger Anordnung auf ihrer Website nicht mehr nutzen. Dies entschied das VG Wiesbaden vergangene Woche (Az.: 6 L 738/21.WI). Grund für die Anordnung ist Cookiebots Datenverarbeitung in den USA. Die Software wird von vielen Websites dafür eingesetzt, um Zustimmungen für eingesetzte Cookies zu erlangen.
Das VG Wiesbaden kritisierte, dass die vollständige IP-Adresse der Benutzer auf Servern in den USA verarbeitet wird, was laut “Schrems II-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs so unzulässig sei.” Das schreibt die Verwaltungsgerichtsbarkeit Hessen in einer Pressemitteilung. Die Nutzer der Seite werden zudem weder über mögliche Risiken dieser Übermittlung informiert, noch sei die Datenverarbeitung in den USA für das Betreiben der Hochschul-Website relevant.
Cookies sind sehr kleine Datenpakete, die Nutzerdaten von Websites lokal und auf dem Website-Server speichern. Die Website kann den Nutzer so wiedererkennen und dadurch viele relevante Funktionen anwenderfreundlicher gestalten. Das geht allerdings auch ohne Datenübertragung in die USA. Website-Betreiber nutzen Dienste wie Cookiebot, um die gesetzlich vorgeschriebene Zustimmungspflicht bei Cookies einzuhalten. Die sogenannte EU-Cookie-Richtlinie und ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union im Oktober 2019 haben dazu geführt, dass Nutzer allen Cookies im Vorfeld zustimmen müssen. Cookiebot übernimmt diese Abfrage. Es gibt allerdings viele datenschutzkonforme Systeme, die das ebenfalls können. Die Hochschule RheinMain kann nun binnen zwei Wochen Beschwerde gegen die Anordnung einlegen.
Usercentrics, die Vertreiber von Cookiebot, das die Hochschule einsetzte, äußerten sich gegenüber Bildung.Table abwartend zu der Entscheidung des VG Wiesbaden. Die Dänen haben auch erst am Montag von der Anordnung erfahren und wollen sich zuerst inhaltlich in den Fall einarbeiten, um angemessen auf die aufgebrachten Kritikpunkte reagieren zu können. Enno Eidens

Das Sicherheitskollektiv Zerforschung hat zum dritten Mal eine schwere Sicherheitslücke in einer Lernsoftware veröffentlicht, diesmal bei Study Smarter. Study Smarter ist nach eigenen Angaben eine Lernapp. Sie soll Schüler:innen und Studierende strukturiert auf Prüfungen vorbereiten. Das geschieht im Wesentlichen mit klassischen Lernkarten, aber auch mit Zusammenfassungen, Übungsaufgaben oder Mindmaps. Die Inhalte können auf der Plattform selbst erstellt und dann mit der Community geteilt werden. So hat man Zugriff auf die Lerninhalte anderer Nutzer:innen. Auch Inhalte professioneller Verlage wie zum Beispiel die Hemmer-Repetitorien für Jura-Studierende stehen als Inhalte auf der Plattform bereit.
Diesmal musste Zerforschungs-Mitglied Karl (Nachname unbekannt) vom Sicherheitskollektiv nicht lange suchen: Die App fragte die Daten des jeweiligen Nutzer:innen-Profils ohne Sicherung vom Server ab. Wenn man diese Profilnummer eins nach unten zählte, bekam man die Profildaten der Person zu sehen, die sich kurz zuvor registriert hatte. Insgesamt rund drei Millionen Stammdaten von registrierten Nutzer:innen standen so ungeschützt im Netz. Sie enthielten Name, E-Mail-Adresse, Schule/Universität, Profilbild, Geburtsdatum und Wohnort.
Mittlerweile ist die Sicherheitslücke bei Study Smarter geschlossen. Das Startup hatte erst im Mai 15 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt. Es habe auch ein Sicherheitsaudit gegeben, das mögliche Sicherheitslücken finden sollte. Der problematische Code entstand wohl erst danach. So ließ Study Smarter eine Sicherheitslücke für teilweise minderjährige Personen zu. “Es müsste eigentlich eine Liste geben, mit Software, die bedenkenlos an Schulen eingesetzt werden kann.” Das sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz in Bayern, Thomas Petri, bereits im Frühjahr. Davon ist noch nichts zu sehen.
Der Autor hat die App Study Smarter für Bildung.Table untersucht. App und Website enthalten auch jetzt noch zahllose Werbetracker, die ohne Einwilligung unzulässig sind. Dazu zählen auch die Facebook Business Tools. Studierende und Schüler:innen ahnen es wahrscheinlich nicht: Ihre Verhaltensdaten in der App gehen direkt an ihr – falls vorhanden – Facebook-Profil. Auch um das herauszufinden, braucht man keine zehn Minuten. Matthias Eberl

Der Abgeordnete und ehemalige Telekom-Personal-Vorstand Thomas Sattelberger wird Staatssekretär im Bundesbildungsministerium (BMBF). Der Werdegang des 72-Jährigen ist alles andere als gewöhnlich. Sattelberger entwickelte sich vom linksradikalen Revoluzzer, der Joschka Fischer zu kleinbürgerlich fand, zum Liberalen und Macher bei Daimler und Telekom. Dort setzte er Diversity-Themen entschieden um. 2017 zog er für die FDP in den Bundestag ein. Nach seiner Wiederwahl nun der Aufstieg auf den Staatssekretärsposten im BMBF. Seine Themen: Diversität und MINT, also Mathematische, Informatische, Naturwissenschaftliche und Technische Bildung.
Am bekanntesten machte Sattelberger die Durchsetzung der Frauenquote bei der Telekom, lange bevor die Politik auf die Idee kam. Sattelberger war von 2007 bis 2012 bei der Telekom als Personalchef tätig. Seine Frauenquote von dreißig Prozent in mittleren und oberen Führungspositionen brachte ihm den Beinamen “Quotenmann der Republik”. Bereits 2010 setzte sich Sattelberger für mehr Gleichstellung ein – auch gegen Widerstände. Als man ihm zehn Monate lang nur Männer als Besetzungsentscheidung für wichtigen Telekompositionen vorschlug, lehnte er ab. Und gab erst nach, als auch Frauen auf den Vorschlagslisten zu finden waren. In einem Interview fragte ihn die taz, was neben der Gerechtigkeit für Diversität spräche. Seine Antwort: “Menschenrechtsfragen mit Demografie oder Erfolgsträchtigkeit zu beantworten, finde ich immer ein bisschen schäbig”.
Kurz zuvor hatte der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, welches von Unternehmen die Selbstverpflichtung einforderte, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Unternehmen wie Eon oder die Commerzbank nahmen sich daraufhin vor, in den Vorständen null Prozent Frauen zu haben. Laut Sattelberger sind flexible Quoten, wie in diesem Gesetz angewandt, schwerer umzusetzen. “Dazu müssen die maskulin definierten Gepflogenheiten auf Chefetagen aufhören. Wenn wir da nicht knallharte Kulturarbeit zum Thema Vielfalt machen, können wir uns das Gesetzesgedudel sparen.”
Wenn Sattelberger Vielfalt sagt, dann meint er nicht nur Frauen. Bei der Telekom setzte er sich auch dafür ein, dass alte Arbeitnehmende, Jugendarbeitslose und Menschen mit Handikaps ins Unternehmen kommen. Er mache das Ganze, sagte er in einem Interview, “weil ich überzeugt bin, dass ein Unternehmen die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln muss. Und weil wir uns der sozialen gesellschaftlichen Verantwortung nicht entledigen können.”
Trotz gesamtgesellschaftlicher Verantwortung setzte Sattelberger 2007 durch, dass die Telekom 50.000 Mitarbeitende in konzerneigene Servicegesellschaften auslagern konnte. Nach einem fünfwöchigen Streik, dem ersten in der Geschichte der Telekom, erzielte der knallharte Macher schließlich einen Kompromiss mit Verdi. Und sicherte somit deren Zustimmung zur Auslagerung.
Neben Vielfalt schreibt sich Sattelberger vor allem die MINT-Bildung auf die Fahnen. Aus seiner Sicht ein entscheidender Baustein zum Umbau der Wirtschaft im Zeitalter der Digitalisierung. Auf seinem Blog beschreibt er sich als aktiver Förderer mit voller Leidenschaft des “Nationalen MINT Forums”. Er ist auch Vorstandsvorsitzender des Vereins “MINT Zukunft schaffen”. Dieser sieht den Wirtschaftsstandort Deutschland durch den Engpass an naturwissenschaftlich-technisch qualifizierten Fachkräften gefährdet. Explizit fordert der Verein einen Abbau von Bildungsbarrieren, die insbesondere Menschen mit Berufsausbildung von weiterer Qualifikation abhalten würden.
Die Kritik am Bildungswesen ist keine neue. Bereits 2011 monierte Sattelberger, wie schwer es sei, als beruflich Qualifizierter Zugang zu Hochschulen zu erhalten. “In diesem Talentsegment steckt so viel Wissen und Aufstiegswille, dass es eine Sünde ist, dies von den Unis fernzuhalten”. Die Schuld dafür sah er vor allem in den zersplitterten Regeln 16 verschiedener Länder. Sattelberger kommentierte: “Die Länder in der deutschen Bildungspolitik, das kommt mir manchmal vor, als wollte man streunende Katzen zähmen.”
Einen gutes Gespür für Politik dürfte Sattelberger dank seines Jugendfreundes Joschka Fischer schon lange haben. Die beiden lernten sich in der Unabhängigen Schülerschaft kennen. Um diese Zeit herum politisierte sich der damals 16-jährige Schwabe bei einem Auslandsjahr in den USA. Er opponierte gegen Vietnamkrieg und Diskriminierung. Im Kommunistischen Arbeiterbund, dem Sattelberger angehörte, wurde ihm die Freundschaft zu Fischer allerdings zum Verhängnis. Da der als Kleinbürger und als nicht links genug galt, waren den Genossen die Freunde nicht geheuer: Sattelberger flog raus. Robert Saar

Die neue Regierung nimmt Gestalt an. Für die Bildung im Land wird eine liberale Ministerin die Verantwortung übernehmen, Bettina Stark-Watzinger. Seit wenigen Tagen stehen nun auch die beiden Staatssekretäre fest, zu denen Jens Brandenburg gehört, Bundestagsabgeordneter für Rhein-Neckar, geboren 1986. Brandenburg wird sich um das Thema kümmern, auf das die FDP schon beim Wahlkampf gesetzt hat: Digitalisierung.
Seit dem Abitur ist Brandenburg bei den Jungen Liberalen. 2017 zog er für die FDP auf einem der hinteren Plätze der Baden-Württembergischen Landesliste in den Bundestag ein. Vom einfachen Parlamentarier zum Staatssekretär im Bundesbildungsministerium (BMBF) – seine steile Karriere hat sich Brandenburg als bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion erarbeitet. Er war eine der lautesten Stimmen im Parlament, die die Corona-Politik der bald ehemaligen Bildungsministerin Anja Karliczek kritisierte.
Die FDP hat sich seit Beginn der Coronavirus-Pandemie als kritische Opposition im Bundestag hervorgetan. Immer wieder haben Junge Liberale, aber auch die Mutterpartei, auf die schwierige Situation der Schüler:innen, Auszubildenden und Studierenden aufmerksam gemacht. Brandenburg plädierte acht Wochen nach dem ersten Lockdown dafür, so schnell wie möglich in die Infrastruktur der Schulen zu investieren. Und nicht nur durch die Verteilung von ein paar hundert Tablets, sondern vor allem mit Geld für gutes IT-Personal. Brandenburg hat das Bildungssystem immer wieder weitergedacht. Zum Beispiel, in dem er neue Formate für die berufliche Aus- und Weiterbildung vorschlug. Oder den Aufbau digitaler Berufsschulen, vergleichbar vielleicht mit der Fernuni Hagen. Im Podcast der Online-Universität forderte er im August, die digitale Bildung müsse so einfach wie das Einkaufen in einem Online-Shop werden.
Das lässt auf ein BMBF hoffen, das gestaltet und nicht nur verwaltet. “Wir werden wichtige Vorhaben in der digitalen Bildung nicht länger liegen lassen oder gar verschleppen”, sagte Brandenburg im Gespräch mit Bildung.Table. Er will die “ambitionierte Agenda” im von der Koalition geplanten Digitalpakt 2.0 zügig vorantreiben. “Die Verlängerung des Digitalpakts bis 2030 ist ein wichtiger Punkt und ein starkes Signal”, sagt Jens Brandenburg. Sie bringe Planungssicherheit für die Schulen. “So können Schulen und Länder auch längerfristige Verträge zum Beispiel für die IT-Wartung schließen.” Eine Frage, die er nicht beantworten mochte, ist die nach der Höhe der zusätzlichen Mittel. So bleibt offen, wie hoch der Digitalpakt 2.0 dotiert sein soll.
Ein anderer Schwerpunkt wird Jens Brandenburg auf das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik setzen. Die FDP fordert schon lange, dieses abzuschaffen. So trägt sogar sein Twitter-Banner die Message “Kooperationsgebot statt Kooperationsverbot”. Er wolle dicke Bretter bohren, sagt Jens Brandenburg. “Das wird nur möglich sein, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen.” Das kann eine Änderung im Grundgesetz nötig machen. “Ich gehe davon aus, dass das ein Thema werden wird”, so der neue Staatssekretär.
Spannend wird es auf jeden Fall, wie sich das neue Dreiergespann – Bettina Stark-Watzinger, Thomas Sattelberger und Jens Brandenburg – mit der Schul-Bubble verstehen wird. Alle drei bringen ein Mindset mit, mit dem man Teams leiten, Unternehmen beraten oder Arbeitsprozesse optimieren kann. Ob das mit einem Berufsstand aus Pädagog:innen und Didaktiker:innen reibungslos zusammengeht? Wirkliche Bildungspolitik haben alle drei noch nicht gemacht und Regieren ist etwas anderes als Opponieren. Immerhin ist Jens Brandenburg ein bisschen näher dran an den Schüler:innen, Auszubildenden und Studierenden, als die Regierungsvertreter. Sein Abitur in Monschau und sein Studium in Mannheim sind noch nicht so lange her wie das seiner Kollegen.
Heute ist Tag der Bildung, eine Initiative vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Viele kleine und großen Angebote finden digital und vor Ort statt. Dazu gibt es die zentrale Bildungskonferenz. Das Bildung.Table-Team hat aus der großen Auswahl ein paar spannende Termine für sie zusammengestellt. Alle Events finden heute über den Tag verteilt statt. Infos & Registrierung
10:00 bis 11:30 Uhr, online
Präsentation/Vortrag: Online-Vortrag “Mit Kindern über Geld reden”
Heike Höhfeld gibt Eltern und Interessierten Tipps zu Taschengeld und Geldgesprächen mit Kindern. Organisiert wird der Vortrag von der Finanzgruppe Beratungsdienst Geld und Haushalt der Sparkassen. Infos & Anmeldung
14:00 bis 15:00 Uhr, online
Workshop/Seminar: “Wir können Politik!” Wie Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene gelingt
Tobias Scherf, Bürgermeister in Warburg und Monika Dehmel, Gründerin von “Politik zum Anfassen” wollen mit Vortrag und Debatte über die Inklusion von Jugendlichen in politische Prozesse sprechen. Infos & Mitmachen
14:00 bis 16:00 Uhr, online
Workshop/Seminar: Gesellschaftlich relevante Themen in Schule bringen: KI und Diskriminierung
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und interessiertes schulisches Personal kann von Ruhr Futur lernen, wie Lernvideos für den Unterricht, präsent oder distanziert, hergestellt und eingesetzt werden können. Infos & Mitmachen
15:00 bis 17:00 Uhr, online
Workshop/Seminar: Lernvideos einfach selber machen
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und interessiertes schulisches Personal kann von Ruhr Futur lernen, wie Lernvideos für den Unterricht erstellt und eingesetzt werden können. Infos & Mitmachen
15:30 bis 18:30 Uhr, im Bildungsforum Potsdam (Am Kanal 47, Potsdam)
Workshop/Seminar: Pixelgames – Baue dein eigenes Videogame
Zum Abschluss ein Termin, der vor Ort stattfindet. Die Stadt- u. Landesbibliothek Potsdam und die Initiative Creative Gaming laden Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zum Programmieren ein. Um Anmeldung wird gebeten. Infos & Mitmachen
jetzt geht`s los: Heute wollen die Abgeordneten des Bundestages von SPD, Grünen und FDP Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen. Danach werden die Minister seines Kabinetts vereidigt. Fortan regiert die Ampel. Nachdem die Koalitionäre zunächst “Fortschritt wagen” zu ihrem Motto erklärt haben, sagte Christian Lindner gestern bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, nun gelte, es “Fortschritt zu gestalten”.
In der Bildung, insbesondere der digitalen Bildung, haben SPD, Grüne und Liberale, viel zu tun. Beim “Tag der Bildung” können die koalitionären Bildungspolitiker heute Experten, Wissenschaftler und Praktiker treffen, die ihnen Hinweise für dringend anzufassende Themen der nächsten vier Jahre geben. Wollen auch Sie sich in das Programm des Bildungs-Tages einklinken? Weiter unten in der heutigen Ausgabe von Bildung.Table haben wir für Sie eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Thomas Sattelberger und Jens Brandenburg: Auf diese beiden FDP-Politiker gilt es in den kommenden Monaten zu achten. Als Staatssekretäre im Bildungsministerium werden sie Schlüsselfiguren bei der Umsetzung der digitalen Bildungsagenda sein. Welche Kompetenzen sie mitbringen, lesen Sie in den Portraits der beiden.
Weil aber wesentliche Änderungen im föderalen Bildungsland Deutschland ohne die Union nicht umzusetzen sind, rücken auch deren Fachleute ins Rampenlicht. Christian Füller hat mit der stellvertretenden Unions-Fraktionschefin Nadine Schön gesprochen, einer ausgewiesenen Digitalexpertin. Sie sieht ihre Oppositionsaufgabe gestaltend und kündigt in Bildung.Table an, der Ampelkoalition bei der Reform des Digitalpaktes nicht im Weg stehen zu wollen, sondern zu kooperieren – bis hin zu einer Änderung des Grundgesetzes.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,


Sie ist die wichtigste Digital-Politikerin der CDU. Jetzt hat die Bundestags-Fraktionsvize Nadine Schön, die zum Team von CDU-Kandidat Helge Braun gehört, der Ampel-Koalition Zusammenarbeit bei der digitalen Bildung signalisiert. “Von Unions-Seite besteht eine große Bereitschaft, zusammenzuarbeiten”, sagte Nadine Schön zu Bildung.Table. Dazu zähle auch, sich über eine Grundgesetz-Änderung zu verständigen. “Wir wollen Strukturen in Politik und Verwaltung verändern. Das gilt auch in der Opposition”, so Schön, deren Aufgabengebiet Digitalisierung ist. Ohne die Union kann die Ampel ihre weitreichenden Pläne zur Veränderung des Digitalpakts kaum verwirklichen.
Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag einen neuen Digitalpakt2.0 verabredet. Der soll nicht nur deutlich höher dotiert sein, sondern werde bis zum Jahr 2030 reichen. Die Pläne der Koalition gingen zwar in die richtige Richtung, sagte Schön. Die Ampel-Ideen seien aber bisher nur Stichworte. “Wir wollen mit der Ampel ins Gespräch kommen, wie man den Digitalpakt und die Kooperation in der digitalen Bildung grundsätzlich entbürokratisieren und beschleunigen kann.” Am Ende müsste auch die Länderseite einbezogen werden, “egal ob es um eine Grundgesetz-Änderung oder nur um eine Bund-Länder-Vereinbarung geht.” Die CDU-Fraktion sei für beides offen. “Wie man beim Digitalpakt gesehen hat, sind die bisherigen Verfahren zu aufwändig und zu bürokratisch. Das steht in keinem Verhältnis zum Output, den wir dabei erzielen”, sagte Schön.
Schön verwies darauf, dass die Union bereits weitreichende Pläne für eine grundlegende Staatsmodernisierung vorgelegt habe. Sie nannte die Initiative “Neustaat” und ein Papier, das der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière mit anderen für die Konrad-Adenauer-Stiftung verfasst hat. Nadine Schön gehörte der Arbeitsgruppe an. Der heutige Vorsitzende der Telekom-Stiftung hat zudem für den Bildungsföderalismus eine “große Staatsreform” vorgeschlagen. Er hat dabei detaillierte Vorstellungen entwickelt, wie man die Zusammenarbeit von Bund und Ländern für die digitale Bildung auf neue Füße stellen könnte (Bildung.Table berichtete). Die Pläne von de Maizière und Schön gehen viel weiter als die Verabredungen, welche die rot-grün-gelbe Koalition zum Thema Bildung traf.
Die Positionen zu Digitalpakt und einer möglichen Grundgesetzänderung folgen nicht den simplen Gesetzen von Parteizugehörigkeit. Schön erinnerte daran, dass der Grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, bei den bisherigen Digitalpakt-Verhandlungen nicht der Konstruktivste war. Tatsächlich hatte die Bundestagsfraktion der Grünen stets ganz andere Vorstellungen als der grüne Landesvater – der sich meistens durchsetzte. Schön, die sich kommende Woche wohl wieder zur Wahl als Bundestagsfraktions-Vize stellen wird, deutete an, dass für Fortschritte bei der Digitalisierung der Bildung auch hier eine Zusammenarbeit hilfreich sein könnte.
“Alle sind sich ja darin einig, die Verfahren bei der Beschaffung digitaler Tools und Plattformen schlanker zu machen”, meinte Schön. “Es geht aber nicht nur um Verfahren, es geht auch darum, dass jeder seine Hausaufgaben macht.” Schön verwies auf die wichtigste Trennlinie, wenn es darum geht, Schulen und Lehrern bei der digitalen Bildung schnell unter die Arme zu greifen: die zwischen Bund und Ländern. “Wir können von der Bundesseite aus viel fordern”, sagte Schön jetzt. “Aber es muss am Ende auch die Länderseite mitmachen.”

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass die Schulschließungen angesichts hoher Infektionszahlen verfassungsmäßig waren. Das hatte unter anderem nur deswegen Gültigkeit, weil Bund und Länder Distanzunterricht möglich machten. Schulische Bildung ist also ab sofort ein einklagbares Recht von Schülerinnen und Schülern. Und dazu gehört auch der Anspruch auf Distanzunterricht. Die Länder, heißt es in den Leitsätzen der Entscheidung, “haben dafür zu sorgen, dass bei einem Verbot von Präsenzunterricht nach Möglichkeit Distanzunterricht stattfindet.”
Dass damit digitaler Distanzunterricht gemeint ist, macht das Verfassungsgericht an einer Fülle von Stellen klar. “Bei guter digitaler Ausstattung von Schülern und Lehrkräften und angepassten pädagogischen Konzepten können nach sachkundiger Einschätzung zumindest Fertigkeiten und Wissen auch im Rahmen von Distanzunterricht erfolgreich vermittelt werden.” Das verblüfft Verfassungsrechtler wie Digitalisten.
Der Bielefelder Verfassungsrechtler Franz Mayer spricht von einer “Pflicht zum Distanzunterricht”, die das Verfassungsgericht den Ländern aufgetragen habe. Und Karlsruhe sei sogar einen Schritt weiter gegangen, es habe ein neues soziales Grundrecht entwickelt. “Das verdichtet sich dann auch noch zum Recht, also, wie die Juristen sagen, zum subjektiven Recht, zum Anspruch auf Distanzunterricht,” sagte Mayer im FAZ-Podcast Einspruch.
Peter Ganten vom Bundesverband digitale Souveränität zeigte sich erfreut. “Wirklich neu und wegweisend ist die daraus abgeleitete Feststellung”, sagte Ganten Bildung.Table, dass “dem gesamten Bildungssystem und vor allem Lehrern, Schulträgern und Ministerien nun verbindlich aufgelegt ist, sich auf die Möglichkeit zukünftiger Schulschließungen vorzubereiten. Sowohl in der Lehrerfortbildung als auch in Bezug auf technische Infrastruktur sind jetzt die Voraussetzungen für Distanzunterricht zu schaffen.”
In der Tat formuliert das BVerfG für den Fall, dass das neue Recht auf Schulbesuch in Präsenz ausfallen könne, weitgehende Forderungen vor allem an die zuständigen Bildungsminister:innen: “Sollten im weiteren Verlauf der Pandemie erneut Beschränkungen des Schulbetriebs in Betracht gezogen werden, wäre deren Zumutbarkeit jedenfalls auch daran zu messen, ob naheliegende Vorkehrungen wie insbesondere eine weitere Digitalisierung des Schulbetriebs ergriffen wurden, um künftige Beschränkungen des Präsenzunterrichts grundrechtsschonender ausgestalten zu können. Dies trifft Bund und Länder, soweit sie kompetenziell zuständig sind, gleichermaßen.” Diese Passage ließe sich auch so übersetzen: Wer digitales Lernen nicht vorbereitet, darf keine Schulen schließen.
Katja Hintze von der Stiftung Bildung leitet daraus einen verfassungsgerichtlich legitimierten Abschied vom Klassenzimmer ab. “Wir bereiten uns als Gesellschaft auch darauf vor, dass das wichtige Lernraum- und Lebensformat ‘in der Schule’ durch ein Recht auf digitalen Distanzunterricht standardmäßig ergänzbar ist. So können wir Bildung chancengerechter und für mögliche weitere unerwartete Veränderungen krisenfester machen”. Max Maendler von Eduki fragte beinahe ungläubig, ob Präsenz damit grundsätzlich infrage gestellt werde. “Könnte ich als Lehrerin oder Schulleiterin entscheiden, dass bei mir das Recht auf schulische Bildung zwei Wochen ohne Präsenz gewahrt wird?”
Lena Spak von der Lernplattform Scobees sagte Bildung.Table: “Mit der Entscheidung des BVerfG steht nun fest: Eltern haben ein einklagbares Recht auf einen brauchbaren Distanzunterricht. Brauchbar ist er nur dann, wenn er mit einem Unterricht in Präsenz vergleichbar ist. Sprich, nicht die Eltern sind dafür zuständig, Anleitungen, Erklärungen und Korrekturen an den schulischen Arbeiten ihrer Kinder vorzunehmen.”
Verfassungsrechtler mahnen allerdings zu Geduld. Karlsruhe habe einen neuen Rechtsgrundsatz aufgestellt. Was gerade die Kultusminister der Länder daraus konkret ableiten, bleibe abzuwarten. Wer Grundrechte säe, werde Verfassungsbeschwerden ernten. “Das ist schon sehr weitgehend“, sagte Franz Mayer zur Entscheidung. Das Gericht habe etwas formuliert, was der Bundesgesetzgeber wegen ihrer Kulturhoheit von den Ländern nicht einfordern konnte. “So etwas den Ländern vorzugeben, wäre wahrscheinlich zu weit in die Kompetenzhoheit im Bereich der Schule der Länder gegangen. Aber das Verfassungsgericht kann das.”
Auf gut siebzig Seiten begründete das Gericht in seiner einstimmig gefassten Entscheidung, warum die Schulschließungen rechtens waren. Im Kern geht es um die Abwägung zwischen zwei hohen Rechtsgütern. Auf der einen Seite stehen Leib und Leben, auf der anderen das Recht auf schulische Bildung, das die Karlsruher Richter aus den Artikeln 2 (Freie Entfaltung der Persönlichkeit) und 7 (Schulen) des Grundgesetzes herleiteten. Karlsruhe entschied, dass ein Teil des Rechts auf freie Persönlichkeitsentwicklung auch das Lernen in der Schule sei. Dieses Recht dürfe der Staat jungen Menschen nicht einfach verwehren. Er darf das selbst zum Schutz von Leib und Leben aller nicht – außer der Staat bietet eine Alternative an. Der Distanzunterricht ist in den Augen des Verfassungsgerichts also das Unterpfand, das Schulschließungen erst legal machte.
Das Urteil etabliert erstmals ein einklagbares, also subjektives Recht auf schulische Bildung. Das wirft auch Fragen hinsichtlich digitaler Bildung und der dafür nötigen Mittel auf. Der Staatsrechtler Michael Wrase aus Hildesheim widmet sich diesen im Verfassungsblog. Aus dem Recht auf schulische Bildung könnten keine einzelnen Ansprüche auf die konkrete Ausgestaltung der Schule hervorgehen. Der Schonraum, der den Kultusministern der Länder bleibe, sei dennoch klein. Denn das Gericht erkenne einen Anspruch auf Distanzunterricht genauso an, wie “deutlich stärkere Anstrengungen, vor allem bei der Digitalisierung.” Laut Wrase wird man zukünftig auch die Ausstattung der Schülerschaft mit “für den Fernunterricht notwendige[n] digitale[n] Mitteln” mindestens für bedürftige Schulpflichtige als “einklagbaren Anspruch ansehen müssen”.
Max Maendler, Gründer und Geschäftsführer von Eduki, sieht im Urteil eine Richtungsänderung: “Es dreht die Dinge in die richtige Reihenfolge. Am Anfang steht eben nicht die Präsenzpflicht, sondern das Recht auf schulische Bildung.” Präsenzunterricht sei nur ein Mittel zum Zweck. Es stehe Ländern oder einzelnen Schulen frei, mittels neuer Wege dem Recht auf Bildung Rechnung zu tragen – etwa durch Lernen außerhalb des Klassenraums. Bei Scobees sei das bereits Wirklichkeit, berichtete Lena Spak: “Sogar während des Lockdowns haben wir auch an sogenannten Brennpunktschulen keinen einzigen Schüler oder Schülerin verloren. Das gelingt vor allem unter Einsatz moderner Lernmethoden, die Kinder zu selbstständigem Lernen befähigen und Lehrkräfte als individuelle Lernbegleiter unterstützen.”
Auch Christian Büttner, Vorsitzender des Bündnis für Bildung, hob auf die Chancengleichheit ab, die das BVerfG in seiner Urteilsbegründung herausstellt. Erfolgreicher Distanzunterricht setze voraus, dass Lehrende und Lernende sich austauschen und gemeinsam lernen könnten. “Dazu ist die Verfügbarkeit einer bedarfsgerechten Ausstattung sowie Umsetzung didaktischer und pädagogischer Konzepte für ein digitales, oder hybrides Lernen notwendig, so dass alle Lernenden gleichermaßen im Präsenzunterricht und am Distanzunterricht teilnehmen können.”
Karlsruhe hat entschieden, dass digitales Lernen das Recht auf Bildung einlösen kann. Nun ist die Politik aufgefordert, Mittel, Fachwissen und Infrastruktur bereitzustellen – um möglichst jedem jungen Menschen digitale Schule zugänglich zu machen. Robert Saar mit Christian Füller

Herr Rummler, Sie haben gerade mit Kolleg:innen der Medienpädagogik ein Papier veröffentlicht, das sich kritisch mit digitaler Schule befasst. Wo wollen Sie die Digitalisierung stoppen? Wo geht sie in die falsche Richtung?
Stoppen wäre der falsche Ansatz. Was aber durchaus irritierend ist, dass sich auch die frühkindliche Bildung für digitale Vermessungs-Technologien öffnen soll. Die pauschalisierende Rede von den Potenzialen digitaler Medien beim Lernen bedarf der Demystifizierung. Die Kultusminister:innen müssen mögliche Risiken, die mit dem Einsatz digitaler Technologien in der Schule einhergehen, klarer in den Blick nehmen.
Was besorgt Sie?
Wir müssen neoliberale und ökonomisierende Tendenzen, welche die Digitalisierung mit sich bringt, viel ernster nehmen, gerade im Schulbereich. Die zunehmende Ökonomisierung der Bildung auch durch digitale Medien führt zu einer grundlegenden Veränderung des Schulsystems.
Aber Sie sind doch nicht grundsätzlich gegen Digitalisierung?
Nein, natürlich nicht. Ein Einbezug digitaler Medien in der Schule macht aus Sicht der Medienpädagogik Sinn. Digitale Medien gehören heute selbstverständlich zum Arbeitsalltag von Schüler:innen und Lehrpersonen – meist allerdings außerhalb der Schule. Das heißt, auch in die Schulen müssen endlich Arbeitsgeräte einziehen wie zum Beispiel Notebooks oder Convertibles – ich meine nicht Tablets…
… warum keine Tablets?
Tablets sind wie große Smartphones, aber keine ernstzunehmenden leistungsfähigen Arbeitsgeräte. Notebooks und Convertibles sind dagegen universell einsetzbar. Zur selbstverständlichen Ausstattung von Schulen zählen ferner, flächendeckendes WLAN an Schulen, Zugang zu online-Lernmitteln bis hin zu Hausaufgaben, die sich allein oder in Gruppen bearbeiten lassen.
Sie sind Medienpädagoge. Warum konzentrieren Sie sich so sehr auf die apparative Ausstattung der Schulen?
Ohne diese Ausstattung können Lehrer:innen die Bildung in der digitalen Welt nicht umsetzen. Im Digitalpakt geht es ja in der Praxis zunächst mal um die technische Infrastruktur der Schulen. Aber, Sie haben recht, das Hauptgeschäft der Medienpädagogik liegt im Entwickeln pädagogischer Konzepte zur Förderung der Medienkompetenz von Schüler:innen.
Man hat den Eindruck, Sie verlieren in Ihrer Kritik die Big Five, die Billionen-Dollar-Konzerne wie Google, Apple und Microsoft, aus dem Blick. Dafür fassen Sie die kleinen digitalen Bildungsanbieter umso härter an.
Nein, die Kritik an einer zunehmenden Ökonomisierung durch digitale Medien bezieht sich sowohl auf Hyperscaler als auch auf kleinere Bildungsanbietende. Zentral ist es für uns, die Entscheider für die Ambivalenzen von Digitalisierung zu sensibilisieren. Das betrifft alle Akteure von schulischer Bildung von den Schulträgern bis hin zu den Kultusminister:innen. Sie sind es, die die Weichen bei der Digitalisierung stellen – häufig, ohne die kritischen öffentlichen Reflexionen. Das kann ganz schnell gehen. Österreich und Schweiz etwa haben mit Microsoft Rahmenverträge für das gesamte Bildungssystem abgeschlossen.
Warum haben Sie gegen diese Rahmenverträge nicht interveniert?
Das haben wir, sind aber damit nicht durchgedrungen. Das Problem an diesen Prozessen ist auch die intransparente Vergabestruktur. Verschiedene Kolleg:innen der Medienpädagogik haben darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die öffentliche vergleichende Auswahl an Anbietern für digitale Schule ist. Wir müssen Lobbystrukturen aufdecken – so wie wir das zum Beispiel in Österreich getan haben. Es geht uns nicht darum, digitale Medien in der Schule zu verhindern. Aber wir brauchen endlich eine intensive öffentliche Diskussion: über deren Einsatz, die Folgen und mögliche Alternativen aus dem Open Source-Bereich. So wie es in Frankreich zum Beispiel im Fall der öffentlichen Verwaltung geschah.
Wäre es nicht ganz einfach? Schule soll Kinder durch Lernen zur Selbstbestimmung führen. Aber ohne informationelle Selbstbestimmung über ihre Daten geht das nun mal nicht.
So einfach ist es leider nicht. In der Schule haben die Kinder ohnehin nur eingeschränkte Selbstbestimmung über ihre Daten. Schulen haben schon immer Daten von Schüler:innen erzeugt, verwaltet und ausgewertet. Bei der Speicherung in digitalen Systemen wird es nun nochmal komplizierter – und weitreichender. Da darf man sich nicht so einfach den vertraglichen Beteuerungen der Anbieter hingeben. Wir müssen eine Datenanalyse etablieren, die wissenschaftlichen Kriterien standhält. Und wir müssen dies in breiter Öffentlichkeit publik machen.
Das Hauptproblem sind hier ja die Big Five, die unsere Daten grundsätzlich den US-Behörden verfügbar machen müssen. Warum aber führen dann bestimmte Teile der Medienpädagogik eine regelrechte Kampagne gegen digitale Mittelständler wie Bettermarks, Simpleclub oder Sofatutor?
Ich sehe diese Kampagne nicht. Besagte Unternehmen machen inhaltlich teilweise einen echt guten Job. Der Markt wird momentan genau durch diese neuen Player ziemlich durchgeschüttelt. Nun müssen wir erkennen, dass man auf dem Markt der Bildungsmedien gar nicht genau darauf geachtet hat, welche unternehmerischen und wirtschaftlichen Konzentrationen entstanden sind, Stichwort Schulbuchverlage. Diese Debatte müssen wir jetzt auf den gesamten Markt übertragen – gerade weil die mächtigen Big Five dort immer stärker eindringen.
Wo liegt das pädagogische Problem dieser Intervention von Technologie?
Hier geht es auch um Phänomene zunehmender Vermessung von Schüler:innen und Lehrpersonen. Und um Fragen nach Qualität – und die sind unabhängig von der Größe des jeweiligen Unternehmens. Wir sollten genau(er) hinschauen, was unter dem Deckmantel der Innovation nun die Schule betritt. Und welche Folgen das gerade für diesen sensiblen Bereich hat.
Selbst kleine Startups wie Scoolio, Learnu oder Study Smarter können sich zu Datenkraken entwickeln. Wieso erkennt die Medienpädagogik solche Fälle nicht früher?
Bei Scoolio und Learnu muss man – wie bei allen Anbietern – genau hinschauen. Einerseits gibt es – oft übertriebene – Befürchtungen aus dem Alltagsleben. Etwa die Angst, dass dunkle Mächte Daten-Abwanderungen oder gar den Verkauf persönlicher Daten inszenieren. Andererseits brauchen wir belastbare wissenschaftlich-empirische Analysen zu Datenverkehr und zum technischen Aufbau einer Bildungssoftware. Diese Anbieter bedienen übrigens den Bildungsmarkt außerhalb der Schule. Da können wir als Medienpädagogen zunächst nur an Eltern appellieren, auf den Datenschutz bei digitaler Bildung zu achten.
Nehmen wir das Beispiel GoStudent. Ein Startup, das den weltweiten Markt im Schnellverfahren erobert, ein Einhorn mit einem Wert von einer Milliarde Euro. Welche Position nimmt die Medienpädagogik da ein?
Auch GoStudent ist ein Anbieter außerhalb des Bildungssystems. Meist geraten sie erst in unseren Blick, wenn sie in das Bildungssystem integriert werden. Solche Unternehmen gewähren zudem praktisch nie Einblick in ihren Code und in die Software. So kann man beispielsweise nicht einschätzen, was eine KI dort genau macht. Daher fordern wir, dass die neuen Bildungsunternehmen sich und ihre Algorithmen für die Forschung öffnen – dann könnte man sie auch ernster nehmen.
Wie ist Ihre Haltung zu Learning Analytics? Sie ermöglichen es, die Lernbewegungen einzelner Schülerinnen und Schüler zu diagnostizieren.
Auch hier gilt es, die Ambivalenzen zwischen Förderung und Überwachung in den Blick zu nehmen. Die quantitative Vermessung von Bildungsprozessen ist nicht per se gut oder schlecht. Sie gehen mit Folgen und Nebenwirkungen einher, die Lern- und Bildungsprozessen auch schaden können. Wir warnen daher vor einem weiteren blinden Ausbau und vor allem einem blinden Vertrauen in derartige Technologien – insbesondere in der Schule.
Wie weit sind Learning Analytics (LA) verbreitet?
LA treten derzeit in sehr unterschiedlichen Formen und recht lückenhaft im Schulsystem auf. Es ist in meinen Augen derzeit noch kein durchgängiges und kein wirklich nutzbares Diagnosetool. Unser Ziel ist es, die pädagogische Diagnostik von Learning Analytics besser für Lehrpersonen verfügbar zu machen. Wichtig ist zu reflektieren: Wer hat denn am Ende eigentlich die Entscheidung über den Umgang mit den Lerndaten inne? Treffen Lehrpersonen die pädagogische Entscheidung? Oder ist es alleine das System, das über Noten, Leistungsniveau oder über den Schulübertritt entscheidet?
Wie kann denn der Umgang mit Learning Analytics durch Schulen so gestaltet werden, dass Kinder nicht zum gläsernen Schüler werden?
Da muss ich schmunzeln. Der viel beschworene gläserne Patient stellte sich nach Einführung der Krankenkassenkarte noch als das geringste Problem heraus.
Was ist beim digitalen Lernen das Problem?
Mit der Digitalisierung geraten wir derzeit in eine riesige gesellschaftliche Aushandlungsdebatte: Welche Daten von uns wollen wir sichtbar machen? Welche sollen wenigstens halbwegs unsichtbar, aber längerfristig übertragbar sein? Und gibt es Daten, die wir keinesfalls gespeichert wissen wollen?
Wieso kommt Ihr Papier eigentlich so spät?
Die Medienpädagogik hätte bereits im Frühjahr 2021 zur weiteren Entwicklung des Strategiepapiers “Bildung in der digitalen Welt” Stellung nehmen sollen. Die KMK hat das jedoch abgelehnt und stattdessen die eigene Ständige Wissenschaftskommission damit beauftragt. Dort sind aber keine Medienspezialisten vertreten, die den jetzigen Stand wirklich einordnen können. Daher wollten wir mit Blick auf die KMK-Sitzung am 9. Dezember dieses kritische Positionspapier bekannt machen.
Dr. Klaus Rummler ist Senior Researcher an der Pädagogischen Hochschule Zürich, Vorsitzender der Sektion Medienpädagogik (der Gesellschaft für Erziehungswissenschaften) und geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift MedienPädagogik.

Gastbeitrag von Sabine Bösl
Die zusätzlichen Aufgaben für uns Schulleiter und der immens gestiegene Organisationsaufwand in unseren Schulen nehmen kein Ende mehr. Wir müssen ständig in Rekordgeschwindigkeit neue Konzepte für das Lernen unter Pandemiebedingungen erstellen. Wir versuchen, alles möglich zu machen, damit der Unterricht läuft. Aber wir sind doch weit über unsere Belastungsgrenze hinausgegangen – seit über eineinhalb Jahren. Wir machen das für die Kinder, die uns am Herzen liegen, und für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen niemanden im Stich lassen. Aber trotzdem müssen viele Schulleiterinnen und Schulleiter erkennen, dass sie nicht mehr können und sich völlig überlastet fühlen. Ich arbeite in der Pandemie wegen der enormen Fülle an Aufgaben oft bis in die Nacht hinein – begleitet von immer neuen Schreiben aus dem Kultusministerium.
Wir kommen kaum mehr hinterher, um alles an unseren Schulen zu schaffen. Wir müssen nicht nur die Verwaltung und die ganze Organisation rund um Corona stemmen. Gerade an den Grundschulen müssen wir gleichzeitig sehr viele Unterrichtsstunden halten, weil wir aus meiner Sicht viel zu wenig Leitungszeit haben. Das ist ein enormes Pensum, und ich habe das Gefühl, ich kann den Kindern im Unterricht dann nicht mehr gerecht werden. Das ist schon in normalen Zeiten für einen Schulleiter kaum zu schaffen – in einer Pandemie wird es noch schwieriger. Aber trotzdem halten wir durch, halten wir noch durch. Obwohl viele von uns schon längst das Handtuch geschmissen hätten. Wie lange soll das noch gut gehen? Wie lange ignoriert die Politik noch unsere Sorgen?
Wir fordern eine bessere und schnellere Kommunikation durch das Kultusministerium an die Schulen. Es kann doch nicht sein, dass wir Schulleiterinnen und Schulleiter Informationen der Presse entnehmen müssen, weil das Schreiben aus dem Kultusministerium erst Tage später verschickt wird. Eltern können das nicht mehr nachvollziehen, warum ihre Schulleiter nicht kompetent Auskunft geben können – wenn bereits Tage zuvor die Pressekonferenz war und in der Zeitung längst alles stand. Ich informiere mich aus der Presse. Die kultusministeriellen Schreiben erreichen uns immer häufiger am Freitagnachmittag oder Abend. Umgesetzt werden müssen diese beschriebenen Maßnahmen natürlich umgehend. Dann arbeiten wir die Wochenenden durch. Diese Informationspolitik führt in den Schulen zu großem Unmut; bei den Schulleitungen und bei den Kolleginnen und Kollegen.
Wir Schulleiterinnen und Schulleiter müssen schauen, wie wir die Löcher stopfen. Ich muss gucken, wie ich vor Ort noch alles irgendwie aufrechterhalte: den normalen Unterricht trotz extremer Personalknappheit, die zusätzlichen Aufgaben der Pandemie mit Kontrollieren, Testen und Nachverfolgen des Infektionsgeschehens und und und. Ich fühle mich im Stich gelassen wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen.
Wir brauchen Rückendeckung und Beistand von unserem Dienstherrn, gerade jetzt, in dieser Situation. Ehrlichkeit ist gefragt. Und nicht ein Schönreden der Wirklichkeit. Wir brauchen eine Politik, die uns öffentlich den Rücken stärkt. Und die uns das Vertrauen ausspricht. Und die uns nicht unter Druck setzt mit völlig unrealistischen Zeitabläufen, die kein Mensch mehr schaffen kann.
Verbale Angriffe von Eltern nehmen nach meiner Erfahrung als Schulleiterin zu, das ist durchaus zu beobachten. Die Eltern stehen unter enormem Druck, und je länger die Pandemie geht, desto deutlicher wird das spürbar. Auch den Eltern geht die Luft aus. Die Erwartungen sind von Elternseite oftmals so hoch, dass wir das in unserer schulischen Realität nicht mehr erfüllen können. Wenn Kolleginnen erkranken und der Lehrermangel dermaßen durchschlägt, dass ich als Schulleiterin für Klassen keine Lehrerin mehr habe und Eltern das nicht verstehen können, dann kommt es manchmal auch zu verbalen Entgleisungen.
Die unterschiedlichen Meinungen in der Gesellschaft spiegeln sich in unserer Elternschaft wider. Es gibt Eltern, die meinen, unsere Regeln an der Schule seien viel zu streng. Es könne doch nicht sein, dass Kinder z. B. derzeit die Maske tragen müssen im Sportunterricht. Und es gibt Eltern, die fordern von mir als Schulleiterin ein, ich müsste doch viel strenger alle Maßnahmen umsetzen. Wir sind da hin- und hergerissen – wie es auch unsere gesamte Gesellschaft ist. Da erkennen manche Eltern die Grenze nicht mehr und greifen uns Schulleiter:innen oder die Klassenlehrkräfte an.
Viele von uns Schulleiterinnen und Schulleitern können nicht mehr. Ich höre das täglich im Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Meiner Meinung nach darf die Politik nicht mehr länger zuschauen, sonst laufen wir sehenden Auges in die Katastrophe. Nun ist unser Dienstherr gefragt, seine Fürsorge für uns unter Beweis zu stellen. Hinter uns zu stehen, Vertrauen zu zeigen und uns zu schützen.
Sabine Bösl ist Leiterin einer Grundschule und stellvertretende Leiterin der Abteilung Schul- und Bildungspolitik im BLLV. Der Lehrerverband ließ fünf Schuleiter:innen ihre Situation schildern.
Soziale Innovationen sind in Deutschland zu dürftig finanziert. Zu diesem Schluss kommt die Vodafone Stiftung in einem neuen Policy Paper. Die Studie hat sich die beiden Bildungs-Hackathons der Coronazeit vorgenommen, #WirVsVirus und #wirfürschule. Beide Projekte erfuhren anfangs einen Hype, verschwanden aber bald vom Radar. Der Grund ist laut der Forscher einfach: “Die Förderungs- und Finanzierungslandschaft für soziale Innovationsprojekte ist in Deutschland lückenhaft.” Es fehle an langfristiger finanzieller Absicherung.
Das Paper macht entsprechend seinem Titel Vorschläge, wie sich “die Wirkung sozialer Innovationen im Bildungsbereich stärken” lässt. Da könne die Bildungspolitik im Falle der beiden Hackathons einiges besser machen. Die starteten als Formate, um ein weites Feld gesellschaftlicher Akteure zur Ideenfindung zusammenzubringen. Es ging darum, die pandemiebedingten Schulschließungen zu nutzen, um Bildung als Ganzes soweit nach vorn zu bringen, wie es im laufenden Betrieb schwer möglich ist. Aus diesem Anfangsschwung sind einige Ideen und Projekte für die Verbesserung von Bildungschancen entstanden. “Es konnten nur wenige dieser Projekte bislang eine größere Wirkung entfalten”, schreiben die Macher der Studie. Es fehlte der lange Atem. Nur wenige der Projekte blieben lange genug bestehen. “Neues zu etablieren, gerade in einem strukturkonservativen Bildungssystem, ist jedoch eine Mammutaufgabe.”
Die Hackathons als Methode der offenen sozialen Innovation scheiterten laut Studie an den Strukturen im Bildungssystem mit seinen ungünstigen Rahmenbedingungen für Bottom-up-Initiativen von außen. So blieben etwa die 15 ausgewählten Projekte, die das Rennen bei #wirfürschule machten, weitgehend auf der Strecke. Man begleitete sie im Anschluss zwar, aber offenbar nicht lange genug. Den Projekten ging nicht nur das Geld aus, sondern auch die öffentliche Aufmerksamkeit. Kleine ehrenamtliche Teams verfügen weder über die Mittel noch über das Marketing, um mit ihren Ideen an den entscheidenden Stellen anzukommen.
Wird dagegen ein Projekt von einem Kultusministerium unterstützt oder auch offiziell als Lernmittel anerkannt, gehe das oft mit finanziellen Ressourcen und einer größeren Sichtbarkeit einher. In der Pflicht sieht die Vodafone Stiftung indes den Bund. Dem Bundesbildungsministerium legt das 16 Seiten lange Paper nahe, mit einem über mehrere Jahre geförderten Programm den Erfolg künftiger Hackathons zu unterstützen – und gleichzeitig für eine Evaluation und bundesweite Vernetzung zu sorgen. Christine Keilholz
Das Verwaltungsgericht Wiesbaden geht gegen die Hochschule RheinMain vor, weil sie die Cookie-Software “Cookiebot” einsetzt. Die Hochschule darf den Dienst Cookiebot per einstweiliger Anordnung auf ihrer Website nicht mehr nutzen. Dies entschied das VG Wiesbaden vergangene Woche (Az.: 6 L 738/21.WI). Grund für die Anordnung ist Cookiebots Datenverarbeitung in den USA. Die Software wird von vielen Websites dafür eingesetzt, um Zustimmungen für eingesetzte Cookies zu erlangen.
Das VG Wiesbaden kritisierte, dass die vollständige IP-Adresse der Benutzer auf Servern in den USA verarbeitet wird, was laut “Schrems II-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs so unzulässig sei.” Das schreibt die Verwaltungsgerichtsbarkeit Hessen in einer Pressemitteilung. Die Nutzer der Seite werden zudem weder über mögliche Risiken dieser Übermittlung informiert, noch sei die Datenverarbeitung in den USA für das Betreiben der Hochschul-Website relevant.
Cookies sind sehr kleine Datenpakete, die Nutzerdaten von Websites lokal und auf dem Website-Server speichern. Die Website kann den Nutzer so wiedererkennen und dadurch viele relevante Funktionen anwenderfreundlicher gestalten. Das geht allerdings auch ohne Datenübertragung in die USA. Website-Betreiber nutzen Dienste wie Cookiebot, um die gesetzlich vorgeschriebene Zustimmungspflicht bei Cookies einzuhalten. Die sogenannte EU-Cookie-Richtlinie und ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union im Oktober 2019 haben dazu geführt, dass Nutzer allen Cookies im Vorfeld zustimmen müssen. Cookiebot übernimmt diese Abfrage. Es gibt allerdings viele datenschutzkonforme Systeme, die das ebenfalls können. Die Hochschule RheinMain kann nun binnen zwei Wochen Beschwerde gegen die Anordnung einlegen.
Usercentrics, die Vertreiber von Cookiebot, das die Hochschule einsetzte, äußerten sich gegenüber Bildung.Table abwartend zu der Entscheidung des VG Wiesbaden. Die Dänen haben auch erst am Montag von der Anordnung erfahren und wollen sich zuerst inhaltlich in den Fall einarbeiten, um angemessen auf die aufgebrachten Kritikpunkte reagieren zu können. Enno Eidens

Das Sicherheitskollektiv Zerforschung hat zum dritten Mal eine schwere Sicherheitslücke in einer Lernsoftware veröffentlicht, diesmal bei Study Smarter. Study Smarter ist nach eigenen Angaben eine Lernapp. Sie soll Schüler:innen und Studierende strukturiert auf Prüfungen vorbereiten. Das geschieht im Wesentlichen mit klassischen Lernkarten, aber auch mit Zusammenfassungen, Übungsaufgaben oder Mindmaps. Die Inhalte können auf der Plattform selbst erstellt und dann mit der Community geteilt werden. So hat man Zugriff auf die Lerninhalte anderer Nutzer:innen. Auch Inhalte professioneller Verlage wie zum Beispiel die Hemmer-Repetitorien für Jura-Studierende stehen als Inhalte auf der Plattform bereit.
Diesmal musste Zerforschungs-Mitglied Karl (Nachname unbekannt) vom Sicherheitskollektiv nicht lange suchen: Die App fragte die Daten des jeweiligen Nutzer:innen-Profils ohne Sicherung vom Server ab. Wenn man diese Profilnummer eins nach unten zählte, bekam man die Profildaten der Person zu sehen, die sich kurz zuvor registriert hatte. Insgesamt rund drei Millionen Stammdaten von registrierten Nutzer:innen standen so ungeschützt im Netz. Sie enthielten Name, E-Mail-Adresse, Schule/Universität, Profilbild, Geburtsdatum und Wohnort.
Mittlerweile ist die Sicherheitslücke bei Study Smarter geschlossen. Das Startup hatte erst im Mai 15 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt. Es habe auch ein Sicherheitsaudit gegeben, das mögliche Sicherheitslücken finden sollte. Der problematische Code entstand wohl erst danach. So ließ Study Smarter eine Sicherheitslücke für teilweise minderjährige Personen zu. “Es müsste eigentlich eine Liste geben, mit Software, die bedenkenlos an Schulen eingesetzt werden kann.” Das sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz in Bayern, Thomas Petri, bereits im Frühjahr. Davon ist noch nichts zu sehen.
Der Autor hat die App Study Smarter für Bildung.Table untersucht. App und Website enthalten auch jetzt noch zahllose Werbetracker, die ohne Einwilligung unzulässig sind. Dazu zählen auch die Facebook Business Tools. Studierende und Schüler:innen ahnen es wahrscheinlich nicht: Ihre Verhaltensdaten in der App gehen direkt an ihr – falls vorhanden – Facebook-Profil. Auch um das herauszufinden, braucht man keine zehn Minuten. Matthias Eberl

Der Abgeordnete und ehemalige Telekom-Personal-Vorstand Thomas Sattelberger wird Staatssekretär im Bundesbildungsministerium (BMBF). Der Werdegang des 72-Jährigen ist alles andere als gewöhnlich. Sattelberger entwickelte sich vom linksradikalen Revoluzzer, der Joschka Fischer zu kleinbürgerlich fand, zum Liberalen und Macher bei Daimler und Telekom. Dort setzte er Diversity-Themen entschieden um. 2017 zog er für die FDP in den Bundestag ein. Nach seiner Wiederwahl nun der Aufstieg auf den Staatssekretärsposten im BMBF. Seine Themen: Diversität und MINT, also Mathematische, Informatische, Naturwissenschaftliche und Technische Bildung.
Am bekanntesten machte Sattelberger die Durchsetzung der Frauenquote bei der Telekom, lange bevor die Politik auf die Idee kam. Sattelberger war von 2007 bis 2012 bei der Telekom als Personalchef tätig. Seine Frauenquote von dreißig Prozent in mittleren und oberen Führungspositionen brachte ihm den Beinamen “Quotenmann der Republik”. Bereits 2010 setzte sich Sattelberger für mehr Gleichstellung ein – auch gegen Widerstände. Als man ihm zehn Monate lang nur Männer als Besetzungsentscheidung für wichtigen Telekompositionen vorschlug, lehnte er ab. Und gab erst nach, als auch Frauen auf den Vorschlagslisten zu finden waren. In einem Interview fragte ihn die taz, was neben der Gerechtigkeit für Diversität spräche. Seine Antwort: “Menschenrechtsfragen mit Demografie oder Erfolgsträchtigkeit zu beantworten, finde ich immer ein bisschen schäbig”.
Kurz zuvor hatte der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, welches von Unternehmen die Selbstverpflichtung einforderte, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Unternehmen wie Eon oder die Commerzbank nahmen sich daraufhin vor, in den Vorständen null Prozent Frauen zu haben. Laut Sattelberger sind flexible Quoten, wie in diesem Gesetz angewandt, schwerer umzusetzen. “Dazu müssen die maskulin definierten Gepflogenheiten auf Chefetagen aufhören. Wenn wir da nicht knallharte Kulturarbeit zum Thema Vielfalt machen, können wir uns das Gesetzesgedudel sparen.”
Wenn Sattelberger Vielfalt sagt, dann meint er nicht nur Frauen. Bei der Telekom setzte er sich auch dafür ein, dass alte Arbeitnehmende, Jugendarbeitslose und Menschen mit Handikaps ins Unternehmen kommen. Er mache das Ganze, sagte er in einem Interview, “weil ich überzeugt bin, dass ein Unternehmen die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln muss. Und weil wir uns der sozialen gesellschaftlichen Verantwortung nicht entledigen können.”
Trotz gesamtgesellschaftlicher Verantwortung setzte Sattelberger 2007 durch, dass die Telekom 50.000 Mitarbeitende in konzerneigene Servicegesellschaften auslagern konnte. Nach einem fünfwöchigen Streik, dem ersten in der Geschichte der Telekom, erzielte der knallharte Macher schließlich einen Kompromiss mit Verdi. Und sicherte somit deren Zustimmung zur Auslagerung.
Neben Vielfalt schreibt sich Sattelberger vor allem die MINT-Bildung auf die Fahnen. Aus seiner Sicht ein entscheidender Baustein zum Umbau der Wirtschaft im Zeitalter der Digitalisierung. Auf seinem Blog beschreibt er sich als aktiver Förderer mit voller Leidenschaft des “Nationalen MINT Forums”. Er ist auch Vorstandsvorsitzender des Vereins “MINT Zukunft schaffen”. Dieser sieht den Wirtschaftsstandort Deutschland durch den Engpass an naturwissenschaftlich-technisch qualifizierten Fachkräften gefährdet. Explizit fordert der Verein einen Abbau von Bildungsbarrieren, die insbesondere Menschen mit Berufsausbildung von weiterer Qualifikation abhalten würden.
Die Kritik am Bildungswesen ist keine neue. Bereits 2011 monierte Sattelberger, wie schwer es sei, als beruflich Qualifizierter Zugang zu Hochschulen zu erhalten. “In diesem Talentsegment steckt so viel Wissen und Aufstiegswille, dass es eine Sünde ist, dies von den Unis fernzuhalten”. Die Schuld dafür sah er vor allem in den zersplitterten Regeln 16 verschiedener Länder. Sattelberger kommentierte: “Die Länder in der deutschen Bildungspolitik, das kommt mir manchmal vor, als wollte man streunende Katzen zähmen.”
Einen gutes Gespür für Politik dürfte Sattelberger dank seines Jugendfreundes Joschka Fischer schon lange haben. Die beiden lernten sich in der Unabhängigen Schülerschaft kennen. Um diese Zeit herum politisierte sich der damals 16-jährige Schwabe bei einem Auslandsjahr in den USA. Er opponierte gegen Vietnamkrieg und Diskriminierung. Im Kommunistischen Arbeiterbund, dem Sattelberger angehörte, wurde ihm die Freundschaft zu Fischer allerdings zum Verhängnis. Da der als Kleinbürger und als nicht links genug galt, waren den Genossen die Freunde nicht geheuer: Sattelberger flog raus. Robert Saar

Die neue Regierung nimmt Gestalt an. Für die Bildung im Land wird eine liberale Ministerin die Verantwortung übernehmen, Bettina Stark-Watzinger. Seit wenigen Tagen stehen nun auch die beiden Staatssekretäre fest, zu denen Jens Brandenburg gehört, Bundestagsabgeordneter für Rhein-Neckar, geboren 1986. Brandenburg wird sich um das Thema kümmern, auf das die FDP schon beim Wahlkampf gesetzt hat: Digitalisierung.
Seit dem Abitur ist Brandenburg bei den Jungen Liberalen. 2017 zog er für die FDP auf einem der hinteren Plätze der Baden-Württembergischen Landesliste in den Bundestag ein. Vom einfachen Parlamentarier zum Staatssekretär im Bundesbildungsministerium (BMBF) – seine steile Karriere hat sich Brandenburg als bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion erarbeitet. Er war eine der lautesten Stimmen im Parlament, die die Corona-Politik der bald ehemaligen Bildungsministerin Anja Karliczek kritisierte.
Die FDP hat sich seit Beginn der Coronavirus-Pandemie als kritische Opposition im Bundestag hervorgetan. Immer wieder haben Junge Liberale, aber auch die Mutterpartei, auf die schwierige Situation der Schüler:innen, Auszubildenden und Studierenden aufmerksam gemacht. Brandenburg plädierte acht Wochen nach dem ersten Lockdown dafür, so schnell wie möglich in die Infrastruktur der Schulen zu investieren. Und nicht nur durch die Verteilung von ein paar hundert Tablets, sondern vor allem mit Geld für gutes IT-Personal. Brandenburg hat das Bildungssystem immer wieder weitergedacht. Zum Beispiel, in dem er neue Formate für die berufliche Aus- und Weiterbildung vorschlug. Oder den Aufbau digitaler Berufsschulen, vergleichbar vielleicht mit der Fernuni Hagen. Im Podcast der Online-Universität forderte er im August, die digitale Bildung müsse so einfach wie das Einkaufen in einem Online-Shop werden.
Das lässt auf ein BMBF hoffen, das gestaltet und nicht nur verwaltet. “Wir werden wichtige Vorhaben in der digitalen Bildung nicht länger liegen lassen oder gar verschleppen”, sagte Brandenburg im Gespräch mit Bildung.Table. Er will die “ambitionierte Agenda” im von der Koalition geplanten Digitalpakt 2.0 zügig vorantreiben. “Die Verlängerung des Digitalpakts bis 2030 ist ein wichtiger Punkt und ein starkes Signal”, sagt Jens Brandenburg. Sie bringe Planungssicherheit für die Schulen. “So können Schulen und Länder auch längerfristige Verträge zum Beispiel für die IT-Wartung schließen.” Eine Frage, die er nicht beantworten mochte, ist die nach der Höhe der zusätzlichen Mittel. So bleibt offen, wie hoch der Digitalpakt 2.0 dotiert sein soll.
Ein anderer Schwerpunkt wird Jens Brandenburg auf das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik setzen. Die FDP fordert schon lange, dieses abzuschaffen. So trägt sogar sein Twitter-Banner die Message “Kooperationsgebot statt Kooperationsverbot”. Er wolle dicke Bretter bohren, sagt Jens Brandenburg. “Das wird nur möglich sein, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen.” Das kann eine Änderung im Grundgesetz nötig machen. “Ich gehe davon aus, dass das ein Thema werden wird”, so der neue Staatssekretär.
Spannend wird es auf jeden Fall, wie sich das neue Dreiergespann – Bettina Stark-Watzinger, Thomas Sattelberger und Jens Brandenburg – mit der Schul-Bubble verstehen wird. Alle drei bringen ein Mindset mit, mit dem man Teams leiten, Unternehmen beraten oder Arbeitsprozesse optimieren kann. Ob das mit einem Berufsstand aus Pädagog:innen und Didaktiker:innen reibungslos zusammengeht? Wirkliche Bildungspolitik haben alle drei noch nicht gemacht und Regieren ist etwas anderes als Opponieren. Immerhin ist Jens Brandenburg ein bisschen näher dran an den Schüler:innen, Auszubildenden und Studierenden, als die Regierungsvertreter. Sein Abitur in Monschau und sein Studium in Mannheim sind noch nicht so lange her wie das seiner Kollegen.
Heute ist Tag der Bildung, eine Initiative vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Viele kleine und großen Angebote finden digital und vor Ort statt. Dazu gibt es die zentrale Bildungskonferenz. Das Bildung.Table-Team hat aus der großen Auswahl ein paar spannende Termine für sie zusammengestellt. Alle Events finden heute über den Tag verteilt statt. Infos & Registrierung
10:00 bis 11:30 Uhr, online
Präsentation/Vortrag: Online-Vortrag “Mit Kindern über Geld reden”
Heike Höhfeld gibt Eltern und Interessierten Tipps zu Taschengeld und Geldgesprächen mit Kindern. Organisiert wird der Vortrag von der Finanzgruppe Beratungsdienst Geld und Haushalt der Sparkassen. Infos & Anmeldung
14:00 bis 15:00 Uhr, online
Workshop/Seminar: “Wir können Politik!” Wie Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene gelingt
Tobias Scherf, Bürgermeister in Warburg und Monika Dehmel, Gründerin von “Politik zum Anfassen” wollen mit Vortrag und Debatte über die Inklusion von Jugendlichen in politische Prozesse sprechen. Infos & Mitmachen
14:00 bis 16:00 Uhr, online
Workshop/Seminar: Gesellschaftlich relevante Themen in Schule bringen: KI und Diskriminierung
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und interessiertes schulisches Personal kann von Ruhr Futur lernen, wie Lernvideos für den Unterricht, präsent oder distanziert, hergestellt und eingesetzt werden können. Infos & Mitmachen
15:00 bis 17:00 Uhr, online
Workshop/Seminar: Lernvideos einfach selber machen
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und interessiertes schulisches Personal kann von Ruhr Futur lernen, wie Lernvideos für den Unterricht erstellt und eingesetzt werden können. Infos & Mitmachen
15:30 bis 18:30 Uhr, im Bildungsforum Potsdam (Am Kanal 47, Potsdam)
Workshop/Seminar: Pixelgames – Baue dein eigenes Videogame
Zum Abschluss ein Termin, der vor Ort stattfindet. Die Stadt- u. Landesbibliothek Potsdam und die Initiative Creative Gaming laden Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zum Programmieren ein. Um Anmeldung wird gebeten. Infos & Mitmachen