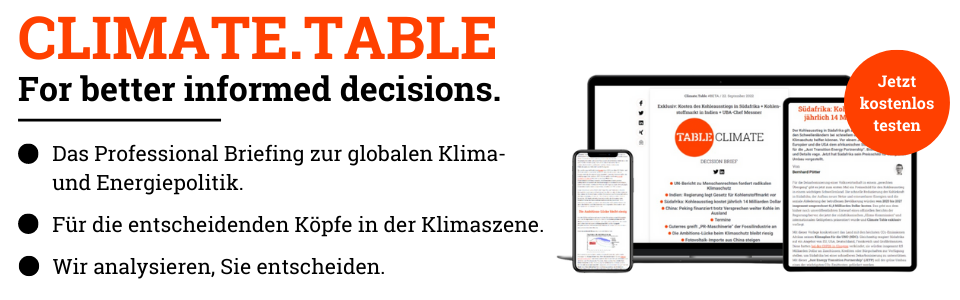immer mehr Azubis bräuchten, wenn sie an den Berufsschulen ankommen, erstmal einen intensiven Sprachkurs. Deutschkenntnisse sind der Schlüssel – ob im Handwerk, in der Industrie oder in der Pflege. Doch ausgerechnet auf die vielen jungen Menschen, deren Eltern keine Muttersprachler sind, ist das duale Berufsbildungsystem schlecht vorbereitet, wie Recherchen meiner Kollegin Janna Degener-Storr zeigen.
In der Ausbildung von Berufsschullehrern, so berichten es Experten und Praktiker, spiele ‘Deutsch als Zweitsprache’ (DaZ) wenn überhaupt eine untergeordnete Rolle. Da können Studierende froh sein, wenn sie wenigstens ein DaZ-Modul an der Uni belegen können. Dabei macht Bayern vor, wie es besser geht.
Außerdem schauen wir in dieser Ausgabe nach Bielefeld, wo am Montag der EdTech Next Summit gestartet ist. Vor drei Wochen versprach Eduvation-Geschäftsführer Tobias Himmerich hier im Briefing, die Konferenz solle “keine zweite Didacta” werden. Und tatsächlich: Unser Reporter Christian Füller traf in Bielefeld auf viele motivierte Gründer, die grenzenlose Euphorie versprühen. Und das obwohl die blanken Zahlen ernüchternd sind: Denn aktuell kann Deutschland gerade einmal 74 EdTech-Start-ups vorweisen.
Apropos ernüchternd: In seinem Standpunkt hält der Ökonom Ingo Isphording den Bildungsministern einen Spiegel vor. Er kritisiert, dass wertvolle Bildungsdaten weiter einer “politischen Bevormundung seitens der KMK” unterliegen. Ein Zustand, der auch Dirk Zorn ärgert. Seit September ist der Princeton- und Harvard-Forscher wieder bei der Bertelsmann-Stiftung in Berlin, wo er sich mit Niklas Prenzel zum Gespräch getroffen hat.
Und nun, viel Vergnügen bei der Lektüre!


Wer in Deutschland eine Ausbildung beginnt, hat laut dem Institut der deutschen Wirtschaft immer häufiger keine deutsche Staatsbürgerschaft. Neben fachlichen Inhalten müssen viele Deutsch lernen, teilweise ein neues Schriftsystem. Manche haben in ihrem Herkunftsland noch gar nicht schreiben und lesen gelernt. Als Pfleger müssen die Azubis später mit Patienten kommunizieren können, als Bürokauffrau Geschäftsbriefe schreiben, als Gärtner bestimmte Fachwörter verstehen. Längst müssen Berufsschulen daher viele Schüler sprachlich vorbereiten – und auch bei Muttersprachlern fehlen oft die geforderten sprachlichen Kompetenzen.
Raphael Dick, selbst Berufsschullehrer für Deutsch, ist in der Berufsvorbereitung tätig und bildet Referendare für den Deutschunterricht aus. Er weiß, dass die Sprachförderung in vielen Berufsschulklassen heute eine große Herausforderung darstellt. “Im Idealfall müsste jede Lehrkraft in jedem Fall einzeln entscheiden, welcher Schüler mit dem normalen Fachbuch arbeiten kann, wer ein vereinfachtes Arbeitsblatt erhält und wer zusätzlich noch eine mündliche Erklärung braucht”, sagt er. Nach seiner Erfahrung sitzen heute in vielen Berufsschulklassen Abiturienten neben Schülern, die gerade so den Mittelschulabschluss geschafft haben, und Jugendlichne, die erst seit wenigen Wochen in Deutschland sind und zuvor vielleicht gar keine Schule besucht haben.
Doch Berufsschullehrer werden im Studium meist nicht darauf vorbereitet, sprachliche Kompetenzen zu vermitteln. “Wir bräuchten viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die darin fachlich fit sind und sich ansatzweise in die Lebenswelt von geflüchteten Schülerinnen und Schülern hineinversetzen können”, sagt Cosima Lemke-Ghafir. Als Expertin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) war sie an verschiedenen beruflichen Schulen in Berlin tätig. Jetzt leitet sie eine Alphabetisierungsklasse an einem Oberstufenzentrum. Christoph Schroeder ist Professor am Institut für Germanistik der Universität Potsdam. Er stellt fest: “Deutsch als Zweitsprache ist zu wenig systematischer Teil der Ausbildung der Lehrkräfte.“
Zwar machen berufliche Schulen, Betriebe und andere Kooperationspartner vereinzelt attraktive Angebote, um neu zugewanderte Jugendliche sprachlich zu unterstützen. In Schleswig-Holstein starten nach den Herbstferien beispielsweise Sprachkurse für Auszubildende nicht-deutscher Herkunft an Berufsschulen. In die Lehrerfortbildung und die Referendarausbildung hat das Thema teilweise Eingang gefunden. Und an Berufsschulen sind unzählige Quereinsteiger tätig, die Germanistik studiert haben oder Berufserfahrungen im Unterrichten von Nicht-Muttersprachlern mitbringen.
Die Hochschulen bereiten angehende Lehrkräfte dahingegen kaum darauf vor, dass einige ihrer Schüler besonderen sprachlichen Förderbedarf haben werden. Dabei hat die Kultusministerkonferenz bereits 1981 “Empfehlungen zur Verbesserung der Lehrerbildung auf dem Gebiet des Ausländerunterrichts” ausgesprochen. 2019 hat sie empfohlen, eine durchgängige und kompetenzorientierte Sprachbildung in die Lehrpläne der Berufsschulen aufzunehmen. Diese sei für Deutschlehrkräfte relevant, die Zugewanderte gezielt fördern, etwa in Willkommens- oder Berufsintegrationsklassen. Aber auch alle anderen Lehrkräfte sollen unabhängig von ihrem Fach “sprachsensiblen Unterricht” anbieten.
In Berlin durchlaufen Studierende für das Berufsschullehramt jedoch lediglich ein Standardmodul in Sprachbildung/DaZ mit fünf Leistungspunkten – alle Lehramtsanwärter müssen es belegen. Auch in NRW gibt es ein solches DaZ-Modul für alle Lehramtsstudierenden. In Schleswig-Holstein gibt es für Lehramtanwärter im Master ein verpflichtendes Modul namens “Inklusion in der Schule: Heterogenität und Sprache”.
Als vorbildlich gilt Bayern, wenn es darum geht, Berufsschullehrkräfte für die Arbeit mit Zuwanderern fit zu machen. Schon 2010 hat das dortige Staatsministerium das Projekt “Berufssprache Deutsch” ins Leben gerufen. Seit 2016 ist es – auch in Folge der hohen Flüchtlingszahlen – ein durchgängiges Unterrichtsprinzip für alle Bereiche der beruflichen Bildung. Heißt: Künftige Deutschlehrer werden auf den Unterricht für Schüler mit einem anderen Sprachhintergrund vorbereitet, aber auch Lehrer anderer Fächer.
An der Technischen Universität München können angehende Lehrkräfte für berufliche Bildung das Fach “Berufssprache Deutsch” studieren. Für alle verpflichtend sind außerdem die Seminare “Sprachliche und kulturelle Vielfalt”. Hier lernen die angehenden Lehrkräfte beispielsweise, aus der Sicht zugewanderter Schüler auf ihr Unterrichtsmaterial zu blicken: Wie anspruchsvoll sind die Aufgaben sprachlich? Beherrschen meine Schüler die grammatischen Strukturen im Text? Wo brauchen sie noch Unterstützung?
Verena Rasp, die in den Seminaren unterrichtet, sagt: “In einer Sitzung zum Thema ‘diskontinuierliche Texte’ sehen wir uns beispielsweise Grafiken, Diagramme und Karten an, die in jeder Fachrichtung der beruflichen Bildung viel verwendet werden, die viele Schülerinnen und Schülern aber nicht verstehen und nicht versprachlichen können.” Dies könne zum Beispiel der Fall sein, wenn die Schüler von ihrer Muttersprache eine andere Leserichtung gewöhnt sind.
Bei der Entwicklung des Curriculums für die Studierenden hat die bayrische Hochschule Anregungen aus verschiedenen Fachbereichen einbezogen: von Deutsch als Zweitsprache über die Erziehungswissenschaften und die Didaktik der beruflichen Bildung bis hin zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Außerdem hat sie sich an Curricula orientiert, die die Leuphana-Universität Lüneburg und die Universität Bielefeld für angehende Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache im Auftrag des BMBF entwickelt haben. Letztlich müsste es ein Ziel der Lehramtsstudierenden werden, dass die Schülerinnen und Schüler ihr sprachliches Handeln reflektieren und so kommunizieren, wie es zur jeweiligen Situation passt. Eine besondere Herausforderung sieht Eveline Wittmann dabei in der Vielzahl an Berufen, in denen die Studierenden später Azubis ausbilden. Sie ist Academic Program Director der TU für die strategische Ausrichtung der beruflichen Bildung zuständig. Bei der Entwicklung von Curricula für einzelne Berufe könnten sie daher nicht sehr in die Tiefe gehen, sagt Wittmann. “Dafür fehlt die wissenschaftliche Evidenz.”

In der großen Halle des Bielefelder Lokschuppens steht eine Rodeo-Maschine. Man kann versuchen, sich auf dem Rücken eines elektrischen Bullen zu halten. Nur dass bei dem EdTech Next Summit der Stier ein Einhorn ist, jenes Maskottchen also, das für den Wert von einer Milliarde Euro steht. Auf der Bühne der Haupthalle allerdings machen die Veranstalter den versammelten Start-ups und Gerne-Gründern wenig Hoffnung: “Es ist unglaublich schwer, in die Schulen hinein zu kommen“, sagt Nik Riesmeier von der Founders Foundation, die das EdTech-Next-Förderprogramm betreut.
1000 Besucher haben sich angemeldet, um beim ersten Gipfel-Treffen dabei zu sein, das sich exklusiv an EdTechs wendet. Drei Jahre lang wird es den Summit geben. Die Bielefelder Founders-Foundation begleitet Gründer und schärft ihre Ideen, Geschäftsmodelle und Pitch-Fähigkeiten. Alle sind einerseits wahnsinnig nett zueinander, andererseits wird der “schwierige Bildungsmarkt” mit so harten Strichen gezeichnet, dass sich keiner überschießende Hoffnungen macht.
Gründerin Nele Mletschkowsky von Europas – angeblich – am schnellsten wachsenden Start-up “Quofox” erzählt, dass sie hier in NRW “kein Ökosystem gefunden hat”. Das war damals, als sie zu gründen begann. Das Problem sei, “genug Geld für deine Idee zu bekommen”. Der Beamte aus dem NRW-Wirtschaftsministerium, Johannes Velling, sagt mit Blick auf die kümmerliche Zahl von 74 EdTech-Start-ups in Deutschland: “Wir sind weit hinten dran, wir müssen aufholen.” Seine grüne Super-Ministerin, Mona Neubaur, ist erst gar nicht nach Bielefeld gekommen – obwohl sie das ganze Unterfangen mit drei Millionen Euro finanziert. Hatte sie vielleicht Angst, ein Bad in schlechter Laune zu nehmen?
Dabei stimmt das gar nicht. Im Lokschuppen in Bielefeld springen eine Reihe von jungen Leuten umher, die unglaublich ansteckend sind, provozierend gute Laune und Ideen haben – und jeden anquatschen, den sie kennen lernen können.
***
Ahmad El-Ali gibt Studierenden die Möglichkeit, auf seiner Plattform Studeez eine leicht zu erarbeitende Musterlösung für Klausuren zu verkaufen. Die Käufer sind andere Studierende. Aber ganz so simpel, wie es sich anhört, ist es nicht. Denn die Studierenden, die ihre Klausur oder ihr Examen geschafft haben, müssen die Musterlösungen aus verschiedenen Tools zusammenbauen – ehe sie die verkaufen können.
Ena Teskeredzić ist Sprachbegleiterin aus Berlin und entwickelt nun eine Gründer-Idee. Viele Fachkräfte aus dem Ausland kommen nach Deutschland – und scheitern an kulturellen Hürden, obwohl sie dringend benötigt werden. Anna, die aus Bosnien-Herzegowina kommt, will den Menschen und den Unternehmen helfen, sich besser zu verstehen.
***
Plötzlich meldet sich im Publikum ein Herr mittleren Alters und fragt, wie man eigentlich den Erfolg eines solchen Start-up-Förderprogramms messen könne. Daraufhin ergeht sich das Podium in sehr komplexen Methoden. Die Zahl der Teilnehmer bei diesem Summit sei ein Kriterium. Die Evaluierung der Anträge, Zwischen- und Abschlussberichte. Und je länger das Podium mit Hilfe immer neuer KPIs (Key Performance Indicators) die Frage beantwortet, desto stärker drängt sich einem auf: die einfachste Methode, die Risiken und Nebenwirkungen von Start-ups in der Bildung zu messen, wäre der Lernstand der Schüler. Können die Grundschüler von Nordrhein-Westfalen mit digitalen Lerntools besser lesen, schreiben und rechnen lernen? Und das wäre auch ganz real wichtig. Denn in der ehemaligen Herzkammer des deutschen Wirtschaftswunders erreichen heute 30 Prozent der Viertklässler den Mindeststandard in Rechtschreibung nicht.
Allerdings scheut die EdTech-Gemeinde an dieser Stelle die Wirklichkeit. Erste Studien zeigen, dass die Lernerfolge und Kompetenzzuwächse bei Nutzung digitaler Medien überschaubar – manchmal sogar negativ sind. Und auch der Mitarbeiter der EU-Kommissarin für Bildung kann da wenig Hoffnung machen. Zwar hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 satte 80 Prozent aller EU-Bürgerinnen digitale Grundfähigkeiten beherrschen. Aber die Mission verläuft nicht gut. Die Rate der EU-Bürger mit ‘digital literacy‘ nehme derzeit nicht zu, sondern ab, verrät Georgi Dimitrov.
Könnte es also sein, dass die Digitalisierung nicht die Antwort, sondern die Ursache der miserablen Ergebnisse etwa des letzten IQB-Bildungstrends ist?
***
Jonas Grünewald hat eine App gebaut, in der Schülerinnen und Schüler eine Art digitalen Schulausflug machen können. Er sagt, Erlebnispädagogik sei ein wichtiger Zweig der Erfahrungen für Kinder und Jugendliche. Natürlich will er nicht, dass Schüler künftig nur virtuell an Schullandfahrten teilnehmen. Besondere Erfahrungen der Kooperation und des Selbstbewusstseins könnte die aber bereits über die App üben.
Wadim Brakowski bastelt an einer VR-Umgebung für technische Berufe. Er will, dass Schülerinnen und Schüler künftig komplexe Vorgänge selbst in einer virtuellen Welt erkunden können. Wadim gehört, wie die anderen Gründer, zur Bielefelder Start-up-School speziell für EdTechs.
***
Auf einem anderen Podium geht es um die Frage, wie EdTechs das Bildungssystem verändern können. Im Laufe der Diskussion zeigt sich, dass die Ziele der Veränderung nicht vollkommen klar sind. Ein Forscher aus Dänemark warnt vor mehr Effizienz. Bisher habe das Ziel darin bestanden, technologische Lösungen dafür zu finden, “um Schulen effektiver zu machen”. Das sei aber gar keine gute Idee. Schüler müssten Fehler machen dürfen. Es sei wichtig, mit technologischen Lösungen einfach nur herumzuspielen.
Das geht dann sogar den EdTechs wie Annie Dörfle von der adaptiven Lernplattform Scobees zu weit. Man müsse Schülern helfen, die Probleme haben, fordert sie. Scobees entwickelt gerade ein kompetenzorientiertes Programm, das Schülern mit Lernschwierigkeiten hilft. Und auch ein Beamter der Staatskanzlei ist da, André Spang, einer der Pioniere des digitalen Lernens in Deutschland. “Die Frage ist, was hilft dem Lernen“, sagt der ehemalige Lehrer. “Die Frage ist nicht: Wie können wir einen Prozess digitalisieren? Es geht immer um die Schüler.”

Die bildungspolitische Diskussion in Deutschland ist eine Geschichte des wiederholten bösen Erwachens: vom PISA-Schock der frühen 2000er bis hin zum jüngst erschienenen IQB-Bildungstrend. Gelernt hat das hochmoderne Industrieland Deutschland daraus nicht genug. Es fehlt an einer fortlaufenden, belastbaren und umfassenden Datenbasis über Bildungserfolg und Bildungswirkungen. Empirisch arbeitende Bildungsforscher und wirkungsorientierte Bildungspolitiker haben es in Deutschland nicht leicht.
Die Datenlage ist, freundlich ausgedrückt, ein Flickenteppich. Die Querschnittsdaten, die das IQB stichprobenartig im Auftrag der KMK für den Bildungstrend erhebt, stehen der freien Wissenschaft nur eingeschränkt zur Verfügung. So unterliegen etwa Forschungsfragen, die einen Ländervergleich umfassen, einer politischen Bevormundung seitens der KMK – Forschungsvorhaben, die das Potential haben, Missstände föderaler Bildungspolitik aufzudecken, können bereits im Vorfeld verhindert werden. Gutgemeinte Längsschnitt-Alternativen wie das Nationale Bildungspanel sind aufgrund unzureichender Fallzahlen für viele Fragestellungen nicht repräsentativ auswertbar. Insgesamt scheint ein politischer Unwillen zu Transparenz und Rechenschaft im Bildungswesen vorzuherrschen.
Fehlende Daten über Bildungserfolg und -wirkung sind nicht nur ein Problem für die Forschung, sondern erschweren die alltägliche Praxis in der öffentlichen Verwaltung. Ein Beispiel ist das undurchsichtige Übergangssystem zwischen Schule und Beruf: Haben Schüler erst einmal das Schulsystem und damit die Verantwortung der Kultusministerien der Länder verlassen, “verschwinden” sie für einige Zeit aus den amtlichen Daten. Läuft es gut, tauchen sie als Auszubildende, Beschäftigte oder Studierende in anderen Datenquellen wieder auf. Läuft es weniger gut, bleiben sie zunächst für die Politik unsichtbar. Solange, bis es zu spät ist – und sie in die sozialen Sicherungssysteme gefallen sind.
Viele verschiedene politische Player scheinen verstanden zu haben, in welchem evidenzlosen Blindflug sich die deutsche Bildungspolitik befindet. Die Diskussion nimmt etwas Fahrt auf. Zumindest denkbar scheint, dass der Forschung Bildungsverlaufsdaten, also die Erfassung individueller Schüler:innen-Laufbahnen, bereitgestellt werden. Doch selbst ein umfassendes Bildungsverlaufsregister kann nur ein Baustein sein. Denn evidenzbasierte und wirkungsorientierte Bildungspolitik muss heißen, nicht nur die Bildung selbst zu vermessen, sondern vor allem auch deren gesellschaftliche Auswirkungen!
Eine solche Bildungspolitik kann Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zugleich sein. Die erhofften Effekte guter Bildungspolitik sind breit gestreut: Internationale Studien zeigen, dass bessere Bildung und geringere Bildungsungleichheit starke Auswirkungen auf Armut, Gesundheit, Kriminalität haben kann. Die soziale Bildungsrendite, also der gesellschaftliche Mehrwert besserer Bildung, der nicht etwa allein durch individuell verbesserte Arbeitsmarktchancen abgegolten ist, überschreitet die private Rendite dabei erheblich!
Wie aber wollen wir die gesellschaftlichen Auswirkungen guter und schlechter Bildungspolitik auf gesellschaftliche Zielgrößen bestimmen? Eine über reine Bildungsdaten hinausgehende Verknüpfung etwa mit Arbeitsmarktdaten und Daten der Sozialversicherung ist unter bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht möglich. Diese umfassende Datenbasis zu schaffen, ist besonders schwierig: Denn dafür müssen Bund und Länder über Verantwortungsgrenzen hinweg und unterschiedliche Ressorts zusammenarbeiten. Allen Beteiligten stünde es gut, über den eigenen Verantwortungsbereich und die laufende Legislaturperiode hinaus eine solche dringend benötigte Datenbasis auf den Weg zu bringen.
Ein Blick in unsere Nachbarländer zeigt, dass eine umfassende Verknüpfung von Datenquellen keine utopische Wunschvorstellung eines datengierigen Wissenschaftlers ist, ebenso wenig eine Orwell’sche Dystopie des gläsernen Schülers. Dänemark und die Niederlande stellen seit vielen Jahren umfangreiche Bevölkerungsdaten zu Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit und dem Justizsystem (und vielem mehr) zur Verfügung. Und das alles DSGVO-konform, anonymisiert und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, sodass ein Missbrauch weitestgehend ausgeschlossen ist.
Die internationale Forschung zeigt eindrucksvoll, wie wissenschaftlicher Zugang zu verknüpften Registerdaten Evidenz für wirkungsorientierte Politik liefern kann: etwa darüber, wie kleinere Klassen sich positiv auf späteren Arbeitsmarkterfolg in Schweden auswirken. Oder inwiefern ein früheres Schuleintrittsalter spätere Kriminalitätsraten der betroffenen Schüler beeinflusst. Oder aber wie zusätzliche verpflichtende Schuljahre die Lebenserwartung in den Niederlanden erhöht. Verknüpfte Registerdaten ermöglichen, langfristige Wirkungen bildungspolitischer Stellschrauben über den direkten Bildungseffekt hinaus zu evaluieren. Sie vermeiden den bildungspolitischen Blindflug.
Bildungsdaten bereitzustellen und auszuwerten, bedeutet immer auch, dass sich Politikerinnen und Politiker der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen stellen – bisher sicher kein Primat der deutschen Politik. Aber die dramatische Bildungsnotlage, die sich in den jüngsten Bildungstrends wiederholt gezeigt hat, sollte alle Beteiligten motivieren, das aktuelle Momentum zu nutzen. Das würde den Rückstand zu unseren Nachbarländern verringern – und die Bildungspolitik hierzulande auf eine evidenzbasierte und wirkungsorientierte Basis stellen.
Der Bildungsökonom Ingo Isphording forscht am IZA (Institut zur Zukunft der Arbeit) in Bonn. Dort koordiniert er das internationale Forschungsnetzwerk “Economics of Education”. Er ist Affiliate am Münchner Center of Economic Studies und am ifo-Institut.
Start-ups aus dem Bildungsbereich können eine Förderung vom Bundesbildungsministerium (BMBF) erhalten. Das bedeutet, dass es zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie direkte finanzielle Unterstützung für EdTechs gibt. Das Ministerium teilte Bildung.Table auf Nachfrage mit, dass insgesamt knapp neun Millionen Euro zur Verfügung stehen. Start-ups erhalten Mittel in zwei Phasen, insgesamt profitieren 30 Jungunternehmen aus dem EdTech-Bereich davon.
Bildungs-Unternehmen und -Start-ups hatten sich im Mai 2021 an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und die Kultusminister gewandt. Sie boten Hilfe bei der Pandemie an – und baten um Zugang zu den Bildungseinrichtungen. Es kam damals nicht einmal zu einem ordentlichen Gesprächstermin. Denn die damalige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, und die Bundesbildungsministerin konnten sich über protokollarische Fragen nicht einigen. Nun scheint von dem Geldsegen, den das BMBF von der Förderwolke namens Bildungsplattform herabregnen lässt, auch bei Klein-Entrepreneuren etwas anzukommen.
Patrick Schmidt, CEO von Brainyoo, sagt: “Mit Stolz halte ich den Zuwendungsbescheid des BMBF für die Mitgestaltung der Nationalen Bildungsplattform in meinen Händen.” Das Start-up versorgte anfangs die Industrie mit digitalen Karteisystemen zum Lernen. Inzwischen ist eine mobile Lernplattform für selbstgesteuertes Lernen und Lernstandserhebung entstanden – sie wird von der Grundschule bis zur beruflichen Ausbildung eingesetzt. Nach 10 Jahren erhält Brainyoo erstmalig einen finanziellen Zuschuss vom Staat. Schmidt verwendet die Mittel für das Programmieren neuer Tools. Selbst nach so langer Zeit sei sehr hilfreich, dass es jetzt eine Förderung gebe, sagte er Bildung Table.
Bildung.Table sprach außerdem mit einem Start-up, das 700.000 Euro erhält. Davon werden nun kompetenzorientierte Lerntrainings für SchülerInnen mit Defiziten erstellt. Das Start-up ist in der Umsetzungsphase. In einer vorgeschalteten Konzeptphase hatte es zunächst einen “proof of concept” erarbeitet. Nun wird die Innovation für viele SchülerInnen zugänglich gemacht. Das BMBF fördert in der Konzeptphase 30 Unternehmen mit 1,7 Millionen Euro. In der Umsetzungsphase erhalten 25 Unternehmen 6,96 Millionen Euro von der gesamten Bundesförderung.
Die Förderrichtlinie richtet sich explizit an EdTechs, wobei beim Namen Stolpergefahr besteht: “Prototypen für eine Bildungssektor-übergreifende, transdisziplinäre Meta-Plattform für kollaborativen, kompetenten und digital gestützten Zugang zu innovativen Lehr-/Lernformaten und unterstützenden Lerntechnologien: Initiative Nationale Bildungsplattform“. Eine sperrigere Formulierung haben die BMBF-Beamten offenbar nicht gefunden. Christian Füller

Gerhard Brand soll zum Jahresende den langjährigen Vorsitzenden Udo Beckmann an der Spitze des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) ablösen. Nach Informationen von Bildung.Table hat sich der VBE-Vorstand Mitte September einstimmig für die Kandidatur von Brand ausgesprochen. Die Wahl findet am 16. Dezember statt. Es ist zu erwarten, dass die Bundesversammlung, das höchste Verbandsgremium, dem Vorschlag folgt.
Seit über zehn Jahren ist Brand Schatzmeister und Mitglied im geschäftsführenden Vorstand. “Seine Kandidatur steht für Kontinuität, die er durch eigene Akzente bereichern wird”, teilt der amtierende Vorsitzende Beckmann auf Anfrage mit. “Gerhard Brand liebt das klare Wort und ist ein beherzter Streiter für die Rechte der Lehrkräfte und der Erzieherinnen und Erzieher.”
Als Winfried Kretschmann vergangene Woche auf den IQB-Schock reagierte, indem er davor warnte, nun nach mehr Lehrkräften zu rufen, holte Brand zum Frontalangriff gegen den Grünen-Ministerpräsidenten aus: Kretschmann habe offensichtlich nach Jahrzehnten in der Politik keine Ahnung vom Schulalltag mehr. “Er versteht davon, was heutzutage im Unterricht passiert, ungefähr genauso viel wie ein Ziegelstein vom Schwimmen.” Brand meint, der Hauptgrund für die schlechten Schülerleistungen sei der Personalmangel – eine Baustelle, die ihn auch auf Bundesebene noch viele Jahre begleiten wird.
Ursprünglich studierte Brand Lehramt in Ludwigsburg, bevor er 2001 als Rektor die Leitung einer Grund- und Hauptschule übernahm. Seit Oktober 2010 ist der Pädagoge Vorsitzender des VBE Baden-Württemberg. Innerhalb des VBE gilt der Landesverband im Südwesten als eher konservativ. “Gerhard wird sicher nicht morgen die Revolution ausrufen”, meint ein Vorstandsmitglied.
Intern hat der designierte Vorsitzende bereits einen Ausblick auf seine Amtszeit gegeben: Er wolle besonders die faktenbasierte Verbandsarbeit fortsetzen und mit repräsentativen Studien und Umfragen die bildungspolitischen Forderungen untermauern. In den vergangenen Jahren konnte der VBE mit dieser Strategie einige Themen erfolgreich in der Öffentlichkeit platzieren – darunter die Klemm-Studie zum Lehrkräftebedarf sowie regelmäßige Forsa-Umfragen zum Thema Gewalt gegen Lehrkräfte und Berufszufriedenheit von Schulleitungen. Moritz Baumann
Wer studiert, sichert sich damit später mehr Geld. Dieser gängigen Behauptung widersprechen Forscher vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer aktuellen Studie (zum Kurzbericht). Zwar verdient man mit einer Stelle, für die der Arbeitgeber ein mindestens vierjähriges Hochschulstudium verlangt, im Schnitt deutlich mehr – bis zur Rente etwa 2,7 Millionen Euro Lebenseinkommen. Zum Vergleich: Bei einer Tätigkeit, die eine Berufsausbildung voraussetzt, sind es 1,7 Millionen Euro; bei Arbeitnehmern, die zusätzlich einen Fortbildungsabschluss erworben haben, 2,36 Millionen. Doch zwischen den einzelnen Berufsfeldern gibt es immense Unterschiede. Laut IAB können Facharbeiter, die eine zwei- bis dreijährige Ausbildung gemacht haben, deutlich mehr verdienen als Akademiker – insbesondere wenn die Ausbildung um einen Meisterabschluss, den Techniker oder den Fachwirt ergänzt wird.
Die Wissenschaftler vom IAB haben für 36 Berufsfelder das durchschnittliche Brutto-Lebensentgelt errechnet. Sie stützen sich auf Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung aus den Jahren 2010 bis 2019. “Wir haben uns Personen einer Berufshauptgruppe angeschaut, die in dem Zeitraum vollzeitbeschäftigt waren und nachvollzogen, was ein 18-Jähriger verdient, ein 19-Jähriger und so weiter, bis zum 65-Jährigen”, sagt Studienautor Heiko Stüber. Die Forscher nahmen dabei an, dass die Arbeitnehmer durchgehend bis zur Rente in Vollzeit arbeiten, weshalb das Ergebnis nur eine Annäherung an die Realität darstellt. “Ein 30-jähriger Handwerksmeister wird in 20 Jahren außerdem wahrscheinlich mehr verdienen wie ein 50-jähriger Berufsgenosse heute”, sagt Stüber.
Besonders in den MINT-Berufen können sich Azubis auf ein vergleichsweise hohes Einkommen freuen: nämlich 2,2 Millionen Euro. Mit Fortbildung sind es mit 2,7 Millionen Euro sogar 500.000 Euro mehr. Das ist mehr als Arbeitnehmer in anderen Berufsfeldern erzielen, die für ihre Stelle ein vierjähriges Studium benötigen (sogenannte Experten).
Mit nur 1,6 Millionen Euro ist bei Experten das Brutto-Lebenseinkommen im Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbe am niedrigsten. In anderen Berufsfeldern können Nicht-Akademiker deutlich mehr verdienen: mit einer einfachen Ausbildung in 13, mit einer zusätzlichen Fortbildung sogar in 29 Berufsfeldern.
Dass man in seiner Berufsgruppe ohne Studium tatsächlich mehr verdient als ohne, kommt dagegen selten vor. Nur in vier Berufsfeldern liegen Arbeitnehmer mit Fortbildungsabschluss leicht vorn, zum Beispiel in der Berufsgruppe Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe und Theologie. “Ein Faktor ist hierbei, dass immer mehr einen Bachelorabschluss haben und sie, da ihr Studium nur drei, nicht vier Jahre dauert, teilweise auf dem gleichen Anforderungsniveau eingestuft werden wie Arbeitnehmer mit Berufsausbildung und Fortbildungsabschluss”, sagt Stüber.
Eine Schwachstelle der IAB-Berechnung ist, dass sie keine Beamten und auch keine Selbständigen und Freischaffenden einbezieht. “Gerade selbständige Meister im Bauhandwerk verdienen wahrscheinlich oft noch mehr als angestellte Meister“, sagt Stüber. Das durchschnittliche Lebenseinkommen dürfte in diesem Bereich bei Personen mit Fortbildung also sogar noch höher liegen als berechnet. Für Stüber hat die Studie vor allem ein Fazit: Nur um mehr zu verdienen, sollte niemand ein Studium beginnen. Anna Parrisius
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien fordert, dass für Kinder mit Sprachförderbedarf mindestens das letzte Kita-Jahr verpflichtend sein soll. “Spätestens mit viereinhalb Jahren müssen wir den Sprachstand eines Kindes überprüfen, damit bis zu seiner Einschulung nötige Fördermaßnahmen ergriffen werden können”, teilte sie den Kieler Nachrichten am Dienstag mit. “Eine Verpflichtung ist für diese Kinder der richtige Weg, um die Bildungschancen zu verbessern.”
Die KMK-Präsidentin handelt mit dieser Forderung im Alleingang und überraschte unter anderem die für Kitas zuständige Sozialministerin Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen). Diese betonte, nicht hinter Priens Vorschlag zu stehen. “Verpflichtende Kitabesuche sind bewusst nicht Teil der Koalitionsvereinbarung und damit auch nicht für diese Legislatur vorgesehen”, so Touré. Wichtig seien systematische Schuleingangsuntersuchungen. Zusätzlich könne man Screenings im Einzugsbereich von sogenannten Brennpunktschulen erproben.
Auch aus den Reihen der Opposition hagelte es Kritik an Priens Vorschlag. So merkte Sophia Schiebe, kitapolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, an, dass für eine Kita-Pflicht für Kinder mit Sprachförderbedarf die Grundvoraussetzungen fehlten und bezog sich damit auf den gravierenden Fachkräftemangel, aber auch auf die fehlende finanzielle Absicherung der Sprachförderung in Kitas. “Wir benötigen erst einmal genügend Kita-Plätze, eine Fachkräfteoffensive für mehr Personal, eine Ausbildungsreform, ausreichend Sprachfachkräfte in den Kitas sowie qualitative Standards für die Vorschularbeit, damit die Kinder gut auf die Schule vorbereitet werden.”
Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt betonte, dass Prien für die Kitapolitik gar nicht zuständig sei. “Unsere Grundschulen müssen durch mehr Stunden pro Woche und besseren Unterricht gestärkt werden”, sagte er. Vogt mahnte an, das Bildungsministerium müsse die Umsetzung der Inklusion verbessern, anstatt diese als Problem auszumachen. dpa/Anouk Schlung
Nach einem Cyberangriff auf das Medienzentrum München-Land vergangenen Donnerstag hatten zahlreiche Schulen in Oberbayern keinen Zugriff mehr auf ihre Daten. Laut dem Münchner Landratsamt sind 55 Schulen im Landkreis München sowie 20 Grund- und Hauptschulen im Landkreis Berchtesgadener Land betroffen. Der Server des Medienzentrums sei gehackt und darauf befindliche Daten unlesbar gemacht worden.
Der Angriff sei innerhalb weniger Minuten entdeckt und die Verbindungen zwischen Internet und Servern schnell unterbrochen werden. Die sensiblen Schuldaten, darunter bereits verschlüsselte Schulverwaltungsdaten wie Namenslisten, Adressen von Schülerinnen und Schülern, Stundenpläne oder Informationen zur Zeugniserstellung, seien somit mit großer Sicherheit nicht in fremde Hände gelangt.
Wie das Landratsamt München dem Bayrischen Rundfunk auf Anfrage mitteilte, sei nach dem Cyberangriff auf dem Server eine Nachricht des Täters mit einer Lösegeldforderung gefunden worden. Darauf sei die Behörde jedoch nicht eingegangen. Abgesehen von den Datenbanken der amtlichen Schulverwaltung seien keine weiteren Bereiche der Landkreisverwaltung betroffen. dpa/Anouk Schlung

Vor fünf Jahren erlebte die deutsche Bildungspolitik ein Erdbeben. Zwei tektonische Platten trafen aufeinander: von der einen Seite schob sich die altgediente Lehrkräfteanalyse der Kultusminister heran, von der anderen die frisch errechneten Zahlen der Bertelsmann-Stiftung. Federführend waren Dirk Zorn und der Bildungsökonom Klaus Klemm, der Zorn auch schonmal seinen “wissenschaftlichen Ziehsohn” nennt. Die beiden errechneten, dass der zu erwartende Lehrermangel zigtausendfach größer ist als von der KMK erwartet. Das Thema kletterte erstmals weit nach oben auf die politische Agenda.
“Das hat damals richtig Spaß gemacht”, sagt Dirk Zorn. Denn es sei die erfolgreichste Studie in 40 Jahren Stiftungsgeschichte gewesen. Ein anderes Mal ließ Zorn Wissenschaftler auswerten, in welchen Berliner Bezirken wie viele Quereinsteiger arbeiten. Das Ergebnis: im armen Wedding viele, im reichen Zehlendorf wenige. Und wieder hatte Zorn damit ein bildungspolitisches Beben verursacht.
Das Handelsblatt hat einmal über die Bertelsmann-Stiftung geschrieben, sie belehre Lehrer. Aber, sagt Zorn: “Wir wollen nicht immer nur recht haben, wir wollen relevant sein.” Kaum ein Quartal vergeht, in dem die Gütersloher nicht mit einer Studie in der Hand winken, um ein Thema zu setzen. Die Besserwisser-Stiftung, finden die einen, die anderen erkennen an: Hier wird handwerklich gute Arbeit geleistet.
Dirk Zorn, 50 Jahre, ist Leiter der Bildungsabteilung und vermag es wie wenig andere hierzulande, die richtigen Fragen zu stellen, sie mit Daten zu beantworten – und politisch wie medial gehört zu werden. Empirisch geforscht hat der promovierte Soziologe zuvor in Princeton und Harvard. Weil er Heimweh nach Europa und seiner Familie hatte und ihm das “letzte Quäntchen Besessenheit” gefehlt habe, um sich ganz der Wissenschaft zu widmen, ging er als Unternehmensberater zu McKinsey. Dort baute Zorn, der selbst vier Kinder hat, nebenher eine unternehmenseigene Kinderbetreuung auf und merkte, wie wichtig ihm das Thema Bildung ist. “Da brach der Lehrersohn in mir durch”, sagt er.
Seit 2015 ist Zorn bei der Bertelsmann-Stiftung, mit einem kurzen Intermezzo im vergangenen Jahr bei der Bosch-Stiftung. Aber auch hier zog es ihn zurück. Die Bertelsmann-Stiftung strukturiert ihren Bildungsbereich derzeit grundlegend um, hat zwischen Humboldt-Forum und Auswärtigem Amt in Berlin-Mitte ein neues, prestigeträchtiges Gebäude bezogen. Dort möchte Zorn bildungspolitischen Austausch ermöglichen, der oft verfahren ist zwischen zahlreichen Ebenen. “Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt für große Veränderungen im Bildungsbereich. Denn der Problemdruck war noch nie so immens.”
Das “einfach Machen”, wie er es in den USA kennenlernte, vermisst er in
manchmal. Studien zu veröffentlichen, reiche ihm nicht. Daher schmiedet Zorn Zukunftspläne. Die Stiftung könnte dabei helfen, ukrainische Lehrkräfte für den Einsatz in deutschen Schulen zu qualifizieren. Derzeit arbeite er an möglichen Kooperationen mit Bundesländern und Universitäten. Daneben schwebt ihm ein Leadership-Institut vor. Schulträger, Lehrkräfte, internationale Wissenschaftler – aus verschiedenen Ebenen des Bildungssystems sollen Menschen zusammenkommen, Change Management lernen und Best Practices diskutieren.
Während Zorn im Besprechungszimmer der Stiftung sitzt, das nach kühlem, lederbezogenem Neuwagen riecht, strahlt er die Hands-on-Mentalität eines Unternehmensberaters aus. Jeder Hauptsatz liefert eine relevante Information, jede Aussage scheint durch eine Powerpoint-Folie belegbar. Aber dann kommt ihm doch eine Floskel über die Lippen: “Wir alle, die wir das Bildungssystem gestalten, müssen für zwei Dinge sorgen: für gutes Aufwachsen und gutes Lernen der Kinder.” Um nichts weniger gehe es. Dirk Zorn nimmt man das ab. Niklas Prenzel
07. November 2022, 16:00 bis 18:00 Uhr, online
Digitaler Impuls: Von Preisträgerschulen lernen: Unser Weg zu einer zukunftsorientierten Unterrichtsentwicklung
Dieser Workshop ist der erste von insgesamt fünf, in denen jeweils eine Preisträgerschule des diesjährigen Deutschen Schulpreises über ihre Lernerfahrungen, Erfolge, Hürden und Ausgangspunkte der Unterrichtsentwicklung berichtet. Die bisher geplanten weiteren Termine sind am 10. November, am 14. November und am 17. November. INFOS & ANMELDUNG
08. November 2022, 18:00 bis 19:45 Uhr, Berlin und online
Studienpräsentation und Podiumsdiskussion: Wikimedia: Offen und gerecht – wird die Nationale Bildungsplattform ihr Versprechen einlösen?
Im Anschluss an die Präsentation der Wikimedia-Studie “Werte und Strukturen für die Nationale Bildungsplattform” setzen sich die Diskussionsteilnehmer mit der Frage “Offen und gerecht – wird die Nationale Bildungsplattform ihr Versprechen einlösen?” auseinander. Speakerinnen sind unter anderem Saskia Esken, Marina Weisband und Dr. Johanna Börsch-Supan. INFOS & ANMELDUNG
09. bis 11. November 2022, Leipzig
Kongress: Zukunft Ganztag
Der diesjährige Ganztagsschulkongress steht unter dem Motto “Weiterdenken – Weiterentwickeln – Weitergehen” und will für den Ganztag mit neuen Perspektiven innovative Ansätze schaffen. Dabei sollen verstärkt aktuelle Herausforderungen und notwendige Veränderungen thematisiert werden. Hinweis: Der Kongress ist zwar bereits ausgebucht, eine Registrierung auf der Warteliste ist aber möglich. INFOS & ANMELDUNG
09. November 2022, 10:00 bis 16:00 Uhr, online
Konferenz: Zukunftskongress 2022
Das jährliche Fachforum des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter wird in diesem Jahr zum Zukunftskongress, um den Abschluss des Aktionsjahres “Digitale Bildung – Nachhaltig in die Zukunft” zu bilden. Neben Keynotes und Panels finden zwei Diskussionsrunden zu den Themen “Bildung neu denken?” und “Politik & digitale Bildung – Bremse oder Wegbereiter?” statt. INFOS & ANMELDUNG
09. November 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr, online
Community Call: Potenziale und Grenzen KI-gestützter Technologien und digitaler Medien für die Unterrichtspraxis von Lehrkräften
Einblicke in die Chancen, Möglichkeiten und Grenzen KI-gestützter Lernsysteme liefert in diesem Community Call der Erziehungswissenschaftler Thorben Jansen vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Im Anschluss wird über Modelle für den schulpraktischen Einsatz von adaptiven Lernsettings und KI diskutiert. INFOS & ANMELDUNG
10. November 2022, 10:30 bis 20:00 Uhr, Düsseldorf
Kongress: Deutscher Schulträgerkongress
Ziel des DSTK, dessen Medienpartner Bildung.Table ist, ist vor allem eines: die Entwicklung von zukunftsfähigen Schulen. Dabei geht es um Themen wie modernen Schulbau, qualitätsvollen Ganztag und Bildungsgerechtigkeit. Speaker sind unter anderem Udo Beckmann (Bundesvorsitzender VBE) und Gerd Landsberg (DStGB). INFOS & ANMELDUNG
10. bis 12. November 2022, Düsseldorf
Kongress: Deutscher Schulleitungskongress
Zu den wichtigsten fünf Themenfeldern des DSLK gehören Führung mit Persönlichkeit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Begeisterung mit Schulkultur, Zukunft durch Digitalisierung sowie das Neudenken von Schul- und Unterrichtsentwicklung. Speaker sind unter anderem Eckart von Hirschhausen und Udo Beckmann. INFOS & ANMELDUNG
immer mehr Azubis bräuchten, wenn sie an den Berufsschulen ankommen, erstmal einen intensiven Sprachkurs. Deutschkenntnisse sind der Schlüssel – ob im Handwerk, in der Industrie oder in der Pflege. Doch ausgerechnet auf die vielen jungen Menschen, deren Eltern keine Muttersprachler sind, ist das duale Berufsbildungsystem schlecht vorbereitet, wie Recherchen meiner Kollegin Janna Degener-Storr zeigen.
In der Ausbildung von Berufsschullehrern, so berichten es Experten und Praktiker, spiele ‘Deutsch als Zweitsprache’ (DaZ) wenn überhaupt eine untergeordnete Rolle. Da können Studierende froh sein, wenn sie wenigstens ein DaZ-Modul an der Uni belegen können. Dabei macht Bayern vor, wie es besser geht.
Außerdem schauen wir in dieser Ausgabe nach Bielefeld, wo am Montag der EdTech Next Summit gestartet ist. Vor drei Wochen versprach Eduvation-Geschäftsführer Tobias Himmerich hier im Briefing, die Konferenz solle “keine zweite Didacta” werden. Und tatsächlich: Unser Reporter Christian Füller traf in Bielefeld auf viele motivierte Gründer, die grenzenlose Euphorie versprühen. Und das obwohl die blanken Zahlen ernüchternd sind: Denn aktuell kann Deutschland gerade einmal 74 EdTech-Start-ups vorweisen.
Apropos ernüchternd: In seinem Standpunkt hält der Ökonom Ingo Isphording den Bildungsministern einen Spiegel vor. Er kritisiert, dass wertvolle Bildungsdaten weiter einer “politischen Bevormundung seitens der KMK” unterliegen. Ein Zustand, der auch Dirk Zorn ärgert. Seit September ist der Princeton- und Harvard-Forscher wieder bei der Bertelsmann-Stiftung in Berlin, wo er sich mit Niklas Prenzel zum Gespräch getroffen hat.
Und nun, viel Vergnügen bei der Lektüre!


Wer in Deutschland eine Ausbildung beginnt, hat laut dem Institut der deutschen Wirtschaft immer häufiger keine deutsche Staatsbürgerschaft. Neben fachlichen Inhalten müssen viele Deutsch lernen, teilweise ein neues Schriftsystem. Manche haben in ihrem Herkunftsland noch gar nicht schreiben und lesen gelernt. Als Pfleger müssen die Azubis später mit Patienten kommunizieren können, als Bürokauffrau Geschäftsbriefe schreiben, als Gärtner bestimmte Fachwörter verstehen. Längst müssen Berufsschulen daher viele Schüler sprachlich vorbereiten – und auch bei Muttersprachlern fehlen oft die geforderten sprachlichen Kompetenzen.
Raphael Dick, selbst Berufsschullehrer für Deutsch, ist in der Berufsvorbereitung tätig und bildet Referendare für den Deutschunterricht aus. Er weiß, dass die Sprachförderung in vielen Berufsschulklassen heute eine große Herausforderung darstellt. “Im Idealfall müsste jede Lehrkraft in jedem Fall einzeln entscheiden, welcher Schüler mit dem normalen Fachbuch arbeiten kann, wer ein vereinfachtes Arbeitsblatt erhält und wer zusätzlich noch eine mündliche Erklärung braucht”, sagt er. Nach seiner Erfahrung sitzen heute in vielen Berufsschulklassen Abiturienten neben Schülern, die gerade so den Mittelschulabschluss geschafft haben, und Jugendlichne, die erst seit wenigen Wochen in Deutschland sind und zuvor vielleicht gar keine Schule besucht haben.
Doch Berufsschullehrer werden im Studium meist nicht darauf vorbereitet, sprachliche Kompetenzen zu vermitteln. “Wir bräuchten viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die darin fachlich fit sind und sich ansatzweise in die Lebenswelt von geflüchteten Schülerinnen und Schülern hineinversetzen können”, sagt Cosima Lemke-Ghafir. Als Expertin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) war sie an verschiedenen beruflichen Schulen in Berlin tätig. Jetzt leitet sie eine Alphabetisierungsklasse an einem Oberstufenzentrum. Christoph Schroeder ist Professor am Institut für Germanistik der Universität Potsdam. Er stellt fest: “Deutsch als Zweitsprache ist zu wenig systematischer Teil der Ausbildung der Lehrkräfte.“
Zwar machen berufliche Schulen, Betriebe und andere Kooperationspartner vereinzelt attraktive Angebote, um neu zugewanderte Jugendliche sprachlich zu unterstützen. In Schleswig-Holstein starten nach den Herbstferien beispielsweise Sprachkurse für Auszubildende nicht-deutscher Herkunft an Berufsschulen. In die Lehrerfortbildung und die Referendarausbildung hat das Thema teilweise Eingang gefunden. Und an Berufsschulen sind unzählige Quereinsteiger tätig, die Germanistik studiert haben oder Berufserfahrungen im Unterrichten von Nicht-Muttersprachlern mitbringen.
Die Hochschulen bereiten angehende Lehrkräfte dahingegen kaum darauf vor, dass einige ihrer Schüler besonderen sprachlichen Förderbedarf haben werden. Dabei hat die Kultusministerkonferenz bereits 1981 “Empfehlungen zur Verbesserung der Lehrerbildung auf dem Gebiet des Ausländerunterrichts” ausgesprochen. 2019 hat sie empfohlen, eine durchgängige und kompetenzorientierte Sprachbildung in die Lehrpläne der Berufsschulen aufzunehmen. Diese sei für Deutschlehrkräfte relevant, die Zugewanderte gezielt fördern, etwa in Willkommens- oder Berufsintegrationsklassen. Aber auch alle anderen Lehrkräfte sollen unabhängig von ihrem Fach “sprachsensiblen Unterricht” anbieten.
In Berlin durchlaufen Studierende für das Berufsschullehramt jedoch lediglich ein Standardmodul in Sprachbildung/DaZ mit fünf Leistungspunkten – alle Lehramtsanwärter müssen es belegen. Auch in NRW gibt es ein solches DaZ-Modul für alle Lehramtsstudierenden. In Schleswig-Holstein gibt es für Lehramtanwärter im Master ein verpflichtendes Modul namens “Inklusion in der Schule: Heterogenität und Sprache”.
Als vorbildlich gilt Bayern, wenn es darum geht, Berufsschullehrkräfte für die Arbeit mit Zuwanderern fit zu machen. Schon 2010 hat das dortige Staatsministerium das Projekt “Berufssprache Deutsch” ins Leben gerufen. Seit 2016 ist es – auch in Folge der hohen Flüchtlingszahlen – ein durchgängiges Unterrichtsprinzip für alle Bereiche der beruflichen Bildung. Heißt: Künftige Deutschlehrer werden auf den Unterricht für Schüler mit einem anderen Sprachhintergrund vorbereitet, aber auch Lehrer anderer Fächer.
An der Technischen Universität München können angehende Lehrkräfte für berufliche Bildung das Fach “Berufssprache Deutsch” studieren. Für alle verpflichtend sind außerdem die Seminare “Sprachliche und kulturelle Vielfalt”. Hier lernen die angehenden Lehrkräfte beispielsweise, aus der Sicht zugewanderter Schüler auf ihr Unterrichtsmaterial zu blicken: Wie anspruchsvoll sind die Aufgaben sprachlich? Beherrschen meine Schüler die grammatischen Strukturen im Text? Wo brauchen sie noch Unterstützung?
Verena Rasp, die in den Seminaren unterrichtet, sagt: “In einer Sitzung zum Thema ‘diskontinuierliche Texte’ sehen wir uns beispielsweise Grafiken, Diagramme und Karten an, die in jeder Fachrichtung der beruflichen Bildung viel verwendet werden, die viele Schülerinnen und Schülern aber nicht verstehen und nicht versprachlichen können.” Dies könne zum Beispiel der Fall sein, wenn die Schüler von ihrer Muttersprache eine andere Leserichtung gewöhnt sind.
Bei der Entwicklung des Curriculums für die Studierenden hat die bayrische Hochschule Anregungen aus verschiedenen Fachbereichen einbezogen: von Deutsch als Zweitsprache über die Erziehungswissenschaften und die Didaktik der beruflichen Bildung bis hin zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Außerdem hat sie sich an Curricula orientiert, die die Leuphana-Universität Lüneburg und die Universität Bielefeld für angehende Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache im Auftrag des BMBF entwickelt haben. Letztlich müsste es ein Ziel der Lehramtsstudierenden werden, dass die Schülerinnen und Schüler ihr sprachliches Handeln reflektieren und so kommunizieren, wie es zur jeweiligen Situation passt. Eine besondere Herausforderung sieht Eveline Wittmann dabei in der Vielzahl an Berufen, in denen die Studierenden später Azubis ausbilden. Sie ist Academic Program Director der TU für die strategische Ausrichtung der beruflichen Bildung zuständig. Bei der Entwicklung von Curricula für einzelne Berufe könnten sie daher nicht sehr in die Tiefe gehen, sagt Wittmann. “Dafür fehlt die wissenschaftliche Evidenz.”

In der großen Halle des Bielefelder Lokschuppens steht eine Rodeo-Maschine. Man kann versuchen, sich auf dem Rücken eines elektrischen Bullen zu halten. Nur dass bei dem EdTech Next Summit der Stier ein Einhorn ist, jenes Maskottchen also, das für den Wert von einer Milliarde Euro steht. Auf der Bühne der Haupthalle allerdings machen die Veranstalter den versammelten Start-ups und Gerne-Gründern wenig Hoffnung: “Es ist unglaublich schwer, in die Schulen hinein zu kommen“, sagt Nik Riesmeier von der Founders Foundation, die das EdTech-Next-Förderprogramm betreut.
1000 Besucher haben sich angemeldet, um beim ersten Gipfel-Treffen dabei zu sein, das sich exklusiv an EdTechs wendet. Drei Jahre lang wird es den Summit geben. Die Bielefelder Founders-Foundation begleitet Gründer und schärft ihre Ideen, Geschäftsmodelle und Pitch-Fähigkeiten. Alle sind einerseits wahnsinnig nett zueinander, andererseits wird der “schwierige Bildungsmarkt” mit so harten Strichen gezeichnet, dass sich keiner überschießende Hoffnungen macht.
Gründerin Nele Mletschkowsky von Europas – angeblich – am schnellsten wachsenden Start-up “Quofox” erzählt, dass sie hier in NRW “kein Ökosystem gefunden hat”. Das war damals, als sie zu gründen begann. Das Problem sei, “genug Geld für deine Idee zu bekommen”. Der Beamte aus dem NRW-Wirtschaftsministerium, Johannes Velling, sagt mit Blick auf die kümmerliche Zahl von 74 EdTech-Start-ups in Deutschland: “Wir sind weit hinten dran, wir müssen aufholen.” Seine grüne Super-Ministerin, Mona Neubaur, ist erst gar nicht nach Bielefeld gekommen – obwohl sie das ganze Unterfangen mit drei Millionen Euro finanziert. Hatte sie vielleicht Angst, ein Bad in schlechter Laune zu nehmen?
Dabei stimmt das gar nicht. Im Lokschuppen in Bielefeld springen eine Reihe von jungen Leuten umher, die unglaublich ansteckend sind, provozierend gute Laune und Ideen haben – und jeden anquatschen, den sie kennen lernen können.
***
Ahmad El-Ali gibt Studierenden die Möglichkeit, auf seiner Plattform Studeez eine leicht zu erarbeitende Musterlösung für Klausuren zu verkaufen. Die Käufer sind andere Studierende. Aber ganz so simpel, wie es sich anhört, ist es nicht. Denn die Studierenden, die ihre Klausur oder ihr Examen geschafft haben, müssen die Musterlösungen aus verschiedenen Tools zusammenbauen – ehe sie die verkaufen können.
Ena Teskeredzić ist Sprachbegleiterin aus Berlin und entwickelt nun eine Gründer-Idee. Viele Fachkräfte aus dem Ausland kommen nach Deutschland – und scheitern an kulturellen Hürden, obwohl sie dringend benötigt werden. Anna, die aus Bosnien-Herzegowina kommt, will den Menschen und den Unternehmen helfen, sich besser zu verstehen.
***
Plötzlich meldet sich im Publikum ein Herr mittleren Alters und fragt, wie man eigentlich den Erfolg eines solchen Start-up-Förderprogramms messen könne. Daraufhin ergeht sich das Podium in sehr komplexen Methoden. Die Zahl der Teilnehmer bei diesem Summit sei ein Kriterium. Die Evaluierung der Anträge, Zwischen- und Abschlussberichte. Und je länger das Podium mit Hilfe immer neuer KPIs (Key Performance Indicators) die Frage beantwortet, desto stärker drängt sich einem auf: die einfachste Methode, die Risiken und Nebenwirkungen von Start-ups in der Bildung zu messen, wäre der Lernstand der Schüler. Können die Grundschüler von Nordrhein-Westfalen mit digitalen Lerntools besser lesen, schreiben und rechnen lernen? Und das wäre auch ganz real wichtig. Denn in der ehemaligen Herzkammer des deutschen Wirtschaftswunders erreichen heute 30 Prozent der Viertklässler den Mindeststandard in Rechtschreibung nicht.
Allerdings scheut die EdTech-Gemeinde an dieser Stelle die Wirklichkeit. Erste Studien zeigen, dass die Lernerfolge und Kompetenzzuwächse bei Nutzung digitaler Medien überschaubar – manchmal sogar negativ sind. Und auch der Mitarbeiter der EU-Kommissarin für Bildung kann da wenig Hoffnung machen. Zwar hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 satte 80 Prozent aller EU-Bürgerinnen digitale Grundfähigkeiten beherrschen. Aber die Mission verläuft nicht gut. Die Rate der EU-Bürger mit ‘digital literacy‘ nehme derzeit nicht zu, sondern ab, verrät Georgi Dimitrov.
Könnte es also sein, dass die Digitalisierung nicht die Antwort, sondern die Ursache der miserablen Ergebnisse etwa des letzten IQB-Bildungstrends ist?
***
Jonas Grünewald hat eine App gebaut, in der Schülerinnen und Schüler eine Art digitalen Schulausflug machen können. Er sagt, Erlebnispädagogik sei ein wichtiger Zweig der Erfahrungen für Kinder und Jugendliche. Natürlich will er nicht, dass Schüler künftig nur virtuell an Schullandfahrten teilnehmen. Besondere Erfahrungen der Kooperation und des Selbstbewusstseins könnte die aber bereits über die App üben.
Wadim Brakowski bastelt an einer VR-Umgebung für technische Berufe. Er will, dass Schülerinnen und Schüler künftig komplexe Vorgänge selbst in einer virtuellen Welt erkunden können. Wadim gehört, wie die anderen Gründer, zur Bielefelder Start-up-School speziell für EdTechs.
***
Auf einem anderen Podium geht es um die Frage, wie EdTechs das Bildungssystem verändern können. Im Laufe der Diskussion zeigt sich, dass die Ziele der Veränderung nicht vollkommen klar sind. Ein Forscher aus Dänemark warnt vor mehr Effizienz. Bisher habe das Ziel darin bestanden, technologische Lösungen dafür zu finden, “um Schulen effektiver zu machen”. Das sei aber gar keine gute Idee. Schüler müssten Fehler machen dürfen. Es sei wichtig, mit technologischen Lösungen einfach nur herumzuspielen.
Das geht dann sogar den EdTechs wie Annie Dörfle von der adaptiven Lernplattform Scobees zu weit. Man müsse Schülern helfen, die Probleme haben, fordert sie. Scobees entwickelt gerade ein kompetenzorientiertes Programm, das Schülern mit Lernschwierigkeiten hilft. Und auch ein Beamter der Staatskanzlei ist da, André Spang, einer der Pioniere des digitalen Lernens in Deutschland. “Die Frage ist, was hilft dem Lernen“, sagt der ehemalige Lehrer. “Die Frage ist nicht: Wie können wir einen Prozess digitalisieren? Es geht immer um die Schüler.”

Die bildungspolitische Diskussion in Deutschland ist eine Geschichte des wiederholten bösen Erwachens: vom PISA-Schock der frühen 2000er bis hin zum jüngst erschienenen IQB-Bildungstrend. Gelernt hat das hochmoderne Industrieland Deutschland daraus nicht genug. Es fehlt an einer fortlaufenden, belastbaren und umfassenden Datenbasis über Bildungserfolg und Bildungswirkungen. Empirisch arbeitende Bildungsforscher und wirkungsorientierte Bildungspolitiker haben es in Deutschland nicht leicht.
Die Datenlage ist, freundlich ausgedrückt, ein Flickenteppich. Die Querschnittsdaten, die das IQB stichprobenartig im Auftrag der KMK für den Bildungstrend erhebt, stehen der freien Wissenschaft nur eingeschränkt zur Verfügung. So unterliegen etwa Forschungsfragen, die einen Ländervergleich umfassen, einer politischen Bevormundung seitens der KMK – Forschungsvorhaben, die das Potential haben, Missstände föderaler Bildungspolitik aufzudecken, können bereits im Vorfeld verhindert werden. Gutgemeinte Längsschnitt-Alternativen wie das Nationale Bildungspanel sind aufgrund unzureichender Fallzahlen für viele Fragestellungen nicht repräsentativ auswertbar. Insgesamt scheint ein politischer Unwillen zu Transparenz und Rechenschaft im Bildungswesen vorzuherrschen.
Fehlende Daten über Bildungserfolg und -wirkung sind nicht nur ein Problem für die Forschung, sondern erschweren die alltägliche Praxis in der öffentlichen Verwaltung. Ein Beispiel ist das undurchsichtige Übergangssystem zwischen Schule und Beruf: Haben Schüler erst einmal das Schulsystem und damit die Verantwortung der Kultusministerien der Länder verlassen, “verschwinden” sie für einige Zeit aus den amtlichen Daten. Läuft es gut, tauchen sie als Auszubildende, Beschäftigte oder Studierende in anderen Datenquellen wieder auf. Läuft es weniger gut, bleiben sie zunächst für die Politik unsichtbar. Solange, bis es zu spät ist – und sie in die sozialen Sicherungssysteme gefallen sind.
Viele verschiedene politische Player scheinen verstanden zu haben, in welchem evidenzlosen Blindflug sich die deutsche Bildungspolitik befindet. Die Diskussion nimmt etwas Fahrt auf. Zumindest denkbar scheint, dass der Forschung Bildungsverlaufsdaten, also die Erfassung individueller Schüler:innen-Laufbahnen, bereitgestellt werden. Doch selbst ein umfassendes Bildungsverlaufsregister kann nur ein Baustein sein. Denn evidenzbasierte und wirkungsorientierte Bildungspolitik muss heißen, nicht nur die Bildung selbst zu vermessen, sondern vor allem auch deren gesellschaftliche Auswirkungen!
Eine solche Bildungspolitik kann Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zugleich sein. Die erhofften Effekte guter Bildungspolitik sind breit gestreut: Internationale Studien zeigen, dass bessere Bildung und geringere Bildungsungleichheit starke Auswirkungen auf Armut, Gesundheit, Kriminalität haben kann. Die soziale Bildungsrendite, also der gesellschaftliche Mehrwert besserer Bildung, der nicht etwa allein durch individuell verbesserte Arbeitsmarktchancen abgegolten ist, überschreitet die private Rendite dabei erheblich!
Wie aber wollen wir die gesellschaftlichen Auswirkungen guter und schlechter Bildungspolitik auf gesellschaftliche Zielgrößen bestimmen? Eine über reine Bildungsdaten hinausgehende Verknüpfung etwa mit Arbeitsmarktdaten und Daten der Sozialversicherung ist unter bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht möglich. Diese umfassende Datenbasis zu schaffen, ist besonders schwierig: Denn dafür müssen Bund und Länder über Verantwortungsgrenzen hinweg und unterschiedliche Ressorts zusammenarbeiten. Allen Beteiligten stünde es gut, über den eigenen Verantwortungsbereich und die laufende Legislaturperiode hinaus eine solche dringend benötigte Datenbasis auf den Weg zu bringen.
Ein Blick in unsere Nachbarländer zeigt, dass eine umfassende Verknüpfung von Datenquellen keine utopische Wunschvorstellung eines datengierigen Wissenschaftlers ist, ebenso wenig eine Orwell’sche Dystopie des gläsernen Schülers. Dänemark und die Niederlande stellen seit vielen Jahren umfangreiche Bevölkerungsdaten zu Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit und dem Justizsystem (und vielem mehr) zur Verfügung. Und das alles DSGVO-konform, anonymisiert und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, sodass ein Missbrauch weitestgehend ausgeschlossen ist.
Die internationale Forschung zeigt eindrucksvoll, wie wissenschaftlicher Zugang zu verknüpften Registerdaten Evidenz für wirkungsorientierte Politik liefern kann: etwa darüber, wie kleinere Klassen sich positiv auf späteren Arbeitsmarkterfolg in Schweden auswirken. Oder inwiefern ein früheres Schuleintrittsalter spätere Kriminalitätsraten der betroffenen Schüler beeinflusst. Oder aber wie zusätzliche verpflichtende Schuljahre die Lebenserwartung in den Niederlanden erhöht. Verknüpfte Registerdaten ermöglichen, langfristige Wirkungen bildungspolitischer Stellschrauben über den direkten Bildungseffekt hinaus zu evaluieren. Sie vermeiden den bildungspolitischen Blindflug.
Bildungsdaten bereitzustellen und auszuwerten, bedeutet immer auch, dass sich Politikerinnen und Politiker der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen stellen – bisher sicher kein Primat der deutschen Politik. Aber die dramatische Bildungsnotlage, die sich in den jüngsten Bildungstrends wiederholt gezeigt hat, sollte alle Beteiligten motivieren, das aktuelle Momentum zu nutzen. Das würde den Rückstand zu unseren Nachbarländern verringern – und die Bildungspolitik hierzulande auf eine evidenzbasierte und wirkungsorientierte Basis stellen.
Der Bildungsökonom Ingo Isphording forscht am IZA (Institut zur Zukunft der Arbeit) in Bonn. Dort koordiniert er das internationale Forschungsnetzwerk “Economics of Education”. Er ist Affiliate am Münchner Center of Economic Studies und am ifo-Institut.
Start-ups aus dem Bildungsbereich können eine Förderung vom Bundesbildungsministerium (BMBF) erhalten. Das bedeutet, dass es zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie direkte finanzielle Unterstützung für EdTechs gibt. Das Ministerium teilte Bildung.Table auf Nachfrage mit, dass insgesamt knapp neun Millionen Euro zur Verfügung stehen. Start-ups erhalten Mittel in zwei Phasen, insgesamt profitieren 30 Jungunternehmen aus dem EdTech-Bereich davon.
Bildungs-Unternehmen und -Start-ups hatten sich im Mai 2021 an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und die Kultusminister gewandt. Sie boten Hilfe bei der Pandemie an – und baten um Zugang zu den Bildungseinrichtungen. Es kam damals nicht einmal zu einem ordentlichen Gesprächstermin. Denn die damalige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, und die Bundesbildungsministerin konnten sich über protokollarische Fragen nicht einigen. Nun scheint von dem Geldsegen, den das BMBF von der Förderwolke namens Bildungsplattform herabregnen lässt, auch bei Klein-Entrepreneuren etwas anzukommen.
Patrick Schmidt, CEO von Brainyoo, sagt: “Mit Stolz halte ich den Zuwendungsbescheid des BMBF für die Mitgestaltung der Nationalen Bildungsplattform in meinen Händen.” Das Start-up versorgte anfangs die Industrie mit digitalen Karteisystemen zum Lernen. Inzwischen ist eine mobile Lernplattform für selbstgesteuertes Lernen und Lernstandserhebung entstanden – sie wird von der Grundschule bis zur beruflichen Ausbildung eingesetzt. Nach 10 Jahren erhält Brainyoo erstmalig einen finanziellen Zuschuss vom Staat. Schmidt verwendet die Mittel für das Programmieren neuer Tools. Selbst nach so langer Zeit sei sehr hilfreich, dass es jetzt eine Förderung gebe, sagte er Bildung Table.
Bildung.Table sprach außerdem mit einem Start-up, das 700.000 Euro erhält. Davon werden nun kompetenzorientierte Lerntrainings für SchülerInnen mit Defiziten erstellt. Das Start-up ist in der Umsetzungsphase. In einer vorgeschalteten Konzeptphase hatte es zunächst einen “proof of concept” erarbeitet. Nun wird die Innovation für viele SchülerInnen zugänglich gemacht. Das BMBF fördert in der Konzeptphase 30 Unternehmen mit 1,7 Millionen Euro. In der Umsetzungsphase erhalten 25 Unternehmen 6,96 Millionen Euro von der gesamten Bundesförderung.
Die Förderrichtlinie richtet sich explizit an EdTechs, wobei beim Namen Stolpergefahr besteht: “Prototypen für eine Bildungssektor-übergreifende, transdisziplinäre Meta-Plattform für kollaborativen, kompetenten und digital gestützten Zugang zu innovativen Lehr-/Lernformaten und unterstützenden Lerntechnologien: Initiative Nationale Bildungsplattform“. Eine sperrigere Formulierung haben die BMBF-Beamten offenbar nicht gefunden. Christian Füller

Gerhard Brand soll zum Jahresende den langjährigen Vorsitzenden Udo Beckmann an der Spitze des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) ablösen. Nach Informationen von Bildung.Table hat sich der VBE-Vorstand Mitte September einstimmig für die Kandidatur von Brand ausgesprochen. Die Wahl findet am 16. Dezember statt. Es ist zu erwarten, dass die Bundesversammlung, das höchste Verbandsgremium, dem Vorschlag folgt.
Seit über zehn Jahren ist Brand Schatzmeister und Mitglied im geschäftsführenden Vorstand. “Seine Kandidatur steht für Kontinuität, die er durch eigene Akzente bereichern wird”, teilt der amtierende Vorsitzende Beckmann auf Anfrage mit. “Gerhard Brand liebt das klare Wort und ist ein beherzter Streiter für die Rechte der Lehrkräfte und der Erzieherinnen und Erzieher.”
Als Winfried Kretschmann vergangene Woche auf den IQB-Schock reagierte, indem er davor warnte, nun nach mehr Lehrkräften zu rufen, holte Brand zum Frontalangriff gegen den Grünen-Ministerpräsidenten aus: Kretschmann habe offensichtlich nach Jahrzehnten in der Politik keine Ahnung vom Schulalltag mehr. “Er versteht davon, was heutzutage im Unterricht passiert, ungefähr genauso viel wie ein Ziegelstein vom Schwimmen.” Brand meint, der Hauptgrund für die schlechten Schülerleistungen sei der Personalmangel – eine Baustelle, die ihn auch auf Bundesebene noch viele Jahre begleiten wird.
Ursprünglich studierte Brand Lehramt in Ludwigsburg, bevor er 2001 als Rektor die Leitung einer Grund- und Hauptschule übernahm. Seit Oktober 2010 ist der Pädagoge Vorsitzender des VBE Baden-Württemberg. Innerhalb des VBE gilt der Landesverband im Südwesten als eher konservativ. “Gerhard wird sicher nicht morgen die Revolution ausrufen”, meint ein Vorstandsmitglied.
Intern hat der designierte Vorsitzende bereits einen Ausblick auf seine Amtszeit gegeben: Er wolle besonders die faktenbasierte Verbandsarbeit fortsetzen und mit repräsentativen Studien und Umfragen die bildungspolitischen Forderungen untermauern. In den vergangenen Jahren konnte der VBE mit dieser Strategie einige Themen erfolgreich in der Öffentlichkeit platzieren – darunter die Klemm-Studie zum Lehrkräftebedarf sowie regelmäßige Forsa-Umfragen zum Thema Gewalt gegen Lehrkräfte und Berufszufriedenheit von Schulleitungen. Moritz Baumann
Wer studiert, sichert sich damit später mehr Geld. Dieser gängigen Behauptung widersprechen Forscher vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer aktuellen Studie (zum Kurzbericht). Zwar verdient man mit einer Stelle, für die der Arbeitgeber ein mindestens vierjähriges Hochschulstudium verlangt, im Schnitt deutlich mehr – bis zur Rente etwa 2,7 Millionen Euro Lebenseinkommen. Zum Vergleich: Bei einer Tätigkeit, die eine Berufsausbildung voraussetzt, sind es 1,7 Millionen Euro; bei Arbeitnehmern, die zusätzlich einen Fortbildungsabschluss erworben haben, 2,36 Millionen. Doch zwischen den einzelnen Berufsfeldern gibt es immense Unterschiede. Laut IAB können Facharbeiter, die eine zwei- bis dreijährige Ausbildung gemacht haben, deutlich mehr verdienen als Akademiker – insbesondere wenn die Ausbildung um einen Meisterabschluss, den Techniker oder den Fachwirt ergänzt wird.
Die Wissenschaftler vom IAB haben für 36 Berufsfelder das durchschnittliche Brutto-Lebensentgelt errechnet. Sie stützen sich auf Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung aus den Jahren 2010 bis 2019. “Wir haben uns Personen einer Berufshauptgruppe angeschaut, die in dem Zeitraum vollzeitbeschäftigt waren und nachvollzogen, was ein 18-Jähriger verdient, ein 19-Jähriger und so weiter, bis zum 65-Jährigen”, sagt Studienautor Heiko Stüber. Die Forscher nahmen dabei an, dass die Arbeitnehmer durchgehend bis zur Rente in Vollzeit arbeiten, weshalb das Ergebnis nur eine Annäherung an die Realität darstellt. “Ein 30-jähriger Handwerksmeister wird in 20 Jahren außerdem wahrscheinlich mehr verdienen wie ein 50-jähriger Berufsgenosse heute”, sagt Stüber.
Besonders in den MINT-Berufen können sich Azubis auf ein vergleichsweise hohes Einkommen freuen: nämlich 2,2 Millionen Euro. Mit Fortbildung sind es mit 2,7 Millionen Euro sogar 500.000 Euro mehr. Das ist mehr als Arbeitnehmer in anderen Berufsfeldern erzielen, die für ihre Stelle ein vierjähriges Studium benötigen (sogenannte Experten).
Mit nur 1,6 Millionen Euro ist bei Experten das Brutto-Lebenseinkommen im Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbe am niedrigsten. In anderen Berufsfeldern können Nicht-Akademiker deutlich mehr verdienen: mit einer einfachen Ausbildung in 13, mit einer zusätzlichen Fortbildung sogar in 29 Berufsfeldern.
Dass man in seiner Berufsgruppe ohne Studium tatsächlich mehr verdient als ohne, kommt dagegen selten vor. Nur in vier Berufsfeldern liegen Arbeitnehmer mit Fortbildungsabschluss leicht vorn, zum Beispiel in der Berufsgruppe Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe und Theologie. “Ein Faktor ist hierbei, dass immer mehr einen Bachelorabschluss haben und sie, da ihr Studium nur drei, nicht vier Jahre dauert, teilweise auf dem gleichen Anforderungsniveau eingestuft werden wie Arbeitnehmer mit Berufsausbildung und Fortbildungsabschluss”, sagt Stüber.
Eine Schwachstelle der IAB-Berechnung ist, dass sie keine Beamten und auch keine Selbständigen und Freischaffenden einbezieht. “Gerade selbständige Meister im Bauhandwerk verdienen wahrscheinlich oft noch mehr als angestellte Meister“, sagt Stüber. Das durchschnittliche Lebenseinkommen dürfte in diesem Bereich bei Personen mit Fortbildung also sogar noch höher liegen als berechnet. Für Stüber hat die Studie vor allem ein Fazit: Nur um mehr zu verdienen, sollte niemand ein Studium beginnen. Anna Parrisius
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien fordert, dass für Kinder mit Sprachförderbedarf mindestens das letzte Kita-Jahr verpflichtend sein soll. “Spätestens mit viereinhalb Jahren müssen wir den Sprachstand eines Kindes überprüfen, damit bis zu seiner Einschulung nötige Fördermaßnahmen ergriffen werden können”, teilte sie den Kieler Nachrichten am Dienstag mit. “Eine Verpflichtung ist für diese Kinder der richtige Weg, um die Bildungschancen zu verbessern.”
Die KMK-Präsidentin handelt mit dieser Forderung im Alleingang und überraschte unter anderem die für Kitas zuständige Sozialministerin Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen). Diese betonte, nicht hinter Priens Vorschlag zu stehen. “Verpflichtende Kitabesuche sind bewusst nicht Teil der Koalitionsvereinbarung und damit auch nicht für diese Legislatur vorgesehen”, so Touré. Wichtig seien systematische Schuleingangsuntersuchungen. Zusätzlich könne man Screenings im Einzugsbereich von sogenannten Brennpunktschulen erproben.
Auch aus den Reihen der Opposition hagelte es Kritik an Priens Vorschlag. So merkte Sophia Schiebe, kitapolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, an, dass für eine Kita-Pflicht für Kinder mit Sprachförderbedarf die Grundvoraussetzungen fehlten und bezog sich damit auf den gravierenden Fachkräftemangel, aber auch auf die fehlende finanzielle Absicherung der Sprachförderung in Kitas. “Wir benötigen erst einmal genügend Kita-Plätze, eine Fachkräfteoffensive für mehr Personal, eine Ausbildungsreform, ausreichend Sprachfachkräfte in den Kitas sowie qualitative Standards für die Vorschularbeit, damit die Kinder gut auf die Schule vorbereitet werden.”
Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt betonte, dass Prien für die Kitapolitik gar nicht zuständig sei. “Unsere Grundschulen müssen durch mehr Stunden pro Woche und besseren Unterricht gestärkt werden”, sagte er. Vogt mahnte an, das Bildungsministerium müsse die Umsetzung der Inklusion verbessern, anstatt diese als Problem auszumachen. dpa/Anouk Schlung
Nach einem Cyberangriff auf das Medienzentrum München-Land vergangenen Donnerstag hatten zahlreiche Schulen in Oberbayern keinen Zugriff mehr auf ihre Daten. Laut dem Münchner Landratsamt sind 55 Schulen im Landkreis München sowie 20 Grund- und Hauptschulen im Landkreis Berchtesgadener Land betroffen. Der Server des Medienzentrums sei gehackt und darauf befindliche Daten unlesbar gemacht worden.
Der Angriff sei innerhalb weniger Minuten entdeckt und die Verbindungen zwischen Internet und Servern schnell unterbrochen werden. Die sensiblen Schuldaten, darunter bereits verschlüsselte Schulverwaltungsdaten wie Namenslisten, Adressen von Schülerinnen und Schülern, Stundenpläne oder Informationen zur Zeugniserstellung, seien somit mit großer Sicherheit nicht in fremde Hände gelangt.
Wie das Landratsamt München dem Bayrischen Rundfunk auf Anfrage mitteilte, sei nach dem Cyberangriff auf dem Server eine Nachricht des Täters mit einer Lösegeldforderung gefunden worden. Darauf sei die Behörde jedoch nicht eingegangen. Abgesehen von den Datenbanken der amtlichen Schulverwaltung seien keine weiteren Bereiche der Landkreisverwaltung betroffen. dpa/Anouk Schlung

Vor fünf Jahren erlebte die deutsche Bildungspolitik ein Erdbeben. Zwei tektonische Platten trafen aufeinander: von der einen Seite schob sich die altgediente Lehrkräfteanalyse der Kultusminister heran, von der anderen die frisch errechneten Zahlen der Bertelsmann-Stiftung. Federführend waren Dirk Zorn und der Bildungsökonom Klaus Klemm, der Zorn auch schonmal seinen “wissenschaftlichen Ziehsohn” nennt. Die beiden errechneten, dass der zu erwartende Lehrermangel zigtausendfach größer ist als von der KMK erwartet. Das Thema kletterte erstmals weit nach oben auf die politische Agenda.
“Das hat damals richtig Spaß gemacht”, sagt Dirk Zorn. Denn es sei die erfolgreichste Studie in 40 Jahren Stiftungsgeschichte gewesen. Ein anderes Mal ließ Zorn Wissenschaftler auswerten, in welchen Berliner Bezirken wie viele Quereinsteiger arbeiten. Das Ergebnis: im armen Wedding viele, im reichen Zehlendorf wenige. Und wieder hatte Zorn damit ein bildungspolitisches Beben verursacht.
Das Handelsblatt hat einmal über die Bertelsmann-Stiftung geschrieben, sie belehre Lehrer. Aber, sagt Zorn: “Wir wollen nicht immer nur recht haben, wir wollen relevant sein.” Kaum ein Quartal vergeht, in dem die Gütersloher nicht mit einer Studie in der Hand winken, um ein Thema zu setzen. Die Besserwisser-Stiftung, finden die einen, die anderen erkennen an: Hier wird handwerklich gute Arbeit geleistet.
Dirk Zorn, 50 Jahre, ist Leiter der Bildungsabteilung und vermag es wie wenig andere hierzulande, die richtigen Fragen zu stellen, sie mit Daten zu beantworten – und politisch wie medial gehört zu werden. Empirisch geforscht hat der promovierte Soziologe zuvor in Princeton und Harvard. Weil er Heimweh nach Europa und seiner Familie hatte und ihm das “letzte Quäntchen Besessenheit” gefehlt habe, um sich ganz der Wissenschaft zu widmen, ging er als Unternehmensberater zu McKinsey. Dort baute Zorn, der selbst vier Kinder hat, nebenher eine unternehmenseigene Kinderbetreuung auf und merkte, wie wichtig ihm das Thema Bildung ist. “Da brach der Lehrersohn in mir durch”, sagt er.
Seit 2015 ist Zorn bei der Bertelsmann-Stiftung, mit einem kurzen Intermezzo im vergangenen Jahr bei der Bosch-Stiftung. Aber auch hier zog es ihn zurück. Die Bertelsmann-Stiftung strukturiert ihren Bildungsbereich derzeit grundlegend um, hat zwischen Humboldt-Forum und Auswärtigem Amt in Berlin-Mitte ein neues, prestigeträchtiges Gebäude bezogen. Dort möchte Zorn bildungspolitischen Austausch ermöglichen, der oft verfahren ist zwischen zahlreichen Ebenen. “Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt für große Veränderungen im Bildungsbereich. Denn der Problemdruck war noch nie so immens.”
Das “einfach Machen”, wie er es in den USA kennenlernte, vermisst er in
manchmal. Studien zu veröffentlichen, reiche ihm nicht. Daher schmiedet Zorn Zukunftspläne. Die Stiftung könnte dabei helfen, ukrainische Lehrkräfte für den Einsatz in deutschen Schulen zu qualifizieren. Derzeit arbeite er an möglichen Kooperationen mit Bundesländern und Universitäten. Daneben schwebt ihm ein Leadership-Institut vor. Schulträger, Lehrkräfte, internationale Wissenschaftler – aus verschiedenen Ebenen des Bildungssystems sollen Menschen zusammenkommen, Change Management lernen und Best Practices diskutieren.
Während Zorn im Besprechungszimmer der Stiftung sitzt, das nach kühlem, lederbezogenem Neuwagen riecht, strahlt er die Hands-on-Mentalität eines Unternehmensberaters aus. Jeder Hauptsatz liefert eine relevante Information, jede Aussage scheint durch eine Powerpoint-Folie belegbar. Aber dann kommt ihm doch eine Floskel über die Lippen: “Wir alle, die wir das Bildungssystem gestalten, müssen für zwei Dinge sorgen: für gutes Aufwachsen und gutes Lernen der Kinder.” Um nichts weniger gehe es. Dirk Zorn nimmt man das ab. Niklas Prenzel
07. November 2022, 16:00 bis 18:00 Uhr, online
Digitaler Impuls: Von Preisträgerschulen lernen: Unser Weg zu einer zukunftsorientierten Unterrichtsentwicklung
Dieser Workshop ist der erste von insgesamt fünf, in denen jeweils eine Preisträgerschule des diesjährigen Deutschen Schulpreises über ihre Lernerfahrungen, Erfolge, Hürden und Ausgangspunkte der Unterrichtsentwicklung berichtet. Die bisher geplanten weiteren Termine sind am 10. November, am 14. November und am 17. November. INFOS & ANMELDUNG
08. November 2022, 18:00 bis 19:45 Uhr, Berlin und online
Studienpräsentation und Podiumsdiskussion: Wikimedia: Offen und gerecht – wird die Nationale Bildungsplattform ihr Versprechen einlösen?
Im Anschluss an die Präsentation der Wikimedia-Studie “Werte und Strukturen für die Nationale Bildungsplattform” setzen sich die Diskussionsteilnehmer mit der Frage “Offen und gerecht – wird die Nationale Bildungsplattform ihr Versprechen einlösen?” auseinander. Speakerinnen sind unter anderem Saskia Esken, Marina Weisband und Dr. Johanna Börsch-Supan. INFOS & ANMELDUNG
09. bis 11. November 2022, Leipzig
Kongress: Zukunft Ganztag
Der diesjährige Ganztagsschulkongress steht unter dem Motto “Weiterdenken – Weiterentwickeln – Weitergehen” und will für den Ganztag mit neuen Perspektiven innovative Ansätze schaffen. Dabei sollen verstärkt aktuelle Herausforderungen und notwendige Veränderungen thematisiert werden. Hinweis: Der Kongress ist zwar bereits ausgebucht, eine Registrierung auf der Warteliste ist aber möglich. INFOS & ANMELDUNG
09. November 2022, 10:00 bis 16:00 Uhr, online
Konferenz: Zukunftskongress 2022
Das jährliche Fachforum des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter wird in diesem Jahr zum Zukunftskongress, um den Abschluss des Aktionsjahres “Digitale Bildung – Nachhaltig in die Zukunft” zu bilden. Neben Keynotes und Panels finden zwei Diskussionsrunden zu den Themen “Bildung neu denken?” und “Politik & digitale Bildung – Bremse oder Wegbereiter?” statt. INFOS & ANMELDUNG
09. November 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr, online
Community Call: Potenziale und Grenzen KI-gestützter Technologien und digitaler Medien für die Unterrichtspraxis von Lehrkräften
Einblicke in die Chancen, Möglichkeiten und Grenzen KI-gestützter Lernsysteme liefert in diesem Community Call der Erziehungswissenschaftler Thorben Jansen vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Im Anschluss wird über Modelle für den schulpraktischen Einsatz von adaptiven Lernsettings und KI diskutiert. INFOS & ANMELDUNG
10. November 2022, 10:30 bis 20:00 Uhr, Düsseldorf
Kongress: Deutscher Schulträgerkongress
Ziel des DSTK, dessen Medienpartner Bildung.Table ist, ist vor allem eines: die Entwicklung von zukunftsfähigen Schulen. Dabei geht es um Themen wie modernen Schulbau, qualitätsvollen Ganztag und Bildungsgerechtigkeit. Speaker sind unter anderem Udo Beckmann (Bundesvorsitzender VBE) und Gerd Landsberg (DStGB). INFOS & ANMELDUNG
10. bis 12. November 2022, Düsseldorf
Kongress: Deutscher Schulleitungskongress
Zu den wichtigsten fünf Themenfeldern des DSLK gehören Führung mit Persönlichkeit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Begeisterung mit Schulkultur, Zukunft durch Digitalisierung sowie das Neudenken von Schul- und Unterrichtsentwicklung. Speaker sind unter anderem Eckart von Hirschhausen und Udo Beckmann. INFOS & ANMELDUNG