es ist nur ein Satz, aber er sagt viel aus über die Landesschulminister:innen. Als zwei Kollegen von Bildung.Table in den letzten Tagen 16 Länder befragten, ob sie ihre Schulen angesichts von Omikron für digitales Distanzlernen fit gemacht haben, da reagierte Bayern u.a. so: “Die Entscheidung, welches digitale Kommunikationswerkzeug an der Schule eingesetzt wird, liegt grundsätzlich bei der jeweiligen Schule ggf. unter Einbeziehung des jeweils zuständigen Schulaufwandsträgers.” Oder kurz: Wir sind nicht zuständig, die anderen sind schuld! Lesen Sie im heutigen Briefing und auf unserer Homepage, was Niklas Prenzel und Jan Lubschik alles nicht von den Kultusministern übers Digitale erfahren haben.
Ganz anders Felix Ohswald. Der junge Mann gehört zu den digitalen Bildungsanbietern in Deutschland, die aus dem Stand die Schüler:innen und Lehrkräfte nicht nur digital verknüpfen, sondern auch mit medial aufbereiteten Inhalten versorgen könnten. Ohswald ist Gründer des Nachhilfeanbieters GoStudent – und sein Unternehmen ist seit gestern um 300 Millionen Euro potenter. So viel Geld hat er auf seiner jüngsten Werbetour für Kapital eingeworben. Ich habe Ohswald gefragt, was er mit dem Geld vorhat – und bei der Konkurrenz nachgehört, ob sie schon Angst vor dem Wettbewerber hat.
Bleiben Sie weiter gesund!

Fast 10.000 Schulklassen mussten in Frankreich in den vergangenen Tagen zu Hause bleiben, weil Schüler:innen und Lehrkräfte sich mit Sars-Cov 2 infiziert hatten. Ein Land, das seine Schulen in der bisherigen Pandemie lange offenhielt, wird von der Omikron-Realität eingeholt. Hierzulande bedroht die Virusvariante den Präsenzunterricht zwar noch nicht derart stark, in der vergangenen Woche erhob die KMK offene Schulen zur höchsten Priorität. Doch werden wegen Corona-Infektionen bereits einzelne Klassen nicht mehr in Präsenz unterrichtet. Vor Weihnachten befanden sich bereits zwölf Schulen in Nordrhein-Westfalen im Distanzunterricht, 24 Schulen in Rheinland-Pfalz sind teilweise geschlossen. Wegen der dynamischen Lage sind die Daten dazu dünn, aber sicher ist: Digitale Schule ist noch längst kein vergangenes Kuriosum für die Geschichtsbücher.
Bildung.Table hat die 16 Kultusminister:innen der Länder gefragt, ob sie sich aktuell auf digitalen Distanzunterricht vorbereiten. Zwölf Ministerien antworteten (Berlin, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen blieben eine Antwort schuldig). Die Antwortschreiben spiegeln einen föderalen Flickenteppich aus Lernsoftwares, Fortbildungsprogrammen und Tablet-Käufen wider – und zeigen dennoch einen roten Faden. Die Digitalisierung schreitet nach bald zwei Jahren Pandemie schneller voran. Doch sehen sich die Länder weder von Omikron noch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts getrieben.
Durch ihr Urteil zur Bundesnotbremse hatten die Karlsruher Richter:innen im November den digitalen Schulunterricht geadelt und auf die große Bühne geholt. Das Gericht formulierte ein neues Grundrecht auf (digitale) schulische Bildung. Es wird abgeleitet aus Artikel 2 und 7 des Grundgesetzes (freie Entfaltung der Persönlichkeit. Aufsicht des Staates über das Schulwesen). Zum Zwecke des Infektionsschutzes seien Schulschließungen rechtens gewesen, weil die Kultusminister Distanzunterricht angeboten haben. Was das BVerfG mit Blick auf mögliche künftige Schulschließungen betonte: Wer digitales Lernen nicht vorbereitet, darf keine Schulen schließen. Bildung.Table berichtete. Für die digitale Schulbildung war das Urteil ein progressiver Pauken-, für die Kultusministerien der Länder wohl eher ein drohender Donnerschlag.
Kein Kultusminister hat seine Vorbereitungen für digitalen Distanzunterricht durch das Karlsruher Urteil erheblich intensiviert. Dabei mahnt das Gericht, dass Distanzunterricht “qualitativ hochwertig” erfolgen müsse. Ob diese Qualität heute flächendeckend erreicht würde, darf zumindest bezweifelt werden. Zur Erinnerung: Immerhin 25 Prozent der Schüler:innen hatte während der Schulschließungen Anfang 2021 täglichen gemeinsamen Distanzunterricht. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie hatte aber immer noch jeder fünfte Schüler überhaupt keinen gemeinsamen Distanzunterricht. Das zeigte eine ifo-Studie. Nun aber, ein weiteres Jahr ist vergangen, sehen sich die Kultusminister der Bundesländer weit fortgeschritten und gut vorbereitet auf Distanzunterricht. Aus Sachsen heißt es dazu selbstsicher: “Die Voraussetzungen für einen ggf. erforderlichen Distanzunterricht (sind) bereits vor dem Urteil geschaffen worden.” Ähnliche Antworten liegen Bildung.Table aus Süd-, Nord- oder Westdeutschland vor.
Die Länder verweisen auf ihren steten Fortschritt bei der Anschaffung von Leihgeräten und Lernsoftware. Die Ministerien kauften Zehntausende mobile Leihgeräte; nach anfänglichem Stocken fließen die Mittel des Digitalpakts. 100 Schüler:innen teilen sich in Deutschland durchschnittlich etwa 25 mobile Endgeräte. Das geht aus den Zahlen hervor, welche die Ministerien Bildung.Table zur Verfügung stellten. In Nordrhein-Westfalen sind es 36, in Hamburg 25, in Rheinland-Pfalz 21. Wobei einige Bundesländer wie Thüringen oder Bremen die Anzahl der Endgeräte mit Verweis auf die Zuständigkeit der Schulträger und Kommunen nicht nennen. Hier eine Übersicht über die Antworten der Bundesländer.
Auch Fortschritte im Angebot von Lernmanagementsystemen (LMS) sind zu verzeichnen. Im internationalen Vergleich setzten 2018 bereits 51 Prozent der Lehrkräfte LMS im Unterricht ein; in Deutschland waren es nur 12 Prozent. Corona hat hier einen Schub gebracht. 58 Prozent nutzen LMS im Unterricht, das ergab die “Digitalisierung Schule”-Studie der GEW im vergangenen Sommer. Gegenüber Bildung.Table können die Bundesländer mittlerweile auf ihre eigenen LMS verweisen und betonen, dass sie Lehrkräfte darin schulen. In Bayern müssen Lehrkräfte fünf Module zur digitalen Bildung verpflichtend belegen. Hamburg schmückt sich mit über 3.000 durchgeführten Fortbildungen und mehr als 50.000 teilnehmenden Lehrer:innen zur “Erhöhung der digitalen Handlungssicherheit”.
Reichen all diese Maßnahmen, die schon seit vielen Monaten laufen, um angemessenen Distanzunterricht zu gewährleisten, wie ihn das Bundesverfassungsgericht auf der einen und bald vielleicht schon die Pandemielage auf der anderen Seite fordern? Der Staatsrechtler Sebastian Piecha interpretiert das Karlsruher Urteil als Aufforderung zu “echte(m) Digitalunterricht statt bloßer Bereitstellung von Materialien, gleiche(r) Teilhabe hieran auch für sozial Schwächere, besondere(n) Regelungen für Abschluss- und Förderklassen”.
Bildung.Table hat die Bildungsministerien nach einem Schreiben gefragt, in dem sie beispielsweise die Schulen – in Folge des Urteils – darum bitten, im Unterricht regelmäßig LMS und Schulclouds einzusetzen. Kein Bundesland antwortete darauf. Aus Schleswig-Holstein kam der Hinweis auf sein Rahmenkonzept für das laufende Schuljahr. “Schulen entwickeln ein zukunftsorientiertes Schulentwicklungskonzept dazu, wie der Transformationsprozess zu einer Schule, die in einer Kultur der Digitalität lernt und lehrt, gestaltet wird.” Es ist ein verklausuliertes, aber klares Bekenntnis zu einer digitalen Schulentwicklung.
Nach der Auswertung der zwölf Antwortschreiben aus den Kultusministerien bleibt der Eindruck, dass man sich im Schatten des BVerfG-Urteils und neuen Distanzunterrichts zwar emsig bemüht, bei der digitalen Bildung aufzuholen und auf den Dreiklang “Leihgeräte, Lernsoftware, Lehrerbildung” setzt. Der neue, revolutionäre Rechtsgrundsatz eines “Rechts auf schulische Bildung” und wie es in einer Pandemie zu verwirklichen ist: Das spielt in den Kultusministerien derzeit aber kaum eine Rolle.
Auf dem europäischen Bildungsmarkt entsteht ein neuer Gigant. Der österreichische Bildungsanbieter GoStudent, der in halb Europa Nachhilfe erteilt, ist mit seiner neuesten Kapitalakquise satte drei Milliarden Euro wert. Man wolle künftig auch in außereuropäischen Märkten wachsen und suche nach Übernahmekandidaten, hieß es aus dem Unternehmen. Der Anbieter hatte bereits im Juni letzten Jahres 200 Millionen Euro bekommen. Die Konkurrenten unter den Startups gratulierten GoStudent für den Erfolg auf dem Finanzplatz. Beobachter warnten aber auch davor, dass die Geschwindigkeit des Wachstums zu groß sein könnte. “Das ist eine gefährliche Wette auf die Zukunft, dass es immer so rasant weitergeht”, hieß es.
Das Angebot von GoStudent ist eigentlich kein technologisches Hexenwerk. Statt einer analogen Nachhilfe sitzen sich bei GoStudent Nachhilfelehrkraft und Schüler:in in einer Videokonferenz gegenüber. Zeitweise experimentierte GoStudent mit einer künstlichen Intelligenz, welche die Emotionen der Nachhilfe-Schüler während des Lernens analysierte. GoStudent ist rein zahlenmäßig nicht der größte Anbieter in Deutschland, hat sich aber innerhalb von zwei Jahren erheblich gesteigert. Inzwischen gibt GoStudent mit seinen Lehrern auch in Spanien, Frankreich, Großbritannien, Russland und Mexiko und einigen weiteren Staaten Nachhilfe.
GoStudent erteilte keine Auskünfte darüber, wie hoch die einzelnen Anteile der Investoren Prosus, Tencent und Deutsche Telekom an den 300 Millionen Euro Kapitalzufuhr sind. Auch die Telekom verweigerte auf Nachfrage, die Höhe ihres Investments zu nennen. Es gehe um eine strategische Beteiligung, sagte ein Sprecher, die aus einem Innovationsfonds des Unternehmens stamme.
In der Bildungsszene dürfte die Aktion der Telekom nicht nur Applaus bringen. Die Telekom hatte einst mit “Schulen ans Netz” ein frühes Lernmanagementsystem aufgebaut, das um das Jahr 2000 immerhin bereits an 10.000 Schulen installiert war. Dann stieg die Telekom aus – und das LMS wurde jedes Jahr weniger gepflegt, bis es kürzlich von dem späteren Käufer Cornelsen eingestellt wurde. Telekom-Manager fielen seither dadurch auf, dass sie die Qualität und die technologische Rückständigkeit des deutschen Bildungssystems kritisierten. Sich nun mit unter 10 Millionen Euro an einem Online-Nachhilfeunternehmen zu beteiligen, löst gewiss keinen technologischen Quantensprung aus.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisierte den neuen mächtigen Anbieter. “Ein wachsender privater Nachhilfebereich verschärft die soziale Spaltung zusätzlich”, sagte die Sprecherin des Vorstandsbereichs für Schule, Anja Bensinger-Stolze Bildung.Table. Eine ganze Industrie schlage daraus Profit. “Ich befürchte, dass die sogenannten Corona-Aufholprogramme teilweise zur Gelddruckmaschine für die private Nachhilfebranche werden”. In der EdTech-Szene gab es viel Beifall für die gelungene Akquise. Es sei gut, dass es einen so erfolgreichen Wettbewerber auch auf dem deutschen Markt gebe. “Chapeau, Felix Ohswald”, sagte ein Sprecher der Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter.
Auch die FDP begrüßte das Investment. “Dass das Start-up Go Student 300 Millionen Euro von namhaften Investoren erhalten hat und mit drei Milliarden Euro bewertet wurde, zeigt, dass es einen großen Bedarf an digitalen Lösungen in der Bildung gibt”, sagte die bildungspolitische Sprecherin der FDP Fraktion, Ria Schröder. Junge Unternehmen entwickelten kreative Lösungen, die zukunftsorientiert und erfolgversprechend seien. “Sie zeigen damit, dass auch der öffentliche Bildungsbereich eine Digitaloffensive benötigt, um unsere Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern”, so Schröder.
Analysten äußerten sich nur im Hintergrund. Sie beschrieben das Geschäftsmodell von GoStudent als nur einen Weg erfolgreichen Wachstums auf dem Bildungsmarkt. Felix Ohswald habe als junger und forscher Macher Schumpeterscher Provenienz den Weg des schnellen Sprungs nach vorn gewählt. Diesen Weg könne man aber nicht dauerhaft mit organischem Wachstum beschreiten. Die Investoren erwarteten fortgesetzte Wachstumsraten, die man dann nur durch Übernahmen schaffen könne. Ohswald sagte im Interview mit Bildung.Table, es seien in naher Zukunft Akquisitionen zu verkünden – im nahen europäischen Ausland. “Ohswald ist zum Wachstum verdammt”, hieß es in der Bildungsszene.

Herr Ohswald, was bedeutet die Akquisition von weiteren 300 Millionen Euro für GoStudent?
Ich glaube, es braucht solche positiven Geschichten, damit mehr Leute im Bildungsbereich etwas gründen.
Meinen Sie nicht, dass jetzt einige andere Start-ups Angst haben?
Nein. Dafür ist der Markt viel zu differenziert. Es gab in Indien in den vergangenen Jahren ein sehr erfolgreiches Bildungsunternehmen, Byju‘s, über das man immer gestaunt hat, auch in China ist das passiert. Schön, dass jetzt auch Europas Bildungsanbieter gutes Geld für gute Arbeit bekommen.
Bitte konkret, wer wäre für GoStudent jetzt interessant? Kämen nicht prinzipiell die führenden Bildung-Start-ups in Deutschland infrage: Sofatutor, Simpleclub oder Bettermarks?
Das sind alles drei coole Plattformen. Mit Bettermarks arbeiten wir über unsere Nachhilfelehrer sogar zusammen. Das ist eine schöne Synergie im pädagogischen Bereich. Es stellt sich natürlich immer die Frage, wo langfristig der Synergieeffekt einer Akquisition liegt.
In welchen Bereichen sollte der nun sein?
Content ist immer spannend, also das, was Sofatutor oder Simpleclub machen. Wir schauen uns ja aktuell auch im Markt einiges an. Wir haben Akquisitionen in der Pipeline, die bald verkündet werden.
In Deutschland, in Europa oder wo?
Momentan tatsächlich mehr außerhalb Deutschlands, in Spanien, in Großbritannien und in Frankreich. Da sind unsere Schwerpunktgebiete.
Manche haben Angst – und die anderen sind wütend. Die Pädagogen werden sagen, Bildung ist doch nicht Geld, Bildung ist Qualität und ein roter didaktischer Faden.
Ja, aber das ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Bildung ist nicht per se kostenlos. Jeder, der in Deutschland Steuern zahlt, bezahlt ja eben auch für Bildung – und zwar gar nicht wenig. 12.000 bis 14.000 Euro fließen pro Kind und Jahr in die Schule. Da wird also richtig viel Geld von uns Steuerzahlern ausgegeben – und es gibt nicht viele andere Bereiche, wo genauso viel Staatsgeld hineinfließt.
Wie geht das in Zukunft weiter?
In Zukunft wird das regulierte Bildungsangebot des Staates am Vormittag mit den privaten Angeboten des Nachmittags verknüpft werden. Das wird dann ein bisschen wie im öffentlichen Straßenverkehr aussehen. Der Staat baut Straßen und stellt Schienen und so weiter zur Verfügung – und darauf bewegen sich dann Autos, Eisenbahnen, Fahrräder und so weiter. Das bedeutet, die Innovation bringt jemand anderes auf die Straße.
Sind wir nicht schon weiter? GoStudent, Simpleclub und andere sind ja nicht nur Anbieter von “Autos”, sondern sie bieten eine digitale Infrastruktur an, die der Staat gar nicht zur Verfügung stellen kann. Kurz: Sie und andere könnten Schüler und Lehrer im Falle einer Schulschließung verknüpfen.
Ich hoffe inständig, dass es keine Schulschließungen geben wird. Das wäre per se schlecht. Dann geht die Schere zwischen denen, die Geld haben, und denen, die benachteiligt sind, noch weiter auseinander.
Sie sind vorbereitet auf digitalen Distanzunterricht – die Bundesländer sind es nicht.
Wir sind auf Einzelunterricht spezialisiert. Das ist noch mal etwas anderes als das Setting einer Klassengruppe. Aber natürlich, wenn wir in einer Krisensituation gebraucht werden, dann könnten wir das.
Was wollen Sie mit dem Geld strategisch anfangen? Warum diese Partner, zum Beispiel Prosus?
Prosus ist inzwischen ein großes Unternehmen, das schwerpunktmäßig auch in Bildung investiert. Für uns ein Partner, bei dem wir uns darauf verlassen können, dass der nicht bei der erstbesten Opportunität sagt, wir wollen unser Invest ausbezahlt bekommen.
Und Chinas Tencent? Sie wissen, dass die Deutschen bei Investitionen aus China zurückhaltend sind – und obendrein Angst vor Überwachung haben?
Die Kapitalflüsse sind bei Start-ups immer global. Und nur weil wir jetzt mit Tencent einen – übrigens sehr kleinen – Investor haben, der aus China kommt, braucht niemand Angst haben, dass wir irgendwelche Daten abfließen lassen. Niemand will in einem überwachten Klassenzimmer sein. Ich schon gar nicht.
Learning analytics findet auch bei Ihnen längst statt.
Es ist heute auch wichtig, dass man eine genaue Diagnose des Lernverhaltens des Schülers leisten kann. Natürlich halten wir uns an den Datenschutz. Aber ohne Diagnose keine echte Lerntherapie.
Warum wäre das falsch?
Ich finde es wichtig, messbar zu machen, welcher Unterricht welche Wirkungen hat – und das dann auch wirklich auszurollen und zu nutzen. Wir müssen die Lehrer, die sehr gut unterrichten, in den Mittelpunkt rücken, die sollen mehr verdienen, das sollen die Superstars werden.
Welche Erfahrungen haben Sie in der Corona-Zeit gemacht?
Für uns hatte die Pandemie durchaus negative Konsequenzen. Es war sofort ein Einbruch bei den Nachfragen zu beobachten. Ich habe das als eine überfordernde Situation für alle erlebt. Es gab keine Prüfungen, es fanden keine Examen statt, es war weniger Druck in der Schule.
Wann hat sich das wieder verändert?
Im Moment der Schulöffnungen ist das sofort wieder auf ein normales Niveau zurückgegangen. Dann haben die Eltern wieder daran gedacht, wie sie ihren Kindern mit unseren Lehrern helfen können. Weil wieder regulärer Unterricht stattgefunden hat.
Und was war positiv?
Dass die Pandemie eine Bewusstseinsveränderung hervorgebracht hat. Es war für jeden ganz normal, Zoom-Meetings und Videokonferenzen zu veranstalten. Das war vorher schon fast nischig gewesen.
Sie hatten bei der Pandemie dem Staat Hilfe angeboten. Hat er die angenommen?
Nein, da hat sich niemand gemeldet.
Auch nicht, um sich mit Felix Ohswald und den anderen Start-ups zu beraten?
Ist nicht passiert.
Haben Sie schon mal in Deutschland einen Kultusminister persönlich kennen gelernt?
Nein, dieses Vergnügen hatte ich leider noch nicht.
Ist es in Ordnung, die digitalen Bildungsanbieter gar nicht erst zu empfangen?
Also mir geht es darum, Lösungen zu finden. Und wenn mich niemand empfängt, dann macht es keinen Sinn, Monate lang darüber zu lamentieren und offene Briefe zu schreiben.
Wie beurteilen Sie die deutsche Schulpolitik?
Im internationalen Vergleich haben Kinder in Ländern wie Deutschland oder Österreich Zugang zu einer qualitativ sehr hochwertigen Bildung. Der Bildungszugang ist frei und die Chancengerechtigkeit in Deutschland hat sich für Kinder aus Nichtakademikerfamilien in den letzten Jahren über alle Bildungsstufen verbessert. Mich bewegt aber auch die Frage: was kann man tun, um es zu verbessern?
Was wäre das?
Das kann man gut an einem Ort in Brasilien beobachten, der Ceará heißt. Dort hat man höchsten Wert auf die Qualität der Lehrer gelegt, in dem man sie bewusster ausgewählt und besser bezahlt hat. Ich bin ein Fan dieses Modells! Das gilt übrigens auch für die Lehrleistungen. Es kann nicht sein, dass eine Lehrkraft deswegen besser bezahlt wird, weil sie mehr Jahre im Schuldienst verbracht hat. Die Ergebnisse ihrer Klassen und Schüler müssen im Mittelpunkt stehen.
Ceará ist weit weg.
Ja, aber das interessanteste war folgendes: Die haben Schulklassen zusammengelegt und die Lehrer, die nicht gut performt haben, aus dem Schuldienst befreit. Das heißt, eine Lehrerin oder ein Lehrer, der richtig gut ist, hat dann zum Beispiel nicht 20, sondern 60 Kinder unterrichtet.
… 60 Kinder, das ist ja aufregend!
Mit den richtigen Lehrern und Konzepten sind neue Modelle möglich. Man muss nur offen für Innovationen sein!
Wie findet GoStudent auf einem leergefegten Lehrerarbeitsmarkt die besten Lehrer?
Wir suchen ja nicht nur klassische Lehrer, sondern zum Beispiel Studierende der Mathematik, die Lust haben, nebenher Nachhilfe zu geben.
Ein pädagogisches Studium ist dabei mindestens hilfreich.
Darüber lässt sich diskutieren. Ich lerne gutes Unterrichten meines Erachtens nicht, indem ich eine Vorlesung über gutes Unterrichten besuche.
Wie finden Sie und Ihre Unternehmen heraus, wer für Ihre Zwecke ein guter Lehrer ist?
Wir prüfen drei Dinge: erstens das Fachwissen. Versteht jemand etwas von Mathematik? Ist jemand mindestens auf Abiturniveau in dem Fach? Zweitens pädagogische Fähigkeiten: Kannst Du ein komplexes Thema einfach und in kurzen Sätzen erklären? Und drittens, einen polizeilichen Background-Check, ob ein Bewerber wirklich mit Kindern arbeiten darf.
Können Sie garantieren, dass das funktioniert? Angeblich kann man bei Ihnen zumindest den Test 1 und 2 bestehen – auch wenn man da gar nicht so gut ist.
Wir verbessern und optimieren dieses System fortlaufend.
Eine Frage noch: Wie viel Geld bekommen Sie von der Deutschen Telekom?
Es handelt sich um einen mittleren siebenstelligen Betrag.
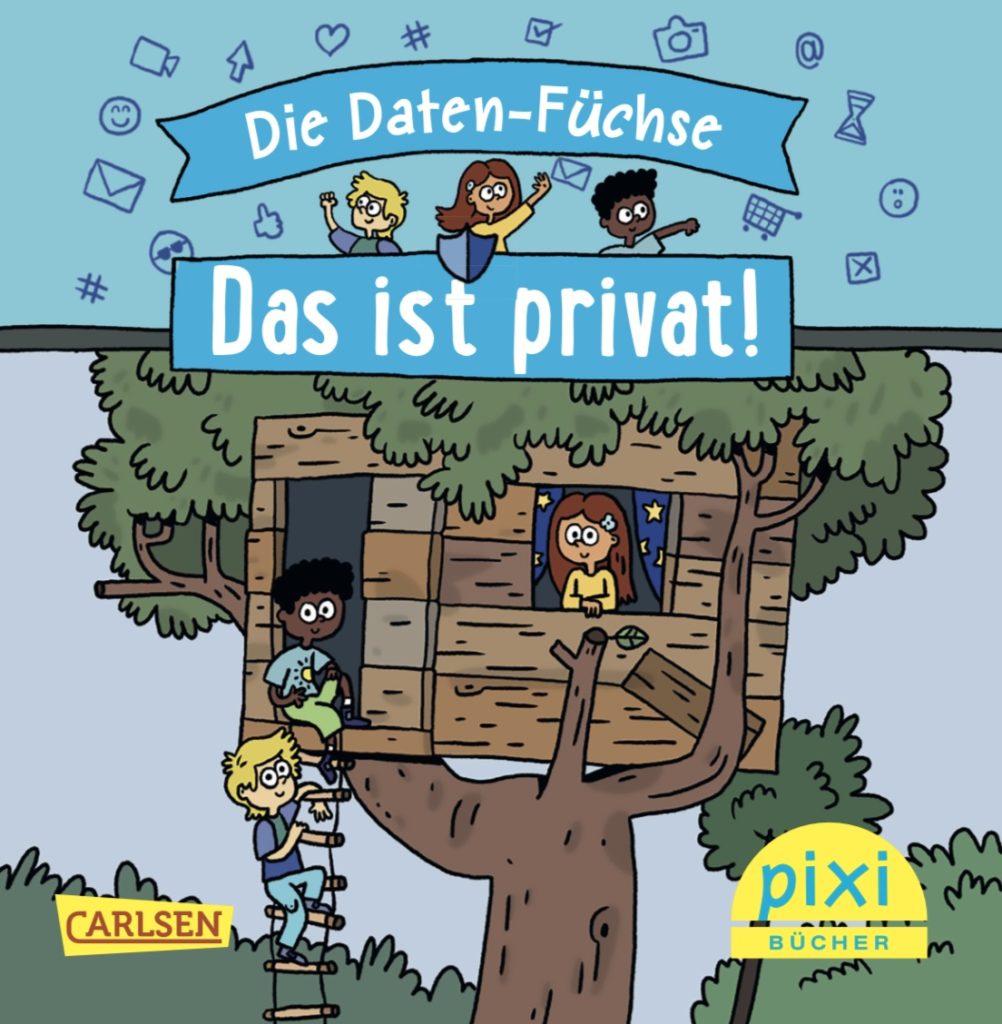
Ein Kind schnappt irgendwo das Wort “privat” auf und weiß nicht, was es bedeutet. Deshalb sucht es zu Hause nach seinem Vater, um ihn danach zu fragen. Ungestüm platzt das Kind ins Badezimmer, während sich der Vater auf der Toilette befindet. “Kann man denn nicht mal im Bad seine Privatsphäre haben!”, schimpft er und scheucht das Kind wieder hinaus. Nun beginnt das Kind zu verstehen, wofür “privat” steht.
Diese kleine Geschichte stammt aus dem neuen Kinderbuch “Die Daten-Füchse – Das ist privat!”. Das Buch erschien im Dezember zusammen mit einem weiteren Pixi-Band: “Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?” Der Bundesdatenschutzbeauftragte veranlasste die kostenlose Herausgabe beider Werke mit der Absicht, digitale Aufklärungsarbeit für Kinder verständlich zu betreiben. In mehreren, unterschiedliche Erzählformen werden allerlei Informationen rund um Privatsphäre, Cybersicherheit und Onlineverhalten eingeflochten. Die Idee dahinter ist, die Kinder zunächst mit kreativen Alltagsgeschichten und dazu passenden Bildern anzufixen. Ist deren Aufmerksamkeit erst einmal gewonnen, lernen sie quasi von selbst alles Wissenswerte, was es als Laie über Datenschutz zu wissen gibt. Dementsprechend präsentiert die Autorin die Fakten auch möglichst kindgerecht. Außerdem werden die Pixi-Bücher kostenlos vom BfDI angeboten, um möglichst viele Kinder erreichen zu können. Jeder kann auf der Website des BfDI jeweils ein kostenloses Exemplar bestellen.
Der Aufbau der Pixi-Bücher unterscheidet sich: In “Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?” werden diverse Alltagssituationen von Kindern geschildert, in denen Fachbegriffe wie “Daten” oder “soziale Netzwerke” erwähnt werden. In den meisten Fällen erfolgt dann eine exakte, kindgerechte Erklärung auf der jeweiligen Folgeseite. “Die Daten-Füchse – Das ist privat!”, widmet sich hingegen vollkommen der Bedeutung von Privatsphäre. Der Datenschutz wird darin nicht einmal erwähnt. Während das erste Buch Leser schon im Grundschul- und fortgeschrittenen Schulalter erreichen soll, richtet sich das zweite Buch nach Verlagsangaben vor allem an Kindergartenkindern. In einer durchgehenden Handlung treffen die jungen Protagonisten immer wieder auf das Wort “privat”. Neugierig erkundigen sie sich nach dessen Sinn. Nachdem sie dessen Stellenwert schlussendlich verstanden haben, verwenden sie das Wort ab sofort selbst.
Damit Kinder die Handlungen verstehen können, hat der Bundesdatenschutzbeauftrage die sachkundige Kinderbuchautorin Tina Blase engagiert. Durch ihre langjährigen Erfahrungen weiß sie, wie man die jüngere Generation anspricht, obwohl Blase selbst von sich sagt, dass sie keine Expertin für das Thema Datenschutz sei. Alles, was die beiden Pixi-Bücher zum Datenschutz betrifft, habe sie in Zusammenarbeit mit Experten des BfDi entwickelt.
Nach der Analyse der Medienpädagogin Jessica Wawrzyniak von Digitalcourage ist insbesondere das Buch “Die Daten-Füchse – Das ist privat!” für Kinder hervorragend geeignet. “Die verwendeten Wörter sind sehr kindgerecht und die Geschichte ist einfach wunderbar. Auf diese Weise versteht ein Kind recht einfach, was es mit ‘Privatsphäre’ auf sich hat.” Das andere Buch “Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?” weise hingegen ein paar Mängel auf. Zu viele Informationen würden auf zu wenigen Seiten behandelt. So würden die Fakten teilweise verkürzt dargestellt.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Datenschutzexperte Jochim Selzer vom Chaos Computer Club. Auch er begrüßt die Initiative des Bundesdatenschutzbeauftragten. “Die Herangehensweise ist sehr angemessen. Kindern wird gezeigt, dass Datenschutz nichts Böses ist.” Stattdessen seien die Erklärungen von Privatsphäre durch die Geschichten überaus einleuchtend, da Kindern so die Verhaltensregeln für ein funktionierendes Zusammenleben direkt vor Augen geführt werden. “Ich gehe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Pixi-Bücher funktionieren werden. Ich bin positiv überrascht, dass so ein trockenes Ministerium solche Kinderbücher schreiben lässt. Der Bundesdatenschutzbeauftragter Kelber betreibt wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit. Seit er das Amt übernommen hat, habe ich einige Veränderungen bemerkt”, lobt Selzer.
Offenbar schaffen es diese beiden Bücher, ein hochkomplexes Thema wie Informationstechnologie und Datenschutz so darzustellen, dass es sogar für Kleinkinder verständlich wird. Inhaltlich und ästhetisch überzeugen sie Fachleute, aber auch Laien. Allerdings kratzen diese Kinderbücher lediglich an der Oberfläche des Fachgebiets. Auf nur 30 Seiten pro Buch ist die Zahl der thematisierten Sachverhalte begrenzt. Die Pixi-Bücher bieten einen guten Ansatzpunkt, um unerfahrene Kinder zum ersten Mal mit den Themen Privatsphäre und Sicherheit im Netz zu konfrontieren. Jan Lubschik
Blase, Tina/Hellmeier, Horst: Die Daten-Füchse – Das ist privat!, Carlsen K, Hamburg, 2021,
Blase, Tina/Hellmeier, Horst: Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?, Carlsen K, Hamburg, 2021. Exklusive Ausgaben für den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Visualisierungen wie Bilder und Videos helfen beim Lernen am meisten. Das sagen etwa 57 Prozent der befragten Schüler in einer Umfrage von Simpleclub zu Lernmethoden. 46,2 Prozent bevorzugen einen Mix aus Schulbuch, Aufgabenheften und Inhalten. Anlässlich der baldigen Halbjahreszeugnisse in vielen Bundesländern führte die Lernplattform Simpleclub eine Umfrage unter knapp 1.500 Nutzenden durch. Sie soll zeigen, wie Schüler der Generation “Digital Native” lernen und ob sie noch mit Heften und Büchern arbeiten. Die Umfrage wurde von Schüler:innen der Klassen 7 bis 13 beantwortet. Von den Befragten besuchen knapp 82 Prozent ein Gymnasium.
Wann Schüler mit dem Lernen vor einer Klausur beginnen, hängt stark von ihrem Alter ab. In der siebten Klasse fangen noch 38,3 Prozent der Befragten ein bis zwei Wochen vorher an. In Jahrgang dreizehn fällt diese Zahl auf 17,3 Prozent. Gleichzeitig steigt die Anzahl derer, die erst wenige Tage vorher beginnen, von 25 Prozent in der siebten Klasse auf knapp 39 Prozent im letzten Schuljahr. Schüler nutzen Simpleclub insbesondere vor Klausuren zum Lernen: 49,3 Prozent gaben an, das Portal am meisten vor Prüfungen zu nutzen. 36,4 Prozent nutzten es “immer mal wieder“. Jeder fünfte Realschüler nutzt Simpleclub das ganze Schuljahr über konstant – ein Wert fast doppelt so hoch wie unter Gymnasiasten.
Genau wie der Lernbeginn vor Prüfungen ist auch die Tageszeit des Lernens abhängig vom Alter. Nur 15 Prozent der Siebtklässler lernen gerne abends, 51,7 Prozent lernen direkt nach der Schule, nach dem Motto: “Dann habe ich es hinter mir”. Mindestens 35 Prozent der Befragten der Jahrgänge acht und aufwärts hingegen lernen vorzugsweise abends. Simpleclub wollte zudem wissen, welche Funktionen Nutzende am meisten verwenden und wie sie die Plattform nutzen. Mit 39,3 Prozent der Befragten ist hier die Option “Ich schaue mir generell immer alles zu einem Thema an – Videos, Zusammenfassungen etc. und mache dazu alle Übungen” mit Abstand die beliebteste. Auf Platz zwei (28 Prozent) folgt “Ich schaue vor allem die Videos“.
Gefragt danach, wie Schüler Simpleclub im Vergleich zum Schulmaterial nutzen, gaben mehr als 50 Prozent an, es sei eine Ergänzung ihrer Lernmethode. Ein Viertel schaue nur noch vor Klausuren auf die Schulmaterialien und lerne sonst mit Simpleclub. Mehr als 13 Prozent der Realschüler sagten, sie lernten nur noch mit Simpleclub. Das ist ein hoher Wert im Vergleich zu Befragten anderer Schulformen, unter denen 8 Prozent ausschließlich auf die Lern-App setzen.
Die Umfrage zeigt, dass sich das Lernverhalten von Schülern über das Alter verändert, insbesondere ihr Zeitmanagement. Schulmaterialien wie Bücher und Aufgabenhefte sind keineswegs ein rotes Tuch für Digital Natives. Sie kombinieren vielmehr gerne verschiedene Lernformen miteinander – sei es zur Wiederholung von Schulstoff oder als erster Zugang, der dann mit digitalen Methoden gefestigt wird. Insgesamt aber ist das digitale Lernangebot aus den Methoden der Befragten nicht mehr wegzudenken. Robert Saar
Diese Studie über Suizidversuche schien ein starkes Argument zu sein: Der Leiter der Essener Kinder-Intensivstation Christian Dohna-Schwake hatte gemutmaßt, dass allein von März bis Mai 2021 insgesamt 500 Kinder einen Suizidversuch unternommen hätten. Nun stellt sich heraus, dass die Studie noch gar nicht veröffentlicht ist. Überdies ist in dieser Untersuchung die Zahl der Kinder, die sich das Leben hätte nehmen wollen, mit 93 beziffert. Die Zahl 500 ist eine Hochrechnung auf alle Kinder-Intensivstation in Deutschland. Professor Dohna-Schwanke hatte die Schulschließungen mit den Suizidversuchen in Verbindung gebracht. Der zweite Lockdown der Schulen habe sich hingezogen wie Kaugummi, sagte Dohna-Schwake. Es sei anzunehmen, “dass da Kinder, die vielleicht auch schon depressiven Verstimmungen gelitten haben, dann eben gedacht haben, ok, das ist jetzt mein Hilferuf. Ich muss da irgendwie rauskommen.” Der Professor berief sich dabei “auf den gesunden Menschenverstand.”
Der Leipziger Kinderpsychologe Julian Schmitz übte nun gegenüber Bildung.Table Kritik an der Suizidstudie. Schmitz rät davon ab, Suizidversuche von Kindern oder Studien darüber in der Debatte für oder gegen Distanzunterricht zu instrumentalisieren. Die einzige echte valide Interpretation sieht Schmitz hierin: Kinder und Jugendliche, die unter Vereinsamung gerade in der Corona-Zeit litten, “haben oft keinen oder keinen leichten Zugang zu psychosozialer Versorgung.”
Dohna-Schwake hatte in einem Podcast von der dramatischen Erhöhung von Suizidversuchen unter Jugendlichen wegen des Lockdowns berichtet. Im Vergleich zum Jahr 2019 (37 Fälle) seien die 93 möglichen Selbsttötungsversuche, die er gezählt hatte, eine Steigerung von 300 Prozent. Im ersten Lockdown Anfang 2020 war die Zahl der Suizidversuche sogar zurückgegangen. Dohna-Schwanke hatte auch da eine Studie begonnen – sie dann aber abgebrochen, weil sich zwei Suizidversuche als unbeabsichtigte Fensterstürze herausgestellt hatten. Die noch nicht veröffentlichte Studie des Essener Professors hatte ein massives Presseecho ausgelöst. Eine Zeitung hatte fälschlicherweise getitelt: “500 Kinder nach Suizidversuchen auf Intensivstation”. Eine derart effekthascherische Berichterstattung bei Suiziden ist gefährlich und verstößt gegen den Pressekodex. Man nennt dies den so genannten Werther-Effekt: berichtet die Presse vermehrt über Suizide, steigt die Zahl der Selbsttötungen. Auf eine Anfrage von Bildung.Table reagierte Dohna-Schwake bis Redaktionsschluss nicht.
Der Leipziger Psychologe Professor Julian Schmitz zweifelt nicht die Validität der Suizidversuchs-Erhebung seines Kollegen Dohna-Schwake in Essen an. “Es kommt aber darauf an, wie man die Daten interpretiert – und welche Konsequenzen man empfiehlt.” Eine gerade veröffentlichte Studie aus Basel zeige zum Beispiel, dass die Schule und der Präsenzunterricht nicht unbedingt gegen Depressivität und suizidalen Neigungen helfen. “Im Gegenteil, schulischer Druck ist Teil des Problems. Hoher Leistungsdruck ist an sich schwierig, in Kombination mit der Vereinsamung und der Verunsicherung der Schüler durch Corona kann er gefährlich werden”, sagte Schmitz. Der Professor an der psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche in Leipzig fordert von Lehrern, die Präsenz an Schulen nicht dazu zu benutzen, noch eine Prüfung nach der anderen durchzubringen. cif
MINT-Studierende sind größtenteils zufrieden damit, wie ihr Studium im Krisenmodus läuft. Das zeigt eine Befragung des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) unter 5.850 Masterstudierenden der Fächer Mathematik, Informatik und Physik aus Deutschland und Österreich. Schlechter bewerteten sie die Zugangsmöglichkeiten zu studienrelevanter Infrastruktur. Ein Großteil wünscht sich eine Kombination aus Präsenzlehre, digitalen Mitteln und Blended Learning. Die Daten wurden im August letzten Jahres erhoben und sind als Schulnoten abgebildet. Die Erhebung ist die dritte des CHE zum Studium in der Coronavirus-Pandemie und Teil des CHE-Masterrankings.
Obwohl dieses Mal nur Masterstudierende aus MINT-Fächern befragt wurden, findet Nina Horstmann vom CHE, dass sich die Daten auf Studierende in Deutschland generalisieren lassen – denn zwei vorherige Erhebungen des CHE kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie hatten denselben Fragebogen genutzt, den im Sommersemester 2020 über 6.774 Wirtschafts-Masterstudierenden und im Wintersemester 2021 rund 27.000 Studierende, darunter vorwiegend Bachelorstudierende oder Studiengänge mit Staatsexamen, beantwortet hatten.
Von den befragten Masterstudierenden der aktuellen Erhebung bewerten 77 Prozent den Umgang ihrer Hochschule mit der Pandemie positiv (Note 1 und 2), 81 Prozent bewerten das Informationsmanagement ihrer Hochschule positiv. Ähnlich gut bewerten sie die “Möglichkeiten zum Kontakt und zum fachlichen Austausch mit Lehrenden” (74 Prozent positiv), die “Erreichbarkeit von zentralen Ansprechpersonen” (81 Prozent positiv) und das digitale Feedback der Lehrenden (71 Prozent positiv). Weniger gut bewerteten die Studierenden die Möglichkeiten zum Austausch untereinander. Zwar gaben 55 % die Schulnoten 1 oder 2, doch auch 14 Prozent die Noten 5 oder 6.
Mit ihren Studienbedingungen sind die Masterstudierenden sehr zufrieden – bis auf einen Aspekt, den das Internet nur schwer ersetzen kann: studienrelevante Infrastruktur. 27 Prozent der Studierenden sind nicht zufrieden (Noten 4 bis 6) mit dem Zugang zu Bibliotheken, Lernräumen und Laboren. Positiv bewerteten sie hingegen die “Möglichkeiten zum Ablegen von Prüfungsleistungen” (83 Prozent) und die “Möglichkeit, das Studium wie geplant fortzusetzen” (84 Prozent positiv).
Nina Horstmann ergänzt gegenüber Bildung.Table, dass Studiengänge mit wenig oder keinen praktischen Anteilen in der Pandemie klar im Vorteil sind. “Praktische Lehrveranstaltungen sind im digitalen Format nahezu unmöglich”, sagt Horstmann. Dies treffe vor allem die medizinischen Fächer, weil “der Unterricht am Patientenbett nicht durch Online-Formate zu ersetzen ist.”
Sehr gut bewerten die Masterstudierenden die digitalen Lernformate während der Pandemie, kritisieren aber die Begeisterungsfähigkeit ihrer Dozierenden. 20 Prozent bewerten diese mit einer Schulnote von 4 bis 6. Besser schneiden ab: die “Vielfalt digitaler Lehrformate” (82 Prozent positiv), die “technischen Rahmenbedingungen für digitale Lernveranstaltungen” (83 Prozent positiv), das digital-didaktische Konzept der Lehrenden (67 Prozent positiv) und die Transparenz in Sachen Lernziele und Anforderungen an Studierende (78 Prozent positiv).
Für einen Blick in die Zukunft vergleicht das CHE die Sicht der befragten Masterstudierenden mit der von Professor:innen. Die Daten über letztere sind ein halbes Jahr älter und aus anderen Studiengängen. “Da wir in beiden Gruppen von Befragten verschiedene Fächer (mit großen Stichproben) untersucht haben, halte ich die Zusammenschau der Ergebnisse durchaus für aussagekräftig”, sagt Nina Horstmann. Zwar gebe es bei den einzelnen Fächern “kleinere Unterschiede in den Präferenzen im Hinblick auf das Lernsetting der Zukunft”, doch grundsätzlich sind Studierende und Professor:innen einer Meinung. Sie wollen eine mit digitalen Elementen angereicherte Präsenzlehre (29 Prozent der Studierenden; 39 Prozent der Professor:innen) und Blended Learning (33 Prozent; 36 Prozent). Einen großen Unterschied gibt es beim Thema Hybride Lehre, die sich 25 Prozent der Studierenden, aber nur 5 Prozent der Professor:innen wünschen. Enno Eidens
es ist nur ein Satz, aber er sagt viel aus über die Landesschulminister:innen. Als zwei Kollegen von Bildung.Table in den letzten Tagen 16 Länder befragten, ob sie ihre Schulen angesichts von Omikron für digitales Distanzlernen fit gemacht haben, da reagierte Bayern u.a. so: “Die Entscheidung, welches digitale Kommunikationswerkzeug an der Schule eingesetzt wird, liegt grundsätzlich bei der jeweiligen Schule ggf. unter Einbeziehung des jeweils zuständigen Schulaufwandsträgers.” Oder kurz: Wir sind nicht zuständig, die anderen sind schuld! Lesen Sie im heutigen Briefing und auf unserer Homepage, was Niklas Prenzel und Jan Lubschik alles nicht von den Kultusministern übers Digitale erfahren haben.
Ganz anders Felix Ohswald. Der junge Mann gehört zu den digitalen Bildungsanbietern in Deutschland, die aus dem Stand die Schüler:innen und Lehrkräfte nicht nur digital verknüpfen, sondern auch mit medial aufbereiteten Inhalten versorgen könnten. Ohswald ist Gründer des Nachhilfeanbieters GoStudent – und sein Unternehmen ist seit gestern um 300 Millionen Euro potenter. So viel Geld hat er auf seiner jüngsten Werbetour für Kapital eingeworben. Ich habe Ohswald gefragt, was er mit dem Geld vorhat – und bei der Konkurrenz nachgehört, ob sie schon Angst vor dem Wettbewerber hat.
Bleiben Sie weiter gesund!

Fast 10.000 Schulklassen mussten in Frankreich in den vergangenen Tagen zu Hause bleiben, weil Schüler:innen und Lehrkräfte sich mit Sars-Cov 2 infiziert hatten. Ein Land, das seine Schulen in der bisherigen Pandemie lange offenhielt, wird von der Omikron-Realität eingeholt. Hierzulande bedroht die Virusvariante den Präsenzunterricht zwar noch nicht derart stark, in der vergangenen Woche erhob die KMK offene Schulen zur höchsten Priorität. Doch werden wegen Corona-Infektionen bereits einzelne Klassen nicht mehr in Präsenz unterrichtet. Vor Weihnachten befanden sich bereits zwölf Schulen in Nordrhein-Westfalen im Distanzunterricht, 24 Schulen in Rheinland-Pfalz sind teilweise geschlossen. Wegen der dynamischen Lage sind die Daten dazu dünn, aber sicher ist: Digitale Schule ist noch längst kein vergangenes Kuriosum für die Geschichtsbücher.
Bildung.Table hat die 16 Kultusminister:innen der Länder gefragt, ob sie sich aktuell auf digitalen Distanzunterricht vorbereiten. Zwölf Ministerien antworteten (Berlin, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen blieben eine Antwort schuldig). Die Antwortschreiben spiegeln einen föderalen Flickenteppich aus Lernsoftwares, Fortbildungsprogrammen und Tablet-Käufen wider – und zeigen dennoch einen roten Faden. Die Digitalisierung schreitet nach bald zwei Jahren Pandemie schneller voran. Doch sehen sich die Länder weder von Omikron noch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts getrieben.
Durch ihr Urteil zur Bundesnotbremse hatten die Karlsruher Richter:innen im November den digitalen Schulunterricht geadelt und auf die große Bühne geholt. Das Gericht formulierte ein neues Grundrecht auf (digitale) schulische Bildung. Es wird abgeleitet aus Artikel 2 und 7 des Grundgesetzes (freie Entfaltung der Persönlichkeit. Aufsicht des Staates über das Schulwesen). Zum Zwecke des Infektionsschutzes seien Schulschließungen rechtens gewesen, weil die Kultusminister Distanzunterricht angeboten haben. Was das BVerfG mit Blick auf mögliche künftige Schulschließungen betonte: Wer digitales Lernen nicht vorbereitet, darf keine Schulen schließen. Bildung.Table berichtete. Für die digitale Schulbildung war das Urteil ein progressiver Pauken-, für die Kultusministerien der Länder wohl eher ein drohender Donnerschlag.
Kein Kultusminister hat seine Vorbereitungen für digitalen Distanzunterricht durch das Karlsruher Urteil erheblich intensiviert. Dabei mahnt das Gericht, dass Distanzunterricht “qualitativ hochwertig” erfolgen müsse. Ob diese Qualität heute flächendeckend erreicht würde, darf zumindest bezweifelt werden. Zur Erinnerung: Immerhin 25 Prozent der Schüler:innen hatte während der Schulschließungen Anfang 2021 täglichen gemeinsamen Distanzunterricht. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie hatte aber immer noch jeder fünfte Schüler überhaupt keinen gemeinsamen Distanzunterricht. Das zeigte eine ifo-Studie. Nun aber, ein weiteres Jahr ist vergangen, sehen sich die Kultusminister der Bundesländer weit fortgeschritten und gut vorbereitet auf Distanzunterricht. Aus Sachsen heißt es dazu selbstsicher: “Die Voraussetzungen für einen ggf. erforderlichen Distanzunterricht (sind) bereits vor dem Urteil geschaffen worden.” Ähnliche Antworten liegen Bildung.Table aus Süd-, Nord- oder Westdeutschland vor.
Die Länder verweisen auf ihren steten Fortschritt bei der Anschaffung von Leihgeräten und Lernsoftware. Die Ministerien kauften Zehntausende mobile Leihgeräte; nach anfänglichem Stocken fließen die Mittel des Digitalpakts. 100 Schüler:innen teilen sich in Deutschland durchschnittlich etwa 25 mobile Endgeräte. Das geht aus den Zahlen hervor, welche die Ministerien Bildung.Table zur Verfügung stellten. In Nordrhein-Westfalen sind es 36, in Hamburg 25, in Rheinland-Pfalz 21. Wobei einige Bundesländer wie Thüringen oder Bremen die Anzahl der Endgeräte mit Verweis auf die Zuständigkeit der Schulträger und Kommunen nicht nennen. Hier eine Übersicht über die Antworten der Bundesländer.
Auch Fortschritte im Angebot von Lernmanagementsystemen (LMS) sind zu verzeichnen. Im internationalen Vergleich setzten 2018 bereits 51 Prozent der Lehrkräfte LMS im Unterricht ein; in Deutschland waren es nur 12 Prozent. Corona hat hier einen Schub gebracht. 58 Prozent nutzen LMS im Unterricht, das ergab die “Digitalisierung Schule”-Studie der GEW im vergangenen Sommer. Gegenüber Bildung.Table können die Bundesländer mittlerweile auf ihre eigenen LMS verweisen und betonen, dass sie Lehrkräfte darin schulen. In Bayern müssen Lehrkräfte fünf Module zur digitalen Bildung verpflichtend belegen. Hamburg schmückt sich mit über 3.000 durchgeführten Fortbildungen und mehr als 50.000 teilnehmenden Lehrer:innen zur “Erhöhung der digitalen Handlungssicherheit”.
Reichen all diese Maßnahmen, die schon seit vielen Monaten laufen, um angemessenen Distanzunterricht zu gewährleisten, wie ihn das Bundesverfassungsgericht auf der einen und bald vielleicht schon die Pandemielage auf der anderen Seite fordern? Der Staatsrechtler Sebastian Piecha interpretiert das Karlsruher Urteil als Aufforderung zu “echte(m) Digitalunterricht statt bloßer Bereitstellung von Materialien, gleiche(r) Teilhabe hieran auch für sozial Schwächere, besondere(n) Regelungen für Abschluss- und Förderklassen”.
Bildung.Table hat die Bildungsministerien nach einem Schreiben gefragt, in dem sie beispielsweise die Schulen – in Folge des Urteils – darum bitten, im Unterricht regelmäßig LMS und Schulclouds einzusetzen. Kein Bundesland antwortete darauf. Aus Schleswig-Holstein kam der Hinweis auf sein Rahmenkonzept für das laufende Schuljahr. “Schulen entwickeln ein zukunftsorientiertes Schulentwicklungskonzept dazu, wie der Transformationsprozess zu einer Schule, die in einer Kultur der Digitalität lernt und lehrt, gestaltet wird.” Es ist ein verklausuliertes, aber klares Bekenntnis zu einer digitalen Schulentwicklung.
Nach der Auswertung der zwölf Antwortschreiben aus den Kultusministerien bleibt der Eindruck, dass man sich im Schatten des BVerfG-Urteils und neuen Distanzunterrichts zwar emsig bemüht, bei der digitalen Bildung aufzuholen und auf den Dreiklang “Leihgeräte, Lernsoftware, Lehrerbildung” setzt. Der neue, revolutionäre Rechtsgrundsatz eines “Rechts auf schulische Bildung” und wie es in einer Pandemie zu verwirklichen ist: Das spielt in den Kultusministerien derzeit aber kaum eine Rolle.
Auf dem europäischen Bildungsmarkt entsteht ein neuer Gigant. Der österreichische Bildungsanbieter GoStudent, der in halb Europa Nachhilfe erteilt, ist mit seiner neuesten Kapitalakquise satte drei Milliarden Euro wert. Man wolle künftig auch in außereuropäischen Märkten wachsen und suche nach Übernahmekandidaten, hieß es aus dem Unternehmen. Der Anbieter hatte bereits im Juni letzten Jahres 200 Millionen Euro bekommen. Die Konkurrenten unter den Startups gratulierten GoStudent für den Erfolg auf dem Finanzplatz. Beobachter warnten aber auch davor, dass die Geschwindigkeit des Wachstums zu groß sein könnte. “Das ist eine gefährliche Wette auf die Zukunft, dass es immer so rasant weitergeht”, hieß es.
Das Angebot von GoStudent ist eigentlich kein technologisches Hexenwerk. Statt einer analogen Nachhilfe sitzen sich bei GoStudent Nachhilfelehrkraft und Schüler:in in einer Videokonferenz gegenüber. Zeitweise experimentierte GoStudent mit einer künstlichen Intelligenz, welche die Emotionen der Nachhilfe-Schüler während des Lernens analysierte. GoStudent ist rein zahlenmäßig nicht der größte Anbieter in Deutschland, hat sich aber innerhalb von zwei Jahren erheblich gesteigert. Inzwischen gibt GoStudent mit seinen Lehrern auch in Spanien, Frankreich, Großbritannien, Russland und Mexiko und einigen weiteren Staaten Nachhilfe.
GoStudent erteilte keine Auskünfte darüber, wie hoch die einzelnen Anteile der Investoren Prosus, Tencent und Deutsche Telekom an den 300 Millionen Euro Kapitalzufuhr sind. Auch die Telekom verweigerte auf Nachfrage, die Höhe ihres Investments zu nennen. Es gehe um eine strategische Beteiligung, sagte ein Sprecher, die aus einem Innovationsfonds des Unternehmens stamme.
In der Bildungsszene dürfte die Aktion der Telekom nicht nur Applaus bringen. Die Telekom hatte einst mit “Schulen ans Netz” ein frühes Lernmanagementsystem aufgebaut, das um das Jahr 2000 immerhin bereits an 10.000 Schulen installiert war. Dann stieg die Telekom aus – und das LMS wurde jedes Jahr weniger gepflegt, bis es kürzlich von dem späteren Käufer Cornelsen eingestellt wurde. Telekom-Manager fielen seither dadurch auf, dass sie die Qualität und die technologische Rückständigkeit des deutschen Bildungssystems kritisierten. Sich nun mit unter 10 Millionen Euro an einem Online-Nachhilfeunternehmen zu beteiligen, löst gewiss keinen technologischen Quantensprung aus.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisierte den neuen mächtigen Anbieter. “Ein wachsender privater Nachhilfebereich verschärft die soziale Spaltung zusätzlich”, sagte die Sprecherin des Vorstandsbereichs für Schule, Anja Bensinger-Stolze Bildung.Table. Eine ganze Industrie schlage daraus Profit. “Ich befürchte, dass die sogenannten Corona-Aufholprogramme teilweise zur Gelddruckmaschine für die private Nachhilfebranche werden”. In der EdTech-Szene gab es viel Beifall für die gelungene Akquise. Es sei gut, dass es einen so erfolgreichen Wettbewerber auch auf dem deutschen Markt gebe. “Chapeau, Felix Ohswald”, sagte ein Sprecher der Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter.
Auch die FDP begrüßte das Investment. “Dass das Start-up Go Student 300 Millionen Euro von namhaften Investoren erhalten hat und mit drei Milliarden Euro bewertet wurde, zeigt, dass es einen großen Bedarf an digitalen Lösungen in der Bildung gibt”, sagte die bildungspolitische Sprecherin der FDP Fraktion, Ria Schröder. Junge Unternehmen entwickelten kreative Lösungen, die zukunftsorientiert und erfolgversprechend seien. “Sie zeigen damit, dass auch der öffentliche Bildungsbereich eine Digitaloffensive benötigt, um unsere Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern”, so Schröder.
Analysten äußerten sich nur im Hintergrund. Sie beschrieben das Geschäftsmodell von GoStudent als nur einen Weg erfolgreichen Wachstums auf dem Bildungsmarkt. Felix Ohswald habe als junger und forscher Macher Schumpeterscher Provenienz den Weg des schnellen Sprungs nach vorn gewählt. Diesen Weg könne man aber nicht dauerhaft mit organischem Wachstum beschreiten. Die Investoren erwarteten fortgesetzte Wachstumsraten, die man dann nur durch Übernahmen schaffen könne. Ohswald sagte im Interview mit Bildung.Table, es seien in naher Zukunft Akquisitionen zu verkünden – im nahen europäischen Ausland. “Ohswald ist zum Wachstum verdammt”, hieß es in der Bildungsszene.

Herr Ohswald, was bedeutet die Akquisition von weiteren 300 Millionen Euro für GoStudent?
Ich glaube, es braucht solche positiven Geschichten, damit mehr Leute im Bildungsbereich etwas gründen.
Meinen Sie nicht, dass jetzt einige andere Start-ups Angst haben?
Nein. Dafür ist der Markt viel zu differenziert. Es gab in Indien in den vergangenen Jahren ein sehr erfolgreiches Bildungsunternehmen, Byju‘s, über das man immer gestaunt hat, auch in China ist das passiert. Schön, dass jetzt auch Europas Bildungsanbieter gutes Geld für gute Arbeit bekommen.
Bitte konkret, wer wäre für GoStudent jetzt interessant? Kämen nicht prinzipiell die führenden Bildung-Start-ups in Deutschland infrage: Sofatutor, Simpleclub oder Bettermarks?
Das sind alles drei coole Plattformen. Mit Bettermarks arbeiten wir über unsere Nachhilfelehrer sogar zusammen. Das ist eine schöne Synergie im pädagogischen Bereich. Es stellt sich natürlich immer die Frage, wo langfristig der Synergieeffekt einer Akquisition liegt.
In welchen Bereichen sollte der nun sein?
Content ist immer spannend, also das, was Sofatutor oder Simpleclub machen. Wir schauen uns ja aktuell auch im Markt einiges an. Wir haben Akquisitionen in der Pipeline, die bald verkündet werden.
In Deutschland, in Europa oder wo?
Momentan tatsächlich mehr außerhalb Deutschlands, in Spanien, in Großbritannien und in Frankreich. Da sind unsere Schwerpunktgebiete.
Manche haben Angst – und die anderen sind wütend. Die Pädagogen werden sagen, Bildung ist doch nicht Geld, Bildung ist Qualität und ein roter didaktischer Faden.
Ja, aber das ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Bildung ist nicht per se kostenlos. Jeder, der in Deutschland Steuern zahlt, bezahlt ja eben auch für Bildung – und zwar gar nicht wenig. 12.000 bis 14.000 Euro fließen pro Kind und Jahr in die Schule. Da wird also richtig viel Geld von uns Steuerzahlern ausgegeben – und es gibt nicht viele andere Bereiche, wo genauso viel Staatsgeld hineinfließt.
Wie geht das in Zukunft weiter?
In Zukunft wird das regulierte Bildungsangebot des Staates am Vormittag mit den privaten Angeboten des Nachmittags verknüpft werden. Das wird dann ein bisschen wie im öffentlichen Straßenverkehr aussehen. Der Staat baut Straßen und stellt Schienen und so weiter zur Verfügung – und darauf bewegen sich dann Autos, Eisenbahnen, Fahrräder und so weiter. Das bedeutet, die Innovation bringt jemand anderes auf die Straße.
Sind wir nicht schon weiter? GoStudent, Simpleclub und andere sind ja nicht nur Anbieter von “Autos”, sondern sie bieten eine digitale Infrastruktur an, die der Staat gar nicht zur Verfügung stellen kann. Kurz: Sie und andere könnten Schüler und Lehrer im Falle einer Schulschließung verknüpfen.
Ich hoffe inständig, dass es keine Schulschließungen geben wird. Das wäre per se schlecht. Dann geht die Schere zwischen denen, die Geld haben, und denen, die benachteiligt sind, noch weiter auseinander.
Sie sind vorbereitet auf digitalen Distanzunterricht – die Bundesländer sind es nicht.
Wir sind auf Einzelunterricht spezialisiert. Das ist noch mal etwas anderes als das Setting einer Klassengruppe. Aber natürlich, wenn wir in einer Krisensituation gebraucht werden, dann könnten wir das.
Was wollen Sie mit dem Geld strategisch anfangen? Warum diese Partner, zum Beispiel Prosus?
Prosus ist inzwischen ein großes Unternehmen, das schwerpunktmäßig auch in Bildung investiert. Für uns ein Partner, bei dem wir uns darauf verlassen können, dass der nicht bei der erstbesten Opportunität sagt, wir wollen unser Invest ausbezahlt bekommen.
Und Chinas Tencent? Sie wissen, dass die Deutschen bei Investitionen aus China zurückhaltend sind – und obendrein Angst vor Überwachung haben?
Die Kapitalflüsse sind bei Start-ups immer global. Und nur weil wir jetzt mit Tencent einen – übrigens sehr kleinen – Investor haben, der aus China kommt, braucht niemand Angst haben, dass wir irgendwelche Daten abfließen lassen. Niemand will in einem überwachten Klassenzimmer sein. Ich schon gar nicht.
Learning analytics findet auch bei Ihnen längst statt.
Es ist heute auch wichtig, dass man eine genaue Diagnose des Lernverhaltens des Schülers leisten kann. Natürlich halten wir uns an den Datenschutz. Aber ohne Diagnose keine echte Lerntherapie.
Warum wäre das falsch?
Ich finde es wichtig, messbar zu machen, welcher Unterricht welche Wirkungen hat – und das dann auch wirklich auszurollen und zu nutzen. Wir müssen die Lehrer, die sehr gut unterrichten, in den Mittelpunkt rücken, die sollen mehr verdienen, das sollen die Superstars werden.
Welche Erfahrungen haben Sie in der Corona-Zeit gemacht?
Für uns hatte die Pandemie durchaus negative Konsequenzen. Es war sofort ein Einbruch bei den Nachfragen zu beobachten. Ich habe das als eine überfordernde Situation für alle erlebt. Es gab keine Prüfungen, es fanden keine Examen statt, es war weniger Druck in der Schule.
Wann hat sich das wieder verändert?
Im Moment der Schulöffnungen ist das sofort wieder auf ein normales Niveau zurückgegangen. Dann haben die Eltern wieder daran gedacht, wie sie ihren Kindern mit unseren Lehrern helfen können. Weil wieder regulärer Unterricht stattgefunden hat.
Und was war positiv?
Dass die Pandemie eine Bewusstseinsveränderung hervorgebracht hat. Es war für jeden ganz normal, Zoom-Meetings und Videokonferenzen zu veranstalten. Das war vorher schon fast nischig gewesen.
Sie hatten bei der Pandemie dem Staat Hilfe angeboten. Hat er die angenommen?
Nein, da hat sich niemand gemeldet.
Auch nicht, um sich mit Felix Ohswald und den anderen Start-ups zu beraten?
Ist nicht passiert.
Haben Sie schon mal in Deutschland einen Kultusminister persönlich kennen gelernt?
Nein, dieses Vergnügen hatte ich leider noch nicht.
Ist es in Ordnung, die digitalen Bildungsanbieter gar nicht erst zu empfangen?
Also mir geht es darum, Lösungen zu finden. Und wenn mich niemand empfängt, dann macht es keinen Sinn, Monate lang darüber zu lamentieren und offene Briefe zu schreiben.
Wie beurteilen Sie die deutsche Schulpolitik?
Im internationalen Vergleich haben Kinder in Ländern wie Deutschland oder Österreich Zugang zu einer qualitativ sehr hochwertigen Bildung. Der Bildungszugang ist frei und die Chancengerechtigkeit in Deutschland hat sich für Kinder aus Nichtakademikerfamilien in den letzten Jahren über alle Bildungsstufen verbessert. Mich bewegt aber auch die Frage: was kann man tun, um es zu verbessern?
Was wäre das?
Das kann man gut an einem Ort in Brasilien beobachten, der Ceará heißt. Dort hat man höchsten Wert auf die Qualität der Lehrer gelegt, in dem man sie bewusster ausgewählt und besser bezahlt hat. Ich bin ein Fan dieses Modells! Das gilt übrigens auch für die Lehrleistungen. Es kann nicht sein, dass eine Lehrkraft deswegen besser bezahlt wird, weil sie mehr Jahre im Schuldienst verbracht hat. Die Ergebnisse ihrer Klassen und Schüler müssen im Mittelpunkt stehen.
Ceará ist weit weg.
Ja, aber das interessanteste war folgendes: Die haben Schulklassen zusammengelegt und die Lehrer, die nicht gut performt haben, aus dem Schuldienst befreit. Das heißt, eine Lehrerin oder ein Lehrer, der richtig gut ist, hat dann zum Beispiel nicht 20, sondern 60 Kinder unterrichtet.
… 60 Kinder, das ist ja aufregend!
Mit den richtigen Lehrern und Konzepten sind neue Modelle möglich. Man muss nur offen für Innovationen sein!
Wie findet GoStudent auf einem leergefegten Lehrerarbeitsmarkt die besten Lehrer?
Wir suchen ja nicht nur klassische Lehrer, sondern zum Beispiel Studierende der Mathematik, die Lust haben, nebenher Nachhilfe zu geben.
Ein pädagogisches Studium ist dabei mindestens hilfreich.
Darüber lässt sich diskutieren. Ich lerne gutes Unterrichten meines Erachtens nicht, indem ich eine Vorlesung über gutes Unterrichten besuche.
Wie finden Sie und Ihre Unternehmen heraus, wer für Ihre Zwecke ein guter Lehrer ist?
Wir prüfen drei Dinge: erstens das Fachwissen. Versteht jemand etwas von Mathematik? Ist jemand mindestens auf Abiturniveau in dem Fach? Zweitens pädagogische Fähigkeiten: Kannst Du ein komplexes Thema einfach und in kurzen Sätzen erklären? Und drittens, einen polizeilichen Background-Check, ob ein Bewerber wirklich mit Kindern arbeiten darf.
Können Sie garantieren, dass das funktioniert? Angeblich kann man bei Ihnen zumindest den Test 1 und 2 bestehen – auch wenn man da gar nicht so gut ist.
Wir verbessern und optimieren dieses System fortlaufend.
Eine Frage noch: Wie viel Geld bekommen Sie von der Deutschen Telekom?
Es handelt sich um einen mittleren siebenstelligen Betrag.
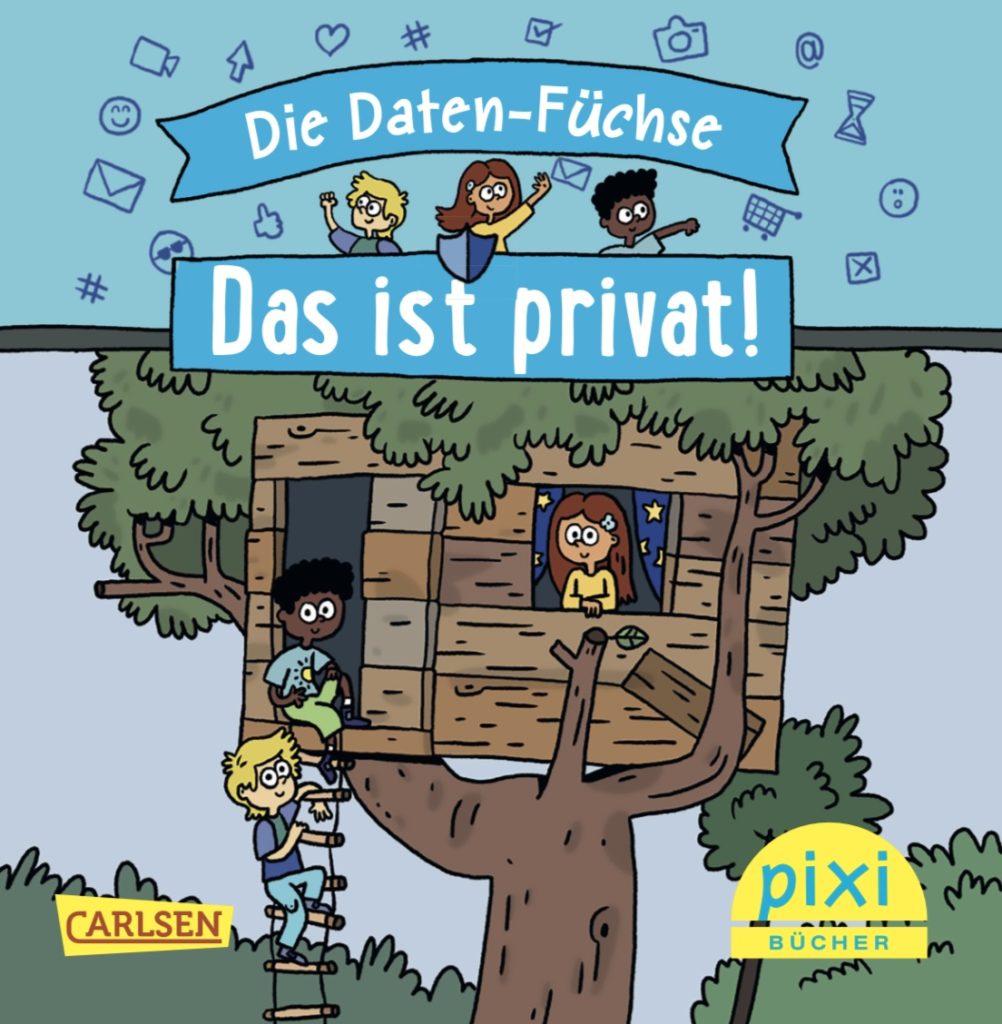
Ein Kind schnappt irgendwo das Wort “privat” auf und weiß nicht, was es bedeutet. Deshalb sucht es zu Hause nach seinem Vater, um ihn danach zu fragen. Ungestüm platzt das Kind ins Badezimmer, während sich der Vater auf der Toilette befindet. “Kann man denn nicht mal im Bad seine Privatsphäre haben!”, schimpft er und scheucht das Kind wieder hinaus. Nun beginnt das Kind zu verstehen, wofür “privat” steht.
Diese kleine Geschichte stammt aus dem neuen Kinderbuch “Die Daten-Füchse – Das ist privat!”. Das Buch erschien im Dezember zusammen mit einem weiteren Pixi-Band: “Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?” Der Bundesdatenschutzbeauftragte veranlasste die kostenlose Herausgabe beider Werke mit der Absicht, digitale Aufklärungsarbeit für Kinder verständlich zu betreiben. In mehreren, unterschiedliche Erzählformen werden allerlei Informationen rund um Privatsphäre, Cybersicherheit und Onlineverhalten eingeflochten. Die Idee dahinter ist, die Kinder zunächst mit kreativen Alltagsgeschichten und dazu passenden Bildern anzufixen. Ist deren Aufmerksamkeit erst einmal gewonnen, lernen sie quasi von selbst alles Wissenswerte, was es als Laie über Datenschutz zu wissen gibt. Dementsprechend präsentiert die Autorin die Fakten auch möglichst kindgerecht. Außerdem werden die Pixi-Bücher kostenlos vom BfDI angeboten, um möglichst viele Kinder erreichen zu können. Jeder kann auf der Website des BfDI jeweils ein kostenloses Exemplar bestellen.
Der Aufbau der Pixi-Bücher unterscheidet sich: In “Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?” werden diverse Alltagssituationen von Kindern geschildert, in denen Fachbegriffe wie “Daten” oder “soziale Netzwerke” erwähnt werden. In den meisten Fällen erfolgt dann eine exakte, kindgerechte Erklärung auf der jeweiligen Folgeseite. “Die Daten-Füchse – Das ist privat!”, widmet sich hingegen vollkommen der Bedeutung von Privatsphäre. Der Datenschutz wird darin nicht einmal erwähnt. Während das erste Buch Leser schon im Grundschul- und fortgeschrittenen Schulalter erreichen soll, richtet sich das zweite Buch nach Verlagsangaben vor allem an Kindergartenkindern. In einer durchgehenden Handlung treffen die jungen Protagonisten immer wieder auf das Wort “privat”. Neugierig erkundigen sie sich nach dessen Sinn. Nachdem sie dessen Stellenwert schlussendlich verstanden haben, verwenden sie das Wort ab sofort selbst.
Damit Kinder die Handlungen verstehen können, hat der Bundesdatenschutzbeauftrage die sachkundige Kinderbuchautorin Tina Blase engagiert. Durch ihre langjährigen Erfahrungen weiß sie, wie man die jüngere Generation anspricht, obwohl Blase selbst von sich sagt, dass sie keine Expertin für das Thema Datenschutz sei. Alles, was die beiden Pixi-Bücher zum Datenschutz betrifft, habe sie in Zusammenarbeit mit Experten des BfDi entwickelt.
Nach der Analyse der Medienpädagogin Jessica Wawrzyniak von Digitalcourage ist insbesondere das Buch “Die Daten-Füchse – Das ist privat!” für Kinder hervorragend geeignet. “Die verwendeten Wörter sind sehr kindgerecht und die Geschichte ist einfach wunderbar. Auf diese Weise versteht ein Kind recht einfach, was es mit ‘Privatsphäre’ auf sich hat.” Das andere Buch “Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?” weise hingegen ein paar Mängel auf. Zu viele Informationen würden auf zu wenigen Seiten behandelt. So würden die Fakten teilweise verkürzt dargestellt.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Datenschutzexperte Jochim Selzer vom Chaos Computer Club. Auch er begrüßt die Initiative des Bundesdatenschutzbeauftragten. “Die Herangehensweise ist sehr angemessen. Kindern wird gezeigt, dass Datenschutz nichts Böses ist.” Stattdessen seien die Erklärungen von Privatsphäre durch die Geschichten überaus einleuchtend, da Kindern so die Verhaltensregeln für ein funktionierendes Zusammenleben direkt vor Augen geführt werden. “Ich gehe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Pixi-Bücher funktionieren werden. Ich bin positiv überrascht, dass so ein trockenes Ministerium solche Kinderbücher schreiben lässt. Der Bundesdatenschutzbeauftragter Kelber betreibt wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit. Seit er das Amt übernommen hat, habe ich einige Veränderungen bemerkt”, lobt Selzer.
Offenbar schaffen es diese beiden Bücher, ein hochkomplexes Thema wie Informationstechnologie und Datenschutz so darzustellen, dass es sogar für Kleinkinder verständlich wird. Inhaltlich und ästhetisch überzeugen sie Fachleute, aber auch Laien. Allerdings kratzen diese Kinderbücher lediglich an der Oberfläche des Fachgebiets. Auf nur 30 Seiten pro Buch ist die Zahl der thematisierten Sachverhalte begrenzt. Die Pixi-Bücher bieten einen guten Ansatzpunkt, um unerfahrene Kinder zum ersten Mal mit den Themen Privatsphäre und Sicherheit im Netz zu konfrontieren. Jan Lubschik
Blase, Tina/Hellmeier, Horst: Die Daten-Füchse – Das ist privat!, Carlsen K, Hamburg, 2021,
Blase, Tina/Hellmeier, Horst: Die Daten-Füchse – Was ist Datenschutz?, Carlsen K, Hamburg, 2021. Exklusive Ausgaben für den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Visualisierungen wie Bilder und Videos helfen beim Lernen am meisten. Das sagen etwa 57 Prozent der befragten Schüler in einer Umfrage von Simpleclub zu Lernmethoden. 46,2 Prozent bevorzugen einen Mix aus Schulbuch, Aufgabenheften und Inhalten. Anlässlich der baldigen Halbjahreszeugnisse in vielen Bundesländern führte die Lernplattform Simpleclub eine Umfrage unter knapp 1.500 Nutzenden durch. Sie soll zeigen, wie Schüler der Generation “Digital Native” lernen und ob sie noch mit Heften und Büchern arbeiten. Die Umfrage wurde von Schüler:innen der Klassen 7 bis 13 beantwortet. Von den Befragten besuchen knapp 82 Prozent ein Gymnasium.
Wann Schüler mit dem Lernen vor einer Klausur beginnen, hängt stark von ihrem Alter ab. In der siebten Klasse fangen noch 38,3 Prozent der Befragten ein bis zwei Wochen vorher an. In Jahrgang dreizehn fällt diese Zahl auf 17,3 Prozent. Gleichzeitig steigt die Anzahl derer, die erst wenige Tage vorher beginnen, von 25 Prozent in der siebten Klasse auf knapp 39 Prozent im letzten Schuljahr. Schüler nutzen Simpleclub insbesondere vor Klausuren zum Lernen: 49,3 Prozent gaben an, das Portal am meisten vor Prüfungen zu nutzen. 36,4 Prozent nutzten es “immer mal wieder“. Jeder fünfte Realschüler nutzt Simpleclub das ganze Schuljahr über konstant – ein Wert fast doppelt so hoch wie unter Gymnasiasten.
Genau wie der Lernbeginn vor Prüfungen ist auch die Tageszeit des Lernens abhängig vom Alter. Nur 15 Prozent der Siebtklässler lernen gerne abends, 51,7 Prozent lernen direkt nach der Schule, nach dem Motto: “Dann habe ich es hinter mir”. Mindestens 35 Prozent der Befragten der Jahrgänge acht und aufwärts hingegen lernen vorzugsweise abends. Simpleclub wollte zudem wissen, welche Funktionen Nutzende am meisten verwenden und wie sie die Plattform nutzen. Mit 39,3 Prozent der Befragten ist hier die Option “Ich schaue mir generell immer alles zu einem Thema an – Videos, Zusammenfassungen etc. und mache dazu alle Übungen” mit Abstand die beliebteste. Auf Platz zwei (28 Prozent) folgt “Ich schaue vor allem die Videos“.
Gefragt danach, wie Schüler Simpleclub im Vergleich zum Schulmaterial nutzen, gaben mehr als 50 Prozent an, es sei eine Ergänzung ihrer Lernmethode. Ein Viertel schaue nur noch vor Klausuren auf die Schulmaterialien und lerne sonst mit Simpleclub. Mehr als 13 Prozent der Realschüler sagten, sie lernten nur noch mit Simpleclub. Das ist ein hoher Wert im Vergleich zu Befragten anderer Schulformen, unter denen 8 Prozent ausschließlich auf die Lern-App setzen.
Die Umfrage zeigt, dass sich das Lernverhalten von Schülern über das Alter verändert, insbesondere ihr Zeitmanagement. Schulmaterialien wie Bücher und Aufgabenhefte sind keineswegs ein rotes Tuch für Digital Natives. Sie kombinieren vielmehr gerne verschiedene Lernformen miteinander – sei es zur Wiederholung von Schulstoff oder als erster Zugang, der dann mit digitalen Methoden gefestigt wird. Insgesamt aber ist das digitale Lernangebot aus den Methoden der Befragten nicht mehr wegzudenken. Robert Saar
Diese Studie über Suizidversuche schien ein starkes Argument zu sein: Der Leiter der Essener Kinder-Intensivstation Christian Dohna-Schwake hatte gemutmaßt, dass allein von März bis Mai 2021 insgesamt 500 Kinder einen Suizidversuch unternommen hätten. Nun stellt sich heraus, dass die Studie noch gar nicht veröffentlicht ist. Überdies ist in dieser Untersuchung die Zahl der Kinder, die sich das Leben hätte nehmen wollen, mit 93 beziffert. Die Zahl 500 ist eine Hochrechnung auf alle Kinder-Intensivstation in Deutschland. Professor Dohna-Schwanke hatte die Schulschließungen mit den Suizidversuchen in Verbindung gebracht. Der zweite Lockdown der Schulen habe sich hingezogen wie Kaugummi, sagte Dohna-Schwake. Es sei anzunehmen, “dass da Kinder, die vielleicht auch schon depressiven Verstimmungen gelitten haben, dann eben gedacht haben, ok, das ist jetzt mein Hilferuf. Ich muss da irgendwie rauskommen.” Der Professor berief sich dabei “auf den gesunden Menschenverstand.”
Der Leipziger Kinderpsychologe Julian Schmitz übte nun gegenüber Bildung.Table Kritik an der Suizidstudie. Schmitz rät davon ab, Suizidversuche von Kindern oder Studien darüber in der Debatte für oder gegen Distanzunterricht zu instrumentalisieren. Die einzige echte valide Interpretation sieht Schmitz hierin: Kinder und Jugendliche, die unter Vereinsamung gerade in der Corona-Zeit litten, “haben oft keinen oder keinen leichten Zugang zu psychosozialer Versorgung.”
Dohna-Schwake hatte in einem Podcast von der dramatischen Erhöhung von Suizidversuchen unter Jugendlichen wegen des Lockdowns berichtet. Im Vergleich zum Jahr 2019 (37 Fälle) seien die 93 möglichen Selbsttötungsversuche, die er gezählt hatte, eine Steigerung von 300 Prozent. Im ersten Lockdown Anfang 2020 war die Zahl der Suizidversuche sogar zurückgegangen. Dohna-Schwanke hatte auch da eine Studie begonnen – sie dann aber abgebrochen, weil sich zwei Suizidversuche als unbeabsichtigte Fensterstürze herausgestellt hatten. Die noch nicht veröffentlichte Studie des Essener Professors hatte ein massives Presseecho ausgelöst. Eine Zeitung hatte fälschlicherweise getitelt: “500 Kinder nach Suizidversuchen auf Intensivstation”. Eine derart effekthascherische Berichterstattung bei Suiziden ist gefährlich und verstößt gegen den Pressekodex. Man nennt dies den so genannten Werther-Effekt: berichtet die Presse vermehrt über Suizide, steigt die Zahl der Selbsttötungen. Auf eine Anfrage von Bildung.Table reagierte Dohna-Schwake bis Redaktionsschluss nicht.
Der Leipziger Psychologe Professor Julian Schmitz zweifelt nicht die Validität der Suizidversuchs-Erhebung seines Kollegen Dohna-Schwake in Essen an. “Es kommt aber darauf an, wie man die Daten interpretiert – und welche Konsequenzen man empfiehlt.” Eine gerade veröffentlichte Studie aus Basel zeige zum Beispiel, dass die Schule und der Präsenzunterricht nicht unbedingt gegen Depressivität und suizidalen Neigungen helfen. “Im Gegenteil, schulischer Druck ist Teil des Problems. Hoher Leistungsdruck ist an sich schwierig, in Kombination mit der Vereinsamung und der Verunsicherung der Schüler durch Corona kann er gefährlich werden”, sagte Schmitz. Der Professor an der psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche in Leipzig fordert von Lehrern, die Präsenz an Schulen nicht dazu zu benutzen, noch eine Prüfung nach der anderen durchzubringen. cif
MINT-Studierende sind größtenteils zufrieden damit, wie ihr Studium im Krisenmodus läuft. Das zeigt eine Befragung des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) unter 5.850 Masterstudierenden der Fächer Mathematik, Informatik und Physik aus Deutschland und Österreich. Schlechter bewerteten sie die Zugangsmöglichkeiten zu studienrelevanter Infrastruktur. Ein Großteil wünscht sich eine Kombination aus Präsenzlehre, digitalen Mitteln und Blended Learning. Die Daten wurden im August letzten Jahres erhoben und sind als Schulnoten abgebildet. Die Erhebung ist die dritte des CHE zum Studium in der Coronavirus-Pandemie und Teil des CHE-Masterrankings.
Obwohl dieses Mal nur Masterstudierende aus MINT-Fächern befragt wurden, findet Nina Horstmann vom CHE, dass sich die Daten auf Studierende in Deutschland generalisieren lassen – denn zwei vorherige Erhebungen des CHE kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie hatten denselben Fragebogen genutzt, den im Sommersemester 2020 über 6.774 Wirtschafts-Masterstudierenden und im Wintersemester 2021 rund 27.000 Studierende, darunter vorwiegend Bachelorstudierende oder Studiengänge mit Staatsexamen, beantwortet hatten.
Von den befragten Masterstudierenden der aktuellen Erhebung bewerten 77 Prozent den Umgang ihrer Hochschule mit der Pandemie positiv (Note 1 und 2), 81 Prozent bewerten das Informationsmanagement ihrer Hochschule positiv. Ähnlich gut bewerten sie die “Möglichkeiten zum Kontakt und zum fachlichen Austausch mit Lehrenden” (74 Prozent positiv), die “Erreichbarkeit von zentralen Ansprechpersonen” (81 Prozent positiv) und das digitale Feedback der Lehrenden (71 Prozent positiv). Weniger gut bewerteten die Studierenden die Möglichkeiten zum Austausch untereinander. Zwar gaben 55 % die Schulnoten 1 oder 2, doch auch 14 Prozent die Noten 5 oder 6.
Mit ihren Studienbedingungen sind die Masterstudierenden sehr zufrieden – bis auf einen Aspekt, den das Internet nur schwer ersetzen kann: studienrelevante Infrastruktur. 27 Prozent der Studierenden sind nicht zufrieden (Noten 4 bis 6) mit dem Zugang zu Bibliotheken, Lernräumen und Laboren. Positiv bewerteten sie hingegen die “Möglichkeiten zum Ablegen von Prüfungsleistungen” (83 Prozent) und die “Möglichkeit, das Studium wie geplant fortzusetzen” (84 Prozent positiv).
Nina Horstmann ergänzt gegenüber Bildung.Table, dass Studiengänge mit wenig oder keinen praktischen Anteilen in der Pandemie klar im Vorteil sind. “Praktische Lehrveranstaltungen sind im digitalen Format nahezu unmöglich”, sagt Horstmann. Dies treffe vor allem die medizinischen Fächer, weil “der Unterricht am Patientenbett nicht durch Online-Formate zu ersetzen ist.”
Sehr gut bewerten die Masterstudierenden die digitalen Lernformate während der Pandemie, kritisieren aber die Begeisterungsfähigkeit ihrer Dozierenden. 20 Prozent bewerten diese mit einer Schulnote von 4 bis 6. Besser schneiden ab: die “Vielfalt digitaler Lehrformate” (82 Prozent positiv), die “technischen Rahmenbedingungen für digitale Lernveranstaltungen” (83 Prozent positiv), das digital-didaktische Konzept der Lehrenden (67 Prozent positiv) und die Transparenz in Sachen Lernziele und Anforderungen an Studierende (78 Prozent positiv).
Für einen Blick in die Zukunft vergleicht das CHE die Sicht der befragten Masterstudierenden mit der von Professor:innen. Die Daten über letztere sind ein halbes Jahr älter und aus anderen Studiengängen. “Da wir in beiden Gruppen von Befragten verschiedene Fächer (mit großen Stichproben) untersucht haben, halte ich die Zusammenschau der Ergebnisse durchaus für aussagekräftig”, sagt Nina Horstmann. Zwar gebe es bei den einzelnen Fächern “kleinere Unterschiede in den Präferenzen im Hinblick auf das Lernsetting der Zukunft”, doch grundsätzlich sind Studierende und Professor:innen einer Meinung. Sie wollen eine mit digitalen Elementen angereicherte Präsenzlehre (29 Prozent der Studierenden; 39 Prozent der Professor:innen) und Blended Learning (33 Prozent; 36 Prozent). Einen großen Unterschied gibt es beim Thema Hybride Lehre, die sich 25 Prozent der Studierenden, aber nur 5 Prozent der Professor:innen wünschen. Enno Eidens
