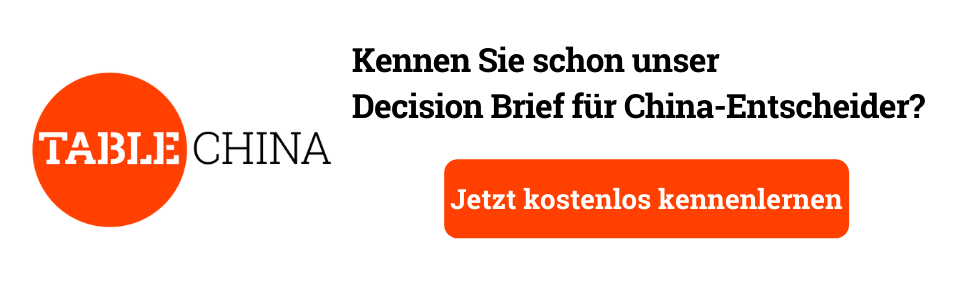das fünfte Sanktionspaket der EU gegen Russland, über das heute beraten wird, fällt schärfer aus als zunächst geplant. Als Reaktion auf die Gräueltaten in Butscha wird jetzt unter anderem über ein Kohleembargo nachgedacht. Till Hoppe hat das Sanktionspaket, bestehend aus sechs Punkten, analysiert.
Die Vorratsdatenspeicherung blickt auf eine bewegte Rechtsgeschichte zurück – seit eineinhalb Jahrzehnten beharren Strafverfolger und Sicherheitsbehörden auf ihre Wichtigkeit. Viele Mitgliedstaaten praktizieren sie aber längst nicht mehr. Der Europäische Gerichtshof auch in seiner jüngsten Entscheidung wieder dargelegt, warum eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung unzulässig ist. Falk Steiner analysiert, welche Schlupflöcher sich aber aufgetan haben.
Lukas Scheid hat sich den Vorschlag zur Reform der Richtlinie über Industrieemissionen angesehen, mit dem die EU-Kommission auf Innovationen, gleiche Ausgangsbedingungen für europäische Industrieanlagen und vor allem langfristige Investitionssicherheit hofft. Stimmen fürchten allerdings, dass die EU ein weiteres Bürokratiemonster geschaffen hat.
Das erste Dossier des Fit-for-55-Pakets, der Bericht zur Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve, wurde gestern im Parlament mit großer Mehrheit angenommen. Die Reform soll das europäische Emissionshandelssystem vor Preisschocks schützen. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Mit Daniela Schwarzer, Executive Director der Open Society Foundations, ist eine echte Verfechterin der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa im Europe.Table-Portrait. Ihre Expertise darüber, wie Europa im Systemwettbewerb mithalten kann, ist immer gefragt.

Die Europäische Union wird voraussichtlich erstmals Energielieferungen aus Russland mit Sanktionen belegen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug gestern ein Einfuhrverbot für russische Kohle vor. Die Kommission arbeite überdies an Maßnahmen gegen die Erdöleinfuhren aus dem Land, sagte sie.
Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten sollen heute Vormittag über das neue Sanktionspaket beraten, das aus insgesamt sechs Elementen besteht. Es fällt deutlich schärfer aus als zunächst geplant. Kommission und Mitgliedstaaten reagieren damit auf die vielen toten Zivilisten (Europe.Table berichtete), die am Wochenende nach dem Abzug russischer Truppen aus Vororten der ukrainischen Hauptstadt Kiew entdeckt worden waren und international für Erschütterung gesorgt hatten.
Mit einem Kohle-Embargo gegen Russland nimmt die EU denjenigen Energieträger ins Visier, für den sie recht unproblematisch alternative Lieferanten findet. Russische Steinkohle machte laut Bundeswirtschaftsministerium bisher zwar rund 50 Prozent des deutschen Steinkohleverbrauchs aus. Kraftwerksbetreiber und Industriekunden wie die Stahlbranche hätten aber bereits begonnen, die Lieferverträge umzustellen. Ein Großteil der Kraftwerke könne daher bis zum Frühsommer gänzlich auf russische Kohle verzichten, schrieb das BMWK in seinem jüngsten Fortschrittsbericht Energiesicherheit. Da der Importstopp nicht sofort, sondern erst nach eine Übergangsfrist von drei Monaten greifen soll, wäre das wohl verkraftbar.
Das Embargo betrifft laut Kommission Kohle-Lieferungen aus Russland im Wert von vier Milliarden Euro. Als alternative Lieferanten stehen laut dem Verein der Kohlenimporteure insbesondere die USA, Kolumbien und Südafrika bereit. Dies sei auch technisch unproblematisch, da bei Steinkohle unterschiedliche Qualitäten leicht gemischt werden könnten. Der liquide Weltmarkt bedeutet aber zugleich, dass der Kohle-Importstopp der EU Russlands Präsidenten nicht sonderlich treffen wird.
Russland werde die Kohlen, die bisher in die EU gingen, künftig wahrscheinlich an Indien und die Türkei liefern, sagte ein Händler zu Europe.Table. Er rechnet lediglich mit einer anderen Verteilung der Brennstoffexporte. Europa könnte etwa Kohlen aus Kolumbien und Südafrika beziehen, die zuvor für Indien und die Türkei bestimmt waren. Über den Hafen von Wanino im Osten des Landes habe Russland bisher außerdem Kohle nach China und Japan verschifft.
Die überschaubaren Schwierigkeiten erleichtern es aber der Bundesregierung, den Einfuhrbann mitzutragen. Berlin hat sich bislang dagegen gewehrt, die Energielieferungen aus Russland zu stoppen. Die Ampel-Koalition ist sich weitgehend einig, dass die Kosten eines Erdgas-Embargos zu hoch wären. Bei Erdöl ist das Bild diffuser.
2021 hatten Rosneft und Co etwa 35 Prozent des deutschen Ölverbrauchs gedeckt. Bis Mitte dieses Jahres will das BMWK diese Importe halbieren. Das Problem: Die Groß-Raffinerien in Leuna und Schwedt werden bislang über Pipelines aus Russland mit Rohöl versorgt. Um dort Öl etwa aus dem Nahen Osten verarbeiten zu können, müssen die Lieferungen über Häfen wie Rostock oder Danzig erfolgen sowie per LKW und Zug.
Hinzu kommt: Die Raffinerie in Schwedt gehört Rosneft. Der Kreml-nahe Staatskonzern wird die Lieferbeziehungen mit Russland kaum freiwillig beenden. Wirtschaftsminister Robert Habeck arbeitet daher an Möglichkeiten, Rosneft die Kontrolle über die Raffinerie zu entwinden.
Auf EU-Ebene wächst nach den Ereignissen von Butscha die Unterstützung für ein Öl-Embargo gegen Russland. Diskutiert werden unterschiedliche Ansätze, etwa russische Öllieferungen mit hohen Strafzöllen zu belegen, wie dies zuletzt ein Beratergremium der französischen Regierung empfohlen hatte. Geprüft wird laut von der Leyen auch, dass Kunden in der EU für die Lieferungen auf ein Treuhandkonto einzahlen. Das Geld würde bei diesem im Umgang mit dem Iran erprobten Vorgehen erst dann freigegeben, wenn Russland seinen Krieg in der Ukraine beendet.
Noch aber schlägt die Kommission kein Öleinfuhrverbot vor. Das neue, insgesamt fünfte Sanktionspaket enthält vielmehr noch diese weiteren Maßnahmen:
Vertreter der US-Regierung kündigten überdies an, gemeinsam mit den Verbündeten heute ein Verbot aller neuen Investitionen in Russland zu beschließen.
Auf ein Gas-Embargo hingegen verzichten EU und USA. Stattdessen bemühen sich die Mitgliedstaaten zunächst, die Gasspeicher für die kommenden Winter ausreichend zu füllen. Über die entsprechende Vorlage der Kommission vom 23. März will das Parlament zügig verhandeln. Am Dienstag stimmte das Plenum für das Dringlichkeitsverfahren, um schnell europaweite Mindestfüllstände und Zertifizierungsverfahren für Speicherbetreiber einführen zu können. Schon am Donnerstag soll der Kommissionsvorschlag in erster Lesung behandelt und an den Industrieausschuss verwiesen werden, der dann in den Trilog mit Kommission und Rat gehen wird. Mit Manuel Berkel und rtr
Seit dem Grundsatzurteil 2014 zur anlasslosen, massenhaften und umfassenden Vorratsdatenspeicherung, wie sie 2006 beschlossen worden war, hatten die Richter sich immer wieder mit kreativen Ideen der Mitgliedstaaten zu beschäftigen. Europaweit hatten sich Gesetzgeber nicht davon abhalten lassen, erneut Varianten einer Vorratsdatenspeicherung zu verabschieden – in Deutschland zuletzt durch die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD 2015. Ende 2016 hatte der EuGH dann in einem weiteren Beschluss noch einmal konkretisiert, inwiefern eine Vorratsdatenspeicherung europarechtswidrig ist – was im Ergebnis dazu führte, dass seit 2017 die Pflicht zur Umsetzung in Deutschland ausgesetzt ist.
Seitdem lag die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland auf Eis, diverse Gerichtsverfahren sind hierzu noch anhängig, unter anderem beim EuGH. Doch der Gesamtzustand ist für alle Beteiligten, von Polizei bis zu den Gegnern, unbefriedigend. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP heißt es dazu, man werde “die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher, anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können.”
Dies bedeutet im Kern eine Abkehr von einer Vorratsdatenspeicherung und die Hinwendung zum sogenannten Quick Freeze-Konzept. Bei diesem erfolgt der Zugriff nicht auf zuvor auf Vorrat gespeicherte Daten, sondern es wird ab einem definierten Zeitpunkt in die Zukunft gespeichert, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Für dieses Konzept hatte sich insbesondere die FDP in der Vergangenheit immer stark gemacht. Doch mit dem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofes könnte die Debatte erneut neue Wege nehmen.
Mit ihrem Urteil gingen die Richter nun auf Vorlagefragen von Gerichten aus Irland und Dänemark zur Klärung der Vereinbarkeit nationaler Regelungen mit dem Europarecht ein. Und stellten klar, dass auch das Ziel, schwere Straftaten aufzuklären, keinen ausreichenden Grund für eine flächendeckende und anlasslose Speicherung bieten würden. Bei der Bedrohung der Nationalen Sicherheit sei eine Vorratsdatenspeicherung zulässig. Doch der irische Weg, schwere Kriminalität kurzerhand zur Frage Nationaler Sicherheit zu erheben, stieß bei den Richtern in Luxemburg auf deutlichen Widerstand.
Eine die Vorratsdatenspeicherung erlaubende Bedrohung der Nationalen Sicherheit würde hinreichend konkrete Umstände voraussetzen. So heißt es im Urteil: “Eine solche Bedrohung unterscheidet sich somit in ihrer Art, ihrer Schwere und der Besonderheit der sie begründenden Umstände nach von der allgemeinen und ständigen Gefahr, dass – auch schwere – Spannungen oder Störungen der öffentlichen Sicherheit auftreten, oder schwerer Straftaten.” Öffentliche Sicherheit und Nationale Sicherheit müssten kategorial getrennt werden. Im Bereich öffentlicher Sicherheit sei eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung sowohl mit der ePrivacy-Richtlinie als auch mit den Garantien der Europäischen Grundrechtecharta unvereinbar.
Allerdings gilt dies nicht für alle Formen einer anlasslosen Speicherung: Die Richter konkretisierten in ihrer gestrigen Entscheidung noch einmal ihre Kriterien, unter denen die Speicherung von IP-Adressen auf Vorrat doch zulässig sein kann (Randnummer 73). Dies betrifft insbesondere Fragen wie die Zugangssicherung zu gespeicherten Daten und die Voraussetzungen, wer unter welchen Umständen auf diese zugreifen dürfe. Auf eine dänische Vorlagefrage hin wurde etwa Staatsanwälten abgesprochen, ausreichend unparteiisch zu sein, um einen Datenzugriff erlauben zu können.
Auch möglich bleibt dem Urteilstext zufolge eine Vorratsdatenspeicherung anhand anderer Kriterien: So ist eine auf konkrete Personen bezogene Speicherung für das höchste Europäische Gericht gleichermaßen zulässig wie eine standortbezogene Ausgestaltung, wenn es sich hierbei objektiv, so der EuGH, um “strategische Orte” mit hohem Besucheraufkommen (Rn. 81) wie Bahnhöfe und Flughäfen oder bei einem Ort “aufgrund objektiver und nicht diskriminierender Anhaltspunkte” davon auszugehen sei, “dass in einem oder mehreren geografischen Gebieten eine durch ein erhöhtes Risiko der Vorbereitung oder Begehung schwerer Straftaten gekennzeichnete Situation” eintrete.
Kritiker von Vorratsdatenspeicherungen aller Art sehen vor allem in diesen geografischen und technologiebezogenen Ausnahmen vom Regelverbot ein Problem. “Eine IP-Vorratsdatenspeicherung wäre ein Anschlag auf das Recht auf Anonymität im Netz und droht unsere komplette Internetnutzung nachvollziehbar zu machen”, kritisiert der Piraten-MdEP Patrick Breyer. “Auch die vermeintlich geografisch gezielte Vorratsdatenspeicherung droht einen Großteil der Bevölkerung ständig zu erfassen.” Breyer befürchtet, dass sich die EU-Kommission durch das gestrige Urteil zu weiteren Plänen zur Neuauflage ermuntert fühlen könnte.
Für die lange verzögerte Neufassung der ePrivacy-Richtlinie als Verordnung, die auch für die EuGH-Rechtsauslegung einige Unterschiede machen könnte, gilt als unverrückbare Parlamentsposition, dass in den dort laufenden Trilogen nicht über die Vorratsdatenspeicherung verhandelt wird. Allerdings gab es immer wieder Versuche, entsprechende Vorhaben in den Prozess einzuspeisen – denen allerdings mit der Koalitionsvertrags-Position der Ampelregierung in Berlin geringere Chancen denn zuvor eingeräumt werden.
Allerdings gibt es bis heute keinen Vorschlag für eine deutsche Neuregelung, während das Verfahren zur nicht angewendeten deutschen Regelung in Luxemburg noch nicht abgeschlossen ist. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es zum Urteil: “Es enthält keine konkrete Aussage zum deutschen Modell einer auf bestimmte Datenkategorien beschränkten Speicherverpflichtung”, so eine Sprecherin auf Anfrage. Im nun SPD-geführten BMI, das traditionell als Fürsprecher einer Vorratsdatenspeicherung auftrat, wurden auch die Ausnahmen im gestrigen Urteil zur Kenntnis genommen. Sollte es zu einer Neuregelung mit einer Teil-Vorratsdatenspeicherung kommen, scheinen jedoch die nächsten Klagen vor dem EuGH garantiert.
Entsprechende Gerichtsverfahren könnten dann erneut Jahre die Justiz beschäftigen und Rechtssicherheit weiterhin ausbleiben – nach inzwischen eineinhalb Jahrzehnten, in denen die Vorratsdatenspeicherung von Strafverfolgern und Sicherheitsbehörden stets für unverzichtbar erklärt wurde, jedoch in vielen EU-Mitgliedstaaten längst nicht mehr stattfindet.
Stattdessen hat sie gleich mehrfach Rechtsgeschichte geschrieben: Einmal, indem der Europäische Gerichtshof erstmals strengere Anforderungen an einen Grundrechtseingriff definierte als das ebenfalls mit der Materie befasste Bundesverfassungsgericht und andere europäische Gerichte. Aber auch mit Blick auf die sich abzeichnende Verfügbarkeit weiterer Datenmassen, etwa aus Fahrzeugen und Sensoriksystemen, für die der EuGH fallbasiert seine eigene Dogmatik im Grundrechtsschutz zu entwickeln begann. Die Vorratsdatenspeicherung bleibt in ihren verschiedenen Ausgestaltungen für Rechtswissenschaftler und Innenpolitiker auf absehbare Zeit relevant, ihre Wirkung in der Praxis bleibt jedoch weiterhin fraglich.
Innovation fördern, Vorreiter belohnen und gleiche Ausgangsbedingungen für europäische Industrieanlagen schaffen – mit dem Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie über Industrieemissionen (IED) hofft die Kommission, für “langfristige Investitionssicherheit” bei Betreibern von Industrieanlagen zu sorgen. Von einer “erheblichen Verringerung der schädlichen Emissionen von Industrieanlagen und Europas größten Nutztierhaltungsbetrieben”, sprach Exekutivpräsident Frans Timmermans am Dienstag. Die neuen Vorschriften sollen “als Richtschnur für langfristige Investitionen fungieren”, auch um Europas Energie- und Ressourcenunabhängigkeit zu erhöhen, so der Green Deal-Kommissar.
Ab voraussichtlich 2024 soll es strengere Vorgaben für die Nutzung sogenannter “Best Available Techniques” (BAT) zur Emissionsvermeidung und Reduzierung geben. Welche BAT-Grenzwerte gelten, soll bereits bei der Genehmigung der Anlagen geprüft werden. Ab 2027 sollen die ersten BATs zum Einsatz kommen. So hätten Anlagenbetreiber ausreichend Zeit, um sich auf die Änderungen vorzubereiten, sagte Timmermans.
Außerdem sollen Ausnahmen von den Regelungen deutlich reduziert und durch einheitliche Methoden gewährt werden. Anlagenbetreiber müssen zudem Transformationspläne vorlegen, mit Blick auf das Null-Schadstoff-Ziel, das Kreislaufwirtschaftsziel und das Dekarbonisierungsziel der EU bis 2050.
Ein neues Innovationszentrum für industrielle Transformation und Emissionen (INCITE) soll Innovationsführer aus der Industrie dabei unterstützen, “Lösungen zur Eindämmung der Umweltverschmutzung zu ermitteln”. Für diese Unternehmen würden flexiblere Genehmigungsvorschriften gelten als für jene, die auf herkömmliche Technologien setzen.
Effektiv betrifft die IED laut der Kommission bisher rund 50.000 große Industrieanlagen und Intensivtierhaltungsbetriebe in Europa. Mit der Überarbeitung soll der Umfang erweitert werden. Darunter: Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltungsbetriebe, die laut Kommission für 60 Prozent der Ammoniakemissionen und 43 Prozent der Methanemissionen aus der Nutztierhaltung in der EU verantwortlich sind. 265.000 Tonnen Methan– und 128.000 Tonnen Ammoniakemissionen will die Kommission so jährlich einsparen.
Dadurch könnten “positive Auswirkungen für die menschliche Gesundheit im Gegenwert von mindestens 5,5 Milliarden Euro pro Jahr erzielt werden”, versprach Umwelt-Kommissar Virginijus Sinkevičius. Finanziert werden soll diese Transformation durch Finanzhilfen aus der GAP.
Auch die Gewinnung von Industriemineralen und -metallen für die Batterieproduktion soll unter die Richtlinie fallen. Da diese künftig zunehmen würden, müssten Produktionsverfahren “so effizient wie möglich und die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich” gehalten werden.
Jens Gieseke (EVP/CDU), Mitglied in den Ausschüssen für Umwelt und Industrie, fürchtet allerdings ein teures Bürokratiemonster. Laut ihrer eigenen Folgenabschätzung erwarte die Kommission durch ihren Vorschlag 210 Millionen Euro jährliche Mehrkosten für die europäische Industrie, sagt Gieseke. “Die Aufnahme von landwirtschaftlichen Betrieben soll zusätzlich 412 Millionen Euro im Jahr kosten, dazu kommen 370 Millionen Euro zusätzliche Bürokratiekosten für die Industrie und 336 Millionen Euro für die öffentlichen Einrichtungen.” Statt 1,3 Milliarden Euro Mehrkosten durch Gesetzgebung vorzuschlagen, müsse über 1,3 Milliarden Euro Entlastungen für Industrie und Betriebe nachgedacht werden, fordert der CDU-Abgeordnete.
BusinessEurope-Generaldirektor, Markus J. Beyrer, hält die IED zudem für den falschen Ort für den industriellen Wandel. “Der Vorschlag greift auch Themen auf, die durch andere Legislativvorschläge weitgehend abgedeckt sind und dort besser behandelt werden.” Durch die Überarbeitung werde die europäische Industrie zusätzliche Unsicherheit erleben, so Beyrer.
Ebenfalls am Dienstag legte die Kommission Vorschläge für strengere Kontrollen fluorierter Treibhausgase (F-Gase) und ozonabbauender Stoffe (ODS) vor. 2,5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen entfallen laut Kommission auf F-Gase. Mit ihrem Vorschlag sollen bis 2030 ein Äquivalent von 40 Millionen Tonnen CO2 und bis 2050 ein Äquivalent von 310 Millionen Tonnen CO2 weniger emittiert werden.
Die neue Regelung für ODS soll insbesondere deren Verwendung in Konsumprodukten stärker reglementieren und so bis 2050 Emissionen “in Höhe des Äquivalents von 180 Millionen Tonnen CO2 und 32.000 Tonnen Ozonabbaupotenzial” verhindern.
Neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe wie Gaspipelines wird ab 2024 in der EU wohl nicht mehr über die Fazilität “Connecting Europe” gefördert werden können. Das Parlament stimmte am Montag mit deutlicher Mehrheit für den Text der überarbeiteten TEN-E-Verordnung zu transeuropäischen Energienetzen. Damit nahmen die Abgeordneten eine Einigung mit den Mitgliedsstaaten vom Dezember vergangenen Jahres an (Europe.Table berichtete). Abschließend muss der Rat noch einmal formal zustimmen. Wahrscheinlich sei es zu spät, die Einigung wieder zu öffnen, sagte Berichterstatter Zdzisław Krasnodębski (ECR) im Plenum.
Mit der 2020 begonnenen Novelle wird die Förderung neuer Erdöl- und Erdgasprojekte beendet. Im vergangenen November hatte die Kommission allerdings noch die fünfte Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI) angenommen. Darin finden sich noch 20 letzte Vorhaben zum Ausbau von Gasleitungen in Ost- und Südeuropa. Die PCI-Liste wird alle zwei Jahre aktualisiert. Künftig erlaubt die Novelle der TEN-E-Verordnung nur noch jeweils ein Gasprojekt für die Anbindung von Malta und Zypern, die jedoch auf Wasserstoff umrüstbar (H2-ready) sein müssen. Neue grenzüberschreitende Gasleitungen können zwar grundsätzlich auch weiterhin gebaut werden, sie profitieren dann aber nicht mehr von vereinfachten Verfahren und Förderung durch “Connecting Europe”.
Bis Ende 2027 können nach der novellierten Verordnung zudem noch Projekte gefördert werden, die bestehende Erdgasleitungen oder Speicher für die Beimischung von Wasserstoff umrüsten. Die neue TEN-E-Verordnung soll außerdem Genehmigungs- und Zulassungsverfahren beschleunigen – erstmals auch für große Elektrolyseure zur Produktion von Wasserstoff. Für die Netzplanung von Offshore-Windparks wird die Möglichkeit einer unverbindlichen Zusammenarbeit geschaffen. Bisher durften solche Parks jeweils nur an das Netz eines Mitgliedsstaates angeschlossen werden. ber
Das Fit-for-55-Paket macht Fortschritte. Das erste Dossier des Pakets hat gestern die Hürde der Parlamentsabstimmung genommen. Der Bericht zur Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve (MSR) wurde mit 490 Stimmen bei 129 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen im Plenum in Straßburg angenommen (Europe.Table berichtete). Die MSR-Reform soll das europäische Emissionshandelssystem (ETS) besser vor Preisschocks schützen, indem eine höhere Anzahl überschüssiger Zertifikate (24 Prozent) in die Reserve übergehen. Mit der Annahme des Parlamentsberichts beginnen die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten.
Außerdem hat die französische Ratspräsidentschaft zu Beginn der Woche einen Kompromissvorschlag für die Überarbeitung der sogenannten “Effort Sharing Regulation” (ESR) vorgelegt – ebenfalls ein Teil des Fit-for-55-Pakets. Contexte veröffentlichte das Papier am Dienstag.
Die Lastenteilungsverordnung legt für jeden Mitgliedstaat jährliche Emissionsreduktionsziele bis 2030 für jene Sektoren fest, die nicht in das ETS einbezogen sind. Die Kommission hatte eine EU-weite Zielerhöhung auf 40 Prozent Emissionsreduktion in den betroffenen Sektoren veranschlagt – Vergleichsjahr 2005. In der aktuell geltenden Effort Sharing Regulation stehen noch 29 Prozent. Daraus ergeben sich auch individuelle Zielerhöhung für die Mitgliedstaaten, wobei die geforderten Reduktionen je nach Pro-Kopf-BIP zwischen 10 und 50 Prozent liegen – Vergleichsjahr ebenfalls 2005.
Um den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Umsetzung dieser Ziele zu ermöglichen, schlägt die französische Ratspräsidentschaft nun vor, die Obergrenzen für die Übertragung von jährlichen Emissionsrechten zwischen einzelnen Staaten zu erhöhen. Länder könnten ihre Ziele entsprechend vermehrt von anderen Staaten erfüllen lassen. Auch der Zugang zu einer Reserve, aus der Mitgliedstaaten schöpfen können, die Schwierigkeiten bei der Zielerfüllung haben, soll erleichtert werden.
Zudem sieht der Kompromiss vor, dass bei der für 2025 vorgesehenen Aktualisierung der jährlichen Emissionszuteilungen nur Erhöhungen berücksichtigt werden sollen, um den Mitgliedstaaten bei den Reduktionszielen “mehr Vorhersehbarkeit” zu ermöglichen. Ausgeglichen werden soll dieser Schritt durch die gesamte Zielerhöhung der Emissionsreduktion. Die 40 Prozent aus dem Kommissionsvorschlag blieben von der französischen Ratspräsidentschaft jedoch unberührt. luk
Die Europäische Union leitet ein Disziplinarverfahren gegen Ungarn ein. Dies gab EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag vor dem EU-Parlament bekannt. Sie bestätigte damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Insider. Deren Angaben zufolge könnte das Verfahren dazu führen, dass Finanzmittel für die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán eingefroren werden. Eine der mit der Sache vertrauten Personen sagte allerdings, es könne noch Monate dauern, bis die Kommission die entsprechenden Maßnahmen den Mitgliedstaaten für eine Entscheidung vorlegt.
Es ist das erste Mal, dass die EU das im Jahr 2020 eingeführte Verfahren anwendet. Orbáns nationalkonservative Fidesz-Partei hatte am Sonntag die Parlamentswahl mit überraschend großem Vorsprung gewonnen (Europe.Table berichtete). Er steht damit vor seiner vierten Amtszeit. Die EU liegt seit Jahren in vielen Fragen mit Orbán über kreuz. So hat die EU im Streit über Demokratie-Standards bereits Gelder für Ungarn eingefroren. Orbán sieht Ungarn nach eigenen Worten als “illiberale Demokratie” und steht für eine Betonung der nationalen Souveränität, traditionelle christliche Werte, eine harte Haltung bei der Einwanderung und Widerstand gegen die Rechte von sexuellen Minderheiten. rtr
Die EU-Finanzminister haben sich nicht auf eine gemeinsame Umsetzung der globalen Mindeststeuer einigen können. Der deutsche Ressortchef Christian Lindner (FDP) sagte am Dienstag in Luxemburg, alle Länder bis auf Polen seien sich einig gewesen. Es sei bedauerlich, dass es trotz guter Vorarbeiten kein Signal der Geschlossenheit in Europa gebe. Zwar dürfe die Steuerlast für Unternehmen nicht zu hoch werden. Steuerdumping sei aber abzulehnen.
Steuerfragen erfordern in der aus 27 Ländern bestehenden Europäischen Union stets Einstimmigkeit, weswegen Änderungen oft mühsam sind. Die neuen Regeln sollen ab 2023 greifen. Der Zeitplan gilt aber als sehr ambitioniert und nur schwer zu halten.
Knapp 140 Staaten hatten sich im Oktober 2021 auf Details einer globalen Steuerreform geeinigt. Dazu gehört eine Mindeststeuer in Höhe von 15 Prozent für international agierende Unternehmen. Außerdem sollen Schwellenländer mehr Einnahmen von den größten Konzernen der Welt abbekommen. Steueroasen sollen so ausgetrocknet und vor allem die großen Digitalkonzerne stärker in die Pflicht genommen werden.
Polen hat nach Angaben der Regierung in Warschau Bedenken, dass die von Frankreich vorgeschlagene Umsetzung nicht dazu führen wird, dass große Konzerne künftig Steueroasen meiden. Es fehle an Rechtsverbindlichkeit. Frankreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und pocht auf eine schnelle Umsetzung in der EU.
Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte, die Sorgen Polens seien berücksichtigt worden. Andere Staaten hätten auch Zugeständnisse gemacht. Vor einem Monat hatten auch Schweden, Malta und Estland eine Einigung noch blockiert, nun aber nicht mehr. Le Maire sagte, er werde das Thema nächsten Monat wieder auf die Tagesordnung setzen. rtr
Große Online-Plattformen müssen mit einer jährlichen Gebühr von bis zu 0,1 Prozent der jährlichen Nettoeinnahmen rechnen, um die Kosten für die Durchsetzung neuer EU-Vorschriften zu decken (Europe.Table berichtete), welche von ihnen verlangen, mehr für die Kontrolle ihrer Inhalte zu tun. Dies geht aus einem EU-Dokument hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.
Die Regeln, die Teil des Digital Services Act sein sollen (Europe.Table berichtete), werden wahrscheinlich noch in diesem Monat zwischen den EU-Ländern und den EU-Gesetzgebern vereinbart. Die Erhebung einer solchen Gebühr für die Einhaltung der Vorschriften wäre das erste Mal, dass die EU-Exekutive eine solche Gebühr erhebt.
“Der Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren basiert auf den geschätzten Kosten, die der Kommission im Zusammenhang mit ihren Aufsichtsaufgaben gemäß dieser Verordnung entstehen”, heißt es in dem Dokument.
EU-Kartellamtschefin Margrethe Vestager habe den Gesetzgebern und den Mitgliedstaaten letzten Monat gesagt, dass die Aufsichtsgebühren zwischen 20 und 30 Millionen Euro jährlich einbringen könnten, sagte eine Person mit direkter Kenntnis der Angelegenheit gegenüber Reuters. rtr

Sie meldet sich aus einem Taxi. Prof. Dr. Daniela Schwarzer ist auf dem Weg vom Flughafen Charles de Gaulle in die Pariser Innenstadt. “Im Moment reise ich noch viel zu wenig”, erzählt sie. Wenn die Pandemie es zulasse, werde es hoffentlich bald wieder mehr sein. Seit vergangenem Jahr leitet die 49-Jährige als Executive Director die Open Society Foundations in Europa und Eurasien. Die zweitgrößte Stiftung der Welt ist ein Global Player der Philanthropie, der sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzt.
Schwarzers aktueller Auftrag: Sie soll die verschiedenen regionalen Einheiten der Stiftung in ihrem Zuständigkeitsbereich neu sortieren und miteinander verzahnen. Woher ihre Leidenschaft fürs Internationale kommt? Die gebürtige Hamburgerin berichtet von London, wo sie einen Teil ihrer Kindheit verbrachte: “Dort habe ich gemerkt, wie spannend es ist, in ein anderes Land und eine andere Sprache einzutauchen.” Nachdem sie in Tübingen und am renommierten Pariser Sciences Po Politikwissenschaft studiert hatte, schrieb sie als Frankreich-Korrespondentin für die Financial Times Deutschland.
Danach liest sich ihr Lebenslauf wie ein Who’s-Who der Denkfabriken: Stiftung Wissenschaft und Politik, Marshall Fund, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bei letzterer war sie bis 2021 Leiterin. Im Moment treibt Schwarzer um, wie sich die EU auf der Weltbühne zwischen den USA und China behaupten kann. Darüber hat sie im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht: “Final Call” – letzter Aufruf. Europa müsse sich beeilen, um im Systemwettbewerb mithalten zu können. Ihre Expertise darüber, wie das gelingen könnte, ist gefragt. Immer wieder berät Schwarzer Regierungen und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, sie lehrt an verschiedenen Hochschulen.
Man merkt, dass es ihr Freude macht, verschiedene Perspektiven zu verstehen und Brücken zu schlagen. An Konzepten, wie man die Union weiter stärken könne, mangele es nicht. Aber es fehle oft die Bereitschaft, nationale Kompetenzen für europäische Zusammenarbeit aufzugeben. Sie findet: “Es geht nicht um die Aufgabe von Souveränität, es geht um ihren Rückgewinn.” Die nationalistischen Tendenzen in vielen Ländern machen ihr Sorgen. Hoffnungsvoll stimmen sie hingegen Beispiele dafür, dass die EU aus ihren Krisen etwas lernt. Mit dem Corona-Wiederaufbaufonds etwa habe man etwas “politisch Mutiges” und “inhaltlich sehr Richtiges” auf die Schiene gesetzt.
“Ich finde es bemerkenswert, dass diese Einigung in der Covid-Krise so verhältnismäßig schnell möglich war”, sagt sie. In der Schulden- und Bankenkrise sei der Einigungsprozess zwischen den Staaten noch deutlich steiniger gewesen. Schwarzer bezahlt ihren Taxifahrer und steigt aus, im Hintergrund hört man nun das Hupen des Pariser Stadtverkehrs. Ob sie optimistisch ist, dass Europa in 20 Jahren international noch genauso einflussreich ist wie heute? “Ja”, antwortet Schwarzer. “Aber das erfordert richtig viel Arbeit und Weitsicht.” Paul Meerkamp (Das Gespräch wurde am 7. Februar 2022 geführt)
das fünfte Sanktionspaket der EU gegen Russland, über das heute beraten wird, fällt schärfer aus als zunächst geplant. Als Reaktion auf die Gräueltaten in Butscha wird jetzt unter anderem über ein Kohleembargo nachgedacht. Till Hoppe hat das Sanktionspaket, bestehend aus sechs Punkten, analysiert.
Die Vorratsdatenspeicherung blickt auf eine bewegte Rechtsgeschichte zurück – seit eineinhalb Jahrzehnten beharren Strafverfolger und Sicherheitsbehörden auf ihre Wichtigkeit. Viele Mitgliedstaaten praktizieren sie aber längst nicht mehr. Der Europäische Gerichtshof auch in seiner jüngsten Entscheidung wieder dargelegt, warum eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung unzulässig ist. Falk Steiner analysiert, welche Schlupflöcher sich aber aufgetan haben.
Lukas Scheid hat sich den Vorschlag zur Reform der Richtlinie über Industrieemissionen angesehen, mit dem die EU-Kommission auf Innovationen, gleiche Ausgangsbedingungen für europäische Industrieanlagen und vor allem langfristige Investitionssicherheit hofft. Stimmen fürchten allerdings, dass die EU ein weiteres Bürokratiemonster geschaffen hat.
Das erste Dossier des Fit-for-55-Pakets, der Bericht zur Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve, wurde gestern im Parlament mit großer Mehrheit angenommen. Die Reform soll das europäische Emissionshandelssystem vor Preisschocks schützen. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Mit Daniela Schwarzer, Executive Director der Open Society Foundations, ist eine echte Verfechterin der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa im Europe.Table-Portrait. Ihre Expertise darüber, wie Europa im Systemwettbewerb mithalten kann, ist immer gefragt.

Die Europäische Union wird voraussichtlich erstmals Energielieferungen aus Russland mit Sanktionen belegen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug gestern ein Einfuhrverbot für russische Kohle vor. Die Kommission arbeite überdies an Maßnahmen gegen die Erdöleinfuhren aus dem Land, sagte sie.
Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten sollen heute Vormittag über das neue Sanktionspaket beraten, das aus insgesamt sechs Elementen besteht. Es fällt deutlich schärfer aus als zunächst geplant. Kommission und Mitgliedstaaten reagieren damit auf die vielen toten Zivilisten (Europe.Table berichtete), die am Wochenende nach dem Abzug russischer Truppen aus Vororten der ukrainischen Hauptstadt Kiew entdeckt worden waren und international für Erschütterung gesorgt hatten.
Mit einem Kohle-Embargo gegen Russland nimmt die EU denjenigen Energieträger ins Visier, für den sie recht unproblematisch alternative Lieferanten findet. Russische Steinkohle machte laut Bundeswirtschaftsministerium bisher zwar rund 50 Prozent des deutschen Steinkohleverbrauchs aus. Kraftwerksbetreiber und Industriekunden wie die Stahlbranche hätten aber bereits begonnen, die Lieferverträge umzustellen. Ein Großteil der Kraftwerke könne daher bis zum Frühsommer gänzlich auf russische Kohle verzichten, schrieb das BMWK in seinem jüngsten Fortschrittsbericht Energiesicherheit. Da der Importstopp nicht sofort, sondern erst nach eine Übergangsfrist von drei Monaten greifen soll, wäre das wohl verkraftbar.
Das Embargo betrifft laut Kommission Kohle-Lieferungen aus Russland im Wert von vier Milliarden Euro. Als alternative Lieferanten stehen laut dem Verein der Kohlenimporteure insbesondere die USA, Kolumbien und Südafrika bereit. Dies sei auch technisch unproblematisch, da bei Steinkohle unterschiedliche Qualitäten leicht gemischt werden könnten. Der liquide Weltmarkt bedeutet aber zugleich, dass der Kohle-Importstopp der EU Russlands Präsidenten nicht sonderlich treffen wird.
Russland werde die Kohlen, die bisher in die EU gingen, künftig wahrscheinlich an Indien und die Türkei liefern, sagte ein Händler zu Europe.Table. Er rechnet lediglich mit einer anderen Verteilung der Brennstoffexporte. Europa könnte etwa Kohlen aus Kolumbien und Südafrika beziehen, die zuvor für Indien und die Türkei bestimmt waren. Über den Hafen von Wanino im Osten des Landes habe Russland bisher außerdem Kohle nach China und Japan verschifft.
Die überschaubaren Schwierigkeiten erleichtern es aber der Bundesregierung, den Einfuhrbann mitzutragen. Berlin hat sich bislang dagegen gewehrt, die Energielieferungen aus Russland zu stoppen. Die Ampel-Koalition ist sich weitgehend einig, dass die Kosten eines Erdgas-Embargos zu hoch wären. Bei Erdöl ist das Bild diffuser.
2021 hatten Rosneft und Co etwa 35 Prozent des deutschen Ölverbrauchs gedeckt. Bis Mitte dieses Jahres will das BMWK diese Importe halbieren. Das Problem: Die Groß-Raffinerien in Leuna und Schwedt werden bislang über Pipelines aus Russland mit Rohöl versorgt. Um dort Öl etwa aus dem Nahen Osten verarbeiten zu können, müssen die Lieferungen über Häfen wie Rostock oder Danzig erfolgen sowie per LKW und Zug.
Hinzu kommt: Die Raffinerie in Schwedt gehört Rosneft. Der Kreml-nahe Staatskonzern wird die Lieferbeziehungen mit Russland kaum freiwillig beenden. Wirtschaftsminister Robert Habeck arbeitet daher an Möglichkeiten, Rosneft die Kontrolle über die Raffinerie zu entwinden.
Auf EU-Ebene wächst nach den Ereignissen von Butscha die Unterstützung für ein Öl-Embargo gegen Russland. Diskutiert werden unterschiedliche Ansätze, etwa russische Öllieferungen mit hohen Strafzöllen zu belegen, wie dies zuletzt ein Beratergremium der französischen Regierung empfohlen hatte. Geprüft wird laut von der Leyen auch, dass Kunden in der EU für die Lieferungen auf ein Treuhandkonto einzahlen. Das Geld würde bei diesem im Umgang mit dem Iran erprobten Vorgehen erst dann freigegeben, wenn Russland seinen Krieg in der Ukraine beendet.
Noch aber schlägt die Kommission kein Öleinfuhrverbot vor. Das neue, insgesamt fünfte Sanktionspaket enthält vielmehr noch diese weiteren Maßnahmen:
Vertreter der US-Regierung kündigten überdies an, gemeinsam mit den Verbündeten heute ein Verbot aller neuen Investitionen in Russland zu beschließen.
Auf ein Gas-Embargo hingegen verzichten EU und USA. Stattdessen bemühen sich die Mitgliedstaaten zunächst, die Gasspeicher für die kommenden Winter ausreichend zu füllen. Über die entsprechende Vorlage der Kommission vom 23. März will das Parlament zügig verhandeln. Am Dienstag stimmte das Plenum für das Dringlichkeitsverfahren, um schnell europaweite Mindestfüllstände und Zertifizierungsverfahren für Speicherbetreiber einführen zu können. Schon am Donnerstag soll der Kommissionsvorschlag in erster Lesung behandelt und an den Industrieausschuss verwiesen werden, der dann in den Trilog mit Kommission und Rat gehen wird. Mit Manuel Berkel und rtr
Seit dem Grundsatzurteil 2014 zur anlasslosen, massenhaften und umfassenden Vorratsdatenspeicherung, wie sie 2006 beschlossen worden war, hatten die Richter sich immer wieder mit kreativen Ideen der Mitgliedstaaten zu beschäftigen. Europaweit hatten sich Gesetzgeber nicht davon abhalten lassen, erneut Varianten einer Vorratsdatenspeicherung zu verabschieden – in Deutschland zuletzt durch die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD 2015. Ende 2016 hatte der EuGH dann in einem weiteren Beschluss noch einmal konkretisiert, inwiefern eine Vorratsdatenspeicherung europarechtswidrig ist – was im Ergebnis dazu führte, dass seit 2017 die Pflicht zur Umsetzung in Deutschland ausgesetzt ist.
Seitdem lag die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland auf Eis, diverse Gerichtsverfahren sind hierzu noch anhängig, unter anderem beim EuGH. Doch der Gesamtzustand ist für alle Beteiligten, von Polizei bis zu den Gegnern, unbefriedigend. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP heißt es dazu, man werde “die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher, anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können.”
Dies bedeutet im Kern eine Abkehr von einer Vorratsdatenspeicherung und die Hinwendung zum sogenannten Quick Freeze-Konzept. Bei diesem erfolgt der Zugriff nicht auf zuvor auf Vorrat gespeicherte Daten, sondern es wird ab einem definierten Zeitpunkt in die Zukunft gespeichert, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Für dieses Konzept hatte sich insbesondere die FDP in der Vergangenheit immer stark gemacht. Doch mit dem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofes könnte die Debatte erneut neue Wege nehmen.
Mit ihrem Urteil gingen die Richter nun auf Vorlagefragen von Gerichten aus Irland und Dänemark zur Klärung der Vereinbarkeit nationaler Regelungen mit dem Europarecht ein. Und stellten klar, dass auch das Ziel, schwere Straftaten aufzuklären, keinen ausreichenden Grund für eine flächendeckende und anlasslose Speicherung bieten würden. Bei der Bedrohung der Nationalen Sicherheit sei eine Vorratsdatenspeicherung zulässig. Doch der irische Weg, schwere Kriminalität kurzerhand zur Frage Nationaler Sicherheit zu erheben, stieß bei den Richtern in Luxemburg auf deutlichen Widerstand.
Eine die Vorratsdatenspeicherung erlaubende Bedrohung der Nationalen Sicherheit würde hinreichend konkrete Umstände voraussetzen. So heißt es im Urteil: “Eine solche Bedrohung unterscheidet sich somit in ihrer Art, ihrer Schwere und der Besonderheit der sie begründenden Umstände nach von der allgemeinen und ständigen Gefahr, dass – auch schwere – Spannungen oder Störungen der öffentlichen Sicherheit auftreten, oder schwerer Straftaten.” Öffentliche Sicherheit und Nationale Sicherheit müssten kategorial getrennt werden. Im Bereich öffentlicher Sicherheit sei eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung sowohl mit der ePrivacy-Richtlinie als auch mit den Garantien der Europäischen Grundrechtecharta unvereinbar.
Allerdings gilt dies nicht für alle Formen einer anlasslosen Speicherung: Die Richter konkretisierten in ihrer gestrigen Entscheidung noch einmal ihre Kriterien, unter denen die Speicherung von IP-Adressen auf Vorrat doch zulässig sein kann (Randnummer 73). Dies betrifft insbesondere Fragen wie die Zugangssicherung zu gespeicherten Daten und die Voraussetzungen, wer unter welchen Umständen auf diese zugreifen dürfe. Auf eine dänische Vorlagefrage hin wurde etwa Staatsanwälten abgesprochen, ausreichend unparteiisch zu sein, um einen Datenzugriff erlauben zu können.
Auch möglich bleibt dem Urteilstext zufolge eine Vorratsdatenspeicherung anhand anderer Kriterien: So ist eine auf konkrete Personen bezogene Speicherung für das höchste Europäische Gericht gleichermaßen zulässig wie eine standortbezogene Ausgestaltung, wenn es sich hierbei objektiv, so der EuGH, um “strategische Orte” mit hohem Besucheraufkommen (Rn. 81) wie Bahnhöfe und Flughäfen oder bei einem Ort “aufgrund objektiver und nicht diskriminierender Anhaltspunkte” davon auszugehen sei, “dass in einem oder mehreren geografischen Gebieten eine durch ein erhöhtes Risiko der Vorbereitung oder Begehung schwerer Straftaten gekennzeichnete Situation” eintrete.
Kritiker von Vorratsdatenspeicherungen aller Art sehen vor allem in diesen geografischen und technologiebezogenen Ausnahmen vom Regelverbot ein Problem. “Eine IP-Vorratsdatenspeicherung wäre ein Anschlag auf das Recht auf Anonymität im Netz und droht unsere komplette Internetnutzung nachvollziehbar zu machen”, kritisiert der Piraten-MdEP Patrick Breyer. “Auch die vermeintlich geografisch gezielte Vorratsdatenspeicherung droht einen Großteil der Bevölkerung ständig zu erfassen.” Breyer befürchtet, dass sich die EU-Kommission durch das gestrige Urteil zu weiteren Plänen zur Neuauflage ermuntert fühlen könnte.
Für die lange verzögerte Neufassung der ePrivacy-Richtlinie als Verordnung, die auch für die EuGH-Rechtsauslegung einige Unterschiede machen könnte, gilt als unverrückbare Parlamentsposition, dass in den dort laufenden Trilogen nicht über die Vorratsdatenspeicherung verhandelt wird. Allerdings gab es immer wieder Versuche, entsprechende Vorhaben in den Prozess einzuspeisen – denen allerdings mit der Koalitionsvertrags-Position der Ampelregierung in Berlin geringere Chancen denn zuvor eingeräumt werden.
Allerdings gibt es bis heute keinen Vorschlag für eine deutsche Neuregelung, während das Verfahren zur nicht angewendeten deutschen Regelung in Luxemburg noch nicht abgeschlossen ist. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es zum Urteil: “Es enthält keine konkrete Aussage zum deutschen Modell einer auf bestimmte Datenkategorien beschränkten Speicherverpflichtung”, so eine Sprecherin auf Anfrage. Im nun SPD-geführten BMI, das traditionell als Fürsprecher einer Vorratsdatenspeicherung auftrat, wurden auch die Ausnahmen im gestrigen Urteil zur Kenntnis genommen. Sollte es zu einer Neuregelung mit einer Teil-Vorratsdatenspeicherung kommen, scheinen jedoch die nächsten Klagen vor dem EuGH garantiert.
Entsprechende Gerichtsverfahren könnten dann erneut Jahre die Justiz beschäftigen und Rechtssicherheit weiterhin ausbleiben – nach inzwischen eineinhalb Jahrzehnten, in denen die Vorratsdatenspeicherung von Strafverfolgern und Sicherheitsbehörden stets für unverzichtbar erklärt wurde, jedoch in vielen EU-Mitgliedstaaten längst nicht mehr stattfindet.
Stattdessen hat sie gleich mehrfach Rechtsgeschichte geschrieben: Einmal, indem der Europäische Gerichtshof erstmals strengere Anforderungen an einen Grundrechtseingriff definierte als das ebenfalls mit der Materie befasste Bundesverfassungsgericht und andere europäische Gerichte. Aber auch mit Blick auf die sich abzeichnende Verfügbarkeit weiterer Datenmassen, etwa aus Fahrzeugen und Sensoriksystemen, für die der EuGH fallbasiert seine eigene Dogmatik im Grundrechtsschutz zu entwickeln begann. Die Vorratsdatenspeicherung bleibt in ihren verschiedenen Ausgestaltungen für Rechtswissenschaftler und Innenpolitiker auf absehbare Zeit relevant, ihre Wirkung in der Praxis bleibt jedoch weiterhin fraglich.
Innovation fördern, Vorreiter belohnen und gleiche Ausgangsbedingungen für europäische Industrieanlagen schaffen – mit dem Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie über Industrieemissionen (IED) hofft die Kommission, für “langfristige Investitionssicherheit” bei Betreibern von Industrieanlagen zu sorgen. Von einer “erheblichen Verringerung der schädlichen Emissionen von Industrieanlagen und Europas größten Nutztierhaltungsbetrieben”, sprach Exekutivpräsident Frans Timmermans am Dienstag. Die neuen Vorschriften sollen “als Richtschnur für langfristige Investitionen fungieren”, auch um Europas Energie- und Ressourcenunabhängigkeit zu erhöhen, so der Green Deal-Kommissar.
Ab voraussichtlich 2024 soll es strengere Vorgaben für die Nutzung sogenannter “Best Available Techniques” (BAT) zur Emissionsvermeidung und Reduzierung geben. Welche BAT-Grenzwerte gelten, soll bereits bei der Genehmigung der Anlagen geprüft werden. Ab 2027 sollen die ersten BATs zum Einsatz kommen. So hätten Anlagenbetreiber ausreichend Zeit, um sich auf die Änderungen vorzubereiten, sagte Timmermans.
Außerdem sollen Ausnahmen von den Regelungen deutlich reduziert und durch einheitliche Methoden gewährt werden. Anlagenbetreiber müssen zudem Transformationspläne vorlegen, mit Blick auf das Null-Schadstoff-Ziel, das Kreislaufwirtschaftsziel und das Dekarbonisierungsziel der EU bis 2050.
Ein neues Innovationszentrum für industrielle Transformation und Emissionen (INCITE) soll Innovationsführer aus der Industrie dabei unterstützen, “Lösungen zur Eindämmung der Umweltverschmutzung zu ermitteln”. Für diese Unternehmen würden flexiblere Genehmigungsvorschriften gelten als für jene, die auf herkömmliche Technologien setzen.
Effektiv betrifft die IED laut der Kommission bisher rund 50.000 große Industrieanlagen und Intensivtierhaltungsbetriebe in Europa. Mit der Überarbeitung soll der Umfang erweitert werden. Darunter: Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltungsbetriebe, die laut Kommission für 60 Prozent der Ammoniakemissionen und 43 Prozent der Methanemissionen aus der Nutztierhaltung in der EU verantwortlich sind. 265.000 Tonnen Methan– und 128.000 Tonnen Ammoniakemissionen will die Kommission so jährlich einsparen.
Dadurch könnten “positive Auswirkungen für die menschliche Gesundheit im Gegenwert von mindestens 5,5 Milliarden Euro pro Jahr erzielt werden”, versprach Umwelt-Kommissar Virginijus Sinkevičius. Finanziert werden soll diese Transformation durch Finanzhilfen aus der GAP.
Auch die Gewinnung von Industriemineralen und -metallen für die Batterieproduktion soll unter die Richtlinie fallen. Da diese künftig zunehmen würden, müssten Produktionsverfahren “so effizient wie möglich und die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich” gehalten werden.
Jens Gieseke (EVP/CDU), Mitglied in den Ausschüssen für Umwelt und Industrie, fürchtet allerdings ein teures Bürokratiemonster. Laut ihrer eigenen Folgenabschätzung erwarte die Kommission durch ihren Vorschlag 210 Millionen Euro jährliche Mehrkosten für die europäische Industrie, sagt Gieseke. “Die Aufnahme von landwirtschaftlichen Betrieben soll zusätzlich 412 Millionen Euro im Jahr kosten, dazu kommen 370 Millionen Euro zusätzliche Bürokratiekosten für die Industrie und 336 Millionen Euro für die öffentlichen Einrichtungen.” Statt 1,3 Milliarden Euro Mehrkosten durch Gesetzgebung vorzuschlagen, müsse über 1,3 Milliarden Euro Entlastungen für Industrie und Betriebe nachgedacht werden, fordert der CDU-Abgeordnete.
BusinessEurope-Generaldirektor, Markus J. Beyrer, hält die IED zudem für den falschen Ort für den industriellen Wandel. “Der Vorschlag greift auch Themen auf, die durch andere Legislativvorschläge weitgehend abgedeckt sind und dort besser behandelt werden.” Durch die Überarbeitung werde die europäische Industrie zusätzliche Unsicherheit erleben, so Beyrer.
Ebenfalls am Dienstag legte die Kommission Vorschläge für strengere Kontrollen fluorierter Treibhausgase (F-Gase) und ozonabbauender Stoffe (ODS) vor. 2,5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen entfallen laut Kommission auf F-Gase. Mit ihrem Vorschlag sollen bis 2030 ein Äquivalent von 40 Millionen Tonnen CO2 und bis 2050 ein Äquivalent von 310 Millionen Tonnen CO2 weniger emittiert werden.
Die neue Regelung für ODS soll insbesondere deren Verwendung in Konsumprodukten stärker reglementieren und so bis 2050 Emissionen “in Höhe des Äquivalents von 180 Millionen Tonnen CO2 und 32.000 Tonnen Ozonabbaupotenzial” verhindern.
Neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe wie Gaspipelines wird ab 2024 in der EU wohl nicht mehr über die Fazilität “Connecting Europe” gefördert werden können. Das Parlament stimmte am Montag mit deutlicher Mehrheit für den Text der überarbeiteten TEN-E-Verordnung zu transeuropäischen Energienetzen. Damit nahmen die Abgeordneten eine Einigung mit den Mitgliedsstaaten vom Dezember vergangenen Jahres an (Europe.Table berichtete). Abschließend muss der Rat noch einmal formal zustimmen. Wahrscheinlich sei es zu spät, die Einigung wieder zu öffnen, sagte Berichterstatter Zdzisław Krasnodębski (ECR) im Plenum.
Mit der 2020 begonnenen Novelle wird die Förderung neuer Erdöl- und Erdgasprojekte beendet. Im vergangenen November hatte die Kommission allerdings noch die fünfte Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI) angenommen. Darin finden sich noch 20 letzte Vorhaben zum Ausbau von Gasleitungen in Ost- und Südeuropa. Die PCI-Liste wird alle zwei Jahre aktualisiert. Künftig erlaubt die Novelle der TEN-E-Verordnung nur noch jeweils ein Gasprojekt für die Anbindung von Malta und Zypern, die jedoch auf Wasserstoff umrüstbar (H2-ready) sein müssen. Neue grenzüberschreitende Gasleitungen können zwar grundsätzlich auch weiterhin gebaut werden, sie profitieren dann aber nicht mehr von vereinfachten Verfahren und Förderung durch “Connecting Europe”.
Bis Ende 2027 können nach der novellierten Verordnung zudem noch Projekte gefördert werden, die bestehende Erdgasleitungen oder Speicher für die Beimischung von Wasserstoff umrüsten. Die neue TEN-E-Verordnung soll außerdem Genehmigungs- und Zulassungsverfahren beschleunigen – erstmals auch für große Elektrolyseure zur Produktion von Wasserstoff. Für die Netzplanung von Offshore-Windparks wird die Möglichkeit einer unverbindlichen Zusammenarbeit geschaffen. Bisher durften solche Parks jeweils nur an das Netz eines Mitgliedsstaates angeschlossen werden. ber
Das Fit-for-55-Paket macht Fortschritte. Das erste Dossier des Pakets hat gestern die Hürde der Parlamentsabstimmung genommen. Der Bericht zur Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve (MSR) wurde mit 490 Stimmen bei 129 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen im Plenum in Straßburg angenommen (Europe.Table berichtete). Die MSR-Reform soll das europäische Emissionshandelssystem (ETS) besser vor Preisschocks schützen, indem eine höhere Anzahl überschüssiger Zertifikate (24 Prozent) in die Reserve übergehen. Mit der Annahme des Parlamentsberichts beginnen die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten.
Außerdem hat die französische Ratspräsidentschaft zu Beginn der Woche einen Kompromissvorschlag für die Überarbeitung der sogenannten “Effort Sharing Regulation” (ESR) vorgelegt – ebenfalls ein Teil des Fit-for-55-Pakets. Contexte veröffentlichte das Papier am Dienstag.
Die Lastenteilungsverordnung legt für jeden Mitgliedstaat jährliche Emissionsreduktionsziele bis 2030 für jene Sektoren fest, die nicht in das ETS einbezogen sind. Die Kommission hatte eine EU-weite Zielerhöhung auf 40 Prozent Emissionsreduktion in den betroffenen Sektoren veranschlagt – Vergleichsjahr 2005. In der aktuell geltenden Effort Sharing Regulation stehen noch 29 Prozent. Daraus ergeben sich auch individuelle Zielerhöhung für die Mitgliedstaaten, wobei die geforderten Reduktionen je nach Pro-Kopf-BIP zwischen 10 und 50 Prozent liegen – Vergleichsjahr ebenfalls 2005.
Um den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Umsetzung dieser Ziele zu ermöglichen, schlägt die französische Ratspräsidentschaft nun vor, die Obergrenzen für die Übertragung von jährlichen Emissionsrechten zwischen einzelnen Staaten zu erhöhen. Länder könnten ihre Ziele entsprechend vermehrt von anderen Staaten erfüllen lassen. Auch der Zugang zu einer Reserve, aus der Mitgliedstaaten schöpfen können, die Schwierigkeiten bei der Zielerfüllung haben, soll erleichtert werden.
Zudem sieht der Kompromiss vor, dass bei der für 2025 vorgesehenen Aktualisierung der jährlichen Emissionszuteilungen nur Erhöhungen berücksichtigt werden sollen, um den Mitgliedstaaten bei den Reduktionszielen “mehr Vorhersehbarkeit” zu ermöglichen. Ausgeglichen werden soll dieser Schritt durch die gesamte Zielerhöhung der Emissionsreduktion. Die 40 Prozent aus dem Kommissionsvorschlag blieben von der französischen Ratspräsidentschaft jedoch unberührt. luk
Die Europäische Union leitet ein Disziplinarverfahren gegen Ungarn ein. Dies gab EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag vor dem EU-Parlament bekannt. Sie bestätigte damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Insider. Deren Angaben zufolge könnte das Verfahren dazu führen, dass Finanzmittel für die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán eingefroren werden. Eine der mit der Sache vertrauten Personen sagte allerdings, es könne noch Monate dauern, bis die Kommission die entsprechenden Maßnahmen den Mitgliedstaaten für eine Entscheidung vorlegt.
Es ist das erste Mal, dass die EU das im Jahr 2020 eingeführte Verfahren anwendet. Orbáns nationalkonservative Fidesz-Partei hatte am Sonntag die Parlamentswahl mit überraschend großem Vorsprung gewonnen (Europe.Table berichtete). Er steht damit vor seiner vierten Amtszeit. Die EU liegt seit Jahren in vielen Fragen mit Orbán über kreuz. So hat die EU im Streit über Demokratie-Standards bereits Gelder für Ungarn eingefroren. Orbán sieht Ungarn nach eigenen Worten als “illiberale Demokratie” und steht für eine Betonung der nationalen Souveränität, traditionelle christliche Werte, eine harte Haltung bei der Einwanderung und Widerstand gegen die Rechte von sexuellen Minderheiten. rtr
Die EU-Finanzminister haben sich nicht auf eine gemeinsame Umsetzung der globalen Mindeststeuer einigen können. Der deutsche Ressortchef Christian Lindner (FDP) sagte am Dienstag in Luxemburg, alle Länder bis auf Polen seien sich einig gewesen. Es sei bedauerlich, dass es trotz guter Vorarbeiten kein Signal der Geschlossenheit in Europa gebe. Zwar dürfe die Steuerlast für Unternehmen nicht zu hoch werden. Steuerdumping sei aber abzulehnen.
Steuerfragen erfordern in der aus 27 Ländern bestehenden Europäischen Union stets Einstimmigkeit, weswegen Änderungen oft mühsam sind. Die neuen Regeln sollen ab 2023 greifen. Der Zeitplan gilt aber als sehr ambitioniert und nur schwer zu halten.
Knapp 140 Staaten hatten sich im Oktober 2021 auf Details einer globalen Steuerreform geeinigt. Dazu gehört eine Mindeststeuer in Höhe von 15 Prozent für international agierende Unternehmen. Außerdem sollen Schwellenländer mehr Einnahmen von den größten Konzernen der Welt abbekommen. Steueroasen sollen so ausgetrocknet und vor allem die großen Digitalkonzerne stärker in die Pflicht genommen werden.
Polen hat nach Angaben der Regierung in Warschau Bedenken, dass die von Frankreich vorgeschlagene Umsetzung nicht dazu führen wird, dass große Konzerne künftig Steueroasen meiden. Es fehle an Rechtsverbindlichkeit. Frankreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und pocht auf eine schnelle Umsetzung in der EU.
Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte, die Sorgen Polens seien berücksichtigt worden. Andere Staaten hätten auch Zugeständnisse gemacht. Vor einem Monat hatten auch Schweden, Malta und Estland eine Einigung noch blockiert, nun aber nicht mehr. Le Maire sagte, er werde das Thema nächsten Monat wieder auf die Tagesordnung setzen. rtr
Große Online-Plattformen müssen mit einer jährlichen Gebühr von bis zu 0,1 Prozent der jährlichen Nettoeinnahmen rechnen, um die Kosten für die Durchsetzung neuer EU-Vorschriften zu decken (Europe.Table berichtete), welche von ihnen verlangen, mehr für die Kontrolle ihrer Inhalte zu tun. Dies geht aus einem EU-Dokument hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.
Die Regeln, die Teil des Digital Services Act sein sollen (Europe.Table berichtete), werden wahrscheinlich noch in diesem Monat zwischen den EU-Ländern und den EU-Gesetzgebern vereinbart. Die Erhebung einer solchen Gebühr für die Einhaltung der Vorschriften wäre das erste Mal, dass die EU-Exekutive eine solche Gebühr erhebt.
“Der Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren basiert auf den geschätzten Kosten, die der Kommission im Zusammenhang mit ihren Aufsichtsaufgaben gemäß dieser Verordnung entstehen”, heißt es in dem Dokument.
EU-Kartellamtschefin Margrethe Vestager habe den Gesetzgebern und den Mitgliedstaaten letzten Monat gesagt, dass die Aufsichtsgebühren zwischen 20 und 30 Millionen Euro jährlich einbringen könnten, sagte eine Person mit direkter Kenntnis der Angelegenheit gegenüber Reuters. rtr

Sie meldet sich aus einem Taxi. Prof. Dr. Daniela Schwarzer ist auf dem Weg vom Flughafen Charles de Gaulle in die Pariser Innenstadt. “Im Moment reise ich noch viel zu wenig”, erzählt sie. Wenn die Pandemie es zulasse, werde es hoffentlich bald wieder mehr sein. Seit vergangenem Jahr leitet die 49-Jährige als Executive Director die Open Society Foundations in Europa und Eurasien. Die zweitgrößte Stiftung der Welt ist ein Global Player der Philanthropie, der sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzt.
Schwarzers aktueller Auftrag: Sie soll die verschiedenen regionalen Einheiten der Stiftung in ihrem Zuständigkeitsbereich neu sortieren und miteinander verzahnen. Woher ihre Leidenschaft fürs Internationale kommt? Die gebürtige Hamburgerin berichtet von London, wo sie einen Teil ihrer Kindheit verbrachte: “Dort habe ich gemerkt, wie spannend es ist, in ein anderes Land und eine andere Sprache einzutauchen.” Nachdem sie in Tübingen und am renommierten Pariser Sciences Po Politikwissenschaft studiert hatte, schrieb sie als Frankreich-Korrespondentin für die Financial Times Deutschland.
Danach liest sich ihr Lebenslauf wie ein Who’s-Who der Denkfabriken: Stiftung Wissenschaft und Politik, Marshall Fund, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bei letzterer war sie bis 2021 Leiterin. Im Moment treibt Schwarzer um, wie sich die EU auf der Weltbühne zwischen den USA und China behaupten kann. Darüber hat sie im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht: “Final Call” – letzter Aufruf. Europa müsse sich beeilen, um im Systemwettbewerb mithalten zu können. Ihre Expertise darüber, wie das gelingen könnte, ist gefragt. Immer wieder berät Schwarzer Regierungen und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, sie lehrt an verschiedenen Hochschulen.
Man merkt, dass es ihr Freude macht, verschiedene Perspektiven zu verstehen und Brücken zu schlagen. An Konzepten, wie man die Union weiter stärken könne, mangele es nicht. Aber es fehle oft die Bereitschaft, nationale Kompetenzen für europäische Zusammenarbeit aufzugeben. Sie findet: “Es geht nicht um die Aufgabe von Souveränität, es geht um ihren Rückgewinn.” Die nationalistischen Tendenzen in vielen Ländern machen ihr Sorgen. Hoffnungsvoll stimmen sie hingegen Beispiele dafür, dass die EU aus ihren Krisen etwas lernt. Mit dem Corona-Wiederaufbaufonds etwa habe man etwas “politisch Mutiges” und “inhaltlich sehr Richtiges” auf die Schiene gesetzt.
“Ich finde es bemerkenswert, dass diese Einigung in der Covid-Krise so verhältnismäßig schnell möglich war”, sagt sie. In der Schulden- und Bankenkrise sei der Einigungsprozess zwischen den Staaten noch deutlich steiniger gewesen. Schwarzer bezahlt ihren Taxifahrer und steigt aus, im Hintergrund hört man nun das Hupen des Pariser Stadtverkehrs. Ob sie optimistisch ist, dass Europa in 20 Jahren international noch genauso einflussreich ist wie heute? “Ja”, antwortet Schwarzer. “Aber das erfordert richtig viel Arbeit und Weitsicht.” Paul Meerkamp (Das Gespräch wurde am 7. Februar 2022 geführt)