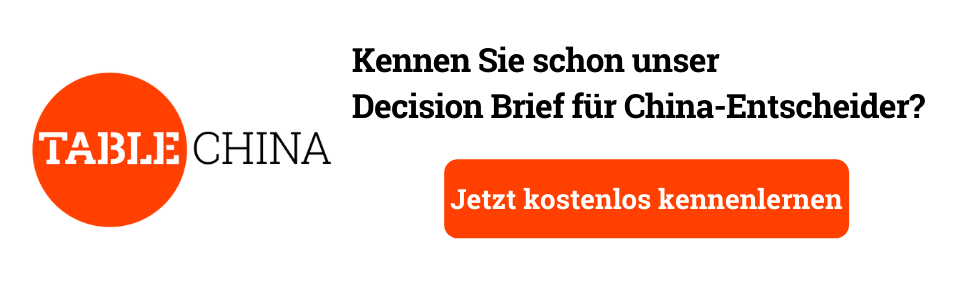zum ersten Mal hat die EU-Kommission den 2021 eingeführten Rechtsstaat-Mechanismus ausgelöst. Die Budget-Kürzungen, die Ungarn nun drohen, werden das Land hart treffen, schreibt Eric Bonse. Besonders das öffentliche Beschaffungswesen sei betroffen.
Vom Tisch ist dagegen der Vorschlag des EU-Erweiterungskommissars Olivér Várhelyi, den rechtsliberalen Polen Andrzej Sadoś zum höchsten Beamten der Generaldirektion für Erweiterung zu machen. Várhelyi gilt eher als Statthalter von Viktor Orbán denn als brennender Verfechter europäischer Werte, schreibt Stephan Israel.
Wie viele Länder der EU plagen auch Portugal und Spanien hohe Energiekosten. Grund ist der stark gestiegene Preis für Gas, der den Strompreis mit nach oben zieht. Die beiden Länder haben der EU-Kommission ein Konzept vorgelegt, mit dem sie den Gaspreis nun begrenzen wollen. Isabel Cuesta Camacho hat den Vorschlag analysiert.
Heute wird das EU-Parlament über eine Resolution zu den Sanktionen gegen Russland abstimmen. Im fünften Sanktionspaket wird voraussichtlich auch ein Embargo für Öl und Kohle enthalten sein. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Das Bundeskabinett hat gestern eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz verabschiedet. Was sich bei Ausschreibungen für erneuerbare Energien und förderfähigen Anlagen im EU-Ausland ändert, lesen Sie in den News.
Mit großer Mehrheit wurde gestern der Kompromiss zum Data Governance Act (DGA) im Europäischen Parlament angenommen und als “Auftakt einer digitalpolitischen Zeitenwende” bezeichnet. In den News lesen Sie Stimmen zum DGA.

Es ist eine Premiere: Als erstes EU-Land muss Ungarn mit einer Kürzung seiner Zahlungen aus dem Gemeinschaftsbudget rechnen. Die EU-Kommission bestätigte am Mittwoch in Brüssel (Europe.Table berichtete), dass sie den neuen Rechtsstaats-Mechanismus auslösen werde. Der formelle Beschluss sei für die erste Kommissionssitzung nach der Osterpause geplant, sagte Budgetkommissar Johannes Hahn im Gespräch mit Europe.Table und anderen europäischen Medien.
Der Rechtsstaats-Mechanismus war unter deutschem EU-Vorsitz Ende 2020 beschlossen und im Januar 2021 eingeführt worden. Er erlaubt nach einem mehrstufigen Verfahren die Kürzung von EU-Geldern (Europe.Table berichtete). Die Regierung in Budapest sprach von einem “Fehler”. Orbáns Kabinettschef Gergely Gulyas forderte die EU-Kommission auf, “die ungarischen Wähler nicht dafür zu bestrafen, dass sie bei den Wahlen am Sonntag, die von der Regierungspartei deutlich gewonnen wurden, keine Meinung nach dem Geschmack von Brüssel geäußert haben”. Ungarn dürfe nicht benachteiligt werden.
Für das Land geht es um viel Geld. 2020 flossen 4,6 Milliarden Euro mehr nach Ungarn als von dort in den EU-Haushalt eingezahlt wurde. Brüssel behält bereits jetzt die Zahlungen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück. Dabei geht es um rund sieben Milliarden Euro. Hahn sagte, in dem Streit mit Ungarn gehe es vor allem um das öffentliche Beschaffungswesen. Er rechne mit einer Entscheidung bei der nächsten Sitzung der EU-Kommission, die wegen der Osterpause erst Ende April stattfindet.
Danach erhält Ungarn eine offizielle Mitteilung, die den Rechtsstaats-Mechanismus formal auslöst. Die Regierung in Budapest muss auf diese “Notifizierung” antworten, dann entscheidet wieder die EU-Kommission. Wenn die Bedenken nicht ausgeräumt werden, legt die EU-Behörde einen Vorschlag zur Kürzung von Haushaltsmitteln vor.
Das letzte Wort hat der Ministerrat, der mit qualifizierter Mehrheit entscheiden muss. Insgesamt werde das Verfahren sechs bis neun Monate dauern, so Hahn. Orbán bleibt also noch eine Schonfrist bis zum Herbst. Danach könnte es ernst werden. Ärger droht schon jetzt wegen der Ukraine-Politik. Die von der EU-Kommission geplante Verschärfung der Sanktionen gegen Russland will Ungarn nicht mittragen. Die Ausweitung der Einfuhrbeschränkungen für Öl und Gas aus Russland sei für ihn eine rote Linie, sagte Ministerpräsident Orbán am Mittwoch in Budapest.
Er zeigte sich zudem bereit, für Gaslieferungen – wie von Russland verlangt – in Rubel zu bezahlen. Andere EU-Staaten, wie Deutschland, lehnen dies ab und wollen ihre Rechnungen weiterhin in Euro oder Dollar begleichen. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto ergänzte, die Gas-Versorgung des Landes sei durch einen Vertrag mit der staatlichen MVM und dem russischen Konzern Gazprom geregelt. In diesem Vertrag spiele die EU keine Rolle. Aus seiner Sicht sei eine gemeinsame Haltung der russisches Gas importierenden EU-Staaten nicht nötig.
Ein Appell zum Festhalten an der gemeinsamen europäischen Linie kam am Nachmittag aus Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erinnerte daran, dass sich die EU-Staaten der Entscheidung der G7-Energieminister angeschlossen hätten, Gaslieferungen weiter in den Währungen zu zahlen, die in den Verträgen mit Russland vereinbart seien.
Dieser Beschluss “hat eine sehr starke, bindende Wirkung für die Länder, die sich bei den Sanktionen beteiligen und ich hoffe, dass diese Bindewirkung so stark bleibt, dass die Leute nicht ausscheren”, sagte Habeck vor Journalisten in Berlin. Nach den Folgen für den Fall gefragt, dass Ungarn seine Ankündigung zu Rubelzahlungen umsetzt, sagte Habeck: “Das isoliert Ungarn”. Mit Manuel Berkel
Die heikle Personalie an der Spitze der Generaldirektion für Erweiterung (NEAR) ließ die Alarmglocken läuten. Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi wolle Polens EU-Botschafter Andrzej Sadoś zu seinem höchsten Beamten machen, hieß es im Brüsseler Europaviertel und im EU-Parlament in Straßburg noch vor wenigen Wochen. Nicht nur sind die beiden Männer befreundet. Beide sind auch stramm auf Linie ihrer rechtsliberalen Regierungen.
Bei Polens Ständigem Vertreter verwundert das weniger. Olivér Várhelyi wäre hingegen als EU-Kommissar eigentlich der europäischen Sache verpflichtet, hat sich aber seit Amtsantritt keinen Zentimeter von Budapest emanzipiert und gilt in Brüssel als Statthalter von Viktor Orbán.
Ausgerechnet das Erweiterungsressort wäre definitiv zum Hort der illiberalen Demokratie geworden. Das Ressort, das eigentlich den Beitrittskandidaten europäische Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Medien und demokratische Standards näherbringen sollte.
Nun gibt es zumindest an dieser Front Entwarnung, werden die schlimmsten Befürchtungen im Apparat nicht wahr. Olivér Várhelyi kann dem Vernehmen nach seine Traumbesetzung nicht durchdrücken. Die Episode ist typisch für den ungarischen EU-Kommissar. Im eigenen Haus stützt sich der 50-Jährige im Kabinett auf einen kleinen Kreis mit Mitarbeitenden.
Er gilt als misstrauisch und hatte schon auf seinem vorherigen Posten als Ungarns EU-Botschafter den Ruf als Zyniker, der unliebsame Mitarbeiter öffentlich abkanzelt. Im Kollegium unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat er keine Verbündeten. Er sei isoliert, viele würden ihn eher meiden, sagt einer, der ihn kennt: “Es ist nicht so, dass er jedermanns Liebling wäre, im Gegenteil”.
Personalbesetzungen auf der Stufe Generaldirektor müssen vom Kollegium abgesegnet werden. Dort war man schon irritiert, dass Várhelyi den Job extern ausschreiben ließ. Sonst werden in der Regel Spitzenposten intern vergeben. So dürfte es auch jetzt kommen. Guten Chancen soll Maciej Popowski haben, praktisch seit Beginn der Legislatur geschäftsführend im Amt. Auch der amtierende Generaldirektor kommt aus Polen, steht dort aber eher der Opposition nahe. Ebenfalls im Rennen sei die stellvertretende Generaldirektorin Katarina Mathernova, eine Slowakin.
Einfach dürfte die Zusammenarbeit so oder so nicht werden. Das Klima unter Olivér Várhelyi ist auf einem Tiefpunkt. Die Direktoren für Westbalkan oder Südliche Nachbarschaft und Türkei sind ebenfalls nur geschäftsführend besetzt. Für Stellenausschreibungen auf tieferer Stufe in den Abteilungen für Serbien, Bosnien oder Montenegro gab es kürzlich kaum Bewerbungen. Wer bleibe, sei demotiviert. Die Generaldirektion NEAR musste zuletzt eine Reihe von Posten an andere Abteilungen abgeben.
Das war allerdings, bevor die Ukraine, Georgien und Moldawien ihre Beitrittsbewerbungen einreichten. Eigentlich wäre jetzt eine gute Zeit zur Profilierung für einen Erweiterungskommissar. Olivér Várhelyi hält sich jedoch strikt an die Agenda seines Mentors Viktor Orbán. Nordmazedoniens blockiertes Beitrittsgesuch voranbringen? Kein Interesse. Orbáns Sympathien gehören Nikola Gruevski, einem früheren nationalistischen Regierungschef Nordmazedonien, zu Hause zu einer Haftstrafe wegen Korruption verurteilt und jetzt “politischer Flüchtling” in Budapest.
Wenn Olivér Várhelyi nach Israel fährt wie kürzlich, posiert er dort selbstverständlich mit Oppositionsführer Benjamin Nethanjahu, ebenfalls einem Verbündeter Orbáns. Absolute Priorität hat allerdings Serbien und dessen Beitrittsverfahren voranzubringen. Orbán und Serbiens frisch wiedergewählter Präsident Aleksandar Vučić betreiben eine ähnliche Schaukelpolitik zwischen Brüssel und Moskau.
Unvergessen in Brüssel die Episode im vergangenen Jahr, als Olivér Várhelyi sein Kabinett beauftragte, den Fortschrittsbericht seiner eigenen Leute zu Serbien zu entschärfen und Kritik an Rückschritten bei Rechtsstaatlichkeit oder Medienfreiheit zu verwässern. Gegensteuer gab es vom liberalen Belgier Didier Reynders, EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. Seither rede man zwischen den Kabinetten Várhelyi und Reynders nicht mehr, heisst es.
Auch in Bosnien-Herzegowina verfolgt der Erweiterungskommissar die ungarische Agenda und soll dort Milorad Dodik unterstützen, derzeit Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium. Dodik sabotiert den bosnischen Zentralstaat mit allen Mitteln und droht mit der Abspaltung der sogenannten Republika Srpska.
Ein EU-internes Dokument scheint die Vorwürfe zu belegen. 30 EU-Parlamentarier aus verschiedenen politischen Gruppen forderten darauf die Kommissionspräsidentin auf, den Vorwürfen nachzugehen. Ursula von der Leyen hat ihrem Erweiterungskommissar immer wieder das Vertrauen ausgesprochen und auch jetzt die Vorwürfe zurückgewiesen. Beobachter sehen die Zurückhaltung darin begründet, dass von der Leyen 2019 schließlich auch mit den Stimmen der Regierungspartei von Orbán zur Kommissionspräsidentin gewählt worden sei.
Auf dem jüngsten EU-Gipfel hatten Spanien und Portugal nach langen Diskussionen durchgesetzt (Europe.Table berichtete), dass für sie eine Ausnahme von den Regeln des europäischen Elektrizitätsmarktes gilt. Die Regierungen in Spanien und Portugal haben inzwischen ein Konzept nach Brüssel geschickt, wie sie verhindern wollen, dass der stark gestiegene Gaspreis den Strompreis nach oben zieht. Der Vorschlag, der noch von der Europäischen Kommission genehmigt werden muss, sieht vor, den Gaspreis für Stromerzeugungsanlagen auf maximal 30 Euro pro Megawattstunde zu begrenzen.
Das Dokument sei ein erster Vorschlag, der mit Brüssel weiter diskutiert werden solle, sagte ein Sprecher des Ministeriums für ökologischen Umbau in Madrid zu Europe.Table. Die Maßnahme könne den Strompreis auf 120 bis 130 Euro pro Megawattstunde senken, weniger als die Hälfte des Durchschnittspreises im März von 284 Euro.
Die Preisobergrenze von 30 Euro pro Megawattstunde würde für Gaskraftwerke gelten, die Strom für Verbraucher in Spanien und Portugal produzieren. Um Marktverzerrungen jenseits der iberischen Halbinsel zu vermeiden, würde sowohl der Gaspreis für die anderen Sektoren als auch der Strompreis auf dem Großhandelsmarkt nicht angetastet, der auch für den Verbund mit dem übrigen Europa gilt.
Die Regierungen in Spanien und Portugal wollen damit verhindern, dass das teure Gas die Strompreise nach oben zieht. Strom sei wegen der Auswirkungen der Gaskrise fünfmal so teurer geworden, obwohl sich weder die Nachfrage noch der Energiemix verändert hätten, so der Ministeriumssprecher. “Wir müssen verhindern, dass der gesamte Strompreis durch den Gaspreis bestimmt wird, was unserer Meinung nach ein Fehler im Energiemarktdesign ist”. Nach den EU-Regeln setzt Erdgas als teuerster Energieträger den Referenzwert für den Strompreis.
Wenn das eigene Konzept funktioniere, würden ihn auch “andere EU-Mitgliedstaaten in Betracht ziehen”, sagte die Ministerin für ökologischen Umbau, Teresa Ribera, der Zeitung El País. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die EU-Kommission den Vorschlag genehmigen werde. Die Maßnahme soll vor dem 1. Mai in Kraft treten.
Der Preisdeckel soll die öffentlichen Haushalte nicht belasten. Vielmehr würden die Kosten laut den beiden Regierungen vom Markt selbst aufgefangen. “Da es sich um ein Übergangssystem für einige Monate handelt, dürfte es sich nicht negativ auf den europäischen Markt auswirken“, sagt José María Yusta, Experte für Energiemärkte der Universität von Zaragoza.
Die Differenz zwischen der Preisobergrenze und den tatsächlichen Produktionskosten von Gaskraftwerken, die von der Industrie auf durchschnittlich 250 Euro pro MWh geschätzt werden, soll letztlich von den Verbrauchern getragen werden. “Ohne eine Deckelung des Gaspreises wird für die gesamte Stromerzeugung ein Durchschnittspreis von 250 Euro verlangt. Durch die Deckelung des Gaspreises werden nur 20 Prozent der Produktion mit 250 Euro belastet, 80 Prozent werden zum gedeckelten Preis abgerechnet“, erklärt das spanische Ministerium für ökologische Transformation. Die Maßnahme beinhaltet also die Herauslösung von Gas aus dem Preisbildungsmechanismus.
Beide Regierungen setzen die Messlatte mit einem Höchstpreis von 30 Euro niedrig an. In den Verhandlungen mit Brüssel könnte die Kommission Spanien und Portugal dazu zwingen, die Gaspreise auf etwa 50 oder 70 Euro anzuheben, damit der Unterschied zwischen der iberischen Halbinsel und den übrigen EU-Ländern nicht zu groß wird.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte nach dem Gipfel Ende März, dass eine mögliche Reform des Strommarktdesigns zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden solle. Vor allem Deutschland und die Niederlande hatten sich strikt gegen eine Änderung der Funktionsweise des gemeinsamen Energiemarktes gewehrt.
Madrid und Lissabon kämpfen seit Monaten dafür (Europe.Table berichtete), dass die geringe Anbindung der beiden Länder an die Energieversorgung in der restlichen EU berücksichtigt wird. “In Bezug auf Energie ist die iberische Halbinsel nicht wirklich eine Halbinsel, sondern eine Insel“, sagte der portugiesische Premierminister Antonio Costa bei dem EU-Gipfel.
Hinzu kommt, dass der Anteil erneuerbarer Energien in beiden Ländern mit einem Anteil von 60 Prozent in Portugal und 45 Prozent in Spanien recht hoch ist. Portugal ist überhaupt nicht auf russisches Gas angewiesen, sondern verwendet ausschließlich Flüssigerdgas (LNG), das hauptsächlich aus Algerien zu seiner Regasifizierungsanlage in Sines geliefert wird. Die russischen Gasimporte nach Spanien erreichen knapp zehn Prozent.
Madrid und Lissabon sind zuversichtlich, dass der Preisdeckel für Gaskraftwerke automatisch zu niedrigeren Strompreisen für die Verbraucher führen wird. In Portugal sind die unmittelbaren Auswirkungen minimal, aber in Spanien leiden etwa 40 Prozent der Haushalte und Unternehmen unter den Preisen. Der soziale Druck im Lande verstärkte sich im März durch den Streik der Lastwagenfahrer, der nicht nur die Lebensmittelversorgung behinderte, sondern auch mehrere Industriezweige zum Stillstand brachte. Einige Industrien mussten ihre Tätigkeit aufgrund der hohen Stromkosten vorübergehend einstellen.
08.04.-10.04.2022, Paris
Steconf World Conference on Sustainability, Energy, and Environment
Steconf’s conference provides a learning opportunity and a networking platform for researchers, non-profit organizations and companies. INFOS & REGISTRATION
08.04.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online
CEPS, Seminar Sustainable Product Policy Initiative: A new framework for environmental performance of products
The Centre for European Policy Studies (CEPS) discusses the European Commission’s Sustainable Product Policy Initiative. INFOS & REGISTRATION
08.04.2022 – 12:30-14:00 Uhr, Berlin
Eco, Vortrag Digital souverän, effizient, sicher und nachhaltig
Der Verband für Internetwirtschaft (Eco) diskutiert, wie die Politik die Branche und die digitale öffentliche Verwaltung adäquat stärken kann, was es in Deutschland hierzu konkret bedarf und welche Rahmenbedingungen es hierzu in Deutschland und Europa braucht. INFOS & ANMELDUNG
08.04.2022 – 14:30 Uhr, Budapest
EC, Workshop Artificial intelligence in translation – the changing role of translators, data management, ethics
The European Commission’s (EC) workshop will examine in what way artificial intelligence, in particular NMT, has been changing the translator profession. INFOS & REGISTRATION
09.04.2022 – 11:00-18:00 Uhr, Stuttgart
HBS, Konferenz Rechtsstaatlichkeit in Europa – Das Fundament der Demokratie unter Druck
Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) widmet sich der Frage, was die EU tun muss, um der Krise der Rechtsstaatlichkeit in Europa zu begegnen. INFOS & ANMELDUNG
12.04.2022 – 09:00-12:00 Uhr,
Next-Netzwerk, Konferenz Digitale Ethik und Machine Learning & KI
Das Next-Netzwerk beschäftigt sich mit der Zukunft einer modernen, digitalen Verwaltung. INFOS & ANMELDUNG
12.04.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online
ASEW, Seminar Risiko Cybercrime – Was tun bei einem Hackerangriff?
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) präsentiert das Fallbeispiel eines Hackerangriffs und erörtet, wie Unternehmen darauf reagieren können. INFOS & ANMELDUNG
12.04.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online
CEPS, Seminar Asia-Europe: cooperation or competition in gas?
The Centre for European Policy Studies (CEPS) discusses the consequences of the competition between Europe and Asia on the global LNG market. INFOS & REGISTRATION
Am heutigen Nachmittag wird im EU-Parlament in Straßburg über eine Resolution zu den Sanktionen gegen Russland abgestimmt. Darin werden sich die Abgeordneten für ein Embargo von Öl und Kohle aussprechen und fordern, dass Nordstream 1 und 2 vollständig aufgegeben werden. In einem Vorab-Entwurf von Mittwochabend, der Europe.Table vorliegt, heißt es, dass auch Gaslieferungen aus Russland “as swiftly as possible” mit einem Embargo belegt werden sollen.
Fraglich war bis zuletzt noch, ob die Forderung nach einem Gasembargo ganz herausgenommen wird, oder die Formulierung “as swiftly as possible” gestrichen wird. Letzteres hatten die Grünen im EU-Parlament in einem Änderungsantrag gefordert und sich somit für ein sofortiges Ende der Gasimporte aus Russland ausgesprochen.
Aus Parlamentskreisen hat Europe.Table erfahren, dass die Formulierung “as swift as possible” zwischen Grünen, Sozialdemokraten, Liberalen und Konservativen abgestimmt ist. Dementsprechend gilt es als unwahrscheinlich, dass die Grünen auf die Streichung des Halbsatzes bestehen werden. Bei der Resolution handelt es sich lediglich um eine Positionierung des Parlaments. Weder für die EU-Kommission noch die Mitgliedstaaten ergeben sich daraus Handelsverpflichtungen.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Dienstag das fünfte Paket mit Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen (Europe.Table berichtete). Es enthält unter anderem ein Importverbot für Kohle aus Russland. Zugleich sagte sie, dass in einer weiteren Sanktionsrunde auch Ölimporte aus Russland eingeschränkt oder ganz verboten werden könnten. Die Sanktionen müssen von den EU-Regierungen gebilligt werden, aber bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch gab es laut Reuters offene Fragen zu Details des Sanktionspakets. Bei einem weiteren Treffen am Donnerstag soll ein Kompromiss gefunden werden. luk/rtr/dpa
Bei Ausschreibungen für erneuerbare Energien will Deutschland Kooperationen mit europäischen Partnern erleichtern. Das sogenannte Gegenseitigkeitsprinzip soll entfallen, zudem sollen höhere Mengen an erneuerbaren Energien aus anderen Mitgliedstaaten von deutscher Förderung profitieren. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die entsprechende Regeln vorsieht.
Nach dem Gegenseitigkeitsprinzip können sich Unternehmen mit Erneuerbaren-Anlagen im EU-Ausland bisher nur dann an deutschen Ausschreibungen beteiligen, wenn die Staaten ihre Ausschreibungssysteme ebenso für Wind- oder Solarparks auf deutschem Staatsgebiet öffneten.
Die Menge an förderfähigen Anlagen im EU-Ausland war bisher zudem stark begrenzt – auf fünf Prozent der gesamten jährlich zu installierenden Erneuerbaren-Leistung. Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz 2023 soll dieser Wert auf 20 Prozent angehoben werden. Wie bisher kann Deutschland den so geförderten Ökostrom auf seine Beiträge gemäß der Erneuerbaren-Richtlinie und der Governance-Verordnung anrechnen.
Die Neuregelung hat die Bundesregierung unverändert aus dem Referentenentwurf des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes vom März übernommen. Der deutsche Erneuerbaren-Verband BEE hatte sich damals gegen die erhöhte Anrechnung von Ökostrom-Projekten aus dem EU-Ausland ausgesprochen. Mit den Änderungen könnten Kooperationsprojekte nunmehr angegangen und Zielmengen gesichert werden, heißt es dagegen in der Gesetzesbegründung der Regierung.
In dem sogenannten Osterpaket schreibt der Bund außerdem den Bau von drei neuen grenzüberschreitenden Stromverbindungsleitungen mit den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz gesetzlich fest. Künftig können außerdem Kraftwerke in Luxemburg an deutschen Ausschreibungen für Kapazitätsreserven teilnehmen, die in Notfällen die Stromversorgung im Bundesgebiet sichern sollen. ber
Es war der letzte notwendige Schritt, jetzt ist der in den Trilogen erzielte Kompromiss zum Data Governance Act (DGA) im EU-Parlament angenommen worden. Mit 501 Ja-Stimmen bei gerade einmal 12 Gegenstimmen und 40 Enthaltungen hat damit der erste Baustein der Datenstrategie auch formal das Verfahren passiert.
Die Berichterstatterin Angelika Niebler (CSU/EVP) sieht darin den Auftakt einer digitalpolitischen Zeitenwende. Nachdem Europa die, so Niebler, “Geburtsstunde der Plattformökonomie verschlafen” habe, sei man nun mit Data Governance Act, Data Act, Digital Markets Act und Digital Services Act auf dem Wege, einen europäischen Weg zu beschreiten. Der Data Governance Act, der keine personenbezogenen Daten umfasst, sei zusammen mit den anderen Legislativvorhaben eine “gewaltige Chance sich digitalwirtschaftlich zu emanzipieren und aus dem Schatten der Datenmonopolisten zu treten”, insbesondere für Startups und kleinere Unternehmen. Es gehe darum, nicht nur das “Spielfeld zu begradigen, sondern Spielregeln grundlegend zu ändern.”
Ein wesentlicher Unterschied zum ausschließlich an Marktmechanismen orientierten US- sowie dem chinesischen Modell, das aus Nieblers Sicht eine Mischung aus Unternehmertum und staatlicher Überwachung ist, sei es, dass man neutrale Akteure für die Vermittlung zwischen Datenanbietern und Nutzern mit dem Rechtsakt etabliere.
Sergej Lagodinsky (Grüne/EFA) erläuterte, dass Europa Daten und Datenschutz brauche, dieser Spagat sei hier ganz gut gelungen. “Wir gestalten für Bürger:innen die Möglichkeit, ihre Daten verfügbar zu machen und gleichzeitig das letzte Wort bei der Verwendung zu behalten”, so Lagodinsky. Datenwirtschaftliche Innovation nicht auf Kosten des Datenschutzes, daran solle man auch künftig festhalten, sagte der Berichterstatter des LIBE-Ausschusses im Parlament mit Blick auf den Data Act.
EU-Industriekommissar Thierry Breton nannte den Data Governance Act im Plenum “den Eckpfeiler des datenregulatorischen Rahmens”, der nun errichtet werde. Europa könne in der kommenden Welle datenbasierter Innovationen ein wesentlicher Mitspieler werden. Insbesondere die industrielle Datenökonomie sei auf einen verlässlichen Rahmen angewiesen. Allerdings gibt es Kritik aus der Wirtschaft, dass mit dem DGA auch bereits etablierte und funktionierende Datenmärkte abgewürgt würden, die nach anderen Kriterien funktionieren.
Unklar ist derzeit, inwieweit ein erhoffter funktionierender europäischer Datenmarkt interoperabel mit anderen Datenmärkten sein kann – und auch soll. Bei der eigentlich politisch angestrebten engeren transatlantischen Interoperabilität besteht die Hoffnung darin, dass die europäischen Regeln ausreichend Strahlkraft erzeugen, um auch US-Unternehmen für diese zu begeistern. Chinesische Anbieter etwa dürften mit dem DGA hingegen ihre Probleme haben: Thierry Breton betonte im Straßburger Plenum, dass der DGA auch Maßnahmen dazu enthalte, unzulässige Zugriffe durch Dritte zu verhindern, insbesondere von außerhalb der EU.
Doch ob der DGA die mit ihm verbundenen Ziele auch in der Praxis erreichen hilft, hängt nicht nur von den noch ausstehenden Vorhaben ab (Europe.Table berichtete). Man habe, sagte Berichterstatterin Angelika Niebler, “ins blaue Hinein versucht, einen Rechtsrahmen zu schaffen”, da es diesen Markt ja noch nicht gebe – bei dem man nun schauen müsse, ob dieser angenommen wird. fst
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen klagt gegen den US-Technologieriesen Google vor dem Landgericht Berlin wegen seiner Cookie-Banner. “Mit Tricks bei der Gestaltung der Cookie-Banner versuchen Unternehmen die Einwilligung der Verbraucher:innen zu erschleichen, um an möglichst viele persönliche Informationen zu gelangen, diese zu sammeln und zu verarbeiten”, begründete der Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, Wolfgang Schuldzinski, am Mittwoch das Verfahren. Es müsse genauso leicht sein, Cookies abzulehnen wie sie zu akzeptieren, um eine unbedachte Datenpreisgabe zu verhindern. Das sei bei den Webseiten der Suchmaschine von Google nicht der Fall.
Google will auf die Kritik reagieren. Eine Firmensprecherin kündigte an, der Konzern werde “in Kürze Änderungen an unserem Einwilligungsbanner und unseren Cookie-Praktiken in ganz Europa, einschließlich Deutschland, vornehmen, um den Anweisungen der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden”.
Die Verbraucherzentrale NRW hält die entsprechende Gestaltung auf den Webseiten der Suchmaschine von Google für unzulässig (Europe.Table berichtete). So sei nur ein Klick für die Zustimmung nötig, aber zur Ablehnung müsse der Nutzer erst auf eine zweite Ebene des Banners wechseln, wo dann mindestens drei verschiedene Kategorien von Cookies einzeln abgelehnt werden müssten (Europe.Table berichtete).
Mit diesen sogenannten Dark Patterns verstößt Google nach Ansicht der Verbraucherzentrale gegen nationale Datenschutz-Regelungen aus dem Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) sowie gegen EU-Recht. Der geplante EU-weite Digital Services Act (DSA) will diese manipulativen Design-Praktiken gänzlich verbieten. rtr
Wegen Mängeln beim Datenschutz geht die EU-Kommission gegen Deutschland vor. Man habe entschieden, ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Konkret geht es demnach darum, dass Deutschland der EU-Kommission noch keine Maßnahmen mitgeteilt hat, wie es die EU-Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung mit Blick auf die Arbeit der Bundespolizei umsetzt.
Die EU-Kommission überwacht in der Staatengemeinschaft die Einhaltung von EU-Recht. Sollte Deutschland die Bedenken der Behörde im Laufe des Verfahrens nicht ausräumen, drohen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und letztlich eine Geldstrafe.
Die fragliche Richtlinie musste eigentlich bis zum 6. Mai 2018 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie soll das Grundrecht der Bürger auf Datenschutz gewährleisten, wenn personenbezogene Daten von Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen benutzt werden. Unter anderem soll sichergestellt werden, dass die Daten von Opfern, Zeugen und Verdächtigen ausreichend geschützt sind. dpa

Der nächste große Test für die Glaubwürdigkeit der G20 wird kommen, wenn (oder falls) ihre Finanzminister und Notenbankgouverneure am 18. bis 24. April zu den Frühjahrstagungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zusammenkommen. Als heute führendes Forum für internationale wirtschaftspolitische Zusammenarbeit wird die G20 eine volle Tagesordnung haben. Spitzenthemen sind unter anderem die Reaktionen der Notenbanken auf die eskalierende weltweite Inflation, zunehmende Hinweise auf einen rapiden Klimawandel und die Koordinierung der Gesundheits- und Fiskalpolitik. Doch der Bär im Wohnzimmer werden Russlands brutaler Überfall auf die Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen sein, angefangen mit seinen Auswirkungen auf die weltweiten Lebensmittelpreise.
Trotz einiger wichtiger Erfolge haben mehrere deutliche Versäumnisse die Glaubwürdigkeit der G20 in den letzten Jahren untergraben. Während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wurden die G20-Communiqués regelmäßig derart verwässert, dass sie nahezu sinnfrei waren. In jüngerer Zeit hat die Gruppe es versäumt, eine wirksame globale Reaktion auf COVID-19 zu formulieren oder gar Vorbereitungen für künftige Pandemien zu treffen.
Die Glaubwürdigkeit der G20 ist in einer Welt zunehmend globalisierter Herausforderungen ein wichtiger Aktivposten. Doch ist Glaubwürdigkeit schwierig aufzubauen und man kann sie leicht verlieren. Das Treffen in diesem Monat könnte daher ein Wendepunkt sein. Bisher haben die G20-Mitglieder sehr unterschiedlich auf die Ukraine-Krise reagiert, und zwar sowohl was die öffentliche Kommunikation angeht als auch politisch. Während die USA und ihre Verbündeten harte Sanktionen verhängt haben, haben 38 Länder – darunter China, Indien und Südafrika – sich bei einer kürzlich verabschiedeten Resolution der UN-Generalversammlung, die Russland kritisierte und einen humanitären Zugang zur Ukraine forderte, der Stimme enthalten.
Laut dem von Chad P. Bown vom Peterson Institute for International Economics gepflegten Sanktions-Tracker haben acht G20-Mitglieder (alle Mitgliedsländer mittleren Einkommens) öffentlich ihre Nichtteilnahme an Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland erklärt, und Saudi-Arabien – ein US-Verbündeter, der im Rahmen der OPEC+ mit Russland zusammenarbeitet – hat sich als ähnlich abgeneigt erwiesen. Es ist daher absehbar, dass die Gruppe nicht einmal bei der Beschreibung des russischen Krieges oder seiner Auswirkungen auf die Weltmärkte einen Konsens erreichen dürfte. Doch die Aggression Russlands im Interesse der Einstimmigkeit herunterzuspielen könnte die Glaubwürdigkeit der G20 unwiederbringlich untergraben.
So oder so wird sich die G20 mit Sicherheit mit einer augenfälligen und unmittelbaren Folge der russischen Invasion befassen: dem potenziellen Rückgang des weltweiten Lebensmittelangebots. Schon vor dem
24. Februar hatten sich die weltweiten Lebensmittelpreise Rekordhöhen genähert. Bedingt war dies durch ein Zusammenspiel von Faktoren ähnlich jenen der Jahre 2007/08 und 2010, welche ebenfalls einen steilen Anstieg der Lebensmittelpreise zur Folge hatten. Diese früheren Episoden führten in einigen ärmeren Ländern zu breit gestreuter sozialer Instabilität. Viele Länder niedrigen und mittleren Einkommens sehen sich zudem Inflationsdruck, höheren Schuldenständen und fortgesetzten Anfälligkeiten gegenüber Seuchen und dem Klimawandel ausgesetzt. Die Auswirkungen könnten explosiv sein.
Die Ukraine und Russland gehören zu den wichtigsten Exporteuren von Weizen, Mais, Sonnenblumenkernen und Sonnenblumenöl. Laut jüngsten Prognosen der Welternährungsorganisation (FAO) könnten die schon jetzt hohen Preise für Lebens- und Futtermittel im Laufe dieses und des nächsten Jahres aufgrund der Zerstörung der Produktions-, Lager- und Transporteinrichtungen der Ukraine sowie möglichen sanktionsbedingten Störungen der russischen Getreide- und Düngemittelexporte, erhöhten Weltenergiepreisen und höheren Versand- und Versicherungskosten um 8 bis 22 Prozent steigen. Infolgedessen könnte die Zahl der unterernährten Menschen weltweit um 8 bis 13 Millionen ansteigen.
Wie bei früheren durch höhere Lebensmittelpreise bedingten Erschütterungen macht die heutige Krise eine internationale politische Koordinierung umso wichtiger. Insbesondere muss die G20, wie die FAO und die Welthandelsorganisation bereits drängen, Exportsteuern oder -kontrollen zulasten anderer Länder kollektiv ablehnen. Obwohl sie in der Vergangenheit massive Erhöhungen der weltweiten Lebensmittelpreise zur Folge hatten, greifen derartige Maßnahmen bereits wieder um sich.
Doch darf es die G20 damit nicht bewenden belassen. Rufe nach palliativen Maßnahmen können helfen, doch wenn sie nicht mit einer offenen Diskussion über Grundursachen und Gegenmaßnahmen einhergehen, drohen sie, Fehlverhalten zu begünstigen. Die gegenwärtige Bedrohung für das weltweite Lebensmittelangebot wurde durch den Angriffskrieg und andere Verstöße gegen das Völkerrecht eines einzigen G20-Mitglieds verschärft. Russland könnte die Krise problemlos einseitig abmildern, indem es seinen blutigen Überfall und insbesondere seine Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur beendet.
Natürlich ist die von diesem Krieg ausgehende weltweite wirtschaftliche Erschütterung zum Teil auch durch die Sanktionen bedingt. Doch würden diese zurückgefahren, wenn Russland seine Truppen abzöge und seine Bombardierungen einstellen würde. In der Zwischenzeit könnte Saudi-Arabien (zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten) den steilen Anstieg der weltweiten Energiepreise abmildern, indem es mehr Öl fördert – was es sich bisher zu tun weigert.
Auch wenn tiefe Meinungsverschiedenheiten zwischen den G20-Mitgliedern unvermeidlich sind, muss der Gipfel stattfinden, denn ihn abzusagen würde die G20 nicht weniger in Misskredit bringen. Die Gruppe muss zeigen, dass sie fähig ist, sich den Realitäten einer unangenehmen Situation zu stellen. Zu diesem Zweck sollte sich die Mehrheit der G20-Mitglieder bemühen, ein Communiqué abzufassen und zu billigen, das Russland offen als eindeutige Quelle sowohl des Problems als auch seiner Lösung identifiziert. Dies könnte eine simple Beschreibung der Tatsachen sein, ohne Formulierungen, die irgendjemanden offen verurteilen.
Natürlich weigert sich Russland bisher eisern, die Tatsachen anzuerkennen, und argumentiert, dass “eine mögliche Lebensmittelkrise nicht durch Russlands Sonderoperation in der Ukraine provoziert wird, sondern durch die illegalen einseitigen Sanktionen des Westens”. Doch wenn sich ein größerer Teil der G20-Mitglieder das Communiqué zu eigen macht, bliebe ein glaubwürdiger Rumpf von Ländern erhalten, der eine künftige multilaterale Zusammenarbeit unterstützen kann. Es ist besser, dass einige Länder dabei nicht mitmachen, wenn das ihr Wunsch ist, als dass man eine nicht vorhandene Einigkeit vorspiegelt.
Die G20-Mitglieder einschließlich Russlands sind die wichtigen Akteure, die das globale Gemeingut beeinflussen. Es ist nach wie vor wichtig, dass sie in all den wichtigen Bereichen kommunizieren, in denen sie Einfluss ausüben, darunter Ernährung, Gesundheit und Klimaschutz. Eine Einigkeit in substanziellen Fragen wird dort, wo sie möglich ist, das weltweite Gemeinwohl fördern. Doch grundlegende Meinungsverschiedenheiten können und sollten öffentlich eingestanden werden, damit Teilgruppen der Mitglieder weiterhin eigene Initiativen verfolgen können.
Aus dem Englischen von Jan Doolan. In Kooperation mit Project Syndicate, 2022.
zum ersten Mal hat die EU-Kommission den 2021 eingeführten Rechtsstaat-Mechanismus ausgelöst. Die Budget-Kürzungen, die Ungarn nun drohen, werden das Land hart treffen, schreibt Eric Bonse. Besonders das öffentliche Beschaffungswesen sei betroffen.
Vom Tisch ist dagegen der Vorschlag des EU-Erweiterungskommissars Olivér Várhelyi, den rechtsliberalen Polen Andrzej Sadoś zum höchsten Beamten der Generaldirektion für Erweiterung zu machen. Várhelyi gilt eher als Statthalter von Viktor Orbán denn als brennender Verfechter europäischer Werte, schreibt Stephan Israel.
Wie viele Länder der EU plagen auch Portugal und Spanien hohe Energiekosten. Grund ist der stark gestiegene Preis für Gas, der den Strompreis mit nach oben zieht. Die beiden Länder haben der EU-Kommission ein Konzept vorgelegt, mit dem sie den Gaspreis nun begrenzen wollen. Isabel Cuesta Camacho hat den Vorschlag analysiert.
Heute wird das EU-Parlament über eine Resolution zu den Sanktionen gegen Russland abstimmen. Im fünften Sanktionspaket wird voraussichtlich auch ein Embargo für Öl und Kohle enthalten sein. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Das Bundeskabinett hat gestern eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz verabschiedet. Was sich bei Ausschreibungen für erneuerbare Energien und förderfähigen Anlagen im EU-Ausland ändert, lesen Sie in den News.
Mit großer Mehrheit wurde gestern der Kompromiss zum Data Governance Act (DGA) im Europäischen Parlament angenommen und als “Auftakt einer digitalpolitischen Zeitenwende” bezeichnet. In den News lesen Sie Stimmen zum DGA.

Es ist eine Premiere: Als erstes EU-Land muss Ungarn mit einer Kürzung seiner Zahlungen aus dem Gemeinschaftsbudget rechnen. Die EU-Kommission bestätigte am Mittwoch in Brüssel (Europe.Table berichtete), dass sie den neuen Rechtsstaats-Mechanismus auslösen werde. Der formelle Beschluss sei für die erste Kommissionssitzung nach der Osterpause geplant, sagte Budgetkommissar Johannes Hahn im Gespräch mit Europe.Table und anderen europäischen Medien.
Der Rechtsstaats-Mechanismus war unter deutschem EU-Vorsitz Ende 2020 beschlossen und im Januar 2021 eingeführt worden. Er erlaubt nach einem mehrstufigen Verfahren die Kürzung von EU-Geldern (Europe.Table berichtete). Die Regierung in Budapest sprach von einem “Fehler”. Orbáns Kabinettschef Gergely Gulyas forderte die EU-Kommission auf, “die ungarischen Wähler nicht dafür zu bestrafen, dass sie bei den Wahlen am Sonntag, die von der Regierungspartei deutlich gewonnen wurden, keine Meinung nach dem Geschmack von Brüssel geäußert haben”. Ungarn dürfe nicht benachteiligt werden.
Für das Land geht es um viel Geld. 2020 flossen 4,6 Milliarden Euro mehr nach Ungarn als von dort in den EU-Haushalt eingezahlt wurde. Brüssel behält bereits jetzt die Zahlungen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück. Dabei geht es um rund sieben Milliarden Euro. Hahn sagte, in dem Streit mit Ungarn gehe es vor allem um das öffentliche Beschaffungswesen. Er rechne mit einer Entscheidung bei der nächsten Sitzung der EU-Kommission, die wegen der Osterpause erst Ende April stattfindet.
Danach erhält Ungarn eine offizielle Mitteilung, die den Rechtsstaats-Mechanismus formal auslöst. Die Regierung in Budapest muss auf diese “Notifizierung” antworten, dann entscheidet wieder die EU-Kommission. Wenn die Bedenken nicht ausgeräumt werden, legt die EU-Behörde einen Vorschlag zur Kürzung von Haushaltsmitteln vor.
Das letzte Wort hat der Ministerrat, der mit qualifizierter Mehrheit entscheiden muss. Insgesamt werde das Verfahren sechs bis neun Monate dauern, so Hahn. Orbán bleibt also noch eine Schonfrist bis zum Herbst. Danach könnte es ernst werden. Ärger droht schon jetzt wegen der Ukraine-Politik. Die von der EU-Kommission geplante Verschärfung der Sanktionen gegen Russland will Ungarn nicht mittragen. Die Ausweitung der Einfuhrbeschränkungen für Öl und Gas aus Russland sei für ihn eine rote Linie, sagte Ministerpräsident Orbán am Mittwoch in Budapest.
Er zeigte sich zudem bereit, für Gaslieferungen – wie von Russland verlangt – in Rubel zu bezahlen. Andere EU-Staaten, wie Deutschland, lehnen dies ab und wollen ihre Rechnungen weiterhin in Euro oder Dollar begleichen. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto ergänzte, die Gas-Versorgung des Landes sei durch einen Vertrag mit der staatlichen MVM und dem russischen Konzern Gazprom geregelt. In diesem Vertrag spiele die EU keine Rolle. Aus seiner Sicht sei eine gemeinsame Haltung der russisches Gas importierenden EU-Staaten nicht nötig.
Ein Appell zum Festhalten an der gemeinsamen europäischen Linie kam am Nachmittag aus Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erinnerte daran, dass sich die EU-Staaten der Entscheidung der G7-Energieminister angeschlossen hätten, Gaslieferungen weiter in den Währungen zu zahlen, die in den Verträgen mit Russland vereinbart seien.
Dieser Beschluss “hat eine sehr starke, bindende Wirkung für die Länder, die sich bei den Sanktionen beteiligen und ich hoffe, dass diese Bindewirkung so stark bleibt, dass die Leute nicht ausscheren”, sagte Habeck vor Journalisten in Berlin. Nach den Folgen für den Fall gefragt, dass Ungarn seine Ankündigung zu Rubelzahlungen umsetzt, sagte Habeck: “Das isoliert Ungarn”. Mit Manuel Berkel
Die heikle Personalie an der Spitze der Generaldirektion für Erweiterung (NEAR) ließ die Alarmglocken läuten. Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi wolle Polens EU-Botschafter Andrzej Sadoś zu seinem höchsten Beamten machen, hieß es im Brüsseler Europaviertel und im EU-Parlament in Straßburg noch vor wenigen Wochen. Nicht nur sind die beiden Männer befreundet. Beide sind auch stramm auf Linie ihrer rechtsliberalen Regierungen.
Bei Polens Ständigem Vertreter verwundert das weniger. Olivér Várhelyi wäre hingegen als EU-Kommissar eigentlich der europäischen Sache verpflichtet, hat sich aber seit Amtsantritt keinen Zentimeter von Budapest emanzipiert und gilt in Brüssel als Statthalter von Viktor Orbán.
Ausgerechnet das Erweiterungsressort wäre definitiv zum Hort der illiberalen Demokratie geworden. Das Ressort, das eigentlich den Beitrittskandidaten europäische Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Medien und demokratische Standards näherbringen sollte.
Nun gibt es zumindest an dieser Front Entwarnung, werden die schlimmsten Befürchtungen im Apparat nicht wahr. Olivér Várhelyi kann dem Vernehmen nach seine Traumbesetzung nicht durchdrücken. Die Episode ist typisch für den ungarischen EU-Kommissar. Im eigenen Haus stützt sich der 50-Jährige im Kabinett auf einen kleinen Kreis mit Mitarbeitenden.
Er gilt als misstrauisch und hatte schon auf seinem vorherigen Posten als Ungarns EU-Botschafter den Ruf als Zyniker, der unliebsame Mitarbeiter öffentlich abkanzelt. Im Kollegium unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat er keine Verbündeten. Er sei isoliert, viele würden ihn eher meiden, sagt einer, der ihn kennt: “Es ist nicht so, dass er jedermanns Liebling wäre, im Gegenteil”.
Personalbesetzungen auf der Stufe Generaldirektor müssen vom Kollegium abgesegnet werden. Dort war man schon irritiert, dass Várhelyi den Job extern ausschreiben ließ. Sonst werden in der Regel Spitzenposten intern vergeben. So dürfte es auch jetzt kommen. Guten Chancen soll Maciej Popowski haben, praktisch seit Beginn der Legislatur geschäftsführend im Amt. Auch der amtierende Generaldirektor kommt aus Polen, steht dort aber eher der Opposition nahe. Ebenfalls im Rennen sei die stellvertretende Generaldirektorin Katarina Mathernova, eine Slowakin.
Einfach dürfte die Zusammenarbeit so oder so nicht werden. Das Klima unter Olivér Várhelyi ist auf einem Tiefpunkt. Die Direktoren für Westbalkan oder Südliche Nachbarschaft und Türkei sind ebenfalls nur geschäftsführend besetzt. Für Stellenausschreibungen auf tieferer Stufe in den Abteilungen für Serbien, Bosnien oder Montenegro gab es kürzlich kaum Bewerbungen. Wer bleibe, sei demotiviert. Die Generaldirektion NEAR musste zuletzt eine Reihe von Posten an andere Abteilungen abgeben.
Das war allerdings, bevor die Ukraine, Georgien und Moldawien ihre Beitrittsbewerbungen einreichten. Eigentlich wäre jetzt eine gute Zeit zur Profilierung für einen Erweiterungskommissar. Olivér Várhelyi hält sich jedoch strikt an die Agenda seines Mentors Viktor Orbán. Nordmazedoniens blockiertes Beitrittsgesuch voranbringen? Kein Interesse. Orbáns Sympathien gehören Nikola Gruevski, einem früheren nationalistischen Regierungschef Nordmazedonien, zu Hause zu einer Haftstrafe wegen Korruption verurteilt und jetzt “politischer Flüchtling” in Budapest.
Wenn Olivér Várhelyi nach Israel fährt wie kürzlich, posiert er dort selbstverständlich mit Oppositionsführer Benjamin Nethanjahu, ebenfalls einem Verbündeter Orbáns. Absolute Priorität hat allerdings Serbien und dessen Beitrittsverfahren voranzubringen. Orbán und Serbiens frisch wiedergewählter Präsident Aleksandar Vučić betreiben eine ähnliche Schaukelpolitik zwischen Brüssel und Moskau.
Unvergessen in Brüssel die Episode im vergangenen Jahr, als Olivér Várhelyi sein Kabinett beauftragte, den Fortschrittsbericht seiner eigenen Leute zu Serbien zu entschärfen und Kritik an Rückschritten bei Rechtsstaatlichkeit oder Medienfreiheit zu verwässern. Gegensteuer gab es vom liberalen Belgier Didier Reynders, EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. Seither rede man zwischen den Kabinetten Várhelyi und Reynders nicht mehr, heisst es.
Auch in Bosnien-Herzegowina verfolgt der Erweiterungskommissar die ungarische Agenda und soll dort Milorad Dodik unterstützen, derzeit Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium. Dodik sabotiert den bosnischen Zentralstaat mit allen Mitteln und droht mit der Abspaltung der sogenannten Republika Srpska.
Ein EU-internes Dokument scheint die Vorwürfe zu belegen. 30 EU-Parlamentarier aus verschiedenen politischen Gruppen forderten darauf die Kommissionspräsidentin auf, den Vorwürfen nachzugehen. Ursula von der Leyen hat ihrem Erweiterungskommissar immer wieder das Vertrauen ausgesprochen und auch jetzt die Vorwürfe zurückgewiesen. Beobachter sehen die Zurückhaltung darin begründet, dass von der Leyen 2019 schließlich auch mit den Stimmen der Regierungspartei von Orbán zur Kommissionspräsidentin gewählt worden sei.
Auf dem jüngsten EU-Gipfel hatten Spanien und Portugal nach langen Diskussionen durchgesetzt (Europe.Table berichtete), dass für sie eine Ausnahme von den Regeln des europäischen Elektrizitätsmarktes gilt. Die Regierungen in Spanien und Portugal haben inzwischen ein Konzept nach Brüssel geschickt, wie sie verhindern wollen, dass der stark gestiegene Gaspreis den Strompreis nach oben zieht. Der Vorschlag, der noch von der Europäischen Kommission genehmigt werden muss, sieht vor, den Gaspreis für Stromerzeugungsanlagen auf maximal 30 Euro pro Megawattstunde zu begrenzen.
Das Dokument sei ein erster Vorschlag, der mit Brüssel weiter diskutiert werden solle, sagte ein Sprecher des Ministeriums für ökologischen Umbau in Madrid zu Europe.Table. Die Maßnahme könne den Strompreis auf 120 bis 130 Euro pro Megawattstunde senken, weniger als die Hälfte des Durchschnittspreises im März von 284 Euro.
Die Preisobergrenze von 30 Euro pro Megawattstunde würde für Gaskraftwerke gelten, die Strom für Verbraucher in Spanien und Portugal produzieren. Um Marktverzerrungen jenseits der iberischen Halbinsel zu vermeiden, würde sowohl der Gaspreis für die anderen Sektoren als auch der Strompreis auf dem Großhandelsmarkt nicht angetastet, der auch für den Verbund mit dem übrigen Europa gilt.
Die Regierungen in Spanien und Portugal wollen damit verhindern, dass das teure Gas die Strompreise nach oben zieht. Strom sei wegen der Auswirkungen der Gaskrise fünfmal so teurer geworden, obwohl sich weder die Nachfrage noch der Energiemix verändert hätten, so der Ministeriumssprecher. “Wir müssen verhindern, dass der gesamte Strompreis durch den Gaspreis bestimmt wird, was unserer Meinung nach ein Fehler im Energiemarktdesign ist”. Nach den EU-Regeln setzt Erdgas als teuerster Energieträger den Referenzwert für den Strompreis.
Wenn das eigene Konzept funktioniere, würden ihn auch “andere EU-Mitgliedstaaten in Betracht ziehen”, sagte die Ministerin für ökologischen Umbau, Teresa Ribera, der Zeitung El País. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die EU-Kommission den Vorschlag genehmigen werde. Die Maßnahme soll vor dem 1. Mai in Kraft treten.
Der Preisdeckel soll die öffentlichen Haushalte nicht belasten. Vielmehr würden die Kosten laut den beiden Regierungen vom Markt selbst aufgefangen. “Da es sich um ein Übergangssystem für einige Monate handelt, dürfte es sich nicht negativ auf den europäischen Markt auswirken“, sagt José María Yusta, Experte für Energiemärkte der Universität von Zaragoza.
Die Differenz zwischen der Preisobergrenze und den tatsächlichen Produktionskosten von Gaskraftwerken, die von der Industrie auf durchschnittlich 250 Euro pro MWh geschätzt werden, soll letztlich von den Verbrauchern getragen werden. “Ohne eine Deckelung des Gaspreises wird für die gesamte Stromerzeugung ein Durchschnittspreis von 250 Euro verlangt. Durch die Deckelung des Gaspreises werden nur 20 Prozent der Produktion mit 250 Euro belastet, 80 Prozent werden zum gedeckelten Preis abgerechnet“, erklärt das spanische Ministerium für ökologische Transformation. Die Maßnahme beinhaltet also die Herauslösung von Gas aus dem Preisbildungsmechanismus.
Beide Regierungen setzen die Messlatte mit einem Höchstpreis von 30 Euro niedrig an. In den Verhandlungen mit Brüssel könnte die Kommission Spanien und Portugal dazu zwingen, die Gaspreise auf etwa 50 oder 70 Euro anzuheben, damit der Unterschied zwischen der iberischen Halbinsel und den übrigen EU-Ländern nicht zu groß wird.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte nach dem Gipfel Ende März, dass eine mögliche Reform des Strommarktdesigns zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden solle. Vor allem Deutschland und die Niederlande hatten sich strikt gegen eine Änderung der Funktionsweise des gemeinsamen Energiemarktes gewehrt.
Madrid und Lissabon kämpfen seit Monaten dafür (Europe.Table berichtete), dass die geringe Anbindung der beiden Länder an die Energieversorgung in der restlichen EU berücksichtigt wird. “In Bezug auf Energie ist die iberische Halbinsel nicht wirklich eine Halbinsel, sondern eine Insel“, sagte der portugiesische Premierminister Antonio Costa bei dem EU-Gipfel.
Hinzu kommt, dass der Anteil erneuerbarer Energien in beiden Ländern mit einem Anteil von 60 Prozent in Portugal und 45 Prozent in Spanien recht hoch ist. Portugal ist überhaupt nicht auf russisches Gas angewiesen, sondern verwendet ausschließlich Flüssigerdgas (LNG), das hauptsächlich aus Algerien zu seiner Regasifizierungsanlage in Sines geliefert wird. Die russischen Gasimporte nach Spanien erreichen knapp zehn Prozent.
Madrid und Lissabon sind zuversichtlich, dass der Preisdeckel für Gaskraftwerke automatisch zu niedrigeren Strompreisen für die Verbraucher führen wird. In Portugal sind die unmittelbaren Auswirkungen minimal, aber in Spanien leiden etwa 40 Prozent der Haushalte und Unternehmen unter den Preisen. Der soziale Druck im Lande verstärkte sich im März durch den Streik der Lastwagenfahrer, der nicht nur die Lebensmittelversorgung behinderte, sondern auch mehrere Industriezweige zum Stillstand brachte. Einige Industrien mussten ihre Tätigkeit aufgrund der hohen Stromkosten vorübergehend einstellen.
08.04.-10.04.2022, Paris
Steconf World Conference on Sustainability, Energy, and Environment
Steconf’s conference provides a learning opportunity and a networking platform for researchers, non-profit organizations and companies. INFOS & REGISTRATION
08.04.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online
CEPS, Seminar Sustainable Product Policy Initiative: A new framework for environmental performance of products
The Centre for European Policy Studies (CEPS) discusses the European Commission’s Sustainable Product Policy Initiative. INFOS & REGISTRATION
08.04.2022 – 12:30-14:00 Uhr, Berlin
Eco, Vortrag Digital souverän, effizient, sicher und nachhaltig
Der Verband für Internetwirtschaft (Eco) diskutiert, wie die Politik die Branche und die digitale öffentliche Verwaltung adäquat stärken kann, was es in Deutschland hierzu konkret bedarf und welche Rahmenbedingungen es hierzu in Deutschland und Europa braucht. INFOS & ANMELDUNG
08.04.2022 – 14:30 Uhr, Budapest
EC, Workshop Artificial intelligence in translation – the changing role of translators, data management, ethics
The European Commission’s (EC) workshop will examine in what way artificial intelligence, in particular NMT, has been changing the translator profession. INFOS & REGISTRATION
09.04.2022 – 11:00-18:00 Uhr, Stuttgart
HBS, Konferenz Rechtsstaatlichkeit in Europa – Das Fundament der Demokratie unter Druck
Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) widmet sich der Frage, was die EU tun muss, um der Krise der Rechtsstaatlichkeit in Europa zu begegnen. INFOS & ANMELDUNG
12.04.2022 – 09:00-12:00 Uhr,
Next-Netzwerk, Konferenz Digitale Ethik und Machine Learning & KI
Das Next-Netzwerk beschäftigt sich mit der Zukunft einer modernen, digitalen Verwaltung. INFOS & ANMELDUNG
12.04.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online
ASEW, Seminar Risiko Cybercrime – Was tun bei einem Hackerangriff?
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) präsentiert das Fallbeispiel eines Hackerangriffs und erörtet, wie Unternehmen darauf reagieren können. INFOS & ANMELDUNG
12.04.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online
CEPS, Seminar Asia-Europe: cooperation or competition in gas?
The Centre for European Policy Studies (CEPS) discusses the consequences of the competition between Europe and Asia on the global LNG market. INFOS & REGISTRATION
Am heutigen Nachmittag wird im EU-Parlament in Straßburg über eine Resolution zu den Sanktionen gegen Russland abgestimmt. Darin werden sich die Abgeordneten für ein Embargo von Öl und Kohle aussprechen und fordern, dass Nordstream 1 und 2 vollständig aufgegeben werden. In einem Vorab-Entwurf von Mittwochabend, der Europe.Table vorliegt, heißt es, dass auch Gaslieferungen aus Russland “as swiftly as possible” mit einem Embargo belegt werden sollen.
Fraglich war bis zuletzt noch, ob die Forderung nach einem Gasembargo ganz herausgenommen wird, oder die Formulierung “as swiftly as possible” gestrichen wird. Letzteres hatten die Grünen im EU-Parlament in einem Änderungsantrag gefordert und sich somit für ein sofortiges Ende der Gasimporte aus Russland ausgesprochen.
Aus Parlamentskreisen hat Europe.Table erfahren, dass die Formulierung “as swift as possible” zwischen Grünen, Sozialdemokraten, Liberalen und Konservativen abgestimmt ist. Dementsprechend gilt es als unwahrscheinlich, dass die Grünen auf die Streichung des Halbsatzes bestehen werden. Bei der Resolution handelt es sich lediglich um eine Positionierung des Parlaments. Weder für die EU-Kommission noch die Mitgliedstaaten ergeben sich daraus Handelsverpflichtungen.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Dienstag das fünfte Paket mit Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen (Europe.Table berichtete). Es enthält unter anderem ein Importverbot für Kohle aus Russland. Zugleich sagte sie, dass in einer weiteren Sanktionsrunde auch Ölimporte aus Russland eingeschränkt oder ganz verboten werden könnten. Die Sanktionen müssen von den EU-Regierungen gebilligt werden, aber bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch gab es laut Reuters offene Fragen zu Details des Sanktionspakets. Bei einem weiteren Treffen am Donnerstag soll ein Kompromiss gefunden werden. luk/rtr/dpa
Bei Ausschreibungen für erneuerbare Energien will Deutschland Kooperationen mit europäischen Partnern erleichtern. Das sogenannte Gegenseitigkeitsprinzip soll entfallen, zudem sollen höhere Mengen an erneuerbaren Energien aus anderen Mitgliedstaaten von deutscher Förderung profitieren. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die entsprechende Regeln vorsieht.
Nach dem Gegenseitigkeitsprinzip können sich Unternehmen mit Erneuerbaren-Anlagen im EU-Ausland bisher nur dann an deutschen Ausschreibungen beteiligen, wenn die Staaten ihre Ausschreibungssysteme ebenso für Wind- oder Solarparks auf deutschem Staatsgebiet öffneten.
Die Menge an förderfähigen Anlagen im EU-Ausland war bisher zudem stark begrenzt – auf fünf Prozent der gesamten jährlich zu installierenden Erneuerbaren-Leistung. Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz 2023 soll dieser Wert auf 20 Prozent angehoben werden. Wie bisher kann Deutschland den so geförderten Ökostrom auf seine Beiträge gemäß der Erneuerbaren-Richtlinie und der Governance-Verordnung anrechnen.
Die Neuregelung hat die Bundesregierung unverändert aus dem Referentenentwurf des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes vom März übernommen. Der deutsche Erneuerbaren-Verband BEE hatte sich damals gegen die erhöhte Anrechnung von Ökostrom-Projekten aus dem EU-Ausland ausgesprochen. Mit den Änderungen könnten Kooperationsprojekte nunmehr angegangen und Zielmengen gesichert werden, heißt es dagegen in der Gesetzesbegründung der Regierung.
In dem sogenannten Osterpaket schreibt der Bund außerdem den Bau von drei neuen grenzüberschreitenden Stromverbindungsleitungen mit den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz gesetzlich fest. Künftig können außerdem Kraftwerke in Luxemburg an deutschen Ausschreibungen für Kapazitätsreserven teilnehmen, die in Notfällen die Stromversorgung im Bundesgebiet sichern sollen. ber
Es war der letzte notwendige Schritt, jetzt ist der in den Trilogen erzielte Kompromiss zum Data Governance Act (DGA) im EU-Parlament angenommen worden. Mit 501 Ja-Stimmen bei gerade einmal 12 Gegenstimmen und 40 Enthaltungen hat damit der erste Baustein der Datenstrategie auch formal das Verfahren passiert.
Die Berichterstatterin Angelika Niebler (CSU/EVP) sieht darin den Auftakt einer digitalpolitischen Zeitenwende. Nachdem Europa die, so Niebler, “Geburtsstunde der Plattformökonomie verschlafen” habe, sei man nun mit Data Governance Act, Data Act, Digital Markets Act und Digital Services Act auf dem Wege, einen europäischen Weg zu beschreiten. Der Data Governance Act, der keine personenbezogenen Daten umfasst, sei zusammen mit den anderen Legislativvorhaben eine “gewaltige Chance sich digitalwirtschaftlich zu emanzipieren und aus dem Schatten der Datenmonopolisten zu treten”, insbesondere für Startups und kleinere Unternehmen. Es gehe darum, nicht nur das “Spielfeld zu begradigen, sondern Spielregeln grundlegend zu ändern.”
Ein wesentlicher Unterschied zum ausschließlich an Marktmechanismen orientierten US- sowie dem chinesischen Modell, das aus Nieblers Sicht eine Mischung aus Unternehmertum und staatlicher Überwachung ist, sei es, dass man neutrale Akteure für die Vermittlung zwischen Datenanbietern und Nutzern mit dem Rechtsakt etabliere.
Sergej Lagodinsky (Grüne/EFA) erläuterte, dass Europa Daten und Datenschutz brauche, dieser Spagat sei hier ganz gut gelungen. “Wir gestalten für Bürger:innen die Möglichkeit, ihre Daten verfügbar zu machen und gleichzeitig das letzte Wort bei der Verwendung zu behalten”, so Lagodinsky. Datenwirtschaftliche Innovation nicht auf Kosten des Datenschutzes, daran solle man auch künftig festhalten, sagte der Berichterstatter des LIBE-Ausschusses im Parlament mit Blick auf den Data Act.
EU-Industriekommissar Thierry Breton nannte den Data Governance Act im Plenum “den Eckpfeiler des datenregulatorischen Rahmens”, der nun errichtet werde. Europa könne in der kommenden Welle datenbasierter Innovationen ein wesentlicher Mitspieler werden. Insbesondere die industrielle Datenökonomie sei auf einen verlässlichen Rahmen angewiesen. Allerdings gibt es Kritik aus der Wirtschaft, dass mit dem DGA auch bereits etablierte und funktionierende Datenmärkte abgewürgt würden, die nach anderen Kriterien funktionieren.
Unklar ist derzeit, inwieweit ein erhoffter funktionierender europäischer Datenmarkt interoperabel mit anderen Datenmärkten sein kann – und auch soll. Bei der eigentlich politisch angestrebten engeren transatlantischen Interoperabilität besteht die Hoffnung darin, dass die europäischen Regeln ausreichend Strahlkraft erzeugen, um auch US-Unternehmen für diese zu begeistern. Chinesische Anbieter etwa dürften mit dem DGA hingegen ihre Probleme haben: Thierry Breton betonte im Straßburger Plenum, dass der DGA auch Maßnahmen dazu enthalte, unzulässige Zugriffe durch Dritte zu verhindern, insbesondere von außerhalb der EU.
Doch ob der DGA die mit ihm verbundenen Ziele auch in der Praxis erreichen hilft, hängt nicht nur von den noch ausstehenden Vorhaben ab (Europe.Table berichtete). Man habe, sagte Berichterstatterin Angelika Niebler, “ins blaue Hinein versucht, einen Rechtsrahmen zu schaffen”, da es diesen Markt ja noch nicht gebe – bei dem man nun schauen müsse, ob dieser angenommen wird. fst
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen klagt gegen den US-Technologieriesen Google vor dem Landgericht Berlin wegen seiner Cookie-Banner. “Mit Tricks bei der Gestaltung der Cookie-Banner versuchen Unternehmen die Einwilligung der Verbraucher:innen zu erschleichen, um an möglichst viele persönliche Informationen zu gelangen, diese zu sammeln und zu verarbeiten”, begründete der Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, Wolfgang Schuldzinski, am Mittwoch das Verfahren. Es müsse genauso leicht sein, Cookies abzulehnen wie sie zu akzeptieren, um eine unbedachte Datenpreisgabe zu verhindern. Das sei bei den Webseiten der Suchmaschine von Google nicht der Fall.
Google will auf die Kritik reagieren. Eine Firmensprecherin kündigte an, der Konzern werde “in Kürze Änderungen an unserem Einwilligungsbanner und unseren Cookie-Praktiken in ganz Europa, einschließlich Deutschland, vornehmen, um den Anweisungen der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden”.
Die Verbraucherzentrale NRW hält die entsprechende Gestaltung auf den Webseiten der Suchmaschine von Google für unzulässig (Europe.Table berichtete). So sei nur ein Klick für die Zustimmung nötig, aber zur Ablehnung müsse der Nutzer erst auf eine zweite Ebene des Banners wechseln, wo dann mindestens drei verschiedene Kategorien von Cookies einzeln abgelehnt werden müssten (Europe.Table berichtete).
Mit diesen sogenannten Dark Patterns verstößt Google nach Ansicht der Verbraucherzentrale gegen nationale Datenschutz-Regelungen aus dem Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) sowie gegen EU-Recht. Der geplante EU-weite Digital Services Act (DSA) will diese manipulativen Design-Praktiken gänzlich verbieten. rtr
Wegen Mängeln beim Datenschutz geht die EU-Kommission gegen Deutschland vor. Man habe entschieden, ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Konkret geht es demnach darum, dass Deutschland der EU-Kommission noch keine Maßnahmen mitgeteilt hat, wie es die EU-Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung mit Blick auf die Arbeit der Bundespolizei umsetzt.
Die EU-Kommission überwacht in der Staatengemeinschaft die Einhaltung von EU-Recht. Sollte Deutschland die Bedenken der Behörde im Laufe des Verfahrens nicht ausräumen, drohen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und letztlich eine Geldstrafe.
Die fragliche Richtlinie musste eigentlich bis zum 6. Mai 2018 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie soll das Grundrecht der Bürger auf Datenschutz gewährleisten, wenn personenbezogene Daten von Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen benutzt werden. Unter anderem soll sichergestellt werden, dass die Daten von Opfern, Zeugen und Verdächtigen ausreichend geschützt sind. dpa

Der nächste große Test für die Glaubwürdigkeit der G20 wird kommen, wenn (oder falls) ihre Finanzminister und Notenbankgouverneure am 18. bis 24. April zu den Frühjahrstagungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zusammenkommen. Als heute führendes Forum für internationale wirtschaftspolitische Zusammenarbeit wird die G20 eine volle Tagesordnung haben. Spitzenthemen sind unter anderem die Reaktionen der Notenbanken auf die eskalierende weltweite Inflation, zunehmende Hinweise auf einen rapiden Klimawandel und die Koordinierung der Gesundheits- und Fiskalpolitik. Doch der Bär im Wohnzimmer werden Russlands brutaler Überfall auf die Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen sein, angefangen mit seinen Auswirkungen auf die weltweiten Lebensmittelpreise.
Trotz einiger wichtiger Erfolge haben mehrere deutliche Versäumnisse die Glaubwürdigkeit der G20 in den letzten Jahren untergraben. Während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wurden die G20-Communiqués regelmäßig derart verwässert, dass sie nahezu sinnfrei waren. In jüngerer Zeit hat die Gruppe es versäumt, eine wirksame globale Reaktion auf COVID-19 zu formulieren oder gar Vorbereitungen für künftige Pandemien zu treffen.
Die Glaubwürdigkeit der G20 ist in einer Welt zunehmend globalisierter Herausforderungen ein wichtiger Aktivposten. Doch ist Glaubwürdigkeit schwierig aufzubauen und man kann sie leicht verlieren. Das Treffen in diesem Monat könnte daher ein Wendepunkt sein. Bisher haben die G20-Mitglieder sehr unterschiedlich auf die Ukraine-Krise reagiert, und zwar sowohl was die öffentliche Kommunikation angeht als auch politisch. Während die USA und ihre Verbündeten harte Sanktionen verhängt haben, haben 38 Länder – darunter China, Indien und Südafrika – sich bei einer kürzlich verabschiedeten Resolution der UN-Generalversammlung, die Russland kritisierte und einen humanitären Zugang zur Ukraine forderte, der Stimme enthalten.
Laut dem von Chad P. Bown vom Peterson Institute for International Economics gepflegten Sanktions-Tracker haben acht G20-Mitglieder (alle Mitgliedsländer mittleren Einkommens) öffentlich ihre Nichtteilnahme an Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland erklärt, und Saudi-Arabien – ein US-Verbündeter, der im Rahmen der OPEC+ mit Russland zusammenarbeitet – hat sich als ähnlich abgeneigt erwiesen. Es ist daher absehbar, dass die Gruppe nicht einmal bei der Beschreibung des russischen Krieges oder seiner Auswirkungen auf die Weltmärkte einen Konsens erreichen dürfte. Doch die Aggression Russlands im Interesse der Einstimmigkeit herunterzuspielen könnte die Glaubwürdigkeit der G20 unwiederbringlich untergraben.
So oder so wird sich die G20 mit Sicherheit mit einer augenfälligen und unmittelbaren Folge der russischen Invasion befassen: dem potenziellen Rückgang des weltweiten Lebensmittelangebots. Schon vor dem
24. Februar hatten sich die weltweiten Lebensmittelpreise Rekordhöhen genähert. Bedingt war dies durch ein Zusammenspiel von Faktoren ähnlich jenen der Jahre 2007/08 und 2010, welche ebenfalls einen steilen Anstieg der Lebensmittelpreise zur Folge hatten. Diese früheren Episoden führten in einigen ärmeren Ländern zu breit gestreuter sozialer Instabilität. Viele Länder niedrigen und mittleren Einkommens sehen sich zudem Inflationsdruck, höheren Schuldenständen und fortgesetzten Anfälligkeiten gegenüber Seuchen und dem Klimawandel ausgesetzt. Die Auswirkungen könnten explosiv sein.
Die Ukraine und Russland gehören zu den wichtigsten Exporteuren von Weizen, Mais, Sonnenblumenkernen und Sonnenblumenöl. Laut jüngsten Prognosen der Welternährungsorganisation (FAO) könnten die schon jetzt hohen Preise für Lebens- und Futtermittel im Laufe dieses und des nächsten Jahres aufgrund der Zerstörung der Produktions-, Lager- und Transporteinrichtungen der Ukraine sowie möglichen sanktionsbedingten Störungen der russischen Getreide- und Düngemittelexporte, erhöhten Weltenergiepreisen und höheren Versand- und Versicherungskosten um 8 bis 22 Prozent steigen. Infolgedessen könnte die Zahl der unterernährten Menschen weltweit um 8 bis 13 Millionen ansteigen.
Wie bei früheren durch höhere Lebensmittelpreise bedingten Erschütterungen macht die heutige Krise eine internationale politische Koordinierung umso wichtiger. Insbesondere muss die G20, wie die FAO und die Welthandelsorganisation bereits drängen, Exportsteuern oder -kontrollen zulasten anderer Länder kollektiv ablehnen. Obwohl sie in der Vergangenheit massive Erhöhungen der weltweiten Lebensmittelpreise zur Folge hatten, greifen derartige Maßnahmen bereits wieder um sich.
Doch darf es die G20 damit nicht bewenden belassen. Rufe nach palliativen Maßnahmen können helfen, doch wenn sie nicht mit einer offenen Diskussion über Grundursachen und Gegenmaßnahmen einhergehen, drohen sie, Fehlverhalten zu begünstigen. Die gegenwärtige Bedrohung für das weltweite Lebensmittelangebot wurde durch den Angriffskrieg und andere Verstöße gegen das Völkerrecht eines einzigen G20-Mitglieds verschärft. Russland könnte die Krise problemlos einseitig abmildern, indem es seinen blutigen Überfall und insbesondere seine Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur beendet.
Natürlich ist die von diesem Krieg ausgehende weltweite wirtschaftliche Erschütterung zum Teil auch durch die Sanktionen bedingt. Doch würden diese zurückgefahren, wenn Russland seine Truppen abzöge und seine Bombardierungen einstellen würde. In der Zwischenzeit könnte Saudi-Arabien (zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten) den steilen Anstieg der weltweiten Energiepreise abmildern, indem es mehr Öl fördert – was es sich bisher zu tun weigert.
Auch wenn tiefe Meinungsverschiedenheiten zwischen den G20-Mitgliedern unvermeidlich sind, muss der Gipfel stattfinden, denn ihn abzusagen würde die G20 nicht weniger in Misskredit bringen. Die Gruppe muss zeigen, dass sie fähig ist, sich den Realitäten einer unangenehmen Situation zu stellen. Zu diesem Zweck sollte sich die Mehrheit der G20-Mitglieder bemühen, ein Communiqué abzufassen und zu billigen, das Russland offen als eindeutige Quelle sowohl des Problems als auch seiner Lösung identifiziert. Dies könnte eine simple Beschreibung der Tatsachen sein, ohne Formulierungen, die irgendjemanden offen verurteilen.
Natürlich weigert sich Russland bisher eisern, die Tatsachen anzuerkennen, und argumentiert, dass “eine mögliche Lebensmittelkrise nicht durch Russlands Sonderoperation in der Ukraine provoziert wird, sondern durch die illegalen einseitigen Sanktionen des Westens”. Doch wenn sich ein größerer Teil der G20-Mitglieder das Communiqué zu eigen macht, bliebe ein glaubwürdiger Rumpf von Ländern erhalten, der eine künftige multilaterale Zusammenarbeit unterstützen kann. Es ist besser, dass einige Länder dabei nicht mitmachen, wenn das ihr Wunsch ist, als dass man eine nicht vorhandene Einigkeit vorspiegelt.
Die G20-Mitglieder einschließlich Russlands sind die wichtigen Akteure, die das globale Gemeingut beeinflussen. Es ist nach wie vor wichtig, dass sie in all den wichtigen Bereichen kommunizieren, in denen sie Einfluss ausüben, darunter Ernährung, Gesundheit und Klimaschutz. Eine Einigkeit in substanziellen Fragen wird dort, wo sie möglich ist, das weltweite Gemeinwohl fördern. Doch grundlegende Meinungsverschiedenheiten können und sollten öffentlich eingestanden werden, damit Teilgruppen der Mitglieder weiterhin eigene Initiativen verfolgen können.
Aus dem Englischen von Jan Doolan. In Kooperation mit Project Syndicate, 2022.