China ist einer der größten Exportmärkte für den deutschen Mittelstand. Umso größer ist die Sorge über den Aufstieg der Konkurrenz aus Fernost. “Wir schützen unsere Technologie noch immer zu stiefmütterlich”, sagt der Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds, Ludwig Veltmann, im Interview mit China.Table. Marcel Grzanna sprach mit ihm über Chinas Ambitionen in Sachen Technologieführerschaft. Der Mittelstand dürfe technisches Know-how nicht leichtfertig an die Konkurrenz aus der Volksrepublik verkaufen, sagt Veltmann.
Ein anderes internationales Problem ist der derzeitige Container-Stau in den Häfen. In vielen Branchen fehlen Material und Zulieferteile, Produktionsstätten stehen still, in den Geschäften steigen die Preise. Wie gut, dass Chinas Staatsmedien die vermeintliche Lösung verkünden: die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen der Volksrepublik und Europa. Sie sind Teil der prestigeträchtigen “Belt-and-Road”-Initiative. Finn Mayer-Kuckkuk hat sich das Potenzial der Land-Seidenstraße genauer angeschaut und kommt zu dem Schluss: Auch wenn die Landstrecken zuletzt an Bedeutung gewonnen haben, den Frachtverkehr zu See werden sie nicht ersetzen können.
In einer weiteren Analyse werfen wir einen Blick auf Brüssel, wo seit vergangener Woche ein Thema dominiert: Der Streit zwischen Frankreich und Australien wegen eines geplatzten U-Boot-Deals. Ausgerechnet am Tag der Vorstellung der EU-Strategie für den Indo-Pazifik gaben Canberra, London und Washington einen neuen Dreier-Sicherheitspakt bekannt und stießen damit die EU-Kapitale Paris vor den Kopf. Steht die transatlantische Zusammenarbeit in Asien nun generell infrage?
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

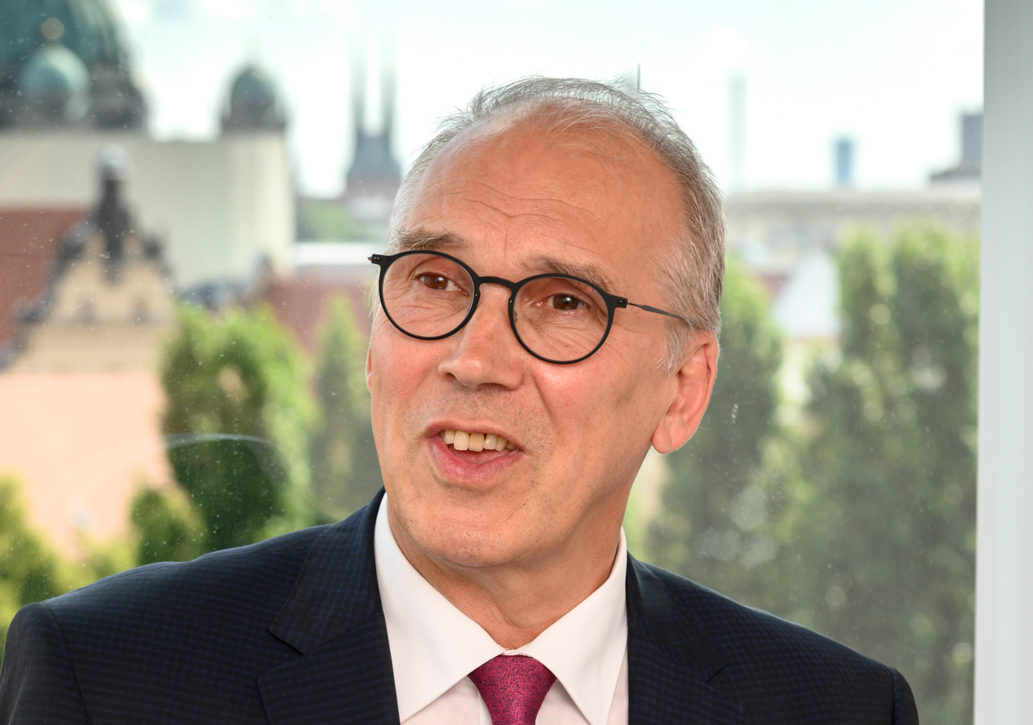
Herr Veltmann, was wäre dem deutschen Mittelstand lieber: Eine Welt unter US-amerikanischer oder chinesischer Technologieführerschaft?
Die Amerikaner sind uns lieber, solange sie keinen Präsidenten wie Trump haben. Sie sind uns kulturell deutlich näher und haben auch ein ähnliches Verständnis von Demokratie. China ist eine Autokratie. Und ein Land, das autoritär organisiert wird, ist uns grundsätzlich suspekt.
Welche Konsequenzen hätte eine chinesische Technologieführerschaft für Deutschland?
Da gibt es zwei Ebenen. Einerseits würde die Wertschöpfungstiefe hierzulande abnehmen. In manchen Technologiebranchen spielen deutsche Unternehmen heute schon keine Rolle mehr. China macht ja selbst vor Technologien nicht halt, in denen die deutsche Industrie bislang noch eine führende Rolle spielt. Wenn China Flugzeuge beispielsweise auf dem Weltmarkt verkauft, wo heute noch Airbus und Boeing den Ton angeben, wird deutlich sichtbar, wie Wertschöpfung nach China abwandert.
Und die zweite Ebene?
Das sind die politischen Implikationen. Es geht um die Frage, wie wir leben wollen. Wir sind hier sehr stolz auf unsere Demokratie und unsere Lebensweise, und sehen unsere Staatsform als die bessere auch im Hinblick auf Wachstums- und Entwicklungsperspektiven an. Nun aber kommt ein Land daher, das autokratisch geführt wird und uns mit seinem Staatskapitalismus zeigt, “was eine Harke ist”. Das könnte den einen oder anderen Technologiebegeisterten dazu bewegen, an unserer Demokratie zu zweifeln. Es könnten Stimmen aufkommen, die nach einem “starken Mann” im Land verlangen, der die mitunter lähmenden Prozeduren in demokratischen Gremien zum Anlass nimmt, Freiheitsrechte einzuschränken. Das besorgt mich.
Halten Sie es für ein reales Szenario, dass wir zur Diktatur werden, weil China wirtschaftlich erfolgreich ist?
In dem Maße, in dem unsere Unternehmen hier an der Bürokratie und langwierigen Prozesse verzweifeln, schaffen wir den Nährboden für solches Gedankengut. Ich höre immer mal wieder aus den Unternehmen, wie unkompliziert und schnell Projekte in China umgesetzt werden. Unsere Firmen dagegen befinden sich gefühlt immer in der Warteschleife für die Genehmigung hierfür oder dafür, und dabei fallen ständig satte Verwaltungsgebühren an, obwohl die Unternehmen reichlich Steuern zahlen. Diese Gesamtsituation produziert viel Frust.
Droht der deutsche Mittelstand zum Bittsteller Chinas zu werden?
Das sind wir doch teilweise jetzt schon. China schottet sich immer weiter ab und arbeitet auffällig in vielen Wirtschaftsbereichen an weitreichender Autarkie. Immer mehr deutsche Firmen, die bei potenziellen chinesischen Geschäftspartnern anklopfen, stoßen auf Probleme. Die Schikane, die Ausländer während der Coronazeit bei der Einreise ins Land erfahren, ist symptomatisch. Außerdem darf nicht mehr offen über systemkritische Vorgänge gesprochen werden. Wenn es um sensible Dinge geht, verbietet sich die chinesische Seite sofort jede Diskussion.
Wäre all das anders, wenn die US-Amerikaner das Rennen um die technologische Dominanz gewinnen?
Da gehe ich von aus. Mal abgesehen von der besseren Kompatibilität unseres politischen Systems mit dem der USA hat China eine klare Strategie formuliert. Nämlich, dass es gegen die Abhängigkeit von Zulieferungen aus dem Ausland arbeitet. Die Technologieführerschaft würde China dabei massiv helfen, sich selbst zu versorgen. Das Land wäre als Exportmarkt für deutsche Unternehmen deutlich weniger attraktiv.
Hat der Mittelstand keine Mittel, um eine drohende chinesische Technologie-Vorherrschaft zu verhindern?
Durch mehr Flexibilität können Erfindergeist und die Einsatzbereitschaft im Mittelstand noch vergrößert werden. Doch dazu muss die Politik den Rahmen schaffen. In den Sonntagsreden ist es immer ganz leicht, den Mittelstand als das Fundament der deutschen Wirtschaft zu preisen und seine Förderung anzukündigen. Am Montag wird es dann wieder schwieriger. Statt Flexibilität gibt es dann Bauauflagen, langwierige Genehmigungs- und Prüfprozesse und Restriktionen, die den Mittelstand behindern. Die auferlegte Ausweitung der Erfassung von Arbeitsstunden beispielsweise passt überhaupt nicht in die heutige Zeit und behindert Betriebe unnötig im Wettbewerb.
Ist es die Schuld der hiesigen Politik, dass China kein Level Playing Field zulässt, was einen enormen Vorteil für chinesische Unternehmen bedeutet?
Die Politik leistet nicht, was sie eigentlich leisten müsste. So könnte sie in der EU starke Allianzen schmieden. Als Europäer setzen wir ohne solche den Chinesen doch gar kein Gewicht entgegen. Wir haben nicht mal einen EU-Außenminister. Da kommt jedes Land der EU allein auf China zu – das spielt einem so großen Land natürlich in die Karten. Wir brauchen deshalb unbedingt ein stärkeres Europa.
Indem es nach dem Motto “Wie du mir, so ich dir” den Chinesen den Zugang zu Ausschreibungen verbietet?
Nein, das wird nicht ohne Weiteres gelingen, wenn wir “tit for tat” spielen. Es bedarf globaler Zusammenarbeit mit klaren Regeln durch die Welthandelsorganisation oder ähnliche Institutionen. Multilaterale Verständigungen sind im Umgang mit China der bessere Hebel als der Bilateralismus. Angesichts der Größe und Marktmacht Chinas ist es unverzichtbar, geschlossen aufzutreten, um seine Interessen gegenüber der chinesischen Regierung wirksam zu vertreten.
Sie kritisieren die Politik. Aber hätte sich der Mittelstand auch besser auf die Herausforderungen einstellen können, denen er aufgrund des Aufstiegs Chinas begegnet?
Mitte der 1980er-Jahren habe ich ein Forschungsprojekt über Kooperationen in Taiwan durchgeführt. Damals war es völlig abwegig, dass die Volksrepublik China ein maßgebliches Gewicht in der Welt bekommen würde. Im Übrigen ging ich nicht als Einziger davon aus, dass sich vielmehr Taiwan wegen seiner damaligen wirtschaftlich deutlichen Überlegenheit gegenüber der Volksrepublik im internationalen Wettbewerb besser behaupten würde. Einem kommunistischen Regime haben wir diesbezüglich dagegen nicht sehr viel zugetraut.
Die Volksrepublik China hat in den zurückliegenden Jahren aber das Gegenteil bewiesen – trotz autokratisch sozialistischer Staatsform. Längst ist das Land nicht mehr die Werkbank der Welt für Billigprodukte und Imitate westlicher Marken. Vielmehr strömten in gewaltiger Dosis Kapital und Know-how ins Land, womit die Gewichte verschoben wurden. Heute gibt es kaum eine Technologie, in der China nicht den Anspruch oder den Ehrgeiz hat, Weltspitze zu sein. Diese Absichten hätte der Mittelstand frühzeitig erkennen müssen und nicht leichtfertig technisches Spitzen-Know-how an China verkaufen dürfen.
Dafür ist es zu spät, aber schützen wir unsere Technologie wenigstens heute ausreichend?
Das tun wir immer noch zu stiefmütterlich. Ich will nicht dem Protektionismus das Wort reden. Aber wenn ein chinesisches Unternehmen ein deutsches erwirbt, um zu gucken, wie das alles so funktioniert, und dann aber das Geschäft in China für den chinesischen Markt weiterbetreibt, dann muss uns klar sein, dass wir am Ende nur allzu rasch in die Röhre gucken. Da müssen wir klüger werden.
Gibt es denn nach all den Jahren immer noch Unternehmen, die von den tiefgreifenden Veränderungen durch Chinas tragende Rolle nichts mitbekommen?
Die ehrgeizigen Ziele Chinas sind inzwischen fast jedem Unternehmen in irgendeiner Form präsent. Aber es gibt noch zu wenig strategische Pläne, dem zu begegnen, was ein paar Tausend Kilometer weiter weg geschieht.
Chinas kategorische Ablehnung jeglicher Verantwortung für die Corona-Pandemie, die Vertragsbrüche in Hongkong, die Tragödien aus Xinjiang: Hat im deutschen Mittelstand in jüngster Vergangenheit ein Prozess begonnen, darüber nachzudenken, ob es moralisch anständig ist, mit China Geschäfte zu machen?
Natürlich hat es das. Und es gibt viele Unternehmen, die daraus Konsequenzen ziehen. Es herrscht schließlich im Mittelstand grundsätzlich Zustimmung für eine Politik, die sagt: Wir achten auf Menschenrechte und Produktionsbedingungen in diesem Land. Aber es ist letztlich nicht realistisch, den Unternehmen abzuverlangen, eine Art Kontrollfunktion zu übernehmen und allein die Verantwortung dafür zu tragen, wo die internationale Politik keine Lösungen findet. Das einzelne mittelständische Unternehmen wird kaum die immer komplexeren Lieferketten nachverfolgen und für das Verhalten der Vorlieferanten oder das Handeln deren Regierungen alleinige Verantwortung übernehmen können.
Ist das menschlich oder müssen wir den Unternehmen mehr abverlangen?
Da stellt sich die Frage, wie weit man einen einzelnen Unternehmer verantwortlich machen kann. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz verlangt ja, dass die Lieferkette nur aus Akteuren mit weißen Westen besteht. Aber so arbeitsteilig, wie die Welt funktioniert, ist das doch gar nicht darstellbar. Wichtig wäre, dass Umwelt- und Sozialstandards durch die Weltgemeinschaft festgelegt werden. Darum sollte sich etwa die WTO kümmern. Dann könnten die Unternehmen viel effizienter ihre Arbeit tun und würden nicht durch kostspielige Bürokratiemonster ausgebremst.
Welche Werkzeuge bleiben dem Mittelstand jenseits politischer Forderungen?
Wenn wir es schaffen, Kreativität und Innovationen zu entfesseln und starke Marken zu schaffen oder fortzuentwickeln, dann haben wir weiterhin beste Chancen im internationalen Wettbewerb. Denn dann können wir uns als unverzichtbarer Akteur in den globalen Wertschöpfungsketten positionieren. Noch ist das Image deutscher Produkte noch sehr gut in China. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass auch das abnimmt. Der Dieselskandal hat das deutsche Auto auch in China unter Druck gesetzt, natürlich auch weil die chinesische Propaganda das für sich genutzt hat.
Vom Grad der Digitalisierung ganz zu schweigen.
Und auch da müssen wir uns fragen, weshalb wir den Zug zu verpassen drohen und ihn in vielen Bereichen leider schon verpasst haben. Digitalisierung benötigt großes Investment, aber dieses in Deutschland in der notwendigen Geschwindigkeit zu mobilisieren, ist oft schlicht nicht in gleichem Maße möglich wie etwa in den USA oder in China. Dabei kann der überfällige Transformationsprozess nur dann gelingen, wenn digitale Tools und vor allem digital gesammelte und aufbereitete Daten gezielt zum Einsatz kommen.
Für den Handel etwa ist es wichtig, die Kundenbedürfnisse genau zu kennen. Wem dies am besten gelingt, der ist im Wettbewerb ganz vorn. Wirtschaftlicher Erfolg erklärt sich heute zumeist datenbasiert. Noch hinken wir bei der Datenauswertung gewaltig hinterher. Wenn man die Vielfalt und den Nutzen der Dienstleistungen etwa auf der Handelsplattform Alibaba näher betrachtet, wird deutlich, wo die Reise im Wettbewerb hingeht.
Das klingt nach viel Arbeit in schwieriger Ausgangslage. Wie schätzen sie die Stimmung im Mittelstand ein?
Mittelständler sind Berufsoptimisten mit erheblicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das stärkt nicht nur ihre Unternehmen und schützt sie gerade in Krisenzeiten, sondern stabilisiert zugleich ganze Volkswirtschaften. Digitalisierung und die sich rapide verschärfende Debatte zum Thema Nachhaltigkeit lösen dramatische Veränderungen in den Märkten aus, denen das einzelne mittelständische Unternehmen immer weniger gewachsen ist. Der Kooperationsgedanke erfährt deshalb gerade wieder eine Renaissance, denn nur gebündelte Kräfte können die Nachteile zu kleiner Einheiten ausgleichen.
Der Mittelstandsverbund bringt hierzu seine Expertise für die Stärkung und Fortentwicklung der Unternehmen auf der Basis der genossenschaftlichen Idee konsequent bei den von ihm vertretenen 230.000 Unternehmen in 320 Unternehmensverbünden aus 45 Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbranchen ein. Hierbei gilt es, den politischen Entscheidungsträgern immer wieder den Wert der kooperativen Wirtschaftsform vor Augen zu führen und für deren Freiräume – etwa in der Kartell- und Wettbewerbspolitik – einzutreten. Als Unternehmer gut vernetzt zu sein, entfaltet sich nicht nur zunehmend als wirtschaftlicher Vorteil, es trägt auch zu einer besseren Stimmung bei.
Ludwig Veltmann, 62, lernte in den 1980er-Jahren Chinesisch und zog für Forschungsprojekte nach Taiwan und in die Volksrepublik. Seit 2001 verfolgt er als Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes den wachsenden Einfluss der Volksrepublik auf die deutsche Wirtschaft.

Der Mangel an Container-Kapazitäten belastet weiterhin den Welthandel (China.Table berichtete). Grund sind vor allem Engpässe in den Häfen. Chinesische Staatsmedien propagieren in den vergangenen Monaten die vermeintliche Lösung in Gestalt der Land-Seidenstraße und schüren gezielt die Hoffnung, dass die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen China und Europa zur Entlastung der Seestrecken beitragen könnten. Diese Erzählung wird begleitet von Erfolgsnachrichten des Prestigeprojekts der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI).
Die Nachrichtenagentur Xinhua präsentiert beispielsweise sehr regelmäßig Bilderstrecken von Zügen, die sich auf den Weg an Orte wie Duisburg machen. Dazu kommen Berichte über beschleunigte Zollabfertigung an den Grenzen, die Inbetriebnahme neuer Verbindungen und eine um 80 Prozent gesteigerte Zugfrequenz.
Experten sind sich indes einig, dass die Landverbindung zwar stark an Bedeutung gewinnt, allerdings nur geringen praktischen Einfluss auf die aktuellen Probleme haben wird. “Eine kleine Entlastung kann der Schienenverkehr natürlich schon darstellen. Er ist aber nicht groß genug, um wirklich das Problem zu lösen”, sagt Holger Görg, Leiter des Forschungsbereichs Internationaler Handel und Investitionen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), dem China.Table.
Die Land-Seidenstraße habe das Schienennetz enorm vergrößert, aber der Schienenverkehr leide ebenfalls an Engpässen, so Görg. Dazu gehören beispielsweise:
Als Engpass viel entscheidender ist jedoch das grundsätzlich viel geringere Fassungsvermögen von Zügen im Vergleich zu Schiffen. Die Betreiber der Seidenstraßen-Routen zu Lande konnten zwar im vergangenen Jahr verkünden, erstmals innerhalb eines Monats mehr als 100.000 Standard-Container transportiert zu haben. Das ist jedoch nur so viel, wie auf fünf Containerschiffe passt. Diese sind zudem ständig zu Hunderten auf den Weltmeeren unterwegs. Auf einen Zug passen eben nur rund 40 Container. Auf ein Schiff bis zu 20.000.
Auch wenn auf der Schiene also doppelt so viele Container rollen wie ein Jahr zuvor, hält sich die Entlastung also kurzfristig gesehen in Grenzen. Der Zug bleibt weiterhin vor allem etwas für Warengruppen, die zu einem höheren Preis schneller ans Ziel sollen.
Dabei wäre eine Entlastung hochwillkommen. Die britische Zeitschrift “Economist” fragt schon: “Werden die fortgesetzten Störungen die Handelsmuster verschieben?” Die Containerreedereien leiden seit Beginn der Pandemie unter einem Desaster nach dem anderen. Chinas Behörden haben mehrfach den Betrieb großer Häfen gedrosselt, nachdem Arbeiter sich mit Covid-19 angesteckt hatten (China.Table berichtete). Zwischendurch blieb ein Schiff im Suezkanal stecken und löste einen Rückstau rund um den Planeten aus. Derzeit stören häufige Taifune den Betrieb – eine Folge des Klimawandels.
Die Logistiker hatten seit Frühjahr 2020 keine Gelegenheit, den Frachtschiffverkehr wieder in den Takt zu bringen. Jede kleine Unregelmäßigkeit hat Folgewirkungen, die das brüchige Gefüge wieder stören. Die Unregelmäßigkeiten tragen zum Mangel an Zulieferteilen und Waren aus Ostasien bei. Da Containerplatz knapp ist, steigen zudem die Preise. Der entsprechende Index ist derzeit dreimal höher als vor einem Jahr und fünfmal höher als vor der Pandemie. Der Containermangel ist ein echtes Problem für die Wirtschaft.
Doch auch wenn der Schienentransport in der aktuellen Krise wenig Erleichterung bringen wird, könnte er dem Schiff langfristig eben doch Konkurrenz machen. Die “Eurasische Eisenbahnallianz”, über die etwa die Hälfte des Güterzugverkehrs von China nach Europa rollt, will ihre Kapazitäten deutlich ausweiten. Bis 2025 soll das Volumen des Containertransports auf der Schiene zwischen Asien und Europa auf eine Million Standardcontainer steigen. Gerade der starke Anstieg des Frachtverkehrs infolge der Pandemie gilt der Allianz als starkes Zeichen dafür, dass sich weitere Investitionen lohnen.
Treiber des Trends ist natürlich Peking. “China investiert stark in die Schieneninfrastruktur”, sagt Ökonom Görg vom IfW. Offizielle chinesische Statistiken zeigen: Es gab zu Jahresbeginn rund 12.400 internationale Schienenverbindungen aus China – im Jahr 2015 waren es noch weniger als 1.000. “Und dieser positive Trend dürfte sich auch in absehbarer Zeit ähnlich fortsetzen”, meint Görg.
Deutsche Unternehmen mit Bezug zur Land-Seidenstraße freuen sich über den Trend und erwarten weiter starkes Wachstum. “Zurückblickend hat sich die Land-Seidenstraße großartig entwickelt”, sagt eine Sprecherin von BREB, einer Reederei aus Bremen (ehemals Eilemann & Bischoff). BREB nimmt in baltischen Häfen viele Seidenstraßen-Container in Empfang, die über die Landroute nach Europa gekommen sind. Seit diesem Frühjahr komme täglich ein kompletter Zug aus Xi’an in der russischen Hafenstadt Baltiysk östlich von Danzig an.
In Baltiysk übernehmen Schiffe von BREB die Container und bringen sie nach Mukran auf Rügen. Dort werden sie auf die Bahn verladen und rollen ins deutsche Hinterland. Die Reederei setzt für diesen Pendelverkehr laufend zwei Schiffe ein, die “BREB Mukran” und die “BREB Balktiysk”. Die beiden Frachter nehmen inzwischen auch Container in Schweden für die Verladung in Richtung China auf. “Die Ladungsmengen über die Land-Seidenstraße wachsen kontinuierlich weiter an“, beobachtet BREB. “Zum jetzigem Zeitpunkt ist noch kein Ende abzusehen.”
Aus Sicht der Reederei BREB ist vor allem die höhere Geschwindigkeit der Zugverbindung entscheidend: “Transitzeit ist ein entscheidender Faktor geworden.” Die Hochseestrecken seien weiter mit Unsicherheiten belastet, “während die Transitzeit auf der Land-Seidenstraße mit plus/minus ein bis zwei Tagen gleich bleibt.”
Derzeit sind die Angebote auf der Schiene in Einzelfällen sogar günstiger als mit dem Frachter. Der Landtransport wird langfristig jedoch teurer bleiben. Schiffe transportieren schlicht sehr, sehr viele Container auf einmal. “Zwar hat sich der Preisunterschied durch den extremen Anstieg der Frachtraten zur See verringert”, sagt Lars Jensen, CEO der Beratungsfirma Vespucci Maritime in Dänemark und einer der führenden Experten für Container-Logistik, dem China.Table. Doch mit der Nachfrage gehen nun auch die Frachtraten auf der Schiene hoch. “Wenn sich die Staus an den Häfen auflösen, wird eine Normalisierung eintreten.”
Görg bestätigt die Einschätzung, dass der Vorteil für die Schiene nach dem Ende der Pandemie wieder schwindet. “Man sollte den Grund für die derzeitigen Kapazitätsprobleme der Seefahrt nicht vergessen”, sagt Görg. Schließungen von Container-Terminals infolge von Corona-Ausbrüchen können zudem auch dem Schienenverkehr passieren. “Dort vielleicht noch häufiger, da viele Grenzen überschritten werden müssen.”
So hatte sich das Brüssel wahrscheinlich nicht vorgestellt. Kurz vor der Präsentation der lange angekündigten Indo-Pazifik-Strategie der Europäischen Union überraschen Australien, die USA und Großbritannien die Europäer mit einem eigenen Sicherheitspakt, der ebenfalls für die pazifische Region gilt. Die Teilnahme Australiens ist dabei besonders schmerzhaft. Schließlich sollte der ozeanische Kontinent ein wichtiger Partner des Vorhabens der EU sein – und wäre sogar der flächenmäßig größte davon gewesen.
Statt also gemeinsam auf die zunehmenden Machtdemonstrationen Chinas zu reagieren, laufen plötzlich konkurrierende Initiativen. Die Motivation Australiens war vermutlich ein Lockangebot der USA: Es lässt sich beim Bau atombetriebener U-Boote helfen. Das wiederum kam in Europa besonders schlecht an. Rüstungs-Schwergewicht Frankreich, dem deshalb nun ein U-Boot-Deal in Milliarden-Höhe mit Canberra aufgekündigt wurde, fühlt sich vor den Kopf gestoßen.
Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian zeigte sich dementsprechend brüskiert: “Das ist ein Vertrauensbruch, und ich bin extrem zornig.” Er hielt US-Präsident Biden vor, sich wie dessen Vorgänger Donald Trump verhalten zu haben. “Diese brutale, einseitige und unberechenbare Entscheidung erinnert mich in vielem an das, was Herr Trump getan hat”, sagte Le Drian dem Radiosender Franceinfo.
Auch in Richtung Brüssel gab es vorab keine Ankündigung über die Dreierallianz “Aukus” zwischen den USA, Großbritannien und Australien. Die EU, die mit ihrer neuen Strategie mehr Gewicht als geopolitischer Akteur im Indo-Pazifik beweisen wollte, wurde schlichtweg außen vorgelassen. “Wir wurden nicht konsultiert”, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag bei der Vorstellung des Papiers.
Borrell geht davon aus, dass ein Abkommen in dieser Größenordnung nicht erst über Nacht ausgearbeitet wurde. Der EU-Chefdiplomat kann der Sache jedoch einen positiven Spin abgewinnen: Aukus zeige die Wichtigkeit der Region und damit auch für die Strategie der EU für den Indo-Pazifik-Raum.
EU-Ratspräsident Charles Michel betonte ebenfalls, eine eigene Strategie des Blocks für die Region sei “mehr denn je notwendig”, das unterstreiche der anglofone Aukus-Pakt. Die Strategie werde auch beim Europäischen Rat im Oktober besprochen, kündigte Michel an.
Die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) hatten nach einem ersten Plan im April sieben Bereiche festgelegt, in welchen die EU ihren Einfluss im Indo-Pazifik erhöhen möchte:
Die EU will alles dafür tun, um die Schifffahrtsverbindung durch das Südchinesische Meer militärisch zu sichern. Dazu will die EU laut Strategie-Papier nun eine höhere Marinepräsenz mit Kriegsschiffen zeigen und “mehr gemeinsame Militärübungen” mit ihren Partnern durchführen. Auch zunehmende Hafenanläufe in der Region sind geplant, “um Piraterie zu bekämpfen und die Freiheit der Schifffahrt zu schützen”.
Die Europäer sind bereits mit zwei Einsätzen im Bereich des Indischen Ozeans unterwegs: Mit der Anti-Piraterie-Mission Atalanta vor der somalischen Küste und mit einer Ausbildungsmission in Mosambik. An Atalanta beteiligen sich asiatische Partnerländer wie Japan, Pakistan und Indien.
Was Peking zudem missfallen wird: Taiwan wird als indopazifischer Partner genannt, mit welchem Handels- und Investitionsabkommen angestrebt werden sollen. Die Forderung ist bisher vor allem aus dem Europaparlament gekommen – praktisch hat die EU-Kommission dafür aber noch keine Hebel in Bewegung gesetzt. Das EU-Parlament wiederholte in einer am Donnerstag angenommenen Entschließung zur Neuausrichtung der China-Politik dieses Anliegen. Das erhöht nun auch den Druck auf die EU-Kommission, konkrete Schritte zu unternehmen. Für ein verstärktes Engagement im Indo-Pazifik sprachen sich auch die EU-Abgeordneten in der Resolution aus (China.Table berichtete).
Die Strategie umfasst außerdem den Abschluss der Handelsverhandlungen mit Australien, Indonesien und Neuseeland sowie eine Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Indien. Zudem soll es zum Beispiel grüne Allianzen und Partnerschaften zur Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltzerstörung geben.
Mit Japan, Südkorea und Singapur soll pilotmässig digitale Kooperationen basierend auf vorhandenen Abkommen aufgebaut werden. In diesem Rahmen sollen dann beispielsweise Standards für den Einsatz von künstlicher Intelligenz “im Einklang mit demokratischen Grundsätzen und Grundrechten” entwickelt werden. Weitere der Partnerschaften mit Staaten in der Region könnten folgen, heißt es weiter in dem Strategie-Papier.
Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, dass die Strategie nicht als Konfrontation mit China verstanden werden sollte. Es gehe um Kooperation mit gleichgesinnten Staaten, wiederholte der Spanier.
Der angelsächsisch geprägte Dreier-Sicherheitspakt Aukus kam am Donnerstag dann als regelrechter Schock für die Europäer. Canberra werde beim Bau von zunächst acht atombetriebenen U-Booten unterstützt, gab der australische Premierminister Scott Morrison bei einer Videokonferenz mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Boris Johnson bekannt. “Wir haben die Absicht, diese U-Boote in Adelaide in Australien in enger Kooperation mit den USA und Großbritannien zu bauen”, kündigte Morrison an. Die U-Boote sollen zwar atomar betrieben sein, aber keine Atomwaffen transportieren. Nach Angaben Morrisons soll in den kommenden 18 Monaten geprüft werden, wie das Vorhaben umgesetzt werden kann.
Die drei Staats- und Regierungschefs erwähnten China bei der Ankündigung ihres Deals ebenfalls nicht explizit. Sie verwiesen jedoch auf regionale Sicherheitsbedenken. “Bei dieser Initiative geht es darum, sicherzustellen, dass jeder von uns über moderne Ressourcen verfügt – die modernsten Ressourcen, die wir brauchen – um auf die sich schnell entwickelnden Bedrohungen zu reagieren und uns zu verteidigen”, sagte US-Präsident Biden. Morrison sagte, das neue Dreierbündnis solle helfen, die “Herausforderungen” in der “zunehmend komplexen” indo-pazifischen Region anzugehen. Australien werde von den USA auch neue Marschflugkörper vom Typ Tomahawk erhalten.
Wenige Stunden nach der Bekanntgabe kündigte Canberra den rund 40 Milliarden Dollar umfassenden Auftrag zum Bau einer neuen U-Boot-Flotte mit dem französischen Reedereikonzern Naval Group auf. Er galt als einer der lukrativsten Verteidigungsdeals weltweit. EU-Chefdiplomat Borrell erklärte, er könne die Enttäuschung der Franzosen verstehen – das Vertrauen in die USA oder Australien dürfen deshalb aber nicht generell infrage gestellt werden.
Chinas Botschaft in Washington verurteilte das Abkommen der drei Staaten. Diese sollten “keinen ausgrenzenden Block bilden, der auf die Interessen Dritter abzielt oder ihnen schadet”, sagte Botschaftssprecher Liu Pengyu der Nachrichtenagentur Reuters. “Insbesondere sollten sie ihre Mentalität des Kalten Krieges und ideologische Vorurteile ablegen.” Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte, Aukus untergrabe “den regionalen Frieden und die Stabilität ernsthaft und fördere das Wettrüsten”.
Analysten und Analystinnen in Brüssel sahen in dem Dreier-Vorstoß dagegen nicht generell eine Untergrabung der EU-Strategie: “Es geht um mehr als einen Deal über U-Boote. Die eigentliche Frage ist, ob ein US-geführter Pushback im Bereich der Sicherheit gegen China im Indo-Pazifik-Raum im strategischen Interesse Europas ist – oder nicht”, sagte die Direktorin des Asia-Programms am Thinktank ECFR, Janka Oertel. Falls ja, könnte Aukus ein wertvoller Bestandteil der EU-Strategie sein und durch Europas Indo-Pazifik-Vorstoß ergänzt werden, so Oertel. “Wenn nicht, dann wird Europa eigene Antworten finden müssen, um regionale Partner glaubwürdig zu unterstützen – und zwar schnell.” Die Europäer seien bisher nicht sehr konsequent darin gewesen, mehr als nur rhetorische Solidarität mit Ländern zu zeigen, die von Peking unter Druck gesetzt würden.
Es gibt jedoch auch andere Meinungen: Dass Australien sich den USA und Großbritannien zugewandt habe, sei ein “Realitätscheck der geopolitischen Ambitionen der EU”, sagte ein EU-Diplomat gegenüber Politico. Die EU und ihre Mitgliedsländer schienen offenbar keine “glaubwürdigen Sicherheitspartner” für die USA und Australien zu sein. “Wir sollten nicht zu viel von der Indo-Pazifik-Strategie halten: Die EU ist kein Akteur im Pazifik-Raum.”
Japans Außenministerium begrüßte indes in einer Mitteilung die Vorstellung der EU-Strategie. Diese stimme mit Japans Ansichten und Bemühungen für einen “freien und offenen Indopazifik” überein, so der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi. Das Land führt seit Mittwoch seine umfassendste Militärübung seit 30 Jahren durch. Die Logistik-Übung mit rund 100.000 Soldaten, 20.000 Bodenfahrzeuge und 120 Flugzeugen soll auch ein Zeichen an China senden.
Das Auswärtige Amt hatte seine Bilanz zu einem Jahr Indo-Pazifik-Leitlinien bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht und die EU-Strategie gelobt. Als Erfolg führte das Ministerium unter anderem den Einsatz der Fregatte “Bayern” an. Dieser war am Mittwoch von chinesischer Seite offiziell das Einlaufen in Shanghai untersagt worden. Das Schiff bekam deshalb nun eine neue Route und einen neuen Stopp: Die Bayern wird zum Tanken anhalten – in Darwin. Damit bekommt die Fregatte nach Perth einen zweiten Anlaufpunkt in Australien.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich mit einem eindringlichen Appell an China und die USA gewandt und sie aufgefordert, ihre “völlig dysfunktionalen Beziehungen” zu reparieren, bevor sich ihre Probleme auf den Rest der Welt übertragen. “Wir müssen unter allen Umständen einen Kalten Krieg verhindern, der anders wäre als in der Vergangenheit, sehr wahrscheinlich gefährlicher und viel schwieriger zu handhaben”, warnte der UN-Generalsekretär.
Guterres forderte kurz vor dem nächsten UN-Gipfel die beiden führenden Wirtschaftsmächte auf, beim Klima zusammenzuarbeiten und in den Bereichen Handel und Technologie intensiver zu verhandeln – ungeachtet ihre Streitigkeiten bei Menschenrechten, Wirtschaftspolitik, Online-Sicherheit oder Souveränität im Südchinesischen Meer. “Bedauerlicherweise haben wir bei allem nur Konfrontation”, sagte Guterres gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press am Wochenende.
“Wir benötigen wieder funktionierende Beziehungen zwischen den beiden Mächten, um die Probleme Impfung, Klimawandel und andere globale Herausforderungen bewältigen zu können”, appellierte der UN-Generalsekretär. “All das kann nicht gelöst werden ohne konstruktive Beziehungen in der internationalen Gemeinschaft und vor allem zwischen den Supermächten.” rad
Peking hat Antrag auf Beitritt zu einem Wirtschaftsbund gestellt, der ursprünglich ökonomischen Druck auf China ausüben sollte. Das Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ist Nachfolger eines Freihandelsprojekts, aus dem US-Präsident Barack Obama gerade China gezielt heraushalten wollte. Unter Donald Trump haben sich jedoch umgekehrt die USA daraus zurückgezogen. Jetzt drängt wiederum China hinein, während Amerika kein Mitglied ist.
Der chinesische Handelsminister Wang Wentao hat den Antrag laut Reuters schriftlich an den neuseeländischen Handelsminister Damien O’Connor übermittelt. Die Hürden für die Aufnahme sind beim CPTPP höher als beim Regional Comprehensive Economic Partnership-Abkommen (RCEP), einer weiteren Wirtschaftspartnerschaft, die seit 2020 zwischen den zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten und fünf weiteren Staaten in der Region gilt. China ist hier ebenfalls beteiligt.
Das CPTPP ist seit Dezember 2018 in Kraft und verbindet insgesamt elf Pazifik-Anrainerstaaten. Darunter befinden sich neben Australien, Japan und Kanada auch mittel- und südamerikanische Länder wie Mexiko und Peru. Großbritannien ist an einem Beitritt interessiert, um die Folgen des Brexits abzumildern. Gemeinsam kommen die Mitglieder auf 13 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Mit China im CPTPP-Abkommen würde sich dieser Wert auf fast 28 Prozent erhöhen. niw
Die kongolesische Provinz Süd-Kivu hat sechs chinesische Unternehmen wegen illegalem Bergbau und Umweltzerstörung die Betriebserlaubnis entzogen. Chinesische Behörden haben prompt reagiert und die Unternehmen angewiesen, das Land zu verlassen. China kündigte sogar eine Bestrafung der Verantwortlichen an, berichtet die South China Morning Post (SCMP). “Wir werden chinesischen Firmen in Afrika niemals erlauben, lokale Gesetze und Regulierungen zu brechen”, schrieb Wu Peng, Generaldirektor der Abteilung für afrikanische Angelegenheiten im chinesischen Außenministerium, auf Twitter. Beobachter äußerten sich überrascht ob dieser deutlichen Worte.
Der Präsident der Demokratische Republik Kongo, Felix Tshisekedi, hat kürzlich angekündigt, die von seinem Vorgänger unterzeichneten Bergbauverträge des Landes mit chinesischen Unternehmen zu überprüfen, da sie die chinesische Seite begünstigen könnten. Dazu zählt ein Abkommen, das den Bau von Infrastruktur durch chinesische Vertragspartner als Bezahlung für Kobalt und Kupfer aus der DR Kongo vorsieht. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf sechs Milliarden US-Dollar, berichtet die SCMP. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe die Überprüfung zur Bedingung für einen Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar gemacht. nib
Die EU-Kommission hat ein Schlupfloch zur Umgehung von Anti-Dumping-Zöllen auf Aluminium-Haushaltsfolien aus China geschlossen. Die Strafzölle auf Alu-Folien für den Haushaltsgebrauch seien auf Importe aus Thailand ausgeweitet worden, teilte die Generaldirektionen für Handel der EU-Kommission mit. Untersuchungen hätten ergeben, dass chinesische Hersteller von Aluminiumfolien ihre Ware nach Thailand brachten, wo sie vor der Wiederausfuhr in die EU “geringfügigen Montagevorgängen” unterzogen wurden und somit nicht mehr unter die Anti-Dumping-Zölle fielen. Zuvor sei den EU-Aufsehern ein Anstieg der Einfuhren von Alu-Haushaltsfolien aus Thailand aufgefallen.
An anderer Stelle scheint die EU-Kommission Anti-Dumping-Zölle nun jedoch zu verzögern: Die Europäische Union werde im Oktober Abgaben auf chinesische Aluminium-Flachwalzprodukte erheben – nur um sie dann sofort für neun Monate auszusetzen, berichtet Reuters unter Berufung auf eine Veröffentlichung des Handelsverbands European Aluminium. Zum Hintergrund: Im April waren vorläufige Anti-Dumping-Zölle auf Aluminiumprodukte wie Bleche, -platten und -folien festgelegt worden (China.Table berichtete). Sie betragen zwischen 19,3 und 46,7 Prozent. Endgültige Anti-Dumping-Zölle sollten eigentlich ab 11. Oktober erhoben werden, dann läuft die Frist für die Festsetzung ab. Die endgültigen Zölle sollen für fünf Jahre gelten und wahrscheinlich zwischen 14 und 25 Prozent betragen.
Nach Beschwerden von zwei Verarbeitern und einem Importeur sollen die Zölle nun aber vorerst ausgesetzt werden, kritisierte European Aluminium. Die Aussetzung sei grundsätzlich ungerechtfertigt ist und widerspreche den Handels- und Klimaambitionen der Kommission, sagte der Generaldirektor des Verbands, Gerd Götz. Die EU-Kommission bestätigte gegenüber Reuters den Eingang des Antrags auf Aussetzung und erklärte, dieser müssen gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten besprochen werden. Eine endgültige Entscheidung war demnach noch nicht gefallen. ari
China und Russland wollen nach eigenen Angaben nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gemeinsam für Stabilität in der Region sorgen. Bei einer Videokonferenz kündigten Chinas Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin an, künftig Geheimdienstinformationen auszutauschen und regelmäßige Gespräche über Afghanistan zu führen. Das Gespräch fand im Rahmen der China-geführten Shanghai Cooperation Organization (SCO) statt (China.Table berichtete), Putin war dem Gipfeltreffen in Tadschikistan per Video zugeschaltet. Xi Jinping sagt, die SCO-Mitgliedsstaaten sollten zu einem reibungslosen Übergang in Afghanistan beitragen und Afghanistan anleiten, eine “integrative politische Struktur” zu entwickeln, wie Staatsmedien berichteten. Außerdem rief Xi die Führung in Kabul zu einer gemäßigten Innen- und Außenpolitik auf.
“Ich hoffe, dass diese Vorschläge zu dem Ziel beitragen, gemeinsam Sicherheit in unserer Region zu erreichen”, sagte Xi demnach. Putin wiederholte Xis Aufruf an die regionalen Hauptstädte, ihre Zusammenarbeit zu verstärken und das regionale Geheimdienstnetzwerk der SCO zum Austausch von Informationen über terroristische Organisationen zu nutzen. Er schlug vor, das SCO-Mandat auch auf die Kontrolle von Waffen und organisierter Kriminalität auszuweiten.
Xi forderte “relevante Parteien” in Afghanistan auf, “terroristische Organisationen auf afghanischem Gebiet auszurotten”, und versprach, der vom Krieg zerrütteten Nation mehr Hilfe zu leisten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der chinesische Präsident kritisierte indirekt die USA: “Bestimmte Länder” sollten ihre Verantwortung für die zukünftige Entwicklung Afghanistans als “Anstifter der schwierigen Situation” übernehmen.
Die SCO besteht aus China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan. Die Organisation hat zudem mit der Aufnahme des Iran begonnen, auch Ägypten, Katar und Saudi-Arabien sind als Gesprächspartner im Zuge der Expansion hinzugekommen. ari
Der strauchelnde Immobilienentwickler Evergrande hat am Samstag angefangen, Investoren mit verbilligten Immobilien zu entschädigen, wie Bloomberg berichtet. Das Unternehmen teilte über WeChat mit, Anleger, die an der Rückzahlung von Vermögensverwaltungsprodukten gegen Sachwerte interessiert sind, sollten sich an ihre Anlageberater oder lokale Evergrande-Niederlassungen wenden, so Reuters. Den Berichten zufolge hätten über 70.000 Anleger, darunter viele Angestellte des Unternehmens, die Vermögensprodukte gekauft. Umgerechnet circa 5,2 Milliarden Euro dieser Produkte seien nun fällig, schreibt das Wirtschaftsportal Caixin. Investoren könnten zwischen verbilligten Wohnungen, Büro- und Einzelhandelsflächen oder Parkhäusern wählen, so Reuters.
Kommenden Donnerstag muss Evergrande Zinsen in Höhe von umgerechnet 100 Millionen Euro für zwei Anleihen bezahlen. Der Termin gilt als wichtiges Zeichen dafür, ob der Konzern über genug Liquidität verfügt, um den Verpflichtungen nachzukommen, wie Bloomberg berichtet. Bei den Zahlungen gegenüber Banken und Lieferanten war der Konzern schon in Rückstand geraten (China.Table berichtete). Das Unternehmen hat ein Schuldenberg in Höhe von umgerechnet über 250 Milliarden Euro angehäuft. nib
Am 10. Juni 2021 verabschiedete der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses das Sanktionsabwehrgesetz (auf Englisch “Anti-Foreign Sanctions Law”). Die politischen Entscheidungsträger hatten das Gesetz hastig im Zusammenhang mit Sanktionen verabschiedet. Die USA, die EU, Großbritannien, Kanada sowie weitere Staaten hatten die Strafmaßnahmen gegen mehrere chinesische Beamte und Organisationen wegen Vorwürfen der Menschenrechtsverletzung in der Region Xinjiang und anderswo verhängt.
Das Gesetz gibt der chinesischen Regierung ein rechtliches Instrument, um auf ausländische Sanktionen mit eigenen Gegensanktionen zu reagieren (China.Table berichtete). Diese könnten Einzelpersonen und Unternehmen, die in China Geschäfte machen, sowie andere im Land tätige ausländische Akteure treffen. Die Umsetzung des Gesetzes stellt ein weiteres potenzielles Risiko für Unternehmen in China dar, da politische Spannungen ein unsichereres Geschäftsumfeld schaffen.
China hat das Gesetz nach mehr als drei Jahren immer weiter eskalierender politischer und wirtschaftlicher Streitigkeiten mit dem Ausland, darunter den USA und die EU, verabschiedet.
Im Juli 2018 hatten die USA unter der Führung des damaligen Präsidenten Donald Trump Zölle auf chinesische Produkte im Wert von rund 34 Milliarden US-Dollar erhoben und damit einen Handelsstreit eingeleitet, der noch immer nicht beigelegt ist.
Während dieser Zeit wurden auch Chinas führende Telekommunikationsunternehmen – Huawei und ZTE – von ausländischen Regierungen stark unter die Lupe genommen. Die USA sanktionierten ZTE, die Huawei-Managerin Meng Wanzhou wurde in Kanada festgenommen, zahlreiche Länder schränkten die Benutzung von Huawei-Produkten ein (China.Table berichtete). Dann folgten im März die Sanktionen gegen China vonseiten der USA, EU, Großbritanniens und Kanadas wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang.
Im Juni führten die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden weitere Beschränkungen ein: Unter anderem, indem sie US-Amerikanern verboten, in mehrere chinesische Unternehmen zu investieren, die im Militär-, Sicherheits- und Überwachungssektor tätig sind.
Als Reaktion auf die politischen und wirtschaftlichen Spannungen verabschiedete China das Sanktionsabwehrgesetz, um ein Instrument zur Abwehr ausländischer Strafmaßnahmen zu installieren. Obwohl die Volksrepublik auf einige der Entwicklungen bereits mit eigenen Gegensanktionen reagiert hatte, bietet das Gesetz einen stärkeren Rechtsrahmen für die Entwicklung und auch die Umsetzung zukünftiger Gegensanktionen.
Das Sanktionsabwehrgesetz beschreibt in groben Zügen, wann chinesische Behörden Gegensanktionen verhängen können, wer Anspruch auf Sanktionen hat und was die Strafmaßnahmen nach sich ziehen.
Laut Artikel 3 des Gesetzes können Einzelpersonen oder Organisationen, die an der Ergreifung oder Umsetzung von “diskriminierenden Maßnahmen gegen chinesische Staatsbürger” oder “Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten” beteiligt sind, auf eine schwarze Liste oder “Gegenliste” gesetzt werden. Das schließt auch Personen oder Organisationen ein, die indirekt an der Formulierung, Entscheidung oder Umsetzung solcher Sanktionsmaßnahmen beteiligt sind.
Artikel 5 des Sanktionsabwehrgesetzes besagt, dass auch die Ehepartner und unmittelbare Familienangehörige der Betroffenen auf die schwarze Liste gesetzt werden können. Organisationen, an denen die Personen beteiligt sind, und leitende Personen innerhalb solcher Organisationen können ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt werden. Es liegt im Ermessen der “relevanten Abteilungen des Staatsrates”, zu bestimmen, wer auf die schwarze Liste aufgenommen oder von ihr entfernt wird.
Personen und Organisationen auf der schwarzen Liste können gemäß Artikel 6 des Gesetzes Visa für die Volksrepublik oder die Einreise in das Land verweigert werden oder aus China abgeschoben werden. Darüber hinaus können sie von Finanztransaktionen mit chinesischen Institutionen ausgeschlossen oder an der Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen gehindert werden. Auch können ihre Vermögenswerte blockiert, beschlagnahmt oder eingefroren werden. Darüber hinaus können auf die schwarze Liste gesetzte Personen noch mit “anderen notwendigen Maßnahmen” sanktioniert werden.
Darüber hinaus besagt Artikel 12, dass Einzelpersonen und Organisationen keine diskriminierenden Maßnahmen eines anderen Landes gegen China durchführen oder bei deren Umsetzung helfen dürfen – diese können sonst von chinesischen Bürgern und Organisationen auf Schadensersatz verklagt werden.
Schließlich enthalten Artikel 13 und Artikel 15 des Anti-Sanktions-Gesetzes weit gefasste Maßnahmen, die besagen, dass Handlungen ausländischer Staaten, Organisationen und Einzelpersonen, die Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährden, anderen Gegenmaßnahmen unterliegen können, die aber nicht im Gesetz enthalten sind.
Vor der Verabschiedung des Sanktionsabwehrgesetzes hatte China bereits in den vergangenen Jahren Strafmaßnahmen ausgesprochen. Seit 2019 hat China gegen eine Reihe von Einzelpersonen und Organisationen Sanktionen verhängt, hauptsächlich in Bezug auf Hongkong, Taiwan und Xinjiang. Bisher hat China vor allem – aber nicht ausschließlich – Politiker, Forscher und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sanktioniert, obwohl auch einige Unternehmen der Rüstungsindustrie ins Visier genommen wurden.
Zu den Zielen der chinesischen Sanktionen gehörten unter anderem US-amerikanische Politiker wie Marco Rubio, Ted Cruz, Josh Hawley und Tom Cotton, der kanadische Politiker Michael Chong und EU-Politiker wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte des Europäischen Parlaments, europäische Wissenschaftler und Think-tanks und NGOs wie Human Rights Watch, Freedom House, die National Endowment for Democracy und Merics.
Bisher sind Unternehmen der Rüstungsindustrie die einzigen Privatunternehmen, die von China im Zusammenhang mit Waffenverkäufen an Taiwan sanktioniert wurden. Betroffen sind Lockheed Martin, Boeing Defense und Raytheon. China hatte außerdem als Reaktion auf politische Streitigkeiten Handelszölle auf eine Reihe ausländischer Produkte wie beispielsweise australischen Wein erhoben. Diese Handelszölle sind jedoch von Sanktionen getrennt.
Es ist unklar, ob das Gesetz China dazu veranlassen wird, seine Sanktionen zu verstärken, oder ob es lediglich bestehende Praktiken kodifiziert, also in einem Gesetzeswerk zusammenfasst.
Das Gesetz richtet sich nicht explizit gegen ausländische Unternehmen und Privatpersonen, die in China Geschäfte machen – sie sind bisher auch den chinesischen Sanktionen (aber nicht den Handelszöllen) weitgehend entgangen. Mit der Gesetzesnovelle könnten sie nun sanktioniert werden, und einige Firmen könnten sich in Situationen wiederfinden, die sie angreifbarer machen.
Beispielsweise verbietet der US-amerikanische Uyghur Forced Labour Prevention Act Unternehmen den Verkauf von Produkten in den USA, die mit Zwangsarbeit in Xinjiang hergestellt wurden. Sollte ein ausländisches Unternehmen, das in Xinjiang Waren produziert oder bezieht, auf diese Gesetzgebung reagieren, indem es die Produktion an einen anderen Ort verlagert, könnte die Firma im Falle eines politischen Streits mit der Volksrepublik mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Zielscheibe chinesischer Sanktionen werden.
Zunehmend eskalierende Sanktionen und Gegensanktionen sowie andere Beschränkungen aufgrund internationaler Meinungsverschiedenheiten werden es ausländischen Unternehmen erschweren, gleichzeitig Gesetze in China und auf ausländischen Märkten einzuhalten. Darüber hinaus ist das Anti-Sanktionsgesetz so vage und weit gefasst, dass seine Grenzen und praktische Anwendbarkeit schwer zu bestimmen sind.
Dementsprechend wird Unternehmen und anderen Organisationen, die in China tätig sind, empfohlen, eine Risk-Map zu erstellen, um ihre Gefährdung durch chinesische Sanktionen gemäß dem neuen Gesetz einzuschätzen. Das könnte beispielsweise die Identifizierung der Verbindungen in die politisch sensiblen Gebiete Hongkong, Taiwan, Xinjiang und Tibet beinhalten – sowohl im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit als auch auf die Netzwerke von Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Darüber hinaus tun Unternehmen gut daran, Notfallpläne zu entwickeln und Reaktionsszenarien zu modellieren, um sich auf potenzielle Sanktionen vorzubereiten.
Obwohl sich ausländische Unternehmen in China durchaus darauf vorbereiten sollten, wie sie auf das Anti-Sanktionsgesetz reagieren könnten, ändert die Gesetzesnovelle nicht grundlegend die Rechtslandschaft. Im Jahr 2020 hat China beispielsweise eine “Liste unzuverlässiger Entitäten” als potenzielles Vergeltungsinstrument im Handelskrieg zwischen den USA und China erstellt – die aber anscheinend nicht wirklich genutzt wurde.
Das Sanktionsabwehrgesetz als solches unterstreicht jedoch abermals, dass sich ausländische Unternehmen in China eine Strategie für ihr Risikomanagement zulegen sollten, um sich an ein zunehmend unsicheres Umfeld anzupassen.
Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

Schweden ist eigentlich nur ein Nebendarsteller auf der großen geopolitischen Bühne. Selten wird hierzulande über die Standpunkte des skandinavischen Staates gesprochen. Doch Schweden hat wie auch Deutschland handelspolitische Interessen. Das Verhältnis zur Volksrepublik China ist zudem immer komplexer geworden – etwa durch die Verhaftung des schwedischen Staatsbürgers und Buchhändlers Gui Minhai in Thailand vor sechs Jahren. “Politiker hier sprechen hinsichtlich der Beziehungen zu China gerne von Chancen und Herausforderungen”, sagt Björn Jerdén. Er ist Direktor des Swedish National China Centre und ein ausgewiesener China-Kenner.
Die schwedische Regierung spreche nicht über eine Eindämmung Chinas oder eine Abkopplung, sondern konzentriere sich auf die Möglichkeiten zur Wirtschaftskooperation, sagt Jerdén. Die China-Strategie des Landes von 2019 definierte diverse Aufgabenfelder für die Regierung, darunter Sicherheit, Handel, Klima, Innovation, Bildung sowie China als Akteur in der Entwicklungshilfe. Es ist eigentlich nie die Rede davon, China in die Schranken zu weisen. “Eine Sache hat sich in Schweden jedoch verändert: Dinge, die früher nur als Chancen gesehen wurden, werden nun auch als Herausforderungen betrachtet”, erklärt Jerdén. Ein Beispiel seien chinesische Investitionen in Schweden.
Eine ausgewogene Betrachtung der Vor- und Nachteile erfordert entsprechende Expertise, die Jerdén mit dem Centre liefern kann. Es hat erst im Januar die Arbeit aufgenommen, wird von der schwedischen Regierung finanziert und soll die Ministerien und Behörden mit Informationen versorgen. “Dafür braucht man Experten, die viel über China wissen und vielleicht Chinesisch sprechen, aber die zudem Expertise in einem bestimmten Bereich haben”, sagt er.
Aus seiner Sicht sei es für jedes EU-Land notwendig, so viel Wissen zu China zu sammeln wie nur möglich. Nur auf diese Weise ließe sich eine gemeinsame europäische Strategie entwickeln. “Doch es gibt keine Einheitslösung für die Wissensgenerierung. Die Situation ist in jedem Land anders, was die Regierung betrifft sowie das Zusammenspiel zwischen Regierung und Universitäten, Think-Tanks und Stiftungen”, meint Jerdén.
Jerdén selbst ist das Produkt der schwedischen Universitätsausbildung. Nach Bachelor und Master am Department of Global Political Studies der Universität in Malmö folgte der erfolgreiche Abschluss der Doktorarbeit in Stockholm. Während seiner Promotionszeit hielt er sich 2012 und 2013 als Gastwissenschaftler in Taiwan auf. Später nahm er am “China and the World Program” der Universitäten Harvard und Princeton teil. Vor seiner Ernennung zum Direktor des Swedish National China Centre arbeitete er am renommierten Institute of International Affairs in Stockholm.
In dieser Zeit erlebte Jerdén, wie das Interesse an der China-Politik in Schweden rapide zunahm. Das lag neben der allgemeinen globalpolitischen Entwicklung auch an Vorkommnissen wie der Inhaftierung des schwedischen Staatsbürgers und Publizisten Gui Minhai im Jahr 2015. “Das führte zu einer Periode der Anspannung in den Beziehungen. Ab 2018 nahm das chinesische Außenministerium über die Botschaft in Stockholm verstärkt am politischen Diskurs in Schweden teil”, erklärt Jerdén.
Damit rückte die schwedische China-Politik auch außerhalb handelsrelevanter Themen auf der Agenda nach oben. “Die Probleme führten zu der Einsicht, langfristig mehr Wissen zu China generieren zu müssen, um die Beziehungen auf gute Weise zu managen. Das China Center ist ein konkretes Resultat dieser Anstrengungen.” Constantin Eckner
China ist einer der größten Exportmärkte für den deutschen Mittelstand. Umso größer ist die Sorge über den Aufstieg der Konkurrenz aus Fernost. “Wir schützen unsere Technologie noch immer zu stiefmütterlich”, sagt der Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds, Ludwig Veltmann, im Interview mit China.Table. Marcel Grzanna sprach mit ihm über Chinas Ambitionen in Sachen Technologieführerschaft. Der Mittelstand dürfe technisches Know-how nicht leichtfertig an die Konkurrenz aus der Volksrepublik verkaufen, sagt Veltmann.
Ein anderes internationales Problem ist der derzeitige Container-Stau in den Häfen. In vielen Branchen fehlen Material und Zulieferteile, Produktionsstätten stehen still, in den Geschäften steigen die Preise. Wie gut, dass Chinas Staatsmedien die vermeintliche Lösung verkünden: die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen der Volksrepublik und Europa. Sie sind Teil der prestigeträchtigen “Belt-and-Road”-Initiative. Finn Mayer-Kuckkuk hat sich das Potenzial der Land-Seidenstraße genauer angeschaut und kommt zu dem Schluss: Auch wenn die Landstrecken zuletzt an Bedeutung gewonnen haben, den Frachtverkehr zu See werden sie nicht ersetzen können.
In einer weiteren Analyse werfen wir einen Blick auf Brüssel, wo seit vergangener Woche ein Thema dominiert: Der Streit zwischen Frankreich und Australien wegen eines geplatzten U-Boot-Deals. Ausgerechnet am Tag der Vorstellung der EU-Strategie für den Indo-Pazifik gaben Canberra, London und Washington einen neuen Dreier-Sicherheitspakt bekannt und stießen damit die EU-Kapitale Paris vor den Kopf. Steht die transatlantische Zusammenarbeit in Asien nun generell infrage?
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

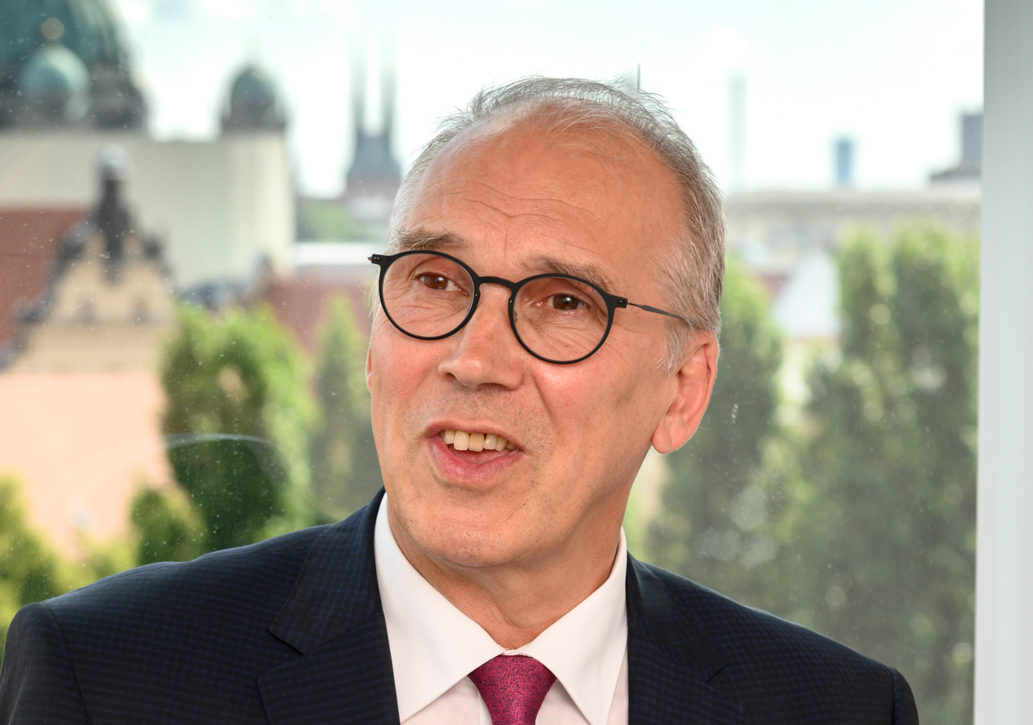
Herr Veltmann, was wäre dem deutschen Mittelstand lieber: Eine Welt unter US-amerikanischer oder chinesischer Technologieführerschaft?
Die Amerikaner sind uns lieber, solange sie keinen Präsidenten wie Trump haben. Sie sind uns kulturell deutlich näher und haben auch ein ähnliches Verständnis von Demokratie. China ist eine Autokratie. Und ein Land, das autoritär organisiert wird, ist uns grundsätzlich suspekt.
Welche Konsequenzen hätte eine chinesische Technologieführerschaft für Deutschland?
Da gibt es zwei Ebenen. Einerseits würde die Wertschöpfungstiefe hierzulande abnehmen. In manchen Technologiebranchen spielen deutsche Unternehmen heute schon keine Rolle mehr. China macht ja selbst vor Technologien nicht halt, in denen die deutsche Industrie bislang noch eine führende Rolle spielt. Wenn China Flugzeuge beispielsweise auf dem Weltmarkt verkauft, wo heute noch Airbus und Boeing den Ton angeben, wird deutlich sichtbar, wie Wertschöpfung nach China abwandert.
Und die zweite Ebene?
Das sind die politischen Implikationen. Es geht um die Frage, wie wir leben wollen. Wir sind hier sehr stolz auf unsere Demokratie und unsere Lebensweise, und sehen unsere Staatsform als die bessere auch im Hinblick auf Wachstums- und Entwicklungsperspektiven an. Nun aber kommt ein Land daher, das autokratisch geführt wird und uns mit seinem Staatskapitalismus zeigt, “was eine Harke ist”. Das könnte den einen oder anderen Technologiebegeisterten dazu bewegen, an unserer Demokratie zu zweifeln. Es könnten Stimmen aufkommen, die nach einem “starken Mann” im Land verlangen, der die mitunter lähmenden Prozeduren in demokratischen Gremien zum Anlass nimmt, Freiheitsrechte einzuschränken. Das besorgt mich.
Halten Sie es für ein reales Szenario, dass wir zur Diktatur werden, weil China wirtschaftlich erfolgreich ist?
In dem Maße, in dem unsere Unternehmen hier an der Bürokratie und langwierigen Prozesse verzweifeln, schaffen wir den Nährboden für solches Gedankengut. Ich höre immer mal wieder aus den Unternehmen, wie unkompliziert und schnell Projekte in China umgesetzt werden. Unsere Firmen dagegen befinden sich gefühlt immer in der Warteschleife für die Genehmigung hierfür oder dafür, und dabei fallen ständig satte Verwaltungsgebühren an, obwohl die Unternehmen reichlich Steuern zahlen. Diese Gesamtsituation produziert viel Frust.
Droht der deutsche Mittelstand zum Bittsteller Chinas zu werden?
Das sind wir doch teilweise jetzt schon. China schottet sich immer weiter ab und arbeitet auffällig in vielen Wirtschaftsbereichen an weitreichender Autarkie. Immer mehr deutsche Firmen, die bei potenziellen chinesischen Geschäftspartnern anklopfen, stoßen auf Probleme. Die Schikane, die Ausländer während der Coronazeit bei der Einreise ins Land erfahren, ist symptomatisch. Außerdem darf nicht mehr offen über systemkritische Vorgänge gesprochen werden. Wenn es um sensible Dinge geht, verbietet sich die chinesische Seite sofort jede Diskussion.
Wäre all das anders, wenn die US-Amerikaner das Rennen um die technologische Dominanz gewinnen?
Da gehe ich von aus. Mal abgesehen von der besseren Kompatibilität unseres politischen Systems mit dem der USA hat China eine klare Strategie formuliert. Nämlich, dass es gegen die Abhängigkeit von Zulieferungen aus dem Ausland arbeitet. Die Technologieführerschaft würde China dabei massiv helfen, sich selbst zu versorgen. Das Land wäre als Exportmarkt für deutsche Unternehmen deutlich weniger attraktiv.
Hat der Mittelstand keine Mittel, um eine drohende chinesische Technologie-Vorherrschaft zu verhindern?
Durch mehr Flexibilität können Erfindergeist und die Einsatzbereitschaft im Mittelstand noch vergrößert werden. Doch dazu muss die Politik den Rahmen schaffen. In den Sonntagsreden ist es immer ganz leicht, den Mittelstand als das Fundament der deutschen Wirtschaft zu preisen und seine Förderung anzukündigen. Am Montag wird es dann wieder schwieriger. Statt Flexibilität gibt es dann Bauauflagen, langwierige Genehmigungs- und Prüfprozesse und Restriktionen, die den Mittelstand behindern. Die auferlegte Ausweitung der Erfassung von Arbeitsstunden beispielsweise passt überhaupt nicht in die heutige Zeit und behindert Betriebe unnötig im Wettbewerb.
Ist es die Schuld der hiesigen Politik, dass China kein Level Playing Field zulässt, was einen enormen Vorteil für chinesische Unternehmen bedeutet?
Die Politik leistet nicht, was sie eigentlich leisten müsste. So könnte sie in der EU starke Allianzen schmieden. Als Europäer setzen wir ohne solche den Chinesen doch gar kein Gewicht entgegen. Wir haben nicht mal einen EU-Außenminister. Da kommt jedes Land der EU allein auf China zu – das spielt einem so großen Land natürlich in die Karten. Wir brauchen deshalb unbedingt ein stärkeres Europa.
Indem es nach dem Motto “Wie du mir, so ich dir” den Chinesen den Zugang zu Ausschreibungen verbietet?
Nein, das wird nicht ohne Weiteres gelingen, wenn wir “tit for tat” spielen. Es bedarf globaler Zusammenarbeit mit klaren Regeln durch die Welthandelsorganisation oder ähnliche Institutionen. Multilaterale Verständigungen sind im Umgang mit China der bessere Hebel als der Bilateralismus. Angesichts der Größe und Marktmacht Chinas ist es unverzichtbar, geschlossen aufzutreten, um seine Interessen gegenüber der chinesischen Regierung wirksam zu vertreten.
Sie kritisieren die Politik. Aber hätte sich der Mittelstand auch besser auf die Herausforderungen einstellen können, denen er aufgrund des Aufstiegs Chinas begegnet?
Mitte der 1980er-Jahren habe ich ein Forschungsprojekt über Kooperationen in Taiwan durchgeführt. Damals war es völlig abwegig, dass die Volksrepublik China ein maßgebliches Gewicht in der Welt bekommen würde. Im Übrigen ging ich nicht als Einziger davon aus, dass sich vielmehr Taiwan wegen seiner damaligen wirtschaftlich deutlichen Überlegenheit gegenüber der Volksrepublik im internationalen Wettbewerb besser behaupten würde. Einem kommunistischen Regime haben wir diesbezüglich dagegen nicht sehr viel zugetraut.
Die Volksrepublik China hat in den zurückliegenden Jahren aber das Gegenteil bewiesen – trotz autokratisch sozialistischer Staatsform. Längst ist das Land nicht mehr die Werkbank der Welt für Billigprodukte und Imitate westlicher Marken. Vielmehr strömten in gewaltiger Dosis Kapital und Know-how ins Land, womit die Gewichte verschoben wurden. Heute gibt es kaum eine Technologie, in der China nicht den Anspruch oder den Ehrgeiz hat, Weltspitze zu sein. Diese Absichten hätte der Mittelstand frühzeitig erkennen müssen und nicht leichtfertig technisches Spitzen-Know-how an China verkaufen dürfen.
Dafür ist es zu spät, aber schützen wir unsere Technologie wenigstens heute ausreichend?
Das tun wir immer noch zu stiefmütterlich. Ich will nicht dem Protektionismus das Wort reden. Aber wenn ein chinesisches Unternehmen ein deutsches erwirbt, um zu gucken, wie das alles so funktioniert, und dann aber das Geschäft in China für den chinesischen Markt weiterbetreibt, dann muss uns klar sein, dass wir am Ende nur allzu rasch in die Röhre gucken. Da müssen wir klüger werden.
Gibt es denn nach all den Jahren immer noch Unternehmen, die von den tiefgreifenden Veränderungen durch Chinas tragende Rolle nichts mitbekommen?
Die ehrgeizigen Ziele Chinas sind inzwischen fast jedem Unternehmen in irgendeiner Form präsent. Aber es gibt noch zu wenig strategische Pläne, dem zu begegnen, was ein paar Tausend Kilometer weiter weg geschieht.
Chinas kategorische Ablehnung jeglicher Verantwortung für die Corona-Pandemie, die Vertragsbrüche in Hongkong, die Tragödien aus Xinjiang: Hat im deutschen Mittelstand in jüngster Vergangenheit ein Prozess begonnen, darüber nachzudenken, ob es moralisch anständig ist, mit China Geschäfte zu machen?
Natürlich hat es das. Und es gibt viele Unternehmen, die daraus Konsequenzen ziehen. Es herrscht schließlich im Mittelstand grundsätzlich Zustimmung für eine Politik, die sagt: Wir achten auf Menschenrechte und Produktionsbedingungen in diesem Land. Aber es ist letztlich nicht realistisch, den Unternehmen abzuverlangen, eine Art Kontrollfunktion zu übernehmen und allein die Verantwortung dafür zu tragen, wo die internationale Politik keine Lösungen findet. Das einzelne mittelständische Unternehmen wird kaum die immer komplexeren Lieferketten nachverfolgen und für das Verhalten der Vorlieferanten oder das Handeln deren Regierungen alleinige Verantwortung übernehmen können.
Ist das menschlich oder müssen wir den Unternehmen mehr abverlangen?
Da stellt sich die Frage, wie weit man einen einzelnen Unternehmer verantwortlich machen kann. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz verlangt ja, dass die Lieferkette nur aus Akteuren mit weißen Westen besteht. Aber so arbeitsteilig, wie die Welt funktioniert, ist das doch gar nicht darstellbar. Wichtig wäre, dass Umwelt- und Sozialstandards durch die Weltgemeinschaft festgelegt werden. Darum sollte sich etwa die WTO kümmern. Dann könnten die Unternehmen viel effizienter ihre Arbeit tun und würden nicht durch kostspielige Bürokratiemonster ausgebremst.
Welche Werkzeuge bleiben dem Mittelstand jenseits politischer Forderungen?
Wenn wir es schaffen, Kreativität und Innovationen zu entfesseln und starke Marken zu schaffen oder fortzuentwickeln, dann haben wir weiterhin beste Chancen im internationalen Wettbewerb. Denn dann können wir uns als unverzichtbarer Akteur in den globalen Wertschöpfungsketten positionieren. Noch ist das Image deutscher Produkte noch sehr gut in China. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass auch das abnimmt. Der Dieselskandal hat das deutsche Auto auch in China unter Druck gesetzt, natürlich auch weil die chinesische Propaganda das für sich genutzt hat.
Vom Grad der Digitalisierung ganz zu schweigen.
Und auch da müssen wir uns fragen, weshalb wir den Zug zu verpassen drohen und ihn in vielen Bereichen leider schon verpasst haben. Digitalisierung benötigt großes Investment, aber dieses in Deutschland in der notwendigen Geschwindigkeit zu mobilisieren, ist oft schlicht nicht in gleichem Maße möglich wie etwa in den USA oder in China. Dabei kann der überfällige Transformationsprozess nur dann gelingen, wenn digitale Tools und vor allem digital gesammelte und aufbereitete Daten gezielt zum Einsatz kommen.
Für den Handel etwa ist es wichtig, die Kundenbedürfnisse genau zu kennen. Wem dies am besten gelingt, der ist im Wettbewerb ganz vorn. Wirtschaftlicher Erfolg erklärt sich heute zumeist datenbasiert. Noch hinken wir bei der Datenauswertung gewaltig hinterher. Wenn man die Vielfalt und den Nutzen der Dienstleistungen etwa auf der Handelsplattform Alibaba näher betrachtet, wird deutlich, wo die Reise im Wettbewerb hingeht.
Das klingt nach viel Arbeit in schwieriger Ausgangslage. Wie schätzen sie die Stimmung im Mittelstand ein?
Mittelständler sind Berufsoptimisten mit erheblicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das stärkt nicht nur ihre Unternehmen und schützt sie gerade in Krisenzeiten, sondern stabilisiert zugleich ganze Volkswirtschaften. Digitalisierung und die sich rapide verschärfende Debatte zum Thema Nachhaltigkeit lösen dramatische Veränderungen in den Märkten aus, denen das einzelne mittelständische Unternehmen immer weniger gewachsen ist. Der Kooperationsgedanke erfährt deshalb gerade wieder eine Renaissance, denn nur gebündelte Kräfte können die Nachteile zu kleiner Einheiten ausgleichen.
Der Mittelstandsverbund bringt hierzu seine Expertise für die Stärkung und Fortentwicklung der Unternehmen auf der Basis der genossenschaftlichen Idee konsequent bei den von ihm vertretenen 230.000 Unternehmen in 320 Unternehmensverbünden aus 45 Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbranchen ein. Hierbei gilt es, den politischen Entscheidungsträgern immer wieder den Wert der kooperativen Wirtschaftsform vor Augen zu führen und für deren Freiräume – etwa in der Kartell- und Wettbewerbspolitik – einzutreten. Als Unternehmer gut vernetzt zu sein, entfaltet sich nicht nur zunehmend als wirtschaftlicher Vorteil, es trägt auch zu einer besseren Stimmung bei.
Ludwig Veltmann, 62, lernte in den 1980er-Jahren Chinesisch und zog für Forschungsprojekte nach Taiwan und in die Volksrepublik. Seit 2001 verfolgt er als Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes den wachsenden Einfluss der Volksrepublik auf die deutsche Wirtschaft.

Der Mangel an Container-Kapazitäten belastet weiterhin den Welthandel (China.Table berichtete). Grund sind vor allem Engpässe in den Häfen. Chinesische Staatsmedien propagieren in den vergangenen Monaten die vermeintliche Lösung in Gestalt der Land-Seidenstraße und schüren gezielt die Hoffnung, dass die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen China und Europa zur Entlastung der Seestrecken beitragen könnten. Diese Erzählung wird begleitet von Erfolgsnachrichten des Prestigeprojekts der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI).
Die Nachrichtenagentur Xinhua präsentiert beispielsweise sehr regelmäßig Bilderstrecken von Zügen, die sich auf den Weg an Orte wie Duisburg machen. Dazu kommen Berichte über beschleunigte Zollabfertigung an den Grenzen, die Inbetriebnahme neuer Verbindungen und eine um 80 Prozent gesteigerte Zugfrequenz.
Experten sind sich indes einig, dass die Landverbindung zwar stark an Bedeutung gewinnt, allerdings nur geringen praktischen Einfluss auf die aktuellen Probleme haben wird. “Eine kleine Entlastung kann der Schienenverkehr natürlich schon darstellen. Er ist aber nicht groß genug, um wirklich das Problem zu lösen”, sagt Holger Görg, Leiter des Forschungsbereichs Internationaler Handel und Investitionen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), dem China.Table.
Die Land-Seidenstraße habe das Schienennetz enorm vergrößert, aber der Schienenverkehr leide ebenfalls an Engpässen, so Görg. Dazu gehören beispielsweise:
Als Engpass viel entscheidender ist jedoch das grundsätzlich viel geringere Fassungsvermögen von Zügen im Vergleich zu Schiffen. Die Betreiber der Seidenstraßen-Routen zu Lande konnten zwar im vergangenen Jahr verkünden, erstmals innerhalb eines Monats mehr als 100.000 Standard-Container transportiert zu haben. Das ist jedoch nur so viel, wie auf fünf Containerschiffe passt. Diese sind zudem ständig zu Hunderten auf den Weltmeeren unterwegs. Auf einen Zug passen eben nur rund 40 Container. Auf ein Schiff bis zu 20.000.
Auch wenn auf der Schiene also doppelt so viele Container rollen wie ein Jahr zuvor, hält sich die Entlastung also kurzfristig gesehen in Grenzen. Der Zug bleibt weiterhin vor allem etwas für Warengruppen, die zu einem höheren Preis schneller ans Ziel sollen.
Dabei wäre eine Entlastung hochwillkommen. Die britische Zeitschrift “Economist” fragt schon: “Werden die fortgesetzten Störungen die Handelsmuster verschieben?” Die Containerreedereien leiden seit Beginn der Pandemie unter einem Desaster nach dem anderen. Chinas Behörden haben mehrfach den Betrieb großer Häfen gedrosselt, nachdem Arbeiter sich mit Covid-19 angesteckt hatten (China.Table berichtete). Zwischendurch blieb ein Schiff im Suezkanal stecken und löste einen Rückstau rund um den Planeten aus. Derzeit stören häufige Taifune den Betrieb – eine Folge des Klimawandels.
Die Logistiker hatten seit Frühjahr 2020 keine Gelegenheit, den Frachtschiffverkehr wieder in den Takt zu bringen. Jede kleine Unregelmäßigkeit hat Folgewirkungen, die das brüchige Gefüge wieder stören. Die Unregelmäßigkeiten tragen zum Mangel an Zulieferteilen und Waren aus Ostasien bei. Da Containerplatz knapp ist, steigen zudem die Preise. Der entsprechende Index ist derzeit dreimal höher als vor einem Jahr und fünfmal höher als vor der Pandemie. Der Containermangel ist ein echtes Problem für die Wirtschaft.
Doch auch wenn der Schienentransport in der aktuellen Krise wenig Erleichterung bringen wird, könnte er dem Schiff langfristig eben doch Konkurrenz machen. Die “Eurasische Eisenbahnallianz”, über die etwa die Hälfte des Güterzugverkehrs von China nach Europa rollt, will ihre Kapazitäten deutlich ausweiten. Bis 2025 soll das Volumen des Containertransports auf der Schiene zwischen Asien und Europa auf eine Million Standardcontainer steigen. Gerade der starke Anstieg des Frachtverkehrs infolge der Pandemie gilt der Allianz als starkes Zeichen dafür, dass sich weitere Investitionen lohnen.
Treiber des Trends ist natürlich Peking. “China investiert stark in die Schieneninfrastruktur”, sagt Ökonom Görg vom IfW. Offizielle chinesische Statistiken zeigen: Es gab zu Jahresbeginn rund 12.400 internationale Schienenverbindungen aus China – im Jahr 2015 waren es noch weniger als 1.000. “Und dieser positive Trend dürfte sich auch in absehbarer Zeit ähnlich fortsetzen”, meint Görg.
Deutsche Unternehmen mit Bezug zur Land-Seidenstraße freuen sich über den Trend und erwarten weiter starkes Wachstum. “Zurückblickend hat sich die Land-Seidenstraße großartig entwickelt”, sagt eine Sprecherin von BREB, einer Reederei aus Bremen (ehemals Eilemann & Bischoff). BREB nimmt in baltischen Häfen viele Seidenstraßen-Container in Empfang, die über die Landroute nach Europa gekommen sind. Seit diesem Frühjahr komme täglich ein kompletter Zug aus Xi’an in der russischen Hafenstadt Baltiysk östlich von Danzig an.
In Baltiysk übernehmen Schiffe von BREB die Container und bringen sie nach Mukran auf Rügen. Dort werden sie auf die Bahn verladen und rollen ins deutsche Hinterland. Die Reederei setzt für diesen Pendelverkehr laufend zwei Schiffe ein, die “BREB Mukran” und die “BREB Balktiysk”. Die beiden Frachter nehmen inzwischen auch Container in Schweden für die Verladung in Richtung China auf. “Die Ladungsmengen über die Land-Seidenstraße wachsen kontinuierlich weiter an“, beobachtet BREB. “Zum jetzigem Zeitpunkt ist noch kein Ende abzusehen.”
Aus Sicht der Reederei BREB ist vor allem die höhere Geschwindigkeit der Zugverbindung entscheidend: “Transitzeit ist ein entscheidender Faktor geworden.” Die Hochseestrecken seien weiter mit Unsicherheiten belastet, “während die Transitzeit auf der Land-Seidenstraße mit plus/minus ein bis zwei Tagen gleich bleibt.”
Derzeit sind die Angebote auf der Schiene in Einzelfällen sogar günstiger als mit dem Frachter. Der Landtransport wird langfristig jedoch teurer bleiben. Schiffe transportieren schlicht sehr, sehr viele Container auf einmal. “Zwar hat sich der Preisunterschied durch den extremen Anstieg der Frachtraten zur See verringert”, sagt Lars Jensen, CEO der Beratungsfirma Vespucci Maritime in Dänemark und einer der führenden Experten für Container-Logistik, dem China.Table. Doch mit der Nachfrage gehen nun auch die Frachtraten auf der Schiene hoch. “Wenn sich die Staus an den Häfen auflösen, wird eine Normalisierung eintreten.”
Görg bestätigt die Einschätzung, dass der Vorteil für die Schiene nach dem Ende der Pandemie wieder schwindet. “Man sollte den Grund für die derzeitigen Kapazitätsprobleme der Seefahrt nicht vergessen”, sagt Görg. Schließungen von Container-Terminals infolge von Corona-Ausbrüchen können zudem auch dem Schienenverkehr passieren. “Dort vielleicht noch häufiger, da viele Grenzen überschritten werden müssen.”
So hatte sich das Brüssel wahrscheinlich nicht vorgestellt. Kurz vor der Präsentation der lange angekündigten Indo-Pazifik-Strategie der Europäischen Union überraschen Australien, die USA und Großbritannien die Europäer mit einem eigenen Sicherheitspakt, der ebenfalls für die pazifische Region gilt. Die Teilnahme Australiens ist dabei besonders schmerzhaft. Schließlich sollte der ozeanische Kontinent ein wichtiger Partner des Vorhabens der EU sein – und wäre sogar der flächenmäßig größte davon gewesen.
Statt also gemeinsam auf die zunehmenden Machtdemonstrationen Chinas zu reagieren, laufen plötzlich konkurrierende Initiativen. Die Motivation Australiens war vermutlich ein Lockangebot der USA: Es lässt sich beim Bau atombetriebener U-Boote helfen. Das wiederum kam in Europa besonders schlecht an. Rüstungs-Schwergewicht Frankreich, dem deshalb nun ein U-Boot-Deal in Milliarden-Höhe mit Canberra aufgekündigt wurde, fühlt sich vor den Kopf gestoßen.
Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian zeigte sich dementsprechend brüskiert: “Das ist ein Vertrauensbruch, und ich bin extrem zornig.” Er hielt US-Präsident Biden vor, sich wie dessen Vorgänger Donald Trump verhalten zu haben. “Diese brutale, einseitige und unberechenbare Entscheidung erinnert mich in vielem an das, was Herr Trump getan hat”, sagte Le Drian dem Radiosender Franceinfo.
Auch in Richtung Brüssel gab es vorab keine Ankündigung über die Dreierallianz “Aukus” zwischen den USA, Großbritannien und Australien. Die EU, die mit ihrer neuen Strategie mehr Gewicht als geopolitischer Akteur im Indo-Pazifik beweisen wollte, wurde schlichtweg außen vorgelassen. “Wir wurden nicht konsultiert”, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag bei der Vorstellung des Papiers.
Borrell geht davon aus, dass ein Abkommen in dieser Größenordnung nicht erst über Nacht ausgearbeitet wurde. Der EU-Chefdiplomat kann der Sache jedoch einen positiven Spin abgewinnen: Aukus zeige die Wichtigkeit der Region und damit auch für die Strategie der EU für den Indo-Pazifik-Raum.
EU-Ratspräsident Charles Michel betonte ebenfalls, eine eigene Strategie des Blocks für die Region sei “mehr denn je notwendig”, das unterstreiche der anglofone Aukus-Pakt. Die Strategie werde auch beim Europäischen Rat im Oktober besprochen, kündigte Michel an.
Die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) hatten nach einem ersten Plan im April sieben Bereiche festgelegt, in welchen die EU ihren Einfluss im Indo-Pazifik erhöhen möchte:
Die EU will alles dafür tun, um die Schifffahrtsverbindung durch das Südchinesische Meer militärisch zu sichern. Dazu will die EU laut Strategie-Papier nun eine höhere Marinepräsenz mit Kriegsschiffen zeigen und “mehr gemeinsame Militärübungen” mit ihren Partnern durchführen. Auch zunehmende Hafenanläufe in der Region sind geplant, “um Piraterie zu bekämpfen und die Freiheit der Schifffahrt zu schützen”.
Die Europäer sind bereits mit zwei Einsätzen im Bereich des Indischen Ozeans unterwegs: Mit der Anti-Piraterie-Mission Atalanta vor der somalischen Küste und mit einer Ausbildungsmission in Mosambik. An Atalanta beteiligen sich asiatische Partnerländer wie Japan, Pakistan und Indien.
Was Peking zudem missfallen wird: Taiwan wird als indopazifischer Partner genannt, mit welchem Handels- und Investitionsabkommen angestrebt werden sollen. Die Forderung ist bisher vor allem aus dem Europaparlament gekommen – praktisch hat die EU-Kommission dafür aber noch keine Hebel in Bewegung gesetzt. Das EU-Parlament wiederholte in einer am Donnerstag angenommenen Entschließung zur Neuausrichtung der China-Politik dieses Anliegen. Das erhöht nun auch den Druck auf die EU-Kommission, konkrete Schritte zu unternehmen. Für ein verstärktes Engagement im Indo-Pazifik sprachen sich auch die EU-Abgeordneten in der Resolution aus (China.Table berichtete).
Die Strategie umfasst außerdem den Abschluss der Handelsverhandlungen mit Australien, Indonesien und Neuseeland sowie eine Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Indien. Zudem soll es zum Beispiel grüne Allianzen und Partnerschaften zur Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltzerstörung geben.
Mit Japan, Südkorea und Singapur soll pilotmässig digitale Kooperationen basierend auf vorhandenen Abkommen aufgebaut werden. In diesem Rahmen sollen dann beispielsweise Standards für den Einsatz von künstlicher Intelligenz “im Einklang mit demokratischen Grundsätzen und Grundrechten” entwickelt werden. Weitere der Partnerschaften mit Staaten in der Region könnten folgen, heißt es weiter in dem Strategie-Papier.
Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, dass die Strategie nicht als Konfrontation mit China verstanden werden sollte. Es gehe um Kooperation mit gleichgesinnten Staaten, wiederholte der Spanier.
Der angelsächsisch geprägte Dreier-Sicherheitspakt Aukus kam am Donnerstag dann als regelrechter Schock für die Europäer. Canberra werde beim Bau von zunächst acht atombetriebenen U-Booten unterstützt, gab der australische Premierminister Scott Morrison bei einer Videokonferenz mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Boris Johnson bekannt. “Wir haben die Absicht, diese U-Boote in Adelaide in Australien in enger Kooperation mit den USA und Großbritannien zu bauen”, kündigte Morrison an. Die U-Boote sollen zwar atomar betrieben sein, aber keine Atomwaffen transportieren. Nach Angaben Morrisons soll in den kommenden 18 Monaten geprüft werden, wie das Vorhaben umgesetzt werden kann.
Die drei Staats- und Regierungschefs erwähnten China bei der Ankündigung ihres Deals ebenfalls nicht explizit. Sie verwiesen jedoch auf regionale Sicherheitsbedenken. “Bei dieser Initiative geht es darum, sicherzustellen, dass jeder von uns über moderne Ressourcen verfügt – die modernsten Ressourcen, die wir brauchen – um auf die sich schnell entwickelnden Bedrohungen zu reagieren und uns zu verteidigen”, sagte US-Präsident Biden. Morrison sagte, das neue Dreierbündnis solle helfen, die “Herausforderungen” in der “zunehmend komplexen” indo-pazifischen Region anzugehen. Australien werde von den USA auch neue Marschflugkörper vom Typ Tomahawk erhalten.
Wenige Stunden nach der Bekanntgabe kündigte Canberra den rund 40 Milliarden Dollar umfassenden Auftrag zum Bau einer neuen U-Boot-Flotte mit dem französischen Reedereikonzern Naval Group auf. Er galt als einer der lukrativsten Verteidigungsdeals weltweit. EU-Chefdiplomat Borrell erklärte, er könne die Enttäuschung der Franzosen verstehen – das Vertrauen in die USA oder Australien dürfen deshalb aber nicht generell infrage gestellt werden.
Chinas Botschaft in Washington verurteilte das Abkommen der drei Staaten. Diese sollten “keinen ausgrenzenden Block bilden, der auf die Interessen Dritter abzielt oder ihnen schadet”, sagte Botschaftssprecher Liu Pengyu der Nachrichtenagentur Reuters. “Insbesondere sollten sie ihre Mentalität des Kalten Krieges und ideologische Vorurteile ablegen.” Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte, Aukus untergrabe “den regionalen Frieden und die Stabilität ernsthaft und fördere das Wettrüsten”.
Analysten und Analystinnen in Brüssel sahen in dem Dreier-Vorstoß dagegen nicht generell eine Untergrabung der EU-Strategie: “Es geht um mehr als einen Deal über U-Boote. Die eigentliche Frage ist, ob ein US-geführter Pushback im Bereich der Sicherheit gegen China im Indo-Pazifik-Raum im strategischen Interesse Europas ist – oder nicht”, sagte die Direktorin des Asia-Programms am Thinktank ECFR, Janka Oertel. Falls ja, könnte Aukus ein wertvoller Bestandteil der EU-Strategie sein und durch Europas Indo-Pazifik-Vorstoß ergänzt werden, so Oertel. “Wenn nicht, dann wird Europa eigene Antworten finden müssen, um regionale Partner glaubwürdig zu unterstützen – und zwar schnell.” Die Europäer seien bisher nicht sehr konsequent darin gewesen, mehr als nur rhetorische Solidarität mit Ländern zu zeigen, die von Peking unter Druck gesetzt würden.
Es gibt jedoch auch andere Meinungen: Dass Australien sich den USA und Großbritannien zugewandt habe, sei ein “Realitätscheck der geopolitischen Ambitionen der EU”, sagte ein EU-Diplomat gegenüber Politico. Die EU und ihre Mitgliedsländer schienen offenbar keine “glaubwürdigen Sicherheitspartner” für die USA und Australien zu sein. “Wir sollten nicht zu viel von der Indo-Pazifik-Strategie halten: Die EU ist kein Akteur im Pazifik-Raum.”
Japans Außenministerium begrüßte indes in einer Mitteilung die Vorstellung der EU-Strategie. Diese stimme mit Japans Ansichten und Bemühungen für einen “freien und offenen Indopazifik” überein, so der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi. Das Land führt seit Mittwoch seine umfassendste Militärübung seit 30 Jahren durch. Die Logistik-Übung mit rund 100.000 Soldaten, 20.000 Bodenfahrzeuge und 120 Flugzeugen soll auch ein Zeichen an China senden.
Das Auswärtige Amt hatte seine Bilanz zu einem Jahr Indo-Pazifik-Leitlinien bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht und die EU-Strategie gelobt. Als Erfolg führte das Ministerium unter anderem den Einsatz der Fregatte “Bayern” an. Dieser war am Mittwoch von chinesischer Seite offiziell das Einlaufen in Shanghai untersagt worden. Das Schiff bekam deshalb nun eine neue Route und einen neuen Stopp: Die Bayern wird zum Tanken anhalten – in Darwin. Damit bekommt die Fregatte nach Perth einen zweiten Anlaufpunkt in Australien.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich mit einem eindringlichen Appell an China und die USA gewandt und sie aufgefordert, ihre “völlig dysfunktionalen Beziehungen” zu reparieren, bevor sich ihre Probleme auf den Rest der Welt übertragen. “Wir müssen unter allen Umständen einen Kalten Krieg verhindern, der anders wäre als in der Vergangenheit, sehr wahrscheinlich gefährlicher und viel schwieriger zu handhaben”, warnte der UN-Generalsekretär.
Guterres forderte kurz vor dem nächsten UN-Gipfel die beiden führenden Wirtschaftsmächte auf, beim Klima zusammenzuarbeiten und in den Bereichen Handel und Technologie intensiver zu verhandeln – ungeachtet ihre Streitigkeiten bei Menschenrechten, Wirtschaftspolitik, Online-Sicherheit oder Souveränität im Südchinesischen Meer. “Bedauerlicherweise haben wir bei allem nur Konfrontation”, sagte Guterres gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press am Wochenende.
“Wir benötigen wieder funktionierende Beziehungen zwischen den beiden Mächten, um die Probleme Impfung, Klimawandel und andere globale Herausforderungen bewältigen zu können”, appellierte der UN-Generalsekretär. “All das kann nicht gelöst werden ohne konstruktive Beziehungen in der internationalen Gemeinschaft und vor allem zwischen den Supermächten.” rad
Peking hat Antrag auf Beitritt zu einem Wirtschaftsbund gestellt, der ursprünglich ökonomischen Druck auf China ausüben sollte. Das Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ist Nachfolger eines Freihandelsprojekts, aus dem US-Präsident Barack Obama gerade China gezielt heraushalten wollte. Unter Donald Trump haben sich jedoch umgekehrt die USA daraus zurückgezogen. Jetzt drängt wiederum China hinein, während Amerika kein Mitglied ist.
Der chinesische Handelsminister Wang Wentao hat den Antrag laut Reuters schriftlich an den neuseeländischen Handelsminister Damien O’Connor übermittelt. Die Hürden für die Aufnahme sind beim CPTPP höher als beim Regional Comprehensive Economic Partnership-Abkommen (RCEP), einer weiteren Wirtschaftspartnerschaft, die seit 2020 zwischen den zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten und fünf weiteren Staaten in der Region gilt. China ist hier ebenfalls beteiligt.
Das CPTPP ist seit Dezember 2018 in Kraft und verbindet insgesamt elf Pazifik-Anrainerstaaten. Darunter befinden sich neben Australien, Japan und Kanada auch mittel- und südamerikanische Länder wie Mexiko und Peru. Großbritannien ist an einem Beitritt interessiert, um die Folgen des Brexits abzumildern. Gemeinsam kommen die Mitglieder auf 13 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Mit China im CPTPP-Abkommen würde sich dieser Wert auf fast 28 Prozent erhöhen. niw
Die kongolesische Provinz Süd-Kivu hat sechs chinesische Unternehmen wegen illegalem Bergbau und Umweltzerstörung die Betriebserlaubnis entzogen. Chinesische Behörden haben prompt reagiert und die Unternehmen angewiesen, das Land zu verlassen. China kündigte sogar eine Bestrafung der Verantwortlichen an, berichtet die South China Morning Post (SCMP). “Wir werden chinesischen Firmen in Afrika niemals erlauben, lokale Gesetze und Regulierungen zu brechen”, schrieb Wu Peng, Generaldirektor der Abteilung für afrikanische Angelegenheiten im chinesischen Außenministerium, auf Twitter. Beobachter äußerten sich überrascht ob dieser deutlichen Worte.
Der Präsident der Demokratische Republik Kongo, Felix Tshisekedi, hat kürzlich angekündigt, die von seinem Vorgänger unterzeichneten Bergbauverträge des Landes mit chinesischen Unternehmen zu überprüfen, da sie die chinesische Seite begünstigen könnten. Dazu zählt ein Abkommen, das den Bau von Infrastruktur durch chinesische Vertragspartner als Bezahlung für Kobalt und Kupfer aus der DR Kongo vorsieht. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf sechs Milliarden US-Dollar, berichtet die SCMP. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe die Überprüfung zur Bedingung für einen Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar gemacht. nib
Die EU-Kommission hat ein Schlupfloch zur Umgehung von Anti-Dumping-Zöllen auf Aluminium-Haushaltsfolien aus China geschlossen. Die Strafzölle auf Alu-Folien für den Haushaltsgebrauch seien auf Importe aus Thailand ausgeweitet worden, teilte die Generaldirektionen für Handel der EU-Kommission mit. Untersuchungen hätten ergeben, dass chinesische Hersteller von Aluminiumfolien ihre Ware nach Thailand brachten, wo sie vor der Wiederausfuhr in die EU “geringfügigen Montagevorgängen” unterzogen wurden und somit nicht mehr unter die Anti-Dumping-Zölle fielen. Zuvor sei den EU-Aufsehern ein Anstieg der Einfuhren von Alu-Haushaltsfolien aus Thailand aufgefallen.
An anderer Stelle scheint die EU-Kommission Anti-Dumping-Zölle nun jedoch zu verzögern: Die Europäische Union werde im Oktober Abgaben auf chinesische Aluminium-Flachwalzprodukte erheben – nur um sie dann sofort für neun Monate auszusetzen, berichtet Reuters unter Berufung auf eine Veröffentlichung des Handelsverbands European Aluminium. Zum Hintergrund: Im April waren vorläufige Anti-Dumping-Zölle auf Aluminiumprodukte wie Bleche, -platten und -folien festgelegt worden (China.Table berichtete). Sie betragen zwischen 19,3 und 46,7 Prozent. Endgültige Anti-Dumping-Zölle sollten eigentlich ab 11. Oktober erhoben werden, dann läuft die Frist für die Festsetzung ab. Die endgültigen Zölle sollen für fünf Jahre gelten und wahrscheinlich zwischen 14 und 25 Prozent betragen.
Nach Beschwerden von zwei Verarbeitern und einem Importeur sollen die Zölle nun aber vorerst ausgesetzt werden, kritisierte European Aluminium. Die Aussetzung sei grundsätzlich ungerechtfertigt ist und widerspreche den Handels- und Klimaambitionen der Kommission, sagte der Generaldirektor des Verbands, Gerd Götz. Die EU-Kommission bestätigte gegenüber Reuters den Eingang des Antrags auf Aussetzung und erklärte, dieser müssen gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten besprochen werden. Eine endgültige Entscheidung war demnach noch nicht gefallen. ari
China und Russland wollen nach eigenen Angaben nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gemeinsam für Stabilität in der Region sorgen. Bei einer Videokonferenz kündigten Chinas Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin an, künftig Geheimdienstinformationen auszutauschen und regelmäßige Gespräche über Afghanistan zu führen. Das Gespräch fand im Rahmen der China-geführten Shanghai Cooperation Organization (SCO) statt (China.Table berichtete), Putin war dem Gipfeltreffen in Tadschikistan per Video zugeschaltet. Xi Jinping sagt, die SCO-Mitgliedsstaaten sollten zu einem reibungslosen Übergang in Afghanistan beitragen und Afghanistan anleiten, eine “integrative politische Struktur” zu entwickeln, wie Staatsmedien berichteten. Außerdem rief Xi die Führung in Kabul zu einer gemäßigten Innen- und Außenpolitik auf.
“Ich hoffe, dass diese Vorschläge zu dem Ziel beitragen, gemeinsam Sicherheit in unserer Region zu erreichen”, sagte Xi demnach. Putin wiederholte Xis Aufruf an die regionalen Hauptstädte, ihre Zusammenarbeit zu verstärken und das regionale Geheimdienstnetzwerk der SCO zum Austausch von Informationen über terroristische Organisationen zu nutzen. Er schlug vor, das SCO-Mandat auch auf die Kontrolle von Waffen und organisierter Kriminalität auszuweiten.
Xi forderte “relevante Parteien” in Afghanistan auf, “terroristische Organisationen auf afghanischem Gebiet auszurotten”, und versprach, der vom Krieg zerrütteten Nation mehr Hilfe zu leisten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der chinesische Präsident kritisierte indirekt die USA: “Bestimmte Länder” sollten ihre Verantwortung für die zukünftige Entwicklung Afghanistans als “Anstifter der schwierigen Situation” übernehmen.
Die SCO besteht aus China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan. Die Organisation hat zudem mit der Aufnahme des Iran begonnen, auch Ägypten, Katar und Saudi-Arabien sind als Gesprächspartner im Zuge der Expansion hinzugekommen. ari
Der strauchelnde Immobilienentwickler Evergrande hat am Samstag angefangen, Investoren mit verbilligten Immobilien zu entschädigen, wie Bloomberg berichtet. Das Unternehmen teilte über WeChat mit, Anleger, die an der Rückzahlung von Vermögensverwaltungsprodukten gegen Sachwerte interessiert sind, sollten sich an ihre Anlageberater oder lokale Evergrande-Niederlassungen wenden, so Reuters. Den Berichten zufolge hätten über 70.000 Anleger, darunter viele Angestellte des Unternehmens, die Vermögensprodukte gekauft. Umgerechnet circa 5,2 Milliarden Euro dieser Produkte seien nun fällig, schreibt das Wirtschaftsportal Caixin. Investoren könnten zwischen verbilligten Wohnungen, Büro- und Einzelhandelsflächen oder Parkhäusern wählen, so Reuters.
Kommenden Donnerstag muss Evergrande Zinsen in Höhe von umgerechnet 100 Millionen Euro für zwei Anleihen bezahlen. Der Termin gilt als wichtiges Zeichen dafür, ob der Konzern über genug Liquidität verfügt, um den Verpflichtungen nachzukommen, wie Bloomberg berichtet. Bei den Zahlungen gegenüber Banken und Lieferanten war der Konzern schon in Rückstand geraten (China.Table berichtete). Das Unternehmen hat ein Schuldenberg in Höhe von umgerechnet über 250 Milliarden Euro angehäuft. nib
Am 10. Juni 2021 verabschiedete der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses das Sanktionsabwehrgesetz (auf Englisch “Anti-Foreign Sanctions Law”). Die politischen Entscheidungsträger hatten das Gesetz hastig im Zusammenhang mit Sanktionen verabschiedet. Die USA, die EU, Großbritannien, Kanada sowie weitere Staaten hatten die Strafmaßnahmen gegen mehrere chinesische Beamte und Organisationen wegen Vorwürfen der Menschenrechtsverletzung in der Region Xinjiang und anderswo verhängt.
Das Gesetz gibt der chinesischen Regierung ein rechtliches Instrument, um auf ausländische Sanktionen mit eigenen Gegensanktionen zu reagieren (China.Table berichtete). Diese könnten Einzelpersonen und Unternehmen, die in China Geschäfte machen, sowie andere im Land tätige ausländische Akteure treffen. Die Umsetzung des Gesetzes stellt ein weiteres potenzielles Risiko für Unternehmen in China dar, da politische Spannungen ein unsichereres Geschäftsumfeld schaffen.
China hat das Gesetz nach mehr als drei Jahren immer weiter eskalierender politischer und wirtschaftlicher Streitigkeiten mit dem Ausland, darunter den USA und die EU, verabschiedet.
Im Juli 2018 hatten die USA unter der Führung des damaligen Präsidenten Donald Trump Zölle auf chinesische Produkte im Wert von rund 34 Milliarden US-Dollar erhoben und damit einen Handelsstreit eingeleitet, der noch immer nicht beigelegt ist.
Während dieser Zeit wurden auch Chinas führende Telekommunikationsunternehmen – Huawei und ZTE – von ausländischen Regierungen stark unter die Lupe genommen. Die USA sanktionierten ZTE, die Huawei-Managerin Meng Wanzhou wurde in Kanada festgenommen, zahlreiche Länder schränkten die Benutzung von Huawei-Produkten ein (China.Table berichtete). Dann folgten im März die Sanktionen gegen China vonseiten der USA, EU, Großbritanniens und Kanadas wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang.
Im Juni führten die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden weitere Beschränkungen ein: Unter anderem, indem sie US-Amerikanern verboten, in mehrere chinesische Unternehmen zu investieren, die im Militär-, Sicherheits- und Überwachungssektor tätig sind.
Als Reaktion auf die politischen und wirtschaftlichen Spannungen verabschiedete China das Sanktionsabwehrgesetz, um ein Instrument zur Abwehr ausländischer Strafmaßnahmen zu installieren. Obwohl die Volksrepublik auf einige der Entwicklungen bereits mit eigenen Gegensanktionen reagiert hatte, bietet das Gesetz einen stärkeren Rechtsrahmen für die Entwicklung und auch die Umsetzung zukünftiger Gegensanktionen.
Das Sanktionsabwehrgesetz beschreibt in groben Zügen, wann chinesische Behörden Gegensanktionen verhängen können, wer Anspruch auf Sanktionen hat und was die Strafmaßnahmen nach sich ziehen.
Laut Artikel 3 des Gesetzes können Einzelpersonen oder Organisationen, die an der Ergreifung oder Umsetzung von “diskriminierenden Maßnahmen gegen chinesische Staatsbürger” oder “Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten” beteiligt sind, auf eine schwarze Liste oder “Gegenliste” gesetzt werden. Das schließt auch Personen oder Organisationen ein, die indirekt an der Formulierung, Entscheidung oder Umsetzung solcher Sanktionsmaßnahmen beteiligt sind.
Artikel 5 des Sanktionsabwehrgesetzes besagt, dass auch die Ehepartner und unmittelbare Familienangehörige der Betroffenen auf die schwarze Liste gesetzt werden können. Organisationen, an denen die Personen beteiligt sind, und leitende Personen innerhalb solcher Organisationen können ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt werden. Es liegt im Ermessen der “relevanten Abteilungen des Staatsrates”, zu bestimmen, wer auf die schwarze Liste aufgenommen oder von ihr entfernt wird.
Personen und Organisationen auf der schwarzen Liste können gemäß Artikel 6 des Gesetzes Visa für die Volksrepublik oder die Einreise in das Land verweigert werden oder aus China abgeschoben werden. Darüber hinaus können sie von Finanztransaktionen mit chinesischen Institutionen ausgeschlossen oder an der Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen gehindert werden. Auch können ihre Vermögenswerte blockiert, beschlagnahmt oder eingefroren werden. Darüber hinaus können auf die schwarze Liste gesetzte Personen noch mit “anderen notwendigen Maßnahmen” sanktioniert werden.
Darüber hinaus besagt Artikel 12, dass Einzelpersonen und Organisationen keine diskriminierenden Maßnahmen eines anderen Landes gegen China durchführen oder bei deren Umsetzung helfen dürfen – diese können sonst von chinesischen Bürgern und Organisationen auf Schadensersatz verklagt werden.
Schließlich enthalten Artikel 13 und Artikel 15 des Anti-Sanktions-Gesetzes weit gefasste Maßnahmen, die besagen, dass Handlungen ausländischer Staaten, Organisationen und Einzelpersonen, die Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährden, anderen Gegenmaßnahmen unterliegen können, die aber nicht im Gesetz enthalten sind.
Vor der Verabschiedung des Sanktionsabwehrgesetzes hatte China bereits in den vergangenen Jahren Strafmaßnahmen ausgesprochen. Seit 2019 hat China gegen eine Reihe von Einzelpersonen und Organisationen Sanktionen verhängt, hauptsächlich in Bezug auf Hongkong, Taiwan und Xinjiang. Bisher hat China vor allem – aber nicht ausschließlich – Politiker, Forscher und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sanktioniert, obwohl auch einige Unternehmen der Rüstungsindustrie ins Visier genommen wurden.
Zu den Zielen der chinesischen Sanktionen gehörten unter anderem US-amerikanische Politiker wie Marco Rubio, Ted Cruz, Josh Hawley und Tom Cotton, der kanadische Politiker Michael Chong und EU-Politiker wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte des Europäischen Parlaments, europäische Wissenschaftler und Think-tanks und NGOs wie Human Rights Watch, Freedom House, die National Endowment for Democracy und Merics.
Bisher sind Unternehmen der Rüstungsindustrie die einzigen Privatunternehmen, die von China im Zusammenhang mit Waffenverkäufen an Taiwan sanktioniert wurden. Betroffen sind Lockheed Martin, Boeing Defense und Raytheon. China hatte außerdem als Reaktion auf politische Streitigkeiten Handelszölle auf eine Reihe ausländischer Produkte wie beispielsweise australischen Wein erhoben. Diese Handelszölle sind jedoch von Sanktionen getrennt.
Es ist unklar, ob das Gesetz China dazu veranlassen wird, seine Sanktionen zu verstärken, oder ob es lediglich bestehende Praktiken kodifiziert, also in einem Gesetzeswerk zusammenfasst.
Das Gesetz richtet sich nicht explizit gegen ausländische Unternehmen und Privatpersonen, die in China Geschäfte machen – sie sind bisher auch den chinesischen Sanktionen (aber nicht den Handelszöllen) weitgehend entgangen. Mit der Gesetzesnovelle könnten sie nun sanktioniert werden, und einige Firmen könnten sich in Situationen wiederfinden, die sie angreifbarer machen.
Beispielsweise verbietet der US-amerikanische Uyghur Forced Labour Prevention Act Unternehmen den Verkauf von Produkten in den USA, die mit Zwangsarbeit in Xinjiang hergestellt wurden. Sollte ein ausländisches Unternehmen, das in Xinjiang Waren produziert oder bezieht, auf diese Gesetzgebung reagieren, indem es die Produktion an einen anderen Ort verlagert, könnte die Firma im Falle eines politischen Streits mit der Volksrepublik mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Zielscheibe chinesischer Sanktionen werden.
Zunehmend eskalierende Sanktionen und Gegensanktionen sowie andere Beschränkungen aufgrund internationaler Meinungsverschiedenheiten werden es ausländischen Unternehmen erschweren, gleichzeitig Gesetze in China und auf ausländischen Märkten einzuhalten. Darüber hinaus ist das Anti-Sanktionsgesetz so vage und weit gefasst, dass seine Grenzen und praktische Anwendbarkeit schwer zu bestimmen sind.
Dementsprechend wird Unternehmen und anderen Organisationen, die in China tätig sind, empfohlen, eine Risk-Map zu erstellen, um ihre Gefährdung durch chinesische Sanktionen gemäß dem neuen Gesetz einzuschätzen. Das könnte beispielsweise die Identifizierung der Verbindungen in die politisch sensiblen Gebiete Hongkong, Taiwan, Xinjiang und Tibet beinhalten – sowohl im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit als auch auf die Netzwerke von Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Darüber hinaus tun Unternehmen gut daran, Notfallpläne zu entwickeln und Reaktionsszenarien zu modellieren, um sich auf potenzielle Sanktionen vorzubereiten.
Obwohl sich ausländische Unternehmen in China durchaus darauf vorbereiten sollten, wie sie auf das Anti-Sanktionsgesetz reagieren könnten, ändert die Gesetzesnovelle nicht grundlegend die Rechtslandschaft. Im Jahr 2020 hat China beispielsweise eine “Liste unzuverlässiger Entitäten” als potenzielles Vergeltungsinstrument im Handelskrieg zwischen den USA und China erstellt – die aber anscheinend nicht wirklich genutzt wurde.
Das Sanktionsabwehrgesetz als solches unterstreicht jedoch abermals, dass sich ausländische Unternehmen in China eine Strategie für ihr Risikomanagement zulegen sollten, um sich an ein zunehmend unsicheres Umfeld anzupassen.
Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

Schweden ist eigentlich nur ein Nebendarsteller auf der großen geopolitischen Bühne. Selten wird hierzulande über die Standpunkte des skandinavischen Staates gesprochen. Doch Schweden hat wie auch Deutschland handelspolitische Interessen. Das Verhältnis zur Volksrepublik China ist zudem immer komplexer geworden – etwa durch die Verhaftung des schwedischen Staatsbürgers und Buchhändlers Gui Minhai in Thailand vor sechs Jahren. “Politiker hier sprechen hinsichtlich der Beziehungen zu China gerne von Chancen und Herausforderungen”, sagt Björn Jerdén. Er ist Direktor des Swedish National China Centre und ein ausgewiesener China-Kenner.
Die schwedische Regierung spreche nicht über eine Eindämmung Chinas oder eine Abkopplung, sondern konzentriere sich auf die Möglichkeiten zur Wirtschaftskooperation, sagt Jerdén. Die China-Strategie des Landes von 2019 definierte diverse Aufgabenfelder für die Regierung, darunter Sicherheit, Handel, Klima, Innovation, Bildung sowie China als Akteur in der Entwicklungshilfe. Es ist eigentlich nie die Rede davon, China in die Schranken zu weisen. “Eine Sache hat sich in Schweden jedoch verändert: Dinge, die früher nur als Chancen gesehen wurden, werden nun auch als Herausforderungen betrachtet”, erklärt Jerdén. Ein Beispiel seien chinesische Investitionen in Schweden.
Eine ausgewogene Betrachtung der Vor- und Nachteile erfordert entsprechende Expertise, die Jerdén mit dem Centre liefern kann. Es hat erst im Januar die Arbeit aufgenommen, wird von der schwedischen Regierung finanziert und soll die Ministerien und Behörden mit Informationen versorgen. “Dafür braucht man Experten, die viel über China wissen und vielleicht Chinesisch sprechen, aber die zudem Expertise in einem bestimmten Bereich haben”, sagt er.
Aus seiner Sicht sei es für jedes EU-Land notwendig, so viel Wissen zu China zu sammeln wie nur möglich. Nur auf diese Weise ließe sich eine gemeinsame europäische Strategie entwickeln. “Doch es gibt keine Einheitslösung für die Wissensgenerierung. Die Situation ist in jedem Land anders, was die Regierung betrifft sowie das Zusammenspiel zwischen Regierung und Universitäten, Think-Tanks und Stiftungen”, meint Jerdén.
Jerdén selbst ist das Produkt der schwedischen Universitätsausbildung. Nach Bachelor und Master am Department of Global Political Studies der Universität in Malmö folgte der erfolgreiche Abschluss der Doktorarbeit in Stockholm. Während seiner Promotionszeit hielt er sich 2012 und 2013 als Gastwissenschaftler in Taiwan auf. Später nahm er am “China and the World Program” der Universitäten Harvard und Princeton teil. Vor seiner Ernennung zum Direktor des Swedish National China Centre arbeitete er am renommierten Institute of International Affairs in Stockholm.
In dieser Zeit erlebte Jerdén, wie das Interesse an der China-Politik in Schweden rapide zunahm. Das lag neben der allgemeinen globalpolitischen Entwicklung auch an Vorkommnissen wie der Inhaftierung des schwedischen Staatsbürgers und Publizisten Gui Minhai im Jahr 2015. “Das führte zu einer Periode der Anspannung in den Beziehungen. Ab 2018 nahm das chinesische Außenministerium über die Botschaft in Stockholm verstärkt am politischen Diskurs in Schweden teil”, erklärt Jerdén.
Damit rückte die schwedische China-Politik auch außerhalb handelsrelevanter Themen auf der Agenda nach oben. “Die Probleme führten zu der Einsicht, langfristig mehr Wissen zu China generieren zu müssen, um die Beziehungen auf gute Weise zu managen. Das China Center ist ein konkretes Resultat dieser Anstrengungen.” Constantin Eckner
