eine Frage haben die Spitzenkandidaten trotz ihrer vielen Wahlkampfauftritte nicht beantwortet: Braucht Deutschland mehr Industriepolitik, mit China mithalten zu können? Elektrofahrzeuge seien zu teuer, hieß es stattdessen in einem der Trielle um die Kanzlerschaft. Eine Krankenschwester könne sich kein Elektrofahrzeug leisten, deswegen sei ein Verbrenner-Verbot unsozial.
Dabei beweist China längst das Gegenteil: Dort sind die Durchschnittspreise für E-Autos in den vergangenen zehn Jahren um fast die Hälfte gefallen – während sie in Europa und den USA gestiegen sind. Paradoxerweise haben Milliarden-Subventionen zum Preisverfall beigetragen. Denn sie haben einen Massenmarkt geschaffen, in dem über hohe Stückzahlen dann auch niedrigere Kosten möglichen waren. Diese Form der Industriepolitik könnte sich auszahlen, analysiert China.Table-Korrespondent Frank Sieren.
“Wir schützen unsere Technologie noch immer zu stiefmütterlich”, beklagt sich auch der Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds, Ludwig Veltmann, im Interview mit China.Table. Der Mittelstand dürfe technisches Know-how nicht leichtfertig an die Konkurrenz aus der Volksrepublik verkaufen. Im Globalisierungswettstreit plädiert Veltmann für ein geeint auftretendes Europa und weltweit festgelegte Umwelt- und Sozialstandards. Das Lieferkettengesetz sieht er jedoch kritisch.
Ein anderes internationales Problem ist der derzeitige Containerstau in den Häfen. Nicht zuletzt in der Autobranche fehlen Material und Zulieferteile, Produktionsstätten stehen still. Wie gut, dass Chinas Staatsmedien die vermeintliche Lösung verkünden: die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen der Volksrepublik und Europa. Finn Mayer-Kuckuk hat sich das Potenzial der Land-Seidenstraße genauer angeschaut und kommt zu dem Schluss: Auch wenn die Landstrecken zuletzt an Bedeutung gewonnen haben, den Frachtverkehr zu See werden sie nicht ersetzen können.
Viele Erkenntnisse beim Lesen wünscht

Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) legte Anfang September die Höhe der Subventionen offen, die die Autohersteller während der vergangenen fünf Jahre erhalten haben. Demnach gab Peking umgerechnet insgesamt 4,3 Milliarden Euro aus, um die Produktion von E-Autos anzukurbeln (China.Table berichtete). Dazu zählen rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie Hybridfahrzeuge. Während die Zahlungen pro Fahrzeug um vier Fünftel sanken, zahlte die Regierung 2020 aufgrund des Verkaufsbooms bei E-Autos mit umgerechnet fast 1,4 Milliarden Euro mehr als das Zehnfache an Subventionen als noch 2016, berichtet die Wirtschaftszeitung Caixin. Laut Analysten könnte der jährliche Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen in China bis 2025 auf 8,3 Millionen Stück steigen.
Peking war aus mehreren Gründen daran interessiert, Chinas E-Automarkt unter die Arme zu greifen. Dazu zählen die Verbesserung der Luftqualität in den Ballungsräumen sowie die Technologieführerschaft in einer sich neu entwickelnden Branche. Im Jahr 2017 beschloss Peking dennoch, die Fördergelder nach und nach zu streichen, um sie 2020 dann ganz auslaufen zu lassen. Am Ende dieser Konsolidierungsphase sollte sich der Markt selbst tragen, so der Plan. Dass viele Start-ups dabei untergingen, nahm die Regierung in Kauf. Die Coronakrise machte der Regierung jedoch einen Strich durch die Rechnung.
Pekings aktuelles Ziel ist es, alle NEV-Anreize bis Ende 2023 auslaufen zu lassen, anstatt wie ursprünglich geplant im Jahr 2020. Das gaben die zuständigen Behörden im April vergangenen Jahres bekannt.
Die Subventionen haben sich ausgezahlt: Heute sind die Autos in China billiger und wettbewerbsfähiger als in Europa. Günstige E-Autos für die breite Masse gibt es in China schon ab 3.700 Euro (China.Table berichtete). In Europa startet die Preisliste erst bei 15.700 Euro. Hier haben sich die Hersteller auf Fahrzeuge im höheren Segment fokussiert. In den USA fallen sogar 24.800 Euro für ein Einsteigermodell an. In den westlichen Märkten ist zudem der Durchschnittspreis für E-Autos in den letzten Jahren um gut ein Drittel gestiegen. Dagegen haben sich in China die Anschaffungskosten seit 2011 im Durchschnitt auf 22.100 Euro fast halbiert.
Eins ist klar: Die Abschaffung der chinesischen Subventionen bringt keine Erleichterung für die deutsche Autoindustrie. Je weniger Subventionen die chinesische Konkurrenz erhält, desto mehr ist sie gezwungen, international zu expandieren. Gelingt es den europäischen Herstellern nicht, rechtzeitig günstigere Modelle auf den Markt zu bringen, könnten die chinesischen Hersteller mit ihren preiswerten und zunehmend attraktiven E-Autos schnell große Marktanteile an sich reißen. Schon jetzt unterhalten Firmen wie Geely oder SAIC eigene Showrooms und Niederlassungen in Deutschland. Viele Hersteller planen die Expansion nach Europa (China.Table berichtete).
Das bedeutet, dass die deutschen Hersteller auf dem Heimatmarkt trotz des Rückgangs der Subventionen in China weiterhin auf Förderung angewiesen bleiben. Deutschlands Steuerzahler subventionieren E-Autos mit bis zu 20.000 Euro pro Fahrzeug. Auf absehbare Zeit können Stromer preislich nicht mit Verbrennerfahrzeugen konkurrieren und bleiben auf Subventionen angewiesen, erklärt Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer. Vor allem durch die hohen Kosten für die Batteriefertigung seien E-Autos teurer. Günstigere Elektroautos anzubieten, werde noch dauern, so Schäfer. “Wir werden günstigere Angebote mit weiterem technischen Fortschritt machen können, aber erst nach einer gewissen Übergangsphase.”

Der Mangel an Container-Kapazitäten belastet weiterhin den Welthandel (China.Table berichtete). Grund sind vor allem Engpässe in den Häfen. Chinesische Staatsmedien propagieren in den vergangenen Monaten die vermeintliche Lösung in Gestalt der Land-Seidenstraße und schüren gezielt die Hoffnung, dass die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen China und Europa zur Entlastung der Seestrecken beitragen könnten. Diese Erzählung wird begleitet von Erfolgsnachrichten des Prestigeprojekts der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI).
Die Nachrichtenagentur Xinhua präsentiert beispielsweise sehr regelmäßig Bilderstrecken von Zügen, die sich auf den Weg an Orte wie Duisburg machen. Dazu kommen Berichte über beschleunigte Zollabfertigung an den Grenzen, die Inbetriebnahme neuer Verbindungen und eine um 80 Prozent gesteigerte Zugfrequenz.
Experten sind sich indes einig, dass die Landverbindung zwar stark an Bedeutung gewinnt, allerdings nur geringen praktischen Einfluss auf die aktuellen Probleme haben wird. “Eine kleine Entlastung kann der Schienenverkehr natürlich schon darstellen. Er ist aber nicht groß genug, um wirklich das Problem zu lösen”, sagt Holger Görg, Leiter des Forschungsbereichs Internationaler Handel und Investitionen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), dem China.Table.
Die Land-Seidenstraße habe das Schienennetz enorm vergrößert, aber der Schienenverkehr leide ebenfalls an Engpässen, so Görg. Dazu gehören beispielsweise:
Als Engpass viel entscheidender ist jedoch das grundsätzlich viel geringere Fassungsvermögen von Zügen im Vergleich zu Schiffen. Die Betreiber der Seidenstraßen-Routen zu Lande konnten zwar im vergangenen Jahr verkünden, erstmals innerhalb eines Monats mehr als 100.000 Standard-Container transportiert zu haben. Das ist jedoch nur so viel, wie auf fünf Containerschiffe passt. Diese sind zudem ständig zu Hunderten auf den Weltmeeren unterwegs. Auf einen Zug passen eben nur rund 40 Container. Auf ein Schiff bis zu 20.000.
Auch wenn auf der Schiene also doppelt so viele Container rollen wie ein Jahr zuvor, hält sich die Entlastung also kurzfristig gesehen in Grenzen. Der Zug bleibt weiterhin vor allem etwas für Warengruppen, die zu einem höheren Preis schneller ans Ziel sollen.
Dabei wäre eine Entlastung hochwillkommen. Die britische Zeitschrift “Economist” fragt schon: “Werden die fortgesetzten Störungen die Handelsmuster verschieben?” Die Containerreedereien leiden seit Beginn der Pandemie unter einem Desaster nach dem anderen. Chinas Behörden haben mehrfach den Betrieb großer Häfen gedrosselt, nachdem Arbeiter sich mit Covid-19 angesteckt hatten (China.Table berichtete). Zwischendurch blieb ein Schiff im Suezkanal stecken und löste einen Rückstau rund um den Planeten aus. Derzeit stören häufige Taifune den Betrieb – eine Folge des Klimawandels.
Die Logistiker hatten seit Frühjahr 2020 keine Gelegenheit, den Frachtschiffverkehr wieder in den Takt zu bringen. Jede kleine Unregelmäßigkeit hat Folgewirkungen, die das brüchige Gefüge wieder stören. Die Unregelmäßigkeiten tragen zum Mangel an Zulieferteilen und Waren aus Ostasien bei. Da Containerplatz knapp ist, steigen zudem die Preise. Der entsprechende Index ist derzeit dreimal höher als vor einem Jahr und fünfmal höher als vor der Pandemie. Der Containermangel ist ein echtes Problem für die Wirtschaft.
Doch auch wenn der Schienentransport in der aktuellen Krise wenig Erleichterung bringen wird, könnte er dem Schiff langfristig eben doch Konkurrenz machen. Die “Eurasische Eisenbahnallianz”, über die etwa die Hälfte des Güterzugverkehrs von China nach Europa rollt, will ihre Kapazitäten deutlich ausweiten. Bis 2025 soll das Volumen des Containertransports auf der Schiene zwischen Asien und Europa auf eine Million Standardcontainer steigen. Gerade der starke Anstieg des Frachtverkehrs infolge der Pandemie gilt der Allianz als starkes Zeichen dafür, dass sich weitere Investitionen lohnen.
Treiber des Trends ist natürlich Peking. “China investiert stark in die Schieneninfrastruktur”, sagt Ökonom Görg vom IfW. Offizielle chinesische Statistiken zeigen: Es gab zu Jahresbeginn rund 12.400 internationale Schienenverbindungen aus China – im Jahr 2015 waren es noch weniger als 1.000. “Und dieser positive Trend dürfte sich auch in absehbarer Zeit ähnlich fortsetzen”, meint Görg.
Deutsche Unternehmen mit Bezug zur Land-Seidenstraße freuen sich über den Trend und erwarten weiter starkes Wachstum. “Zurückblickend hat sich die Land-Seidenstraße großartig entwickelt”, sagt eine Sprecherin von BREB, einer Reederei aus Bremen (ehemals Eilemann & Bischoff). BREB nimmt in baltischen Häfen viele Seidenstraßen-Container in Empfang, die über die Landroute nach Europa gekommen sind. Seit diesem Frühjahr komme täglich ein kompletter Zug aus Xi’an in der russischen Hafenstadt Baltiysk östlich von Danzig an.
In Baltiysk übernehmen Schiffe von BREB die Container und bringen sie nach Mukran auf Rügen. Dort werden sie auf die Bahn verladen und rollen ins deutsche Hinterland. Die Reederei setzt für diesen Pendelverkehr laufend zwei Schiffe ein, die “BREB Mukran” und die “BREB Balktiysk”. Die beiden Frachter nehmen inzwischen auch Container in Schweden für die Verladung in Richtung China auf. “Die Ladungsmengen über die Land-Seidenstraße wachsen kontinuierlich weiter an“, beobachtet BREB. “Zum jetzigem Zeitpunkt ist noch kein Ende abzusehen.”
Aus Sicht der Reederei BREB ist vor allem die höhere Geschwindigkeit der Zugverbindung entscheidend: “Transitzeit ist ein entscheidender Faktor geworden.” Die Hochseestrecken seien weiter mit Unsicherheiten belastet, “während die Transitzeit auf der Land-Seidenstraße mit plus/minus ein bis zwei Tagen gleich bleibt.”
Derzeit sind die Angebote auf der Schiene in Einzelfällen sogar günstiger als mit dem Frachter. Der Landtransport wird langfristig jedoch teurer bleiben. Schiffe transportieren schlicht sehr, sehr viele Container auf einmal. “Zwar hat sich der Preisunterschied durch den extremen Anstieg der Frachtraten zur See verringert”, sagt Lars Jensen, CEO der Beratungsfirma Vespucci Maritime in Dänemark und einer der führenden Experten für Container-Logistik, dem China.Table. Doch mit der Nachfrage gehen nun auch die Frachtraten auf der Schiene hoch. “Wenn sich die Staus an den Häfen auflösen, wird eine Normalisierung eintreten.”
Görg bestätigt die Einschätzung, dass der Vorteil für die Schiene nach dem Ende der Pandemie wieder schwindet. “Man sollte den Grund für die derzeitigen Kapazitätsprobleme der Seefahrt nicht vergessen”, sagt Görg. Schließungen von Container-Terminals infolge von Corona-Ausbrüchen können zudem auch dem Schienenverkehr passieren. “Dort vielleicht noch häufiger, da viele Grenzen überschritten werden müssen.”
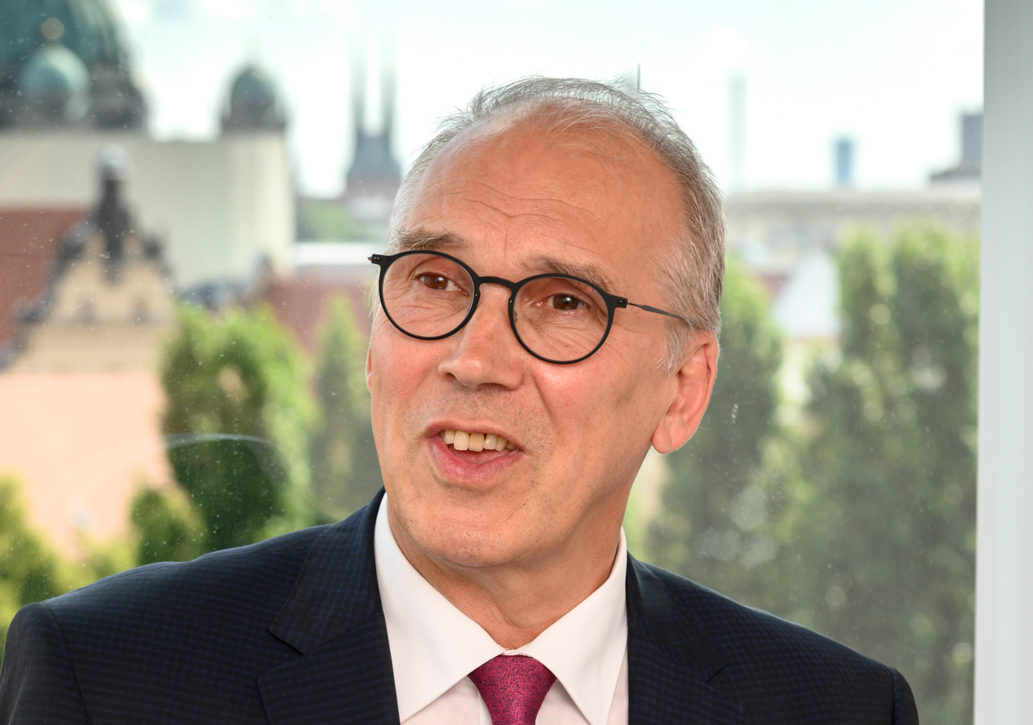
Herr Veltmann, was wäre dem deutschen Mittelstand lieber: Eine Welt unter US-amerikanischer oder chinesischer Technologieführerschaft?
Die Amerikaner sind uns lieber, solange sie keinen Präsidenten wie Trump haben. Sie sind uns kulturell deutlich näher und haben auch ein ähnliches Verständnis von Demokratie. China ist eine Autokratie. Und ein Land, das autoritär organisiert wird, ist uns grundsätzlich suspekt.
Welche Konsequenzen hätte eine chinesische Technologieführerschaft für Deutschland?
Da gibt es zwei Ebenen. Einerseits würde die Wertschöpfungstiefe hierzulande abnehmen. In manchen Technologiebranchen spielen deutsche Unternehmen heute schon keine Rolle mehr. China macht ja selbst vor Technologien nicht halt, in denen die deutsche Industrie bislang noch eine führende Rolle spielt. Wenn China Flugzeuge beispielsweise auf dem Weltmarkt verkauft, wo heute noch Airbus und Boeing den Ton angeben, wird deutlich sichtbar, wie Wertschöpfung nach China abwandert.
Und die zweite Ebene?
Das sind die politischen Implikationen. Es geht um die Frage, wie wir leben wollen. Wir sind hier sehr stolz auf unsere Demokratie und unsere Lebensweise, und sehen unsere Staatsform als die bessere auch im Hinblick auf Wachstums- und Entwicklungsperspektiven an. Nun aber kommt ein Land daher, das autokratisch geführt wird und uns mit seinem Staatskapitalismus zeigt, “was eine Harke ist”. Das könnte den einen oder anderen Technologiebegeisterten dazu bewegen, an unserer Demokratie zu zweifeln. Es könnten Stimmen aufkommen, die nach einem “starken Mann” im Land verlangen, der die mitunter lähmenden Prozeduren in demokratischen Gremien zum Anlass nimmt, Freiheitsrechte einzuschränken. Das besorgt mich.
Halten Sie es für ein reales Szenario, dass wir zur Diktatur werden, weil China wirtschaftlich erfolgreich ist?
In dem Maße, in dem unsere Unternehmen hier an der Bürokratie und langwierigen Prozesse verzweifeln, schaffen wir den Nährboden für solches Gedankengut. Ich höre immer mal wieder aus den Unternehmen, wie unkompliziert und schnell Projekte in China umgesetzt werden. Unsere Firmen dagegen befinden sich gefühlt immer in der Warteschleife für die Genehmigung hierfür oder dafür, und dabei fallen ständig satte Verwaltungsgebühren an, obwohl die Unternehmen reichlich Steuern zahlen. Diese Gesamtsituation produziert viel Frust.
Droht der deutsche Mittelstand zum Bittsteller Chinas zu werden?
Das sind wir doch teilweise jetzt schon. China schottet sich immer weiter ab und arbeitet auffällig in vielen Wirtschaftsbereichen an weitreichender Autarkie. Immer mehr deutsche Firmen, die bei potenziellen chinesischen Geschäftspartnern anklopfen, stoßen auf Probleme. Die Schikane, die Ausländer während der Coronazeit bei der Einreise ins Land erfahren, ist symptomatisch. Außerdem darf nicht mehr offen über systemkritische Vorgänge gesprochen werden. Wenn es um sensible Dinge geht, verbietet sich die chinesische Seite sofort jede Diskussion.
Wäre all das anders, wenn die US-Amerikaner das Rennen um die technologische Dominanz gewinnen?
Da gehe ich von aus. Mal abgesehen von der besseren Kompatibilität unseres politischen Systems mit dem der USA hat China eine klare Strategie formuliert. Nämlich, dass es gegen die Abhängigkeit von Zulieferungen aus dem Ausland arbeitet. Die Technologieführerschaft würde China dabei massiv helfen, sich selbst zu versorgen. Das Land wäre als Exportmarkt für deutsche Unternehmen deutlich weniger attraktiv.
Hat der Mittelstand keine Mittel, um eine drohende chinesische Technologie-Vorherrschaft zu verhindern?
Durch mehr Flexibilität können Erfindergeist und die Einsatzbereitschaft im Mittelstand noch vergrößert werden. Doch dazu muss die Politik den Rahmen schaffen. In den Sonntagsreden ist es immer ganz leicht, den Mittelstand als das Fundament der deutschen Wirtschaft zu preisen und seine Förderung anzukündigen. Am Montag wird es dann wieder schwieriger. Statt Flexibilität gibt es dann Bauauflagen, langwierige Genehmigungs- und Prüfprozesse und Restriktionen, die den Mittelstand behindern. Die auferlegte Ausweitung der Erfassung von Arbeitsstunden beispielsweise passt überhaupt nicht in die heutige Zeit und behindert Betriebe unnötig im Wettbewerb.
Ist es die Schuld der hiesigen Politik, dass China kein Level Playing Field zulässt, was einen enormen Vorteil für chinesische Unternehmen bedeutet?
Die Politik leistet nicht, was sie eigentlich leisten müsste. So könnte sie in der EU starke Allianzen schmieden. Als Europäer setzen wir ohne solche den Chinesen doch gar kein Gewicht entgegen. Wir haben nicht mal einen EU-Außenminister. Da kommt jedes Land der EU allein auf China zu – das spielt einem so großen Land natürlich in die Karten. Wir brauchen deshalb unbedingt ein stärkeres Europa.
Indem es nach dem Motto “Wie du mir, so ich dir” den Chinesen den Zugang zu Ausschreibungen verbietet?
Nein, das wird nicht ohne Weiteres gelingen, wenn wir “tit for tat” spielen. Es bedarf globaler Zusammenarbeit mit klaren Regeln durch die Welthandelsorganisation oder ähnliche Institutionen. Multilaterale Verständigungen sind im Umgang mit China der bessere Hebel als der Bilateralismus. Angesichts der Größe und Marktmacht Chinas ist es unverzichtbar, geschlossen aufzutreten, um seine Interessen gegenüber der chinesischen Regierung wirksam zu vertreten.
Sie kritisieren die Politik. Aber hätte sich der Mittelstand auch besser auf die Herausforderungen einstellen können, denen er aufgrund des Aufstiegs Chinas begegnet?
Mitte der 1980er-Jahren habe ich ein Forschungsprojekt über Kooperationen in Taiwan durchgeführt. Damals war es völlig abwegig, dass die Volksrepublik China ein maßgebliches Gewicht in der Welt bekommen würde. Im Übrigen ging ich nicht als Einziger davon aus, dass sich vielmehr Taiwan wegen seiner damaligen wirtschaftlich deutlichen Überlegenheit gegenüber der Volksrepublik im internationalen Wettbewerb besser behaupten würde. Einem kommunistischen Regime haben wir diesbezüglich dagegen nicht sehr viel zugetraut.
Die Volksrepublik China hat in den zurückliegenden Jahren aber das Gegenteil bewiesen – trotz autokratisch sozialistischer Staatsform. Längst ist das Land nicht mehr die Werkbank der Welt für Billigprodukte und Imitate westlicher Marken. Vielmehr strömten in gewaltiger Dosis Kapital und Know-how ins Land, womit die Gewichte verschoben wurden. Heute gibt es kaum eine Technologie, in der China nicht den Anspruch oder den Ehrgeiz hat, Weltspitze zu sein. Diese Absichten hätte der Mittelstand frühzeitig erkennen müssen und nicht leichtfertig technisches Spitzen-Know-how an China verkaufen dürfen.
Dafür ist es zu spät, aber schützen wir unsere Technologie wenigstens heute ausreichend?
Das tun wir immer noch zu stiefmütterlich. Ich will nicht dem Protektionismus das Wort reden. Aber wenn ein chinesisches Unternehmen ein deutsches erwirbt, um zu gucken, wie das alles so funktioniert, und dann aber das Geschäft in China für den chinesischen Markt weiterbetreibt, dann muss uns klar sein, dass wir am Ende nur allzu rasch in die Röhre gucken. Da müssen wir klüger werden.
Gibt es denn nach all den Jahren immer noch Unternehmen, die von den tiefgreifenden Veränderungen durch Chinas tragende Rolle nichts mitbekommen?
Die ehrgeizigen Ziele Chinas sind inzwischen fast jedem Unternehmen in irgendeiner Form präsent. Aber es gibt noch zu wenig strategische Pläne, dem zu begegnen, was ein paar Tausend Kilometer weiter weg geschieht.
Chinas kategorische Ablehnung jeglicher Verantwortung für die Corona-Pandemie, die Vertragsbrüche in Hongkong, die Tragödien aus Xinjiang: Hat im deutschen Mittelstand in jüngster Vergangenheit ein Prozess begonnen, darüber nachzudenken, ob es moralisch anständig ist, mit China Geschäfte zu machen?
Natürlich hat es das. Und es gibt viele Unternehmen, die daraus Konsequenzen ziehen. Es herrscht schließlich im Mittelstand grundsätzlich Zustimmung für eine Politik, die sagt: Wir achten auf Menschenrechte und Produktionsbedingungen in diesem Land. Aber es ist letztlich nicht realistisch, den Unternehmen abzuverlangen, eine Art Kontrollfunktion zu übernehmen und allein die Verantwortung dafür zu tragen, wo die internationale Politik keine Lösungen findet. Das einzelne mittelständische Unternehmen wird kaum die immer komplexeren Lieferketten nachverfolgen und für das Verhalten der Vorlieferanten oder das Handeln deren Regierungen alleinige Verantwortung übernehmen können.
Ist das menschlich oder müssen wir den Unternehmen mehr abverlangen?
Da stellt sich die Frage, wie weit man einen einzelnen Unternehmer verantwortlich machen kann. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz verlangt ja, dass die Lieferkette nur aus Akteuren mit weißen Westen besteht. Aber so arbeitsteilig, wie die Welt funktioniert, ist das doch gar nicht darstellbar. Wichtig wäre, dass Umwelt- und Sozialstandards durch die Weltgemeinschaft festgelegt werden. Darum sollte sich etwa die WTO kümmern. Dann könnten die Unternehmen viel effizienter ihre Arbeit tun und würden nicht durch kostspielige Bürokratiemonster ausgebremst.
Welche Werkzeuge bleiben dem Mittelstand jenseits politischer Forderungen?
Wenn wir es schaffen, Kreativität und Innovationen zu entfesseln und starke Marken zu schaffen oder fortzuentwickeln, dann haben wir weiterhin beste Chancen im internationalen Wettbewerb. Denn dann können wir uns als unverzichtbarer Akteur in den globalen Wertschöpfungsketten positionieren. Noch ist das Image deutscher Produkte noch sehr gut in China. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass auch das abnimmt. Der Dieselskandal hat das deutsche Auto auch in China unter Druck gesetzt, natürlich auch weil die chinesische Propaganda das für sich genutzt hat.
Vom Grad der Digitalisierung ganz zu schweigen.
Und auch da müssen wir uns fragen, weshalb wir den Zug zu verpassen drohen und ihn in vielen Bereichen leider schon verpasst haben. Digitalisierung benötigt großes Investment, aber dieses in Deutschland in der notwendigen Geschwindigkeit zu mobilisieren, ist oft schlicht nicht in gleichem Maße möglich wie etwa in den USA oder in China. Dabei kann der überfällige Transformationsprozess nur dann gelingen, wenn digitale Tools und vor allem digital gesammelte und aufbereitete Daten gezielt zum Einsatz kommen.
Für den Handel etwa ist es wichtig, die Kundenbedürfnisse genau zu kennen. Wem dies am besten gelingt, der ist im Wettbewerb ganz vorn. Wirtschaftlicher Erfolg erklärt sich heute zumeist datenbasiert. Noch hinken wir bei der Datenauswertung gewaltig hinterher. Wenn man die Vielfalt und den Nutzen der Dienstleistungen etwa auf der Handelsplattform Alibaba näher betrachtet, wird deutlich, wo die Reise im Wettbewerb hingeht.
Das klingt nach viel Arbeit in schwieriger Ausgangslage. Wie schätzen sie die Stimmung im Mittelstand ein?
Mittelständler sind Berufsoptimisten mit erheblicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das stärkt nicht nur ihre Unternehmen und schützt sie gerade in Krisenzeiten, sondern stabilisiert zugleich ganze Volkswirtschaften. Digitalisierung und die sich rapide verschärfende Debatte zum Thema Nachhaltigkeit lösen dramatische Veränderungen in den Märkten aus, denen das einzelne mittelständische Unternehmen immer weniger gewachsen ist. Der Kooperationsgedanke erfährt deshalb gerade wieder eine Renaissance, denn nur gebündelte Kräfte können die Nachteile zu kleiner Einheiten ausgleichen.
Der Mittelstandsverbund bringt hierzu seine Expertise für die Stärkung und Fortentwicklung der Unternehmen auf der Basis der genossenschaftlichen Idee konsequent bei den von ihm vertretenen 230.000 Unternehmen in 320 Unternehmensverbünden aus 45 Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbranchen ein. Hierbei gilt es, den politischen Entscheidungsträgern immer wieder den Wert der kooperativen Wirtschaftsform vor Augen zu führen und für deren Freiräume – etwa in der Kartell- und Wettbewerbspolitik – einzutreten. Als Unternehmer gut vernetzt zu sein, entfaltet sich nicht nur zunehmend als wirtschaftlicher Vorteil, es trägt auch zu einer besseren Stimmung bei.
Ludwig Veltmann, 62, lernte in den 1980er-Jahren Chinesisch und zog für Forschungsprojekte nach Taiwan und in die Volksrepublik. Seit 2001 verfolgt er als Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes den wachsenden Einfluss der Volksrepublik auf die deutsche Wirtschaft.
Der chinesische Internetkonzern Baidu weitet seine Ambitionen in der Elektromobilität aus. Das Unternehmen, das Chinas gleichnamige und größte Internet-Suchmaschine betreibt, hat die Serienproduktion eines vollelektrischen LKW angekündigt. 2023 soll der sogenannte “Roboter-LKW” Xingtu auf den Markt kommen. Das Fahrzeug wird zunächst mit dem Automatisierungsgrad Level 3 ausgestattet sein, der später auf Level 4 erhöht werden soll. Level 3 ermöglicht autonomes Fahren in Staus oder auf Autobahnen. Sein System führt Vorgänge wie Blinken, Spurwechsel oder Spurhalten selbständig durch, ohne dass der Fahrer das System ständig überwachen muss.
Baidu hat den Xingtu in einem Gemeinschaftsunternehmen namens DeepWay zusammen mit dem chinesischen Finanzdienstleister Lionbridge entwickelt. Attraktiv für Kunden soll ihn neben seiner fortgeschrittenen Selbstfahrtechnologie auch das Akkuwechsel-System machen, mit dem die Batterie des Fahrzeugs binnen weniger Minuten ausgetauscht und auf mögliche lange Ladezeiten verzichtet werden kann.
Baidu arbeitet schon seit 2013 an der Selbstfahrtechnologie Apollo, die vornehmlich in Elektroautos zum Einsatz kommen soll. Im März gründete das Unternehmen ein Joint Venture mit dem privaten Autobauer Geely, das sich auf die Entwicklung und Produktion von E-Autos spezialisiert und im kommenden Jahr sein erstes Modell auf den Markt bringen möchte (China.Table berichtete). grz
China hat in den letzten Jahren am meisten Patente für 6G-Technologien angemeldet. Das geht aus einer Untersuchung der japanischen Zeitung Nikkei und dem japanischen Forschungsunternehmen Cyber Creative Institute hervor. Die beiden Partner haben knapp 20.000 Patentanmeldungen in neun 6G-Technologiebereichen ausgewertet. Demnach haben Unternehmen und Forschungsinstitute aus China 40 Prozent der Patente in Bereichen wie Kommunikation, Quantentechnologie, Basisstationen und künstliche Intelligenz angemeldet. Die USA liegen mit 35 Prozent der Anmeldungen knapp dahinter. Europa und Japan konnten jeweils knapp unter zehn Prozent auf sich vereinen.
Huawei sowie die Staatsfirmen State Grid und China Aerospace Science and Technology gehören zu den größten Inhabern von 6G-Patenten, so Nikkei. Trotz der Tech-Sanktionen von US-Präsident Trump sei es China gelungen, seine Wettbewerbsfähigkeit im 6G-Bereich durch die Mobilisierung staatlicher Unternehmen und Universitäten zu erhalten.
Die 6G-Technologie ermögliche aufgrund ihrer Geschwindigkeit beispielsweise vollautonom fahrende Autos, Virtual-Reality Anwendungen in höchster Auflösung und Internetverbindungen selbst an abgelegensten Orten, so Nikkei. Die 6G-Technologie wird demzufolge ab 2030 kommerziell nutzbar sein. Staaten, die viele Patenten anmelden, werden die zukünftigen Industriestandards mitbestimmen. nib
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF und CATL, Batterie-Weltmarktführer, sind eine Partnerschaft bei der Entwicklung und Lieferung von Materialien für moderne Akkus eingegangen. Ziel ist auch der Klimaschutz: Die beiden Unternehmen haben einen Rahmenvertrag unterzeichnet, um ihre Ziele bei der Emissionsneutralität schneller zu erreichen. Bei der Zusammenarbeit geht es um die Lieferung von Materialien für die Kathode, also einem Teil im Inneren der Batterie, der je nach Stromfluss Elektronen aufnimmt oder abgibt. BASF als wichtiger Chemie-Zulieferer für die Autoindustrie besitzt auch eine starke Position im Markt für Kathodenmaterialien. Ein weiteres Gebiet der Kooperation ist das Recycling ausgedienter Batterien, das künftig stark an Bedeutung gewinnen wird (China.Table berichtete).
CATL wiederum baut derzeit in Erfurt ein Batteriewerk (China.Table berichtete). Das chinesische Unternehmen will für seine Kunden vor Ort eine lokale Lieferkette aufbauen. CATL befindet sich insgesamt auf Expansionskurs. In der Stadt Yichun investiert das Unternehmen derzeit 13,5 Milliarden Yuan (1,7 Milliarden Euro) in ein neues Werk. In China sind sogar 20 neue Fabriken geplant. Erfurt nimmt hier als einziger großer Auslandsstandort eine Sonderstellung ein. fin
Um die Einhaltung der neuen Vorschriften zum Umgang mit Daten in China und beim Datentransfer ins Ausland gewährleisten zu können, sollten sich die betroffenen Unternehmen rasch mit dem Datensicherheitsgesetz beschäftigen. Schließlich drohen bei Nichteinhaltung hohe Strafen für Unternehmen; deren Vertreter müssen unter Umständen mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.
Historisch gesehen krönt das DSL eine Handlungsreihe des chinesischen Gesetzgebers in den letzten Jahren. Mit dem Cyber Security Law (CSL) wurden 2017 zum ersten Mal in der Geschichte der Volksrepublik die Weichen für die Anforderungen bei der Behandlung von Daten für Betreiber von kritischer Informationsinfrastruktur (KII) gestellt. Seitdem spielt die nationale Internet-Informationsbehörde (“Cyberspace Administration of China”, kurz: “CAC”) eine zentrale Rolle bei der Konkretisierung von gesetzlichen Maßnahmen. Mit dem Verordnungsentwurf 2019 ist eine drastische Verschärfung und Ausweitung der Verpflichtung zur Sicherheitsbewertung zu verzeichnen.
Das neue DSL der chinesischen Gesetzgeber stellt ein systematisches “Upgrade” im Bereich Netzwerk- und Informationssicherheit sowie der Sicherheit von persönlichen Daten dar. Bemerkenswert ist vor allem der geographische Anwendungsbereich. So schreibt § 2 des neuen DSL vor, dass das Gesetz nicht nur für Datenverarbeitungstätigkeiten innerhalb Chinas, sondern auch für Datenverarbeitungstätigkeiten außerhalb Chinas gilt, wenn die nationale Sicherheit oder das öffentliche Interesse Chinas gefährdet sind.
Die starke Verlinkung mit dem CSL ist beim neuen DSL nicht zu übersehen. Demzufolge gelten weiterhin die Bestimmung der CSL für das Sicherheitsmanagement beim Export von Daten, die von den Betreibern kritischer Informationsinfrastrukturen innerhalb des chinesischen Territoriums gesammelt oder produziert werden. Als Neuerung ist ein einheitliches Verfahren in Bezug auf die Sicherheitsüberprüfung, das sogenannte Security Assessment, in § 24 DSL geschaffen worden. Allerdings sind Anwendungsbereich und verfahrenstechnische Details derzeit noch unklar. Ferner gilt der Zusammenhang zwischen der Datensicherheitsprüfung und der Cybersicherheitsprüfung auch noch zu klären.
Zu beachten sind die – durchaus drastischen – Strafen bei festgestellten Verstößen. Zu den rechtlichen Folgen gehören zivilrechtliche Haftungen, Verwaltungsstrafen (z.B. Geldbußen und Entzug der Geschäftslizenz) sowie strafrechtliche Haftungen.
Parallel zum DSL gilt ein weiteres neues Gesetz als zentrales Element im Bereich der Datensicherheit: Das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten, das am 1. November 2021 in Kraft treten wird. Datenverarbeiter von persönlichen Daten müssen unterschiedlichen Compliance-Verpflichtungen nachkommen. Ähnlich wie das DSL ist das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten auch extraterritorial anwendbar. Dieses Regelwerk ist in vielfacher Hinsicht mit der General Data Protection Regulation GDPR der Europäischen Union vergleichbar; allerdings deutlich strenger in Bezug auf den Schutz der öffentlichen Sicherheit.
Bemerkenswert ist auch die Gesetzgebung in einzelnen Industriebranchen: Die vorläufigen Regelungen für das Management der Datensicherheit in der Automobilindustrie werden am 1. Oktober 2021 in Kraft treten. Diese Regelungen betreffen sogenannte Automobil-Datenverarbeiter, also Automobilhersteller, Teile- und Softwarelieferanten, Händler, Reparaturbetriebe sowie Fahrdienstleister. Die Automobil-Datenverarbeiter müssen sich an die Bestimmungen dieser Regelungen halten, wenn sie persönliche Daten und wichtige Daten verarbeiten, die mit dem Design, der Herstellung, dem Verkauf, der Nutzung, dem Betrieb oder der Wartung von Fahrzeugen zusammenhängen. Automobil-Datenverarbeiter müssen den zuständigen Behörden jährlich über das “Management der Datensicherheit” berichten.
Es bleibt abzuwarten, wie die neuen Gesetze und Regelungen in der Praxis umgesetzt werden. Es ist jedoch abzusehen, dass zahlreiche Ergänzungen im Bereich des Datenschutzes eingeführt werden. Dieser Trend lässt sich bereits im Bereich der Cybersicherheit beobachten. Nach der Verabschiedung des Cybersicherheitsgesetzes wurden zahlreiche Regelungen und nationale Standards erlassen. Die zuständige Behörde CAC setzt das Gesetz aktiv durch.
Ein typisches Beispiel war die Einleitung der Cybersicherheitsprüfung beim chinesischen Fahrdienstvermittler Didi Anfang Juli 2021 (China.Table berichtete). Kurz nach dessen Börsengang in New York veröffentlichte die CAC einen Entwurf zur Überarbeitung der Regelung zur Cybersicherheitsprüfung. Demnach unterliegt nun auch ein ausländischer Börsengang der Cybersicherheitsprüfung, wenn das Unternehmen Daten von mehr als einer Million Nutzern speichert. Ausländische Börsengänge chinesischer Unternehmen könnten somit in Zukunft sicherlich erschwert werden.
Die Verschärfungen der Datenschutzgesetzgebung in China wird für Unternehmen mit China-Bezug eine Herausforderung für ihre Compliance-Regelungen darstellen. Aufgrund höherer gesetzlicher Anforderungen sind börsennotierte Unternehmen in China – einschließlich deren ausländischer Tochtergesellschaften – stark betroffen. Um Compliance-Risiken zu reduzieren, müssen deutsche Unternehmen, die mit Tochtergesellschaften in China vertreten sind, ebenfalls umfassend vorbereitet sein. Im Falle eines Verstoßes drohen nicht nur Strafen wie Geldbuße, sondern auch Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeiten. Insbesondere ist darauf zu achten, ob das Unternehmen oder dessen Geschäftspartner als “Betreiber kritischer Informationsinfrastrukturen” eingestuft wird und ob das Unternehmen “wichtige Daten” verarbeitet. Interne betriebliche Regeln sollten entsprechend zügig den neuen Bestimmungen zum Datenschutz angepasst werden.
Quo vadis: Mit DSL ist in China der gesetzliche Anker im Bereich Datenschutz gesetzt worden. Sicher werden in den kommenden Jahren weitere Konkretisierung der Durchführungsmaßnahmen folgen. Sicher ist auch das Ziel des Gesetzgebers: maximale Sicherheit für Daten mit China-Bezug. Nicht sicher ist hingegen, wie weit die Verschärfungen noch gehen werden. Wirtschaft und Unternehmen stehen diesbezüglich sicherlich noch vor weiteren Herausforderungen bei ihren Aktivitäten in China.
Jiawei Wang LL.M. ist Legal Counsel bei Rödl & Partner in Stuttgart und dort für den Bereich China Desk verantwortlich. Er hat Rechtswissenschaften in Shanghai und Heidelberg studiert und ist in der Volksrepublik China als Lü Shi (Anwalt chin. Rechts) zugelassen. Wang vertritt unter anderem deutsche Industrieunternehmen bei Vertragsverhandlungen und bei Rechtsstreitigkeiten mit chinesischen Geschäftspartnern. Ferner ist er darauf spezialisiert, Unternehmen und Geschäftsführer umfassend bei Fragen zum chinesischen Arbeitsrecht sowie in den Bereichen Company Compliance und White-Collar Crime zu beraten.
Jean Liu, Präsidentin des Fahrdienstvermittlers Didi Chuxing hat laut Reuters ihren Rückzug aus dem Unternehmen angekündigt. Liu studierte Informationstechnologie, erst an der Peking-Universität, dann in Harvard. Als Analystin arbeitete sie zwölf Jahre bei Goldman Sachs in Hongkong, bevor sie 2014 zu Didi Chuxing wechselte.
Karl Deppen (55) wird zum 1. Dezember in den Vorstand der Daimler Truck AG berufen. Deppen verantwortet dann Truck China, einschließlich des Joint-Ventures Beijing Foton Daimler Automotive. Derzeit ist Deppen als Leiter Mercedes-Benz do Brasil tätig. Zuvor war er unter anderem CFO von Daimler Greater China.
Nach 35 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen im Daimler Konzern geht Hartmut Schick (59), Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich für Daimler Trucks Asia zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand.
Sebastian Wolf, Europachef des chinesischen Batteriezellenherstellers Farasis, wechselt zu VW. Wie das Manager Magazin berichtet, wird Wolf bei VW für den Aufbau der europäischen Batteriezellwerke zuständig sein.
eine Frage haben die Spitzenkandidaten trotz ihrer vielen Wahlkampfauftritte nicht beantwortet: Braucht Deutschland mehr Industriepolitik, mit China mithalten zu können? Elektrofahrzeuge seien zu teuer, hieß es stattdessen in einem der Trielle um die Kanzlerschaft. Eine Krankenschwester könne sich kein Elektrofahrzeug leisten, deswegen sei ein Verbrenner-Verbot unsozial.
Dabei beweist China längst das Gegenteil: Dort sind die Durchschnittspreise für E-Autos in den vergangenen zehn Jahren um fast die Hälfte gefallen – während sie in Europa und den USA gestiegen sind. Paradoxerweise haben Milliarden-Subventionen zum Preisverfall beigetragen. Denn sie haben einen Massenmarkt geschaffen, in dem über hohe Stückzahlen dann auch niedrigere Kosten möglichen waren. Diese Form der Industriepolitik könnte sich auszahlen, analysiert China.Table-Korrespondent Frank Sieren.
“Wir schützen unsere Technologie noch immer zu stiefmütterlich”, beklagt sich auch der Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds, Ludwig Veltmann, im Interview mit China.Table. Der Mittelstand dürfe technisches Know-how nicht leichtfertig an die Konkurrenz aus der Volksrepublik verkaufen. Im Globalisierungswettstreit plädiert Veltmann für ein geeint auftretendes Europa und weltweit festgelegte Umwelt- und Sozialstandards. Das Lieferkettengesetz sieht er jedoch kritisch.
Ein anderes internationales Problem ist der derzeitige Containerstau in den Häfen. Nicht zuletzt in der Autobranche fehlen Material und Zulieferteile, Produktionsstätten stehen still. Wie gut, dass Chinas Staatsmedien die vermeintliche Lösung verkünden: die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen der Volksrepublik und Europa. Finn Mayer-Kuckuk hat sich das Potenzial der Land-Seidenstraße genauer angeschaut und kommt zu dem Schluss: Auch wenn die Landstrecken zuletzt an Bedeutung gewonnen haben, den Frachtverkehr zu See werden sie nicht ersetzen können.
Viele Erkenntnisse beim Lesen wünscht

Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) legte Anfang September die Höhe der Subventionen offen, die die Autohersteller während der vergangenen fünf Jahre erhalten haben. Demnach gab Peking umgerechnet insgesamt 4,3 Milliarden Euro aus, um die Produktion von E-Autos anzukurbeln (China.Table berichtete). Dazu zählen rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie Hybridfahrzeuge. Während die Zahlungen pro Fahrzeug um vier Fünftel sanken, zahlte die Regierung 2020 aufgrund des Verkaufsbooms bei E-Autos mit umgerechnet fast 1,4 Milliarden Euro mehr als das Zehnfache an Subventionen als noch 2016, berichtet die Wirtschaftszeitung Caixin. Laut Analysten könnte der jährliche Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen in China bis 2025 auf 8,3 Millionen Stück steigen.
Peking war aus mehreren Gründen daran interessiert, Chinas E-Automarkt unter die Arme zu greifen. Dazu zählen die Verbesserung der Luftqualität in den Ballungsräumen sowie die Technologieführerschaft in einer sich neu entwickelnden Branche. Im Jahr 2017 beschloss Peking dennoch, die Fördergelder nach und nach zu streichen, um sie 2020 dann ganz auslaufen zu lassen. Am Ende dieser Konsolidierungsphase sollte sich der Markt selbst tragen, so der Plan. Dass viele Start-ups dabei untergingen, nahm die Regierung in Kauf. Die Coronakrise machte der Regierung jedoch einen Strich durch die Rechnung.
Pekings aktuelles Ziel ist es, alle NEV-Anreize bis Ende 2023 auslaufen zu lassen, anstatt wie ursprünglich geplant im Jahr 2020. Das gaben die zuständigen Behörden im April vergangenen Jahres bekannt.
Die Subventionen haben sich ausgezahlt: Heute sind die Autos in China billiger und wettbewerbsfähiger als in Europa. Günstige E-Autos für die breite Masse gibt es in China schon ab 3.700 Euro (China.Table berichtete). In Europa startet die Preisliste erst bei 15.700 Euro. Hier haben sich die Hersteller auf Fahrzeuge im höheren Segment fokussiert. In den USA fallen sogar 24.800 Euro für ein Einsteigermodell an. In den westlichen Märkten ist zudem der Durchschnittspreis für E-Autos in den letzten Jahren um gut ein Drittel gestiegen. Dagegen haben sich in China die Anschaffungskosten seit 2011 im Durchschnitt auf 22.100 Euro fast halbiert.
Eins ist klar: Die Abschaffung der chinesischen Subventionen bringt keine Erleichterung für die deutsche Autoindustrie. Je weniger Subventionen die chinesische Konkurrenz erhält, desto mehr ist sie gezwungen, international zu expandieren. Gelingt es den europäischen Herstellern nicht, rechtzeitig günstigere Modelle auf den Markt zu bringen, könnten die chinesischen Hersteller mit ihren preiswerten und zunehmend attraktiven E-Autos schnell große Marktanteile an sich reißen. Schon jetzt unterhalten Firmen wie Geely oder SAIC eigene Showrooms und Niederlassungen in Deutschland. Viele Hersteller planen die Expansion nach Europa (China.Table berichtete).
Das bedeutet, dass die deutschen Hersteller auf dem Heimatmarkt trotz des Rückgangs der Subventionen in China weiterhin auf Förderung angewiesen bleiben. Deutschlands Steuerzahler subventionieren E-Autos mit bis zu 20.000 Euro pro Fahrzeug. Auf absehbare Zeit können Stromer preislich nicht mit Verbrennerfahrzeugen konkurrieren und bleiben auf Subventionen angewiesen, erklärt Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer. Vor allem durch die hohen Kosten für die Batteriefertigung seien E-Autos teurer. Günstigere Elektroautos anzubieten, werde noch dauern, so Schäfer. “Wir werden günstigere Angebote mit weiterem technischen Fortschritt machen können, aber erst nach einer gewissen Übergangsphase.”

Der Mangel an Container-Kapazitäten belastet weiterhin den Welthandel (China.Table berichtete). Grund sind vor allem Engpässe in den Häfen. Chinesische Staatsmedien propagieren in den vergangenen Monaten die vermeintliche Lösung in Gestalt der Land-Seidenstraße und schüren gezielt die Hoffnung, dass die immer besser ausgebauten Schienenverbindungen für Güterzüge zwischen China und Europa zur Entlastung der Seestrecken beitragen könnten. Diese Erzählung wird begleitet von Erfolgsnachrichten des Prestigeprojekts der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI).
Die Nachrichtenagentur Xinhua präsentiert beispielsweise sehr regelmäßig Bilderstrecken von Zügen, die sich auf den Weg an Orte wie Duisburg machen. Dazu kommen Berichte über beschleunigte Zollabfertigung an den Grenzen, die Inbetriebnahme neuer Verbindungen und eine um 80 Prozent gesteigerte Zugfrequenz.
Experten sind sich indes einig, dass die Landverbindung zwar stark an Bedeutung gewinnt, allerdings nur geringen praktischen Einfluss auf die aktuellen Probleme haben wird. “Eine kleine Entlastung kann der Schienenverkehr natürlich schon darstellen. Er ist aber nicht groß genug, um wirklich das Problem zu lösen”, sagt Holger Görg, Leiter des Forschungsbereichs Internationaler Handel und Investitionen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), dem China.Table.
Die Land-Seidenstraße habe das Schienennetz enorm vergrößert, aber der Schienenverkehr leide ebenfalls an Engpässen, so Görg. Dazu gehören beispielsweise:
Als Engpass viel entscheidender ist jedoch das grundsätzlich viel geringere Fassungsvermögen von Zügen im Vergleich zu Schiffen. Die Betreiber der Seidenstraßen-Routen zu Lande konnten zwar im vergangenen Jahr verkünden, erstmals innerhalb eines Monats mehr als 100.000 Standard-Container transportiert zu haben. Das ist jedoch nur so viel, wie auf fünf Containerschiffe passt. Diese sind zudem ständig zu Hunderten auf den Weltmeeren unterwegs. Auf einen Zug passen eben nur rund 40 Container. Auf ein Schiff bis zu 20.000.
Auch wenn auf der Schiene also doppelt so viele Container rollen wie ein Jahr zuvor, hält sich die Entlastung also kurzfristig gesehen in Grenzen. Der Zug bleibt weiterhin vor allem etwas für Warengruppen, die zu einem höheren Preis schneller ans Ziel sollen.
Dabei wäre eine Entlastung hochwillkommen. Die britische Zeitschrift “Economist” fragt schon: “Werden die fortgesetzten Störungen die Handelsmuster verschieben?” Die Containerreedereien leiden seit Beginn der Pandemie unter einem Desaster nach dem anderen. Chinas Behörden haben mehrfach den Betrieb großer Häfen gedrosselt, nachdem Arbeiter sich mit Covid-19 angesteckt hatten (China.Table berichtete). Zwischendurch blieb ein Schiff im Suezkanal stecken und löste einen Rückstau rund um den Planeten aus. Derzeit stören häufige Taifune den Betrieb – eine Folge des Klimawandels.
Die Logistiker hatten seit Frühjahr 2020 keine Gelegenheit, den Frachtschiffverkehr wieder in den Takt zu bringen. Jede kleine Unregelmäßigkeit hat Folgewirkungen, die das brüchige Gefüge wieder stören. Die Unregelmäßigkeiten tragen zum Mangel an Zulieferteilen und Waren aus Ostasien bei. Da Containerplatz knapp ist, steigen zudem die Preise. Der entsprechende Index ist derzeit dreimal höher als vor einem Jahr und fünfmal höher als vor der Pandemie. Der Containermangel ist ein echtes Problem für die Wirtschaft.
Doch auch wenn der Schienentransport in der aktuellen Krise wenig Erleichterung bringen wird, könnte er dem Schiff langfristig eben doch Konkurrenz machen. Die “Eurasische Eisenbahnallianz”, über die etwa die Hälfte des Güterzugverkehrs von China nach Europa rollt, will ihre Kapazitäten deutlich ausweiten. Bis 2025 soll das Volumen des Containertransports auf der Schiene zwischen Asien und Europa auf eine Million Standardcontainer steigen. Gerade der starke Anstieg des Frachtverkehrs infolge der Pandemie gilt der Allianz als starkes Zeichen dafür, dass sich weitere Investitionen lohnen.
Treiber des Trends ist natürlich Peking. “China investiert stark in die Schieneninfrastruktur”, sagt Ökonom Görg vom IfW. Offizielle chinesische Statistiken zeigen: Es gab zu Jahresbeginn rund 12.400 internationale Schienenverbindungen aus China – im Jahr 2015 waren es noch weniger als 1.000. “Und dieser positive Trend dürfte sich auch in absehbarer Zeit ähnlich fortsetzen”, meint Görg.
Deutsche Unternehmen mit Bezug zur Land-Seidenstraße freuen sich über den Trend und erwarten weiter starkes Wachstum. “Zurückblickend hat sich die Land-Seidenstraße großartig entwickelt”, sagt eine Sprecherin von BREB, einer Reederei aus Bremen (ehemals Eilemann & Bischoff). BREB nimmt in baltischen Häfen viele Seidenstraßen-Container in Empfang, die über die Landroute nach Europa gekommen sind. Seit diesem Frühjahr komme täglich ein kompletter Zug aus Xi’an in der russischen Hafenstadt Baltiysk östlich von Danzig an.
In Baltiysk übernehmen Schiffe von BREB die Container und bringen sie nach Mukran auf Rügen. Dort werden sie auf die Bahn verladen und rollen ins deutsche Hinterland. Die Reederei setzt für diesen Pendelverkehr laufend zwei Schiffe ein, die “BREB Mukran” und die “BREB Balktiysk”. Die beiden Frachter nehmen inzwischen auch Container in Schweden für die Verladung in Richtung China auf. “Die Ladungsmengen über die Land-Seidenstraße wachsen kontinuierlich weiter an“, beobachtet BREB. “Zum jetzigem Zeitpunkt ist noch kein Ende abzusehen.”
Aus Sicht der Reederei BREB ist vor allem die höhere Geschwindigkeit der Zugverbindung entscheidend: “Transitzeit ist ein entscheidender Faktor geworden.” Die Hochseestrecken seien weiter mit Unsicherheiten belastet, “während die Transitzeit auf der Land-Seidenstraße mit plus/minus ein bis zwei Tagen gleich bleibt.”
Derzeit sind die Angebote auf der Schiene in Einzelfällen sogar günstiger als mit dem Frachter. Der Landtransport wird langfristig jedoch teurer bleiben. Schiffe transportieren schlicht sehr, sehr viele Container auf einmal. “Zwar hat sich der Preisunterschied durch den extremen Anstieg der Frachtraten zur See verringert”, sagt Lars Jensen, CEO der Beratungsfirma Vespucci Maritime in Dänemark und einer der führenden Experten für Container-Logistik, dem China.Table. Doch mit der Nachfrage gehen nun auch die Frachtraten auf der Schiene hoch. “Wenn sich die Staus an den Häfen auflösen, wird eine Normalisierung eintreten.”
Görg bestätigt die Einschätzung, dass der Vorteil für die Schiene nach dem Ende der Pandemie wieder schwindet. “Man sollte den Grund für die derzeitigen Kapazitätsprobleme der Seefahrt nicht vergessen”, sagt Görg. Schließungen von Container-Terminals infolge von Corona-Ausbrüchen können zudem auch dem Schienenverkehr passieren. “Dort vielleicht noch häufiger, da viele Grenzen überschritten werden müssen.”
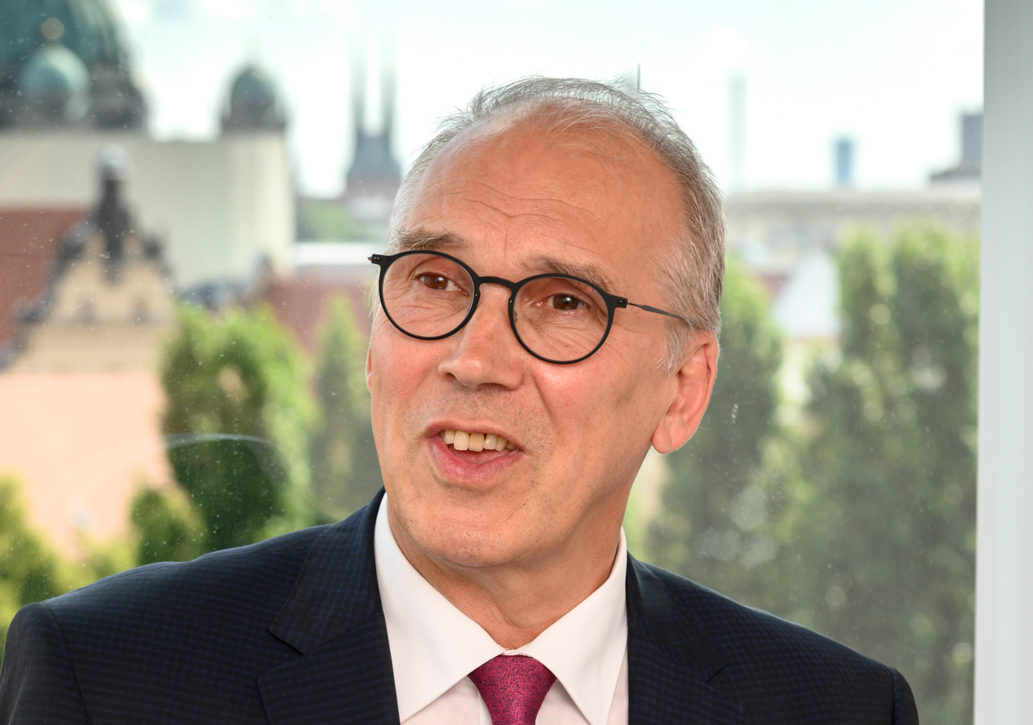
Herr Veltmann, was wäre dem deutschen Mittelstand lieber: Eine Welt unter US-amerikanischer oder chinesischer Technologieführerschaft?
Die Amerikaner sind uns lieber, solange sie keinen Präsidenten wie Trump haben. Sie sind uns kulturell deutlich näher und haben auch ein ähnliches Verständnis von Demokratie. China ist eine Autokratie. Und ein Land, das autoritär organisiert wird, ist uns grundsätzlich suspekt.
Welche Konsequenzen hätte eine chinesische Technologieführerschaft für Deutschland?
Da gibt es zwei Ebenen. Einerseits würde die Wertschöpfungstiefe hierzulande abnehmen. In manchen Technologiebranchen spielen deutsche Unternehmen heute schon keine Rolle mehr. China macht ja selbst vor Technologien nicht halt, in denen die deutsche Industrie bislang noch eine führende Rolle spielt. Wenn China Flugzeuge beispielsweise auf dem Weltmarkt verkauft, wo heute noch Airbus und Boeing den Ton angeben, wird deutlich sichtbar, wie Wertschöpfung nach China abwandert.
Und die zweite Ebene?
Das sind die politischen Implikationen. Es geht um die Frage, wie wir leben wollen. Wir sind hier sehr stolz auf unsere Demokratie und unsere Lebensweise, und sehen unsere Staatsform als die bessere auch im Hinblick auf Wachstums- und Entwicklungsperspektiven an. Nun aber kommt ein Land daher, das autokratisch geführt wird und uns mit seinem Staatskapitalismus zeigt, “was eine Harke ist”. Das könnte den einen oder anderen Technologiebegeisterten dazu bewegen, an unserer Demokratie zu zweifeln. Es könnten Stimmen aufkommen, die nach einem “starken Mann” im Land verlangen, der die mitunter lähmenden Prozeduren in demokratischen Gremien zum Anlass nimmt, Freiheitsrechte einzuschränken. Das besorgt mich.
Halten Sie es für ein reales Szenario, dass wir zur Diktatur werden, weil China wirtschaftlich erfolgreich ist?
In dem Maße, in dem unsere Unternehmen hier an der Bürokratie und langwierigen Prozesse verzweifeln, schaffen wir den Nährboden für solches Gedankengut. Ich höre immer mal wieder aus den Unternehmen, wie unkompliziert und schnell Projekte in China umgesetzt werden. Unsere Firmen dagegen befinden sich gefühlt immer in der Warteschleife für die Genehmigung hierfür oder dafür, und dabei fallen ständig satte Verwaltungsgebühren an, obwohl die Unternehmen reichlich Steuern zahlen. Diese Gesamtsituation produziert viel Frust.
Droht der deutsche Mittelstand zum Bittsteller Chinas zu werden?
Das sind wir doch teilweise jetzt schon. China schottet sich immer weiter ab und arbeitet auffällig in vielen Wirtschaftsbereichen an weitreichender Autarkie. Immer mehr deutsche Firmen, die bei potenziellen chinesischen Geschäftspartnern anklopfen, stoßen auf Probleme. Die Schikane, die Ausländer während der Coronazeit bei der Einreise ins Land erfahren, ist symptomatisch. Außerdem darf nicht mehr offen über systemkritische Vorgänge gesprochen werden. Wenn es um sensible Dinge geht, verbietet sich die chinesische Seite sofort jede Diskussion.
Wäre all das anders, wenn die US-Amerikaner das Rennen um die technologische Dominanz gewinnen?
Da gehe ich von aus. Mal abgesehen von der besseren Kompatibilität unseres politischen Systems mit dem der USA hat China eine klare Strategie formuliert. Nämlich, dass es gegen die Abhängigkeit von Zulieferungen aus dem Ausland arbeitet. Die Technologieführerschaft würde China dabei massiv helfen, sich selbst zu versorgen. Das Land wäre als Exportmarkt für deutsche Unternehmen deutlich weniger attraktiv.
Hat der Mittelstand keine Mittel, um eine drohende chinesische Technologie-Vorherrschaft zu verhindern?
Durch mehr Flexibilität können Erfindergeist und die Einsatzbereitschaft im Mittelstand noch vergrößert werden. Doch dazu muss die Politik den Rahmen schaffen. In den Sonntagsreden ist es immer ganz leicht, den Mittelstand als das Fundament der deutschen Wirtschaft zu preisen und seine Förderung anzukündigen. Am Montag wird es dann wieder schwieriger. Statt Flexibilität gibt es dann Bauauflagen, langwierige Genehmigungs- und Prüfprozesse und Restriktionen, die den Mittelstand behindern. Die auferlegte Ausweitung der Erfassung von Arbeitsstunden beispielsweise passt überhaupt nicht in die heutige Zeit und behindert Betriebe unnötig im Wettbewerb.
Ist es die Schuld der hiesigen Politik, dass China kein Level Playing Field zulässt, was einen enormen Vorteil für chinesische Unternehmen bedeutet?
Die Politik leistet nicht, was sie eigentlich leisten müsste. So könnte sie in der EU starke Allianzen schmieden. Als Europäer setzen wir ohne solche den Chinesen doch gar kein Gewicht entgegen. Wir haben nicht mal einen EU-Außenminister. Da kommt jedes Land der EU allein auf China zu – das spielt einem so großen Land natürlich in die Karten. Wir brauchen deshalb unbedingt ein stärkeres Europa.
Indem es nach dem Motto “Wie du mir, so ich dir” den Chinesen den Zugang zu Ausschreibungen verbietet?
Nein, das wird nicht ohne Weiteres gelingen, wenn wir “tit for tat” spielen. Es bedarf globaler Zusammenarbeit mit klaren Regeln durch die Welthandelsorganisation oder ähnliche Institutionen. Multilaterale Verständigungen sind im Umgang mit China der bessere Hebel als der Bilateralismus. Angesichts der Größe und Marktmacht Chinas ist es unverzichtbar, geschlossen aufzutreten, um seine Interessen gegenüber der chinesischen Regierung wirksam zu vertreten.
Sie kritisieren die Politik. Aber hätte sich der Mittelstand auch besser auf die Herausforderungen einstellen können, denen er aufgrund des Aufstiegs Chinas begegnet?
Mitte der 1980er-Jahren habe ich ein Forschungsprojekt über Kooperationen in Taiwan durchgeführt. Damals war es völlig abwegig, dass die Volksrepublik China ein maßgebliches Gewicht in der Welt bekommen würde. Im Übrigen ging ich nicht als Einziger davon aus, dass sich vielmehr Taiwan wegen seiner damaligen wirtschaftlich deutlichen Überlegenheit gegenüber der Volksrepublik im internationalen Wettbewerb besser behaupten würde. Einem kommunistischen Regime haben wir diesbezüglich dagegen nicht sehr viel zugetraut.
Die Volksrepublik China hat in den zurückliegenden Jahren aber das Gegenteil bewiesen – trotz autokratisch sozialistischer Staatsform. Längst ist das Land nicht mehr die Werkbank der Welt für Billigprodukte und Imitate westlicher Marken. Vielmehr strömten in gewaltiger Dosis Kapital und Know-how ins Land, womit die Gewichte verschoben wurden. Heute gibt es kaum eine Technologie, in der China nicht den Anspruch oder den Ehrgeiz hat, Weltspitze zu sein. Diese Absichten hätte der Mittelstand frühzeitig erkennen müssen und nicht leichtfertig technisches Spitzen-Know-how an China verkaufen dürfen.
Dafür ist es zu spät, aber schützen wir unsere Technologie wenigstens heute ausreichend?
Das tun wir immer noch zu stiefmütterlich. Ich will nicht dem Protektionismus das Wort reden. Aber wenn ein chinesisches Unternehmen ein deutsches erwirbt, um zu gucken, wie das alles so funktioniert, und dann aber das Geschäft in China für den chinesischen Markt weiterbetreibt, dann muss uns klar sein, dass wir am Ende nur allzu rasch in die Röhre gucken. Da müssen wir klüger werden.
Gibt es denn nach all den Jahren immer noch Unternehmen, die von den tiefgreifenden Veränderungen durch Chinas tragende Rolle nichts mitbekommen?
Die ehrgeizigen Ziele Chinas sind inzwischen fast jedem Unternehmen in irgendeiner Form präsent. Aber es gibt noch zu wenig strategische Pläne, dem zu begegnen, was ein paar Tausend Kilometer weiter weg geschieht.
Chinas kategorische Ablehnung jeglicher Verantwortung für die Corona-Pandemie, die Vertragsbrüche in Hongkong, die Tragödien aus Xinjiang: Hat im deutschen Mittelstand in jüngster Vergangenheit ein Prozess begonnen, darüber nachzudenken, ob es moralisch anständig ist, mit China Geschäfte zu machen?
Natürlich hat es das. Und es gibt viele Unternehmen, die daraus Konsequenzen ziehen. Es herrscht schließlich im Mittelstand grundsätzlich Zustimmung für eine Politik, die sagt: Wir achten auf Menschenrechte und Produktionsbedingungen in diesem Land. Aber es ist letztlich nicht realistisch, den Unternehmen abzuverlangen, eine Art Kontrollfunktion zu übernehmen und allein die Verantwortung dafür zu tragen, wo die internationale Politik keine Lösungen findet. Das einzelne mittelständische Unternehmen wird kaum die immer komplexeren Lieferketten nachverfolgen und für das Verhalten der Vorlieferanten oder das Handeln deren Regierungen alleinige Verantwortung übernehmen können.
Ist das menschlich oder müssen wir den Unternehmen mehr abverlangen?
Da stellt sich die Frage, wie weit man einen einzelnen Unternehmer verantwortlich machen kann. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz verlangt ja, dass die Lieferkette nur aus Akteuren mit weißen Westen besteht. Aber so arbeitsteilig, wie die Welt funktioniert, ist das doch gar nicht darstellbar. Wichtig wäre, dass Umwelt- und Sozialstandards durch die Weltgemeinschaft festgelegt werden. Darum sollte sich etwa die WTO kümmern. Dann könnten die Unternehmen viel effizienter ihre Arbeit tun und würden nicht durch kostspielige Bürokratiemonster ausgebremst.
Welche Werkzeuge bleiben dem Mittelstand jenseits politischer Forderungen?
Wenn wir es schaffen, Kreativität und Innovationen zu entfesseln und starke Marken zu schaffen oder fortzuentwickeln, dann haben wir weiterhin beste Chancen im internationalen Wettbewerb. Denn dann können wir uns als unverzichtbarer Akteur in den globalen Wertschöpfungsketten positionieren. Noch ist das Image deutscher Produkte noch sehr gut in China. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass auch das abnimmt. Der Dieselskandal hat das deutsche Auto auch in China unter Druck gesetzt, natürlich auch weil die chinesische Propaganda das für sich genutzt hat.
Vom Grad der Digitalisierung ganz zu schweigen.
Und auch da müssen wir uns fragen, weshalb wir den Zug zu verpassen drohen und ihn in vielen Bereichen leider schon verpasst haben. Digitalisierung benötigt großes Investment, aber dieses in Deutschland in der notwendigen Geschwindigkeit zu mobilisieren, ist oft schlicht nicht in gleichem Maße möglich wie etwa in den USA oder in China. Dabei kann der überfällige Transformationsprozess nur dann gelingen, wenn digitale Tools und vor allem digital gesammelte und aufbereitete Daten gezielt zum Einsatz kommen.
Für den Handel etwa ist es wichtig, die Kundenbedürfnisse genau zu kennen. Wem dies am besten gelingt, der ist im Wettbewerb ganz vorn. Wirtschaftlicher Erfolg erklärt sich heute zumeist datenbasiert. Noch hinken wir bei der Datenauswertung gewaltig hinterher. Wenn man die Vielfalt und den Nutzen der Dienstleistungen etwa auf der Handelsplattform Alibaba näher betrachtet, wird deutlich, wo die Reise im Wettbewerb hingeht.
Das klingt nach viel Arbeit in schwieriger Ausgangslage. Wie schätzen sie die Stimmung im Mittelstand ein?
Mittelständler sind Berufsoptimisten mit erheblicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das stärkt nicht nur ihre Unternehmen und schützt sie gerade in Krisenzeiten, sondern stabilisiert zugleich ganze Volkswirtschaften. Digitalisierung und die sich rapide verschärfende Debatte zum Thema Nachhaltigkeit lösen dramatische Veränderungen in den Märkten aus, denen das einzelne mittelständische Unternehmen immer weniger gewachsen ist. Der Kooperationsgedanke erfährt deshalb gerade wieder eine Renaissance, denn nur gebündelte Kräfte können die Nachteile zu kleiner Einheiten ausgleichen.
Der Mittelstandsverbund bringt hierzu seine Expertise für die Stärkung und Fortentwicklung der Unternehmen auf der Basis der genossenschaftlichen Idee konsequent bei den von ihm vertretenen 230.000 Unternehmen in 320 Unternehmensverbünden aus 45 Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbranchen ein. Hierbei gilt es, den politischen Entscheidungsträgern immer wieder den Wert der kooperativen Wirtschaftsform vor Augen zu führen und für deren Freiräume – etwa in der Kartell- und Wettbewerbspolitik – einzutreten. Als Unternehmer gut vernetzt zu sein, entfaltet sich nicht nur zunehmend als wirtschaftlicher Vorteil, es trägt auch zu einer besseren Stimmung bei.
Ludwig Veltmann, 62, lernte in den 1980er-Jahren Chinesisch und zog für Forschungsprojekte nach Taiwan und in die Volksrepublik. Seit 2001 verfolgt er als Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes den wachsenden Einfluss der Volksrepublik auf die deutsche Wirtschaft.
Der chinesische Internetkonzern Baidu weitet seine Ambitionen in der Elektromobilität aus. Das Unternehmen, das Chinas gleichnamige und größte Internet-Suchmaschine betreibt, hat die Serienproduktion eines vollelektrischen LKW angekündigt. 2023 soll der sogenannte “Roboter-LKW” Xingtu auf den Markt kommen. Das Fahrzeug wird zunächst mit dem Automatisierungsgrad Level 3 ausgestattet sein, der später auf Level 4 erhöht werden soll. Level 3 ermöglicht autonomes Fahren in Staus oder auf Autobahnen. Sein System führt Vorgänge wie Blinken, Spurwechsel oder Spurhalten selbständig durch, ohne dass der Fahrer das System ständig überwachen muss.
Baidu hat den Xingtu in einem Gemeinschaftsunternehmen namens DeepWay zusammen mit dem chinesischen Finanzdienstleister Lionbridge entwickelt. Attraktiv für Kunden soll ihn neben seiner fortgeschrittenen Selbstfahrtechnologie auch das Akkuwechsel-System machen, mit dem die Batterie des Fahrzeugs binnen weniger Minuten ausgetauscht und auf mögliche lange Ladezeiten verzichtet werden kann.
Baidu arbeitet schon seit 2013 an der Selbstfahrtechnologie Apollo, die vornehmlich in Elektroautos zum Einsatz kommen soll. Im März gründete das Unternehmen ein Joint Venture mit dem privaten Autobauer Geely, das sich auf die Entwicklung und Produktion von E-Autos spezialisiert und im kommenden Jahr sein erstes Modell auf den Markt bringen möchte (China.Table berichtete). grz
China hat in den letzten Jahren am meisten Patente für 6G-Technologien angemeldet. Das geht aus einer Untersuchung der japanischen Zeitung Nikkei und dem japanischen Forschungsunternehmen Cyber Creative Institute hervor. Die beiden Partner haben knapp 20.000 Patentanmeldungen in neun 6G-Technologiebereichen ausgewertet. Demnach haben Unternehmen und Forschungsinstitute aus China 40 Prozent der Patente in Bereichen wie Kommunikation, Quantentechnologie, Basisstationen und künstliche Intelligenz angemeldet. Die USA liegen mit 35 Prozent der Anmeldungen knapp dahinter. Europa und Japan konnten jeweils knapp unter zehn Prozent auf sich vereinen.
Huawei sowie die Staatsfirmen State Grid und China Aerospace Science and Technology gehören zu den größten Inhabern von 6G-Patenten, so Nikkei. Trotz der Tech-Sanktionen von US-Präsident Trump sei es China gelungen, seine Wettbewerbsfähigkeit im 6G-Bereich durch die Mobilisierung staatlicher Unternehmen und Universitäten zu erhalten.
Die 6G-Technologie ermögliche aufgrund ihrer Geschwindigkeit beispielsweise vollautonom fahrende Autos, Virtual-Reality Anwendungen in höchster Auflösung und Internetverbindungen selbst an abgelegensten Orten, so Nikkei. Die 6G-Technologie wird demzufolge ab 2030 kommerziell nutzbar sein. Staaten, die viele Patenten anmelden, werden die zukünftigen Industriestandards mitbestimmen. nib
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF und CATL, Batterie-Weltmarktführer, sind eine Partnerschaft bei der Entwicklung und Lieferung von Materialien für moderne Akkus eingegangen. Ziel ist auch der Klimaschutz: Die beiden Unternehmen haben einen Rahmenvertrag unterzeichnet, um ihre Ziele bei der Emissionsneutralität schneller zu erreichen. Bei der Zusammenarbeit geht es um die Lieferung von Materialien für die Kathode, also einem Teil im Inneren der Batterie, der je nach Stromfluss Elektronen aufnimmt oder abgibt. BASF als wichtiger Chemie-Zulieferer für die Autoindustrie besitzt auch eine starke Position im Markt für Kathodenmaterialien. Ein weiteres Gebiet der Kooperation ist das Recycling ausgedienter Batterien, das künftig stark an Bedeutung gewinnen wird (China.Table berichtete).
CATL wiederum baut derzeit in Erfurt ein Batteriewerk (China.Table berichtete). Das chinesische Unternehmen will für seine Kunden vor Ort eine lokale Lieferkette aufbauen. CATL befindet sich insgesamt auf Expansionskurs. In der Stadt Yichun investiert das Unternehmen derzeit 13,5 Milliarden Yuan (1,7 Milliarden Euro) in ein neues Werk. In China sind sogar 20 neue Fabriken geplant. Erfurt nimmt hier als einziger großer Auslandsstandort eine Sonderstellung ein. fin
Um die Einhaltung der neuen Vorschriften zum Umgang mit Daten in China und beim Datentransfer ins Ausland gewährleisten zu können, sollten sich die betroffenen Unternehmen rasch mit dem Datensicherheitsgesetz beschäftigen. Schließlich drohen bei Nichteinhaltung hohe Strafen für Unternehmen; deren Vertreter müssen unter Umständen mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.
Historisch gesehen krönt das DSL eine Handlungsreihe des chinesischen Gesetzgebers in den letzten Jahren. Mit dem Cyber Security Law (CSL) wurden 2017 zum ersten Mal in der Geschichte der Volksrepublik die Weichen für die Anforderungen bei der Behandlung von Daten für Betreiber von kritischer Informationsinfrastruktur (KII) gestellt. Seitdem spielt die nationale Internet-Informationsbehörde (“Cyberspace Administration of China”, kurz: “CAC”) eine zentrale Rolle bei der Konkretisierung von gesetzlichen Maßnahmen. Mit dem Verordnungsentwurf 2019 ist eine drastische Verschärfung und Ausweitung der Verpflichtung zur Sicherheitsbewertung zu verzeichnen.
Das neue DSL der chinesischen Gesetzgeber stellt ein systematisches “Upgrade” im Bereich Netzwerk- und Informationssicherheit sowie der Sicherheit von persönlichen Daten dar. Bemerkenswert ist vor allem der geographische Anwendungsbereich. So schreibt § 2 des neuen DSL vor, dass das Gesetz nicht nur für Datenverarbeitungstätigkeiten innerhalb Chinas, sondern auch für Datenverarbeitungstätigkeiten außerhalb Chinas gilt, wenn die nationale Sicherheit oder das öffentliche Interesse Chinas gefährdet sind.
Die starke Verlinkung mit dem CSL ist beim neuen DSL nicht zu übersehen. Demzufolge gelten weiterhin die Bestimmung der CSL für das Sicherheitsmanagement beim Export von Daten, die von den Betreibern kritischer Informationsinfrastrukturen innerhalb des chinesischen Territoriums gesammelt oder produziert werden. Als Neuerung ist ein einheitliches Verfahren in Bezug auf die Sicherheitsüberprüfung, das sogenannte Security Assessment, in § 24 DSL geschaffen worden. Allerdings sind Anwendungsbereich und verfahrenstechnische Details derzeit noch unklar. Ferner gilt der Zusammenhang zwischen der Datensicherheitsprüfung und der Cybersicherheitsprüfung auch noch zu klären.
Zu beachten sind die – durchaus drastischen – Strafen bei festgestellten Verstößen. Zu den rechtlichen Folgen gehören zivilrechtliche Haftungen, Verwaltungsstrafen (z.B. Geldbußen und Entzug der Geschäftslizenz) sowie strafrechtliche Haftungen.
Parallel zum DSL gilt ein weiteres neues Gesetz als zentrales Element im Bereich der Datensicherheit: Das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten, das am 1. November 2021 in Kraft treten wird. Datenverarbeiter von persönlichen Daten müssen unterschiedlichen Compliance-Verpflichtungen nachkommen. Ähnlich wie das DSL ist das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten auch extraterritorial anwendbar. Dieses Regelwerk ist in vielfacher Hinsicht mit der General Data Protection Regulation GDPR der Europäischen Union vergleichbar; allerdings deutlich strenger in Bezug auf den Schutz der öffentlichen Sicherheit.
Bemerkenswert ist auch die Gesetzgebung in einzelnen Industriebranchen: Die vorläufigen Regelungen für das Management der Datensicherheit in der Automobilindustrie werden am 1. Oktober 2021 in Kraft treten. Diese Regelungen betreffen sogenannte Automobil-Datenverarbeiter, also Automobilhersteller, Teile- und Softwarelieferanten, Händler, Reparaturbetriebe sowie Fahrdienstleister. Die Automobil-Datenverarbeiter müssen sich an die Bestimmungen dieser Regelungen halten, wenn sie persönliche Daten und wichtige Daten verarbeiten, die mit dem Design, der Herstellung, dem Verkauf, der Nutzung, dem Betrieb oder der Wartung von Fahrzeugen zusammenhängen. Automobil-Datenverarbeiter müssen den zuständigen Behörden jährlich über das “Management der Datensicherheit” berichten.
Es bleibt abzuwarten, wie die neuen Gesetze und Regelungen in der Praxis umgesetzt werden. Es ist jedoch abzusehen, dass zahlreiche Ergänzungen im Bereich des Datenschutzes eingeführt werden. Dieser Trend lässt sich bereits im Bereich der Cybersicherheit beobachten. Nach der Verabschiedung des Cybersicherheitsgesetzes wurden zahlreiche Regelungen und nationale Standards erlassen. Die zuständige Behörde CAC setzt das Gesetz aktiv durch.
Ein typisches Beispiel war die Einleitung der Cybersicherheitsprüfung beim chinesischen Fahrdienstvermittler Didi Anfang Juli 2021 (China.Table berichtete). Kurz nach dessen Börsengang in New York veröffentlichte die CAC einen Entwurf zur Überarbeitung der Regelung zur Cybersicherheitsprüfung. Demnach unterliegt nun auch ein ausländischer Börsengang der Cybersicherheitsprüfung, wenn das Unternehmen Daten von mehr als einer Million Nutzern speichert. Ausländische Börsengänge chinesischer Unternehmen könnten somit in Zukunft sicherlich erschwert werden.
Die Verschärfungen der Datenschutzgesetzgebung in China wird für Unternehmen mit China-Bezug eine Herausforderung für ihre Compliance-Regelungen darstellen. Aufgrund höherer gesetzlicher Anforderungen sind börsennotierte Unternehmen in China – einschließlich deren ausländischer Tochtergesellschaften – stark betroffen. Um Compliance-Risiken zu reduzieren, müssen deutsche Unternehmen, die mit Tochtergesellschaften in China vertreten sind, ebenfalls umfassend vorbereitet sein. Im Falle eines Verstoßes drohen nicht nur Strafen wie Geldbuße, sondern auch Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeiten. Insbesondere ist darauf zu achten, ob das Unternehmen oder dessen Geschäftspartner als “Betreiber kritischer Informationsinfrastrukturen” eingestuft wird und ob das Unternehmen “wichtige Daten” verarbeitet. Interne betriebliche Regeln sollten entsprechend zügig den neuen Bestimmungen zum Datenschutz angepasst werden.
Quo vadis: Mit DSL ist in China der gesetzliche Anker im Bereich Datenschutz gesetzt worden. Sicher werden in den kommenden Jahren weitere Konkretisierung der Durchführungsmaßnahmen folgen. Sicher ist auch das Ziel des Gesetzgebers: maximale Sicherheit für Daten mit China-Bezug. Nicht sicher ist hingegen, wie weit die Verschärfungen noch gehen werden. Wirtschaft und Unternehmen stehen diesbezüglich sicherlich noch vor weiteren Herausforderungen bei ihren Aktivitäten in China.
Jiawei Wang LL.M. ist Legal Counsel bei Rödl & Partner in Stuttgart und dort für den Bereich China Desk verantwortlich. Er hat Rechtswissenschaften in Shanghai und Heidelberg studiert und ist in der Volksrepublik China als Lü Shi (Anwalt chin. Rechts) zugelassen. Wang vertritt unter anderem deutsche Industrieunternehmen bei Vertragsverhandlungen und bei Rechtsstreitigkeiten mit chinesischen Geschäftspartnern. Ferner ist er darauf spezialisiert, Unternehmen und Geschäftsführer umfassend bei Fragen zum chinesischen Arbeitsrecht sowie in den Bereichen Company Compliance und White-Collar Crime zu beraten.
Jean Liu, Präsidentin des Fahrdienstvermittlers Didi Chuxing hat laut Reuters ihren Rückzug aus dem Unternehmen angekündigt. Liu studierte Informationstechnologie, erst an der Peking-Universität, dann in Harvard. Als Analystin arbeitete sie zwölf Jahre bei Goldman Sachs in Hongkong, bevor sie 2014 zu Didi Chuxing wechselte.
Karl Deppen (55) wird zum 1. Dezember in den Vorstand der Daimler Truck AG berufen. Deppen verantwortet dann Truck China, einschließlich des Joint-Ventures Beijing Foton Daimler Automotive. Derzeit ist Deppen als Leiter Mercedes-Benz do Brasil tätig. Zuvor war er unter anderem CFO von Daimler Greater China.
Nach 35 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen im Daimler Konzern geht Hartmut Schick (59), Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich für Daimler Trucks Asia zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand.
Sebastian Wolf, Europachef des chinesischen Batteriezellenherstellers Farasis, wechselt zu VW. Wie das Manager Magazin berichtet, wird Wolf bei VW für den Aufbau der europäischen Batteriezellwerke zuständig sein.
