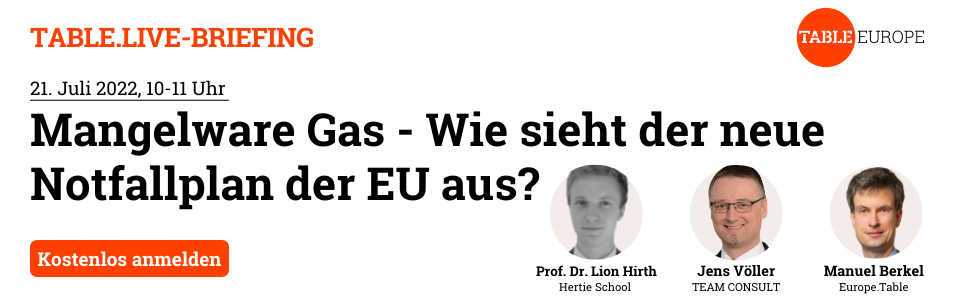Einheit auf allen Ebenen. Mit einem Fonds von über 500 Millionen Euro will die EU kurzfristig Anreize für die EU-Länder schaffen, Rüstungsprojekte gemeinsam anzugehen. Neu ist so ein Instrument nicht, aber es erhält nun angesichts des Krieges in der Ukraine endlich die nötige Rückendeckung aus den Mitgliedstaaten, schreibt Ella Joyner.
Auch bei der Gaskrise will die EU künftig noch stärker als Einheit funktionieren. Die Mitgliedstaaten sollen nun zum Sparen “angeregt”, später notfalls sogar verpflichtet werden. Außerdem soll ein neuer unionsweiter Alarm ausgelöst werden können, wenn Versorgungsnotfälle drohen. Und das könnte passieren, wenn in wenigen Tagen kein Gas über Nord Stream in Europa ankommt. Die Signale sind da allerdings derzeit nicht so eindeutig. Manuel Berkel erklärt, warum.
Auch in Richtung China will man geschlossen auftreten. Denn die Liste der Probleme zwischen der EU und China ist lang. Nach fast zweijähriger Pause wurde jetzt zumindest der Handelsdialog wieder aufgenommen. Für Irritation sorgte dort auch die Einladung Xi Jinpings, die er angeblich europäischen Regierungschefs haben soll. Er wisse nicht, woher diese Information stamme, sagte er. Meine Kollegin Amelie Richter berichtet.
Sie wollen mehr zur aktuellen Gaskrise erfahren, direkt vom Experten? Dann möchten wir Sie noch einmal auf das Europe.Table-Webinar am kommenden Donnerstag, 21. Juli, 10 bis 11 Uhr hinweisen: Mein Kollege Manuel Berkel diskutiert mit Lion Hirth, Assistant Professor an der Hertie School, und Jens Völler, Head of Business Unit Gas Markets bei TEAM CONSULT, den Notfallplan für die Energieversorgung ohne russisches Gas. Hier können Sie sich kostenfrei registrieren.

Die EU-Kommission hat am Dienstag ein neues Instrument vorgestellt, mit dem zumindest ein Teil der benötigten Neuanschaffungen von den Mitgliedstaaten gemeinsam gekauft werden sollen. Zu diesem Zweck stehen 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt für zwei Jahre (voraussichtlich 2023/2024) zur Verfügung. Die Kommission finanziert nicht die direkten Waffenkäufe selbst, sondern soll mit dem Geld einen Anreiz bieten, wenn drei oder mehr Mitgliedstaaten gemeinsam Waffen beschaffen wollen.
“Während der Krieg an den Grenzen Europas tobt, folgen wir dem Ruf der EU-Staatschefs”, sagte der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar Thierry Breton bei der Vorstellung des Programms. Auf dem Versailler Gipfel im März beauftragten die EU-Regierungen die Kommission mit der Vorbereitung einer solchen Initiative (Europe.Table berichtete). “Es geht darum, die Vorräte wieder aufzufüllen. Wenn der Krieg lange andauert, müssen wir in der Lage sein, dies auf koordinierte Weise für eine lange Zeit zu tun”.
Es handelt sich also um ein kurzfristiges Instrument, aber laut Breton soll es auch eine längerfristige Umstrukturierung des EU-Waffenmarktes unterstützen. Die Fragmentierung des EU-Rüstungsmarktes wird seit Jahren als Problem angesehen. Die Mitgliedstaaten beschaffen den Großteil ihrer Ausrüstung im eigenen Land, was als ineffizient und teuer gilt.
Im Wesentlichen bedeutet diese Fragmentierung, dass die EU weniger für ihr Geld bekommt als beispielsweise die Vereinigten Staaten, die über eine sehr konsolidierte industrielle Basis verfügen, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in den letzten Monaten mehrfach betont hat. Außerdem gibt es Probleme mit der Interoperabilität von Verteidigungsgütern.
Der Kommission zufolge zielt die neue Initiative auch darauf ab, Verdrängungseffekte zu verhindern, also die Unfähigkeit kleinerer Mitgliedstaaten, ihren Bedarf an Verteidigungsgütern aufgrund von Nachfragespitzen zu decken. Genehmigte Projekte werden von der Kommission unterstützt und erhalten einen Zuschuss, aber die Initiative und der größte Teil des Geldes werden von den Mitgliedstaaten selbst kommen.
Breton sagte am Dienstag, die industrielle Basis der europäischen Verteidigungsproduktion sei derzeit nicht zweckmäßig. Die neue Initiative sei ein Pilotprojekt, das mit mehr Geld zu einem dauerhaften Instrument werden solle. Weitere Einzelheiten könnten noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden.
Die Kommission setzt also ein Zeichen für die Industrie: Macht euch bereit – eine groß angelegte gemeinsame Beschaffung wird kommen. “Im Moment ist die Industrie auf kleine und mittlere Bedarfsmengen eingestellt”, so Breton. Die Kommission hat die mittel- und langfristige Perspektive im Auge, und die Produktionskapazitäten sollten wachsen, sagte er.
Aus diesem Grund sei das Instrument ein “historischer Schritt” für die europäische Verteidigung, so EU-Kommissar Breton. Aber wie historisch ist er wirklich? Seit fast zwei Jahren bemühen sich die EU-Institutionen darum, dass die EU-Staaten ihre Verteidigungspolitik besser koordinieren. Die am Dienstag vorgestellte Initiative ist das erste Mal, dass die Kommission eine gemeinsame Waffenbeschaffung auf diese Weise direkt finanziert. Allerdings gibt es bereits ein ähnliches Instrument, das bisher keine nennenswerte Wirkung gezeigt hat.
Die Kommission von Präsident Jean-Claude Juncker hat den Weg für den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) geebnet, der 2019 seine Arbeit aufgenommen hat und 2021 bis 2027 acht Milliarden Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Verfügung stellen kann. Es ist zu früh, den Erfolg der EDF als Projekt zu beurteilen. Klar ist aber, dass die Jahre der Debatte und Warnungen von der Kommission kaum auf die Mitgliedstaaten gewirkt hat.
Im Jahr 2020 gaben die 27 EU-Mitgliedstaaten nach Angaben der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) fast 200 Milliarden Euro für Rüstung und Verteidigung aus. Die Mitgliedstaaten gaben insgesamt 4,1 Milliarden Euro für die Beschaffung neuer Ausrüstung in Zusammenarbeit mit anderen aus, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Im Jahr 2020 haben die Mitgliedstaaten nur 11 Prozent ihrer gesamten Ausrüstungsbeschaffungen in Zusammenarbeit mit anderen EU-Mitgliedstaaten getätigt.
“Die der EDA übermittelten Daten zeigen einen signifikanten Rückgang der europäischen Verteidigungsbeschaffung in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten seit 2016″, schrieb die Agentur im Dezember 2021. Bei dem neuen Instrument sehen Experten allerdings das Problem, dass 500 Millionen Euro einfach nicht viel Geld ist – definitiv nicht genug, um eine große Marktumstrukturierung auszulösen. Das behauptet auch Breton nicht.
Sicher ist, dass die Kommission endlich den Segen der Mitgliedstaaten hat, als wichtiger Koordinator in der Verteidigungspolitik aufzutreten, die traditionell von den nationalen Regierungen streng gehütet wird. Auch die Zusammenarbeit mit den großen Rüstungsunternehmen wird enger, was die Aktivisten nicht immer zufrieden stellt.
Wenn dieses neue Instrument zu einem Multimilliarden-Dollar-Projekt wird, wird sich die Kommission sehr gestärkt sehen. In jedem Fall würde es Jahre dauern, den fragmentierten Produktionssektor zu konsolidieren. Produktionsketten lassen sich nicht über Nacht umgestalten. Aber Geld auf den Tisch zu legen, ist ein wichtiger erster Schritt.
Der Ukraine-Krieg könnte die Mitgliedstaaten jedoch endlich dazu bewegen, genau das zu tun, was die Kommission seit Jahren fordert. Die Mitgliedstaaten haben sich bereits verpflichtet, ihre kollektiven Verteidigungsausgaben um 200 Milliarden zu erhöhen, so Breton. Fast alle wollen das fabelhafte 2-Prozent-Ziel erreichen. Die Frage ist nun, ob genug von diesem neuen Geld wirklich gemeinsam ausgegeben werden kann.
Die Kommission will in der aktuellen Energiekrise in Europa notfalls ein verpflichtendes kurzfristiges Energiesparziel für sämtliche Mitgliedstaaten. Nach einem neuen Entwurf für den Notfallplan Gas, der Europe.Table am Dienstag vorlag, will die Kommission heute vorschlagen, dass der Rat eine entsprechende Verordnung erlässt. Das Parlament müsste dem Rechtsakt nicht zustimmen, das Verfahren ließe sich so beschleunigen. Das nächste Ratstreffen der Energieminister findet bereits am kommenden Dienstag statt.
Zunächst soll nach den Kommissionsplänen ein freiwilliges Energiesparziel gelten, dessen Höhe in dem Entwurf noch mit “X” gekennzeichnet ist. Wie Bloomberg später am Abend meldete, soll die indikative Einsparung bei 15 Prozent liegen. Falls die freiwillige Minderung nicht ausreicht, soll die Kommission laut dem vorliegenden Entwurf die Kompetenz erhalten, ein verpflichtendes Energiesparziel festlegen können.
Voraussetzung ist die Ausrufung eines neuen “unionsweiten Alarms”, den mindestens zwei Mitgliedstaaten beantragen müssten, “wenn sich die Lage und die Aussichten in Bezug auf das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage negativ entwickeln und zu Notfällen führen können”. Dieser Alarm könne “jederzeit” in den kommenden Wochen oder Monaten ausgerufen werden.
Mit dem Vorschlag will die Kommission deutlich über die bisher geltende SoS-Verordnung hinausgehen. Die rechtliche Grundlage für die neue Verordnung des Rates sieht sie in Artikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der insbesondere für Versorgungsschwierigkeiten mit bestimmten Waren wie Energieträgern geschaffen wurde (Europe.Table berichtete).
In der Verordnung will die Kommission am liebsten auch eine verschärfte Aufsicht festschreiben lassen. Bewertet werden sollen die Erfolge der Mitgliedstaaten hinsichtlich Investitionen in Alternativen zu russischem Gas und Verbrauchsreduzierungen.
Die Kommission ruft die Staaten außerdem dazu auf, schon bis Ende September ihre nationalen Notfallpläne zu aktualisieren und darin Maßnahmen zur Nachfragereduzierung zu benennen. An anderer Stelle setzt sich die Kommission für eine Stärkung der kürzlich gestarteten Energieplattform ein. “Ein notwendiger nächster Schritt ist es, zur gemeinsamen Beschaffung im Rahmen der Energieplattform überzugehen, um eine stärkere Koordinierung sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zu erreichen.” Nach einem Bericht des “Spiegel” vom Wochenende kursiert in der Industrie die Sorge, Gas von der EU-Plattform nur noch zugeteilt zu bekommen, falls diese verpflichtend werden sollte.
Die Bundesregierung will Industrieunternehmen mit Auktionen zum freiwilligen Gasverzicht anreizen. Diesen Mechanismus unterstützt auch die Kommission. In dem aktuellen Papier kündigt sie nun an, zusätzlich “schnell” die Möglichkeit für EU-weite Auktionen untersuchen zu wollen.
Falls marktbasierte Mechanismen angesichts der Energiekrise in Europa aber nicht mehr ausreichen sollten, könnten für strategisch wichtige Industriezweige “neue Instrumente” entwickelt werden, um sie bei der Diversifizierung der Bezugsquellen, dem Ersatz des Energieträgers Gas und Einsparungen zu “ermutigen”.
Die Kommission bereitet sich auf alle Szenarien vor, was das Wiederanfahren von Nord Stream 1 angehe. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, dass die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline am Donnerstag nicht wieder aufgenommen würden, sagte gestern ein Sprecher. Reuters und Bloomberg berichteten gestern übereinstimmend, dass die Pipeline am Donnerstag mit verminderter Kapazität wieder in Betrieb gehen werde. Beide Agenturen beriefen sich auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Laut Bloomberg liegt die letzte Entscheidung aber beim Kreml. Die Bundesregierung wolle mindestens bis Montag mit der Bewertung warten, ob und in welchem Umfang wieder Gas durch Nord Stream fließt.
Am Dienstagnachmittag strömte stundenweise wieder etwas Gas durch die Pipeline. Der Nord-Stream-Betreiber erklärte, dass die auf der Website des Unternehmens angezeigten Gasmengen mit dem technisch erforderlichen Druckausgleich vor dem Ende der Wartungsarbeiten zusammenhängen.
Die Bundesregierung treibt derweil die Beschaffung von schwimmenden LNG-Terminals an den deutschen Küsten voran. Neben den FSRU-Schiffen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven sollen zwei weitere Standorte in Stade und Lubmin entstehen, wie das Wirtschaftsministerium gestern mitteilte.
Wilhelmshaven und Brunsbüttel sollen bereits im Winter in Betrieb gehen. Die Terminals in Stade und Lubmin sind der Regierung zufolge wohl erst Ende 2023 betriebsbereit. In Lubmin werde zudem bis Ende des Jahres ein fünftes Terminal durch ein privates Konsortium entstehen. “Wir müssen innerhalb kürzester Zeit eine neue Infrastruktur aufbauen, um russisches Gas so schnell es geht ersetzen zu können”, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. “Es ist daher eine sehr gute Nachricht, dass zusätzlich zu den vier Bundes-Schiffen jetzt noch ein fünftes privates Regasifizierungsschiff hinzukommt.”
In Lubmin will die Deutsche Regas mit der französischen TotalEnergies investieren. Lubmin ist als Standort geeignet, da dort auch die Nordstream-Leitungen aus Russland anlanden und ins Inland weiterführen.
Jedes der vier Schiffe im Bundesauftrag hat eine Kapazität von gut fünf Milliarden Kubikmeter (bcm) Gas pro Jahr. In Brunsbüttel muss allerdings noch eine Anbindungsleitung gebaut werden, sodass laut BMWK im Sommer 2023 zunächst noch verminderte Mengen eingespeist werden müssten. Die Leitungskapazitäten für Stade und Lubmin würden derzeit mit den Akteuren von Ort bestimmt. Mit rtr
Die EU-Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, hat es gestern gut zusammengefasst: “Seit dem letzten ranghohen Handelsdialog im Jahr 2020 haben sich viele Probleme angesammelt“, schrieb sie auf Twitter nach den ersten Handelsgesprächen zwischen Brüssel und Peking nach gut zwei Jahren. Das auf Eis gelegte Investitionsabkommen CAI und die Handelsblockade gegen EU-Staat Litauen sind nur zwei dieser Probleme – die Liste der Tagesordnungspunkte für das 9. Treffen des sogenannten EU-China High-Level Economic and Trade Dialogue (kurz HED) war lang.
EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis und der chinesische Vizepremier Liu He sprachen über Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine, wie die EU-Kommission nach dem Gespräch mitteilte. Die EU habe “die Bereitschaft Chinas zur Kenntnis genommen, bei der Gewährleistung der Stabilität der Weltmärkte und der Bekämpfung der weltweiten Ernährungsunsicherheit zusammenzuarbeiten, auch durch den Export von Düngemitteln”, hieß es in einer Erklärung aus Brüssel.
Außerdem habe man sich darauf verständigt, dass die Unterbrechung von Lieferketten verhindert werden müsse. Mehr Transparenz soll es bei Informationen über die Lieferungen bestimmter kritischer Rohstoffe geben (China.Table berichtete). Fortschritte gab es im Bereich der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen. Aber auch das sich verschlechternde Geschäftsumfeld in China für europäische Unternehmen, marktverzerrende Subventionen und die Rolle von Staatsunternehmen seien angesprochen worden. Ebenso der auf Litauen ausgeübte wirtschaftliche Zwang und die nächsten Schritte für eine WTO-Reform.
Menschenrechtsverletzungen oder die Lage in Xinjiang – wo einige EU-Unternehmen Werke haben – waren der offiziellen Mitteilung zufolge bei dem Gespräch kein Thema. Es scheint ein wenig, als habe Brüssel nach dem desaströsen EU-China-Gipfel im April sichergehen wollen, dass der Handelsdialog konstruktiv verläuft. Nach der zweijährigen Pause ist der Dialog aber ein gutes Zeichen, auch wenn er erneut nur als Videocall stattfinden konnte. Einen zweiten HED wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, der nächste wird erst im Jahr 2023 stattfinden. Vielleicht dann wieder persönlich.
Verwirrung gab es indes um eine Einladung europäischer Regierungschefs in die Volksrepublik: Die Tageszeitung South China Morning Post hatte über ein mutmaßliches Gesprächsangebot von Xi Jinping berichtet. Dieser habe Bundeskanzler Olaf Scholz, den französischen Staatschef Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidenten Mario Draghi und den spanischen Premier Pedro Sánchez zu einem persönlichen Treffen im November in Peking eingeladen, schrieb die SCMP unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bestätigungen oder Stellungnahmen zu dem Bericht gab es aus den vier europäischen Hauptstädten nicht. Berlin wollte Reisepläne nicht kommentieren.
Peking antwortete am Dienstag dann jedoch mit einem klaren Dementi: “Ich weiß nicht, woher die Informationen stammen”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian. Die Einladung an die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten für Xi eine Rückkehr zur persönlichen Diplomatie mit europäischen Politikern bedeutet. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hat sich kein europäischer Politiker mit dem chinesischen Staatschef bilateral direkt getroffen. Der Austausch fand immer über Video statt.
Nach Veröffentlichung des Berichts hatte es Kritik an der mutmaßlichen Einladung an Scholz, Macron, Draghi und Sánchez gegeben. Zweifel kamen auch auf, da das Gesprächsangebot für einen Zeitpunkt ausgesprochen worden sein soll, der nach dem Parteitag der KPCh im Oktober liegt. Bei diesem will sich Xi allerdings erst im Amt bestätigen lassen. Vielleicht war Peking aufgefallen, dass es für die Außenwirkung einer echten Wahl nicht sonderlich vorteilhaft ist, wenn ein vermeintlich noch um seinen Posten “bangender” Staatspräsident bereits jetzt große Einladungen ausspricht – daher der öffentliche Rückzieher.
Auch die Auswahl der Europäer kam nicht sonderlich gut an: Mit Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hätte China die größten EU-Wirtschaftspartner eingeladen. Diese würden in Peking dann dem “Partei-Kaiser” direkt nach dem Parteitag ihren Respekt zollen, kritisierte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Er mahnte an, über die Antwort zu der Einladung gut nachzudenken. Außerdem gab es Kritik am Ausschluss anderer EU-Staaten. Die mittel- und osteuropäischen Staaten seien “jahrelang als Trojanische Pferde beschuldigt” worden, schrieb der slowakische China-Analyst Matej Šimalčík auf Twitter. Der einzig moralisch akzeptable Schritt für die vier EU-Staaten sei es deshalb “höflich abzulehnen und um ein vollständiges EU27+China-Treffen zu bitten”, so Šimalčík.
Bis es zu einem hochrangigen Besuch aus Europa in China kommt, wird es noch dauern. Nicht zuletzt deshalb erhielt nun die Reise der Vizepräsidentin des Europaparlaments und deutschen FDP-Europaabgeordneten, Nicola Beer, nach Taiwan besondere Aufmerksamkeit. Beer ist ab Dienstag zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in Taipeh. Es handelt sich dabei um den ersten Besuch Beers als Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Taiwan. Am Dienstag traf die FDP-Politikerin Taiwans Ministerpräsidenten Su Tseng-chang, am Mittwoch soll ein Gespräch mit Präsidentin Tsai Ing-wen folgen. Aus Peking kam zu Beers Besuch die bereits bekannte Kritik: Die EU-Politikerin missachte das “Ein-China-Prinzip”.
Beer rief zum Auftakt ihres Besuchs dazu auf, den Inselstaat gegen China zu unterstützen. “Taiwans Blüte ist auch Europas Blüte. Wir werden Chinas Drohungen gegen Taiwan nicht ignorieren”, so Beer laut Medienberichten. Sie stellte einen direkten Bezug ihres Besuchs zur russischen Invasion in der Ukraine her. Beer sagte laut der Nachrichtenagentur AFP: “Es gibt keinen Raum für chinesische Aggression im demokratischen Taiwan. Derzeit werden wir Zeugen eines Krieges in Europa. Wir wollen nicht Zeugen eines Krieges in Asien werden.”
Taipeh soll einem Bericht zufolge im August noch weiteren Besuch erhalten, der Peking bereits jetzt erzürnt. Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere Insider berichtete, plant Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, noch im August einen Besuch in Taipeh. Die Visite ist demnach Teil einer Reise einer US-Delegation, die auch Japan, Malaysia, Singapur und dem indopazifischen Kommando der US-Streitkräfte auf Hawaii einen Besuch abstatten soll. Offiziell bestätigt wurde die Reise zunächst weder vom US-Außenministerium, noch von Taiwan. Ursprünglich war ein Besuch schon im April geplant. Er musste wegen einer Corona-Infektion Pelosis aber abgesagt werden. Schon im April hatte der chinesische Außenminister Wang Yi gesagt, ein Besuch von Pelosi auf Taiwan wäre eine “bösartige Provokation”.
Die Regierung in Frankreich lässt sich die Verstaatlichung des Versorgers EDF fast zehn Milliarden Euro kosten. Der Staat will EDF mit der Übernahme der restlichen 16 Prozent für 9,7 Milliarden Euro stabilisieren und die Energieversorgung des Landes sichern.
Das hochverschuldete Unternehmen, das Europas größter Betreiber von Atomkraftwerken ist, kämpft mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. EDF muss derzeit Strom im Ausland zu rekordhohen Preisen einkaufen, aber wegen der Preisbremse der Regierung billiger an seine Konkurrenten abgeben. Doch schon vorher waren Kernkraftwerke ungeplant ausgefallen, die Kosten für neue Atommeiler explodierten, die Fertigstellung verzögert sich.
Das Finanzministerium in Paris bietet den restlichen EDF-Aktionären zwölf Euro je Aktie, wie es am Dienstag mitteilte. Das sind zwar 53 Prozent mehr als die Aktie am 5. Juli kostete, dem Tag vor der Ankündigung der Verstaatlichungs-Pläne (Europe.Table berichtete), aber weit weniger als die 33 Euro, für die EDF 2005 an die Börse gebracht worden war.
Nach der Wiederaufnahme des Handels schossen die Papiere am Dienstag um 15 Prozent auf 11,80 Euro nach oben. Sie waren für eine Woche vom Handel ausgesetzt worden. Die Offerte soll bis September vorgelegt werden, bis Ende Oktober soll der Rückzug von der Börse laut Ministeriumskreisen vollzogen sein. Dafür braucht der Staat mindestens 90 Prozent der Anteils.
“Die Verstaatlichung ist letztlich der einzige Weg, um das Unternehmen zu retten und die Energieversorgung zu sichern”, sagte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka. “Das ist ein bitterer, aber notwendiger Schritt.” Normalerweise exportiert Frankreich um diese Jahreszeit Atomstrom, in diesem Jahr muss EDF aber in Spanien, der Schweiz, Großbritannien und Deutschland einkaufen. Im Winter werde die Lage noch angespannter, warnen Experten.
Die Ratingagentur S&P geht davon aus, dass der Schuldenberg von EDF noch in diesem Jahr über 100 Milliarden Euro steigen wird. Dabei hatte der Staat schon im Frühjahr den Großteil einer Kapitalerhöhung über drei Milliarden Euro gestemmt. Ein mit der Angelegenheit vertrauter Banker sagte, EDF werde bald weiteres frisches Geld brauchen. Die Verwerfungen auf den Energiemärkten angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine plagen viele Strom- und Gasversorger. Die deutsche Bundesregierung ringt mit dem Mehrheitseigentümer von Uniper, der staatlichen finnischen Fortum, um die Kosten für die Rettung des größten Gas-Importeurs. rtr
Nach mehrjährigem Dornröschenschlaf nimmt die europäische Erweiterungspolitik weiter an Fahrt auf. Rund vier Wochen nach dem Beschluss, der Ukraine und Moldau den Status des Beitrittskandidaten zu verleihen, hat die Europäische Union am Dienstag in Brüssel formelle Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien aufgenommen.
Ursprünglich sollten die Verhandlungen bereits vor zwei Jahren beginnen. Bulgarien hat den Start jedoch immer wieder hinausgezögert (Europe.Table berichtete). “Sie haben viel strategische Geduld bewiesen”, lobte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die eigens angereisten Staats- und Regierungschefs der Kandidatenländer, Petr Fiala und Edi Rama. Von der Leyen betonte, Nordmazedonien und Albanien hätten hart für diesen “historischen Moment” gearbeitet. Als Beispiele nannte sie Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit, den Kampf gegen Korruption und Wirtschaftsreformen. Nordmazedonien ist bereits seit 2005 Kandidat für einen EU-Beitritt, Albanien seit 2014.
Dass nun der Weg für Beitrittsverhandlungen frei ist (Europe.Table berichtete), geht auf einen Kompromissvorschlag aus Paris zurück. Dieser Vorschlag, der im Juni unter dem damaligen französischen EU-Vorsitz erarbeitet wurde, sieht vor, die Rechte der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien durch die Verfassung schützen zu lassen.
Die Verfassungsänderung könnte aber schwierig werden, weil die Regierung derzeit nicht über die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament verfügt. Die wichtigste Oppositionspartei, die rechtsnationalistische VMRO-DPMNE, läuft seit Tagen Sturm gegen den Kompromiss. Sie wirft der Regierung in Skopje “Verrat” vor.
Von der Leyen sagte, Nordmazedonien müsse sich keine Sorgen machen. Alle EU-Dokumente würden in mazedonischer Sprache ausgehandelt. Dies gelte auch für ein Abkommen mit der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, die schon bald in das Land geschickt werden soll. Außerdem könne Skopje mit mehr Investitionen und Handelserleichterungen rechnen. Auch Albanien kann nach den Worten der deutschen EU-Chefin mit Vorteilen aus den Beitrittsgesprächen rechnen. Von der Leyen versprach die rasche Aufnahme in den Zivilschutz-Mechanismus der EU, der etwa bei Waldbränden hilft. Allerdings dürfen weder Albanien noch Nordmazedonien einen schnellen EU-Beitritt erwarten.
Die Verhandlungen mit Brüssel dauern meist viele Jahre; eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Vielmehr können Kandidatenländer bei anhaltenden Problemen zurückgestuft oder Gespräche ausgesetzt werden. Als Negativ-Beispiel gilt die Türkei. Dort liegen die Gespräche seit Jahren auf Eis, ein EU-Beitritt gilt nicht mehr als realistisch.
“Alle rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Kriterien müssen vollständig erfüllt werden”, warnte der CDU-Europaabgeordnete David McAllister. Das Tempo hänge von den “individuellen Bemühungen” der Kandidaten ab. Optimistischer zeigte sich die deutsche Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne). “Damit setzen wir ein ganz klares Signal, dass die Länder des westlichen Balkans in die EU gehören”, sagte sie in Brüssel. ebo
Die Europäische Union will Russlands größte Bank und den Chef des Zink- und Kupferkonzerns UMMC auf ihre Sanktionsliste nehmen. Sie wirft der Sberbank und dem UMMC-Chef Andrej Kosizyn vor, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen, wie aus einem Reuters vorliegenden Entwurfsdokument hervorgeht.
Für die Bank hätte der Schritt weitreichende Konsequenzen: Die Behörden würden in diesem Fall das Vermögen der Bank im Westen einfrieren und alle Transaktionen mit Ausnahme von Zahlungen für Lebensmittel- und Düngerlieferungen stoppen, sagte ein EU-Insider. Die EU hat den Zugang der Sberbank zum internationalen Zahlungssystem SWIFT bereits gesperrt (Europe.Table berichtete) und damit die Geschäfte des russischen Geldhauses eingeschränkt.
Insgesamt will die EU 48 Personen und neun Gruppen neu auf die Sanktionsliste nehmen (Europe.Table berichtete) – darunter der Motorradclub “Nachtwölfe”, Schauspieler, Politiker, der stellvertretende Leiter einer russischen Sicherheitsbehörde, Familienmitglieder bereits sanktionierter Oligarchen und Mitglieder der Streitkräfte. Die geplanten Sanktionen gegen UMMC-Chef Kosizyn werden damit begründet, dass er in einem Geschäftsbereich tätig sei, der der Regierung signifikante Einnahmen generiere.
Die EU wird am Mittwoch über weiteren Sanktionen entscheiden. Sollten die Vorschläge durchgehen, würde sich die Zahl der von der EU sanktionierten Personen auf 1.229 und die Zahl der sanktionierten Unternehmen auf 110 erhöhen. rtr
Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als Premierminister und Parteichef der britischen Konservativen hat sich die Zahl der Bewerber weiter reduziert. Am Dienstag schied die Abgeordnete vom rechten Rand der Tory-Partei, Kemi Badenoch, aus.
Als beinahe schon gesetzt für die Endrunde gilt der von indischen Einwanderern abstammende Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der bei der Fraktionsabstimmung erneut mit deutlichem Abstand die meisten Stimmen erhielt. Um den zweiten Platz konkurrieren Außenministerin Liz Truss und Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt. Entscheidend dürfte sein, wer die meisten Abgeordneten hinter sich bringen kann, die zuletzt für Badenoch gestimmt hatten. Einige Beobachter rechnen mit einem Schub für Truss, die ebenfalls dem rechten Flügel der Partei zugerechnet wird.
Die verbliebenen Bewerber sollen sich am Mittwoch einer letzten Abstimmungsrunde in der Fraktion stellen. Mit dem Ergebnis wird um 17 Uhr (MESZ) gerechnet. Der oder die Letztplatzierte fliegt raus. Wer von den beiden Finalisten letztlich die Johnson-Nachfolge antritt (Europe.Table berichtete), entscheiden die Parteimitglieder in einer Stichwahl über den Sommer. Am 5. September soll das Verfahren abgeschlossen sein.
Schlechte Nachrichten für Sunak brachte das Ergebnis einer Umfrage unter Tory-Parteimitgliedern des Meinungsforschungsinstituts Yougov am Dienstag. Demnach dürfte er bei der Stichwahl unterliegen – egal, welche der beiden Frauen gegen ihn antritt. Wie viele Mitglieder die Tory-Partei derzeit hat, ist unklar. Bei der letzten Parteichef-Wahl im Jahr 2019 waren es rund 160.000 Mitglieder. dpa
Der zu Alphabet gehörende Internet-Konzern Google senkt ab sofort die Gebühren für Entwickler von Nicht-Gaming-Apps in ihrem App Store, die zu konkurrierenden Zahlungssystemen wechseln. Mit der nur für europäische Kunden geltenden Gebührensenkung von 15 auf 12 Prozent entspreche Google den neuen EU-Tech-Regeln, teilte der US-Technologieriese am Dienstag mit.
Die Senkung solle künftig auch auf Spiele-Apps ausgeweitet werden. Das EU-Regelwerk Digital Markets Act (DMA) tritt nächstes Jahr in Kraft (Europe.Table berichtete) und verlangt von den Tech-Giganten, dass sie App-Entwicklern die Nutzung konkurrierender Zahlungsplattformen für App-Verkäufe erlauben – sonst riskieren sie Geldstrafen von bis zu 10 Prozent ihres weltweiten Umsatzes. Googles Schritt setzt eine Reihe von Zugeständnissen gegenüber Behörden fort (Europe.Table berichtete), zu der auch die Beilegung eines Urheberrechtsstreits in Frankreich und eine Entschädigungszahlung in Australien gehören. rtr

Katharina Zweig, Informatikprofessorin an der Technischen Universität Kaiserslautern, möchte Künstliche-Intelligenz-Systeme besser und fairer machen. In dem von ihr geleiteten “Algorithm Accountability Lab” befasst sie sich daher mit der Frage, wie man die Qualität und Fairness von algorithmischen Entscheidungssystemen messen kann.
Neben verbesserter KI ist Wissen der beste Schutz vor folgenschweren KI-basierten Entscheidungen, ist sie überzeugt. Mit ihrem Buch “Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl” möchte Katharina Zweig Menschen befähigen, KI-Systeme und ihre Entscheidungen besser einschätzen zu können: “Jeder Mensch, der mit KI-Entscheidungen in Kontakt kommt, muss eine ungefähre Ahnung haben, was KI kann und was KI nicht kann. Für diese Personen habe ich das Buch geschrieben.”
Katharina Zweig wollte schon als Kind Wissenschaftlerin werden. Nach ihrem Abitur im Jahr 1995 schrieb sich die damals 18-Jährige für ein Biochemie-Studium an der Universität Tübingen ein: “Ich wollte den Menschen in- und auswendig kennen, vom Atom bis hin zur Psychologie.” Während des Vordiploms entschloss sich Zweig, parallel noch Bioinformatik zu studieren. Hier wurde ihre neue Leidenschaft entfacht: “Ich habe mich in die theoretische Informatik verliebt, genauer gesagt, in die Entwicklung von Algorithmen.” Das Studium schloss Zweig im Jahr 2006 mit Diplom ab und promovierte im Jahr 2007 in der theoretischen Informatik.
Algorithmen sind die Grundlage aller KI. Und diese wird bereits erfolgreich zur Vorhersage des Kaufverhaltens von Menschen eingesetzt. “Der Erfolg der KI im e-Commerce-Bereich hat aber zu dem Gedanken verleitet, dass Maschinen menschliches Verhalten auch über den Wirtschaftsbereich hinaus besser vorhersehen könnten als menschliche Experten.”
Hier ist allerdings große Vorsicht geboten, warnt die Wissenschaftlerin: “Im Wirtschaftsbereich haben falsche Prognosen keine schweren Konsequenzen, in anderen Bereichen, beispielsweise bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit oder vor Gericht, kann eine falsche Prognose das Leben eines Menschen ruinieren.”
Mit dem Artificial Intelligence Act hat die Europäische Kommission einen Entwurf für ein Gesetz vorgelegt, welches den Einsatz von KI regeln soll. Der Gesetzesentwurf teilt KI-Systeme in Risikogruppen ein und regelt entsprechende Schutzmaßnahmen. Als Hochrisiko-KI-Systeme gelten etwa solche Systeme, die erhebliche Risiken für die Gesundheit und Sicherheit oder die Grundrechte von Personen bergen.
Katharina Zweig befürwortet eine starke Regulierung bezüglich kritischer KI (Europe.Table berichtete), sieht den aktuellen Entwurf jedoch teilweise als potenziellen Chancen-Killer: “Die Definition von KI ist im aktuellen Entwurf derart weit gefasst, dass sehr viele unkritische Systeme umfasst sind. Das kann hilfreiche Anwendungen verhindern. Bei der Regulierung ist also ein gutes Augenmaß erforderlich, sodass vor potenziellen Gefahren geschützt wird, die EU sich aber auch keine Chancen verbaut.” Alina Jensen
Einheit auf allen Ebenen. Mit einem Fonds von über 500 Millionen Euro will die EU kurzfristig Anreize für die EU-Länder schaffen, Rüstungsprojekte gemeinsam anzugehen. Neu ist so ein Instrument nicht, aber es erhält nun angesichts des Krieges in der Ukraine endlich die nötige Rückendeckung aus den Mitgliedstaaten, schreibt Ella Joyner.
Auch bei der Gaskrise will die EU künftig noch stärker als Einheit funktionieren. Die Mitgliedstaaten sollen nun zum Sparen “angeregt”, später notfalls sogar verpflichtet werden. Außerdem soll ein neuer unionsweiter Alarm ausgelöst werden können, wenn Versorgungsnotfälle drohen. Und das könnte passieren, wenn in wenigen Tagen kein Gas über Nord Stream in Europa ankommt. Die Signale sind da allerdings derzeit nicht so eindeutig. Manuel Berkel erklärt, warum.
Auch in Richtung China will man geschlossen auftreten. Denn die Liste der Probleme zwischen der EU und China ist lang. Nach fast zweijähriger Pause wurde jetzt zumindest der Handelsdialog wieder aufgenommen. Für Irritation sorgte dort auch die Einladung Xi Jinpings, die er angeblich europäischen Regierungschefs haben soll. Er wisse nicht, woher diese Information stamme, sagte er. Meine Kollegin Amelie Richter berichtet.
Sie wollen mehr zur aktuellen Gaskrise erfahren, direkt vom Experten? Dann möchten wir Sie noch einmal auf das Europe.Table-Webinar am kommenden Donnerstag, 21. Juli, 10 bis 11 Uhr hinweisen: Mein Kollege Manuel Berkel diskutiert mit Lion Hirth, Assistant Professor an der Hertie School, und Jens Völler, Head of Business Unit Gas Markets bei TEAM CONSULT, den Notfallplan für die Energieversorgung ohne russisches Gas. Hier können Sie sich kostenfrei registrieren.

Die EU-Kommission hat am Dienstag ein neues Instrument vorgestellt, mit dem zumindest ein Teil der benötigten Neuanschaffungen von den Mitgliedstaaten gemeinsam gekauft werden sollen. Zu diesem Zweck stehen 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt für zwei Jahre (voraussichtlich 2023/2024) zur Verfügung. Die Kommission finanziert nicht die direkten Waffenkäufe selbst, sondern soll mit dem Geld einen Anreiz bieten, wenn drei oder mehr Mitgliedstaaten gemeinsam Waffen beschaffen wollen.
“Während der Krieg an den Grenzen Europas tobt, folgen wir dem Ruf der EU-Staatschefs”, sagte der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar Thierry Breton bei der Vorstellung des Programms. Auf dem Versailler Gipfel im März beauftragten die EU-Regierungen die Kommission mit der Vorbereitung einer solchen Initiative (Europe.Table berichtete). “Es geht darum, die Vorräte wieder aufzufüllen. Wenn der Krieg lange andauert, müssen wir in der Lage sein, dies auf koordinierte Weise für eine lange Zeit zu tun”.
Es handelt sich also um ein kurzfristiges Instrument, aber laut Breton soll es auch eine längerfristige Umstrukturierung des EU-Waffenmarktes unterstützen. Die Fragmentierung des EU-Rüstungsmarktes wird seit Jahren als Problem angesehen. Die Mitgliedstaaten beschaffen den Großteil ihrer Ausrüstung im eigenen Land, was als ineffizient und teuer gilt.
Im Wesentlichen bedeutet diese Fragmentierung, dass die EU weniger für ihr Geld bekommt als beispielsweise die Vereinigten Staaten, die über eine sehr konsolidierte industrielle Basis verfügen, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in den letzten Monaten mehrfach betont hat. Außerdem gibt es Probleme mit der Interoperabilität von Verteidigungsgütern.
Der Kommission zufolge zielt die neue Initiative auch darauf ab, Verdrängungseffekte zu verhindern, also die Unfähigkeit kleinerer Mitgliedstaaten, ihren Bedarf an Verteidigungsgütern aufgrund von Nachfragespitzen zu decken. Genehmigte Projekte werden von der Kommission unterstützt und erhalten einen Zuschuss, aber die Initiative und der größte Teil des Geldes werden von den Mitgliedstaaten selbst kommen.
Breton sagte am Dienstag, die industrielle Basis der europäischen Verteidigungsproduktion sei derzeit nicht zweckmäßig. Die neue Initiative sei ein Pilotprojekt, das mit mehr Geld zu einem dauerhaften Instrument werden solle. Weitere Einzelheiten könnten noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden.
Die Kommission setzt also ein Zeichen für die Industrie: Macht euch bereit – eine groß angelegte gemeinsame Beschaffung wird kommen. “Im Moment ist die Industrie auf kleine und mittlere Bedarfsmengen eingestellt”, so Breton. Die Kommission hat die mittel- und langfristige Perspektive im Auge, und die Produktionskapazitäten sollten wachsen, sagte er.
Aus diesem Grund sei das Instrument ein “historischer Schritt” für die europäische Verteidigung, so EU-Kommissar Breton. Aber wie historisch ist er wirklich? Seit fast zwei Jahren bemühen sich die EU-Institutionen darum, dass die EU-Staaten ihre Verteidigungspolitik besser koordinieren. Die am Dienstag vorgestellte Initiative ist das erste Mal, dass die Kommission eine gemeinsame Waffenbeschaffung auf diese Weise direkt finanziert. Allerdings gibt es bereits ein ähnliches Instrument, das bisher keine nennenswerte Wirkung gezeigt hat.
Die Kommission von Präsident Jean-Claude Juncker hat den Weg für den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) geebnet, der 2019 seine Arbeit aufgenommen hat und 2021 bis 2027 acht Milliarden Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Verfügung stellen kann. Es ist zu früh, den Erfolg der EDF als Projekt zu beurteilen. Klar ist aber, dass die Jahre der Debatte und Warnungen von der Kommission kaum auf die Mitgliedstaaten gewirkt hat.
Im Jahr 2020 gaben die 27 EU-Mitgliedstaaten nach Angaben der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) fast 200 Milliarden Euro für Rüstung und Verteidigung aus. Die Mitgliedstaaten gaben insgesamt 4,1 Milliarden Euro für die Beschaffung neuer Ausrüstung in Zusammenarbeit mit anderen aus, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Im Jahr 2020 haben die Mitgliedstaaten nur 11 Prozent ihrer gesamten Ausrüstungsbeschaffungen in Zusammenarbeit mit anderen EU-Mitgliedstaaten getätigt.
“Die der EDA übermittelten Daten zeigen einen signifikanten Rückgang der europäischen Verteidigungsbeschaffung in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten seit 2016″, schrieb die Agentur im Dezember 2021. Bei dem neuen Instrument sehen Experten allerdings das Problem, dass 500 Millionen Euro einfach nicht viel Geld ist – definitiv nicht genug, um eine große Marktumstrukturierung auszulösen. Das behauptet auch Breton nicht.
Sicher ist, dass die Kommission endlich den Segen der Mitgliedstaaten hat, als wichtiger Koordinator in der Verteidigungspolitik aufzutreten, die traditionell von den nationalen Regierungen streng gehütet wird. Auch die Zusammenarbeit mit den großen Rüstungsunternehmen wird enger, was die Aktivisten nicht immer zufrieden stellt.
Wenn dieses neue Instrument zu einem Multimilliarden-Dollar-Projekt wird, wird sich die Kommission sehr gestärkt sehen. In jedem Fall würde es Jahre dauern, den fragmentierten Produktionssektor zu konsolidieren. Produktionsketten lassen sich nicht über Nacht umgestalten. Aber Geld auf den Tisch zu legen, ist ein wichtiger erster Schritt.
Der Ukraine-Krieg könnte die Mitgliedstaaten jedoch endlich dazu bewegen, genau das zu tun, was die Kommission seit Jahren fordert. Die Mitgliedstaaten haben sich bereits verpflichtet, ihre kollektiven Verteidigungsausgaben um 200 Milliarden zu erhöhen, so Breton. Fast alle wollen das fabelhafte 2-Prozent-Ziel erreichen. Die Frage ist nun, ob genug von diesem neuen Geld wirklich gemeinsam ausgegeben werden kann.
Die Kommission will in der aktuellen Energiekrise in Europa notfalls ein verpflichtendes kurzfristiges Energiesparziel für sämtliche Mitgliedstaaten. Nach einem neuen Entwurf für den Notfallplan Gas, der Europe.Table am Dienstag vorlag, will die Kommission heute vorschlagen, dass der Rat eine entsprechende Verordnung erlässt. Das Parlament müsste dem Rechtsakt nicht zustimmen, das Verfahren ließe sich so beschleunigen. Das nächste Ratstreffen der Energieminister findet bereits am kommenden Dienstag statt.
Zunächst soll nach den Kommissionsplänen ein freiwilliges Energiesparziel gelten, dessen Höhe in dem Entwurf noch mit “X” gekennzeichnet ist. Wie Bloomberg später am Abend meldete, soll die indikative Einsparung bei 15 Prozent liegen. Falls die freiwillige Minderung nicht ausreicht, soll die Kommission laut dem vorliegenden Entwurf die Kompetenz erhalten, ein verpflichtendes Energiesparziel festlegen können.
Voraussetzung ist die Ausrufung eines neuen “unionsweiten Alarms”, den mindestens zwei Mitgliedstaaten beantragen müssten, “wenn sich die Lage und die Aussichten in Bezug auf das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage negativ entwickeln und zu Notfällen führen können”. Dieser Alarm könne “jederzeit” in den kommenden Wochen oder Monaten ausgerufen werden.
Mit dem Vorschlag will die Kommission deutlich über die bisher geltende SoS-Verordnung hinausgehen. Die rechtliche Grundlage für die neue Verordnung des Rates sieht sie in Artikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der insbesondere für Versorgungsschwierigkeiten mit bestimmten Waren wie Energieträgern geschaffen wurde (Europe.Table berichtete).
In der Verordnung will die Kommission am liebsten auch eine verschärfte Aufsicht festschreiben lassen. Bewertet werden sollen die Erfolge der Mitgliedstaaten hinsichtlich Investitionen in Alternativen zu russischem Gas und Verbrauchsreduzierungen.
Die Kommission ruft die Staaten außerdem dazu auf, schon bis Ende September ihre nationalen Notfallpläne zu aktualisieren und darin Maßnahmen zur Nachfragereduzierung zu benennen. An anderer Stelle setzt sich die Kommission für eine Stärkung der kürzlich gestarteten Energieplattform ein. “Ein notwendiger nächster Schritt ist es, zur gemeinsamen Beschaffung im Rahmen der Energieplattform überzugehen, um eine stärkere Koordinierung sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zu erreichen.” Nach einem Bericht des “Spiegel” vom Wochenende kursiert in der Industrie die Sorge, Gas von der EU-Plattform nur noch zugeteilt zu bekommen, falls diese verpflichtend werden sollte.
Die Bundesregierung will Industrieunternehmen mit Auktionen zum freiwilligen Gasverzicht anreizen. Diesen Mechanismus unterstützt auch die Kommission. In dem aktuellen Papier kündigt sie nun an, zusätzlich “schnell” die Möglichkeit für EU-weite Auktionen untersuchen zu wollen.
Falls marktbasierte Mechanismen angesichts der Energiekrise in Europa aber nicht mehr ausreichen sollten, könnten für strategisch wichtige Industriezweige “neue Instrumente” entwickelt werden, um sie bei der Diversifizierung der Bezugsquellen, dem Ersatz des Energieträgers Gas und Einsparungen zu “ermutigen”.
Die Kommission bereitet sich auf alle Szenarien vor, was das Wiederanfahren von Nord Stream 1 angehe. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, dass die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline am Donnerstag nicht wieder aufgenommen würden, sagte gestern ein Sprecher. Reuters und Bloomberg berichteten gestern übereinstimmend, dass die Pipeline am Donnerstag mit verminderter Kapazität wieder in Betrieb gehen werde. Beide Agenturen beriefen sich auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Laut Bloomberg liegt die letzte Entscheidung aber beim Kreml. Die Bundesregierung wolle mindestens bis Montag mit der Bewertung warten, ob und in welchem Umfang wieder Gas durch Nord Stream fließt.
Am Dienstagnachmittag strömte stundenweise wieder etwas Gas durch die Pipeline. Der Nord-Stream-Betreiber erklärte, dass die auf der Website des Unternehmens angezeigten Gasmengen mit dem technisch erforderlichen Druckausgleich vor dem Ende der Wartungsarbeiten zusammenhängen.
Die Bundesregierung treibt derweil die Beschaffung von schwimmenden LNG-Terminals an den deutschen Küsten voran. Neben den FSRU-Schiffen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven sollen zwei weitere Standorte in Stade und Lubmin entstehen, wie das Wirtschaftsministerium gestern mitteilte.
Wilhelmshaven und Brunsbüttel sollen bereits im Winter in Betrieb gehen. Die Terminals in Stade und Lubmin sind der Regierung zufolge wohl erst Ende 2023 betriebsbereit. In Lubmin werde zudem bis Ende des Jahres ein fünftes Terminal durch ein privates Konsortium entstehen. “Wir müssen innerhalb kürzester Zeit eine neue Infrastruktur aufbauen, um russisches Gas so schnell es geht ersetzen zu können”, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. “Es ist daher eine sehr gute Nachricht, dass zusätzlich zu den vier Bundes-Schiffen jetzt noch ein fünftes privates Regasifizierungsschiff hinzukommt.”
In Lubmin will die Deutsche Regas mit der französischen TotalEnergies investieren. Lubmin ist als Standort geeignet, da dort auch die Nordstream-Leitungen aus Russland anlanden und ins Inland weiterführen.
Jedes der vier Schiffe im Bundesauftrag hat eine Kapazität von gut fünf Milliarden Kubikmeter (bcm) Gas pro Jahr. In Brunsbüttel muss allerdings noch eine Anbindungsleitung gebaut werden, sodass laut BMWK im Sommer 2023 zunächst noch verminderte Mengen eingespeist werden müssten. Die Leitungskapazitäten für Stade und Lubmin würden derzeit mit den Akteuren von Ort bestimmt. Mit rtr
Die EU-Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, hat es gestern gut zusammengefasst: “Seit dem letzten ranghohen Handelsdialog im Jahr 2020 haben sich viele Probleme angesammelt“, schrieb sie auf Twitter nach den ersten Handelsgesprächen zwischen Brüssel und Peking nach gut zwei Jahren. Das auf Eis gelegte Investitionsabkommen CAI und die Handelsblockade gegen EU-Staat Litauen sind nur zwei dieser Probleme – die Liste der Tagesordnungspunkte für das 9. Treffen des sogenannten EU-China High-Level Economic and Trade Dialogue (kurz HED) war lang.
EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis und der chinesische Vizepremier Liu He sprachen über Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine, wie die EU-Kommission nach dem Gespräch mitteilte. Die EU habe “die Bereitschaft Chinas zur Kenntnis genommen, bei der Gewährleistung der Stabilität der Weltmärkte und der Bekämpfung der weltweiten Ernährungsunsicherheit zusammenzuarbeiten, auch durch den Export von Düngemitteln”, hieß es in einer Erklärung aus Brüssel.
Außerdem habe man sich darauf verständigt, dass die Unterbrechung von Lieferketten verhindert werden müsse. Mehr Transparenz soll es bei Informationen über die Lieferungen bestimmter kritischer Rohstoffe geben (China.Table berichtete). Fortschritte gab es im Bereich der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen. Aber auch das sich verschlechternde Geschäftsumfeld in China für europäische Unternehmen, marktverzerrende Subventionen und die Rolle von Staatsunternehmen seien angesprochen worden. Ebenso der auf Litauen ausgeübte wirtschaftliche Zwang und die nächsten Schritte für eine WTO-Reform.
Menschenrechtsverletzungen oder die Lage in Xinjiang – wo einige EU-Unternehmen Werke haben – waren der offiziellen Mitteilung zufolge bei dem Gespräch kein Thema. Es scheint ein wenig, als habe Brüssel nach dem desaströsen EU-China-Gipfel im April sichergehen wollen, dass der Handelsdialog konstruktiv verläuft. Nach der zweijährigen Pause ist der Dialog aber ein gutes Zeichen, auch wenn er erneut nur als Videocall stattfinden konnte. Einen zweiten HED wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, der nächste wird erst im Jahr 2023 stattfinden. Vielleicht dann wieder persönlich.
Verwirrung gab es indes um eine Einladung europäischer Regierungschefs in die Volksrepublik: Die Tageszeitung South China Morning Post hatte über ein mutmaßliches Gesprächsangebot von Xi Jinping berichtet. Dieser habe Bundeskanzler Olaf Scholz, den französischen Staatschef Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidenten Mario Draghi und den spanischen Premier Pedro Sánchez zu einem persönlichen Treffen im November in Peking eingeladen, schrieb die SCMP unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bestätigungen oder Stellungnahmen zu dem Bericht gab es aus den vier europäischen Hauptstädten nicht. Berlin wollte Reisepläne nicht kommentieren.
Peking antwortete am Dienstag dann jedoch mit einem klaren Dementi: “Ich weiß nicht, woher die Informationen stammen”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian. Die Einladung an die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten für Xi eine Rückkehr zur persönlichen Diplomatie mit europäischen Politikern bedeutet. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hat sich kein europäischer Politiker mit dem chinesischen Staatschef bilateral direkt getroffen. Der Austausch fand immer über Video statt.
Nach Veröffentlichung des Berichts hatte es Kritik an der mutmaßlichen Einladung an Scholz, Macron, Draghi und Sánchez gegeben. Zweifel kamen auch auf, da das Gesprächsangebot für einen Zeitpunkt ausgesprochen worden sein soll, der nach dem Parteitag der KPCh im Oktober liegt. Bei diesem will sich Xi allerdings erst im Amt bestätigen lassen. Vielleicht war Peking aufgefallen, dass es für die Außenwirkung einer echten Wahl nicht sonderlich vorteilhaft ist, wenn ein vermeintlich noch um seinen Posten “bangender” Staatspräsident bereits jetzt große Einladungen ausspricht – daher der öffentliche Rückzieher.
Auch die Auswahl der Europäer kam nicht sonderlich gut an: Mit Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hätte China die größten EU-Wirtschaftspartner eingeladen. Diese würden in Peking dann dem “Partei-Kaiser” direkt nach dem Parteitag ihren Respekt zollen, kritisierte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Er mahnte an, über die Antwort zu der Einladung gut nachzudenken. Außerdem gab es Kritik am Ausschluss anderer EU-Staaten. Die mittel- und osteuropäischen Staaten seien “jahrelang als Trojanische Pferde beschuldigt” worden, schrieb der slowakische China-Analyst Matej Šimalčík auf Twitter. Der einzig moralisch akzeptable Schritt für die vier EU-Staaten sei es deshalb “höflich abzulehnen und um ein vollständiges EU27+China-Treffen zu bitten”, so Šimalčík.
Bis es zu einem hochrangigen Besuch aus Europa in China kommt, wird es noch dauern. Nicht zuletzt deshalb erhielt nun die Reise der Vizepräsidentin des Europaparlaments und deutschen FDP-Europaabgeordneten, Nicola Beer, nach Taiwan besondere Aufmerksamkeit. Beer ist ab Dienstag zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in Taipeh. Es handelt sich dabei um den ersten Besuch Beers als Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Taiwan. Am Dienstag traf die FDP-Politikerin Taiwans Ministerpräsidenten Su Tseng-chang, am Mittwoch soll ein Gespräch mit Präsidentin Tsai Ing-wen folgen. Aus Peking kam zu Beers Besuch die bereits bekannte Kritik: Die EU-Politikerin missachte das “Ein-China-Prinzip”.
Beer rief zum Auftakt ihres Besuchs dazu auf, den Inselstaat gegen China zu unterstützen. “Taiwans Blüte ist auch Europas Blüte. Wir werden Chinas Drohungen gegen Taiwan nicht ignorieren”, so Beer laut Medienberichten. Sie stellte einen direkten Bezug ihres Besuchs zur russischen Invasion in der Ukraine her. Beer sagte laut der Nachrichtenagentur AFP: “Es gibt keinen Raum für chinesische Aggression im demokratischen Taiwan. Derzeit werden wir Zeugen eines Krieges in Europa. Wir wollen nicht Zeugen eines Krieges in Asien werden.”
Taipeh soll einem Bericht zufolge im August noch weiteren Besuch erhalten, der Peking bereits jetzt erzürnt. Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere Insider berichtete, plant Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, noch im August einen Besuch in Taipeh. Die Visite ist demnach Teil einer Reise einer US-Delegation, die auch Japan, Malaysia, Singapur und dem indopazifischen Kommando der US-Streitkräfte auf Hawaii einen Besuch abstatten soll. Offiziell bestätigt wurde die Reise zunächst weder vom US-Außenministerium, noch von Taiwan. Ursprünglich war ein Besuch schon im April geplant. Er musste wegen einer Corona-Infektion Pelosis aber abgesagt werden. Schon im April hatte der chinesische Außenminister Wang Yi gesagt, ein Besuch von Pelosi auf Taiwan wäre eine “bösartige Provokation”.
Die Regierung in Frankreich lässt sich die Verstaatlichung des Versorgers EDF fast zehn Milliarden Euro kosten. Der Staat will EDF mit der Übernahme der restlichen 16 Prozent für 9,7 Milliarden Euro stabilisieren und die Energieversorgung des Landes sichern.
Das hochverschuldete Unternehmen, das Europas größter Betreiber von Atomkraftwerken ist, kämpft mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. EDF muss derzeit Strom im Ausland zu rekordhohen Preisen einkaufen, aber wegen der Preisbremse der Regierung billiger an seine Konkurrenten abgeben. Doch schon vorher waren Kernkraftwerke ungeplant ausgefallen, die Kosten für neue Atommeiler explodierten, die Fertigstellung verzögert sich.
Das Finanzministerium in Paris bietet den restlichen EDF-Aktionären zwölf Euro je Aktie, wie es am Dienstag mitteilte. Das sind zwar 53 Prozent mehr als die Aktie am 5. Juli kostete, dem Tag vor der Ankündigung der Verstaatlichungs-Pläne (Europe.Table berichtete), aber weit weniger als die 33 Euro, für die EDF 2005 an die Börse gebracht worden war.
Nach der Wiederaufnahme des Handels schossen die Papiere am Dienstag um 15 Prozent auf 11,80 Euro nach oben. Sie waren für eine Woche vom Handel ausgesetzt worden. Die Offerte soll bis September vorgelegt werden, bis Ende Oktober soll der Rückzug von der Börse laut Ministeriumskreisen vollzogen sein. Dafür braucht der Staat mindestens 90 Prozent der Anteils.
“Die Verstaatlichung ist letztlich der einzige Weg, um das Unternehmen zu retten und die Energieversorgung zu sichern”, sagte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka. “Das ist ein bitterer, aber notwendiger Schritt.” Normalerweise exportiert Frankreich um diese Jahreszeit Atomstrom, in diesem Jahr muss EDF aber in Spanien, der Schweiz, Großbritannien und Deutschland einkaufen. Im Winter werde die Lage noch angespannter, warnen Experten.
Die Ratingagentur S&P geht davon aus, dass der Schuldenberg von EDF noch in diesem Jahr über 100 Milliarden Euro steigen wird. Dabei hatte der Staat schon im Frühjahr den Großteil einer Kapitalerhöhung über drei Milliarden Euro gestemmt. Ein mit der Angelegenheit vertrauter Banker sagte, EDF werde bald weiteres frisches Geld brauchen. Die Verwerfungen auf den Energiemärkten angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine plagen viele Strom- und Gasversorger. Die deutsche Bundesregierung ringt mit dem Mehrheitseigentümer von Uniper, der staatlichen finnischen Fortum, um die Kosten für die Rettung des größten Gas-Importeurs. rtr
Nach mehrjährigem Dornröschenschlaf nimmt die europäische Erweiterungspolitik weiter an Fahrt auf. Rund vier Wochen nach dem Beschluss, der Ukraine und Moldau den Status des Beitrittskandidaten zu verleihen, hat die Europäische Union am Dienstag in Brüssel formelle Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien aufgenommen.
Ursprünglich sollten die Verhandlungen bereits vor zwei Jahren beginnen. Bulgarien hat den Start jedoch immer wieder hinausgezögert (Europe.Table berichtete). “Sie haben viel strategische Geduld bewiesen”, lobte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die eigens angereisten Staats- und Regierungschefs der Kandidatenländer, Petr Fiala und Edi Rama. Von der Leyen betonte, Nordmazedonien und Albanien hätten hart für diesen “historischen Moment” gearbeitet. Als Beispiele nannte sie Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit, den Kampf gegen Korruption und Wirtschaftsreformen. Nordmazedonien ist bereits seit 2005 Kandidat für einen EU-Beitritt, Albanien seit 2014.
Dass nun der Weg für Beitrittsverhandlungen frei ist (Europe.Table berichtete), geht auf einen Kompromissvorschlag aus Paris zurück. Dieser Vorschlag, der im Juni unter dem damaligen französischen EU-Vorsitz erarbeitet wurde, sieht vor, die Rechte der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien durch die Verfassung schützen zu lassen.
Die Verfassungsänderung könnte aber schwierig werden, weil die Regierung derzeit nicht über die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament verfügt. Die wichtigste Oppositionspartei, die rechtsnationalistische VMRO-DPMNE, läuft seit Tagen Sturm gegen den Kompromiss. Sie wirft der Regierung in Skopje “Verrat” vor.
Von der Leyen sagte, Nordmazedonien müsse sich keine Sorgen machen. Alle EU-Dokumente würden in mazedonischer Sprache ausgehandelt. Dies gelte auch für ein Abkommen mit der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, die schon bald in das Land geschickt werden soll. Außerdem könne Skopje mit mehr Investitionen und Handelserleichterungen rechnen. Auch Albanien kann nach den Worten der deutschen EU-Chefin mit Vorteilen aus den Beitrittsgesprächen rechnen. Von der Leyen versprach die rasche Aufnahme in den Zivilschutz-Mechanismus der EU, der etwa bei Waldbränden hilft. Allerdings dürfen weder Albanien noch Nordmazedonien einen schnellen EU-Beitritt erwarten.
Die Verhandlungen mit Brüssel dauern meist viele Jahre; eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Vielmehr können Kandidatenländer bei anhaltenden Problemen zurückgestuft oder Gespräche ausgesetzt werden. Als Negativ-Beispiel gilt die Türkei. Dort liegen die Gespräche seit Jahren auf Eis, ein EU-Beitritt gilt nicht mehr als realistisch.
“Alle rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Kriterien müssen vollständig erfüllt werden”, warnte der CDU-Europaabgeordnete David McAllister. Das Tempo hänge von den “individuellen Bemühungen” der Kandidaten ab. Optimistischer zeigte sich die deutsche Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne). “Damit setzen wir ein ganz klares Signal, dass die Länder des westlichen Balkans in die EU gehören”, sagte sie in Brüssel. ebo
Die Europäische Union will Russlands größte Bank und den Chef des Zink- und Kupferkonzerns UMMC auf ihre Sanktionsliste nehmen. Sie wirft der Sberbank und dem UMMC-Chef Andrej Kosizyn vor, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen, wie aus einem Reuters vorliegenden Entwurfsdokument hervorgeht.
Für die Bank hätte der Schritt weitreichende Konsequenzen: Die Behörden würden in diesem Fall das Vermögen der Bank im Westen einfrieren und alle Transaktionen mit Ausnahme von Zahlungen für Lebensmittel- und Düngerlieferungen stoppen, sagte ein EU-Insider. Die EU hat den Zugang der Sberbank zum internationalen Zahlungssystem SWIFT bereits gesperrt (Europe.Table berichtete) und damit die Geschäfte des russischen Geldhauses eingeschränkt.
Insgesamt will die EU 48 Personen und neun Gruppen neu auf die Sanktionsliste nehmen (Europe.Table berichtete) – darunter der Motorradclub “Nachtwölfe”, Schauspieler, Politiker, der stellvertretende Leiter einer russischen Sicherheitsbehörde, Familienmitglieder bereits sanktionierter Oligarchen und Mitglieder der Streitkräfte. Die geplanten Sanktionen gegen UMMC-Chef Kosizyn werden damit begründet, dass er in einem Geschäftsbereich tätig sei, der der Regierung signifikante Einnahmen generiere.
Die EU wird am Mittwoch über weiteren Sanktionen entscheiden. Sollten die Vorschläge durchgehen, würde sich die Zahl der von der EU sanktionierten Personen auf 1.229 und die Zahl der sanktionierten Unternehmen auf 110 erhöhen. rtr
Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als Premierminister und Parteichef der britischen Konservativen hat sich die Zahl der Bewerber weiter reduziert. Am Dienstag schied die Abgeordnete vom rechten Rand der Tory-Partei, Kemi Badenoch, aus.
Als beinahe schon gesetzt für die Endrunde gilt der von indischen Einwanderern abstammende Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der bei der Fraktionsabstimmung erneut mit deutlichem Abstand die meisten Stimmen erhielt. Um den zweiten Platz konkurrieren Außenministerin Liz Truss und Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt. Entscheidend dürfte sein, wer die meisten Abgeordneten hinter sich bringen kann, die zuletzt für Badenoch gestimmt hatten. Einige Beobachter rechnen mit einem Schub für Truss, die ebenfalls dem rechten Flügel der Partei zugerechnet wird.
Die verbliebenen Bewerber sollen sich am Mittwoch einer letzten Abstimmungsrunde in der Fraktion stellen. Mit dem Ergebnis wird um 17 Uhr (MESZ) gerechnet. Der oder die Letztplatzierte fliegt raus. Wer von den beiden Finalisten letztlich die Johnson-Nachfolge antritt (Europe.Table berichtete), entscheiden die Parteimitglieder in einer Stichwahl über den Sommer. Am 5. September soll das Verfahren abgeschlossen sein.
Schlechte Nachrichten für Sunak brachte das Ergebnis einer Umfrage unter Tory-Parteimitgliedern des Meinungsforschungsinstituts Yougov am Dienstag. Demnach dürfte er bei der Stichwahl unterliegen – egal, welche der beiden Frauen gegen ihn antritt. Wie viele Mitglieder die Tory-Partei derzeit hat, ist unklar. Bei der letzten Parteichef-Wahl im Jahr 2019 waren es rund 160.000 Mitglieder. dpa
Der zu Alphabet gehörende Internet-Konzern Google senkt ab sofort die Gebühren für Entwickler von Nicht-Gaming-Apps in ihrem App Store, die zu konkurrierenden Zahlungssystemen wechseln. Mit der nur für europäische Kunden geltenden Gebührensenkung von 15 auf 12 Prozent entspreche Google den neuen EU-Tech-Regeln, teilte der US-Technologieriese am Dienstag mit.
Die Senkung solle künftig auch auf Spiele-Apps ausgeweitet werden. Das EU-Regelwerk Digital Markets Act (DMA) tritt nächstes Jahr in Kraft (Europe.Table berichtete) und verlangt von den Tech-Giganten, dass sie App-Entwicklern die Nutzung konkurrierender Zahlungsplattformen für App-Verkäufe erlauben – sonst riskieren sie Geldstrafen von bis zu 10 Prozent ihres weltweiten Umsatzes. Googles Schritt setzt eine Reihe von Zugeständnissen gegenüber Behörden fort (Europe.Table berichtete), zu der auch die Beilegung eines Urheberrechtsstreits in Frankreich und eine Entschädigungszahlung in Australien gehören. rtr

Katharina Zweig, Informatikprofessorin an der Technischen Universität Kaiserslautern, möchte Künstliche-Intelligenz-Systeme besser und fairer machen. In dem von ihr geleiteten “Algorithm Accountability Lab” befasst sie sich daher mit der Frage, wie man die Qualität und Fairness von algorithmischen Entscheidungssystemen messen kann.
Neben verbesserter KI ist Wissen der beste Schutz vor folgenschweren KI-basierten Entscheidungen, ist sie überzeugt. Mit ihrem Buch “Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl” möchte Katharina Zweig Menschen befähigen, KI-Systeme und ihre Entscheidungen besser einschätzen zu können: “Jeder Mensch, der mit KI-Entscheidungen in Kontakt kommt, muss eine ungefähre Ahnung haben, was KI kann und was KI nicht kann. Für diese Personen habe ich das Buch geschrieben.”
Katharina Zweig wollte schon als Kind Wissenschaftlerin werden. Nach ihrem Abitur im Jahr 1995 schrieb sich die damals 18-Jährige für ein Biochemie-Studium an der Universität Tübingen ein: “Ich wollte den Menschen in- und auswendig kennen, vom Atom bis hin zur Psychologie.” Während des Vordiploms entschloss sich Zweig, parallel noch Bioinformatik zu studieren. Hier wurde ihre neue Leidenschaft entfacht: “Ich habe mich in die theoretische Informatik verliebt, genauer gesagt, in die Entwicklung von Algorithmen.” Das Studium schloss Zweig im Jahr 2006 mit Diplom ab und promovierte im Jahr 2007 in der theoretischen Informatik.
Algorithmen sind die Grundlage aller KI. Und diese wird bereits erfolgreich zur Vorhersage des Kaufverhaltens von Menschen eingesetzt. “Der Erfolg der KI im e-Commerce-Bereich hat aber zu dem Gedanken verleitet, dass Maschinen menschliches Verhalten auch über den Wirtschaftsbereich hinaus besser vorhersehen könnten als menschliche Experten.”
Hier ist allerdings große Vorsicht geboten, warnt die Wissenschaftlerin: “Im Wirtschaftsbereich haben falsche Prognosen keine schweren Konsequenzen, in anderen Bereichen, beispielsweise bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit oder vor Gericht, kann eine falsche Prognose das Leben eines Menschen ruinieren.”
Mit dem Artificial Intelligence Act hat die Europäische Kommission einen Entwurf für ein Gesetz vorgelegt, welches den Einsatz von KI regeln soll. Der Gesetzesentwurf teilt KI-Systeme in Risikogruppen ein und regelt entsprechende Schutzmaßnahmen. Als Hochrisiko-KI-Systeme gelten etwa solche Systeme, die erhebliche Risiken für die Gesundheit und Sicherheit oder die Grundrechte von Personen bergen.
Katharina Zweig befürwortet eine starke Regulierung bezüglich kritischer KI (Europe.Table berichtete), sieht den aktuellen Entwurf jedoch teilweise als potenziellen Chancen-Killer: “Die Definition von KI ist im aktuellen Entwurf derart weit gefasst, dass sehr viele unkritische Systeme umfasst sind. Das kann hilfreiche Anwendungen verhindern. Bei der Regulierung ist also ein gutes Augenmaß erforderlich, sodass vor potenziellen Gefahren geschützt wird, die EU sich aber auch keine Chancen verbaut.” Alina Jensen