Deutschland stand in der europäischen Diskussion um ein Öl-Embargo gegen Russland lange auf der Bremse. Nun setzt sich die Bundesregierung für neue Sanktionen ein. Grund für den Kurswechsel dürften die jüngsten Erfolge bei der Reduzierung der deutschen Energieabhängigkeit von Öl und Kohle aus Russland sein, wie aus dem “Zweiten Fortschrittsbericht Energiesicherheit” hervorgeht. Beim Gas sieht das noch anders aus. Ein neues Gesetz, dessen Ausgestaltung am Wochenende Form annahm, soll Abhilfe schaffen.
Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet. Sie bereiten europäischen Logistikern seit vielen Monaten Kopfzerbrechen, wie Christiane Kühl berichtet. Analysten nennen die Containerschiffe bereits schwimmende Lagerhäuser. Hafenbetreiber in Europa erwarten für 2022 noch mehr Durcheinander als schon 2021. Denn die Container stauen infolge der Störungen auch in Europa.
In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wurden bei einer internationalen Evakuierungsaktion mehrere Dutzend Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk Asovstal gerettet. Das russische Fernsehen erzählte eine andere Geschichte: Die Zivilisten, die gewaltsam von den “ukrainischen Nazisten” dort gefangen gehalten würden, hätten sich selbst befreit. Je länger Putins Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr Anstrengungen unternimmt die russische Propaganda. In meiner Analyse “Russische Medien: Alles inszeniert” erkläre ich, wie die mediale Manipulation funktioniert.
Heute beginnen die Berliner Energietage, eine hochrangige Fachkonferenz, die sich über die ganz Woche hinzieht. Das Europe.Table-Redaktionsteam wird ausführlich von den Energietagen berichten. Einen ersten Ausblick auf die Programmhighlights finden Sie in dieser Ausgabe, damit Sie bei 250 Programmstunden nichts Wichtiges verpassen.

Sie sind wieder da: Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet, die seit Beginn der Pandemie immer wieder die globalen Lieferketten durcheinander bringen. Am vergangenen Mittwoch lagen laut Daten von Bloomberg 230 Schiffe auf der gemeinsamen Reede vor den Häfen von Shanghai und Ningbo. Am gestrigen Donnerstag stufte die Fachwebsite Vesselfinder bereits 296 Schiffe vor Ningbo und Shanghais Häfen als “erwartet” ein. Manches wird über Shenzhen umgeleitet, sodass sich auch dort bereits wieder Schiffe stauen.
Die Häfen in Shanghai operieren in einem “Closed-Loop”-System halbwegs normal weiter, sind aber von der Stadt abgeschottet (China.Table berichtete). Der Zugang für Lastwagen ist stark eingeschränkt. Container warten dort laut Bloomberg derzeit im Durchschnitt 12 Tage in Shanghai, bevor sie per Lkw abgeholt werden. Gekühlte und gefährliche Güter werden gar nicht umgeschlagen. Umgekehrt gelangen Waren für den Export nicht in den Hafen.
Experten weisen auf den enormen Anteil Shanghais am weltweiten Warenverkehr hin. Viele besonders gefragte und wichtige Produkte werden von hier verschifft. “Die Exportgüter mit dem höchsten Wert, die via Shanghai gehen, sind Computer, Mikrochips und Halbleiter sowie Autoteile“, sagt Chris Rogers, Researcher beim digitalen Spediteur Flexport. Bei Computern und Autoteilen wickelt Shanghai jeweils gut zehn Prozent der chinesischen Exporte ab. Bei Halbleitern betrage der Anteil Shanghais sogar fast 20 Prozent. “Daher stellt der Engpass für Exporteure all dieser Waren ein ernstes Problem dar.” In den USA und Europa gebe es erste Engpässe, so Rogers zu China.Table. “Waren, die die Menschen brauchen, stecken auf Schiffen fest, die bereits als ‘schwimmende Lagerhäuser’ bezeichnet werden.” Von Asien nach Europa brauche ein Schiff heute rund 120 statt der üblichen 50 Tage.
Insgesamt gebe es weltweit eine Container-Kapazität von rund 25 Millionen Standardcontainern (TEU), erklärt Philip Oetker, Chief Commercial Officer der Reederei Hamburg Süd. Von dieser Kapazität sei ein immer geringerer Teil auch tatsächlich auf den Meeren unterwegs, so Oetker am Donnerstag auf einem von China.Table unterstützten Webinar der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in Hongkong. Im Januar 2020 waren demnach noch rund 19 Millionen Standardcontainer (TEU) auf Schiffen im aktiven Einsatz. Heute seien es nur noch 16,5 Millionen TEU, so Oetker unter Berufung auf eine Studie von McKinsey.
Zu den Gründen für das seit nunmehr über zwei Jahren anhaltenden Verkehrschaos auf See gehören neben der Corona-Pandemie auch Sondereffekte wie die Havarie der “Ever Given”. Und nun kommt noch der Krieg in der Ukraine hinzu, der Warenströme umleitet und die Kosten hochtreibt – nicht nur für Rohstoffe selbst, die nun nicht mehr aus Russland bezogen werden. Sondern nach Angaben von Axel Mattern, Geschäftsführer des Hamburger Hafens, auch für den Logistiksektor – etwa durch längere Wege und Zeiten. Kohle komme nach Hamburg zum Beispiel heute nicht mehr aus Russland, sondern aus Australien, so Mattern im AHK-Webinar.
Der Anteil der Corona-Pandemie an der Lage ist jedenfalls groß. Auf China entfallen etwa zwölf Prozent des Welthandels, sodass die durch die Null-Covid-Politik entstandenen Probleme die gesamte Welt betreffen. Diese entstehen zum Teil durch zusätzliche Effekte, wie etwa das Corona-Stimulus-Paket der USA von 2021: Dadurch explodierte dort die Nachfrage nach Waren, von denen viele aus China stammen. Aufgrund der Schiffsstaus vor China können aber die vielen in den USA angekommenen Kisten nicht wieder im gewohnten Tempo in die Volksrepublik zurück – weder leer, noch mit Exportwaren gefüllt. Die Terminals sind übervoll mit Containern, wie auch in Europa. Dort wird das Durcheinander verstärkt durch die Nähe zum Krieg in der Ukraine. Rotterdam, Hamburg, Antwerpen und drei Häfen in Großbritannien sind ausgelastet oder überlastet.
Die Häfen merken die Folgen ganz deutlich. “Container stehen bei uns derzeit um 60 Prozent länger als normalerweise“, sagt Thomas Lütje, Sales Director beim Hamburger Terminalbetreiber HHLA. “Wir haben wenig Platz, denn Terminals sind angelegt, Container umzuschlagen, nicht um sie zu lagern.” Derzeit warten laut Lütje sechs Schiffe auf einen HHLA-Anlegeplatz. “Das habe ich noch nie erlebt.”
Ein rasches Ende ist nicht in Sicht. “Wir erwarten ein größeres Durcheinander als im letzten Jahr“, sagte Jacques Vandermeiren, Geschäftsführer des Hafens von Antwerpen, mit Europas zweitgrößtem Containervolumen, kürzlich in einem Interview. “Das Durcheinander wird für das gesamte Jahr 2022 negative Auswirkungen haben, und zwar große negative Auswirkungen.”
Trotzdem veränderten sich seit Anfang 2022 die Erwartungen von Einkäufern in Übersee, wie Sunny Ho, Direktor der Spediteursvereinigung Hong Kong Shippers Council, auf dem Webinar berichtet. Die Einkäufer “sehen Covid als beinahe überstanden an. Während sie von 2020 bis 2022 Betriebsstörungen in der Logistik akzeptierten, heißt es heute: Das ist euer Problem, nicht meins.” So verlangten Einkäufer inzwischen wieder, dass der Spediteur die Kosten für die Luftfracht übernimmt, wenn das Schiff nicht pünktlich sei. “Das war vorher nicht so. Dabei leiden wir seit neun Monaten unter Störungen in Shenzhen und Hongkong, rund 400 Schiffsfahrten wurden storniert. Und es ist ja nicht nur der Lockdown selbst. Die Konsequenzen werden noch lange spürbar sein.”
Die Lage beschleunige den Trend hin zur Diversifizierung der Lieferketten, sagt Ho. “Käufer aus Übersee bitten Lieferanten in Hongkong, ihre Quellen zu diversifizieren.”
An geopolitische Risiken könne man sich nur so gut wie möglich anpassen, sagt Lütje von der HHLA. “Eines ist aber klar: Alle Logistikbetreiber sitzen dabei in einem Boot.” Dazu gehören in der Schifffahrt Speditionen, Reedereien und eben Häfen und Terminals. Man müsse in der Zukunft besser zusammenarbeiten als in früheren Zeiten, so Lütje. Die HHLA hatte erst im Oktober 35 Prozent ihres Terminals Tollerort an den Terminal-Arm der chinesischen Staatsreederei COSCO verkauft (China.Table berichtete) und setzt grundsätzlich große Hoffnungen auf den Warenverkehr mit China.
Oetker von der Hamburg Süd wünscht sich derweil mehr Aufmerksamkeit für die Logistik als vor der Pandemie. “Marketing oder Finanzen wurden für wesentlich relevanter gehalten als die Logistik. Manager sollten das komplexe Ökosystem der Logistik und auch die Gründe für Staus besser verstehen.” Lütje hofft zudem auf mehr Pufferzeiten bei den Firmen statt der bislang üblichen, eng getakteten Just-in-time-Produktion. Vielleicht finden die Logistiker nach dem Ende der aktuellen Krise ja bei ihren Kunden Gehör. Christiane Kühl
Programm Berliner Energietage
11:00-13:00 Uhr
Leopoldina, acatech, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, DECHEMA Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Perspektiven auf die Wasserstoffwirtschaft 2030
Die zweiteilige Session betrachtet aktuelle Fragen aus systemischer Perspektive: Der erste Teil der Veranstaltung fokussiert auf sich abzeichnende Wasserstoffbedarfe und Möglichkeiten, diese zu decken. Wie viel Wasserstoff Deutschland wann benötigen wird, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann und welche Infrastrukturen hierfür entstehen müssen, sind zentrale Fragen der aktuellen Debatte. Der zweite Teil wird Herausforderungen des Wasserstofftransports in den Blick nehmen: Was muss bis 2030 getan werden, um signifikante Mengen (grünen) Wasserstoffs verfügbar zu haben? Details
12:30-14:00 Uhr
GFZ, Bundesverband Geothermie Geothermie kann Wärmewende!
Die von Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelte “Roadmap Tiefe Geothermie für Deutschland” gibt neue Impulse für die Umstrukturierung des Wärmemarktes. Die Session stellt die “Roadmap Geothermie” vor und beleuchtet aktuelle Rahmenbedingungen und Projekte. Details
15:00-16:30 Uhr
Stiftung Arbeit und Umwelt Krisen-Resilienz in der Energiewende: Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung – wie kriegen wir beides hin?
Das dreiteilige Fachgespräch zum Thema “Krisen-Resilienz in der Energiewende: Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung – wie kriegen wir beides hin?” wird sich in knapp 90 Minuten den kurz-, mittel- und langfristigen Aspekten der Versorgungssicherheit widmen. Details
16:30-18:30 Uhr
Deutsche Energie-Agentur Dezentrale Wasserstoffkonzepte – Notwendiger Beitrag zur Versorgungssicherheit und Transformation des Energiesystems
Nach einer kurzen strategischen Einführung in die Welt des dezentralen Wasserstoffs, werden dem Publikum ausgewählte Kurzimpulse zu den verschiedenen Konzepten und Anwendungsbereichen präsentiert. In einer anschließenden Podiumsdiskussion soll der Beitrag dieser Konzepte zur Versorgungssicherheit und Transformation des Energiesystems diskutiert werden. Details
16:30-18:00 Uhr
Europe.Table Neue Abhängigkeiten? Rohstoffversorgung für klimafreundliche Technologien
Erneuerbare Energien sollen Deutschland und Europa aus der Abhängigkeit von Russland und anderen Lieferanten von fossilen Brennstoffen befreien – Bundesfinanzminister Christian Lindner spricht von “Freiheitsenergien”. Doch der Photovoltaik-Markt wird dominiert von China, zentrale Rohstoffe für Windkraftanlagen und Elektromobilität bezieht die EU aus China und anderen Drittstaaten. Begibt sich Europa also in neue Abhängigkeiten? Wie können EU-Kommission und Mitgliedsstaaten vermeiden, erneut erpressbar zu werden? Details
Der Jahrestag des Sieges der Alliierten über das Deutsche Reich naht. Während der Krieg in Europa in den meisten Regionen am 08. Mai beendet wurde, die bedingungslose Kapitulation erfolgte 1945 um 23 Uhr, war in Moskau zu diesem Zeitpunkt bereits der 09. Mai angebrochen. Dieser “Tag des Sieges” im “großen vaterländischen Krieg”, wie er in Russland genannt wird, ist in der russischen Gesellschaft von großer symbolischer Bedeutung. Daher vermuten westliche Experten, dass der Kreml an diesem Tag auf Teufel komm raus einen wie auch immer gearteten Erfolg in der Ukraine verkünden will.
Russlands Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren. Seit der russischen Invasion in die Ukraine senden die wichtigsten TV-Sender Erster Kanal (Pervy Kanal) und Rossia 1 fast ausschließlich Nachrichten- und Politiksendungen. Unterbrochen werden diese von einigen wenigen Unterhaltungsformaten wie “Gesund leben” oder – zumeist patriotischen – Fernsehserien und alten Filmklassikern aus der Sowjetzeit.
“Wir sehen keine Anzeichen einer Deeskalation in den russischen Medien”, sagte bei einer Veranstaltung Ruslan Deynychenko, Mitbegründer von StopFake in der Ukraine. StopFake ist eine ukrainischen Website, die Falschinformationen über die Ukraine in kremltreuen Medien aufdeckt. Wenn man die Inhalte der kremlnahen Medien analysiere, könne man trotz der Desinformation frühzeitig gewisse Entwicklungen in der Zukunft “vorhersagen”, berichtet er.
So hätten Mitarbeiter von StopFake bereits rund ein Jahr vor der Invasion festgestellt, wie russisches Fernsehen angefangen habe, die russische Öffentlichkeit auf den Krieg vorzubereiten. Dass das russische Volk derzeit auf ein Ende des Krieges eingestimmt würde, sei nicht zu beobachten, sagte Deynychenko. “Vielmehr sehen wir Indizien dafür, dass eine weitere Eskalation zu erwarten ist.”
Während die russische Propaganda in der Anfangszeit des Krieges etwa betonte, dass lediglich die militärische Infrastruktur in der Ukraine vernichtet werden soll, und die Zerstörung von zivilen Einrichtungen sowie die toten Zivilisten verschwieg, hat sich die Strategie mittlerweile verändert. Jetzt wimmelt es in den Fernsehberichten nur so von zerbombten Ruinen und Toten einerseits, und Darstellungen von vorgeblichen oder tatsächlichen Erfolgen der russischen Armee und der angeblich glücklichen Menschen in den “befreiten” Städten andererseits.
In den vergangenen Wochen arbeiteten sich die russischen Medien am Massaker an Zivilisten in Butscha ab. Jedoch mit umgekehrten Vorzeichen: Die grausamen Morde in Butscha seien lediglich eine “inszenierte Provokation des Westens“, hieß es auf allen kremltreuen Kommunikationskanälen. In zahlreichen Sendungen und Beiträgen waren sie seitdem damit beschäftigt, genau das zu “beweisen”.
Das angeblich investigative Format “Anti-Fake” ging am 9. März erstmals auf Sendung. “Der Westen unterdrückt Russland mit einem bestialischen Hass. Videos, die einen Sturm an Emotionen hervorrufen, können sich in Wirklichkeit als seelenlos und zynisch produzierte Fälschungen erweisen. Wie soll man Lüge von Wahrheit unterscheiden? Damit beschäftigen sich die Experten des Formats Anti-Fake”, lautete die Beschreibung des Programms.
“Wir stellen fest, dass russische Medien ihre eigenen Faktenchecks kreieren“, bestätigt Raimonda Miglinaite, Information and Communication Officer, East Stratcom Task Force Information Analysis and Strategic Communications Division beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS). Das trage nicht nur dazu bei, Desinformation zu verbreiten, sondern auch das Vertrauen zu untergraben und Zweifel zu säen. Doch wie funktioniert diese mediale Manipulation genau?
“Hier führen wir unseren Kampf gegen Fakes und Desinformation”, begrüßt der Moderator Alexander Smoll die Zuschauer. Die Studiogäste, die die angeblichen Fakes entlarven sollen, sind diesmal Dmitri Sidorin, ein Big Data-Unternehmer und PR-Berater, Timur Schafir, Exekutivsekretär des russischen Journalistenverbandes, sowie der Militär- und Nato-Experte Alexander Artamonow.
Es geht wieder einmal um Butscha. Im Fokus sollen “vollkommen unbeteiligte” Menschen stehen, die “grundlos” beschuldigt würden, in Butscha Zivilisten umgebracht zu haben. Ein Ausschnitt einer ukrainischen Website wird eingeblendet. Darin heißt es, dass man weitere Soldaten identifizieren konnte, die an dem Massaker beteiligt sein sollen. Einer davon sei Igor Timoschewskij, ein 29-jähriger Soldat, heißt es unter anderem auf dem Nachrichtenportal nv.ua. “Dieser Mensch sah sich daraufhin nicht nur mit Kritik, sondern auch mit Drohungen konfrontiert”, empört sich der Moderator.
Der Militärexperte Artamonow schaut sich das Foto an und “entlarvt” anhand von Parametern wie der Beschaffenheit der Landschaft und des Bodens, der sichtbaren Ausrüstung des Soldaten und Ähnlichem, dass das Foto niemals in Butscha entstanden sein könne. Die einhellige Schlussfolgerung des Moderators und seiner Gäste lautet daraufhin: Timoschweskij müsse also ein einfacher Soldat sein, der nie in der Ukraine war, und nun willkürlich an den Pranger gestellt werde.
Die wesentliche Information wird verschwiegen: Ukrainische Medien behaupteten gar nicht, das besprochene Foto sei aktuell und stamme aus Butscha. Tatsächlich steht in ukrainischen Medien unter dem veröffentlichten Foto, dass es von Timoschweskijs Profil auf dem russischen Facebook-Klon VK (kurz für V Kontakte, wortwörtlich “im Kontakt”) stamme. Der Ratschlag vom Big Data-Unternehmer und Reputationsberater Sidorin an Menschen, die sich “unschuldig” mit derlei Vorwürfen konfrontiert sähen: Sie sollten am besten das Internet “abdrehen”, aufs Land rausfahren und auf der Datscha Kartoffeln pflanzen.
Nach dieser doch unerwarteten Empfehlung geht es um Bilder, die Anfang März um die Welt gingen: Das Video zeigt, wie Ärzte verzweifelt um das Leben eines kleinen Mädchens kämpfen. Die Sechsjährige soll beim Beschuss Mariupols durch die russische Armee verletzt worden sein und kam mit einem Rettungswagen in der Notaufnahme an. Dort verstarb es.
Der Moderator von “Anti-Fake” kündigt eine Frau an, die die Mutter des Mädchens sein soll. Ob das stimmt, kann nicht verifiziert werden. Und dann passiert das, was in den russischen Medien systematisch betrieben wird: Nicht die russischen, sondern die Streitkräfte der Ukraine hätten die Autos, in denen das Mädchen und weitere Menschen saßen, beschossen, berichtet die mutmaßliche Mutter unter Tränen. Anschließend hätten diese den Krankenwagen gerufen und sie ins Krankenhaus gebracht. Dort seien schon Medien vor Ort gewesen, bereit zu drehen.
Das Urteil der russischen “Experten” steht schnell fest: Die Inszenierung sei “offensichtlich”. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Menschen mit Absicht beschossen, um anschließend die Rettungsaktion öffentlichkeitswirksam und professionell zu inszenieren und die russischen Streitkräfte zu diskreditieren. “Das sind Unmenschen”, sagt der Moderator. Während das verstörende Video ausgestrahlt wird, flimmert das Wort Fake in roter Schrift mehrfach diagonal über die Bilder.
Und wenn die angebliche Mutter schon da ist, dann soll sie doch bitte bestätigen, dass die ukrainischen Soldaten mit Absicht ihre Stützpunkte in den Wohngebieten errichten, um die Zivilisten als lebende Schutzschilde zu missbrauchen, fordert Smoll die Frau auf. Und auch die Gerüchte, dass die Menschen aus der Ukraine in Russland in Auffanglagern landen, solle sie dementieren. Der Bitte kommt die Frau wenig überraschend nach.
“In den vergangenen Jahren war die Ukraine das beliebteste Ziel der russischen Desinformation”, sagt Raimonda Miglinaite. Rund 40 Prozent der registrierten Fälle von Desinformation hätten die Ukraine betroffen. In den drei Monaten vor der russischen Invasion in die Ukraine sei allein die Häufigkeit des Wortes Nazi in Verbindung mit der Ukraine in den offiziellen russischen Medien um 290 Prozent gestiegen.
Laut Taras Shevchenko, stellvertretender ukrainischer Minister für Kultur- und Informationspolitik, ist es sogar wichtiger, Wege zu finden, die innerrussische Propaganda zu bekämpfen. “In der Ukraine und auch in der EU sind wir sensibilisiert und können uns ganz gut wehren”, sagte er. Die Desinformation und die Propaganda innerhalb Russlands seien weitaus gefährlicher, weil sie inzwischen weitgehend unwidersprochen blieben und die Basis für die Unterstützung der russischen Bevölkerung für den Krieg darstellen würden.
Nach anfänglicher Zurückhaltung unterstützt nun auch die Bundesregierung ein mögliches europäisches Öl-Embargo gegen Russland. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Wochenende von EU-Diplomaten in Brüssel. Dass ein Einfuhrstopp russischen Öls für Deutschland inzwischen auch leichter zu verkraften wäre als noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs, zeigt der “Zweite Fortschrittsbericht Energiesicherheit”, den das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium am Sonntag veröffentlichte.
Demnach hat Deutschland in den vergangenen Wochen seine Abhängigkeit vor allem von russischem Öl und russischer Kohle verringert. Die Abhängigkeit von russischem Öl ist demnach von etwa 35 Prozent im vergangenen Jahr auf inzwischen 12 Prozent gesunken. Bei Kohle sei durch Vertragsumstellungen die Abhängigkeit seit Jahresbeginn von 50 Prozent auf rund 8 Prozent gesunken. Die EU hatte ein Importverbot für russische Kohle mit einer Übergangsfrist eingeführt.
Auch beim Erdgas gab es Fortschritte. Dennoch ist der Anteil russischen Gases am deutschen Verbrauch weiter groß. Die Abhängigkeit von russischem Gas sank von zuvor 55 Prozent auf etwa 35 Prozent. Beim Gas-Problem soll ein neues Gesetz Abhilfe schaffen, dessen Ausgestaltung am Wochenende Form annahm. “All diese Schritte, die wir gehen, verlangen eine enorme gemeinsame Kraftanstrengung aller Akteure, und sie bedeuten auch Kosten, die sowohl die Wirtschaft wie auch die Verbraucher spüren“, so Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne).
In der Diskussion um ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland gelten damit nur noch Ungarn, Österreich und die Slowakei sowie Spanien, Italien und Griechenland als Bremser. Länder wie die Slowakei und Ungarn sind dabei nach Angaben von Diplomaten bislang vor allem wegen ihrer großen Abhängigkeit von russischen Öllieferungen gegen ein schnelles Einfuhrverbot. In den südeuropäischen Ländern wird unterdessen vor allem der nach einem Embargo erwartete Anstieg der Energiepreise für Verbraucher mit großer Besorgnis gesehen.
Wie es mit den Embargo-Planungen weitergeht, wird sich vermutlich bereits in den kommenden Tagen zeigen. Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen will nach dpa-Informationen so schnell wie möglich den Entwurf für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen präsentieren. Damit will man den Druck auf die Regierung in Moskau wegen des Kriegs gegen die Ukraine noch einmal erhöhen. Nach Schätzungen der Denkfabrik Bruegel hat die EU zuletzt täglich russisches Öl im Wert von etwa 450 Millionen Euro importiert.
Insbesondere in Ostdeutschland sei der Prozess, gänzlich von russischem Öl unabhängig zu werden, aber anspruchsvoll. Das betrifft vor allem die Raffinerie in Schwedt, die laut Bericht weiterhin ausschließlich russisches Rohöl bezieht. “Da sie mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft ist, ist hier eine freiwillige Beendigung der Lieferbeziehungen mit Russland nicht zu erwarten“, hieß es. Wenn man dieses Öl nicht mehr haben wolle, brauche man für Schwedt eine Alternative.
Diese Alternative könnte es sein, die Raffinerie unter staatliche Aufsicht zu stellen – wie in Fall der deutschen Gazprom-Tochter. Für diese hatte Habeck die Bundesnetzagentur als Treuhänderin eingesetzt (Europe.Table berichtete). Das allerdings geschah auf Grundlage des Außenwirtschaftsrechts und war möglich, weil die Firma von einer anderen russischen übernommen werden sollte. Habeck hatte die Treuhandverwaltung mit unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften begründet.
Im Fall von Rosneft könnte nun das Energiesicherungsgesetz die Grundlage für eine staatliche Aufsicht bilden. Auch eine Enteignung wäre möglich. Eine solche sah das Gesetz, das als Reaktion auf die Ölkrise aus dem Jahr 1975 stammt, zwar auch bisher schon vor. In der nun geplanten Novelle aber sollen die Möglichkeiten klarer gefasst werden. Im Gesetzentwurf heißt es, zur Sicherung der Energieversorgung könnten Enteignungen vorgenommen werden.
Am längsten dauert es laut Bericht, die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu beenden. Sie sei bis Mitte April auf etwa 35 Prozent gesunken. Dafür sei der Erdgasbezug aus Norwegen und den Niederlanden erhöht sowie der Import von Flüssigerdgas (LNG) “signifikant” gesteigert worden.
Ein wesentlicher Baustein: Bereits 2022 und 2023 sollen in Deutschland mehrere schwimmende Terminals für den Import von Flüssiggas (LNG) per Schiff in Betrieb genommen werden. Weitere auch landgebundene LNG-Terminals befinden sich in Planungsprozessen. Im Gespräch sind unter anderem Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, Wilhelmshaven und Stade in Niedersachsen oder Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Flüssiggas hat den Vorteil, dass es auf dem Seeweg aus verschiedenen Ländern eingeführt werden kann und nicht an die Pipelines aus Russland gebunden ist.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat im Austausch mit dem Umwelt- und dem Justizministerium eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung von LNG-Vorhaben in Norddeutschland erarbeitet und in die Ressortabstimmung gegeben, wie die dpa aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums erfuhr.
Konkret sollen Genehmigungsbehörden vorübergehend bestimmte Anforderungen, etwa bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, unter speziellen Bedingungen aussetzen dürfen. Das Gesetz soll für schwimmende und landgebundene LNG-Importterminals gelten, die schneller genehmigt und in Betrieb genommen werden sollen. Für beide Varianten ist spezielle Infrastruktur nötig, etwa müssen sie an das Erdgasleitungsnetz angeschlossen und zum Teil dafür auch Hafenanlagen angepasst werden. Im Gegensatz zu den stationären Anlagen lassen sich die schwimmenden Anlande- und Speicherplattformen, sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU), schneller installieren.
Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), kritisierte das geplante Gesetz: “Wir bewegen uns in Nordsee und Wattenmeer in extrem sensiblen Ökosystemen und im Weltnaturerbe. Statt in großer Eile über potenzielle Schäden für die Umwelt hinwegzugehen, sollten Umweltrisiken bei der Planung berücksichtigt werden.” red/dpa
Ukrainischen Unternehmen soll es ermöglicht werden, mehr Güter über die Straße in die EU zu liefern. Das geht aus dem Protokoll einer Präsentation hervor, die Henrik Hololei, Generaldirektor für Mobilität und Verkehr der EU-Kommission, vor den Abgeordneten des Verkehrsausschusses im EU-Parlament von vergangenem Donnerstag hielt. Das Thema habe man bereits mit dem ukrainischen Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov diskutiert, heißt es in dem Papier, das Europe.Table vorliegt.
Die Kommission hat den Rat laut Hololei um ein Mandat zur Aushandlung eines Abkommens über den Straßengüterverkehr mit der Ukraine und der Republik Moldau gebeten. Man sei zuversichtlich, die Verhandlungen mit beiden Partnern unverzüglich aufnehmen zu können, sodass die Abkommen bereits in den nächsten Wochen in Kraft treten, erklärte die Behörde. Dabei gehe es auch darum, ukrainische Führerscheine in der EU anzuerkennen. “Unsere Partner in der Ukraine und in Moldawien brauchen das dringend, und wir müssen unsere Kräfte bündeln und schnell und effektiv handeln. Es gibt keine andere Möglichkeit.”
Dies will die Kommission auch vor dem Hintergrund einer drohenden Lebensmittelknappheit schnellstmöglich vorantreiben. Die Ukraine produziert und exportiert unter anderem Getreide und Sonnenblumenöl. Ein Ausfall der Exporte könne laut Hololei die Ernährungssicherheit im Nahen Osten, Teilen Asiens und Afrikas beeinträchtigen. Daher wolle man Exporte aus der Ukraine über die Schiene, auf der Straße oder Binnenwasserstraßen zu den “relevanten EU-Güterkorridoren, einschließlich EU-Häfen, zur weiteren Verteilung umleiten”.
Außerdem will die Kommission für mehr Sicherheit der Transportarbeiter sorgen. Für Seeleute sei die Situation im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer nach wie vor sehr besorgniserregend, da die russische Marine “de facto eine Blockade dieses Gebiets aufrechterhält und Handelsschiffe bombardiert”. Obwohl man sich in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) darauf verständigt habe, würden die sogenannten “blauen Korridore” für die Evakuierung von Schiffen immer noch nicht umgesetzt, so Hololei. luk
Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) erschwert Indiens neutrale Haltung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. “Der Westen muss damit rechnen, dass sich Indien in einer mehr und mehr bipolaren Weltordnung keinem Lager zuordnen wird”, sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, anlässlich der deutsch-Indischen Regierungskonsultationen am Montag in Berlin.
“Im Systemwettbewerb mit China müssen Deutschland und Europa genauso wie Indien ihre internationalen Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren“, sagte Niedermark. Beide Seiten müssten in der aktuellen Lage Abhängigkeiten von Russland reduzieren. “Das gilt für europäische Energieimporte wie für die russisch-indische Militärkooperation.”
Für ein Handelsabkommen müssten Indien und die EU aufeinander zugehen. “Europäische Unternehmen erwarten ein sicheres Investitionsumfeld und niedrigere Zölle. Die Einfuhr von Komponenten für die Fertigung muss kostengünstiger werden, damit Indien als Investitionsstandort attraktiv bleibt”, sagte Niedermark.
Der Verband der Anlagen- und Maschinenbauer (VDMA) appellierte an die Bundesregierung, auf eine Wiederaufnahme der Freihandelsgespräche zwischen EU und Indien zu drängen. “Das Land ist ein großer Wachstumsmarkt in Asien und steht bisher viel zu wenig im Fokus der deutschen und europäischen Politik“, sagte der VDMA-Abteilungsleiter für Außenwirtschaft, Ulrich Ackermann, am Sonntag. Aus Sicht der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, sollten die Gespräche am Montag genutzt werden, um Indien zur Marktöffnung zu drängen. Auch sollte die Zusammenarbeit in den Bereichen Rohstoffe und Energie intensiviert werden.
Die 6. deutsch-indischen Regierungskonsultationen finden am Montag in Berlin statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich dazu mit Indiens Premierminister Narendra Modi zum bilateralen Austausch sowie zur Plenarsitzung mit Ressortvertretern. Auch ein Treffen beider mit Vertretern der Wirtschaft ist geplant.
Indien vertritt bislang eine neutrale Haltung im Ukraine-Krieg. Es hat den Angriffskrieg Russlands nicht verurteilt und trägt auch die Sanktionen nicht mit. Stattdessen kauft Indien beispielsweise mehr günstiges Öl aus Russland. Auch bei seiner militärischen Ausrüstung und bei Ersatzteilen ist Indien stark auf Moskau angewiesen. dpa
Die EU-Energieregulierungsbehörde Acer hat sich gegen eine tiefgreifende Reform der europäische Strommärkte ausgesprochen. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht kommt Acer zu dem Schluss, dass der derzeitige Aufbau der EU-Großhandelsmärkte unter normalen Bedingungen eine effiziente und sichere Stromversorgung garantiert. “Daher ist Acer der Ansicht, dass das derzeitige Marktdesign beibehalten werden sollte”, heißt es in dem Bericht. Somit lehnt Acer Forderungen von Ländern wie Spanien und Frankreich ab, den Strompreis vom Gaspreis zu lösen.
Auch wenn die derzeitige Situation an den Energiemärkten nicht normal sei, sei nicht der Aufbau des Strommarktes dafür verantwortlich, schreibt Acer. Das Strommarkt-Design habe vielmehr dazu beigetragen, Verbraucher vor Stromausfällen zu schützen. “Die derzeitige Energiekrise ist im Wesentlichen ein Gaspreis-Schock, der sich auch auf die Strompreise auswirkt.” Acer rät den EU-Staaten, das Grundproblem der Krise – den Gasmarkt – anzugehen, etwa durch zusätzliche Importe, vollere Gasspeicher und Maßnahmen, um den Gasverbrauch zu reduzieren. Zudem könnten gezielt die am meisten betroffenen Verbraucher entlastet werden.
Um in Zukunft gegen hohe Strompreise vorzugehen, müsse man den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, schreibt Acer. Länder könnten künftig auch eine sogenanntes Druckventil einführen – ein vorübergehendes Preislimit, das automatisch in Kraft tritt, wenn die Preise im Großhandel in kurzer Zeit stark ansteigen. Langfristig müsse man das europäische Stromnetz besser integrieren und ausbauen, um es für die Energiewende fit zu machen.
Länder wie Frankreich und Spanien fordern angesichts der stark angestiegenen Strompreise seit Monaten, dass das Preisbildungssystem für Strom überarbeitet werden soll. So erhoffen sie sich, dass der Strompreis weniger vom stark gestiegenen Gaspreis abhängig ist und sinkt. Der Großhandelspreis für Strom an den europäischen Märkten ist von der teuersten benötigten Energiequelle bestimmt – das ist momentan Gas. Sinkt die Nachfrage, wird der Preis wieder durch billige erneuerbare Energiequellen bestimmt, da die Gaskraftwerke abgestellt werden können. Das System soll Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien schaffen. dpa
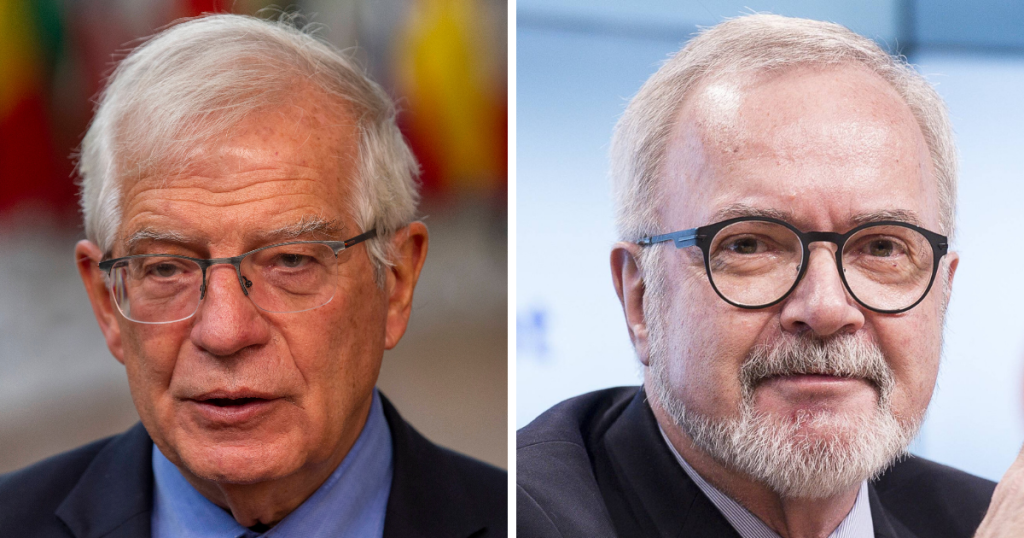
Die geopolitischen Gründe hierfür überschneiden sich mit der Notwendigkeit, die Klimakrise zu bewältigen. Der jüngste Bericht des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) über die Eindämmung des Klimawandels hebt die Dringlichkeit dieser Aufgabe hervor. Die weltweiten Treibhausgasemissionen müssen ihren Höhepunkt bis spätestens 2025 erreicht haben, wenn wir einen katastrophalen Temperaturanstieg verhindern wollen. Darüber hinaus muss die gesamtwirtschaftliche Umstellung auf saubere Energie gradlinig angegangen werden, um unvermeidlichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen Rechnung zu tragen und um einen “gerechter Übergang” zu garantieren.
Die EU und die Europäische Investitionsbank (EIB) spielen bei diesem Übergang eine entscheidende Rolle. Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und innovative Technologien wie zum Beispiel grüner Wasserstoff sind ein wichtiges Instrument, um der Aggression Russlands ein Ende zu setzen, die weltweite Ressourcenabhängigkeit zu verringern und zur Rettung des Planeten beizutragen. Jeder Euro, den wir zu Hause für die Energiewende ausgeben, ist ein Euro, den wir autoritären Mächten, die Angriffskriege führen, entziehen. Jeder Euro, der für saubere Energie ausgegeben wird, stärkt unsere Freiheit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Jeder Euro, der unseren internationalen Partnern dabei hilft, ihre eigenen Dekarbonisierungsstrategien zu beschleunigen, ist eine Investition in Resilienz und in die Bekämpfung des Klimawandels.
Seit der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar beschleunigt die Europäische Union ihre Pläne für die Energiewende, um uns schnellstmöglich von unserer Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe aus Russland zu befreien. Auch wenn dies nicht über Nacht geschehen wird, sind die Anreize dafür heute größer denn je. Wir können Energieunabhängigkeit erreichen, indem wir Effizienz dadurch verbessern, dass wir unsere Versorgung diversifizieren und mehr erneuerbare Energien nutzen. Dieser Prozess erfordert eine Mobilisierung auf allen Ebenen – von internationalen Organisationen bis hin zu Haushalten und Einzelpersonen.
Dabei sind insbesondere zwei wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Erstens darf die Suche nach alternativen Erdgaslieferanten, so wichtig sie kurzfristig auch sein mag, uns nicht in neue langfristige Abhängigkeiten bringen, die hohe Investitionen in neue Infrastrukturen für fossile Brennstoffe erfordern. Dies wäre kostspielig, katastrophal für den Planeten und angesichts der klimabewussteren Möglichkeiten letztlich unnötig. Zweitens dürfen wir nicht von einem Engpass in den nächsten stolpern und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gegen die Abhängigkeit von Materialien eintauschen, die für die grüne Transition benötigt werden und die sich stark auf eine Handvoll Länder konzentrieren, die nicht alle die gleichen Werte und Interessen wie die EU haben. Die Stärkung der strategischen Autonomie und Resilienz der EU muss ein zentrales Ziel des Übergangs bleiben.
Europa kann dies nicht alleine bewältigen. Der Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Aggression Russlands sind globale Herausforderungen, die eine globale Reaktion erfordern. Präsident Putins Krieg hat die Gründe aller Länder, ihre Importe fossiler Brennstoffe zu reduzieren und mehr in klimafreundliche Energielösungen zu investieren, verstärkt.
Deshalb engagiert sich die EU aktiv in der Klimadiplomatie. Wir wollen andere dazu ermutigen, ihre Klimaschutzziele zu erhöhen, und wir haben beträchtliche Ressourcen für die Zusammenarbeit mit Partnerländern bereitgestellt, damit auch diese Länder eine widerstandsfähige Wirtschaft mit Netto-Nullemissionen erreichen können. Im Rahmen des Europäischen Grünen Deals und der neuen EU-Initiative Global Gateway arbeiten die EU-Organe und die Mitgliedstaaten daran, bis zu 300 Mrd. EUR an nachhaltigen Investitionen für grüne und digitale Infrastrukturen zu mobilisieren, um die Klima-, Umwelt- und Energiekrise zu bewältigen.
Darüber hinaus hat die EIB zugesagt, bis 2030 Investitionen in den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit im Umfang von 1 Billion Euro zu unterstützen. Im Rahmen ihrer neuen Entwicklungssparte “EIB Global” wird die Bank mit Partnern in der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Mittel für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Stromnetze zu mobilisieren.
Als Teil der gemeinsamen Anstrengungen der EU im Rahmen von “Team Europe” reicht die Unterstützung der EIB für eine saubere Energiezukunft von Investitionen in Solarenergie in Senegal bis hin zur Finanzierung energieeffizienter Kindergärten in Armenien. Die Bank hat auch dazu beigetragen, eine “Partnerschaft für eine gerechte Energiewende” mit Südafrika aufzubauen, Mittel für die in Indien ansässige Internationale Solarallianz bereitgestellt, die die Entwicklung der Solarenergie in 105 tropischen Ländern unterstützt, und sich an einem integrierten Wassermanagement- und Hochwasserschutzprogramm in Argentinien beteiligt.
Die EU ist bereit, die globale Gemeinschaft bei der Beendigung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Die Invasion der Ukraine ist kein Grund, Investitionen in die Klimakrise zu verzögern. Im Gegenteil: Investitionen in die grüne Wirtschaft werden uns mehr strategische Autonomie verschaffen. Die Dekarbonisierung ist zu einer geopolitischen Notwendigkeit geworden. Wir rufen unsere globalen Partner, Regierungen und auch internationale Finanzinstitutionen, auf sich uns anzuschließen, um die Finanzierung sauberer Energie zu beschleunigen. Durch das Erreichen von Klimaneutralität, können wir auch Energiesicherheit bewirken.
In Kooperation mit Project Syndicate, 2022.
Deutschland stand in der europäischen Diskussion um ein Öl-Embargo gegen Russland lange auf der Bremse. Nun setzt sich die Bundesregierung für neue Sanktionen ein. Grund für den Kurswechsel dürften die jüngsten Erfolge bei der Reduzierung der deutschen Energieabhängigkeit von Öl und Kohle aus Russland sein, wie aus dem “Zweiten Fortschrittsbericht Energiesicherheit” hervorgeht. Beim Gas sieht das noch anders aus. Ein neues Gesetz, dessen Ausgestaltung am Wochenende Form annahm, soll Abhilfe schaffen.
Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet. Sie bereiten europäischen Logistikern seit vielen Monaten Kopfzerbrechen, wie Christiane Kühl berichtet. Analysten nennen die Containerschiffe bereits schwimmende Lagerhäuser. Hafenbetreiber in Europa erwarten für 2022 noch mehr Durcheinander als schon 2021. Denn die Container stauen infolge der Störungen auch in Europa.
In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wurden bei einer internationalen Evakuierungsaktion mehrere Dutzend Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk Asovstal gerettet. Das russische Fernsehen erzählte eine andere Geschichte: Die Zivilisten, die gewaltsam von den “ukrainischen Nazisten” dort gefangen gehalten würden, hätten sich selbst befreit. Je länger Putins Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr Anstrengungen unternimmt die russische Propaganda. In meiner Analyse “Russische Medien: Alles inszeniert” erkläre ich, wie die mediale Manipulation funktioniert.
Heute beginnen die Berliner Energietage, eine hochrangige Fachkonferenz, die sich über die ganz Woche hinzieht. Das Europe.Table-Redaktionsteam wird ausführlich von den Energietagen berichten. Einen ersten Ausblick auf die Programmhighlights finden Sie in dieser Ausgabe, damit Sie bei 250 Programmstunden nichts Wichtiges verpassen.

Sie sind wieder da: Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet, die seit Beginn der Pandemie immer wieder die globalen Lieferketten durcheinander bringen. Am vergangenen Mittwoch lagen laut Daten von Bloomberg 230 Schiffe auf der gemeinsamen Reede vor den Häfen von Shanghai und Ningbo. Am gestrigen Donnerstag stufte die Fachwebsite Vesselfinder bereits 296 Schiffe vor Ningbo und Shanghais Häfen als “erwartet” ein. Manches wird über Shenzhen umgeleitet, sodass sich auch dort bereits wieder Schiffe stauen.
Die Häfen in Shanghai operieren in einem “Closed-Loop”-System halbwegs normal weiter, sind aber von der Stadt abgeschottet (China.Table berichtete). Der Zugang für Lastwagen ist stark eingeschränkt. Container warten dort laut Bloomberg derzeit im Durchschnitt 12 Tage in Shanghai, bevor sie per Lkw abgeholt werden. Gekühlte und gefährliche Güter werden gar nicht umgeschlagen. Umgekehrt gelangen Waren für den Export nicht in den Hafen.
Experten weisen auf den enormen Anteil Shanghais am weltweiten Warenverkehr hin. Viele besonders gefragte und wichtige Produkte werden von hier verschifft. “Die Exportgüter mit dem höchsten Wert, die via Shanghai gehen, sind Computer, Mikrochips und Halbleiter sowie Autoteile“, sagt Chris Rogers, Researcher beim digitalen Spediteur Flexport. Bei Computern und Autoteilen wickelt Shanghai jeweils gut zehn Prozent der chinesischen Exporte ab. Bei Halbleitern betrage der Anteil Shanghais sogar fast 20 Prozent. “Daher stellt der Engpass für Exporteure all dieser Waren ein ernstes Problem dar.” In den USA und Europa gebe es erste Engpässe, so Rogers zu China.Table. “Waren, die die Menschen brauchen, stecken auf Schiffen fest, die bereits als ‘schwimmende Lagerhäuser’ bezeichnet werden.” Von Asien nach Europa brauche ein Schiff heute rund 120 statt der üblichen 50 Tage.
Insgesamt gebe es weltweit eine Container-Kapazität von rund 25 Millionen Standardcontainern (TEU), erklärt Philip Oetker, Chief Commercial Officer der Reederei Hamburg Süd. Von dieser Kapazität sei ein immer geringerer Teil auch tatsächlich auf den Meeren unterwegs, so Oetker am Donnerstag auf einem von China.Table unterstützten Webinar der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in Hongkong. Im Januar 2020 waren demnach noch rund 19 Millionen Standardcontainer (TEU) auf Schiffen im aktiven Einsatz. Heute seien es nur noch 16,5 Millionen TEU, so Oetker unter Berufung auf eine Studie von McKinsey.
Zu den Gründen für das seit nunmehr über zwei Jahren anhaltenden Verkehrschaos auf See gehören neben der Corona-Pandemie auch Sondereffekte wie die Havarie der “Ever Given”. Und nun kommt noch der Krieg in der Ukraine hinzu, der Warenströme umleitet und die Kosten hochtreibt – nicht nur für Rohstoffe selbst, die nun nicht mehr aus Russland bezogen werden. Sondern nach Angaben von Axel Mattern, Geschäftsführer des Hamburger Hafens, auch für den Logistiksektor – etwa durch längere Wege und Zeiten. Kohle komme nach Hamburg zum Beispiel heute nicht mehr aus Russland, sondern aus Australien, so Mattern im AHK-Webinar.
Der Anteil der Corona-Pandemie an der Lage ist jedenfalls groß. Auf China entfallen etwa zwölf Prozent des Welthandels, sodass die durch die Null-Covid-Politik entstandenen Probleme die gesamte Welt betreffen. Diese entstehen zum Teil durch zusätzliche Effekte, wie etwa das Corona-Stimulus-Paket der USA von 2021: Dadurch explodierte dort die Nachfrage nach Waren, von denen viele aus China stammen. Aufgrund der Schiffsstaus vor China können aber die vielen in den USA angekommenen Kisten nicht wieder im gewohnten Tempo in die Volksrepublik zurück – weder leer, noch mit Exportwaren gefüllt. Die Terminals sind übervoll mit Containern, wie auch in Europa. Dort wird das Durcheinander verstärkt durch die Nähe zum Krieg in der Ukraine. Rotterdam, Hamburg, Antwerpen und drei Häfen in Großbritannien sind ausgelastet oder überlastet.
Die Häfen merken die Folgen ganz deutlich. “Container stehen bei uns derzeit um 60 Prozent länger als normalerweise“, sagt Thomas Lütje, Sales Director beim Hamburger Terminalbetreiber HHLA. “Wir haben wenig Platz, denn Terminals sind angelegt, Container umzuschlagen, nicht um sie zu lagern.” Derzeit warten laut Lütje sechs Schiffe auf einen HHLA-Anlegeplatz. “Das habe ich noch nie erlebt.”
Ein rasches Ende ist nicht in Sicht. “Wir erwarten ein größeres Durcheinander als im letzten Jahr“, sagte Jacques Vandermeiren, Geschäftsführer des Hafens von Antwerpen, mit Europas zweitgrößtem Containervolumen, kürzlich in einem Interview. “Das Durcheinander wird für das gesamte Jahr 2022 negative Auswirkungen haben, und zwar große negative Auswirkungen.”
Trotzdem veränderten sich seit Anfang 2022 die Erwartungen von Einkäufern in Übersee, wie Sunny Ho, Direktor der Spediteursvereinigung Hong Kong Shippers Council, auf dem Webinar berichtet. Die Einkäufer “sehen Covid als beinahe überstanden an. Während sie von 2020 bis 2022 Betriebsstörungen in der Logistik akzeptierten, heißt es heute: Das ist euer Problem, nicht meins.” So verlangten Einkäufer inzwischen wieder, dass der Spediteur die Kosten für die Luftfracht übernimmt, wenn das Schiff nicht pünktlich sei. “Das war vorher nicht so. Dabei leiden wir seit neun Monaten unter Störungen in Shenzhen und Hongkong, rund 400 Schiffsfahrten wurden storniert. Und es ist ja nicht nur der Lockdown selbst. Die Konsequenzen werden noch lange spürbar sein.”
Die Lage beschleunige den Trend hin zur Diversifizierung der Lieferketten, sagt Ho. “Käufer aus Übersee bitten Lieferanten in Hongkong, ihre Quellen zu diversifizieren.”
An geopolitische Risiken könne man sich nur so gut wie möglich anpassen, sagt Lütje von der HHLA. “Eines ist aber klar: Alle Logistikbetreiber sitzen dabei in einem Boot.” Dazu gehören in der Schifffahrt Speditionen, Reedereien und eben Häfen und Terminals. Man müsse in der Zukunft besser zusammenarbeiten als in früheren Zeiten, so Lütje. Die HHLA hatte erst im Oktober 35 Prozent ihres Terminals Tollerort an den Terminal-Arm der chinesischen Staatsreederei COSCO verkauft (China.Table berichtete) und setzt grundsätzlich große Hoffnungen auf den Warenverkehr mit China.
Oetker von der Hamburg Süd wünscht sich derweil mehr Aufmerksamkeit für die Logistik als vor der Pandemie. “Marketing oder Finanzen wurden für wesentlich relevanter gehalten als die Logistik. Manager sollten das komplexe Ökosystem der Logistik und auch die Gründe für Staus besser verstehen.” Lütje hofft zudem auf mehr Pufferzeiten bei den Firmen statt der bislang üblichen, eng getakteten Just-in-time-Produktion. Vielleicht finden die Logistiker nach dem Ende der aktuellen Krise ja bei ihren Kunden Gehör. Christiane Kühl
Programm Berliner Energietage
11:00-13:00 Uhr
Leopoldina, acatech, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, DECHEMA Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Perspektiven auf die Wasserstoffwirtschaft 2030
Die zweiteilige Session betrachtet aktuelle Fragen aus systemischer Perspektive: Der erste Teil der Veranstaltung fokussiert auf sich abzeichnende Wasserstoffbedarfe und Möglichkeiten, diese zu decken. Wie viel Wasserstoff Deutschland wann benötigen wird, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann und welche Infrastrukturen hierfür entstehen müssen, sind zentrale Fragen der aktuellen Debatte. Der zweite Teil wird Herausforderungen des Wasserstofftransports in den Blick nehmen: Was muss bis 2030 getan werden, um signifikante Mengen (grünen) Wasserstoffs verfügbar zu haben? Details
12:30-14:00 Uhr
GFZ, Bundesverband Geothermie Geothermie kann Wärmewende!
Die von Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelte “Roadmap Tiefe Geothermie für Deutschland” gibt neue Impulse für die Umstrukturierung des Wärmemarktes. Die Session stellt die “Roadmap Geothermie” vor und beleuchtet aktuelle Rahmenbedingungen und Projekte. Details
15:00-16:30 Uhr
Stiftung Arbeit und Umwelt Krisen-Resilienz in der Energiewende: Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung – wie kriegen wir beides hin?
Das dreiteilige Fachgespräch zum Thema “Krisen-Resilienz in der Energiewende: Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung – wie kriegen wir beides hin?” wird sich in knapp 90 Minuten den kurz-, mittel- und langfristigen Aspekten der Versorgungssicherheit widmen. Details
16:30-18:30 Uhr
Deutsche Energie-Agentur Dezentrale Wasserstoffkonzepte – Notwendiger Beitrag zur Versorgungssicherheit und Transformation des Energiesystems
Nach einer kurzen strategischen Einführung in die Welt des dezentralen Wasserstoffs, werden dem Publikum ausgewählte Kurzimpulse zu den verschiedenen Konzepten und Anwendungsbereichen präsentiert. In einer anschließenden Podiumsdiskussion soll der Beitrag dieser Konzepte zur Versorgungssicherheit und Transformation des Energiesystems diskutiert werden. Details
16:30-18:00 Uhr
Europe.Table Neue Abhängigkeiten? Rohstoffversorgung für klimafreundliche Technologien
Erneuerbare Energien sollen Deutschland und Europa aus der Abhängigkeit von Russland und anderen Lieferanten von fossilen Brennstoffen befreien – Bundesfinanzminister Christian Lindner spricht von “Freiheitsenergien”. Doch der Photovoltaik-Markt wird dominiert von China, zentrale Rohstoffe für Windkraftanlagen und Elektromobilität bezieht die EU aus China und anderen Drittstaaten. Begibt sich Europa also in neue Abhängigkeiten? Wie können EU-Kommission und Mitgliedsstaaten vermeiden, erneut erpressbar zu werden? Details
Der Jahrestag des Sieges der Alliierten über das Deutsche Reich naht. Während der Krieg in Europa in den meisten Regionen am 08. Mai beendet wurde, die bedingungslose Kapitulation erfolgte 1945 um 23 Uhr, war in Moskau zu diesem Zeitpunkt bereits der 09. Mai angebrochen. Dieser “Tag des Sieges” im “großen vaterländischen Krieg”, wie er in Russland genannt wird, ist in der russischen Gesellschaft von großer symbolischer Bedeutung. Daher vermuten westliche Experten, dass der Kreml an diesem Tag auf Teufel komm raus einen wie auch immer gearteten Erfolg in der Ukraine verkünden will.
Russlands Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren. Seit der russischen Invasion in die Ukraine senden die wichtigsten TV-Sender Erster Kanal (Pervy Kanal) und Rossia 1 fast ausschließlich Nachrichten- und Politiksendungen. Unterbrochen werden diese von einigen wenigen Unterhaltungsformaten wie “Gesund leben” oder – zumeist patriotischen – Fernsehserien und alten Filmklassikern aus der Sowjetzeit.
“Wir sehen keine Anzeichen einer Deeskalation in den russischen Medien”, sagte bei einer Veranstaltung Ruslan Deynychenko, Mitbegründer von StopFake in der Ukraine. StopFake ist eine ukrainischen Website, die Falschinformationen über die Ukraine in kremltreuen Medien aufdeckt. Wenn man die Inhalte der kremlnahen Medien analysiere, könne man trotz der Desinformation frühzeitig gewisse Entwicklungen in der Zukunft “vorhersagen”, berichtet er.
So hätten Mitarbeiter von StopFake bereits rund ein Jahr vor der Invasion festgestellt, wie russisches Fernsehen angefangen habe, die russische Öffentlichkeit auf den Krieg vorzubereiten. Dass das russische Volk derzeit auf ein Ende des Krieges eingestimmt würde, sei nicht zu beobachten, sagte Deynychenko. “Vielmehr sehen wir Indizien dafür, dass eine weitere Eskalation zu erwarten ist.”
Während die russische Propaganda in der Anfangszeit des Krieges etwa betonte, dass lediglich die militärische Infrastruktur in der Ukraine vernichtet werden soll, und die Zerstörung von zivilen Einrichtungen sowie die toten Zivilisten verschwieg, hat sich die Strategie mittlerweile verändert. Jetzt wimmelt es in den Fernsehberichten nur so von zerbombten Ruinen und Toten einerseits, und Darstellungen von vorgeblichen oder tatsächlichen Erfolgen der russischen Armee und der angeblich glücklichen Menschen in den “befreiten” Städten andererseits.
In den vergangenen Wochen arbeiteten sich die russischen Medien am Massaker an Zivilisten in Butscha ab. Jedoch mit umgekehrten Vorzeichen: Die grausamen Morde in Butscha seien lediglich eine “inszenierte Provokation des Westens“, hieß es auf allen kremltreuen Kommunikationskanälen. In zahlreichen Sendungen und Beiträgen waren sie seitdem damit beschäftigt, genau das zu “beweisen”.
Das angeblich investigative Format “Anti-Fake” ging am 9. März erstmals auf Sendung. “Der Westen unterdrückt Russland mit einem bestialischen Hass. Videos, die einen Sturm an Emotionen hervorrufen, können sich in Wirklichkeit als seelenlos und zynisch produzierte Fälschungen erweisen. Wie soll man Lüge von Wahrheit unterscheiden? Damit beschäftigen sich die Experten des Formats Anti-Fake”, lautete die Beschreibung des Programms.
“Wir stellen fest, dass russische Medien ihre eigenen Faktenchecks kreieren“, bestätigt Raimonda Miglinaite, Information and Communication Officer, East Stratcom Task Force Information Analysis and Strategic Communications Division beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS). Das trage nicht nur dazu bei, Desinformation zu verbreiten, sondern auch das Vertrauen zu untergraben und Zweifel zu säen. Doch wie funktioniert diese mediale Manipulation genau?
“Hier führen wir unseren Kampf gegen Fakes und Desinformation”, begrüßt der Moderator Alexander Smoll die Zuschauer. Die Studiogäste, die die angeblichen Fakes entlarven sollen, sind diesmal Dmitri Sidorin, ein Big Data-Unternehmer und PR-Berater, Timur Schafir, Exekutivsekretär des russischen Journalistenverbandes, sowie der Militär- und Nato-Experte Alexander Artamonow.
Es geht wieder einmal um Butscha. Im Fokus sollen “vollkommen unbeteiligte” Menschen stehen, die “grundlos” beschuldigt würden, in Butscha Zivilisten umgebracht zu haben. Ein Ausschnitt einer ukrainischen Website wird eingeblendet. Darin heißt es, dass man weitere Soldaten identifizieren konnte, die an dem Massaker beteiligt sein sollen. Einer davon sei Igor Timoschewskij, ein 29-jähriger Soldat, heißt es unter anderem auf dem Nachrichtenportal nv.ua. “Dieser Mensch sah sich daraufhin nicht nur mit Kritik, sondern auch mit Drohungen konfrontiert”, empört sich der Moderator.
Der Militärexperte Artamonow schaut sich das Foto an und “entlarvt” anhand von Parametern wie der Beschaffenheit der Landschaft und des Bodens, der sichtbaren Ausrüstung des Soldaten und Ähnlichem, dass das Foto niemals in Butscha entstanden sein könne. Die einhellige Schlussfolgerung des Moderators und seiner Gäste lautet daraufhin: Timoschweskij müsse also ein einfacher Soldat sein, der nie in der Ukraine war, und nun willkürlich an den Pranger gestellt werde.
Die wesentliche Information wird verschwiegen: Ukrainische Medien behaupteten gar nicht, das besprochene Foto sei aktuell und stamme aus Butscha. Tatsächlich steht in ukrainischen Medien unter dem veröffentlichten Foto, dass es von Timoschweskijs Profil auf dem russischen Facebook-Klon VK (kurz für V Kontakte, wortwörtlich “im Kontakt”) stamme. Der Ratschlag vom Big Data-Unternehmer und Reputationsberater Sidorin an Menschen, die sich “unschuldig” mit derlei Vorwürfen konfrontiert sähen: Sie sollten am besten das Internet “abdrehen”, aufs Land rausfahren und auf der Datscha Kartoffeln pflanzen.
Nach dieser doch unerwarteten Empfehlung geht es um Bilder, die Anfang März um die Welt gingen: Das Video zeigt, wie Ärzte verzweifelt um das Leben eines kleinen Mädchens kämpfen. Die Sechsjährige soll beim Beschuss Mariupols durch die russische Armee verletzt worden sein und kam mit einem Rettungswagen in der Notaufnahme an. Dort verstarb es.
Der Moderator von “Anti-Fake” kündigt eine Frau an, die die Mutter des Mädchens sein soll. Ob das stimmt, kann nicht verifiziert werden. Und dann passiert das, was in den russischen Medien systematisch betrieben wird: Nicht die russischen, sondern die Streitkräfte der Ukraine hätten die Autos, in denen das Mädchen und weitere Menschen saßen, beschossen, berichtet die mutmaßliche Mutter unter Tränen. Anschließend hätten diese den Krankenwagen gerufen und sie ins Krankenhaus gebracht. Dort seien schon Medien vor Ort gewesen, bereit zu drehen.
Das Urteil der russischen “Experten” steht schnell fest: Die Inszenierung sei “offensichtlich”. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Menschen mit Absicht beschossen, um anschließend die Rettungsaktion öffentlichkeitswirksam und professionell zu inszenieren und die russischen Streitkräfte zu diskreditieren. “Das sind Unmenschen”, sagt der Moderator. Während das verstörende Video ausgestrahlt wird, flimmert das Wort Fake in roter Schrift mehrfach diagonal über die Bilder.
Und wenn die angebliche Mutter schon da ist, dann soll sie doch bitte bestätigen, dass die ukrainischen Soldaten mit Absicht ihre Stützpunkte in den Wohngebieten errichten, um die Zivilisten als lebende Schutzschilde zu missbrauchen, fordert Smoll die Frau auf. Und auch die Gerüchte, dass die Menschen aus der Ukraine in Russland in Auffanglagern landen, solle sie dementieren. Der Bitte kommt die Frau wenig überraschend nach.
“In den vergangenen Jahren war die Ukraine das beliebteste Ziel der russischen Desinformation”, sagt Raimonda Miglinaite. Rund 40 Prozent der registrierten Fälle von Desinformation hätten die Ukraine betroffen. In den drei Monaten vor der russischen Invasion in die Ukraine sei allein die Häufigkeit des Wortes Nazi in Verbindung mit der Ukraine in den offiziellen russischen Medien um 290 Prozent gestiegen.
Laut Taras Shevchenko, stellvertretender ukrainischer Minister für Kultur- und Informationspolitik, ist es sogar wichtiger, Wege zu finden, die innerrussische Propaganda zu bekämpfen. “In der Ukraine und auch in der EU sind wir sensibilisiert und können uns ganz gut wehren”, sagte er. Die Desinformation und die Propaganda innerhalb Russlands seien weitaus gefährlicher, weil sie inzwischen weitgehend unwidersprochen blieben und die Basis für die Unterstützung der russischen Bevölkerung für den Krieg darstellen würden.
Nach anfänglicher Zurückhaltung unterstützt nun auch die Bundesregierung ein mögliches europäisches Öl-Embargo gegen Russland. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Wochenende von EU-Diplomaten in Brüssel. Dass ein Einfuhrstopp russischen Öls für Deutschland inzwischen auch leichter zu verkraften wäre als noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs, zeigt der “Zweite Fortschrittsbericht Energiesicherheit”, den das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium am Sonntag veröffentlichte.
Demnach hat Deutschland in den vergangenen Wochen seine Abhängigkeit vor allem von russischem Öl und russischer Kohle verringert. Die Abhängigkeit von russischem Öl ist demnach von etwa 35 Prozent im vergangenen Jahr auf inzwischen 12 Prozent gesunken. Bei Kohle sei durch Vertragsumstellungen die Abhängigkeit seit Jahresbeginn von 50 Prozent auf rund 8 Prozent gesunken. Die EU hatte ein Importverbot für russische Kohle mit einer Übergangsfrist eingeführt.
Auch beim Erdgas gab es Fortschritte. Dennoch ist der Anteil russischen Gases am deutschen Verbrauch weiter groß. Die Abhängigkeit von russischem Gas sank von zuvor 55 Prozent auf etwa 35 Prozent. Beim Gas-Problem soll ein neues Gesetz Abhilfe schaffen, dessen Ausgestaltung am Wochenende Form annahm. “All diese Schritte, die wir gehen, verlangen eine enorme gemeinsame Kraftanstrengung aller Akteure, und sie bedeuten auch Kosten, die sowohl die Wirtschaft wie auch die Verbraucher spüren“, so Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne).
In der Diskussion um ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland gelten damit nur noch Ungarn, Österreich und die Slowakei sowie Spanien, Italien und Griechenland als Bremser. Länder wie die Slowakei und Ungarn sind dabei nach Angaben von Diplomaten bislang vor allem wegen ihrer großen Abhängigkeit von russischen Öllieferungen gegen ein schnelles Einfuhrverbot. In den südeuropäischen Ländern wird unterdessen vor allem der nach einem Embargo erwartete Anstieg der Energiepreise für Verbraucher mit großer Besorgnis gesehen.
Wie es mit den Embargo-Planungen weitergeht, wird sich vermutlich bereits in den kommenden Tagen zeigen. Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen will nach dpa-Informationen so schnell wie möglich den Entwurf für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen präsentieren. Damit will man den Druck auf die Regierung in Moskau wegen des Kriegs gegen die Ukraine noch einmal erhöhen. Nach Schätzungen der Denkfabrik Bruegel hat die EU zuletzt täglich russisches Öl im Wert von etwa 450 Millionen Euro importiert.
Insbesondere in Ostdeutschland sei der Prozess, gänzlich von russischem Öl unabhängig zu werden, aber anspruchsvoll. Das betrifft vor allem die Raffinerie in Schwedt, die laut Bericht weiterhin ausschließlich russisches Rohöl bezieht. “Da sie mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft ist, ist hier eine freiwillige Beendigung der Lieferbeziehungen mit Russland nicht zu erwarten“, hieß es. Wenn man dieses Öl nicht mehr haben wolle, brauche man für Schwedt eine Alternative.
Diese Alternative könnte es sein, die Raffinerie unter staatliche Aufsicht zu stellen – wie in Fall der deutschen Gazprom-Tochter. Für diese hatte Habeck die Bundesnetzagentur als Treuhänderin eingesetzt (Europe.Table berichtete). Das allerdings geschah auf Grundlage des Außenwirtschaftsrechts und war möglich, weil die Firma von einer anderen russischen übernommen werden sollte. Habeck hatte die Treuhandverwaltung mit unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften begründet.
Im Fall von Rosneft könnte nun das Energiesicherungsgesetz die Grundlage für eine staatliche Aufsicht bilden. Auch eine Enteignung wäre möglich. Eine solche sah das Gesetz, das als Reaktion auf die Ölkrise aus dem Jahr 1975 stammt, zwar auch bisher schon vor. In der nun geplanten Novelle aber sollen die Möglichkeiten klarer gefasst werden. Im Gesetzentwurf heißt es, zur Sicherung der Energieversorgung könnten Enteignungen vorgenommen werden.
Am längsten dauert es laut Bericht, die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu beenden. Sie sei bis Mitte April auf etwa 35 Prozent gesunken. Dafür sei der Erdgasbezug aus Norwegen und den Niederlanden erhöht sowie der Import von Flüssigerdgas (LNG) “signifikant” gesteigert worden.
Ein wesentlicher Baustein: Bereits 2022 und 2023 sollen in Deutschland mehrere schwimmende Terminals für den Import von Flüssiggas (LNG) per Schiff in Betrieb genommen werden. Weitere auch landgebundene LNG-Terminals befinden sich in Planungsprozessen. Im Gespräch sind unter anderem Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, Wilhelmshaven und Stade in Niedersachsen oder Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Flüssiggas hat den Vorteil, dass es auf dem Seeweg aus verschiedenen Ländern eingeführt werden kann und nicht an die Pipelines aus Russland gebunden ist.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat im Austausch mit dem Umwelt- und dem Justizministerium eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung von LNG-Vorhaben in Norddeutschland erarbeitet und in die Ressortabstimmung gegeben, wie die dpa aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums erfuhr.
Konkret sollen Genehmigungsbehörden vorübergehend bestimmte Anforderungen, etwa bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, unter speziellen Bedingungen aussetzen dürfen. Das Gesetz soll für schwimmende und landgebundene LNG-Importterminals gelten, die schneller genehmigt und in Betrieb genommen werden sollen. Für beide Varianten ist spezielle Infrastruktur nötig, etwa müssen sie an das Erdgasleitungsnetz angeschlossen und zum Teil dafür auch Hafenanlagen angepasst werden. Im Gegensatz zu den stationären Anlagen lassen sich die schwimmenden Anlande- und Speicherplattformen, sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU), schneller installieren.
Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), kritisierte das geplante Gesetz: “Wir bewegen uns in Nordsee und Wattenmeer in extrem sensiblen Ökosystemen und im Weltnaturerbe. Statt in großer Eile über potenzielle Schäden für die Umwelt hinwegzugehen, sollten Umweltrisiken bei der Planung berücksichtigt werden.” red/dpa
Ukrainischen Unternehmen soll es ermöglicht werden, mehr Güter über die Straße in die EU zu liefern. Das geht aus dem Protokoll einer Präsentation hervor, die Henrik Hololei, Generaldirektor für Mobilität und Verkehr der EU-Kommission, vor den Abgeordneten des Verkehrsausschusses im EU-Parlament von vergangenem Donnerstag hielt. Das Thema habe man bereits mit dem ukrainischen Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov diskutiert, heißt es in dem Papier, das Europe.Table vorliegt.
Die Kommission hat den Rat laut Hololei um ein Mandat zur Aushandlung eines Abkommens über den Straßengüterverkehr mit der Ukraine und der Republik Moldau gebeten. Man sei zuversichtlich, die Verhandlungen mit beiden Partnern unverzüglich aufnehmen zu können, sodass die Abkommen bereits in den nächsten Wochen in Kraft treten, erklärte die Behörde. Dabei gehe es auch darum, ukrainische Führerscheine in der EU anzuerkennen. “Unsere Partner in der Ukraine und in Moldawien brauchen das dringend, und wir müssen unsere Kräfte bündeln und schnell und effektiv handeln. Es gibt keine andere Möglichkeit.”
Dies will die Kommission auch vor dem Hintergrund einer drohenden Lebensmittelknappheit schnellstmöglich vorantreiben. Die Ukraine produziert und exportiert unter anderem Getreide und Sonnenblumenöl. Ein Ausfall der Exporte könne laut Hololei die Ernährungssicherheit im Nahen Osten, Teilen Asiens und Afrikas beeinträchtigen. Daher wolle man Exporte aus der Ukraine über die Schiene, auf der Straße oder Binnenwasserstraßen zu den “relevanten EU-Güterkorridoren, einschließlich EU-Häfen, zur weiteren Verteilung umleiten”.
Außerdem will die Kommission für mehr Sicherheit der Transportarbeiter sorgen. Für Seeleute sei die Situation im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer nach wie vor sehr besorgniserregend, da die russische Marine “de facto eine Blockade dieses Gebiets aufrechterhält und Handelsschiffe bombardiert”. Obwohl man sich in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) darauf verständigt habe, würden die sogenannten “blauen Korridore” für die Evakuierung von Schiffen immer noch nicht umgesetzt, so Hololei. luk
Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) erschwert Indiens neutrale Haltung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. “Der Westen muss damit rechnen, dass sich Indien in einer mehr und mehr bipolaren Weltordnung keinem Lager zuordnen wird”, sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, anlässlich der deutsch-Indischen Regierungskonsultationen am Montag in Berlin.
“Im Systemwettbewerb mit China müssen Deutschland und Europa genauso wie Indien ihre internationalen Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren“, sagte Niedermark. Beide Seiten müssten in der aktuellen Lage Abhängigkeiten von Russland reduzieren. “Das gilt für europäische Energieimporte wie für die russisch-indische Militärkooperation.”
Für ein Handelsabkommen müssten Indien und die EU aufeinander zugehen. “Europäische Unternehmen erwarten ein sicheres Investitionsumfeld und niedrigere Zölle. Die Einfuhr von Komponenten für die Fertigung muss kostengünstiger werden, damit Indien als Investitionsstandort attraktiv bleibt”, sagte Niedermark.
Der Verband der Anlagen- und Maschinenbauer (VDMA) appellierte an die Bundesregierung, auf eine Wiederaufnahme der Freihandelsgespräche zwischen EU und Indien zu drängen. “Das Land ist ein großer Wachstumsmarkt in Asien und steht bisher viel zu wenig im Fokus der deutschen und europäischen Politik“, sagte der VDMA-Abteilungsleiter für Außenwirtschaft, Ulrich Ackermann, am Sonntag. Aus Sicht der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, sollten die Gespräche am Montag genutzt werden, um Indien zur Marktöffnung zu drängen. Auch sollte die Zusammenarbeit in den Bereichen Rohstoffe und Energie intensiviert werden.
Die 6. deutsch-indischen Regierungskonsultationen finden am Montag in Berlin statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich dazu mit Indiens Premierminister Narendra Modi zum bilateralen Austausch sowie zur Plenarsitzung mit Ressortvertretern. Auch ein Treffen beider mit Vertretern der Wirtschaft ist geplant.
Indien vertritt bislang eine neutrale Haltung im Ukraine-Krieg. Es hat den Angriffskrieg Russlands nicht verurteilt und trägt auch die Sanktionen nicht mit. Stattdessen kauft Indien beispielsweise mehr günstiges Öl aus Russland. Auch bei seiner militärischen Ausrüstung und bei Ersatzteilen ist Indien stark auf Moskau angewiesen. dpa
Die EU-Energieregulierungsbehörde Acer hat sich gegen eine tiefgreifende Reform der europäische Strommärkte ausgesprochen. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht kommt Acer zu dem Schluss, dass der derzeitige Aufbau der EU-Großhandelsmärkte unter normalen Bedingungen eine effiziente und sichere Stromversorgung garantiert. “Daher ist Acer der Ansicht, dass das derzeitige Marktdesign beibehalten werden sollte”, heißt es in dem Bericht. Somit lehnt Acer Forderungen von Ländern wie Spanien und Frankreich ab, den Strompreis vom Gaspreis zu lösen.
Auch wenn die derzeitige Situation an den Energiemärkten nicht normal sei, sei nicht der Aufbau des Strommarktes dafür verantwortlich, schreibt Acer. Das Strommarkt-Design habe vielmehr dazu beigetragen, Verbraucher vor Stromausfällen zu schützen. “Die derzeitige Energiekrise ist im Wesentlichen ein Gaspreis-Schock, der sich auch auf die Strompreise auswirkt.” Acer rät den EU-Staaten, das Grundproblem der Krise – den Gasmarkt – anzugehen, etwa durch zusätzliche Importe, vollere Gasspeicher und Maßnahmen, um den Gasverbrauch zu reduzieren. Zudem könnten gezielt die am meisten betroffenen Verbraucher entlastet werden.
Um in Zukunft gegen hohe Strompreise vorzugehen, müsse man den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, schreibt Acer. Länder könnten künftig auch eine sogenanntes Druckventil einführen – ein vorübergehendes Preislimit, das automatisch in Kraft tritt, wenn die Preise im Großhandel in kurzer Zeit stark ansteigen. Langfristig müsse man das europäische Stromnetz besser integrieren und ausbauen, um es für die Energiewende fit zu machen.
Länder wie Frankreich und Spanien fordern angesichts der stark angestiegenen Strompreise seit Monaten, dass das Preisbildungssystem für Strom überarbeitet werden soll. So erhoffen sie sich, dass der Strompreis weniger vom stark gestiegenen Gaspreis abhängig ist und sinkt. Der Großhandelspreis für Strom an den europäischen Märkten ist von der teuersten benötigten Energiequelle bestimmt – das ist momentan Gas. Sinkt die Nachfrage, wird der Preis wieder durch billige erneuerbare Energiequellen bestimmt, da die Gaskraftwerke abgestellt werden können. Das System soll Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien schaffen. dpa
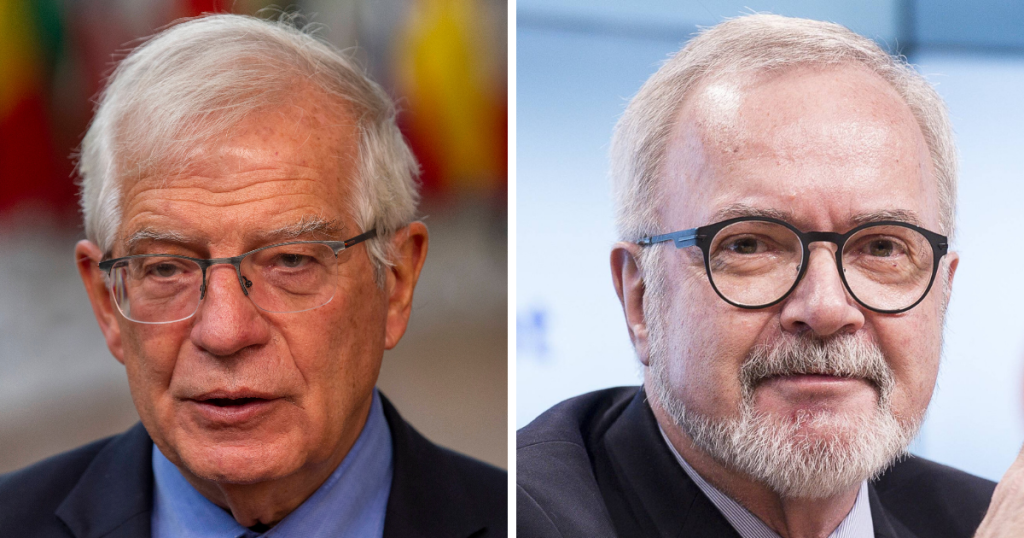
Die geopolitischen Gründe hierfür überschneiden sich mit der Notwendigkeit, die Klimakrise zu bewältigen. Der jüngste Bericht des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) über die Eindämmung des Klimawandels hebt die Dringlichkeit dieser Aufgabe hervor. Die weltweiten Treibhausgasemissionen müssen ihren Höhepunkt bis spätestens 2025 erreicht haben, wenn wir einen katastrophalen Temperaturanstieg verhindern wollen. Darüber hinaus muss die gesamtwirtschaftliche Umstellung auf saubere Energie gradlinig angegangen werden, um unvermeidlichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen Rechnung zu tragen und um einen “gerechter Übergang” zu garantieren.
Die EU und die Europäische Investitionsbank (EIB) spielen bei diesem Übergang eine entscheidende Rolle. Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und innovative Technologien wie zum Beispiel grüner Wasserstoff sind ein wichtiges Instrument, um der Aggression Russlands ein Ende zu setzen, die weltweite Ressourcenabhängigkeit zu verringern und zur Rettung des Planeten beizutragen. Jeder Euro, den wir zu Hause für die Energiewende ausgeben, ist ein Euro, den wir autoritären Mächten, die Angriffskriege führen, entziehen. Jeder Euro, der für saubere Energie ausgegeben wird, stärkt unsere Freiheit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Jeder Euro, der unseren internationalen Partnern dabei hilft, ihre eigenen Dekarbonisierungsstrategien zu beschleunigen, ist eine Investition in Resilienz und in die Bekämpfung des Klimawandels.
Seit der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar beschleunigt die Europäische Union ihre Pläne für die Energiewende, um uns schnellstmöglich von unserer Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe aus Russland zu befreien. Auch wenn dies nicht über Nacht geschehen wird, sind die Anreize dafür heute größer denn je. Wir können Energieunabhängigkeit erreichen, indem wir Effizienz dadurch verbessern, dass wir unsere Versorgung diversifizieren und mehr erneuerbare Energien nutzen. Dieser Prozess erfordert eine Mobilisierung auf allen Ebenen – von internationalen Organisationen bis hin zu Haushalten und Einzelpersonen.
Dabei sind insbesondere zwei wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Erstens darf die Suche nach alternativen Erdgaslieferanten, so wichtig sie kurzfristig auch sein mag, uns nicht in neue langfristige Abhängigkeiten bringen, die hohe Investitionen in neue Infrastrukturen für fossile Brennstoffe erfordern. Dies wäre kostspielig, katastrophal für den Planeten und angesichts der klimabewussteren Möglichkeiten letztlich unnötig. Zweitens dürfen wir nicht von einem Engpass in den nächsten stolpern und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gegen die Abhängigkeit von Materialien eintauschen, die für die grüne Transition benötigt werden und die sich stark auf eine Handvoll Länder konzentrieren, die nicht alle die gleichen Werte und Interessen wie die EU haben. Die Stärkung der strategischen Autonomie und Resilienz der EU muss ein zentrales Ziel des Übergangs bleiben.
Europa kann dies nicht alleine bewältigen. Der Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Aggression Russlands sind globale Herausforderungen, die eine globale Reaktion erfordern. Präsident Putins Krieg hat die Gründe aller Länder, ihre Importe fossiler Brennstoffe zu reduzieren und mehr in klimafreundliche Energielösungen zu investieren, verstärkt.
Deshalb engagiert sich die EU aktiv in der Klimadiplomatie. Wir wollen andere dazu ermutigen, ihre Klimaschutzziele zu erhöhen, und wir haben beträchtliche Ressourcen für die Zusammenarbeit mit Partnerländern bereitgestellt, damit auch diese Länder eine widerstandsfähige Wirtschaft mit Netto-Nullemissionen erreichen können. Im Rahmen des Europäischen Grünen Deals und der neuen EU-Initiative Global Gateway arbeiten die EU-Organe und die Mitgliedstaaten daran, bis zu 300 Mrd. EUR an nachhaltigen Investitionen für grüne und digitale Infrastrukturen zu mobilisieren, um die Klima-, Umwelt- und Energiekrise zu bewältigen.
Darüber hinaus hat die EIB zugesagt, bis 2030 Investitionen in den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit im Umfang von 1 Billion Euro zu unterstützen. Im Rahmen ihrer neuen Entwicklungssparte “EIB Global” wird die Bank mit Partnern in der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Mittel für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Stromnetze zu mobilisieren.
Als Teil der gemeinsamen Anstrengungen der EU im Rahmen von “Team Europe” reicht die Unterstützung der EIB für eine saubere Energiezukunft von Investitionen in Solarenergie in Senegal bis hin zur Finanzierung energieeffizienter Kindergärten in Armenien. Die Bank hat auch dazu beigetragen, eine “Partnerschaft für eine gerechte Energiewende” mit Südafrika aufzubauen, Mittel für die in Indien ansässige Internationale Solarallianz bereitgestellt, die die Entwicklung der Solarenergie in 105 tropischen Ländern unterstützt, und sich an einem integrierten Wassermanagement- und Hochwasserschutzprogramm in Argentinien beteiligt.
Die EU ist bereit, die globale Gemeinschaft bei der Beendigung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Die Invasion der Ukraine ist kein Grund, Investitionen in die Klimakrise zu verzögern. Im Gegenteil: Investitionen in die grüne Wirtschaft werden uns mehr strategische Autonomie verschaffen. Die Dekarbonisierung ist zu einer geopolitischen Notwendigkeit geworden. Wir rufen unsere globalen Partner, Regierungen und auch internationale Finanzinstitutionen, auf sich uns anzuschließen, um die Finanzierung sauberer Energie zu beschleunigen. Durch das Erreichen von Klimaneutralität, können wir auch Energiesicherheit bewirken.
In Kooperation mit Project Syndicate, 2022.

