gespannte Blicke richten sich derzeit nach Genf – noch vor ihrem Abtritt als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte hatte Michelle Bachelet die Veröffentlichung ihres umstrittenen China-Berichts zugesichert. Bachelet bleiben dafür nur noch knapp zwei Wochen. Nicht wenige Beobachter fürchten, dass sie der chinesischen Darstellung auf den Leim gegangen ist. Ihr Bericht wird es zeigen, wenn er endlich herauskommt.
Ein anderer, nicht minder wichtiger UN-Bericht erhebt jetzt schon schwere Vorwürfe gegen die Volksrepublik. Der Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zu Sklaverei hält es für erwiesen, dass es sowohl in der autonomen Region Xinjiang als auch in Tibet zu “Formen der Sklaverei” kommt. Marcel Grzanna hat sich das Dokument genauer angesehen. Der Report formuliert unverblümt genau die Vorwürfe, die China sonst stets zurückweist.
Die Einbeziehung von Huawei oder ZTE beim Ausbau des 5G-Netzes in Europa ist ein Dauerbrenner. Wurde in der Vergangenheit vor allem das Verteilnetz zwischen den Stationen und die Backbone-Leitungen der Anbieter als kritisch erachtet, geht es seit der Huawei-Debatte und mit 5G zunehmend auch um die Endpunkte des Mobilfunknetzes, schreibt Falk Steiner. Eine Idee, um dort mehr Sicherheit zu gewährleisten ist Open RAN, ein System vordefinierter, standardisierter Funknetzwerk-Komponenten und Software. Aber ausgerechnet chinesische Akteure prägen derzeit die Open RAN Alliance. Die EU-Kommission und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) melden Bedenken an.
Die Bedenken bei Behörden mindern wollte offenbar Jack Ma. Ma scheint einen Großteil seiner Stimmrechtsanteile bei Ant an Führungskräfte übertragen zu wollen, um so den Weg für einen Börsengang freizumachen, berichtet unser Autoren-Team aus Peking. Für den Konzern bedeutet das allerdings nicht nur gute Nachrichten.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!


Wenige Tage nach der feierlich präsentierten Ratifizierung internationaler Konventionen gegen Zwangsarbeit sieht sich die Volksrepublik China schweren Anschuldigungen durch ein UN-Gremium ausgesetzt. Ein Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, Tomoya Obokata, hält es für erwiesen, dass es sowohl in der autonomen Region Xinjiang als auch in Tibet zu “Formen der Sklaverei” kommt.
“Unabhängige akademische Forschung, offene Quellen, Zeugenaussagen von Opfern, Konsultationen mit Interessenvertretern und Berichte der Regierung” rechtfertigten diese Schlussfolgerung, heißt es in einem 20-seitigen Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Mehr noch könnten “übermäßige Überwachung, missbräuchliche Lebens- und Arbeitsbedingungen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Internierung, Drohungen, körperliche und/oder sexuelle Gewalt und andere unmenschliche oder erniedrigende Behandlung” den Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllen.
Das drastische Fazit des japanischen Sonderberichterstatters für moderne Formen der Sklaverei ist Teil eines Papiers, das sich nicht nur mit Zwangsarbeit in China, sondern auch in anderen Teilen der Welt befasst. Es dient dem Menschenrechtsrat für dessen 51. Sitzung in Genf im September als Diskussionsgrundlage.
Wenn der Rat zusammentritt, wird die noch amtierende UN-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet nicht mehr dabei sein. Eigentlich war es die Chilenin, die einen Bericht zur Situation der Uiguren und anderen Minderheiten hätte vorlegen sollen. Doch mehrfach ist eine Veröffentlichung bereits verschoben worden. Der Hochkommissarin, die Ende Mai die Volksrepublik besucht hatte, wird vorgeworfen, den Bericht im Interesses der chinesischen Regierung zu verschleppen und sich deren sprachliche Verharmlosung angeeignet zu haben.
Jetzt soll das Dokument angeblich an ihrem letzten Tag im Amt Ende August veröffentlicht werden. Peking durfte den Bericht bereits einsehen und dessen Einschätzungen kommentieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass um kritische Formulierungen bis zuletzt gerungen wird und China die Vorwürfe glattbügeln will.
Obokatas Bericht schmeckt China überhaupt nicht, formuliert er doch unverblümt genau jene Vorwürfe, die das Land stets in Reich der Fabeln verbannen will. Am Mittwoch reagierte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums abermals mit verbalen Gegenangriffen und wähnte die Volksrepublik reflexartig in der Opferrolle. Obokata habe sich entschieden, “Lügen und von den USA und anti-chinesischen Kräften fabrizierte Falschinformationen zu glauben.” Der Sonderberichterstatter besudele “bösartig” Chinas Ansehen.
Die Volksrepublik versucht seit Jahren, mit penibel gesteuerter Informationspolitik ein anderes Bild aus Xinjiang zu zeichnen. Um den zunehmend massiven Vorwürfen die Wucht zu nehmen, setzt Peking auch auf wirtschaftliche Zwänge gegen ausländische Unternehmen, von denen viele Angst haben vor Konsequenzen für ihre Umsätze im Land. Entweder schweigen sie deshalb zu der Thematik oder winden sich in zweifelhaftem Schönreden.
Obokatas Bericht nimmt dementsprechend auch internationale Firmen in die Pflicht. Den Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA oder Lieferkettengesetze in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder auf EU-Ebene bezeichnet er als gute Beispiele, um die Unternehmen zur Sorgfalt zu verpflichten.
Hoffnungsvoll reagierten uigurische Interessenvertreter. “Die Ergebnisse dieses Berichts müssen ein Weckruf für diejenigen sein, die sich bisher geweigert haben, Maßnahmen gegen die Verbreitung von Waren in globalen Lieferketten zu ergreifen, die durch uigurische Zwangsarbeit hergestellt werden”, sagte der Präsident des Weltkongresses der Uiguren (WUC), Dolkun Isa. Der WUC fordert zudem Michelle Bachelet zur sofortigen Veröffentlichung ihres Berichts auf.
Positive Resonanz gab es auch von tibetischen Organisationen. Die International Campaign for Tibet (ICT) begrüßte den expliziten Hinweis des Berichts auf Zwangsarbeit in den tibetischen Siedlungsgebieten der Volksrepublik. “Die Feststellung des Sonderberichterstatters unterstreicht auch die Dramatik der Situation in Tibet sowie die Tatsache, dass diese ebenfalls besondere Aufmerksamkeit verdient“, sagte ICT-Geschäftsführer Kai Müller in einer Stellungnahme. “Wir haben immer wieder auf sogenannte Arbeitsprogramme der chinesischen Regierung hingewiesen, in die Hunderttausende Tibeter gezwungen werden”, so Müller, der sich der Forderung zur umgehenden Veröffentlichung von Bachelets Bericht anschloss.
Erst Ende vergangener Woche hatte China die Übereinkommen 29 und 105 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. Die Konvention über Zwangsarbeit von 1930 und die Konvention zur Abschaffung der Zwangsarbeit von 1957 verpflichten die Volksrepublik dazu, jegliche Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu unterbinden und auch nicht “als Mittel des politischen Zwangs, der Bildung oder als Strafe für das Halten oder Ausdrücken politischer Ansichten oder Ansichten, die dem etablierten politischen, sozialen oder wirtschaftlichen System ideologisch entgegengesetzt sind”.
“Der Zeitpunkt des Berichts ist angesichts der jüngsten Ratifizierung von zwei ILO-Übereinkommen durch China, die den Einsatz von Zwangsarbeit verbieten, recht heikel”, kommentierte Adrian Zenz auf Twitter. Der deutsche Anthropologe hatte mit seinen minutiösen Recherchen zu Zwangsarbeit in Xinjiang die Wahrnehmung der Problematik weltweit drastisch erhöht. Zenz beurteilt das UN-Papier als “äußerst bedeutende und starke Einschätzung”.
Doch so drückend die Beweislage auch ist, auf die sich der Bericht stützt, dürfte China auch in Zukunft eine Front an Fürsprecher ins Feld führen, die versucht, die Vorwürfe zu entkräften. Anfang August hatte die chinesische Regierung Gesandte aus 30 islamischen Staaten nach Xinjiang eingeladen, darunter Vertreter aus Saudi-Arabien, Pakistan, Algerien, Irak und Jemen. Das Fazit der Delegation war laut chinesischen Medien, dass die Teilnehmer zu der Überzeugung gekommen seien, dass die Rechte der ethnischen Minderheiten wie die der Uiguren gewahrt würden. Der algerische Botschafter schwärmte: “Die Früchte hier sind so süß wie das Leben der Menschen hier.”
Um die 5G-Komponenten chinesischer Anbieter hat sich eine hitzige Debatte entwickelt. Kernpunkt ist die Idee, auf Hard- und Software zu verzichten, deren Anbieter man nicht komplett vertrauen kann. Zumindest da, wo es drauf ankommt, beispielsweise im Telekommunikationsnetz. Die Diskussion betrifft vor allem chinesische Anbieter wie Huawei und ZTE. Die Befürchtung: Die chinesische Seite könnte die Geräte für Spionagezwecke einsetzen. Im Konfrontationsfall könnten sogar ein “Kill-Switch” zum Einsatz kommen. Damit ließen sich dann kompletter Netzbereiche abschalten.
Gerade im Bereich des Aufbaus von 5G-Netzen und nachfolgenden Generationen wurde daher politisch hektisch nach Lösungen gesucht. Es soll eine klare Präferenz auf andere Anbieter, vor allem die europäischen Ausrüster Nokia und Ericsson, gelegt werden. Zugleich sollten chinesische Anbieter nicht mit einem rechtlichen Marktausschluss belegt werden. Die EU veröffentlichte daraufhin ihre sogenannte 5G-Toolbox, in Deutschland wurden das IT-Sicherheitsgesetz und das BSI-Gesetz angepasst.
Kern der politischen Debatten: Wurde in der Vergangenheit vor allem das Verteilnetz zwischen den Stationen und die Backbone-Leitungen der Anbieter als kritisch erachtet, geht es seit der Huawei-Debatte und mit 5G zunehmend auch um die Endpunkte des Mobilfunknetzes. Denn mit 5G kommt diesen eine größere und aktivere Rolle zu. Als RAN wird dabei der Mobilfunknetzwerkbereich bezeichnet, der die Funkverbindung zu den Endnutzern herstellt und Antennen und Hardware am Funkturm mit dem Kernnetzwerk der Anbieter verbindet. Eine Idee, um dort mehr Sicherheit zu gewährleisten: Open RAN – ein System vordefinierter, standardisierter Funknetzwerk-Komponenten und Software.
Mittels Open RAN soll die Technik auch dann funktionieren, wenn Teile von unterschiedlichen Herstellern kommen. Damit soll auch der Austausch einfacher werden und Sicherheitsbedenken bei einzelnen Anbietern schneller begegnet werden. Deutsche und europäische Mobilfunkunternehmen erachten Open RAN daher als eine Möglichkeit, zum einen Gefahren zu minimieren. Zum anderen sollen jedoch dadurch, dass ganz unterschiedliche Anbieter zum Zuge kommen können, die Kosten gering gehalten werden. Chinesische Anbieter sprangen früh auf das vorgeblich offene Konzept auf und unterstützen es seitdem intensiv.
In einem nun veröffentlichten Papier (PDF) des Forschungskonsortiums Digital Power China warnen die Autoren Jan-Peter Kleinhans und Tim Rühlig vor Leichtgläubigkeit im Zusammenhang mit Open RAN. Sehr genau müsse unterschieden werden, was mit Open RAN überhaupt gemeint wäre – und welche Akteure mit welchen Interessen an den Open RAN-Definitionen mitwirkten. “Mindestens 16 Mitglieder der O-RAN Alliance haben Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat”, heißt es in dem Papier, auch alle drei staatlichen Mobilfunkanbieter der Volksrepublik würden mitwirken.
Insbesondere China Mobile sei als Gründungsmitglied problematisch, da es Co-Vorsitzende in zehn Arbeitsgruppen stelle und in Aufsichtsrat und Geschäftsführung vertreten sei. Außerdem sei China Mobile Mitglied des technischen Steuerungskomitees, das über technologische Angelegenheiten noch vor Veröffentlichung mitentscheide. Vor einer drohenden Übermacht chinesischer Akteure in solchen Standardisierungsgremien warnen auch EU-Kommission und Bundesregierung mit zunehmender Intensität.
Ein weiteres großes Problem sehen die Autoren darin, dass Open RAN-Gremien nicht nur Hardware, sondern die maßgeblichen Vorgaben für die Software erstellen. Selbst wenn der Quellcode offen liege: Die schiere Menge des RAN-Code sei kaum auf seine Sicherheit zu prüfen.
Die Autoren warnen davor, die Debatte nur auf Huawei zu verengen – es gehe um China. Insgesamt sei die O-RAN Alliance “alles andere als ein vertrauenswürdiger Partner”. Es sei “hochgradig fraglich, ob die Kooperation innerhalb und die Verwendung von O-RAN Alliance-kompatiblem Equipment effektiv die Probleme adressieren kann, die im Zusammenhang mit der Rolle Huaweis im 5G-Rollout zutage tragen.”
Anfang Mai hatte die EU-Kommission zur Sicherheit von Open RAN eine Studie veröffentlicht, an der unter anderem die Europäische Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde (ENISA) mitgearbeitet hatte. Auch in dieser wurden Open RAN erhebliche Sicherheitsrisiken bescheinigt. Kernrisiken wären der Studie etwa, dass Open RAN sicherheitstechnisch unausgereift wäre und die Angriffsfläche für böswillige Akteure vergrößern könne.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte bereits 2019 eine Studie in Auftrag gegeben, die Sicherheitsrisiken durch Open RAN prüfen sollte. Die Autoren vom Barkhausen Institut und Advancing Individual Networks waren damals zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Stand “vielfältige Sicherheitsrisiken beinhalte”. Eine davon ist besonders relevant: Open RAN sei nicht nach den Prinzipien des Security by design oder Security by default konzipiert worden. Security by design meint, dass Soft- und Hardware von vornherein auf ein hohes Sicherheitsniveau hin gedacht und umgesetzt wird und nicht vor allem auf Kosten- und Funktionseffizienz hin entworfen wird. Security by default beschreibt, dass Hard- und Software bei der Inbetriebnahme maximale Sicherheitsfunktionen erfüllen – und diese erst im Nachgang angepasst werden.
Der Anbieter 1und1, der derzeit als vierter Anbieter in Deutschland ein eigenes 5G-Mobilfunknetz aufbaut, sagt, ihm sei die Kritik an Open RAN vertraut, etwa der BSI-Bericht zum Thema. “Die darin verankerten Sicherheits-Empfehlungen erfüllen wir von Beginn an in allen zentralen Punkten und stehen in regelmäßigem Austausch mit der Behörde”, so eine Sprecherin auf Anfrage. “Um die Sicherheit in OpenRAN-Netzen zu gewährleisten, bedarf es – ebenso wie bei herkömmlichen Mobilfunknetzen – intensiver Risikoanalysen sowie der kontinuierlichen Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Kriterien.”
Open RAN biete den großen Vorteil der Standardisierung, die von einzelnen Herstellern Unabhängigkeit sicherstelle. “So können wir von Anfang an auf umstrittene Hersteller – beispielsweise aus China – verzichten und über klar definierte Schnittstellen flexibel die beste und sicherste Technik verbauen.”
Für Mitarbeiter der Ant Group waren die vergangenen zwei Jahre alles andere als einfach. Viele von ihnen hätten im Herbst 2020 durch ihre Aktien-Optionen eine gehörige Stange Geld verdient, wäre der Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group wie geplant über die Bühne gegangen. Laut Schätzungen lag der Wert des Unternehmens damals noch bei über 235 Milliarden US-Dollar, es hätte einer der größten Börsengänge aller Zeiten werden sollen. Doch bekanntlich schritten Chinas Regulatoren damals aus Ärger über eine regierungskritische Rede von Alibaba-Gründer Jack Ma ein und untersagten die Pläne in letzter Minute.
Nach schmerzhaften Monaten für alle Anteilseigner gibt es für sie nun neue Hoffnung. Wie unter anderem das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, plant Ma einen Großteil seine Stimmrechtsanteile bei Ant an Führungskräfte zu übertragen, unter anderem an CEO Eric Jing. Die Beteiligung Mas an Ant soll demnach von zuletzt knapp über 50 auf 8,8 Prozent sinken. Mit dem Schritt, so heißt es in Alibaba-Kreisen, könnten letzte Bedenken Pekings ausgeräumt werden. Einem Börsengang stünde dann mittelfristig nichts mehr im Weg.
Ma selbst befindet sich dieser Tage auf großer Europa-Tour. Die Yacht des Alibaba-Gründers wurde zuletzt vor Mallorca gesichtet. Auch machte der 57-Jährige einen Abstecher nach Österreich und besuchte eine Universität in den Niederlanden, um sich dort über nachhaltige Landwirtschaft zu informieren. So oft in so kurzer Abfolge wurde der einst reichste Mann Chinas nicht mehr gesehen, seitdem er vor gut zwei Jahren den Zorn der chinesischen Führung zu spüren bekam.
Dass Jack Ma sich nun wieder häufiger unbeschwert in der Öffentlichkeit zeigt, ist ein Zeichen dafür, dass er wohl eine Übereinkunft mit Peking getroffen hat: Der Alibaba-Gründer hält sich aus allen Geschäftsbelangen raus, dafür dürfen Alibaba und Ant wieder prosperieren.
Zuletzt hatte sich die Lage in Chinas Tech-Branche insgesamt deutlich beruhigt. Peking ist zu der Einsicht gekommen, dass es besser ist, die Konzerne vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftskrise zumindest ein Stück weit wieder von der kurzen Leine zu nehmen. So können sie helfen, der Konjunktur neuen Schwung zu verleihen. Der Tech-Crackdown der vergangenen zwei Jahre scheint vorerst beendet.
Für Ma ist die Abgabe der Kontrolle bei Ant vertretbar. Schließlich hatte er schon Jahre vor dem Streit mit Peking ein ganz ähnliches Szenario im Sinn. Bei Alibaba war er bereits 2013 als CEO und 2019 als Vorstandschef zurückgetreten. Und bereits 2014 hatte er öffentlich gesagt, dass er seine Beteiligung an Ant eines Tages auf höchstens 8,8 Prozent reduzieren und Aktien für wohltätige Zwecke spenden wolle. Nun erfolgt die Machtabgabe schneller als geplant.
Mas Eingeständnis an die Behörden ist für Ant eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Einerseits dürfte die Kontrollabgabe endlich den Weg für den lang ersehnten Börsengang frei machen. Jedoch wird es noch dauern. Denn nach chinesischem Recht ist ein Listing gleich nach einem Eigentümerwechsel nicht möglich. Bei einem Wechsel des Mehrheitseigentümers müsste Ant in Shanghai zunächst mindestens zwei Jahre warten. In Hongkong ist es nur ein Jahr. Der ursprüngliche Plan von Ant sah vor, zur gleichen Zeit in Shanghai und Hongkong an die Börse zugehen.
Klar ist zudem schon jetzt, dass Ant bei einem möglichen Börsengang nur noch ein Schatten seiner selbst sein wird. Der Konzern musste sich auf Druck Pekings in den vergangenen zwei Jahren auf zahlreiche neue Regeln einlassen, die zu einem Gewinneinbruch geführt und das Geschäftsmodell nachhaltig verändert haben. Zum laufenden Umbau gehört auch, dass sich Ant als eine Finanzholding registrieren muss, womit es noch strengeren Auflagen unterliegen würde und offiziell kein Tech-Unternehmen mehr wäre. Das alles hat sich negativ auf die Bewertung des Konzerns ausgewirkt.
Die einstige Bewertung von 235 Milliarden US-Dollar war schon vor einem Jahr laut Schätzungen auf nur noch 78 Milliarden Dollar zusammengeschmolzen. Erfolgt die von Peking verlangte Umwandlung in eine Finanzholding, könnte der Wert im schlimmsten Fall sogar auf nur noch 29 Milliarden Dollar abrutschen, wie Analysten von Bloomberg errechnet haben.
Hinzu kommt, dass Pekings Tech-Crackdown das Vertrauen von Anlegern nachhaltig erschüttert hat. Investoren mussten seit Ende 2020 deutliche Verluste hinnehmen. Allein die Alibaba-Aktie verlor in der Spitze über 70 Prozent. Dass sich Anleger also bald euphorisch auf Ant-Anteile stürzen werden, scheint mehr als fraglich. Jörn Petring/Gregor Koppenburg
China wird an einem Militär-Manöver in Russland teilnehmen. Soldaten der Volksbefreiungsarmee würden für die gemeinsam mit Russland, Indien, Belarus, Tadschikistan, Mongolei und weitere Länder angesetzten Übungen nach Russland entsandt, gab das chinesische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt. Die Teilnahme stehe nicht in Zusammenhang mit der derzeitigen internationalen und regionalen Lage und sei vielmehr Teil einer seit Jahren laufenden, bilateralen Vereinbarung. Moskau hatte die sogenannte Wostok-Militärübung im Juli für Ende August angekündigt. Details zu den Teilnehmer-Staaten wurden damals nicht genannt.
Das letzte Militär-Manöver dieser Art fand 2018 statt. China nahm damals zum ersten Mal teil. “Ziel ist es, die praktische und freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Armeen der teilnehmenden Länder zu vertiefen, das Niveau der strategischen Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Parteien zu verbessern und die Fähigkeit zu stärken, auf verschiedene Sicherheitsbedrohungen zu reagieren”, hieß es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums.
Der oberste Vertreter Taiwans in Berlin, Jhy-Wey Shieh, forderte indes eine engere militärische Zusammenarbeit seines Landes mit Deutschland und dessen Verbündeten (China.Table berichtete). Sollte es ein neues Manöver der Bundeswehr mit den Partnern des Indopazifik-Raumes geben, würde er sich wünschen, “dass Taiwan auch dazu eingeladen wird, dass die Rolle von Taiwan besser zum Ausdruck kommt”, sagte Shieh in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Und ich glaube, das wird geschehen.” Es gehe darum, dass Taiwan eine Aufwertung erfahre.
Fiele Taiwan in die Hände Chinas, wäre dies sehr tragisch, auch für Europa, sagte Shieh. “Taiwan ist ein (…) Leuchtturm der Freiheit.” Dies gelte im übrigen auch für systemkritische Chinesen. Daher müsse es eine enge Zusammenarbeit Europas und der USA mit den Partnern im Indopazifik wie Japan, Südkorea und Australien geben. ari/rtr
In der Immobilienkrise Chinas greifen einige Städte zu drastischen Maßnahmen. In Shimen, in der Provinz Hunan, rief ein Offizieller die Staatsbediensteten dazu auf, neue Immobilien zu kaufen: “Ich hoffe, dass die Teilnehmer, einschließlich der Beamten, die Initiative ergreifen und ein weiteres Haus kaufen”, sagte der Offizielle auf einer Immobilienmesse laut eines Berichts von Reuters. In der 800.000-Einwohner-Stadt Sixian, Provinz Anhui, sollen Staatsbedienstete Immobilien an ihre Freunde und Familie verkaufen, wie demnach aus einer Meldung der städtischen Regierung hervorgeht.
Chinas Immobiliensektor befindet sich in einer schweren Krise. Viele Immobilienentwickler sind hoch verschuldet. Zuletzt kam es zu einem Hypotheken-Streik, bei dem die Käufer mit der Aussetzung ihrer Zahlungen drohten, weil sich die Fertigstellung ihrer Häuser immer weiter verzögert. Die Immobilienpreise sind zuletzt zurückgegangen, nachdem sie jahrelang nur angestiegen waren (China.Table berichtete). Dadurch sinkt die Nachfrage weiter und viele Immobilien bleiben unverkauft. Ob dieser Teufelskreis mit ein paar Käufen durch Staatsbeamte aufgehalten werden kann, ist allerdings mehr als fraglich. nib
Chinas Automarkt hat wieder an Schwung gewonnen, deutsche Autobauer haben jedoch Marktanteile verloren. China sei erneut die “Lokomotive”, schreibt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research (CAR) am Mittwoch in einer Analyse, aus der die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Obwohl der globale Autoabsatz in diesem Jahr voraussichtlich um 3,2 Prozent zurückgehen dürfte, soll der Markt in China um fünf Prozent zulegen, schätzt Dudenhöffer.
Der Absatz der deutschen Hersteller auf dem für sie wichtigsten Markt ist im ersten Halbjahr massiv eingebrochen. Der VW-Konzern verzeichnet ein Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mercedes und BMW hätten jeweils 19 Prozent weniger verkauft. Der Marktanteil von VW in China sei damit von 18,4 auf 14,2 Prozent zurückgegangen. Für Mercedes habe er sich von 4,4 auf 3,4 Prozent und für BMW von 4,7 auf 3,7 Prozent verringert, ergab die Analyse laut dpa.
“Gewinner sind klar die Chinesen und Tesla“, schreibt Dudenhöffer. Ein wichtiger Grund sei der Boom batterie-elektrischer Autos. “Da tun sich die deutschen Autobauer in China noch schwer.” Ähnliches gelte für Software-Funktionen bei Premiumfahrzeugen. Ein weiterer Grund für den Rückstand deutscher Autobauer seien die schlechteren Einkaufs- und Produktionssysteme, was sich auch im Vergleich zu Toyota zeige.
Im Interview mit ntv warnt Dudenhöffer vor einer möglichen Abkopplung der deutschen Wirtschaft von China. “Für Deutschland wäre ein China-Embargo der GAU”, sagt Dudenhöffer.” Bei einem China-Konflikt brechen die Absatzmärkte weg, möglicherweise beenden die Chinesen ihre Auslands-Engagements, Technologie-Import bleibt auf der Strecke.” flee
Der Weltkongress der Uiguren (WUC) und das Uyghur Human Rights Project (UHRP) wollen den früheren Parteisekretär der Region Xinjiang wegen Völkermords zur Verantwortung ziehen. Am Mittwoch reichte die Lobby-Koalition vor einem argentinischen Gericht Klage gegen Chen Quanguo und andere Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas ein. Dazu gehören auch die von der Europäischen Union sanktionierten hochrangigen Parteikader Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan und der frühere Polizeichef von Xinjiang, Chen Mingguo.
Die Anwälte der Kläger entschieden sich für Argentinien als Ort der Klage, weil die Verfassung des südamerikanischen Staates internationale Ermittlungen bei Genozid-Vorwürfen ermöglicht – allerdings nur gegen natürliche Personen, nicht gegen Regierungen. Weder der Internationale Strafgerichtshof noch der Internationale Gerichtshof war für eine solche Klage infrage gekommen, weil China die Zuständigkeit der beiden Gerichte nicht anerkennt. grz
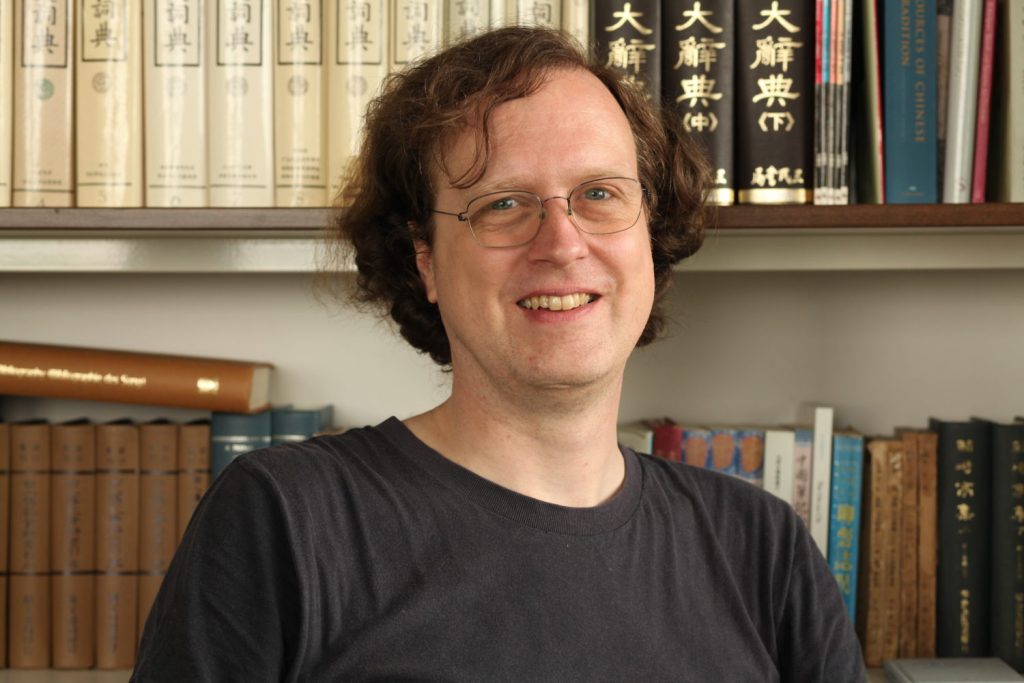
“Alle 20 Jahre wendet sich das Blatt in China.” So beobachtet Christian Soffel die Politik in der Volksrepublik. Den letzten Wendepunkt hat der Sinologe im Jahr 2008 ausgemacht, damals sei die Offenheit dem Westen gegenüber auf einem Höhepunkt gewesen. Unter Xi Jinping gehe es aktuell bergab, und das gelte auch für die europäisch-chinesischen Beziehungen. Die mehr als zwei Jahre Pandemie haben den Austausch zwischen den beiden Blöcken zusätzlich erschwert. Sowohl in der großen Politik, als auch im Austausch zwischen Wissenschaftlern: “Mir fehlen die Kaffeepausen”, sagt der Sinologe, “da werden die Hintergründe besprochen”.
Der 55-Jährige ist Professor für Sinologie an der Universität Trier. Als er Anfang der 1990er-Jahre in München ein Sinologie-Studium beginnt, ist die Stimmung auf einem Tiefpunkt. Nach dem Tian’anmen-Massaker will in Europa kaum jemand etwas mit der Volksrepublik zu tun haben. “Ich erinnere mich an einen Sprachkurs im zweiten Studienjahr, da waren wir zu dritt”, sagt Soffel.
Er selbst studiert zunächst Slavistik, Mathematik und Theoretische Physik, besucht eher zufällig einen Freund in Peking – und ist fasziniert. Soffel beginnt, Mandarin zu lernen, studiert für einige Monate in Taiwan. Dort begegnen ihm zum ersten Mal die Texte des Konfuzius. “Mich haben die zutiefst menschlichen Werte angesprochen”, sagt Soffel: “Geduld, Bescheidenheit, Mitmenschlichkeit”.
Im chinesischen Turbokapitalismus wandeln sich die Werte. Der Konfuzianismus entwickelt sich auf dem chinesischen Festland in eine sehr materialistische Richtung, so Soffel. Das passt zum Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik. “Das wichtigste Argument der kommunistischen Partei ist, dass sie den Menschen viel Wohlstand gebracht hat”, sagt Soffel. In einem materialistischen Konfuzianismus sei dieser Wohlstand ein wichtiger Grund für menschliches Handeln. Damit könne sich die Partei wiederum legitimieren.
Das heißt nicht unbedingt, dass der Alltag der Chinesinnen und Chinesen noch viel mit den konfuzianischen Grundwerten zu tun hat. Trotzdem sei der Konfuzianismus heute wieder stark im Kommen, geduldet und gefördert von der Partei. Die KP will die philosophischen Ideen für sich nutzen. “Die Partei beruft sich auf Traditionen und kann so positive Energien in der Bevölkerung abschöpfen”, sagt Soffel.
“In Taiwan bekommt man ein ganz anderes Bild”, sagt der Sinologe. Die konfuzianische Szene auf der Insel sei offener und kreativer: “Dort sind eher Moral und Ideale wie die Menschenwürde wichtig.”
Soffel hofft, dass er sich über solche Ideen bald wieder persönlich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen kann. Er ist Sekretär der European Association for Chinese Philosophy, im nächsten Jahr wollen sich die Mitglieder zu einer Konferenz in Italien treffen. Wann die nächste Reise nach China ansteht, kann der Sinologe noch nicht abschätzen. Dennoch ist Soffel sich sicher: “Ich dürfte noch erleben, wie das Verhältnis wieder besser wird.” Jana Hemmersmeier
Dominik Fischer ist neuer Market Manager für China und Ostasien bei Würth Group. Fischer hat die Position seit Juli inne, zuvor war er vier Jahre in den International Direct Sales ebenfalls bei Würth tätig.
Dominik Brugger ist neuer Head of Engineering für China bei Rena Technologies in Furtwangen. Brugger war zuvor Entwicklungsingenieur bei Rena.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Arbeitsplatz mit Ausblick auf den Jangtse: Die Versorgungstechniker warten auf eines der letzten Teile für einen Stromübertragungsturm der 800-Kilovolt-UHV-Direktleitung Baihetan-Zhejiang. Die Arbeit an mehreren Übertragungstürmen wurde in dieser Woche abgeschlossen. Mit einer Gesamtlänge von rund 2.140 Kilometern ist das Projekt ein wichtiger Teil der West-Ost-Stromversorgung Chinas.
gespannte Blicke richten sich derzeit nach Genf – noch vor ihrem Abtritt als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte hatte Michelle Bachelet die Veröffentlichung ihres umstrittenen China-Berichts zugesichert. Bachelet bleiben dafür nur noch knapp zwei Wochen. Nicht wenige Beobachter fürchten, dass sie der chinesischen Darstellung auf den Leim gegangen ist. Ihr Bericht wird es zeigen, wenn er endlich herauskommt.
Ein anderer, nicht minder wichtiger UN-Bericht erhebt jetzt schon schwere Vorwürfe gegen die Volksrepublik. Der Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zu Sklaverei hält es für erwiesen, dass es sowohl in der autonomen Region Xinjiang als auch in Tibet zu “Formen der Sklaverei” kommt. Marcel Grzanna hat sich das Dokument genauer angesehen. Der Report formuliert unverblümt genau die Vorwürfe, die China sonst stets zurückweist.
Die Einbeziehung von Huawei oder ZTE beim Ausbau des 5G-Netzes in Europa ist ein Dauerbrenner. Wurde in der Vergangenheit vor allem das Verteilnetz zwischen den Stationen und die Backbone-Leitungen der Anbieter als kritisch erachtet, geht es seit der Huawei-Debatte und mit 5G zunehmend auch um die Endpunkte des Mobilfunknetzes, schreibt Falk Steiner. Eine Idee, um dort mehr Sicherheit zu gewährleisten ist Open RAN, ein System vordefinierter, standardisierter Funknetzwerk-Komponenten und Software. Aber ausgerechnet chinesische Akteure prägen derzeit die Open RAN Alliance. Die EU-Kommission und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) melden Bedenken an.
Die Bedenken bei Behörden mindern wollte offenbar Jack Ma. Ma scheint einen Großteil seiner Stimmrechtsanteile bei Ant an Führungskräfte übertragen zu wollen, um so den Weg für einen Börsengang freizumachen, berichtet unser Autoren-Team aus Peking. Für den Konzern bedeutet das allerdings nicht nur gute Nachrichten.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!


Wenige Tage nach der feierlich präsentierten Ratifizierung internationaler Konventionen gegen Zwangsarbeit sieht sich die Volksrepublik China schweren Anschuldigungen durch ein UN-Gremium ausgesetzt. Ein Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, Tomoya Obokata, hält es für erwiesen, dass es sowohl in der autonomen Region Xinjiang als auch in Tibet zu “Formen der Sklaverei” kommt.
“Unabhängige akademische Forschung, offene Quellen, Zeugenaussagen von Opfern, Konsultationen mit Interessenvertretern und Berichte der Regierung” rechtfertigten diese Schlussfolgerung, heißt es in einem 20-seitigen Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Mehr noch könnten “übermäßige Überwachung, missbräuchliche Lebens- und Arbeitsbedingungen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Internierung, Drohungen, körperliche und/oder sexuelle Gewalt und andere unmenschliche oder erniedrigende Behandlung” den Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllen.
Das drastische Fazit des japanischen Sonderberichterstatters für moderne Formen der Sklaverei ist Teil eines Papiers, das sich nicht nur mit Zwangsarbeit in China, sondern auch in anderen Teilen der Welt befasst. Es dient dem Menschenrechtsrat für dessen 51. Sitzung in Genf im September als Diskussionsgrundlage.
Wenn der Rat zusammentritt, wird die noch amtierende UN-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet nicht mehr dabei sein. Eigentlich war es die Chilenin, die einen Bericht zur Situation der Uiguren und anderen Minderheiten hätte vorlegen sollen. Doch mehrfach ist eine Veröffentlichung bereits verschoben worden. Der Hochkommissarin, die Ende Mai die Volksrepublik besucht hatte, wird vorgeworfen, den Bericht im Interesses der chinesischen Regierung zu verschleppen und sich deren sprachliche Verharmlosung angeeignet zu haben.
Jetzt soll das Dokument angeblich an ihrem letzten Tag im Amt Ende August veröffentlicht werden. Peking durfte den Bericht bereits einsehen und dessen Einschätzungen kommentieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass um kritische Formulierungen bis zuletzt gerungen wird und China die Vorwürfe glattbügeln will.
Obokatas Bericht schmeckt China überhaupt nicht, formuliert er doch unverblümt genau jene Vorwürfe, die das Land stets in Reich der Fabeln verbannen will. Am Mittwoch reagierte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums abermals mit verbalen Gegenangriffen und wähnte die Volksrepublik reflexartig in der Opferrolle. Obokata habe sich entschieden, “Lügen und von den USA und anti-chinesischen Kräften fabrizierte Falschinformationen zu glauben.” Der Sonderberichterstatter besudele “bösartig” Chinas Ansehen.
Die Volksrepublik versucht seit Jahren, mit penibel gesteuerter Informationspolitik ein anderes Bild aus Xinjiang zu zeichnen. Um den zunehmend massiven Vorwürfen die Wucht zu nehmen, setzt Peking auch auf wirtschaftliche Zwänge gegen ausländische Unternehmen, von denen viele Angst haben vor Konsequenzen für ihre Umsätze im Land. Entweder schweigen sie deshalb zu der Thematik oder winden sich in zweifelhaftem Schönreden.
Obokatas Bericht nimmt dementsprechend auch internationale Firmen in die Pflicht. Den Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA oder Lieferkettengesetze in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder auf EU-Ebene bezeichnet er als gute Beispiele, um die Unternehmen zur Sorgfalt zu verpflichten.
Hoffnungsvoll reagierten uigurische Interessenvertreter. “Die Ergebnisse dieses Berichts müssen ein Weckruf für diejenigen sein, die sich bisher geweigert haben, Maßnahmen gegen die Verbreitung von Waren in globalen Lieferketten zu ergreifen, die durch uigurische Zwangsarbeit hergestellt werden”, sagte der Präsident des Weltkongresses der Uiguren (WUC), Dolkun Isa. Der WUC fordert zudem Michelle Bachelet zur sofortigen Veröffentlichung ihres Berichts auf.
Positive Resonanz gab es auch von tibetischen Organisationen. Die International Campaign for Tibet (ICT) begrüßte den expliziten Hinweis des Berichts auf Zwangsarbeit in den tibetischen Siedlungsgebieten der Volksrepublik. “Die Feststellung des Sonderberichterstatters unterstreicht auch die Dramatik der Situation in Tibet sowie die Tatsache, dass diese ebenfalls besondere Aufmerksamkeit verdient“, sagte ICT-Geschäftsführer Kai Müller in einer Stellungnahme. “Wir haben immer wieder auf sogenannte Arbeitsprogramme der chinesischen Regierung hingewiesen, in die Hunderttausende Tibeter gezwungen werden”, so Müller, der sich der Forderung zur umgehenden Veröffentlichung von Bachelets Bericht anschloss.
Erst Ende vergangener Woche hatte China die Übereinkommen 29 und 105 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. Die Konvention über Zwangsarbeit von 1930 und die Konvention zur Abschaffung der Zwangsarbeit von 1957 verpflichten die Volksrepublik dazu, jegliche Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu unterbinden und auch nicht “als Mittel des politischen Zwangs, der Bildung oder als Strafe für das Halten oder Ausdrücken politischer Ansichten oder Ansichten, die dem etablierten politischen, sozialen oder wirtschaftlichen System ideologisch entgegengesetzt sind”.
“Der Zeitpunkt des Berichts ist angesichts der jüngsten Ratifizierung von zwei ILO-Übereinkommen durch China, die den Einsatz von Zwangsarbeit verbieten, recht heikel”, kommentierte Adrian Zenz auf Twitter. Der deutsche Anthropologe hatte mit seinen minutiösen Recherchen zu Zwangsarbeit in Xinjiang die Wahrnehmung der Problematik weltweit drastisch erhöht. Zenz beurteilt das UN-Papier als “äußerst bedeutende und starke Einschätzung”.
Doch so drückend die Beweislage auch ist, auf die sich der Bericht stützt, dürfte China auch in Zukunft eine Front an Fürsprecher ins Feld führen, die versucht, die Vorwürfe zu entkräften. Anfang August hatte die chinesische Regierung Gesandte aus 30 islamischen Staaten nach Xinjiang eingeladen, darunter Vertreter aus Saudi-Arabien, Pakistan, Algerien, Irak und Jemen. Das Fazit der Delegation war laut chinesischen Medien, dass die Teilnehmer zu der Überzeugung gekommen seien, dass die Rechte der ethnischen Minderheiten wie die der Uiguren gewahrt würden. Der algerische Botschafter schwärmte: “Die Früchte hier sind so süß wie das Leben der Menschen hier.”
Um die 5G-Komponenten chinesischer Anbieter hat sich eine hitzige Debatte entwickelt. Kernpunkt ist die Idee, auf Hard- und Software zu verzichten, deren Anbieter man nicht komplett vertrauen kann. Zumindest da, wo es drauf ankommt, beispielsweise im Telekommunikationsnetz. Die Diskussion betrifft vor allem chinesische Anbieter wie Huawei und ZTE. Die Befürchtung: Die chinesische Seite könnte die Geräte für Spionagezwecke einsetzen. Im Konfrontationsfall könnten sogar ein “Kill-Switch” zum Einsatz kommen. Damit ließen sich dann kompletter Netzbereiche abschalten.
Gerade im Bereich des Aufbaus von 5G-Netzen und nachfolgenden Generationen wurde daher politisch hektisch nach Lösungen gesucht. Es soll eine klare Präferenz auf andere Anbieter, vor allem die europäischen Ausrüster Nokia und Ericsson, gelegt werden. Zugleich sollten chinesische Anbieter nicht mit einem rechtlichen Marktausschluss belegt werden. Die EU veröffentlichte daraufhin ihre sogenannte 5G-Toolbox, in Deutschland wurden das IT-Sicherheitsgesetz und das BSI-Gesetz angepasst.
Kern der politischen Debatten: Wurde in der Vergangenheit vor allem das Verteilnetz zwischen den Stationen und die Backbone-Leitungen der Anbieter als kritisch erachtet, geht es seit der Huawei-Debatte und mit 5G zunehmend auch um die Endpunkte des Mobilfunknetzes. Denn mit 5G kommt diesen eine größere und aktivere Rolle zu. Als RAN wird dabei der Mobilfunknetzwerkbereich bezeichnet, der die Funkverbindung zu den Endnutzern herstellt und Antennen und Hardware am Funkturm mit dem Kernnetzwerk der Anbieter verbindet. Eine Idee, um dort mehr Sicherheit zu gewährleisten: Open RAN – ein System vordefinierter, standardisierter Funknetzwerk-Komponenten und Software.
Mittels Open RAN soll die Technik auch dann funktionieren, wenn Teile von unterschiedlichen Herstellern kommen. Damit soll auch der Austausch einfacher werden und Sicherheitsbedenken bei einzelnen Anbietern schneller begegnet werden. Deutsche und europäische Mobilfunkunternehmen erachten Open RAN daher als eine Möglichkeit, zum einen Gefahren zu minimieren. Zum anderen sollen jedoch dadurch, dass ganz unterschiedliche Anbieter zum Zuge kommen können, die Kosten gering gehalten werden. Chinesische Anbieter sprangen früh auf das vorgeblich offene Konzept auf und unterstützen es seitdem intensiv.
In einem nun veröffentlichten Papier (PDF) des Forschungskonsortiums Digital Power China warnen die Autoren Jan-Peter Kleinhans und Tim Rühlig vor Leichtgläubigkeit im Zusammenhang mit Open RAN. Sehr genau müsse unterschieden werden, was mit Open RAN überhaupt gemeint wäre – und welche Akteure mit welchen Interessen an den Open RAN-Definitionen mitwirkten. “Mindestens 16 Mitglieder der O-RAN Alliance haben Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat”, heißt es in dem Papier, auch alle drei staatlichen Mobilfunkanbieter der Volksrepublik würden mitwirken.
Insbesondere China Mobile sei als Gründungsmitglied problematisch, da es Co-Vorsitzende in zehn Arbeitsgruppen stelle und in Aufsichtsrat und Geschäftsführung vertreten sei. Außerdem sei China Mobile Mitglied des technischen Steuerungskomitees, das über technologische Angelegenheiten noch vor Veröffentlichung mitentscheide. Vor einer drohenden Übermacht chinesischer Akteure in solchen Standardisierungsgremien warnen auch EU-Kommission und Bundesregierung mit zunehmender Intensität.
Ein weiteres großes Problem sehen die Autoren darin, dass Open RAN-Gremien nicht nur Hardware, sondern die maßgeblichen Vorgaben für die Software erstellen. Selbst wenn der Quellcode offen liege: Die schiere Menge des RAN-Code sei kaum auf seine Sicherheit zu prüfen.
Die Autoren warnen davor, die Debatte nur auf Huawei zu verengen – es gehe um China. Insgesamt sei die O-RAN Alliance “alles andere als ein vertrauenswürdiger Partner”. Es sei “hochgradig fraglich, ob die Kooperation innerhalb und die Verwendung von O-RAN Alliance-kompatiblem Equipment effektiv die Probleme adressieren kann, die im Zusammenhang mit der Rolle Huaweis im 5G-Rollout zutage tragen.”
Anfang Mai hatte die EU-Kommission zur Sicherheit von Open RAN eine Studie veröffentlicht, an der unter anderem die Europäische Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde (ENISA) mitgearbeitet hatte. Auch in dieser wurden Open RAN erhebliche Sicherheitsrisiken bescheinigt. Kernrisiken wären der Studie etwa, dass Open RAN sicherheitstechnisch unausgereift wäre und die Angriffsfläche für böswillige Akteure vergrößern könne.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte bereits 2019 eine Studie in Auftrag gegeben, die Sicherheitsrisiken durch Open RAN prüfen sollte. Die Autoren vom Barkhausen Institut und Advancing Individual Networks waren damals zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Stand “vielfältige Sicherheitsrisiken beinhalte”. Eine davon ist besonders relevant: Open RAN sei nicht nach den Prinzipien des Security by design oder Security by default konzipiert worden. Security by design meint, dass Soft- und Hardware von vornherein auf ein hohes Sicherheitsniveau hin gedacht und umgesetzt wird und nicht vor allem auf Kosten- und Funktionseffizienz hin entworfen wird. Security by default beschreibt, dass Hard- und Software bei der Inbetriebnahme maximale Sicherheitsfunktionen erfüllen – und diese erst im Nachgang angepasst werden.
Der Anbieter 1und1, der derzeit als vierter Anbieter in Deutschland ein eigenes 5G-Mobilfunknetz aufbaut, sagt, ihm sei die Kritik an Open RAN vertraut, etwa der BSI-Bericht zum Thema. “Die darin verankerten Sicherheits-Empfehlungen erfüllen wir von Beginn an in allen zentralen Punkten und stehen in regelmäßigem Austausch mit der Behörde”, so eine Sprecherin auf Anfrage. “Um die Sicherheit in OpenRAN-Netzen zu gewährleisten, bedarf es – ebenso wie bei herkömmlichen Mobilfunknetzen – intensiver Risikoanalysen sowie der kontinuierlichen Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Kriterien.”
Open RAN biete den großen Vorteil der Standardisierung, die von einzelnen Herstellern Unabhängigkeit sicherstelle. “So können wir von Anfang an auf umstrittene Hersteller – beispielsweise aus China – verzichten und über klar definierte Schnittstellen flexibel die beste und sicherste Technik verbauen.”
Für Mitarbeiter der Ant Group waren die vergangenen zwei Jahre alles andere als einfach. Viele von ihnen hätten im Herbst 2020 durch ihre Aktien-Optionen eine gehörige Stange Geld verdient, wäre der Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group wie geplant über die Bühne gegangen. Laut Schätzungen lag der Wert des Unternehmens damals noch bei über 235 Milliarden US-Dollar, es hätte einer der größten Börsengänge aller Zeiten werden sollen. Doch bekanntlich schritten Chinas Regulatoren damals aus Ärger über eine regierungskritische Rede von Alibaba-Gründer Jack Ma ein und untersagten die Pläne in letzter Minute.
Nach schmerzhaften Monaten für alle Anteilseigner gibt es für sie nun neue Hoffnung. Wie unter anderem das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, plant Ma einen Großteil seine Stimmrechtsanteile bei Ant an Führungskräfte zu übertragen, unter anderem an CEO Eric Jing. Die Beteiligung Mas an Ant soll demnach von zuletzt knapp über 50 auf 8,8 Prozent sinken. Mit dem Schritt, so heißt es in Alibaba-Kreisen, könnten letzte Bedenken Pekings ausgeräumt werden. Einem Börsengang stünde dann mittelfristig nichts mehr im Weg.
Ma selbst befindet sich dieser Tage auf großer Europa-Tour. Die Yacht des Alibaba-Gründers wurde zuletzt vor Mallorca gesichtet. Auch machte der 57-Jährige einen Abstecher nach Österreich und besuchte eine Universität in den Niederlanden, um sich dort über nachhaltige Landwirtschaft zu informieren. So oft in so kurzer Abfolge wurde der einst reichste Mann Chinas nicht mehr gesehen, seitdem er vor gut zwei Jahren den Zorn der chinesischen Führung zu spüren bekam.
Dass Jack Ma sich nun wieder häufiger unbeschwert in der Öffentlichkeit zeigt, ist ein Zeichen dafür, dass er wohl eine Übereinkunft mit Peking getroffen hat: Der Alibaba-Gründer hält sich aus allen Geschäftsbelangen raus, dafür dürfen Alibaba und Ant wieder prosperieren.
Zuletzt hatte sich die Lage in Chinas Tech-Branche insgesamt deutlich beruhigt. Peking ist zu der Einsicht gekommen, dass es besser ist, die Konzerne vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftskrise zumindest ein Stück weit wieder von der kurzen Leine zu nehmen. So können sie helfen, der Konjunktur neuen Schwung zu verleihen. Der Tech-Crackdown der vergangenen zwei Jahre scheint vorerst beendet.
Für Ma ist die Abgabe der Kontrolle bei Ant vertretbar. Schließlich hatte er schon Jahre vor dem Streit mit Peking ein ganz ähnliches Szenario im Sinn. Bei Alibaba war er bereits 2013 als CEO und 2019 als Vorstandschef zurückgetreten. Und bereits 2014 hatte er öffentlich gesagt, dass er seine Beteiligung an Ant eines Tages auf höchstens 8,8 Prozent reduzieren und Aktien für wohltätige Zwecke spenden wolle. Nun erfolgt die Machtabgabe schneller als geplant.
Mas Eingeständnis an die Behörden ist für Ant eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Einerseits dürfte die Kontrollabgabe endlich den Weg für den lang ersehnten Börsengang frei machen. Jedoch wird es noch dauern. Denn nach chinesischem Recht ist ein Listing gleich nach einem Eigentümerwechsel nicht möglich. Bei einem Wechsel des Mehrheitseigentümers müsste Ant in Shanghai zunächst mindestens zwei Jahre warten. In Hongkong ist es nur ein Jahr. Der ursprüngliche Plan von Ant sah vor, zur gleichen Zeit in Shanghai und Hongkong an die Börse zugehen.
Klar ist zudem schon jetzt, dass Ant bei einem möglichen Börsengang nur noch ein Schatten seiner selbst sein wird. Der Konzern musste sich auf Druck Pekings in den vergangenen zwei Jahren auf zahlreiche neue Regeln einlassen, die zu einem Gewinneinbruch geführt und das Geschäftsmodell nachhaltig verändert haben. Zum laufenden Umbau gehört auch, dass sich Ant als eine Finanzholding registrieren muss, womit es noch strengeren Auflagen unterliegen würde und offiziell kein Tech-Unternehmen mehr wäre. Das alles hat sich negativ auf die Bewertung des Konzerns ausgewirkt.
Die einstige Bewertung von 235 Milliarden US-Dollar war schon vor einem Jahr laut Schätzungen auf nur noch 78 Milliarden Dollar zusammengeschmolzen. Erfolgt die von Peking verlangte Umwandlung in eine Finanzholding, könnte der Wert im schlimmsten Fall sogar auf nur noch 29 Milliarden Dollar abrutschen, wie Analysten von Bloomberg errechnet haben.
Hinzu kommt, dass Pekings Tech-Crackdown das Vertrauen von Anlegern nachhaltig erschüttert hat. Investoren mussten seit Ende 2020 deutliche Verluste hinnehmen. Allein die Alibaba-Aktie verlor in der Spitze über 70 Prozent. Dass sich Anleger also bald euphorisch auf Ant-Anteile stürzen werden, scheint mehr als fraglich. Jörn Petring/Gregor Koppenburg
China wird an einem Militär-Manöver in Russland teilnehmen. Soldaten der Volksbefreiungsarmee würden für die gemeinsam mit Russland, Indien, Belarus, Tadschikistan, Mongolei und weitere Länder angesetzten Übungen nach Russland entsandt, gab das chinesische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt. Die Teilnahme stehe nicht in Zusammenhang mit der derzeitigen internationalen und regionalen Lage und sei vielmehr Teil einer seit Jahren laufenden, bilateralen Vereinbarung. Moskau hatte die sogenannte Wostok-Militärübung im Juli für Ende August angekündigt. Details zu den Teilnehmer-Staaten wurden damals nicht genannt.
Das letzte Militär-Manöver dieser Art fand 2018 statt. China nahm damals zum ersten Mal teil. “Ziel ist es, die praktische und freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Armeen der teilnehmenden Länder zu vertiefen, das Niveau der strategischen Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Parteien zu verbessern und die Fähigkeit zu stärken, auf verschiedene Sicherheitsbedrohungen zu reagieren”, hieß es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums.
Der oberste Vertreter Taiwans in Berlin, Jhy-Wey Shieh, forderte indes eine engere militärische Zusammenarbeit seines Landes mit Deutschland und dessen Verbündeten (China.Table berichtete). Sollte es ein neues Manöver der Bundeswehr mit den Partnern des Indopazifik-Raumes geben, würde er sich wünschen, “dass Taiwan auch dazu eingeladen wird, dass die Rolle von Taiwan besser zum Ausdruck kommt”, sagte Shieh in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Und ich glaube, das wird geschehen.” Es gehe darum, dass Taiwan eine Aufwertung erfahre.
Fiele Taiwan in die Hände Chinas, wäre dies sehr tragisch, auch für Europa, sagte Shieh. “Taiwan ist ein (…) Leuchtturm der Freiheit.” Dies gelte im übrigen auch für systemkritische Chinesen. Daher müsse es eine enge Zusammenarbeit Europas und der USA mit den Partnern im Indopazifik wie Japan, Südkorea und Australien geben. ari/rtr
In der Immobilienkrise Chinas greifen einige Städte zu drastischen Maßnahmen. In Shimen, in der Provinz Hunan, rief ein Offizieller die Staatsbediensteten dazu auf, neue Immobilien zu kaufen: “Ich hoffe, dass die Teilnehmer, einschließlich der Beamten, die Initiative ergreifen und ein weiteres Haus kaufen”, sagte der Offizielle auf einer Immobilienmesse laut eines Berichts von Reuters. In der 800.000-Einwohner-Stadt Sixian, Provinz Anhui, sollen Staatsbedienstete Immobilien an ihre Freunde und Familie verkaufen, wie demnach aus einer Meldung der städtischen Regierung hervorgeht.
Chinas Immobiliensektor befindet sich in einer schweren Krise. Viele Immobilienentwickler sind hoch verschuldet. Zuletzt kam es zu einem Hypotheken-Streik, bei dem die Käufer mit der Aussetzung ihrer Zahlungen drohten, weil sich die Fertigstellung ihrer Häuser immer weiter verzögert. Die Immobilienpreise sind zuletzt zurückgegangen, nachdem sie jahrelang nur angestiegen waren (China.Table berichtete). Dadurch sinkt die Nachfrage weiter und viele Immobilien bleiben unverkauft. Ob dieser Teufelskreis mit ein paar Käufen durch Staatsbeamte aufgehalten werden kann, ist allerdings mehr als fraglich. nib
Chinas Automarkt hat wieder an Schwung gewonnen, deutsche Autobauer haben jedoch Marktanteile verloren. China sei erneut die “Lokomotive”, schreibt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research (CAR) am Mittwoch in einer Analyse, aus der die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Obwohl der globale Autoabsatz in diesem Jahr voraussichtlich um 3,2 Prozent zurückgehen dürfte, soll der Markt in China um fünf Prozent zulegen, schätzt Dudenhöffer.
Der Absatz der deutschen Hersteller auf dem für sie wichtigsten Markt ist im ersten Halbjahr massiv eingebrochen. Der VW-Konzern verzeichnet ein Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mercedes und BMW hätten jeweils 19 Prozent weniger verkauft. Der Marktanteil von VW in China sei damit von 18,4 auf 14,2 Prozent zurückgegangen. Für Mercedes habe er sich von 4,4 auf 3,4 Prozent und für BMW von 4,7 auf 3,7 Prozent verringert, ergab die Analyse laut dpa.
“Gewinner sind klar die Chinesen und Tesla“, schreibt Dudenhöffer. Ein wichtiger Grund sei der Boom batterie-elektrischer Autos. “Da tun sich die deutschen Autobauer in China noch schwer.” Ähnliches gelte für Software-Funktionen bei Premiumfahrzeugen. Ein weiterer Grund für den Rückstand deutscher Autobauer seien die schlechteren Einkaufs- und Produktionssysteme, was sich auch im Vergleich zu Toyota zeige.
Im Interview mit ntv warnt Dudenhöffer vor einer möglichen Abkopplung der deutschen Wirtschaft von China. “Für Deutschland wäre ein China-Embargo der GAU”, sagt Dudenhöffer.” Bei einem China-Konflikt brechen die Absatzmärkte weg, möglicherweise beenden die Chinesen ihre Auslands-Engagements, Technologie-Import bleibt auf der Strecke.” flee
Der Weltkongress der Uiguren (WUC) und das Uyghur Human Rights Project (UHRP) wollen den früheren Parteisekretär der Region Xinjiang wegen Völkermords zur Verantwortung ziehen. Am Mittwoch reichte die Lobby-Koalition vor einem argentinischen Gericht Klage gegen Chen Quanguo und andere Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas ein. Dazu gehören auch die von der Europäischen Union sanktionierten hochrangigen Parteikader Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan und der frühere Polizeichef von Xinjiang, Chen Mingguo.
Die Anwälte der Kläger entschieden sich für Argentinien als Ort der Klage, weil die Verfassung des südamerikanischen Staates internationale Ermittlungen bei Genozid-Vorwürfen ermöglicht – allerdings nur gegen natürliche Personen, nicht gegen Regierungen. Weder der Internationale Strafgerichtshof noch der Internationale Gerichtshof war für eine solche Klage infrage gekommen, weil China die Zuständigkeit der beiden Gerichte nicht anerkennt. grz
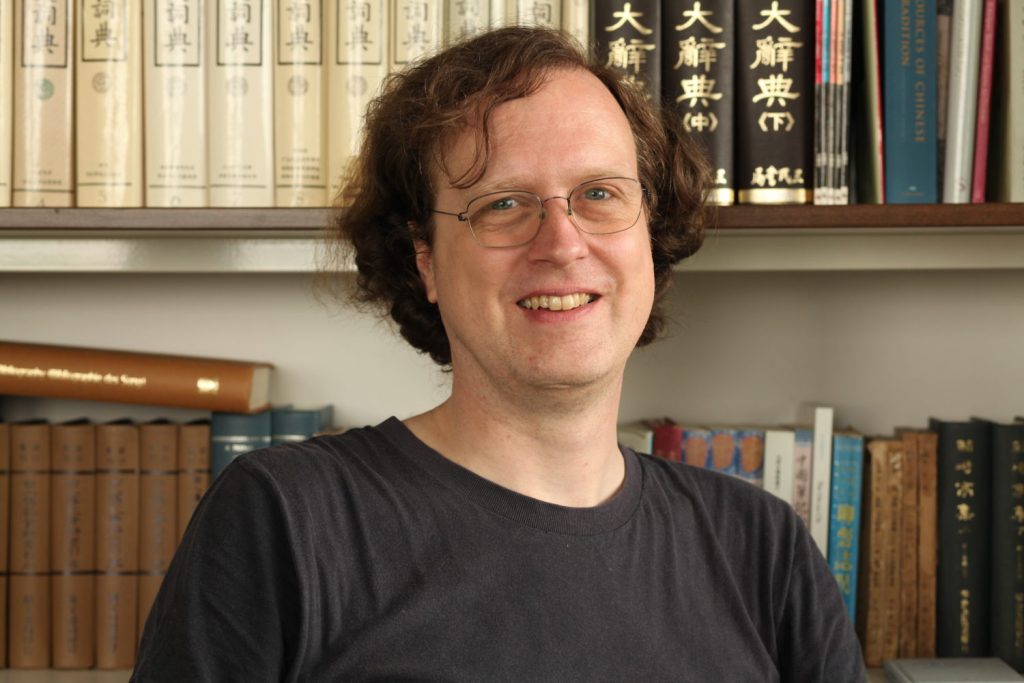
“Alle 20 Jahre wendet sich das Blatt in China.” So beobachtet Christian Soffel die Politik in der Volksrepublik. Den letzten Wendepunkt hat der Sinologe im Jahr 2008 ausgemacht, damals sei die Offenheit dem Westen gegenüber auf einem Höhepunkt gewesen. Unter Xi Jinping gehe es aktuell bergab, und das gelte auch für die europäisch-chinesischen Beziehungen. Die mehr als zwei Jahre Pandemie haben den Austausch zwischen den beiden Blöcken zusätzlich erschwert. Sowohl in der großen Politik, als auch im Austausch zwischen Wissenschaftlern: “Mir fehlen die Kaffeepausen”, sagt der Sinologe, “da werden die Hintergründe besprochen”.
Der 55-Jährige ist Professor für Sinologie an der Universität Trier. Als er Anfang der 1990er-Jahre in München ein Sinologie-Studium beginnt, ist die Stimmung auf einem Tiefpunkt. Nach dem Tian’anmen-Massaker will in Europa kaum jemand etwas mit der Volksrepublik zu tun haben. “Ich erinnere mich an einen Sprachkurs im zweiten Studienjahr, da waren wir zu dritt”, sagt Soffel.
Er selbst studiert zunächst Slavistik, Mathematik und Theoretische Physik, besucht eher zufällig einen Freund in Peking – und ist fasziniert. Soffel beginnt, Mandarin zu lernen, studiert für einige Monate in Taiwan. Dort begegnen ihm zum ersten Mal die Texte des Konfuzius. “Mich haben die zutiefst menschlichen Werte angesprochen”, sagt Soffel: “Geduld, Bescheidenheit, Mitmenschlichkeit”.
Im chinesischen Turbokapitalismus wandeln sich die Werte. Der Konfuzianismus entwickelt sich auf dem chinesischen Festland in eine sehr materialistische Richtung, so Soffel. Das passt zum Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik. “Das wichtigste Argument der kommunistischen Partei ist, dass sie den Menschen viel Wohlstand gebracht hat”, sagt Soffel. In einem materialistischen Konfuzianismus sei dieser Wohlstand ein wichtiger Grund für menschliches Handeln. Damit könne sich die Partei wiederum legitimieren.
Das heißt nicht unbedingt, dass der Alltag der Chinesinnen und Chinesen noch viel mit den konfuzianischen Grundwerten zu tun hat. Trotzdem sei der Konfuzianismus heute wieder stark im Kommen, geduldet und gefördert von der Partei. Die KP will die philosophischen Ideen für sich nutzen. “Die Partei beruft sich auf Traditionen und kann so positive Energien in der Bevölkerung abschöpfen”, sagt Soffel.
“In Taiwan bekommt man ein ganz anderes Bild”, sagt der Sinologe. Die konfuzianische Szene auf der Insel sei offener und kreativer: “Dort sind eher Moral und Ideale wie die Menschenwürde wichtig.”
Soffel hofft, dass er sich über solche Ideen bald wieder persönlich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen kann. Er ist Sekretär der European Association for Chinese Philosophy, im nächsten Jahr wollen sich die Mitglieder zu einer Konferenz in Italien treffen. Wann die nächste Reise nach China ansteht, kann der Sinologe noch nicht abschätzen. Dennoch ist Soffel sich sicher: “Ich dürfte noch erleben, wie das Verhältnis wieder besser wird.” Jana Hemmersmeier
Dominik Fischer ist neuer Market Manager für China und Ostasien bei Würth Group. Fischer hat die Position seit Juli inne, zuvor war er vier Jahre in den International Direct Sales ebenfalls bei Würth tätig.
Dominik Brugger ist neuer Head of Engineering für China bei Rena Technologies in Furtwangen. Brugger war zuvor Entwicklungsingenieur bei Rena.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Arbeitsplatz mit Ausblick auf den Jangtse: Die Versorgungstechniker warten auf eines der letzten Teile für einen Stromübertragungsturm der 800-Kilovolt-UHV-Direktleitung Baihetan-Zhejiang. Die Arbeit an mehreren Übertragungstürmen wurde in dieser Woche abgeschlossen. Mit einer Gesamtlänge von rund 2.140 Kilometern ist das Projekt ein wichtiger Teil der West-Ost-Stromversorgung Chinas.
