die Stärkung von Technik und Wissenschaft war neben der Einführung der Marktwirtschaft der größte Faktor für Chinas Erfolge nach 1978. Nach der Kulturrevolution befand sich die Mathematik an Chinas Hochschulen auf dem Stand des deutschen Oberstufenunterrichts. Wie wir alle wissen, hat sich die Lage seitdem gedreht. Chinas Schulen und Unis haben Weltklasseniveau, die IT-Firmen des Landes rangieren weit vor der deutschen Konkurrenz, wo sie überhaupt vorhanden ist.
Im CEO-Talk mit dem China.Table spricht Niels Peter Thomas über einen wichtigen Aspekt des Wissenschaftsbetriebs: das Publikationswesen. Er leitet die China-Niederlassung des Verlags Springer Nature, der wichtigen Fachzeitschriften herausbringt. Thomas zufolge geht der Aufstieg der chinesischen Wissenschaft derzeit in eine neue Phase. Er registriert einen rasanten Anstieg der Zahl hervorragender Veröffentlichungen. Rückkehrer von ausländischen Hochschulen haben die Methoden und den Geist der Wissenschaft nach China gebracht. Eine neue Generation steht jetzt den Forscherkollegen in den USA und Europa in nichts mehr nach. Der positive Effekt: “Die Vielfalt wird größer.”
Doch Thomas blickt auch über sein Fachgebiet hinaus. Gerade bei der Wissenschaftskooperation sieht er keinen Trend zu Abschottung. In einer Zeit, in der China immer unzugänglicher erscheint, ist das eine gute Nachricht. “Es gibt in der Bevölkerung weiterhin eine unglaubliche Aufgeschlossenheit und Neugier der Welt gegenüber“, sagt Thomas. An einer Konfrontation mit dem Westen habe hier keiner ein Interesse.
Kurz vor der großen Konferenz in Glasgow hat China am Sonntag seinen großen Klimaplan online gestellt. Darin finden sich die bekannten Ziele: einen Rückgang der Kohleverbrennung ab 2030 und CO2-Neutralität bis 2060. Dazu kommen aber zahlreiche neue Details, die Nico Beckert genauer unter die Lupe genommen hat.
Einen guten Start in die Woche wünscht


Dr. Niels Peter Thomas ist erst 49 Jahre alt und dennoch kennt er noch das China ohne Autos. Als Schüler hat er ab 1985 in Peking gelebt, seine Mutter war dort Lehrerin. Fasziniert von dem Land, kam er dann als Studierender wieder. Der Diplom-Elektroingenieur hat in Wirtschaft promoviert. Er ist nun schon zum zweiten Mal als Manager im Land.
Heute ist er Präsident für die Region Greater China eines der größten Wissenschaftsverlage der Welt: Springer Nature. Das bedeutet viel Tradition. Denn zum Verlag gehören beispielsweise das britische Wissenschaftsjournal Nature (1908 gegründet), sowie Scientific American (1844 gegründet), für das später auch Albert Einstein geschrieben hat. Und der deutsche Springer Verlag aus Heidelberg ist sogar noch älter: Er ist 1842 entstanden.
Aber Springer Nature steht mindestens ebenso für Innovation. Der Verlag betreibt die größte Open-Access-Wissenschafts-Plattform der Welt. Er hat Fachbücher publiziert, die nicht mehr von Menschen, sondern von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden. Die Muttergesellschaft ist mit 53 Prozent die Stuttgarter Holtzbrinck Publishing Group. Um das Gespräch in voller Länge als Video zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Herr Thomas, wie gut geht China mit seinem Wissen um?
Beeindruckend ist ein zunehmendes Bewusstsein für die Bedeutung von Wissen, wenn man mit Universitäten oder Forschern spricht, aber auch mit Behörden. Es geht um die Sammlung, Organisation und den unkomplizierten Austausch von Wissen. Der Sinn dafür ist zuweilen sogar ausgeprägter als bei uns im Westen
Woher kommt das?
Für ein schnell wachsendes Land mit einer langen erfolgreichen Geschichte ist es offensichtlicher, wie wichtig Innovation und die Weitergabe von Wissen für die wirtschaftliche und technologische Entwicklung sind. China hat eine lange Tradition der Wissensweitergabe. Auch daraus resultiert der Wunsch, Wissen immer besser zu managen. Peking will dies nicht dem Zufall überlassen, wie das in manchen Bereichen im Westen leider der Fall ist.
Betrifft das auch die internationale Zusammenarbeit? Oder glaubt Peking, das Wissensmanagement mehr und mehr alleine hinzubekommen?
Nein, auch Peking ist sich bewusst, dass man als globaler Einzelgänger die Entwicklungsgeschwindigkeit nicht halten kann. Das gilt übrigens nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Politik. Auch dort ist internationale Zusammenarbeit nötiger denn je. Es gibt zwar auch Bereiche, in denen man sich abschottet, aber das ist nicht der große Trend an den Universitäten.
Die wissenschaftlichen Gemeinschaftsproduktionen zwischen chinesischen und ausländischen Wissenschaftlern sind in der vergangenen Dekade deutlich gestiegen. Das sehen wir an der Anzahl der wissenschaftlichen Fachaufsätze, die in begutachteten internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften von chinesischen Forschern akzeptiert und publiziert wurden. Inzwischen sind 27 Prozent davon zusammen mit ausländischen Wissenschaftlern geschrieben, Tendenz steigend. Von einer Abschottung kann also nicht die Rede sein.
Der Schwerpunkt liegt dann aber sicherlich im naturwissenschaftlichen Bereich?
In jedem Fall, wenn man die absoluten Zahlen betrachtet. Allerdings gibt es auch ein beachtliches prozentuales Wachstum der chinesisch-ausländischen Artikel in den Sozial- und Geisteswissenschaften, auch wenn wir bei manchen ideologischen Themen nur schwer zusammenkommen. Und es werden Themen an chinesischen Universitäten erforscht, die in Europa nur noch Nischenthemen sind, zum Beispiel zur Soziologie des ländlichen Raums.
Woran liegt dieser Boom?
Es ist ein zentraler Teil der chinesischen Politik, den internationalen Austausch in vielen Bereichen zu fördern. Internationale Publikationen oder Konferenzen auf internationalen Niveau werden finanziell gefördert oder sind mit besseren Karrierechancen verbunden. Gleichzeitig will sie den wissenschaftlichen Forschungsstand der Welt nach China holen. Beides hilft der chinesischen Wissenschaft besser zu werden und erhöht die Innovationsgeschwindigkeit im globalen Wettbewerb.
Warum sind Chinas Wissenschaftler nun wieder so innovativ? Zwei, drei Jahrzehnte lang waren wir ja überzeugt: Das, was die Chinesen am besten können, ist vom Westen zu kopieren.
Sie mussten erst einmal wieder aufschließen. In der Wissenschaft würden wir das eher als Fleißarbeit bezeichnen denn als kopieren. Es gab lange ein nacherzählendes Wachstum an Forschungsarbeiten. Inzwischen sehen wir allerdings bei “Springer Nature” mit seiner strengen Auslese, was Relevanz und Qualität betrifft, ein signifikantes qualitatives Wachstum. Alle Artikel müssen sich, egal woher sie kommen, einem Peer-Review-Verfahren unterziehen. Das bedeutet, sie müssen von unabhängigen Fachkollegen für wissenschaftlich solide und relevant befunden werden, was meist bedeutet, dass westliche Wissenschaftler die Artikel ihrer chinesischen Kollegen begutachten.
Hat Sie das überrascht?
Nein, das hat sich hinter den Kulissen über viele Jahre angebahnt. Die besten Universitäten bekommen sehr viel Geld und Infrastruktur. Schon lange, also seit mehr als zehn Jahren, gibt es Anreize für chinesische Wissenschaftler, die im Ausland Karriere gemacht haben, nach China zurückzukehren. Das wiederum prägt die nächste Generation der Doktoranden. Sie können inzwischen an vielen chinesischen Universitäten in manchen Fachgebieten so promovieren, als ob sie im Ausland wären.
Sie waren schon als Schüler in den achtziger Jahren in China. Welche Erfahrungen können Sie mit uns teilen?
China ist ein Land, das man nur wirklich begreifen kann, wenn man länger vor Ort ist. Und ich bin dankbar, dass ich die Chance hatte, China über so einen langen Zeitraum immer wieder zu erleben. Wenn ich damals mit der U-Bahn zur Schule gefahren bin und war einen Tag krank, haben mich am nächsten Tag unbekannte Mitfahrer gefragt, wo ich denn gestern gewesen sei. Das ist heute eher unwahrscheinlich und sagt viel über das alte und das neue Peking.
Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als der dritte Ring gebaut wurde, der am Hotel Kempinski vorbeiführt. Damals wurde eine sechsspurige Autobahn ins Grüne gesetzt. Ich war nicht der einzige, der sich damals gefragt hat, ob das nicht ein großer Unsinn ist. Dort fuhren anfangs ja nur Pferdekarren und ein paar Fahrräder. Heute verläuft der dritte Ring mitten in der Stadt, er ist immer verstopft und es gibt inzwischen einen sechsten Ring. Aufgrund dieser Erfahrung sehe ich gegenwärtige Zukunftsprojekte Chinas mit ganz anderen Augen.
Ist China heute nationalistischer geworden?
Das ist ein schwieriger Begriff im Deutschen. Wenn Nationalismus Stolz auf das Erreichte und ein größeres Selbstbewusstsein meint, bis hin zu der Tendenz, dass man sich von anderen immer weniger sagen lassen will, was man zu tun oder zu lassen hat, dann würde ich zustimmen. Wenn mit Nationalismus Abschottung gemeint ist, würde ich widersprechen. Es gibt in der Bevölkerung – jedenfalls bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe – eine unglaubliche Aufgeschlossenheit und Neugier der Welt gegenüber, eine Bereitschaft voneinander zu lernen.
Gilt das auch für das Verhältnis zwischen chinesischen und internationalen Wissenschaftlern? Politisch knirscht es ja gewaltig.
In der Wissenschaft spürt man das kaum. Die Vernetzung steht im Vordergrund, nicht die Konfrontation. Wissenschaftler interessiert weniger, woher das neue Wissen kommt, das ihren Fachbereich voranbringt, sondern mehr, ob man zusammen schneller weiterkommt als auf eigene Faust. So sind sehr erfolgreiche internationale Kooperationen entstanden. Manche westlichen Wissenschaftler schauen inzwischen neidisch auf die Ausstattung ihrer chinesischen Kollegen.
Welche Rolle hat das Corona-Virus gespielt? Hat es die Szene der Virologen politisch entzweit?
Nein. In der Not ist man sogar eher zusammengerückt. Die großen Wissenschaftsverlage haben sich kurz nach dem Corona-Ausbruch entschieden, alle Inhalte zu diesem Thema ohne Bezahlschranke zugänglich zu machen. Damit wurde es noch einfacher, weltweit zusammenzuarbeiten. Die erste Welle der Publikationen kam ja vor allem aus China, weil China früher von dem Virus betroffen war und schon Erfahrungen mit SARS hatte. Da haben sich die inzwischen stabilen und vertrauensvollen Netzwerke zwischen chinesischen und internationalen Forschern bewährt.
Dass die Westler nicht ins Labor konnten, sondern zu Hause im Homeoffice saßen, während die chinesischen Kollegen schon wieder im Labor arbeiten konnten, hat den Austausch eher noch erhöht. Das alles finde ich sehr ermutigend. Natürlich kenne ich auch die politischen Spannungen in diesem Kontext, aber auf Arbeitsebene gibt es immer noch sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wie verändert sich die Wissenschaftslandschaft dadurch, dass mit China nun ein großer neuer Spieler auf dem Markt ist, der gleichzeitig Partner und Wettbewerber ist?
Die Vielfalt wird größer. Sehr viele neu erforschte Themen kommen aus China. Schon jetzt gehören einige chinesische Metropolregionen zu den weltweit innovativsten Regionen. Peking gehört dazu, sicherlich auch Shanghai und Nanjing und vor allem auch die Greater Bay Area mit Shenzhen und Guangzhou im Süden des Landes. Sie müssen sich nicht mehr verstecken gegenüber traditionellen Zentren wie Boston in den USA, dem Silicon Valley für angewandte Forschung, Oxford in England oder auch München in Deutschland.
Bei den Nobelpreisträgern sieht es aber noch anders aus. Da ist China nicht einmal unter den Top 10 aller Länder. Die USA haben rund 400, China nicht einmal 10.
Da der Preis seit 120 Jahren vergeben wird, dauert es natürlich entsprechend länger aufzuholen. Dass die Chinesen dieses Thema beschäftigt, habe ich jüngst auf einer Konferenz mitbekommen, bei der es um die Zukunft der chinesischen Wissenschaft geht. Da wurde die Frage an einen amerikanischen Nobelpreisträger gestellt, was China tun muss, um mehr Nobelpreise zu bekommen.
Und?
Die Antwort lautete: Such dir die schlausten Köpfe deines Landes, bring sie zusammen, gib ihnen genügend Ressourcen und maximale Freiheit, zu erforschen, was sie erforschen wollen und auch Fehler zu machen. Gib ihnen auf keinen Fall vor, in welche Richtung sie gehen sollen. Und dann warte geduldig 30 bis 35 Jahre ab.
Eine bittere Nachricht für Politiker, die sich selbst in China nicht 30 Jahre in ihrer Spitzenposition halten.
Das ist jedenfalls ein großer Ansporn, eine Abkürzung zu finden. Ich bin sehr gespannt, ob es in China nicht doch schneller geht.
Wichtig ist dabei sicher auch das Thema Open Access. Wie steht man in China dazu?
Es wird derzeit erstaunlicherweise viel über Open Access gesprochen. Dabei geht es vor allem darum, dass auch Forschungseinrichtungen in kleineren Städten guten Zugang zum globalen Wissenspool bekommen und dass Forschungen, wenn sie relevant sind, auch international wahrgenommen werden.
Dass die Chinesen ein Interesse daran haben, kann man verstehen. Aber hat auch der Westen ein Interesse daran?
Ich glaube, es ist wichtig einzusehen, dass wir die großen gesellschaftlichen und technischen Herausforderungen nur gemeinsam lösen können. Deswegen haben wir ein Interesse daran, die Vernetzung weiter zu fördern. Dazu gibt es keine Alternative aus wissenschaftlicher Sicht!
Das ist klar. Aber ein Wissenschaftsverlag kann ja kein Interesse an Open Access haben. Denn er lebt von Bezahlschranken.
Auch bei Open Access wird unser Service bezahlt. Allerdings nicht vom Leser, sondern aus dem Budget der Institution, die die Forschung fördert, die ja ein großes Interesse daran hat, dass die Forschungsergebnisse breit wahrgenommen werden.
Schränkt das nicht die publizistische Unabhängigkeit ein?
Nein. Open Access bedeutet nicht, dass jeder, der bezahlt, alles publizieren kann, was er will, sondern nur das, was unsere strenge Qualitätskontrolle durchlaufen hat und dann für alle erreichbar ist. Deshalb gibt es einen ganz klaren Trend zu mehr Open Access. In manchen Fachgebieten ist bereits die Schwelle von 50 Prozent überschritten. In den Lebenswissenschaften hat es angefangen und kommt nun auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften an. Die Ingenieure hinken noch ein wenig hinterher.
Im politischen Kontext Chinas finde ich es sehr spannend, dass sich sowohl die Politik als auch die Wissenschaft mehr und mehr dafür interessiert, wie Open Access funktioniert. Die Chinese Academy of Sciences, also die hiesige wissenschaftliche Leitinstitution, wird noch in diesem Jahr eine Open-Access-Week veranstalten, um über das Thema zu informieren.
Open Access und Ideologie passen allerdings nicht gut zusammen. Denn Ideologie will Wissen kanalisieren, zensieren.
Wir müssen realistisch sein. Es wird in China Open Access und Zensur nebeneinander geben. Am Ende steht dann wohl ein Open Access mit chinesischen Charakteristiken. Immer noch wahrscheinlich ein beachtlicher Fortschritt, allerdings womöglich einer, der nicht so weit geht, wie wir uns das gewünscht hätten.
Wie gehen Sie denn mit dem Thema Zensur generell um?
In der Hauptrichtung unserer Arbeit spielt sie kaum eine Rolle: Wir wollen chinesischen Autoren, wie allen anderen Autoren weltweit auch, die Möglichkeit geben, international zu publizieren. Aber wir lizenzieren auch westliche Inhalte für China. Das ist in manchen Fachgebieten schwieriger, keine Frage. Aber es ist gut zu wissen, dass die Versorgung chinesischer Wissenschaftler mit internationaler Literatur auch aus den Sozial- und Geisteswissenschaften heute insgesamt vielfältiger ist als noch vor wenigen Jahren beziehungsweise Jahrzehnten. Pekings Schwerpunkt liegt immer noch eher in Richtung Versorgung mit Wissen als in Richtung Abschottung. Was für uns in diesem Zusammenhang wichtig ist: Wir legen als Verlag keine unterschiedlichen Kriterien für Publikationen aus verschiedenen Ländern an.
China ist technologisch sehr offen. Hier stellt man sich womöglich früher die Frage, wie die vielen Daten und die Künstliche Intelligenz wissenschaftliche Texte und Verlage verändern.
Das ist eine junge und sehr spannende Diskussion, die extrem relevant ist für die weitere Entwicklung der Wissenschaftswelt. Wir sprechen dabei nicht mehr von Open Access, sondern von Open Science. Dieser Begriff beinhaltet nicht nur Texte, sondern eben auch Daten. Der einfache und freie Zugang zu einer ungeahnt großen Menge von Daten wird eine neue Wissenschaft ermöglichen. Für den Bereich der Forschung und Entwicklung ist in China die Offenheit dafür viel größer, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Wie werden sich die Publikationen dadurch verändern?
Wir sind tatsächlich schon relativ weit. Wir publizieren schon zwei Jahre lang Bücher, die keinen menschlichen Autor mehr haben, sondern von einem Algorithmus geschrieben worden sind. Bei dem ersten Buch ging es um Lithium-Ionen-Batterien, also um ein Thema, bei dem auch chinesische Forschung eine zentrale Rolle spielt.
Wie funktioniert das?
Wir haben einen Algorithmus damit trainiert, alles zu lesen, was zu diesem Thema zu finden war. Das können 15.000 und mehr Artikel oder Kapitel sein, also mehr als jeder Mensch in einem vernünftigen Zeitrahmen lesen und verarbeiten könnte. Der Algorithmus versucht, Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen, zum Beispiel, indem er schaut, was, wie oft und wo zitiert wird. So bilden sich Cluster, aus denen allmählich eine Struktur für ein solches Buch entsteht. Daraus wird am Ende ein Buch, von dem die Forscher überzeugt sind, dass es tatsächlich den Stand der Forschung angemessen darstellt.
Ein Buch allerdings, in dem nichts Neues drinsteht.
Das haben wir uns auch gedacht. Es entsteht in diesen Clustern jedoch eine neue Struktur. Die Art, wie der Algorithmus die Erkenntnisse zusammen denkt, unterscheidet sich erheblich von den vorhandenen Reviews zu dem Thema. Es entsteht durchaus ein neuer eigenständiger Blickwinkel, der in eine neue Richtung weist. Einen Literaturnobelpreis wird ein solcher Text nicht bekommen. Aber die Elektro-Chemiker sagen, das bringt meine Doktoranden auf neue Ideen, weil es eine unglaubliche kompakte Form ist, den Stand der Forschung darzustellen.
Neben den Autoren können wir auch den Lesern einen neuen Service bieten. Sprachbarrieren können immer mehr durch Software überwunden werden und die Leser können gewissermaßen dem Buch mitteilen, wie viel Zeit sie für welchen Aspekt des Buches haben und bekommen dann umgehend die entsprechende Zusammenfassung oder einen höheren Detailgrad. Es gibt dann noch eine Ursprungsausgabe, aber ansonsten kann sich das Buch den Wünschen des Lesers anpassen.
Wie praktisch. Der Verlag schafft den lästigen Autor ab …
… und gleich auch den Lektor. Wir produzieren dann auf Knopfdruck Bücher wie Waschmaschinen. Nein, darum geht es selbstverständlich nicht. Das ist wie beim autonomen Fahren. Es wird das Selbstfahren nie völlig ersetzen, ist aber hilfreich, um einfacher und schneller ans Ziel zu kommen. Beim Schreiben von Büchern wird es wahrscheinlich der Normalfall werden, dass die Algorithmen dem Autor helfen, die Daten und den Forschungsstand so aufzubereiten, dass der Forscher mehr Zeit und Spielraum hat, den Forschungsstand zu interpretieren. Damit schaffen es Autoren, Bücher zu verfassen, die dafür unter analogen Umständen keine Zeit hätten.
Der Algorithmus kann dem Autor also helfen, mehr Zeit zu haben, Neues zu entdecken. Unsere Aufgabe als Verlag wird es zukünftig sein, den Autoren diesen Service zur Verfügung zu stellen. Eines der größten Hemmnisse im Verlagsgeschäft ist ja bekanntlich der innere Schweinehund des Autors. In Zukunft können wir mit Algorithmen den Autor unterstützen, diesen zu überwinden.
Kurz vor der Weltklimakonferenz in Glasgow hat China am Sonntag das lang erwartete “oberste Planungsdokument” zur Erreichung der nationalen Klimaziele vorgelegt. In dem Strategiepapier werden die wichtigsten Klimaziele bis 2025, 2030 und 2060 dargelegt. Die in Klimaplan aufgezeigten Ziele entsprechen in großen Teilen schon zuvor geäußerten Zielwerten, aber es gab auch Überraschungen:
Die Volksrepublik agiert also kurzfristig nicht mit absoluten Zielen zur Senkung der CO2-Emissionen. Stattdessen gibt es weiterhin nur Ziele, die in Bezug zum Wirtschaftswachstum stehen. Die relativen Zielsetzungen bedeuten, dass die CO2-Emissionen bei hohem Wachstum nur langsam sinken.
Der am Sonntag vorgelegte Klimaplan ist das oberste Planungsdokument für Chinas Weg zum Netto-Null-Ziel – also dem Ausstieg aus dem Treibhausgasausstoß unter Berücksichtigung von Ausgleichsmöglichkeiten. Der Plan gibt den Rahmen “für die gesamte künftige Klimaplanung vor”, wie die Analysten der Beratungsfirma Trivium China schreiben. Dem zentralen Plan wird nun eine Reihe von Aktionsplänen folgen, die mehr Details zur Erreichung der Klimaziele beinhalten werden.
Diese Aktionspläne beziehen sich dann auf bestimmte Sektoren wie beispielsweise den Energie-, Industrie- oder Transportsektor. Insgesamt machen der Klimaplan und die Aktionspläne den sogenannten “1+N-Rahmenplan” aus. Die “1” steht für den Klimaplan, das “N” für eine bestimmte Anzahl an Aktionsplänen. Damit folgt er dem Ansatz der Fünfjahrespläne, die von einem Leitdokument ausgehend detaillierte Teilpläne für Branchen und Regionen umfassen.
Laut Trivium China brauchte die Volksrepublik dringend diesen zentralen Klimaplan, um “all die willkürlichen Planungen, die bereits im Gange sind, einzudämmen.” Denn allerlei Akteure, von Ministerien über Provinz- und Lokalregierungen sowie den oft staatlichen Unternehmen versuchen “krampfhaft, ihre Übereinstimmung mit Xi Jinpings Klimazielen zu demonstrieren”, so die Analysten von Trivium.
Der Klimaplan enthält auch eine Passage zum Transportsektor. Der Ausbau der E-Mobilität soll beschleunigt werden. Dazu gehört der Ausbau des Netzwerks von Ladestationen und Batterie-Tausch-Stationen für E-Autos. Zudem sollen die Energieeffizienzstandards für Autos mit Verbrennungsmotoren weiter verschärft werden. Zugstrecken sollen schneller elektrifiziert werden und der Gütertransport grüner werden.
Auch der Bausektor soll energiesparender arbeiten und die vorhandenen Gebäude sollen weniger Strom verbrauchen. Innovationen und Technologien sollen dazu beitragen, dass die CO2-Emissionen in allen Sektoren sinken.
Der Plan wiederholt zudem das schon in der Vergangenheit geäußerte Bekenntnis, Investitionen in CO2-intensive Projekte wie Kohlestrom, Stahl, Aluminium, Zement und petrochemische Produkte “streng zu kontrollieren”. Zudem sollen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung unterstützt werden. Auch der Green Finance Sektor soll weiter ausgebaut und die Standards in diesem Bereich weiterentwickelt werden (China.Table berichtete). Banken sollen laut dem Klimaplan dazu ermutigt werden, günstige Kredite für nachhaltige Investitionen zur Verfügung zu stellen (China.Table berichtete).
Der Klimaplan enthält zudem einige sogenannte “Funktionsprinzipien”. Damit sind die politischen und wirtschaftlichen Mechanismen gemeint, die die Umsetzung voranbringen sollen. Beispielsweise sollen Staat und Markt gleichermaßen zur Erreichung der Klimaziele beitragen.
Peking hat schon in den letzten Jahren vermehrt auf Marktmechanismen gesetzt. Im Juli wurde nach jahrelanger Planung ein nationaler Emissionshandel gestartet. Daran müssen bisher allerdings vorrangig Kohlekraftwerke teilnehmen. Auch der Preis pro Tonne CO2 ist derzeit noch sehr gering (China.Table berichtete).
Nichtsdestotrotz umfasst der Emissionshandel schon heute gut 40 Prozent aller in China verursachten Emissionen. Nach dem langsamen Handelsstart könnte schon bald eine erhebliche Beschleunigung folgen, da die erste Phase des Emissionshandels lediglich als vorsichtige Testphase gilt. Der Klimaplan sieht die “schrittweise Ausweitung” des Emissionshandels vor, der allerdings schon ursprünglich mehr Sektoren umfassen sollte als lediglich die gut 2.000 Kraftwerke aus dem Energiesektor, die er derzeit umfasst.
Ein in den letzten Monaten ebenfalls diskutierter Marktmechanismus ist die Bepreisung von Naturgütern und -dienstleistungen. Die Idee dahinter: Wenn die Umwelt einen Preis hat, ist der Anreiz größer, sie zu schützen. Dadurch soll es gelingen, Naturdienstleistungen wie die Speicherung von CO2 durch Wälder und Moore zu erhalten. Die politischen Eliten debattieren dazu sogar die Einführung eines sogenannte “Brutto-Ökosystem-Produkts”, dass den Umweltschutz messbar machen soll und langfristig auf einer Ebene mit der Wirtschaftsleistung und dem BIP stehen könnte (China.Table berichtete). Der Klimaplan sieht nun vor, einen “ökologischen Ausgleichsmechanismus einzuführen, der den Wert von Kohlenstoffsenken widerspiegelt”.
Ein weiteres Funktionsprinzip des Klimaplans ist die “Vorbeugung von Risiken”. Der Plan betont die “Beziehung zwischen Klimaschutz und Energiesicherheit und der Sicherheit von industriellen Lieferketten” und ruft dazu auf, eine “Überreaktion zu verhindern”. Das bedeutet, dass die Reduktion von CO2-Emissionen nicht auf Kosten der Energiesicherheit der Industrie gehen dürfen, beziehungsweise dass der Aufbau neuer Energiequellen abseits der Kohle schnell genug voranschreiten muss, damit es nicht zu wiederholten Energiekrisen wie derzeit kommt (China.Table berichtete).
Die Analysten von Refinitiv gehen jedoch trotz des noch vor der Klimakonferenz in Glasgow vorgelegten Klimaplans nicht davon aus, dass China auf der Konferenz neue Zugeständnisse machen wird. Chinas politische Führung müsse kurzfristig “die Energieversorgung im Winter und anschließenden Frühling sicherstellen”, so Refinitiv.
China hat den Plan in Hinblick auf die bevorstehende UN-Klimakonferenz (COP26) veröffentlicht. Die Volksrepublik befindet vor der COP26 in einem größeren Dilemma als ursprünglich angenommen (China.Table berichtete). Denn eine Häufung von Stromausfällen lässt einen schnellen Ausstieg aus der Kohle derzeit wieder unwahrscheinlicher erscheinen. Das Land ist derzeit noch zu abhängig vom Kohlestrom. Der starke Preisanstieg des Rohstoffs hat den Verbrauch verteuert. Da die Strompreise lange Zeit staatlich reguliert waren, konnten sie nicht ebenfalls ansteigen. Die Herstellung von Elektrizität war für die Kraftwerke nicht mehr profitabel. Strom aus anderen Quellen konnte den Ausfall beim Kohlestrom nicht ersetzen. In ganzen Regionen gingen die Lichter und Klimaanlagen aus, Fabriken standen still. All das zeigt, wie abhängig China nach derzeitigem Stand noch von der Kohle ist. Mitarbeit: Finn Mayer-Kuckuk
Die USA würden Taiwan nach Worten von Präsident Joe Biden im Falle eines chinesischen Angriffs dabei helfen, sich zu verteidigen. Die US-Regierung habe eine “Verpflichtung”, dies zu tun, sagte Biden bei CNN. Washington suche keinen Konflikt mit China, aber Peking müsse verstehen, “dass wir keinen Schritt zurück machen werden, dass wir unsere Positionen nicht ändern werden”, so Biden. Die USA haben sich darauf festgelegt, die Verteidigungsfähigkeit Taiwans zu erhalten. Das bedeutet bislang vor allem Waffenlieferungen. Die Frage nach einem militärischen Beistand im Angriffsfall wurde meist bewusst offengelassen.
Nach der Frage eines Bürgers zu dem Thema hakte CNN-Moderator Anderson Cooper bei einer Town Hall-Veranstaltung in Baltimore nach und fragte Biden mit Blick auf China: “Sagen Sie, dass die Vereinigten Staaten Taiwan verteidigen würden, falls es versuchen würde, anzugreifen?” Biden antwortete daraufhin: “Ja, wir haben uns verpflichtet, das zu tun.”
Bidens Wortwahl signalisiert in der derzeitigen Lage allerdings nur vergleichsweise schwache Rückendeckung für Taiwan. Er verspricht “keinen Schritt zurück zu machen” – aber eben auch keinen nach vorn. Die Selbstverpflichtung zum Schutz Taiwans besteht zudem bereits seit Jahrzehnten. Biden hätte mit stärkerer Wortwahl auch eine deutlichere Botschaft nach Peking senden können. Er hat darauf aber vorerst verzichtet – vermutlich bewusst, um keinen diplomatischen Schlagabtausch mit China auszulösen.
Die Reaktionen aus Peking und Taipeh folgten dennoch prompt: Taiwans Regierung begrüßte die Aussage. “Seit Bidens Amtsübernahme hat die US-Regierung kontinuierlich durch praktische Schritte ihre felsenfeste Unterstützung für Taiwan demonstriert”, sagte ein Präsidentensprecher am Freitag – und erlaubte sich damit die maximale Interpretation der Worte Bidens.
Peking riet indes zu “Vorsicht”: “China wird keine Kompromisse eingehen, wenn es um seine grundlegenden Interessen wie Souveränität und territoriale Integrität geht”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP. Chinas Präsident Xi Jinping hatte den chinesischen Anspruch auf eine Vereinigung mit Taiwan zuletzt wiederholt bekräftigt (China.Table berichtete). ari
Mehrere chinesische Regionen registrieren steigende Corona-Zahlen auf sehr niedrigem Niveau. Die Behörden berichteten von 26 nachgewiesenen Fällen. Wie in China üblich, reagieren die Behörden heftig, um die Ausbrüche im Keim zu ersticken. Dabei blicken sie auch auf die Olympischen Spiele im Februar, die nicht von steigenden Infektionszahlen überschattet sein sollen. Das war im Sommer im Nachbarland Japan der Fall.
Die Stadt Peking hat am Sonntag die Wohnanlage Hongfuyuan im Distrikt Changping komplett abgeriegelt, nachdem dort eine Person positiv getestet wurde. Lebensmittel werden angeliefert, die Bewohner dürfen das Gelände nicht verlassen. Lieferfahrer übergeben ihre Waren an die Personal in Ganzkörper-Schutzkleidung, das sie in den Bereich innerhalb der Mauer der Wohnanlage weiterträgt.
Der für Sonntag geplante Marathon in der Stadt Wuhan fiel derweil aus. Die Organisatoren haben die Veranstaltung verschoben, “um das Risiko einer epidemischen Ausbreitung zu verhindern”. An dem Sportereignis wollten 26.000 Menschen teilnehmen. Ebenfalls betroffen sind die Provinzen Ningxia, Shaanxi und Hebei. fin
Der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande hat in letzter Minute eine Zahlung für Auslandsschulden geleistet. Eine letzte Nachfrist hätte am Samstag geendet – und 24 Stunden vorher hat das Unternehmen die nötigen 84 Millionen Dollar überwiesen. Das berichtet die Finanzzeitung Securities Times. Es ging um die Zahlung von Zinsen für eine Anleihe von ausländischen Investoren unter Federführung der Citibank.
Der Vorgang hat erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das Unternehmen die relativ kleine Summe im vergangenen Monat zum ursprünglichen Stichtag nicht aufbringen konnte. Das galt als sicheres Zeichen, dass mit Evergrande etwas nicht stimmt (China.Table berichtete). Noch bis Ende vergangenen Jahres hat Firmengründer Xu Jiayin mit Millionen und Milliarden um sich geworfen.
Die Überweisung hat an den Börsen zwar Erleichterung ausgelöst. Diese Reaktion kann jedoch als übertrieben gelten. Denn Evergrande schuldet seinen Geldgebern immer noch gut das 3.500-fache der Summe, die es jetzt mit Ach und Krach aufgebracht hat. Die meisten Gläubiger sitzen dabei im chinesischen Inland. Auch wenn Evergrande nun alle Auslandskredite regulär bediente, bliebe das Unternehmen überschuldet. Allein bis Jahresende sind Zinszahlungen in Höhe von umgerechnet einer halben Milliarde Dollar fällig. Damit ist noch nichts von den eigentlichen Schulden getilgt.
Evergrande bemüht sich dennoch, wieder zumindest ein bisschen gute Stimmung zu verbreiten. Am Sonntag hat das Unternehmen bekannt gegeben, an zehn Bauprojekten die Arbeit wieder aufzunehmen. Ein Symptom der Zahlungsschwierigkeiten war der Stillstand auf zahlreichen Baustellen von Evergrande. Der Immobilienentwickler konnte den Baufirmen und Handwerkern die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Auch die Wiederaufnahme der Arbeiten soll als positives Signal an die Märkte dienen. Denn je mehr Zweifel das Unternehmen umgeben, desto schwerer wird es, frische Mittel aufzutreiben. fin
Das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover und das Konfuzius-Institut an der Universität Duisburg-Essen haben eine Veranstaltung zu dem Buch “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt” kurzfristig abgesagt. Der Piper-Verlag, in dem das Buch herausgekommen ist, sieht “chinesischen Druck” als Grund des Rückziehers. “Die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute ist ein beunruhigendes und verstörendes Signal”, sagt Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg.
Autoren des Buches sind die Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges. China.Table hatte bei Erscheinen einen Auszug aus dem Werk veröffentlicht, das sich auch kritisch mit dem chinesischen Staats- und Parteichef auseinandersetzt. Eine Diktatur versuche hier, “ihre gegen unsere Freiheit gerichteten Werte international durchzusetzen”, kommentierte Aust den Vorgang.
Die Konfuzius-Institute werden von der chinesischen Regierung getragen. Nach Angaben des Verlags hat gegenüber dem Konfuzius-Institut in Hannover die Tongji-Universität Shanghai auf einer Absage der Veranstaltung bestanden. Die Tongji betreibt das Institut gemeinsam mit der Leibniz-Universität. In Duisburg intervenierte der Generalkonsul Chinas in Düsseldorf persönlich. Xi Jinping sei “unantastbar”, begründete laut Piper eine Mitarbeiterin des Konfuzius-Instituts das Vorgehen. fin
Die Regierung will die Schulkindern etwas entlasten. Ein neues Gesetz verbietet exzessive Hausaufgaben und ruft Schulen und Lehrer dazu auf, den Kindern auch Zeit für Spiel und Sport zu lassen. Das Gesetz wird am 1. Januar wirksam, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. Es geht vor allem darum, die Doppelbelastung aus Nachhilfeschulen und regulären Schulaufgaben aufzulösen. Im April hatte das Bildungsministerium bereits per Erlass vorgegeben, dass Erst- und Zweitklässler keine schriftlichen Hausaufgaben mehr erhalten sollen.
Chinas Eltern haben sich in den vergangenen Jahren einen zunehmend erbitterten Rüstungswettlauf um die besten Noten geliefert. Sie haben ihre Kinder dazu nach dem Vorbild Südkoreas und Japans in Zusatz-Schulen geschickt, die besonderen Erfolg garantieren. Die Kindern kommen jedoch ohnehin spät aus der Schule und haben zudem Hausaufgaben auf. Die Regierung sorgt sich daher um Gesundheit und Kreativität der jungen Chinesinnen und Chinesen. Im Juli hat sie zunächst das Nachhilfewesen reguliert, das bereits zu einer milliardenschweren Industrie geworden war (China.Table berichtete). Nun folgt die Eindämmung der Hausaufgaben. fin

Liebe ist gut für die Integration. Sie ist ein Anker. Liebe bildet sogar, wie Jochen Goller, Präsident und CEO der BMW Group Region China, bestätigt. Von 2004 bis 2009 war er schon einmal in der Volksrepublik – als Marketingleiter. Damals lernte er seine heutige Frau kennen. Als er 2015 zurück nach China kam, beherrschte er die Sprache schon sehr gut. Die gemeinsame Tochter lernt sogar drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Chinesisch.
Mit guten Sprachkenntnisse fällt es einem natürlich leichter, in China wirklich anzukommen. Goller brauchte keine Orientierungs- oder Eingewöhnungsphase. “Es gibt in Bezug auf China selten Zwischentöne. Entweder, man mag das Land, oder man mag es nicht. Ich gehöre zur ersten Gruppe und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt”, erzählt er.
Gollers erster China-Aufenthalt fiel in eine spannende Zeit. BMW, der deutsche Traditions-Autobauer, erlebte eine Entwicklung, die sonst eher zu Start-ups passt. Im Jahr 2004 explodierten die Geschäftszahlen in der Volksrepublik. Von 15 Händlern, die 12.000 Autos pro Jahr verkauften, sprang die Kurve auf 100 Händler und 90.000 Autos im Jahr 2009. Heute setzt die Marke aus Bayern dank 550 Händler etwa 750.000 Fahrzeuge ab.
Die Entwicklung BMWs in China spiegelt sich in der Entwicklung des gesamten Landes wider. Die Volksrepublik hatte zweistellige Zuwachsraten beim Bruttoinlandsprodukt. “Die Automobilindustrie ist ein Spiegelbild dessen, was in der Wirtschaft und in der Gesellschaft passiert”, so Goller. Das Bild großer Städte verändert sich bis heute in rasantem Tempo. Infrastruktur und Mobilität müssen da mithalten.
Eine Geschwindigkeit, die das Miteinander und die Gesprächskultur prägt. “Es ist ein sehr direktes und kompetitives Land. Keine Frage. Weil ganz China gesellschaftlich nach oben möchte”, so nimmt Goller es wahr. Die chinesische Teezeremonie dient ihm dabei als Gegengewicht. Die hat er lieben gelernt. Sie entschleunigt Meetings. Geschäftsführer und Firmenpräsidenten würden erst einmal Tee zubereiten, was eine entspannte Diskussionsebene erlaube. Auch, wenn der Ton ergebnisorientiert bleibe.
Das muss so sein. Denn die Mobilität in China steht vor Umwälzungen – in den kommenden Jahren will die Regierung verstärkt auf Wasserstoff setzen. Erst einmal im Bereich der Nutzfahrzeuge, betont Goller. BMW sei “technologieoffen” und habe aktuell eine Wasserstoff-Kleinserie auf der Straße. Sollte ab dem Jahr 2030 diese Antriebstechnologie bei Pkw eine Rolle spielen, sei auch seine Marke bereit.
Auch beim Halbleiter-Mangel gibt sich Goller eher gelassen. BMW sei gut durch die Krise gekommen und verlasse sich erfolgreich auf lokale Zulieferer. Zwar könnte das Problem mit den Mikrochips noch ein paar Quartale dauern, prophezeit Goller. Eine langfristige Änderung der Strategie sei aber nicht notwendig.
Dass BMW in der Position ist, der Branche in solchen Fragen Orientierung zu bieten, liegt auch an Goller: “Was ich von Anfang an mitgeprägt habe, war die Markenwahrnehmung von BMW und MINI und die Positionierung beider Marken sowie die entsprechende Produktpolitik.” Christian Domke Seidel
Heiko Hillebrandt ist als Fachanwalt für Patentrecht bei W. K. Gore & Associates von Hongkong nach München zurückgekehrt. Von Deutschland aus kümmert er sich weiterhin um Kunden im Raum Asien-Pazifik.
Tobias Gabriel ist jetzt Category Manager Electronics bei dem Autozulieferer Webasto in Shanghai. Gabriel ist in China von der Schindler Group zu Webasto gewechselt.
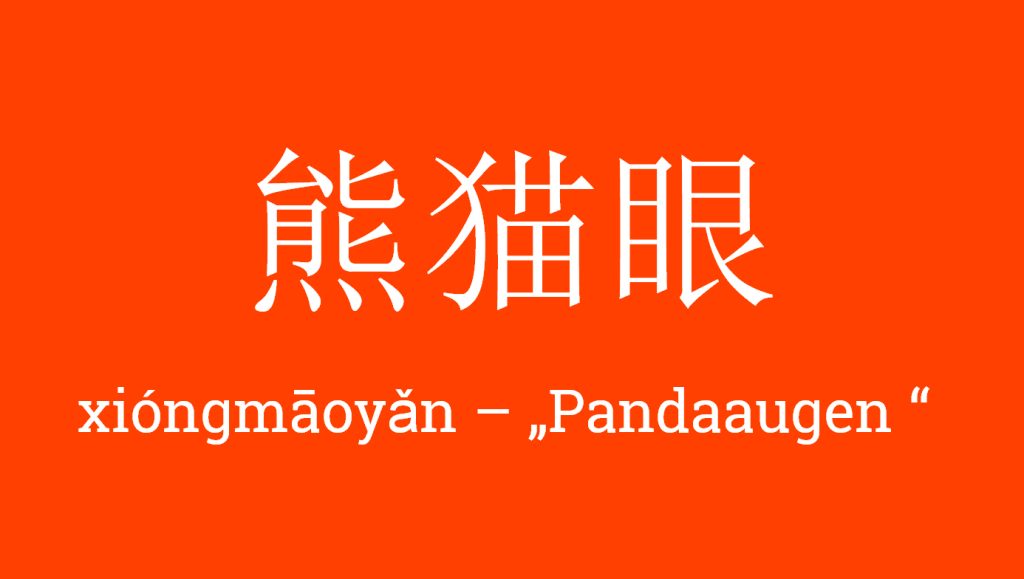
Montagmorgen vor dem ersten Kaffee? Sitzen Sie vielleicht gerade mit Pandaaugen vor dieser Kolumne? Sie haben richtig gehört! Der Panda ist nicht nur flauschiges Nationalschätzchen der Chinesen, sondern auch Namensgeber für ein Meme, dass es schon vor Social Media gab: nämlich dicke, schwarze Ringe unter den Augen. Die heißen in der chinesischen Umgangssprache tatsächlich “Pandaaugen” (zusammengesetzt aus 熊猫 xióngmāo “Panda” und 眼 yǎn von 眼睛 yǎnjing “Augen”).
Am zielsichersten züchtet man Pandaringe, wenn man sich die Nächte um die Ohren schlägt – bzw. sie langsam “durchköchelt”, wie der Chinese sagen würde (熬夜 áoyè “die Nacht durchköcheln”). Überstunden bis tief in die Nacht fühlen sich bekanntlich manchmal so rädernd an, als hätte man die ganze Nacht am Steuer gesessen – auf Chinesisch heißt das praktischerweise auch so: “den Nachtwagen fahren” (开夜车 kāi yèchē) ist ein Synonym für Rackern bis in die Morgendämmerung.
Der Blick in die Augenregion hält in China übrigens noch einige weitere wunderbar bildliche Wortkreationen parat, die uns Ausländern das Vokabellernen versüßen. Hier eine kleine Auswahl: Wer über die Jahre zu viele Pandaaugen-Phasen einlegt hat, bei dem ziehen sich vielleicht bald “Fischschwanzfalten” (鱼尾纹 yúwěiwén) durch die Augenwinkel (bei uns besser bekannt als “Krähenfüße”). Aber die lassen sich ja glücklicherweise gut mit einer “Tintenbrille” kaschieren (墨镜 mòjìng “Sonnenbrille”, wörtl. “Tinten-” oder “Tuschebrille”).
Oder alternativ mit einem wuchtigen Brillengestell. Wenn dieses zu extravagant ausfällt, läuft man allerdings Gefahr, als “Vierauge” veralbert zu werden (四眼 sìyǎn – Chinas Pendant für “Brillenschlange”). Und mit zu viel Brillentarnung ist man außerdem für die Augen von Freunden und Kollegen schnell nicht mehr “gar”, sondern “roh” (眼熟 yǎnshóu “bekannt, vertraut” – wörtlich “den Augen gar”; im Gegensatz zu: 眼生 yǎnshēng “fremd, unbekannt” – wörtlich “den Augen roh”). Dann doch lieber mutig Fischschwanzfalte zeigen, auch gerne mit Kontaktlinse. Auch für die kennt das Chinesische praktischerweise eine erfrischend einfache Übersetzung: 隐形眼镜 yǐnxíng yǎnjìng – “unsichtbare Brille”.
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.
die Stärkung von Technik und Wissenschaft war neben der Einführung der Marktwirtschaft der größte Faktor für Chinas Erfolge nach 1978. Nach der Kulturrevolution befand sich die Mathematik an Chinas Hochschulen auf dem Stand des deutschen Oberstufenunterrichts. Wie wir alle wissen, hat sich die Lage seitdem gedreht. Chinas Schulen und Unis haben Weltklasseniveau, die IT-Firmen des Landes rangieren weit vor der deutschen Konkurrenz, wo sie überhaupt vorhanden ist.
Im CEO-Talk mit dem China.Table spricht Niels Peter Thomas über einen wichtigen Aspekt des Wissenschaftsbetriebs: das Publikationswesen. Er leitet die China-Niederlassung des Verlags Springer Nature, der wichtigen Fachzeitschriften herausbringt. Thomas zufolge geht der Aufstieg der chinesischen Wissenschaft derzeit in eine neue Phase. Er registriert einen rasanten Anstieg der Zahl hervorragender Veröffentlichungen. Rückkehrer von ausländischen Hochschulen haben die Methoden und den Geist der Wissenschaft nach China gebracht. Eine neue Generation steht jetzt den Forscherkollegen in den USA und Europa in nichts mehr nach. Der positive Effekt: “Die Vielfalt wird größer.”
Doch Thomas blickt auch über sein Fachgebiet hinaus. Gerade bei der Wissenschaftskooperation sieht er keinen Trend zu Abschottung. In einer Zeit, in der China immer unzugänglicher erscheint, ist das eine gute Nachricht. “Es gibt in der Bevölkerung weiterhin eine unglaubliche Aufgeschlossenheit und Neugier der Welt gegenüber“, sagt Thomas. An einer Konfrontation mit dem Westen habe hier keiner ein Interesse.
Kurz vor der großen Konferenz in Glasgow hat China am Sonntag seinen großen Klimaplan online gestellt. Darin finden sich die bekannten Ziele: einen Rückgang der Kohleverbrennung ab 2030 und CO2-Neutralität bis 2060. Dazu kommen aber zahlreiche neue Details, die Nico Beckert genauer unter die Lupe genommen hat.
Einen guten Start in die Woche wünscht


Dr. Niels Peter Thomas ist erst 49 Jahre alt und dennoch kennt er noch das China ohne Autos. Als Schüler hat er ab 1985 in Peking gelebt, seine Mutter war dort Lehrerin. Fasziniert von dem Land, kam er dann als Studierender wieder. Der Diplom-Elektroingenieur hat in Wirtschaft promoviert. Er ist nun schon zum zweiten Mal als Manager im Land.
Heute ist er Präsident für die Region Greater China eines der größten Wissenschaftsverlage der Welt: Springer Nature. Das bedeutet viel Tradition. Denn zum Verlag gehören beispielsweise das britische Wissenschaftsjournal Nature (1908 gegründet), sowie Scientific American (1844 gegründet), für das später auch Albert Einstein geschrieben hat. Und der deutsche Springer Verlag aus Heidelberg ist sogar noch älter: Er ist 1842 entstanden.
Aber Springer Nature steht mindestens ebenso für Innovation. Der Verlag betreibt die größte Open-Access-Wissenschafts-Plattform der Welt. Er hat Fachbücher publiziert, die nicht mehr von Menschen, sondern von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden. Die Muttergesellschaft ist mit 53 Prozent die Stuttgarter Holtzbrinck Publishing Group. Um das Gespräch in voller Länge als Video zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Herr Thomas, wie gut geht China mit seinem Wissen um?
Beeindruckend ist ein zunehmendes Bewusstsein für die Bedeutung von Wissen, wenn man mit Universitäten oder Forschern spricht, aber auch mit Behörden. Es geht um die Sammlung, Organisation und den unkomplizierten Austausch von Wissen. Der Sinn dafür ist zuweilen sogar ausgeprägter als bei uns im Westen
Woher kommt das?
Für ein schnell wachsendes Land mit einer langen erfolgreichen Geschichte ist es offensichtlicher, wie wichtig Innovation und die Weitergabe von Wissen für die wirtschaftliche und technologische Entwicklung sind. China hat eine lange Tradition der Wissensweitergabe. Auch daraus resultiert der Wunsch, Wissen immer besser zu managen. Peking will dies nicht dem Zufall überlassen, wie das in manchen Bereichen im Westen leider der Fall ist.
Betrifft das auch die internationale Zusammenarbeit? Oder glaubt Peking, das Wissensmanagement mehr und mehr alleine hinzubekommen?
Nein, auch Peking ist sich bewusst, dass man als globaler Einzelgänger die Entwicklungsgeschwindigkeit nicht halten kann. Das gilt übrigens nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Politik. Auch dort ist internationale Zusammenarbeit nötiger denn je. Es gibt zwar auch Bereiche, in denen man sich abschottet, aber das ist nicht der große Trend an den Universitäten.
Die wissenschaftlichen Gemeinschaftsproduktionen zwischen chinesischen und ausländischen Wissenschaftlern sind in der vergangenen Dekade deutlich gestiegen. Das sehen wir an der Anzahl der wissenschaftlichen Fachaufsätze, die in begutachteten internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften von chinesischen Forschern akzeptiert und publiziert wurden. Inzwischen sind 27 Prozent davon zusammen mit ausländischen Wissenschaftlern geschrieben, Tendenz steigend. Von einer Abschottung kann also nicht die Rede sein.
Der Schwerpunkt liegt dann aber sicherlich im naturwissenschaftlichen Bereich?
In jedem Fall, wenn man die absoluten Zahlen betrachtet. Allerdings gibt es auch ein beachtliches prozentuales Wachstum der chinesisch-ausländischen Artikel in den Sozial- und Geisteswissenschaften, auch wenn wir bei manchen ideologischen Themen nur schwer zusammenkommen. Und es werden Themen an chinesischen Universitäten erforscht, die in Europa nur noch Nischenthemen sind, zum Beispiel zur Soziologie des ländlichen Raums.
Woran liegt dieser Boom?
Es ist ein zentraler Teil der chinesischen Politik, den internationalen Austausch in vielen Bereichen zu fördern. Internationale Publikationen oder Konferenzen auf internationalen Niveau werden finanziell gefördert oder sind mit besseren Karrierechancen verbunden. Gleichzeitig will sie den wissenschaftlichen Forschungsstand der Welt nach China holen. Beides hilft der chinesischen Wissenschaft besser zu werden und erhöht die Innovationsgeschwindigkeit im globalen Wettbewerb.
Warum sind Chinas Wissenschaftler nun wieder so innovativ? Zwei, drei Jahrzehnte lang waren wir ja überzeugt: Das, was die Chinesen am besten können, ist vom Westen zu kopieren.
Sie mussten erst einmal wieder aufschließen. In der Wissenschaft würden wir das eher als Fleißarbeit bezeichnen denn als kopieren. Es gab lange ein nacherzählendes Wachstum an Forschungsarbeiten. Inzwischen sehen wir allerdings bei “Springer Nature” mit seiner strengen Auslese, was Relevanz und Qualität betrifft, ein signifikantes qualitatives Wachstum. Alle Artikel müssen sich, egal woher sie kommen, einem Peer-Review-Verfahren unterziehen. Das bedeutet, sie müssen von unabhängigen Fachkollegen für wissenschaftlich solide und relevant befunden werden, was meist bedeutet, dass westliche Wissenschaftler die Artikel ihrer chinesischen Kollegen begutachten.
Hat Sie das überrascht?
Nein, das hat sich hinter den Kulissen über viele Jahre angebahnt. Die besten Universitäten bekommen sehr viel Geld und Infrastruktur. Schon lange, also seit mehr als zehn Jahren, gibt es Anreize für chinesische Wissenschaftler, die im Ausland Karriere gemacht haben, nach China zurückzukehren. Das wiederum prägt die nächste Generation der Doktoranden. Sie können inzwischen an vielen chinesischen Universitäten in manchen Fachgebieten so promovieren, als ob sie im Ausland wären.
Sie waren schon als Schüler in den achtziger Jahren in China. Welche Erfahrungen können Sie mit uns teilen?
China ist ein Land, das man nur wirklich begreifen kann, wenn man länger vor Ort ist. Und ich bin dankbar, dass ich die Chance hatte, China über so einen langen Zeitraum immer wieder zu erleben. Wenn ich damals mit der U-Bahn zur Schule gefahren bin und war einen Tag krank, haben mich am nächsten Tag unbekannte Mitfahrer gefragt, wo ich denn gestern gewesen sei. Das ist heute eher unwahrscheinlich und sagt viel über das alte und das neue Peking.
Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als der dritte Ring gebaut wurde, der am Hotel Kempinski vorbeiführt. Damals wurde eine sechsspurige Autobahn ins Grüne gesetzt. Ich war nicht der einzige, der sich damals gefragt hat, ob das nicht ein großer Unsinn ist. Dort fuhren anfangs ja nur Pferdekarren und ein paar Fahrräder. Heute verläuft der dritte Ring mitten in der Stadt, er ist immer verstopft und es gibt inzwischen einen sechsten Ring. Aufgrund dieser Erfahrung sehe ich gegenwärtige Zukunftsprojekte Chinas mit ganz anderen Augen.
Ist China heute nationalistischer geworden?
Das ist ein schwieriger Begriff im Deutschen. Wenn Nationalismus Stolz auf das Erreichte und ein größeres Selbstbewusstsein meint, bis hin zu der Tendenz, dass man sich von anderen immer weniger sagen lassen will, was man zu tun oder zu lassen hat, dann würde ich zustimmen. Wenn mit Nationalismus Abschottung gemeint ist, würde ich widersprechen. Es gibt in der Bevölkerung – jedenfalls bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe – eine unglaubliche Aufgeschlossenheit und Neugier der Welt gegenüber, eine Bereitschaft voneinander zu lernen.
Gilt das auch für das Verhältnis zwischen chinesischen und internationalen Wissenschaftlern? Politisch knirscht es ja gewaltig.
In der Wissenschaft spürt man das kaum. Die Vernetzung steht im Vordergrund, nicht die Konfrontation. Wissenschaftler interessiert weniger, woher das neue Wissen kommt, das ihren Fachbereich voranbringt, sondern mehr, ob man zusammen schneller weiterkommt als auf eigene Faust. So sind sehr erfolgreiche internationale Kooperationen entstanden. Manche westlichen Wissenschaftler schauen inzwischen neidisch auf die Ausstattung ihrer chinesischen Kollegen.
Welche Rolle hat das Corona-Virus gespielt? Hat es die Szene der Virologen politisch entzweit?
Nein. In der Not ist man sogar eher zusammengerückt. Die großen Wissenschaftsverlage haben sich kurz nach dem Corona-Ausbruch entschieden, alle Inhalte zu diesem Thema ohne Bezahlschranke zugänglich zu machen. Damit wurde es noch einfacher, weltweit zusammenzuarbeiten. Die erste Welle der Publikationen kam ja vor allem aus China, weil China früher von dem Virus betroffen war und schon Erfahrungen mit SARS hatte. Da haben sich die inzwischen stabilen und vertrauensvollen Netzwerke zwischen chinesischen und internationalen Forschern bewährt.
Dass die Westler nicht ins Labor konnten, sondern zu Hause im Homeoffice saßen, während die chinesischen Kollegen schon wieder im Labor arbeiten konnten, hat den Austausch eher noch erhöht. Das alles finde ich sehr ermutigend. Natürlich kenne ich auch die politischen Spannungen in diesem Kontext, aber auf Arbeitsebene gibt es immer noch sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wie verändert sich die Wissenschaftslandschaft dadurch, dass mit China nun ein großer neuer Spieler auf dem Markt ist, der gleichzeitig Partner und Wettbewerber ist?
Die Vielfalt wird größer. Sehr viele neu erforschte Themen kommen aus China. Schon jetzt gehören einige chinesische Metropolregionen zu den weltweit innovativsten Regionen. Peking gehört dazu, sicherlich auch Shanghai und Nanjing und vor allem auch die Greater Bay Area mit Shenzhen und Guangzhou im Süden des Landes. Sie müssen sich nicht mehr verstecken gegenüber traditionellen Zentren wie Boston in den USA, dem Silicon Valley für angewandte Forschung, Oxford in England oder auch München in Deutschland.
Bei den Nobelpreisträgern sieht es aber noch anders aus. Da ist China nicht einmal unter den Top 10 aller Länder. Die USA haben rund 400, China nicht einmal 10.
Da der Preis seit 120 Jahren vergeben wird, dauert es natürlich entsprechend länger aufzuholen. Dass die Chinesen dieses Thema beschäftigt, habe ich jüngst auf einer Konferenz mitbekommen, bei der es um die Zukunft der chinesischen Wissenschaft geht. Da wurde die Frage an einen amerikanischen Nobelpreisträger gestellt, was China tun muss, um mehr Nobelpreise zu bekommen.
Und?
Die Antwort lautete: Such dir die schlausten Köpfe deines Landes, bring sie zusammen, gib ihnen genügend Ressourcen und maximale Freiheit, zu erforschen, was sie erforschen wollen und auch Fehler zu machen. Gib ihnen auf keinen Fall vor, in welche Richtung sie gehen sollen. Und dann warte geduldig 30 bis 35 Jahre ab.
Eine bittere Nachricht für Politiker, die sich selbst in China nicht 30 Jahre in ihrer Spitzenposition halten.
Das ist jedenfalls ein großer Ansporn, eine Abkürzung zu finden. Ich bin sehr gespannt, ob es in China nicht doch schneller geht.
Wichtig ist dabei sicher auch das Thema Open Access. Wie steht man in China dazu?
Es wird derzeit erstaunlicherweise viel über Open Access gesprochen. Dabei geht es vor allem darum, dass auch Forschungseinrichtungen in kleineren Städten guten Zugang zum globalen Wissenspool bekommen und dass Forschungen, wenn sie relevant sind, auch international wahrgenommen werden.
Dass die Chinesen ein Interesse daran haben, kann man verstehen. Aber hat auch der Westen ein Interesse daran?
Ich glaube, es ist wichtig einzusehen, dass wir die großen gesellschaftlichen und technischen Herausforderungen nur gemeinsam lösen können. Deswegen haben wir ein Interesse daran, die Vernetzung weiter zu fördern. Dazu gibt es keine Alternative aus wissenschaftlicher Sicht!
Das ist klar. Aber ein Wissenschaftsverlag kann ja kein Interesse an Open Access haben. Denn er lebt von Bezahlschranken.
Auch bei Open Access wird unser Service bezahlt. Allerdings nicht vom Leser, sondern aus dem Budget der Institution, die die Forschung fördert, die ja ein großes Interesse daran hat, dass die Forschungsergebnisse breit wahrgenommen werden.
Schränkt das nicht die publizistische Unabhängigkeit ein?
Nein. Open Access bedeutet nicht, dass jeder, der bezahlt, alles publizieren kann, was er will, sondern nur das, was unsere strenge Qualitätskontrolle durchlaufen hat und dann für alle erreichbar ist. Deshalb gibt es einen ganz klaren Trend zu mehr Open Access. In manchen Fachgebieten ist bereits die Schwelle von 50 Prozent überschritten. In den Lebenswissenschaften hat es angefangen und kommt nun auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften an. Die Ingenieure hinken noch ein wenig hinterher.
Im politischen Kontext Chinas finde ich es sehr spannend, dass sich sowohl die Politik als auch die Wissenschaft mehr und mehr dafür interessiert, wie Open Access funktioniert. Die Chinese Academy of Sciences, also die hiesige wissenschaftliche Leitinstitution, wird noch in diesem Jahr eine Open-Access-Week veranstalten, um über das Thema zu informieren.
Open Access und Ideologie passen allerdings nicht gut zusammen. Denn Ideologie will Wissen kanalisieren, zensieren.
Wir müssen realistisch sein. Es wird in China Open Access und Zensur nebeneinander geben. Am Ende steht dann wohl ein Open Access mit chinesischen Charakteristiken. Immer noch wahrscheinlich ein beachtlicher Fortschritt, allerdings womöglich einer, der nicht so weit geht, wie wir uns das gewünscht hätten.
Wie gehen Sie denn mit dem Thema Zensur generell um?
In der Hauptrichtung unserer Arbeit spielt sie kaum eine Rolle: Wir wollen chinesischen Autoren, wie allen anderen Autoren weltweit auch, die Möglichkeit geben, international zu publizieren. Aber wir lizenzieren auch westliche Inhalte für China. Das ist in manchen Fachgebieten schwieriger, keine Frage. Aber es ist gut zu wissen, dass die Versorgung chinesischer Wissenschaftler mit internationaler Literatur auch aus den Sozial- und Geisteswissenschaften heute insgesamt vielfältiger ist als noch vor wenigen Jahren beziehungsweise Jahrzehnten. Pekings Schwerpunkt liegt immer noch eher in Richtung Versorgung mit Wissen als in Richtung Abschottung. Was für uns in diesem Zusammenhang wichtig ist: Wir legen als Verlag keine unterschiedlichen Kriterien für Publikationen aus verschiedenen Ländern an.
China ist technologisch sehr offen. Hier stellt man sich womöglich früher die Frage, wie die vielen Daten und die Künstliche Intelligenz wissenschaftliche Texte und Verlage verändern.
Das ist eine junge und sehr spannende Diskussion, die extrem relevant ist für die weitere Entwicklung der Wissenschaftswelt. Wir sprechen dabei nicht mehr von Open Access, sondern von Open Science. Dieser Begriff beinhaltet nicht nur Texte, sondern eben auch Daten. Der einfache und freie Zugang zu einer ungeahnt großen Menge von Daten wird eine neue Wissenschaft ermöglichen. Für den Bereich der Forschung und Entwicklung ist in China die Offenheit dafür viel größer, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Wie werden sich die Publikationen dadurch verändern?
Wir sind tatsächlich schon relativ weit. Wir publizieren schon zwei Jahre lang Bücher, die keinen menschlichen Autor mehr haben, sondern von einem Algorithmus geschrieben worden sind. Bei dem ersten Buch ging es um Lithium-Ionen-Batterien, also um ein Thema, bei dem auch chinesische Forschung eine zentrale Rolle spielt.
Wie funktioniert das?
Wir haben einen Algorithmus damit trainiert, alles zu lesen, was zu diesem Thema zu finden war. Das können 15.000 und mehr Artikel oder Kapitel sein, also mehr als jeder Mensch in einem vernünftigen Zeitrahmen lesen und verarbeiten könnte. Der Algorithmus versucht, Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen, zum Beispiel, indem er schaut, was, wie oft und wo zitiert wird. So bilden sich Cluster, aus denen allmählich eine Struktur für ein solches Buch entsteht. Daraus wird am Ende ein Buch, von dem die Forscher überzeugt sind, dass es tatsächlich den Stand der Forschung angemessen darstellt.
Ein Buch allerdings, in dem nichts Neues drinsteht.
Das haben wir uns auch gedacht. Es entsteht in diesen Clustern jedoch eine neue Struktur. Die Art, wie der Algorithmus die Erkenntnisse zusammen denkt, unterscheidet sich erheblich von den vorhandenen Reviews zu dem Thema. Es entsteht durchaus ein neuer eigenständiger Blickwinkel, der in eine neue Richtung weist. Einen Literaturnobelpreis wird ein solcher Text nicht bekommen. Aber die Elektro-Chemiker sagen, das bringt meine Doktoranden auf neue Ideen, weil es eine unglaubliche kompakte Form ist, den Stand der Forschung darzustellen.
Neben den Autoren können wir auch den Lesern einen neuen Service bieten. Sprachbarrieren können immer mehr durch Software überwunden werden und die Leser können gewissermaßen dem Buch mitteilen, wie viel Zeit sie für welchen Aspekt des Buches haben und bekommen dann umgehend die entsprechende Zusammenfassung oder einen höheren Detailgrad. Es gibt dann noch eine Ursprungsausgabe, aber ansonsten kann sich das Buch den Wünschen des Lesers anpassen.
Wie praktisch. Der Verlag schafft den lästigen Autor ab …
… und gleich auch den Lektor. Wir produzieren dann auf Knopfdruck Bücher wie Waschmaschinen. Nein, darum geht es selbstverständlich nicht. Das ist wie beim autonomen Fahren. Es wird das Selbstfahren nie völlig ersetzen, ist aber hilfreich, um einfacher und schneller ans Ziel zu kommen. Beim Schreiben von Büchern wird es wahrscheinlich der Normalfall werden, dass die Algorithmen dem Autor helfen, die Daten und den Forschungsstand so aufzubereiten, dass der Forscher mehr Zeit und Spielraum hat, den Forschungsstand zu interpretieren. Damit schaffen es Autoren, Bücher zu verfassen, die dafür unter analogen Umständen keine Zeit hätten.
Der Algorithmus kann dem Autor also helfen, mehr Zeit zu haben, Neues zu entdecken. Unsere Aufgabe als Verlag wird es zukünftig sein, den Autoren diesen Service zur Verfügung zu stellen. Eines der größten Hemmnisse im Verlagsgeschäft ist ja bekanntlich der innere Schweinehund des Autors. In Zukunft können wir mit Algorithmen den Autor unterstützen, diesen zu überwinden.
Kurz vor der Weltklimakonferenz in Glasgow hat China am Sonntag das lang erwartete “oberste Planungsdokument” zur Erreichung der nationalen Klimaziele vorgelegt. In dem Strategiepapier werden die wichtigsten Klimaziele bis 2025, 2030 und 2060 dargelegt. Die in Klimaplan aufgezeigten Ziele entsprechen in großen Teilen schon zuvor geäußerten Zielwerten, aber es gab auch Überraschungen:
Die Volksrepublik agiert also kurzfristig nicht mit absoluten Zielen zur Senkung der CO2-Emissionen. Stattdessen gibt es weiterhin nur Ziele, die in Bezug zum Wirtschaftswachstum stehen. Die relativen Zielsetzungen bedeuten, dass die CO2-Emissionen bei hohem Wachstum nur langsam sinken.
Der am Sonntag vorgelegte Klimaplan ist das oberste Planungsdokument für Chinas Weg zum Netto-Null-Ziel – also dem Ausstieg aus dem Treibhausgasausstoß unter Berücksichtigung von Ausgleichsmöglichkeiten. Der Plan gibt den Rahmen “für die gesamte künftige Klimaplanung vor”, wie die Analysten der Beratungsfirma Trivium China schreiben. Dem zentralen Plan wird nun eine Reihe von Aktionsplänen folgen, die mehr Details zur Erreichung der Klimaziele beinhalten werden.
Diese Aktionspläne beziehen sich dann auf bestimmte Sektoren wie beispielsweise den Energie-, Industrie- oder Transportsektor. Insgesamt machen der Klimaplan und die Aktionspläne den sogenannten “1+N-Rahmenplan” aus. Die “1” steht für den Klimaplan, das “N” für eine bestimmte Anzahl an Aktionsplänen. Damit folgt er dem Ansatz der Fünfjahrespläne, die von einem Leitdokument ausgehend detaillierte Teilpläne für Branchen und Regionen umfassen.
Laut Trivium China brauchte die Volksrepublik dringend diesen zentralen Klimaplan, um “all die willkürlichen Planungen, die bereits im Gange sind, einzudämmen.” Denn allerlei Akteure, von Ministerien über Provinz- und Lokalregierungen sowie den oft staatlichen Unternehmen versuchen “krampfhaft, ihre Übereinstimmung mit Xi Jinpings Klimazielen zu demonstrieren”, so die Analysten von Trivium.
Der Klimaplan enthält auch eine Passage zum Transportsektor. Der Ausbau der E-Mobilität soll beschleunigt werden. Dazu gehört der Ausbau des Netzwerks von Ladestationen und Batterie-Tausch-Stationen für E-Autos. Zudem sollen die Energieeffizienzstandards für Autos mit Verbrennungsmotoren weiter verschärft werden. Zugstrecken sollen schneller elektrifiziert werden und der Gütertransport grüner werden.
Auch der Bausektor soll energiesparender arbeiten und die vorhandenen Gebäude sollen weniger Strom verbrauchen. Innovationen und Technologien sollen dazu beitragen, dass die CO2-Emissionen in allen Sektoren sinken.
Der Plan wiederholt zudem das schon in der Vergangenheit geäußerte Bekenntnis, Investitionen in CO2-intensive Projekte wie Kohlestrom, Stahl, Aluminium, Zement und petrochemische Produkte “streng zu kontrollieren”. Zudem sollen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung unterstützt werden. Auch der Green Finance Sektor soll weiter ausgebaut und die Standards in diesem Bereich weiterentwickelt werden (China.Table berichtete). Banken sollen laut dem Klimaplan dazu ermutigt werden, günstige Kredite für nachhaltige Investitionen zur Verfügung zu stellen (China.Table berichtete).
Der Klimaplan enthält zudem einige sogenannte “Funktionsprinzipien”. Damit sind die politischen und wirtschaftlichen Mechanismen gemeint, die die Umsetzung voranbringen sollen. Beispielsweise sollen Staat und Markt gleichermaßen zur Erreichung der Klimaziele beitragen.
Peking hat schon in den letzten Jahren vermehrt auf Marktmechanismen gesetzt. Im Juli wurde nach jahrelanger Planung ein nationaler Emissionshandel gestartet. Daran müssen bisher allerdings vorrangig Kohlekraftwerke teilnehmen. Auch der Preis pro Tonne CO2 ist derzeit noch sehr gering (China.Table berichtete).
Nichtsdestotrotz umfasst der Emissionshandel schon heute gut 40 Prozent aller in China verursachten Emissionen. Nach dem langsamen Handelsstart könnte schon bald eine erhebliche Beschleunigung folgen, da die erste Phase des Emissionshandels lediglich als vorsichtige Testphase gilt. Der Klimaplan sieht die “schrittweise Ausweitung” des Emissionshandels vor, der allerdings schon ursprünglich mehr Sektoren umfassen sollte als lediglich die gut 2.000 Kraftwerke aus dem Energiesektor, die er derzeit umfasst.
Ein in den letzten Monaten ebenfalls diskutierter Marktmechanismus ist die Bepreisung von Naturgütern und -dienstleistungen. Die Idee dahinter: Wenn die Umwelt einen Preis hat, ist der Anreiz größer, sie zu schützen. Dadurch soll es gelingen, Naturdienstleistungen wie die Speicherung von CO2 durch Wälder und Moore zu erhalten. Die politischen Eliten debattieren dazu sogar die Einführung eines sogenannte “Brutto-Ökosystem-Produkts”, dass den Umweltschutz messbar machen soll und langfristig auf einer Ebene mit der Wirtschaftsleistung und dem BIP stehen könnte (China.Table berichtete). Der Klimaplan sieht nun vor, einen “ökologischen Ausgleichsmechanismus einzuführen, der den Wert von Kohlenstoffsenken widerspiegelt”.
Ein weiteres Funktionsprinzip des Klimaplans ist die “Vorbeugung von Risiken”. Der Plan betont die “Beziehung zwischen Klimaschutz und Energiesicherheit und der Sicherheit von industriellen Lieferketten” und ruft dazu auf, eine “Überreaktion zu verhindern”. Das bedeutet, dass die Reduktion von CO2-Emissionen nicht auf Kosten der Energiesicherheit der Industrie gehen dürfen, beziehungsweise dass der Aufbau neuer Energiequellen abseits der Kohle schnell genug voranschreiten muss, damit es nicht zu wiederholten Energiekrisen wie derzeit kommt (China.Table berichtete).
Die Analysten von Refinitiv gehen jedoch trotz des noch vor der Klimakonferenz in Glasgow vorgelegten Klimaplans nicht davon aus, dass China auf der Konferenz neue Zugeständnisse machen wird. Chinas politische Führung müsse kurzfristig “die Energieversorgung im Winter und anschließenden Frühling sicherstellen”, so Refinitiv.
China hat den Plan in Hinblick auf die bevorstehende UN-Klimakonferenz (COP26) veröffentlicht. Die Volksrepublik befindet vor der COP26 in einem größeren Dilemma als ursprünglich angenommen (China.Table berichtete). Denn eine Häufung von Stromausfällen lässt einen schnellen Ausstieg aus der Kohle derzeit wieder unwahrscheinlicher erscheinen. Das Land ist derzeit noch zu abhängig vom Kohlestrom. Der starke Preisanstieg des Rohstoffs hat den Verbrauch verteuert. Da die Strompreise lange Zeit staatlich reguliert waren, konnten sie nicht ebenfalls ansteigen. Die Herstellung von Elektrizität war für die Kraftwerke nicht mehr profitabel. Strom aus anderen Quellen konnte den Ausfall beim Kohlestrom nicht ersetzen. In ganzen Regionen gingen die Lichter und Klimaanlagen aus, Fabriken standen still. All das zeigt, wie abhängig China nach derzeitigem Stand noch von der Kohle ist. Mitarbeit: Finn Mayer-Kuckuk
Die USA würden Taiwan nach Worten von Präsident Joe Biden im Falle eines chinesischen Angriffs dabei helfen, sich zu verteidigen. Die US-Regierung habe eine “Verpflichtung”, dies zu tun, sagte Biden bei CNN. Washington suche keinen Konflikt mit China, aber Peking müsse verstehen, “dass wir keinen Schritt zurück machen werden, dass wir unsere Positionen nicht ändern werden”, so Biden. Die USA haben sich darauf festgelegt, die Verteidigungsfähigkeit Taiwans zu erhalten. Das bedeutet bislang vor allem Waffenlieferungen. Die Frage nach einem militärischen Beistand im Angriffsfall wurde meist bewusst offengelassen.
Nach der Frage eines Bürgers zu dem Thema hakte CNN-Moderator Anderson Cooper bei einer Town Hall-Veranstaltung in Baltimore nach und fragte Biden mit Blick auf China: “Sagen Sie, dass die Vereinigten Staaten Taiwan verteidigen würden, falls es versuchen würde, anzugreifen?” Biden antwortete daraufhin: “Ja, wir haben uns verpflichtet, das zu tun.”
Bidens Wortwahl signalisiert in der derzeitigen Lage allerdings nur vergleichsweise schwache Rückendeckung für Taiwan. Er verspricht “keinen Schritt zurück zu machen” – aber eben auch keinen nach vorn. Die Selbstverpflichtung zum Schutz Taiwans besteht zudem bereits seit Jahrzehnten. Biden hätte mit stärkerer Wortwahl auch eine deutlichere Botschaft nach Peking senden können. Er hat darauf aber vorerst verzichtet – vermutlich bewusst, um keinen diplomatischen Schlagabtausch mit China auszulösen.
Die Reaktionen aus Peking und Taipeh folgten dennoch prompt: Taiwans Regierung begrüßte die Aussage. “Seit Bidens Amtsübernahme hat die US-Regierung kontinuierlich durch praktische Schritte ihre felsenfeste Unterstützung für Taiwan demonstriert”, sagte ein Präsidentensprecher am Freitag – und erlaubte sich damit die maximale Interpretation der Worte Bidens.
Peking riet indes zu “Vorsicht”: “China wird keine Kompromisse eingehen, wenn es um seine grundlegenden Interessen wie Souveränität und territoriale Integrität geht”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP. Chinas Präsident Xi Jinping hatte den chinesischen Anspruch auf eine Vereinigung mit Taiwan zuletzt wiederholt bekräftigt (China.Table berichtete). ari
Mehrere chinesische Regionen registrieren steigende Corona-Zahlen auf sehr niedrigem Niveau. Die Behörden berichteten von 26 nachgewiesenen Fällen. Wie in China üblich, reagieren die Behörden heftig, um die Ausbrüche im Keim zu ersticken. Dabei blicken sie auch auf die Olympischen Spiele im Februar, die nicht von steigenden Infektionszahlen überschattet sein sollen. Das war im Sommer im Nachbarland Japan der Fall.
Die Stadt Peking hat am Sonntag die Wohnanlage Hongfuyuan im Distrikt Changping komplett abgeriegelt, nachdem dort eine Person positiv getestet wurde. Lebensmittel werden angeliefert, die Bewohner dürfen das Gelände nicht verlassen. Lieferfahrer übergeben ihre Waren an die Personal in Ganzkörper-Schutzkleidung, das sie in den Bereich innerhalb der Mauer der Wohnanlage weiterträgt.
Der für Sonntag geplante Marathon in der Stadt Wuhan fiel derweil aus. Die Organisatoren haben die Veranstaltung verschoben, “um das Risiko einer epidemischen Ausbreitung zu verhindern”. An dem Sportereignis wollten 26.000 Menschen teilnehmen. Ebenfalls betroffen sind die Provinzen Ningxia, Shaanxi und Hebei. fin
Der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande hat in letzter Minute eine Zahlung für Auslandsschulden geleistet. Eine letzte Nachfrist hätte am Samstag geendet – und 24 Stunden vorher hat das Unternehmen die nötigen 84 Millionen Dollar überwiesen. Das berichtet die Finanzzeitung Securities Times. Es ging um die Zahlung von Zinsen für eine Anleihe von ausländischen Investoren unter Federführung der Citibank.
Der Vorgang hat erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das Unternehmen die relativ kleine Summe im vergangenen Monat zum ursprünglichen Stichtag nicht aufbringen konnte. Das galt als sicheres Zeichen, dass mit Evergrande etwas nicht stimmt (China.Table berichtete). Noch bis Ende vergangenen Jahres hat Firmengründer Xu Jiayin mit Millionen und Milliarden um sich geworfen.
Die Überweisung hat an den Börsen zwar Erleichterung ausgelöst. Diese Reaktion kann jedoch als übertrieben gelten. Denn Evergrande schuldet seinen Geldgebern immer noch gut das 3.500-fache der Summe, die es jetzt mit Ach und Krach aufgebracht hat. Die meisten Gläubiger sitzen dabei im chinesischen Inland. Auch wenn Evergrande nun alle Auslandskredite regulär bediente, bliebe das Unternehmen überschuldet. Allein bis Jahresende sind Zinszahlungen in Höhe von umgerechnet einer halben Milliarde Dollar fällig. Damit ist noch nichts von den eigentlichen Schulden getilgt.
Evergrande bemüht sich dennoch, wieder zumindest ein bisschen gute Stimmung zu verbreiten. Am Sonntag hat das Unternehmen bekannt gegeben, an zehn Bauprojekten die Arbeit wieder aufzunehmen. Ein Symptom der Zahlungsschwierigkeiten war der Stillstand auf zahlreichen Baustellen von Evergrande. Der Immobilienentwickler konnte den Baufirmen und Handwerkern die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Auch die Wiederaufnahme der Arbeiten soll als positives Signal an die Märkte dienen. Denn je mehr Zweifel das Unternehmen umgeben, desto schwerer wird es, frische Mittel aufzutreiben. fin
Das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover und das Konfuzius-Institut an der Universität Duisburg-Essen haben eine Veranstaltung zu dem Buch “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt” kurzfristig abgesagt. Der Piper-Verlag, in dem das Buch herausgekommen ist, sieht “chinesischen Druck” als Grund des Rückziehers. “Die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute ist ein beunruhigendes und verstörendes Signal”, sagt Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg.
Autoren des Buches sind die Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges. China.Table hatte bei Erscheinen einen Auszug aus dem Werk veröffentlicht, das sich auch kritisch mit dem chinesischen Staats- und Parteichef auseinandersetzt. Eine Diktatur versuche hier, “ihre gegen unsere Freiheit gerichteten Werte international durchzusetzen”, kommentierte Aust den Vorgang.
Die Konfuzius-Institute werden von der chinesischen Regierung getragen. Nach Angaben des Verlags hat gegenüber dem Konfuzius-Institut in Hannover die Tongji-Universität Shanghai auf einer Absage der Veranstaltung bestanden. Die Tongji betreibt das Institut gemeinsam mit der Leibniz-Universität. In Duisburg intervenierte der Generalkonsul Chinas in Düsseldorf persönlich. Xi Jinping sei “unantastbar”, begründete laut Piper eine Mitarbeiterin des Konfuzius-Instituts das Vorgehen. fin
Die Regierung will die Schulkindern etwas entlasten. Ein neues Gesetz verbietet exzessive Hausaufgaben und ruft Schulen und Lehrer dazu auf, den Kindern auch Zeit für Spiel und Sport zu lassen. Das Gesetz wird am 1. Januar wirksam, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. Es geht vor allem darum, die Doppelbelastung aus Nachhilfeschulen und regulären Schulaufgaben aufzulösen. Im April hatte das Bildungsministerium bereits per Erlass vorgegeben, dass Erst- und Zweitklässler keine schriftlichen Hausaufgaben mehr erhalten sollen.
Chinas Eltern haben sich in den vergangenen Jahren einen zunehmend erbitterten Rüstungswettlauf um die besten Noten geliefert. Sie haben ihre Kinder dazu nach dem Vorbild Südkoreas und Japans in Zusatz-Schulen geschickt, die besonderen Erfolg garantieren. Die Kindern kommen jedoch ohnehin spät aus der Schule und haben zudem Hausaufgaben auf. Die Regierung sorgt sich daher um Gesundheit und Kreativität der jungen Chinesinnen und Chinesen. Im Juli hat sie zunächst das Nachhilfewesen reguliert, das bereits zu einer milliardenschweren Industrie geworden war (China.Table berichtete). Nun folgt die Eindämmung der Hausaufgaben. fin

Liebe ist gut für die Integration. Sie ist ein Anker. Liebe bildet sogar, wie Jochen Goller, Präsident und CEO der BMW Group Region China, bestätigt. Von 2004 bis 2009 war er schon einmal in der Volksrepublik – als Marketingleiter. Damals lernte er seine heutige Frau kennen. Als er 2015 zurück nach China kam, beherrschte er die Sprache schon sehr gut. Die gemeinsame Tochter lernt sogar drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Chinesisch.
Mit guten Sprachkenntnisse fällt es einem natürlich leichter, in China wirklich anzukommen. Goller brauchte keine Orientierungs- oder Eingewöhnungsphase. “Es gibt in Bezug auf China selten Zwischentöne. Entweder, man mag das Land, oder man mag es nicht. Ich gehöre zur ersten Gruppe und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt”, erzählt er.
Gollers erster China-Aufenthalt fiel in eine spannende Zeit. BMW, der deutsche Traditions-Autobauer, erlebte eine Entwicklung, die sonst eher zu Start-ups passt. Im Jahr 2004 explodierten die Geschäftszahlen in der Volksrepublik. Von 15 Händlern, die 12.000 Autos pro Jahr verkauften, sprang die Kurve auf 100 Händler und 90.000 Autos im Jahr 2009. Heute setzt die Marke aus Bayern dank 550 Händler etwa 750.000 Fahrzeuge ab.
Die Entwicklung BMWs in China spiegelt sich in der Entwicklung des gesamten Landes wider. Die Volksrepublik hatte zweistellige Zuwachsraten beim Bruttoinlandsprodukt. “Die Automobilindustrie ist ein Spiegelbild dessen, was in der Wirtschaft und in der Gesellschaft passiert”, so Goller. Das Bild großer Städte verändert sich bis heute in rasantem Tempo. Infrastruktur und Mobilität müssen da mithalten.
Eine Geschwindigkeit, die das Miteinander und die Gesprächskultur prägt. “Es ist ein sehr direktes und kompetitives Land. Keine Frage. Weil ganz China gesellschaftlich nach oben möchte”, so nimmt Goller es wahr. Die chinesische Teezeremonie dient ihm dabei als Gegengewicht. Die hat er lieben gelernt. Sie entschleunigt Meetings. Geschäftsführer und Firmenpräsidenten würden erst einmal Tee zubereiten, was eine entspannte Diskussionsebene erlaube. Auch, wenn der Ton ergebnisorientiert bleibe.
Das muss so sein. Denn die Mobilität in China steht vor Umwälzungen – in den kommenden Jahren will die Regierung verstärkt auf Wasserstoff setzen. Erst einmal im Bereich der Nutzfahrzeuge, betont Goller. BMW sei “technologieoffen” und habe aktuell eine Wasserstoff-Kleinserie auf der Straße. Sollte ab dem Jahr 2030 diese Antriebstechnologie bei Pkw eine Rolle spielen, sei auch seine Marke bereit.
Auch beim Halbleiter-Mangel gibt sich Goller eher gelassen. BMW sei gut durch die Krise gekommen und verlasse sich erfolgreich auf lokale Zulieferer. Zwar könnte das Problem mit den Mikrochips noch ein paar Quartale dauern, prophezeit Goller. Eine langfristige Änderung der Strategie sei aber nicht notwendig.
Dass BMW in der Position ist, der Branche in solchen Fragen Orientierung zu bieten, liegt auch an Goller: “Was ich von Anfang an mitgeprägt habe, war die Markenwahrnehmung von BMW und MINI und die Positionierung beider Marken sowie die entsprechende Produktpolitik.” Christian Domke Seidel
Heiko Hillebrandt ist als Fachanwalt für Patentrecht bei W. K. Gore & Associates von Hongkong nach München zurückgekehrt. Von Deutschland aus kümmert er sich weiterhin um Kunden im Raum Asien-Pazifik.
Tobias Gabriel ist jetzt Category Manager Electronics bei dem Autozulieferer Webasto in Shanghai. Gabriel ist in China von der Schindler Group zu Webasto gewechselt.
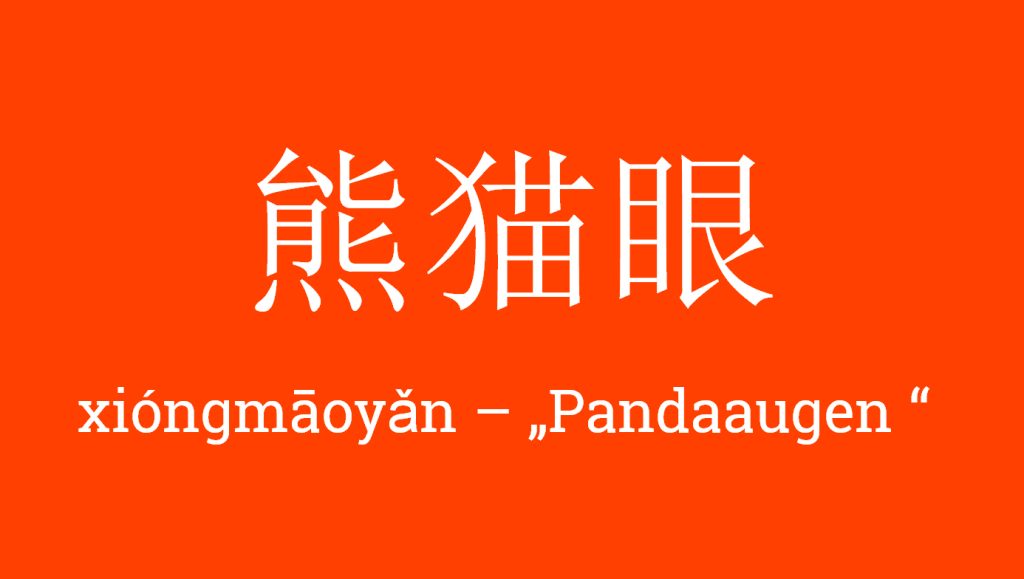
Montagmorgen vor dem ersten Kaffee? Sitzen Sie vielleicht gerade mit Pandaaugen vor dieser Kolumne? Sie haben richtig gehört! Der Panda ist nicht nur flauschiges Nationalschätzchen der Chinesen, sondern auch Namensgeber für ein Meme, dass es schon vor Social Media gab: nämlich dicke, schwarze Ringe unter den Augen. Die heißen in der chinesischen Umgangssprache tatsächlich “Pandaaugen” (zusammengesetzt aus 熊猫 xióngmāo “Panda” und 眼 yǎn von 眼睛 yǎnjing “Augen”).
Am zielsichersten züchtet man Pandaringe, wenn man sich die Nächte um die Ohren schlägt – bzw. sie langsam “durchköchelt”, wie der Chinese sagen würde (熬夜 áoyè “die Nacht durchköcheln”). Überstunden bis tief in die Nacht fühlen sich bekanntlich manchmal so rädernd an, als hätte man die ganze Nacht am Steuer gesessen – auf Chinesisch heißt das praktischerweise auch so: “den Nachtwagen fahren” (开夜车 kāi yèchē) ist ein Synonym für Rackern bis in die Morgendämmerung.
Der Blick in die Augenregion hält in China übrigens noch einige weitere wunderbar bildliche Wortkreationen parat, die uns Ausländern das Vokabellernen versüßen. Hier eine kleine Auswahl: Wer über die Jahre zu viele Pandaaugen-Phasen einlegt hat, bei dem ziehen sich vielleicht bald “Fischschwanzfalten” (鱼尾纹 yúwěiwén) durch die Augenwinkel (bei uns besser bekannt als “Krähenfüße”). Aber die lassen sich ja glücklicherweise gut mit einer “Tintenbrille” kaschieren (墨镜 mòjìng “Sonnenbrille”, wörtl. “Tinten-” oder “Tuschebrille”).
Oder alternativ mit einem wuchtigen Brillengestell. Wenn dieses zu extravagant ausfällt, läuft man allerdings Gefahr, als “Vierauge” veralbert zu werden (四眼 sìyǎn – Chinas Pendant für “Brillenschlange”). Und mit zu viel Brillentarnung ist man außerdem für die Augen von Freunden und Kollegen schnell nicht mehr “gar”, sondern “roh” (眼熟 yǎnshóu “bekannt, vertraut” – wörtlich “den Augen gar”; im Gegensatz zu: 眼生 yǎnshēng “fremd, unbekannt” – wörtlich “den Augen roh”). Dann doch lieber mutig Fischschwanzfalte zeigen, auch gerne mit Kontaktlinse. Auch für die kennt das Chinesische praktischerweise eine erfrischend einfache Übersetzung: 隐形眼镜 yǐnxíng yǎnjìng – “unsichtbare Brille”.
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.

