zunächst einmal haben wir heute eine gute Nachricht für all jene, die nach China einreisen möchten. Die deutsche Außenhandelskammer AHK hat vier weitere Charterflüge von Frankfurt nach Qingdao organisiert. Der erste wird in knapp einem Monat abheben, am 24. November. Alles Weitere, wie auch einen Link zu der entsprechenden AHK-Website, finden Sie in unserem Nachrichtenteil. Wegen des laufenden Corona-Ausbruchs in China wurde mit Lanzhou derweil eine ganze Millionenmetropole unter Quarantäne gestellt. Peking bleibt bei seiner Null-Toleranz-Linie.
Charlotte Wirth analysiert, warum das geplante EU-Lieferkettengesetz weiter auf sich warten lässt. Eigentlich sollte das Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht heute vorgestellt werden. Doch daraus wird nichts, denn offenbar kann sich die Kommission in zentralen Fragen nicht einigen. Einer der strittigen Punkte ist das Thema Zwangsarbeit. Und das betrifft auch China, man denke an die Vorwürfe zu Zwangsarbeit in Xinjiang.
Derweil macht sich Chinas ältester staatlicher Autobauer FAW daran, ein Elektromodell seiner Luxus-Marke Hongqi – übersetzt “Rote Fahne” und Staatskarosse der politischen Elite – im Ausland zu vermarkten. Das Eingangstor nach Europa soll, wie für andere Elektroauto-Hersteller auch, Norwegen sein. Frank Sieren erklärt, was es mit dem neuen Luxusschlitten auf sich hat, und welche Qualität Käufer in der Welt von dem Auto erwarten können.
Und auch sonst ist wieder einiges los in und um China. Wir wünschen Ihnen also eine spannende Lektüre.

Seit Monaten warten Beobachter und Unternehmen auf den Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission zum EU-Lieferkettengesetz. Eigentlich wollte die EU-Kommission einen Vorschlag dazu am Mittwoch vorstellen. In dem Papier soll konkret beschrieben werden, wie sich das EU-Lieferkettengesetz nach Ansicht der Brüsseler Behörden gestalten wird. Doch die Kommission reißt die Deadline. Sie kann sich nicht zu einer gemeinsamen Haltung in zentralen Fragen zusammenraufen, etwa dem künftigen Anwendungsbereich des Textes. Es herrsche ein “Kalter Krieg” zwischen den zuständigen Generaldirektionen, der für Binnenmarkt (DG Grow) und der für Justiz (DG Just), heißt es aus Kreisen.
Nun will die Kommission erst am 8. Dezember liefern. Aber immerhin will sie ihre überarbeitete Folgenabschätzung diese Woche beim Ausschuss für Regulierungskontrolle einreichen. Dieser prüft als unabhängiges Gremium alle Initiativen der EU-Kommission. Fest steht bereits, dass die Mitgliedsstaaten für die spätere Umsetzung des Lieferkettengesetzes zuständig sein werden. Weiterhin offen ist dagegen, welche Stufen der Lieferketten das Gesetz überhaupt regeln wird, inwiefern es Opfern Zugang zum EU-Justizsystem ermöglicht, und ob und wie die persönliche Haftung der Führungskräfte der Unternehmen umgesetzt wird (Europe.Table berichtete). Das sind in der Tat wichtige Fragen.
Und nun hat Ursula von der Leyen auch noch einen weiteren Punkt auf die Liste der Streitpunkte gesetzt: das Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit (China.Table berichtete). Ein solches Vorhaben hatte die Kommissionschefin in ihrer diesjährigen Rede zur Lage der Europäischen Union angekündigt: “Wir wollen […] auf unseren Märkten Produkte verbieten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Menschenrechte sind nicht käuflich – für kein Geld der Welt”, sagte von der Leyen im September. Was sie jedoch nicht sagte – und wahrscheinlich auch nicht wusste – war, wie sie das Verbot durchsetzen will. Und die zuständigen Kommissare, allen voran Handelskommissar Valdis Dombrovskis, waren über ihren Vorstoß anscheinend nicht informiert.
Naheliegend wäre es, das Importverbot über ein eigenständiges Handelsinstrument umzusetzen, das dann nicht in den Rahmen des EU-Lieferkettengesetzes fallen würde. Denkbar wäre zum Beispiel eine Regulierung, die es dem Zoll ermöglicht, Produkte abzufangen, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. So erlaubt der “Tariff Act” der USA den Zollbehörden, Produkte zu beschlagnahmen, die aus Zwangsarbeit stammen könnten. Im Juli stoppten US-Behörden auf diese Weise die Einfuhr menschlicher Haarprodukte aus Xinjiang. Washington plant desweiteren die Umsetzung eines Gesetzes, dass sich speziell gegen China richtet, des “Uyghur Forced Labour Prevention Act”.
Doch von der Leyen hat die Rechnung ohne ihren Handelskommissar gemacht. Dombrovskis sperrt sich bislang gegen den Vorstoß. Seine Generaldirektion für Handel (DG Trade) prüft schon länger die Umsetzung eines Importverbots – bisher erfolglos. Ein Gesetz nach US-amerikanischem Vorbild sei nicht möglich, da die europäischen Zölle so nicht funktionierten, heißt es aus internen Kreisen. Zudem befürchte man, ein solcher Vorschlag wäre nicht konform mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Zumindest nicht, wenn sich das Importverbot implizit gegen ein einziges Land, nämlich China, richte.
Zu einem anderen Schluss kommt hingegen eine Studie im Auftrag der Grünen von letztem Februar. Demnach wäre ein europäisierter “Tariff Act” durchaus möglich. Dieser könnte sich etwa an einer bereits existierenden Verordnung für das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, orientieren. Auch Anahita Thoms, Partnerin bei der Anwaltskanzlei Baker McKenzie und Expertin für Handelsrecht, schließt eine solche Umsetzung nicht aus. Vorstellbar wäre zum Beispiel das Thema Handel mit Produkten aus Zwangsarbeit in die Freihandelsabkommen zu integrieren, die die EU mit Partnerländern schließt.
Die EU-Kommissionspräsidentin hatte den Ball für das Importverbot aber statt Handelskommissar Dombrovskis dem EU-Kommissar zuständig für Binnenmarkt, Thierry Breton, und Justiz-Kommissar Didier Reynders zugespielt. Was wichtig daran ist: Eine Integration des Einfuhrverbots in das Lieferketten-Gesetz würde bedeuten, dass die Verantwortung bei Unternehmen liegt. Die Firmen müssten Produkte, bei denen die Vermutung besteht, dass Zulieferer aus problematischen Regionen wie Xinjiang eingekauft haben, aus dem Verkauf nehmen.
Anwältin Thoms sieht dieses Vorhaben kritisch und geht davon aus, dass von der Leyens Vorstoß das ohnehin schon verspätete EU-Lieferkettengesetz womöglich noch weiter hinauszögert. “Es ist sowieso schon eine große Herausforderung. Wieso erschwert man das Gesetzesvorhaben so kurzfristig durch einen Vorschlag, von dem man nicht weiß, wie er nachher in der Praxis umgesetzt werden kann?”, fragt Thoms.
Gleich mehrere Elemente behindern eine rasche Umsetzung eines Importverbots: Da wäre etwa die Komplexität der Produkte, die auf dem europäischen Markt zirkulieren. Oft stammen die Komponenten aus verschiedenen Herkunftsländern. Die Einzelteile werden in einem dritten Land zu fertigen Produkten verarbeitet. Doch was, wenn etwa zehn Prozent eines Produktes aus einer “problematischen” Region stammen, der Rest aber nicht? Wenn jedes einzelne Teilchen eines komplex zusammengebauten Produktes unter ein Importverbot fiele, so könnte das in der Praxis “immense Herausforderungen für die Unternehmen verursachen”, warnt Thoms.
Die Implementierung des Einfuhrverbotes über die Verordnung zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht – also das Lieferkettengesetz – hätte zudem große Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Regulierung, gibt die Anwältin zu bedenken. Denn noch ist nicht klar, welche Stufen der Lieferketten unter die Sorgfaltspflicht fallen werden, und ob die Unternehmen etwa nur ihre direkten Zulieferer werden prüfen müssen. Diese Diskussion aber wäre mit einem Importverbot hinfällig: “Wenn ein Unternehmen dafür sorgen muss, dass ein Produkt, das aus Zwangsarbeit stammt, gar nicht erst auf den europäischen Markt kommt, dann muss im Ergebnis die gesamte Lieferkette geprüft werden“, so Thoms.
Die Entscheidung, wo das Thema Zwangsarbeit aufgehängt wird, hat also durchaus gravierende praktische Folgen für Firmen mit Aktivitäten etwa in China.
Gleichzeitig zielt das EU-Lieferkettengesetz, zumindest in einer strengen Auslegung, die sich Justiz-Kommissar Reynders wünscht, ohnehin darauf ab, Menschenrechtsverletzungen – darunter eben auch Zwangsarbeit – zu vermeiden. Unternehmen sind schließlich dazu angehalten, ihre Lieferketten zu prüfen und sie anzupassen, wenn sie Menschenrechtsverletzungen feststellen. In diesem Sinne dürfte ein strenges Gesetz implizit dafür sorgen, dass Produkte aus Zwangsarbeit nicht auf dem europäischen Markt landen.
Denkbar wären aber auch ergänzende Maßnahmen, die Nicht-EU-Unternehmen anvisieren, sagt Anahita Thoms. Diese könnten verhindern, dass Produkte aus Drittländern, die Komponenten aus Zwangsarbeit enthalten, auf den europäischen Markt gelangen. Dann wiederum müsste die Verantwortung beim Zoll liegen. Sprich: Der Ball läge wieder bei Handelskommissar Vladis Dombrovskis.
Im EU-Parlament stößt ein Importverbot via Lieferkettengesetz auf wenig Rückenwind. Der sozialdemokratische Abgeordnete Raphael Glücksmann aus Frankreich, der sich intensiv mit der Lage der Uiguren in Xinjiang beschäftigt, spricht sich vehement gegen die Idee aus: “Die Verordnung wird so schon kompliziert genug. Die Sorgfaltspflicht gilt für Unternehmen. Ein Verbot fokussiert sich aber auf Produkte. Es muss durch ein Handelsinstrument durchgesetzt werden.” Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini teilt seine Bedenken. Die Implementierung durch die Sorgfaltspflicht würde den Prozess nur weiter verkomplizieren. Auch Menschenrechtsorganisationen wie Global Witness halten von dem Vorstoß von der Leyens wenig und fordern die Kommission auf, einen separaten Vorschlag für ein Importverbot zu entwerfen.
Die EU-Kommission selbst äußert sich bisher nicht eindeutig darüber, wie sie von der Leyens Importverbot umsetzen will, zählt das geplante EU-Lieferkettengesetz aber zu den möglichen Wegen. Ein zentraler Punkt des Vorschlags seien “wirksame Aktionen” und “Durchsetzungsmechanismen”, wenn Unternehmen Probleme in ihren Lieferketten – etwa Zwangsarbeit – feststellen, sagt eine Sprecherin. Wie diese Mechanismen aussehen könnten, lässt sie allerdings offen. Bei einer Verordnung haben darüber ohnehin die Mitgliedsstaaten das letzte Wort.
Während Breton und Reynders sich über keinen anderen Aspekt des geplanten Gesetzes einig sind, halten sie beim Importverbot zusammen. Man will keine spezifischen Verbote oder Sanktionen einführen. Es sieht ganz so aus, als ob nur eine Person von der Idee überzeugt ist, das Importverbot über die Lieferketten einzuführen: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Der “Hongqi” – übersetzt “Rote Flagge” – ist die symbolträchtigste Automarke der Volksrepublik. Bereits Mao Zedong ließ sich in einer schwarzen Staatskarosse von Hongqi herumkutschieren. Und auch heute noch ist der Hongqi das Fahrzeug der Wahl für die Partei-Elite. Die Autos sind regelmäßig in der Nähe des Pekinger Regierungsviertels zu sehen, ebenso wie auf Militärparaden. Das offene Auto, in dem Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Militärparaden abnimmt, ist ein Hongqi. Und auch US-Präsidenten und deutsche Kanzler:innen wurden mit Autos dieser Marke vom Flughafen abgeholt.
Eine Edelversion der “Roten Fahne” soll nun die Welt erobern: Die “kommunistische Luxusmarke” exportiert seit kurzem in China hergestellte Hongqi-Elektro-SUVs nach Norwegen. Anfang Oktober erhielt FAW nach eigenen Angaben für den Elektro-SUV E-HS9 bereits 500 Bestellungen aus dem skandinavischen Land, das eine Hochburg der Elektromobilität ist.
Doch ganz so einfach wird es nicht mit dem Markteinstieg in Europa. Die ideologisch-historische Anziehungskraft von Hongqi mag in China stellenweise wirken, im Westen es nur ein weiteres chinesisches Auto.
Hongqi gehört zum Staatskonzern First Automobile Works (FAW), der auch Joint Venture Partner von VW und Audi ist. Das Unternehmen wurde 1953 mit sowjetischer Unterstützung als erste Automobilfabrik Chinas in Changchun in der nordöstlichen Provinz Jilin gegründet.
Der 5,2 Meter lange E-HS9 ist heute das Flaggschiff des Unternehmens. Das Gefährt erinnert optisch an Autos der Marke Rolls-Royce. Das ist kein Zufall: Denn entworfen hat ihn Giles Taylor, der zuvor Designchef von Rolls-Royce war und seit 2018 als Global Vice President of Design und Chief Creative Officer bei Hongqi im Einsatz ist. Der Wechsel machte für ihn durchaus Sinn. Die Marke ist zwar nicht so renommiert, der Job aber viel spannender. Taylor durfte unter anderem für Hongqi und FAW ein Design-Zentrum in München aufbauen. Hongqi ist derzeit die einzige heimische Superluxusmarke auf dem größten Automobilmarkt der Welt. Und FAW hat mit dieser Marke noch viel vor.
Der Hongqi E-HS9 basiert auf der FMA-Plattform und ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Basisversion kommt als 6- oder 7-Sitzer. Er verfügt über zwei 160-kW-Motoren und einen 84-kWh-Akku. Die Reichweite liegt bei mindestens 460 km. Die Top-End-Konfiguration, die in 6- und 4-Sitzer-Ausführung erhältlich ist, verwendet einen 160-kW-Motor, einen 245-kW-Motor und einen 99-kWh-Akku. Der E-HS9 unterstützt kabellose Ladetechnologie, mit der das SUV in 8,4 Stunden vollständig aufgeladen werden kann. Autonome Fahrmanöver der Stufe 3+ sollen ebenfalls möglich sein. Auf Wunsch gibt es das Auto sogar mit einem beleuchteten, kristallbesetzten Schaltknüppel.
Norwegen hat die bislang beste Infrastruktur für Elektroautos in Europa. Es ist daher das Einfallstor auch für andere chinesische Elektro-Marken, etwa NIO, Xpeng und BYD. Auch FAW will mit der Einführung des E-HS9 in Norwegen die Marke Hongqi in Europa etablieren. FAW geht davon aus, dass die Verfügbarkeit des Hongqi-Sortiments in Zukunft auf den Rest der Welt ausgeweitet wird. Im hochpreisigen Automobilmarkt Dubais ist das Unternehmen bereits präsent.
Für den Vertrieb hat sich FAW deshalb mit dem lokalen Autohändler Motor Gruppen zusammengetan – einem renommierten Autohändler mit 45 Jahren Erfahrung. Motor Gruppen kümmert sich sowohl um den Verkauf als auch den Service der Hongqi-Fahrzeuge. Die Preise sollen umgerechnet zwischen 57.000 bis 66.000 Euro liegen.
In China ist der Absatz von Hongqi in den letzten Jahren dank der Einführung neuer Modelle und der Erweiterung des Vertriebsnetzes stetig gestiegen. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres konnte das Unternehmen über 170.600 Fahrzeuge verkaufen, 95 Prozent mehr als im Vorjahr, indem jedoch auch Corona-Beschränkungen den Verkauf drosselten. Aktuell bietet Hongqi insgesamt zwölf Modelle an. FAW will den Absatz 2022 auf 400.000 Exemplare, 2025 auf 600.000 und 2030 auf stolze 800.000 bis eine Million steigern.
Das teuerste für Privatpersonen erhältliche Modell ist der L5. Er kostet bis zu 1,2 Millionen Dollar, also sechsmal so viel wie eine Mercedes-Maybach S-Klasse. Die Botschaft: Auch China kann begehrenswerte Luxuslimousinen bauen. Der Grund für den Preis dürfte jedoch vor allem daran liegen, dass die Luxusschlitten so “einzigartig und so selten sind”, wie das Forbes-Magazin erklärt. Das Design ist imposant, eine gelungene Mischung zwischen Rolls-Royce-Anmutung und der Hongqi-Tradition. Bei der Verarbeitungsqualität der Innenausstattung kommen die Hongqis jedoch nicht annähernd an einen Maybach heran. Da sieht man dann doch, was jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich wert ist. Unlösbar sind solche Probleme aber nicht.
Ein weiteres, auf 99 Exemplare limitiertes Sonderstück wurde im Frühjahr auf der Auto Shanghai 2021 vorgestellt. Der Sportwagen S9 erinnert mit seiner roten Lackierung und der schnittigen Karosserie an Modelle von Ferrari oder Lamborghini. Gestaltet hat ihn Walter de Silva, der zuvor unter anderem für Alfa Romeo und Audi gearbeitet hat. Bei den Ingolstädtern war er für Audis Sportwagen R8 und die Audi Tochter Lamborghini zuständig.
Der S9 verfügt über ein Plug-in-Hybridsystem mit einem V8-Verbrennungsmotor unter der Haube, der 1.420 PS (1.044 Kilowatt) leistet. Angeblich ist der S9 in der Lage, aus dem Stand in nur 1,9 Sekunden 100 km/h zu erreichen. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 402 km/h liegen, während die rein elektrische Reichweite bei 40 Kilometern liegt. Künftig soll der S9 auch als reines Elektroauto verfügbar sein.
Das Hybrid-Hypercar S9 wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Ingenieur- und Design-Startup Silk EV entwickelt. Die Investitionen in das Gemeinschaftsunternehmen liegen bei über einer Milliarde Euro. Berichten zufolge soll der S9 im italienischen Modena montiert werden, weil die gewünschte Qualität bei FAW in China nicht möglich ist. Produktionsstart ist 2022. Der Preis des Flitzers soll bei rund 1,4 Millionen US-Dollar liegen. Mit einer Staatskarosse hat dieses Auto nicht mehr so viel zu tun.
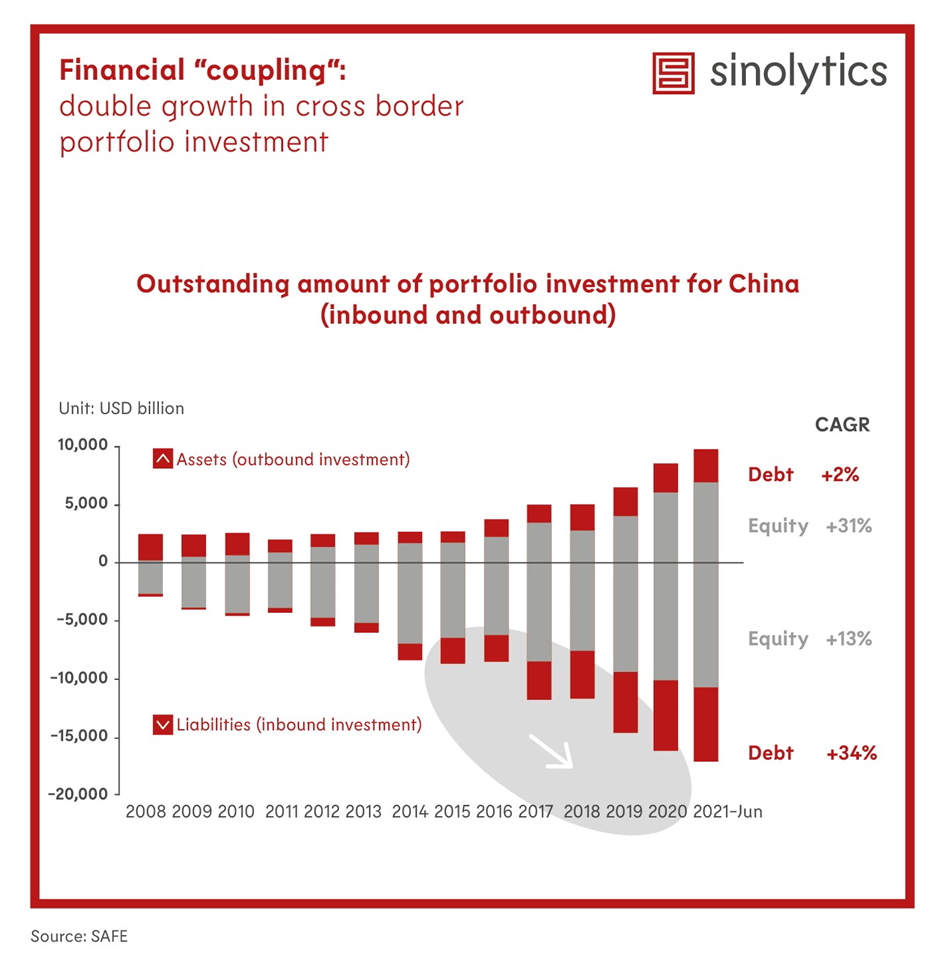
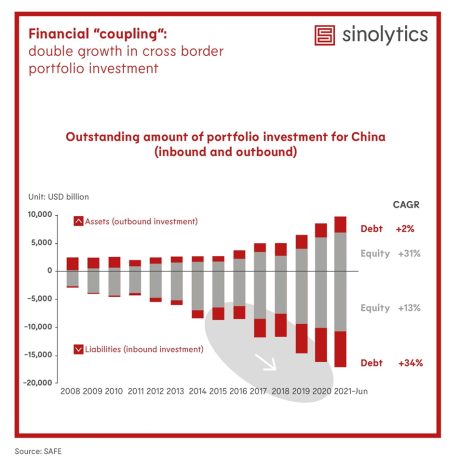
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.
China hat einen Klima-Aktionsplan für die Jahre bis zum Erreichen des Höchststands der CO2-Emissionen 2030 vorgelegt. Dieser Aktionsplan ist der erste in einer Reihe von Sektorplänen, die dem am Sonntag veröffentlichten “obersten Planungsdokument” zur Erreichung der Klimaziele folgen (China.Table berichtete).
Insgesamt nennt der Aktionsplan neun übergeordnete Bereiche, in denen Emissionen gesenkt werden sollen. Dazu zählen:
Neue Klimaziele enthält der Aktionsplan aber nicht, sondern bekräftigt Bekanntes: Der Kohleverbrauch soll “strikt kontrolliert” werden und im Zeitraum zwischen 2026 und 2030 sinken. Bis 2030 soll der Anteil des Verbrauchs nicht-fossiler Energieträger 25 Prozent erreichen. Die Kohlendioxidemissionen pro BIP-Einheit sollen bis 2030 im Vergleich zu 2005 um mehr als 65 Prozent sinken.
Lauri Myllyvirta, Energieexperte vom Centre for Research on Energy and Clean Air, kritisiert, dass der Plan keine Angaben über die Höhe der Emissionen und den genauen Zeitpunkt des anvisierten Emissions-Höchststands macht. Das könnte man von einem nationalen Aktionsplan zu dem Thema allerdings verlangen, so der Klimaexperte. Der Plan sei “viel allgemeiner und offener” als Myllyvirta erwartet hatte.
Der Aktionsplan betont zudem das derzeit stark in den Fokus gerückte Thema Energiesicherheit. China sei reich an Kohle und arm an Öl und Gas. Der Plan ruft deshalb zu einer “stetigen und geordneten, sicheren Kohlenstoffreduzierung” auf. nib
Chinas Zentralregierung will die derzeit stark steigenden Preise für Kohle stärker regulieren. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission will dafür einen Mechanismus ausarbeiten, damit der Kohlepreis nicht mehr zu stark schwankt. Es soll demnach einen Referenzpreis und eine bestimmte Spanne geben, die der Preis um den Referenzpreis schwanken darf. Die Regierung schaue sich für die Entwicklung des Mechanismus die Profitabilität und Kosten der Kohleproduzenten an, berichtet Reuters.
Chinas Kohlepreise sind seit Jahresanfang um 150 Prozent angestiegen. Sie sind eine der zentralen Ursachen für die aktuelle Energiekrise. Weil die Strompreise staatlich festgelegt waren, waren viele Kraftwerke angesichts der horrenden Kohelpreise nicht mehr profitabel (China.Table berichtete). Sie drosselten die Produktion, während die Nachfrage nach Strom aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs im Gefolge der Corona-Pandemie stark stieg. Die Preise sanken nach einem Höhepunkt zuletzt leicht, nachdem die Regierung Maßnahmen angekündigt hatte.
In den letzten Tagen hat die Volksrepublik zudem die Ausweitung der Kohleproduktion angeordnet. Ebenso wurde eine Strompreisreform durchgeführt (China.Table berichtete). Trotzdem haben die Kraftwerke noch immer Schwierigkeiten, ihre Lagerbestände aufzustocken, wie Reuters berichtet. Analysten gehen demnach davon aus, dass der Kohleverbrauch ab Mitte November aufgrund des Wintereinbruchs steigen wird. Der Bergbau und der Transport der Kohle werde sich dann aufgrund des schlechten Wetters verlangsamen. nib
Die deutsche Außenhandelskammer in China (AHK) startet eine neue Reihe an Charterflügen nach China. Ab dem 24. November werden vier Flüge von Frankfurt am Main aus nach Qingdao abheben. Der zweite Flug ist am 15. Dezember, der dritte am 5. Januar 2022 und der vorerst letzte am 26. Januar. Wie schon bei vergangenen Flügen gibt die AHK aber keine Garantie ab, dass die Flüge tatsächlich so stattfinden wie geplant.
Mit den Flügen verbunden ist ein Fast Track-Kanal für eine schnellere Ausstellung der PU-Letter und Visa, die für die Einreise notwendig sind. Chinesische Behörden müssen die Passagierliste allerdings absegnen. Bei der Einreise selbst sind die Regeln genauso streng wie für alle Ankommenden: Pflicht sind zwei negative PCR-Tests und ein negativer Antigen-Test vor dem Abflug. Während der Quarantäne wird weiter getestet – das gilt auch für Geimpfte. Eine Covid-Impfung ist aber keine Voraussetzung für das grüne Gesundheits-Zertifikat, das alle Reisenden brauchen. China erkennt die westlichen Impfstoffe wie Biontech/Pfizer ohnehin nicht an.
Die Tickets kosten 2.800 Euro für AHK-Mitglieder oder 3.200 Euro für Nicht-Mitglieder. Der Preis beinhaltet die Organisation der mindestens 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft in Qingdao, nicht aber den Aufenthalt selbst. Dafür veranschlagt die Kammer rund 1.000 Yuan pro Nacht einschließlich Verpflegung, umgerechnet etwa 135 Euro.
Es ist ein teures Vergnügen. Allerdings gibt es noch immer Expats oder Familienangehörige von Expats, die aktuell keine Möglichkeit sehen, nach China zu reisen – und somit entweder ihren Job in China nicht antreten können oder nicht gemeinsam mit ihrem Partner, beziehungsweise ihren Eltern leben können. Einigen von ihnen können die AHK-Flüge nun helfen. Alle Informationen zu den Flügen finden sich auf der AHK-Website. ck
China greift aus Furcht vor einer neuen Corona-Welle zu immer drastischeren Maßnahmen. Am Dienstag stellten die Behörden eine ganze Stadt unter Quarantäne: Die vier Millionen Einwohner von Lanzhou am Gelben Fluss im Nordwesten des Landes dürften ihre Wohnanlagen nur noch in Notfällen oder zum Kauf von Lebensmitteln verlassen, erklärte die Stadtverwaltung. Ein- und Ausgänge der Wohnkomplexe sollten überwacht werden. Zuvor hatte China am Dienstag ganze 29 neue lokale Corona-Infektionen gemeldet, davon sechs in der Provinz Gansu, deren Hauptstadt Lanzhou ist. Innerhalb von acht Tagen (Montag bis Montag) hatte die Volksrepublik 195 neue inländisch übertragene symptomatische Infektionen vermeldet.
Auch in Peking werden die Auflagen immer schärfer. Am Montag wurden die Bewohner der Hauptstadt aufgefordert, Peking nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Seit Sonntag sind alle Bewohner eines Wohnkomplexes im Nordwesten der Stadt isoliert, da es dort einen positiven Corona-Fall gegeben hatte. Personen dürfen aus Regionen, in denen es Infektionen gab, vorerst nicht in die Haupstadt einreisen, nicht einmal Bewohner. In Peking sind die Behörden aufgrund der bevorstehenden Olympischen Winterspiele besonders nervös. Neue Richtlinien vom Montag verlangen, dass alle ungeimpften Olympia-Athleten nach der Ankunft in Peking für 21 Tage in Quarantäne gehen müssen. Ausnahmen werden demnach nur in Einzelfällen geprüft, etwa wenn jemand aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfe. ck
Tesla hat ein Zentrum für Entwicklung und Forschung (R&D) in Shanghai eingerichtet. Es sei der erste R&D Standort außerhalb der USA, berichtet Bloomberg. Der Grund ist der übliche für Ansiedlungen von Forschungskapazitäten in China: Mit dem Standort werde das Ziel verfolgt, “Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Bedürfnissen der chinesischen Verbraucher besser entsprechen“, gab der E-Autobauer in einer Erklärung an. Neben dem R&D-Zentrum sei in Shanghai auch ein Datenzentrum gebaut worden. Beide werden in naher Zukunft in Betrieb gehen.
Das Unternehmen hatte im September über 56.000 Autos im chinesischen Markt abgesetzt und damit einen neuen Absatzrekord gefeiert (China.Table berichtete). Das Unternehmen profitiert in China unter anderem von einem nationalen Emissionspunkte-System. Dabei müssen Autobauer Emissionspunkte von anderen Herstellern aufkaufen, wenn sie selbst zu wenige E-Autos verkaufen. Tesla konnte über dieses Emissionshandelssystem über 330 Millionen Euro einnehmen (China.Table berichtete). Am Montag war der Börsenwert Teslas auf über eine Billion US-Dollar gestiegen. nib
Die chinesische Reederei Cosco hat ihre Anteile am Hafen im griechischen Piräus erhöht. Cosco habe seinen Anteil an der Betreibergesellschaft Piraeus Port Authority (PPA) auf 67 Prozent erhöht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Bisher hielt Cosco 51 Prozent und hatte damit bereits seit 2016 die Mehrheitsbeteiligung an dem Mittelmeer-Hafen inne. Die griechischen Behörden hatten Medienberichten zufolge im Sommer dieses Jahres zugestimmt, weitere 16 Prozent an Cosco abzutreten.
Der Hafen von Piräus unweit der griechischen Hauptstadt Athen, hat nach Xinhua-Angaben einen jährlichen Umschlag von 7,2 Millionen Standardcontainern (TEU). Er ist der größte Seehafen Griechenlands und einer der größten im Mittelmeerraum. Die Erhöhung des Anteils von Cosco trifft mit einem ranghohen Besuch zusammen: Chinas Außenminister Wang Yi wird am Mittwoch auf Einladung seines griechischen Amtskollegen Nikos Dendias in Athen erwartet.
Die chinesische Beteiligung ist immer wieder Anlass für Debatten. Cosco beteiligt sich auch mit 35 Prozent an einem Containerterminal in Hamburg Tollerort. (China.Table berichtete). Die Übernahme wartet derzeit noch auf wettbewerbs- und außenwirtschaftsrechtliche Genehmigungen. ari
Eine Lesung zu einer Biografie über Xi Jinping in Duisburg findet nun doch statt – allerdings nicht durch das der Universität angegliederte Konfuzius-Institut. Stattdessen wird die Veranstaltung vom Ostasieninstitut der Universität selbst organisiert, wie die dpa berichtet. Zunächst war die Veranstaltung auf chinesischen Druck hin abgesagt worden (China.Table berichtete). Eine ähnliche Lesung in Hannover hat bisher keinen anderen Veranstalter gefunden. Die dortige Universität ist der Nachrichtenagentur zufolge jedoch in Gesprächen mit dem Verlag des Buches “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt” der Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges. nib

Die Entwicklungszusammenarbeit Chinas mit dem Globalen Süden hat in den westlichen Medien zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Wachsende Aufmerksamkeit hat jedoch nicht immer zu wachsendem Verständnis geführt. So ist in vielen Medien die Rede von einer “Kreditfalle” und “Schuldenfallendiplomatie” Chinas. Gleichzeitig argumentieren beispielsweise Deborah Brautigam, Professorin an der Johns Hopkins University, und Meg Rithmire, außerordentliche Professorin an der Harvard Business School: “Das Narrativ stellt sowohl Peking selbst, als auch die kooperierenden Entwicklungsländer falsch dar.” Ist der Vorwurf der “Schuldenfallendiplomatie” gerechtfertigt?
Es ist schwer, Antworten auf solche Fragen zu finden. Dafür gibt es zwei Gründe: das Fehlen ausreichender Daten und das mangelnde Verständnis der Funktionsmechanismen von Chinas System der Auslandshilfe. Der Mangel an ausreichenden Daten ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es keine umfassenden Berichtssysteme für Entwicklungsprojekte Chinas gibt. Während Deutschland wie viele andere Länder seine Projekte an die OECD berichtet, die die Informationen für alle zugänglich aufbereitet, stellt China keine vergleichbaren Daten bereit. Da es keine verlässliche, offizielle Quelle gibt, war es in der Vergangenheit schwierig, sich ein umfassendes Bild von Pekings ausländischen Entwicklungsaktivitäten zu machen.
Initiativen wie AidData am College of William & Mary haben versucht, diese Lücke zu schließen. Seit 2013 verfolgen AidData unter der Leitung von Dr. Brad Parks die offiziellen Finanztransfers aus China an Entwicklungsländer mit ihrer sogenannten TUFF-Methode. TUFF steht hierbei für Tracking Underreported Financial Flows. Dafür bringt AidData unstrukturierte, offen zugängliche, projektbezogene Daten zusammen, die von verschiedensten Quellen veröffentlicht werden und standardisiert und vereinheitlicht die Daten. Auf der Grundlage dieser Methodik begann AidData zunächst mit der Veröffentlichung regionalspezifischer Datensätze. 2017 präsentierte AidData den ersten Datensatz, der den gesamten Globalen Süden abdeckt. Der in diesem September aktualisierte Datensatz umfasst 13.427 Projekte im Wert von 843 Milliarden US-Dollar in 165 Ländern in allen wichtigen Weltregionen über einen Zeitraum von 18 Jahren.
Die Verbindung von umfassenden Datenerhebungen und sinologischen Methoden ermöglichen es, das Verständnis von Chinas Entwicklungszusammenarbeit im Ausland zu verbessern. Für Deutschland und die Europäische Union als Stakeholder ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir ein klares Bild von den Arbeitsmechanismen und dem Umfang der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit bekommen.
Unter dem Titel “Making Chinese Foreign Aid Transparent – What is Hidden in Data and Policy Documents?” debattieren am Donnerstag Dr. Brad Parks von AidData und Dr. Marina Rudyak von der Universität Heidelberg im Rahmen der dritten Global China Conversation der Kiel Institute China Initiative dieses Thema. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.
Prof. Andreas Fuchs leitet die Kiel China Initiative des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und ist Professor für Entwicklungsökonomik an der Universität Göttingen. Seine Forschung untersucht Handels-, Investitions- und Entwicklungspolitik mit quantitativen Methoden und einem besonderen Fokus auf China und andere aufstrebende Schwellenländer.
Wang Jianjun, bisher Vorsitzender der Börse Shenzhen, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der China Securities Regulatory Commission (CSRC), der obersten Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes, ernannt. Wang wird die Arbeitsbereiche Börsengänge, Anlegerschutz und Marktoperationen beaufsichtigen. Dies teilten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wirtschaftsportal Caixin mit.

Erntezeit ist Trockenzeit: In traditioneller Spiralform ordnen Bauern im Dorf Butangkou der Provinz Jiangxi Früchte des Kamelienbaums (Camellia Oleifera) zum Trocknen an. Aus den Früchten werden dann die stark ölhaltigen Samen gewonnen. Kamelienöl wird in Asien in der Ernährung verwendet, sowie als hochwertiges Pflegeprodukt für Haut und Haar. Camellia Oleifera gilt als die winterhärteste Art unter den Kamelien.
zunächst einmal haben wir heute eine gute Nachricht für all jene, die nach China einreisen möchten. Die deutsche Außenhandelskammer AHK hat vier weitere Charterflüge von Frankfurt nach Qingdao organisiert. Der erste wird in knapp einem Monat abheben, am 24. November. Alles Weitere, wie auch einen Link zu der entsprechenden AHK-Website, finden Sie in unserem Nachrichtenteil. Wegen des laufenden Corona-Ausbruchs in China wurde mit Lanzhou derweil eine ganze Millionenmetropole unter Quarantäne gestellt. Peking bleibt bei seiner Null-Toleranz-Linie.
Charlotte Wirth analysiert, warum das geplante EU-Lieferkettengesetz weiter auf sich warten lässt. Eigentlich sollte das Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht heute vorgestellt werden. Doch daraus wird nichts, denn offenbar kann sich die Kommission in zentralen Fragen nicht einigen. Einer der strittigen Punkte ist das Thema Zwangsarbeit. Und das betrifft auch China, man denke an die Vorwürfe zu Zwangsarbeit in Xinjiang.
Derweil macht sich Chinas ältester staatlicher Autobauer FAW daran, ein Elektromodell seiner Luxus-Marke Hongqi – übersetzt “Rote Fahne” und Staatskarosse der politischen Elite – im Ausland zu vermarkten. Das Eingangstor nach Europa soll, wie für andere Elektroauto-Hersteller auch, Norwegen sein. Frank Sieren erklärt, was es mit dem neuen Luxusschlitten auf sich hat, und welche Qualität Käufer in der Welt von dem Auto erwarten können.
Und auch sonst ist wieder einiges los in und um China. Wir wünschen Ihnen also eine spannende Lektüre.

Seit Monaten warten Beobachter und Unternehmen auf den Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission zum EU-Lieferkettengesetz. Eigentlich wollte die EU-Kommission einen Vorschlag dazu am Mittwoch vorstellen. In dem Papier soll konkret beschrieben werden, wie sich das EU-Lieferkettengesetz nach Ansicht der Brüsseler Behörden gestalten wird. Doch die Kommission reißt die Deadline. Sie kann sich nicht zu einer gemeinsamen Haltung in zentralen Fragen zusammenraufen, etwa dem künftigen Anwendungsbereich des Textes. Es herrsche ein “Kalter Krieg” zwischen den zuständigen Generaldirektionen, der für Binnenmarkt (DG Grow) und der für Justiz (DG Just), heißt es aus Kreisen.
Nun will die Kommission erst am 8. Dezember liefern. Aber immerhin will sie ihre überarbeitete Folgenabschätzung diese Woche beim Ausschuss für Regulierungskontrolle einreichen. Dieser prüft als unabhängiges Gremium alle Initiativen der EU-Kommission. Fest steht bereits, dass die Mitgliedsstaaten für die spätere Umsetzung des Lieferkettengesetzes zuständig sein werden. Weiterhin offen ist dagegen, welche Stufen der Lieferketten das Gesetz überhaupt regeln wird, inwiefern es Opfern Zugang zum EU-Justizsystem ermöglicht, und ob und wie die persönliche Haftung der Führungskräfte der Unternehmen umgesetzt wird (Europe.Table berichtete). Das sind in der Tat wichtige Fragen.
Und nun hat Ursula von der Leyen auch noch einen weiteren Punkt auf die Liste der Streitpunkte gesetzt: das Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit (China.Table berichtete). Ein solches Vorhaben hatte die Kommissionschefin in ihrer diesjährigen Rede zur Lage der Europäischen Union angekündigt: “Wir wollen […] auf unseren Märkten Produkte verbieten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Menschenrechte sind nicht käuflich – für kein Geld der Welt”, sagte von der Leyen im September. Was sie jedoch nicht sagte – und wahrscheinlich auch nicht wusste – war, wie sie das Verbot durchsetzen will. Und die zuständigen Kommissare, allen voran Handelskommissar Valdis Dombrovskis, waren über ihren Vorstoß anscheinend nicht informiert.
Naheliegend wäre es, das Importverbot über ein eigenständiges Handelsinstrument umzusetzen, das dann nicht in den Rahmen des EU-Lieferkettengesetzes fallen würde. Denkbar wäre zum Beispiel eine Regulierung, die es dem Zoll ermöglicht, Produkte abzufangen, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. So erlaubt der “Tariff Act” der USA den Zollbehörden, Produkte zu beschlagnahmen, die aus Zwangsarbeit stammen könnten. Im Juli stoppten US-Behörden auf diese Weise die Einfuhr menschlicher Haarprodukte aus Xinjiang. Washington plant desweiteren die Umsetzung eines Gesetzes, dass sich speziell gegen China richtet, des “Uyghur Forced Labour Prevention Act”.
Doch von der Leyen hat die Rechnung ohne ihren Handelskommissar gemacht. Dombrovskis sperrt sich bislang gegen den Vorstoß. Seine Generaldirektion für Handel (DG Trade) prüft schon länger die Umsetzung eines Importverbots – bisher erfolglos. Ein Gesetz nach US-amerikanischem Vorbild sei nicht möglich, da die europäischen Zölle so nicht funktionierten, heißt es aus internen Kreisen. Zudem befürchte man, ein solcher Vorschlag wäre nicht konform mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Zumindest nicht, wenn sich das Importverbot implizit gegen ein einziges Land, nämlich China, richte.
Zu einem anderen Schluss kommt hingegen eine Studie im Auftrag der Grünen von letztem Februar. Demnach wäre ein europäisierter “Tariff Act” durchaus möglich. Dieser könnte sich etwa an einer bereits existierenden Verordnung für das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, orientieren. Auch Anahita Thoms, Partnerin bei der Anwaltskanzlei Baker McKenzie und Expertin für Handelsrecht, schließt eine solche Umsetzung nicht aus. Vorstellbar wäre zum Beispiel das Thema Handel mit Produkten aus Zwangsarbeit in die Freihandelsabkommen zu integrieren, die die EU mit Partnerländern schließt.
Die EU-Kommissionspräsidentin hatte den Ball für das Importverbot aber statt Handelskommissar Dombrovskis dem EU-Kommissar zuständig für Binnenmarkt, Thierry Breton, und Justiz-Kommissar Didier Reynders zugespielt. Was wichtig daran ist: Eine Integration des Einfuhrverbots in das Lieferketten-Gesetz würde bedeuten, dass die Verantwortung bei Unternehmen liegt. Die Firmen müssten Produkte, bei denen die Vermutung besteht, dass Zulieferer aus problematischen Regionen wie Xinjiang eingekauft haben, aus dem Verkauf nehmen.
Anwältin Thoms sieht dieses Vorhaben kritisch und geht davon aus, dass von der Leyens Vorstoß das ohnehin schon verspätete EU-Lieferkettengesetz womöglich noch weiter hinauszögert. “Es ist sowieso schon eine große Herausforderung. Wieso erschwert man das Gesetzesvorhaben so kurzfristig durch einen Vorschlag, von dem man nicht weiß, wie er nachher in der Praxis umgesetzt werden kann?”, fragt Thoms.
Gleich mehrere Elemente behindern eine rasche Umsetzung eines Importverbots: Da wäre etwa die Komplexität der Produkte, die auf dem europäischen Markt zirkulieren. Oft stammen die Komponenten aus verschiedenen Herkunftsländern. Die Einzelteile werden in einem dritten Land zu fertigen Produkten verarbeitet. Doch was, wenn etwa zehn Prozent eines Produktes aus einer “problematischen” Region stammen, der Rest aber nicht? Wenn jedes einzelne Teilchen eines komplex zusammengebauten Produktes unter ein Importverbot fiele, so könnte das in der Praxis “immense Herausforderungen für die Unternehmen verursachen”, warnt Thoms.
Die Implementierung des Einfuhrverbotes über die Verordnung zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht – also das Lieferkettengesetz – hätte zudem große Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Regulierung, gibt die Anwältin zu bedenken. Denn noch ist nicht klar, welche Stufen der Lieferketten unter die Sorgfaltspflicht fallen werden, und ob die Unternehmen etwa nur ihre direkten Zulieferer werden prüfen müssen. Diese Diskussion aber wäre mit einem Importverbot hinfällig: “Wenn ein Unternehmen dafür sorgen muss, dass ein Produkt, das aus Zwangsarbeit stammt, gar nicht erst auf den europäischen Markt kommt, dann muss im Ergebnis die gesamte Lieferkette geprüft werden“, so Thoms.
Die Entscheidung, wo das Thema Zwangsarbeit aufgehängt wird, hat also durchaus gravierende praktische Folgen für Firmen mit Aktivitäten etwa in China.
Gleichzeitig zielt das EU-Lieferkettengesetz, zumindest in einer strengen Auslegung, die sich Justiz-Kommissar Reynders wünscht, ohnehin darauf ab, Menschenrechtsverletzungen – darunter eben auch Zwangsarbeit – zu vermeiden. Unternehmen sind schließlich dazu angehalten, ihre Lieferketten zu prüfen und sie anzupassen, wenn sie Menschenrechtsverletzungen feststellen. In diesem Sinne dürfte ein strenges Gesetz implizit dafür sorgen, dass Produkte aus Zwangsarbeit nicht auf dem europäischen Markt landen.
Denkbar wären aber auch ergänzende Maßnahmen, die Nicht-EU-Unternehmen anvisieren, sagt Anahita Thoms. Diese könnten verhindern, dass Produkte aus Drittländern, die Komponenten aus Zwangsarbeit enthalten, auf den europäischen Markt gelangen. Dann wiederum müsste die Verantwortung beim Zoll liegen. Sprich: Der Ball läge wieder bei Handelskommissar Vladis Dombrovskis.
Im EU-Parlament stößt ein Importverbot via Lieferkettengesetz auf wenig Rückenwind. Der sozialdemokratische Abgeordnete Raphael Glücksmann aus Frankreich, der sich intensiv mit der Lage der Uiguren in Xinjiang beschäftigt, spricht sich vehement gegen die Idee aus: “Die Verordnung wird so schon kompliziert genug. Die Sorgfaltspflicht gilt für Unternehmen. Ein Verbot fokussiert sich aber auf Produkte. Es muss durch ein Handelsinstrument durchgesetzt werden.” Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini teilt seine Bedenken. Die Implementierung durch die Sorgfaltspflicht würde den Prozess nur weiter verkomplizieren. Auch Menschenrechtsorganisationen wie Global Witness halten von dem Vorstoß von der Leyens wenig und fordern die Kommission auf, einen separaten Vorschlag für ein Importverbot zu entwerfen.
Die EU-Kommission selbst äußert sich bisher nicht eindeutig darüber, wie sie von der Leyens Importverbot umsetzen will, zählt das geplante EU-Lieferkettengesetz aber zu den möglichen Wegen. Ein zentraler Punkt des Vorschlags seien “wirksame Aktionen” und “Durchsetzungsmechanismen”, wenn Unternehmen Probleme in ihren Lieferketten – etwa Zwangsarbeit – feststellen, sagt eine Sprecherin. Wie diese Mechanismen aussehen könnten, lässt sie allerdings offen. Bei einer Verordnung haben darüber ohnehin die Mitgliedsstaaten das letzte Wort.
Während Breton und Reynders sich über keinen anderen Aspekt des geplanten Gesetzes einig sind, halten sie beim Importverbot zusammen. Man will keine spezifischen Verbote oder Sanktionen einführen. Es sieht ganz so aus, als ob nur eine Person von der Idee überzeugt ist, das Importverbot über die Lieferketten einzuführen: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Der “Hongqi” – übersetzt “Rote Flagge” – ist die symbolträchtigste Automarke der Volksrepublik. Bereits Mao Zedong ließ sich in einer schwarzen Staatskarosse von Hongqi herumkutschieren. Und auch heute noch ist der Hongqi das Fahrzeug der Wahl für die Partei-Elite. Die Autos sind regelmäßig in der Nähe des Pekinger Regierungsviertels zu sehen, ebenso wie auf Militärparaden. Das offene Auto, in dem Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Militärparaden abnimmt, ist ein Hongqi. Und auch US-Präsidenten und deutsche Kanzler:innen wurden mit Autos dieser Marke vom Flughafen abgeholt.
Eine Edelversion der “Roten Fahne” soll nun die Welt erobern: Die “kommunistische Luxusmarke” exportiert seit kurzem in China hergestellte Hongqi-Elektro-SUVs nach Norwegen. Anfang Oktober erhielt FAW nach eigenen Angaben für den Elektro-SUV E-HS9 bereits 500 Bestellungen aus dem skandinavischen Land, das eine Hochburg der Elektromobilität ist.
Doch ganz so einfach wird es nicht mit dem Markteinstieg in Europa. Die ideologisch-historische Anziehungskraft von Hongqi mag in China stellenweise wirken, im Westen es nur ein weiteres chinesisches Auto.
Hongqi gehört zum Staatskonzern First Automobile Works (FAW), der auch Joint Venture Partner von VW und Audi ist. Das Unternehmen wurde 1953 mit sowjetischer Unterstützung als erste Automobilfabrik Chinas in Changchun in der nordöstlichen Provinz Jilin gegründet.
Der 5,2 Meter lange E-HS9 ist heute das Flaggschiff des Unternehmens. Das Gefährt erinnert optisch an Autos der Marke Rolls-Royce. Das ist kein Zufall: Denn entworfen hat ihn Giles Taylor, der zuvor Designchef von Rolls-Royce war und seit 2018 als Global Vice President of Design und Chief Creative Officer bei Hongqi im Einsatz ist. Der Wechsel machte für ihn durchaus Sinn. Die Marke ist zwar nicht so renommiert, der Job aber viel spannender. Taylor durfte unter anderem für Hongqi und FAW ein Design-Zentrum in München aufbauen. Hongqi ist derzeit die einzige heimische Superluxusmarke auf dem größten Automobilmarkt der Welt. Und FAW hat mit dieser Marke noch viel vor.
Der Hongqi E-HS9 basiert auf der FMA-Plattform und ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Basisversion kommt als 6- oder 7-Sitzer. Er verfügt über zwei 160-kW-Motoren und einen 84-kWh-Akku. Die Reichweite liegt bei mindestens 460 km. Die Top-End-Konfiguration, die in 6- und 4-Sitzer-Ausführung erhältlich ist, verwendet einen 160-kW-Motor, einen 245-kW-Motor und einen 99-kWh-Akku. Der E-HS9 unterstützt kabellose Ladetechnologie, mit der das SUV in 8,4 Stunden vollständig aufgeladen werden kann. Autonome Fahrmanöver der Stufe 3+ sollen ebenfalls möglich sein. Auf Wunsch gibt es das Auto sogar mit einem beleuchteten, kristallbesetzten Schaltknüppel.
Norwegen hat die bislang beste Infrastruktur für Elektroautos in Europa. Es ist daher das Einfallstor auch für andere chinesische Elektro-Marken, etwa NIO, Xpeng und BYD. Auch FAW will mit der Einführung des E-HS9 in Norwegen die Marke Hongqi in Europa etablieren. FAW geht davon aus, dass die Verfügbarkeit des Hongqi-Sortiments in Zukunft auf den Rest der Welt ausgeweitet wird. Im hochpreisigen Automobilmarkt Dubais ist das Unternehmen bereits präsent.
Für den Vertrieb hat sich FAW deshalb mit dem lokalen Autohändler Motor Gruppen zusammengetan – einem renommierten Autohändler mit 45 Jahren Erfahrung. Motor Gruppen kümmert sich sowohl um den Verkauf als auch den Service der Hongqi-Fahrzeuge. Die Preise sollen umgerechnet zwischen 57.000 bis 66.000 Euro liegen.
In China ist der Absatz von Hongqi in den letzten Jahren dank der Einführung neuer Modelle und der Erweiterung des Vertriebsnetzes stetig gestiegen. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres konnte das Unternehmen über 170.600 Fahrzeuge verkaufen, 95 Prozent mehr als im Vorjahr, indem jedoch auch Corona-Beschränkungen den Verkauf drosselten. Aktuell bietet Hongqi insgesamt zwölf Modelle an. FAW will den Absatz 2022 auf 400.000 Exemplare, 2025 auf 600.000 und 2030 auf stolze 800.000 bis eine Million steigern.
Das teuerste für Privatpersonen erhältliche Modell ist der L5. Er kostet bis zu 1,2 Millionen Dollar, also sechsmal so viel wie eine Mercedes-Maybach S-Klasse. Die Botschaft: Auch China kann begehrenswerte Luxuslimousinen bauen. Der Grund für den Preis dürfte jedoch vor allem daran liegen, dass die Luxusschlitten so “einzigartig und so selten sind”, wie das Forbes-Magazin erklärt. Das Design ist imposant, eine gelungene Mischung zwischen Rolls-Royce-Anmutung und der Hongqi-Tradition. Bei der Verarbeitungsqualität der Innenausstattung kommen die Hongqis jedoch nicht annähernd an einen Maybach heran. Da sieht man dann doch, was jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich wert ist. Unlösbar sind solche Probleme aber nicht.
Ein weiteres, auf 99 Exemplare limitiertes Sonderstück wurde im Frühjahr auf der Auto Shanghai 2021 vorgestellt. Der Sportwagen S9 erinnert mit seiner roten Lackierung und der schnittigen Karosserie an Modelle von Ferrari oder Lamborghini. Gestaltet hat ihn Walter de Silva, der zuvor unter anderem für Alfa Romeo und Audi gearbeitet hat. Bei den Ingolstädtern war er für Audis Sportwagen R8 und die Audi Tochter Lamborghini zuständig.
Der S9 verfügt über ein Plug-in-Hybridsystem mit einem V8-Verbrennungsmotor unter der Haube, der 1.420 PS (1.044 Kilowatt) leistet. Angeblich ist der S9 in der Lage, aus dem Stand in nur 1,9 Sekunden 100 km/h zu erreichen. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 402 km/h liegen, während die rein elektrische Reichweite bei 40 Kilometern liegt. Künftig soll der S9 auch als reines Elektroauto verfügbar sein.
Das Hybrid-Hypercar S9 wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Ingenieur- und Design-Startup Silk EV entwickelt. Die Investitionen in das Gemeinschaftsunternehmen liegen bei über einer Milliarde Euro. Berichten zufolge soll der S9 im italienischen Modena montiert werden, weil die gewünschte Qualität bei FAW in China nicht möglich ist. Produktionsstart ist 2022. Der Preis des Flitzers soll bei rund 1,4 Millionen US-Dollar liegen. Mit einer Staatskarosse hat dieses Auto nicht mehr so viel zu tun.
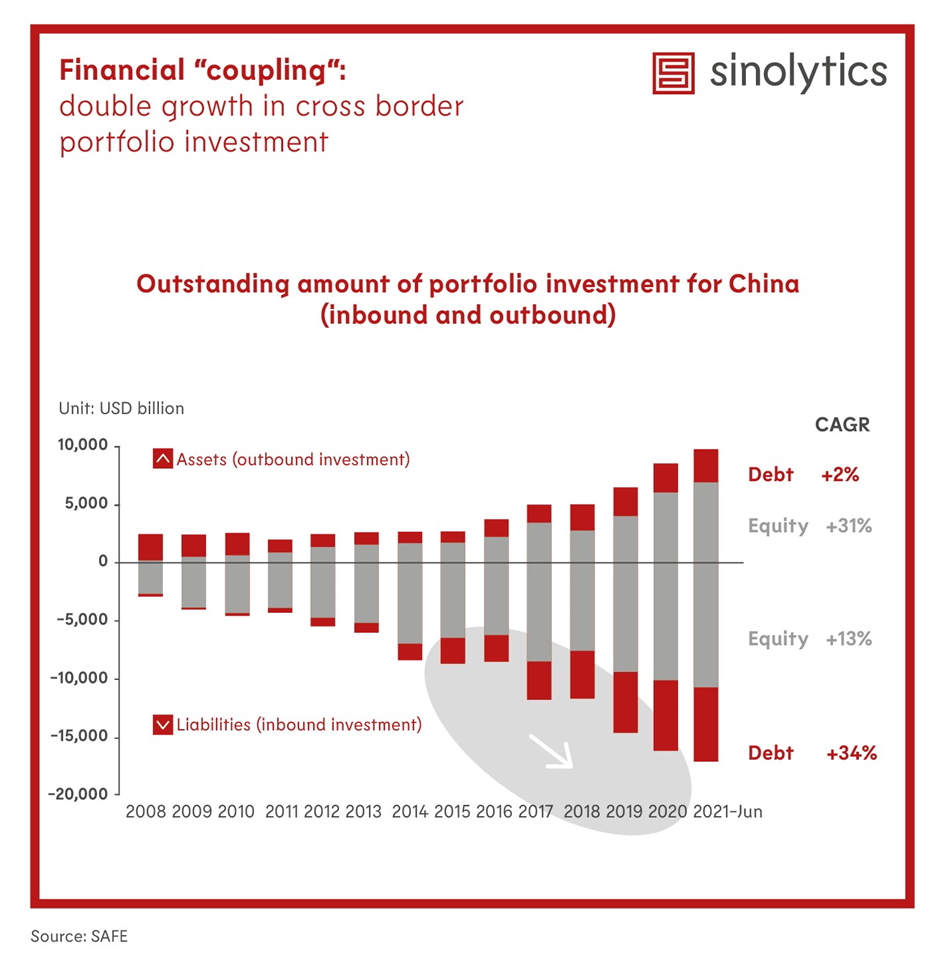
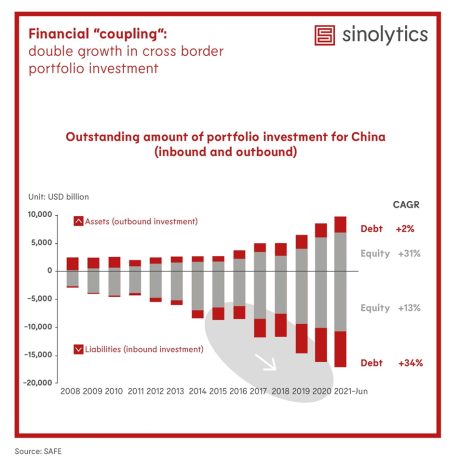
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.
China hat einen Klima-Aktionsplan für die Jahre bis zum Erreichen des Höchststands der CO2-Emissionen 2030 vorgelegt. Dieser Aktionsplan ist der erste in einer Reihe von Sektorplänen, die dem am Sonntag veröffentlichten “obersten Planungsdokument” zur Erreichung der Klimaziele folgen (China.Table berichtete).
Insgesamt nennt der Aktionsplan neun übergeordnete Bereiche, in denen Emissionen gesenkt werden sollen. Dazu zählen:
Neue Klimaziele enthält der Aktionsplan aber nicht, sondern bekräftigt Bekanntes: Der Kohleverbrauch soll “strikt kontrolliert” werden und im Zeitraum zwischen 2026 und 2030 sinken. Bis 2030 soll der Anteil des Verbrauchs nicht-fossiler Energieträger 25 Prozent erreichen. Die Kohlendioxidemissionen pro BIP-Einheit sollen bis 2030 im Vergleich zu 2005 um mehr als 65 Prozent sinken.
Lauri Myllyvirta, Energieexperte vom Centre for Research on Energy and Clean Air, kritisiert, dass der Plan keine Angaben über die Höhe der Emissionen und den genauen Zeitpunkt des anvisierten Emissions-Höchststands macht. Das könnte man von einem nationalen Aktionsplan zu dem Thema allerdings verlangen, so der Klimaexperte. Der Plan sei “viel allgemeiner und offener” als Myllyvirta erwartet hatte.
Der Aktionsplan betont zudem das derzeit stark in den Fokus gerückte Thema Energiesicherheit. China sei reich an Kohle und arm an Öl und Gas. Der Plan ruft deshalb zu einer “stetigen und geordneten, sicheren Kohlenstoffreduzierung” auf. nib
Chinas Zentralregierung will die derzeit stark steigenden Preise für Kohle stärker regulieren. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission will dafür einen Mechanismus ausarbeiten, damit der Kohlepreis nicht mehr zu stark schwankt. Es soll demnach einen Referenzpreis und eine bestimmte Spanne geben, die der Preis um den Referenzpreis schwanken darf. Die Regierung schaue sich für die Entwicklung des Mechanismus die Profitabilität und Kosten der Kohleproduzenten an, berichtet Reuters.
Chinas Kohlepreise sind seit Jahresanfang um 150 Prozent angestiegen. Sie sind eine der zentralen Ursachen für die aktuelle Energiekrise. Weil die Strompreise staatlich festgelegt waren, waren viele Kraftwerke angesichts der horrenden Kohelpreise nicht mehr profitabel (China.Table berichtete). Sie drosselten die Produktion, während die Nachfrage nach Strom aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs im Gefolge der Corona-Pandemie stark stieg. Die Preise sanken nach einem Höhepunkt zuletzt leicht, nachdem die Regierung Maßnahmen angekündigt hatte.
In den letzten Tagen hat die Volksrepublik zudem die Ausweitung der Kohleproduktion angeordnet. Ebenso wurde eine Strompreisreform durchgeführt (China.Table berichtete). Trotzdem haben die Kraftwerke noch immer Schwierigkeiten, ihre Lagerbestände aufzustocken, wie Reuters berichtet. Analysten gehen demnach davon aus, dass der Kohleverbrauch ab Mitte November aufgrund des Wintereinbruchs steigen wird. Der Bergbau und der Transport der Kohle werde sich dann aufgrund des schlechten Wetters verlangsamen. nib
Die deutsche Außenhandelskammer in China (AHK) startet eine neue Reihe an Charterflügen nach China. Ab dem 24. November werden vier Flüge von Frankfurt am Main aus nach Qingdao abheben. Der zweite Flug ist am 15. Dezember, der dritte am 5. Januar 2022 und der vorerst letzte am 26. Januar. Wie schon bei vergangenen Flügen gibt die AHK aber keine Garantie ab, dass die Flüge tatsächlich so stattfinden wie geplant.
Mit den Flügen verbunden ist ein Fast Track-Kanal für eine schnellere Ausstellung der PU-Letter und Visa, die für die Einreise notwendig sind. Chinesische Behörden müssen die Passagierliste allerdings absegnen. Bei der Einreise selbst sind die Regeln genauso streng wie für alle Ankommenden: Pflicht sind zwei negative PCR-Tests und ein negativer Antigen-Test vor dem Abflug. Während der Quarantäne wird weiter getestet – das gilt auch für Geimpfte. Eine Covid-Impfung ist aber keine Voraussetzung für das grüne Gesundheits-Zertifikat, das alle Reisenden brauchen. China erkennt die westlichen Impfstoffe wie Biontech/Pfizer ohnehin nicht an.
Die Tickets kosten 2.800 Euro für AHK-Mitglieder oder 3.200 Euro für Nicht-Mitglieder. Der Preis beinhaltet die Organisation der mindestens 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft in Qingdao, nicht aber den Aufenthalt selbst. Dafür veranschlagt die Kammer rund 1.000 Yuan pro Nacht einschließlich Verpflegung, umgerechnet etwa 135 Euro.
Es ist ein teures Vergnügen. Allerdings gibt es noch immer Expats oder Familienangehörige von Expats, die aktuell keine Möglichkeit sehen, nach China zu reisen – und somit entweder ihren Job in China nicht antreten können oder nicht gemeinsam mit ihrem Partner, beziehungsweise ihren Eltern leben können. Einigen von ihnen können die AHK-Flüge nun helfen. Alle Informationen zu den Flügen finden sich auf der AHK-Website. ck
China greift aus Furcht vor einer neuen Corona-Welle zu immer drastischeren Maßnahmen. Am Dienstag stellten die Behörden eine ganze Stadt unter Quarantäne: Die vier Millionen Einwohner von Lanzhou am Gelben Fluss im Nordwesten des Landes dürften ihre Wohnanlagen nur noch in Notfällen oder zum Kauf von Lebensmitteln verlassen, erklärte die Stadtverwaltung. Ein- und Ausgänge der Wohnkomplexe sollten überwacht werden. Zuvor hatte China am Dienstag ganze 29 neue lokale Corona-Infektionen gemeldet, davon sechs in der Provinz Gansu, deren Hauptstadt Lanzhou ist. Innerhalb von acht Tagen (Montag bis Montag) hatte die Volksrepublik 195 neue inländisch übertragene symptomatische Infektionen vermeldet.
Auch in Peking werden die Auflagen immer schärfer. Am Montag wurden die Bewohner der Hauptstadt aufgefordert, Peking nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Seit Sonntag sind alle Bewohner eines Wohnkomplexes im Nordwesten der Stadt isoliert, da es dort einen positiven Corona-Fall gegeben hatte. Personen dürfen aus Regionen, in denen es Infektionen gab, vorerst nicht in die Haupstadt einreisen, nicht einmal Bewohner. In Peking sind die Behörden aufgrund der bevorstehenden Olympischen Winterspiele besonders nervös. Neue Richtlinien vom Montag verlangen, dass alle ungeimpften Olympia-Athleten nach der Ankunft in Peking für 21 Tage in Quarantäne gehen müssen. Ausnahmen werden demnach nur in Einzelfällen geprüft, etwa wenn jemand aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfe. ck
Tesla hat ein Zentrum für Entwicklung und Forschung (R&D) in Shanghai eingerichtet. Es sei der erste R&D Standort außerhalb der USA, berichtet Bloomberg. Der Grund ist der übliche für Ansiedlungen von Forschungskapazitäten in China: Mit dem Standort werde das Ziel verfolgt, “Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Bedürfnissen der chinesischen Verbraucher besser entsprechen“, gab der E-Autobauer in einer Erklärung an. Neben dem R&D-Zentrum sei in Shanghai auch ein Datenzentrum gebaut worden. Beide werden in naher Zukunft in Betrieb gehen.
Das Unternehmen hatte im September über 56.000 Autos im chinesischen Markt abgesetzt und damit einen neuen Absatzrekord gefeiert (China.Table berichtete). Das Unternehmen profitiert in China unter anderem von einem nationalen Emissionspunkte-System. Dabei müssen Autobauer Emissionspunkte von anderen Herstellern aufkaufen, wenn sie selbst zu wenige E-Autos verkaufen. Tesla konnte über dieses Emissionshandelssystem über 330 Millionen Euro einnehmen (China.Table berichtete). Am Montag war der Börsenwert Teslas auf über eine Billion US-Dollar gestiegen. nib
Die chinesische Reederei Cosco hat ihre Anteile am Hafen im griechischen Piräus erhöht. Cosco habe seinen Anteil an der Betreibergesellschaft Piraeus Port Authority (PPA) auf 67 Prozent erhöht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Bisher hielt Cosco 51 Prozent und hatte damit bereits seit 2016 die Mehrheitsbeteiligung an dem Mittelmeer-Hafen inne. Die griechischen Behörden hatten Medienberichten zufolge im Sommer dieses Jahres zugestimmt, weitere 16 Prozent an Cosco abzutreten.
Der Hafen von Piräus unweit der griechischen Hauptstadt Athen, hat nach Xinhua-Angaben einen jährlichen Umschlag von 7,2 Millionen Standardcontainern (TEU). Er ist der größte Seehafen Griechenlands und einer der größten im Mittelmeerraum. Die Erhöhung des Anteils von Cosco trifft mit einem ranghohen Besuch zusammen: Chinas Außenminister Wang Yi wird am Mittwoch auf Einladung seines griechischen Amtskollegen Nikos Dendias in Athen erwartet.
Die chinesische Beteiligung ist immer wieder Anlass für Debatten. Cosco beteiligt sich auch mit 35 Prozent an einem Containerterminal in Hamburg Tollerort. (China.Table berichtete). Die Übernahme wartet derzeit noch auf wettbewerbs- und außenwirtschaftsrechtliche Genehmigungen. ari
Eine Lesung zu einer Biografie über Xi Jinping in Duisburg findet nun doch statt – allerdings nicht durch das der Universität angegliederte Konfuzius-Institut. Stattdessen wird die Veranstaltung vom Ostasieninstitut der Universität selbst organisiert, wie die dpa berichtet. Zunächst war die Veranstaltung auf chinesischen Druck hin abgesagt worden (China.Table berichtete). Eine ähnliche Lesung in Hannover hat bisher keinen anderen Veranstalter gefunden. Die dortige Universität ist der Nachrichtenagentur zufolge jedoch in Gesprächen mit dem Verlag des Buches “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt” der Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges. nib

Die Entwicklungszusammenarbeit Chinas mit dem Globalen Süden hat in den westlichen Medien zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Wachsende Aufmerksamkeit hat jedoch nicht immer zu wachsendem Verständnis geführt. So ist in vielen Medien die Rede von einer “Kreditfalle” und “Schuldenfallendiplomatie” Chinas. Gleichzeitig argumentieren beispielsweise Deborah Brautigam, Professorin an der Johns Hopkins University, und Meg Rithmire, außerordentliche Professorin an der Harvard Business School: “Das Narrativ stellt sowohl Peking selbst, als auch die kooperierenden Entwicklungsländer falsch dar.” Ist der Vorwurf der “Schuldenfallendiplomatie” gerechtfertigt?
Es ist schwer, Antworten auf solche Fragen zu finden. Dafür gibt es zwei Gründe: das Fehlen ausreichender Daten und das mangelnde Verständnis der Funktionsmechanismen von Chinas System der Auslandshilfe. Der Mangel an ausreichenden Daten ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es keine umfassenden Berichtssysteme für Entwicklungsprojekte Chinas gibt. Während Deutschland wie viele andere Länder seine Projekte an die OECD berichtet, die die Informationen für alle zugänglich aufbereitet, stellt China keine vergleichbaren Daten bereit. Da es keine verlässliche, offizielle Quelle gibt, war es in der Vergangenheit schwierig, sich ein umfassendes Bild von Pekings ausländischen Entwicklungsaktivitäten zu machen.
Initiativen wie AidData am College of William & Mary haben versucht, diese Lücke zu schließen. Seit 2013 verfolgen AidData unter der Leitung von Dr. Brad Parks die offiziellen Finanztransfers aus China an Entwicklungsländer mit ihrer sogenannten TUFF-Methode. TUFF steht hierbei für Tracking Underreported Financial Flows. Dafür bringt AidData unstrukturierte, offen zugängliche, projektbezogene Daten zusammen, die von verschiedensten Quellen veröffentlicht werden und standardisiert und vereinheitlicht die Daten. Auf der Grundlage dieser Methodik begann AidData zunächst mit der Veröffentlichung regionalspezifischer Datensätze. 2017 präsentierte AidData den ersten Datensatz, der den gesamten Globalen Süden abdeckt. Der in diesem September aktualisierte Datensatz umfasst 13.427 Projekte im Wert von 843 Milliarden US-Dollar in 165 Ländern in allen wichtigen Weltregionen über einen Zeitraum von 18 Jahren.
Die Verbindung von umfassenden Datenerhebungen und sinologischen Methoden ermöglichen es, das Verständnis von Chinas Entwicklungszusammenarbeit im Ausland zu verbessern. Für Deutschland und die Europäische Union als Stakeholder ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir ein klares Bild von den Arbeitsmechanismen und dem Umfang der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit bekommen.
Unter dem Titel “Making Chinese Foreign Aid Transparent – What is Hidden in Data and Policy Documents?” debattieren am Donnerstag Dr. Brad Parks von AidData und Dr. Marina Rudyak von der Universität Heidelberg im Rahmen der dritten Global China Conversation der Kiel Institute China Initiative dieses Thema. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.
Prof. Andreas Fuchs leitet die Kiel China Initiative des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und ist Professor für Entwicklungsökonomik an der Universität Göttingen. Seine Forschung untersucht Handels-, Investitions- und Entwicklungspolitik mit quantitativen Methoden und einem besonderen Fokus auf China und andere aufstrebende Schwellenländer.
Wang Jianjun, bisher Vorsitzender der Börse Shenzhen, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der China Securities Regulatory Commission (CSRC), der obersten Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes, ernannt. Wang wird die Arbeitsbereiche Börsengänge, Anlegerschutz und Marktoperationen beaufsichtigen. Dies teilten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wirtschaftsportal Caixin mit.

Erntezeit ist Trockenzeit: In traditioneller Spiralform ordnen Bauern im Dorf Butangkou der Provinz Jiangxi Früchte des Kamelienbaums (Camellia Oleifera) zum Trocknen an. Aus den Früchten werden dann die stark ölhaltigen Samen gewonnen. Kamelienöl wird in Asien in der Ernährung verwendet, sowie als hochwertiges Pflegeprodukt für Haut und Haar. Camellia Oleifera gilt als die winterhärteste Art unter den Kamelien.
