technologische Standards haben heute noch nicht die politische Bedeutung, die sie in 20 Jahren haben werden. Einfach aus dem Grund, weil viele Zukunftstechnologien noch keine breite Marktreife erreicht haben. Europa muss aber darauf vorbereitet sein, dass die Volksrepublik China die Entwicklung von Standards in geopolitische Kraft ummünzen wird. Die Erfahrungen während der Corona-Pandemie dienen als Blaupause.
China hat in der Krise gelernt, wie es Verzögerungen und Knappheiten in den globalen Lieferketten politisch zu seinen Gunsten nutzen kann. Auch droht Peking Kritikern immer häufiger ganz unverblümt mit seiner Marktmacht. Sollte die Volksrepublik ihre Standards in Schlüsselindustrien eines Tages durchgesetzt haben, wird ihr politischer Druck auf andere Akteure massiv zunehmen – gerade auch auf Deutschland. Es wäre naiv, daran zu zweifeln.
Im Interview mit China.Table sagt Sibylle Gabler vom Deutschen Institut für Normung: “Chinas Aktivitäten haben hier zugenommen”. Meine Prognose wäre: Das ist erst der Anfang.
In der Praxis verankert die Volksrepublik heute schon das Grundgerüst ihrer Standards in weiten Teilen der Welt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten investieren chinesische Firmen als Akteure der neuen Seidenstraße in nahezu alle künftige Schlüsselindustrien. Wir haben uns die Entwicklung in Dubai vor Ort angeschaut.
Die Erkenntnis: Das globale Infrastruktur-Programm der Europäischen Union namens Global Gateway als Antwort auf die neue Seidenstraße kommt keinen Tag zu früh. Es wird höchste Zeit, dass Europa seine Präsenz dort erhöht, wo die Volksrepublik schon lange begonnen hat, sich auszubreiten.
Ein freundlicher Gruß


Standardisierung gilt eher als trockenes Thema. Warum sollte uns Normung denn überhaupt interessieren?
Dazu gibt es viele Antworten. Zunächst mal ist Standardisierung einfach ein wichtiges Mittel für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Es gilt nach wie vor der Satz: “Wer die Norm macht, hat den Markt”. Wenn Sie also Inhalte in eine Norm bringen können, die für Ihr Unternehmen von Vorteil sind, dann haben Sie es leichter, Ihre Produkte auf deutsche oder eben auch internationale Märkte zu bringen. Und es ist natürlich auch für die Volkswirtschaft als Ganzes wichtig. Denn die Normen sind eine gemeinsame Sprache und Grundlage. Rein nationale Normen können das Gegenteil bewirken. Sie können Märkte abschotten. Und Normen spielen natürlich auch eine Rolle in Sicherheitsthemen und Verbraucherschutz. Normen haben zum Beispiel den Arbeitsschutz im Bergbau verbessert und retten dadurch Menschenleben. Auch beim Thema Umweltschutz kann Standardisierung einen wichtigen Beitrag leisten.
Nun wird China als neue Weltmacht in der Standardisierung gesehen. Wie sehen Sie das? Ist es schon so weit?
Man muss sich die Frage stellen, wie definiert man Macht an dieser Stelle? Wenn wir schauen, wie intensiv China auf internationaler Ebene Positionen übernimmt, kann man jetzt nicht sagen, China wäre übermächtig. Die Volksrepublik kommt da ja letztlich von dem Stand eines Entwicklungslands und ist noch nicht an dem Punkt angelangt, der analog wäre zur jetzigen wirtschaftlichen Bedeutung. Aber sie gehen in Richtung Weltmacht mit großen Schritten und deswegen werden wir auch alle zunehmend aufmerksam, was das betrifft. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Präsidenten bei ISO aus China. Was die Übernahme von Sekretariaten anbetrifft, haben wir eine starke Steigerung von 106 Prozent. Sie sind also schwer im Kommen. Im Geschäft mit China nehmen natürlich auch chinesische Standards eine immer stärkere Bedeutung ein. Das ist für exportorientierte deutsche Unternehmen durchaus eine Herausforderung.
Müssen wir denn jetzt mehr chinesische Normen übernehmen?
Das kann man nicht so pauschal beantworten. Auf internationaler Ebene ist es ja nicht so, dass jemand aus einem Land kommt, eine Norm vorlegt und sagt “So, das ist meine Norm, macht jetzt mal eine internationale Norm daraus und schreibt ISO oder IEC drauf.” So funktioniert das nicht. Sondern man muss das mit den Experten der einzelnen Länder dann entsprechend verhandeln. Insofern ist an der Stelle eine zwingende Übernahme nicht gegeben oder möglich. Aber in dem Moment, in dem man mit China in Handelsbeziehungen tritt, sieht das unter Umständen anders aus. Unternehmen, die starke Geschäftsbeziehungen haben, müssen natürlich schauen, welche Normen in China für ihr Geschäft eine Rolle spielen.
Wie unterscheiden sich die Standardisierungsphilosophien in EU, China und USA?
In den USA gibt es nicht die eine Organisation, wie für Deutschland DIN oder ähnliche nationale Organisationen in den einzelnen Ländern Europas. Sondern es gibt hunderte von Standardisierungs-Organisationen, die zum Beispiel bei Verbänden sind. Dort ist es die Philosophie, dass sich der beste Standard schon durchsetzen wird. Europa und die USA haben eines gemeinsam: den Bottom-up-Ansatz. Die Wirtschaft sagt: “Okay, wir brauchen da jetzt eine Norm und dann machen wir eine.” In Europa haben wir noch die zusätzliche Komponente, dass auch die Europäische Kommission ein Auftraggeber für Normen sein kann und ein wichtiger Mitinitiator ist. Wir erwarten derzeit übrigens die Standardisierungs-Strategie der EU, die bald veröffentlicht werden soll.
Und in China?
Das chinesische System ist seit seiner Reform zweigeteilt, sozusagen in einen mehr staatsgelenkten Teil und einen mehr marktgetriebenen Teil. In diesem marktgetriebenen Teil sind das Wichtigste die Association-Standards, das erinnert am ehesten an das US-amerikanische Modell, wo Normen von einer Vielzahl von Organisationen erarbeitet werden. Diese Normen schnellen zahlenmäßig massiv in die Höhe, da kommen immer mehr. Dann gibt es noch den von der Regierung gelenkten Teil, aus dem nationale Normen entstehen. Einige davon sind verbindlich anzuwenden und daher am ehesten mit unserer technischen Regulierung vergleichbar. Insgesamt ist das chinesische System im Vergleich zu USA und Europa deutlich stärker staatlich gelenkt.
Peking hat vor einigen Wochen seine “Chinese Standards 2035” vorgestellt. Ist das jetzt der große Schlag von China, sich in Sachen Standardisierung einen Vorteil zu verschaffen?
Ich habe eher den Eindruck gewonnen, dass man sich damit so ein bisschen alle Möglichkeiten offen lässt. Es ist weder Abschottung, noch ein komplettes Commitment zur internationalen Normung. Es ist irgendwie ein bisschen beides. Ich denke aber, dass es generell positiv zu bewerten ist, dass es eine Berücksichtigung der internationalen Normung gibt. Man möchte sich weiterhin intensiv international einbringen. Vorgesehen ist auch, dass China 85 Prozent der internationalen Normen national übernehmen will. Das ist letztlich das Entscheidende. China kann natürlich überall mitarbeiten. Wichtig ist, dass die Normen anschließend auch verwendet werden. Ob internationale Normen dann auch wirklich unverändert übernommen werden, bleibt abzuwarten.
Wie bringt sich China denn in den internationalen Organisationen ein? Sie hatten ja bereits über die technischen Komitees oder Sekretariate gesprochen. Könnten Sie uns kurz erklären, warum diese so wichtig sind?
Die eigentliche fachliche Arbeit muss organisatorisch strukturiert werden und da kommen die Technischen Komitees ins Spiel. Das sind bei ISO über 300, wie zum Beispiel Informationstechnologie, Lebensmittel oder Qualitätsmanagement. Es gibt größere und kleinere Komitees und diese sind dann nochmal weiter aufgeteilt, zum Beispiel zur Erarbeitung von Test-Methoden, Sicherheits- oder Qualitätsaspekten. Und dort gibt es nochmal verschiedene Arbeitsgruppen. Im Sekretariat und in der Führung der Technischen Komitees hat man Gestaltungsmöglichkeiten, kann Dinge vorantreiben oder auch nicht. Deutschland war und ist dabei immer ganz gut aufgestellt. Doch nun kommt eben eine aufstrebende Volkswirtschaft wie China und übernimmt in zunehmendem Maße Sekretariate.
Was bedeutet das?
Deutschland ist in manchen Bereichen wie dem Maschinenbau sehr stark in der Normung. Gerade bei digitalen Themen sind wir aber nicht besonders gut aufgestellt. Darin sind die USA sehr stark und eben auch China. Bei Themen wie Seltene Erden, Plastik, Lithium ist China in Führung gegangen. Und damit sind wir natürlich bei Bereichen, die geopolitisch wichtig sind.
Setzt China Normung denn als geopolitisches Mittel ein?
Bei Themen wie den Seltenen Erden oder Lithium geht es auch um Recycling und um Umweltschutz. Wenn Sie da sozusagen bereits Duftmarken gesetzt haben, wie es China hat, dann sind Sie eine Nasenlänge voraus, was die Inhalte betrifft. Hier greift der alte Spruch: Wer schreibt, der bleibt. Wenn Sie Normen initiieren und dann nicht mit einem weißen Blatt Papier kommen, sondern schon etwas aufgeschrieben haben, dann haben Sie bereits gewisse Fakten geschaffen. Und auch das Thema zu setzen, ist natürlich schon politisch. Chinas Aktivitäten haben hier zugenommen. Das betrifft auch andere für China wichtige Themen wie etwa den Schienenverkehr.
Schienenverkehr ist ein gutes Stichwort, wenn es um den Green Deal geht. Wie sieht es aus bei der Standardisierung im Bereich Nachhaltigkeit? Was kommt da auf uns zu?
Das wird natürlich spannend, da wir derzeit zwei großen Umbauten in der Industrie weltweit, aber auch in Europa sehen: Der digitale und der grüne Umbau der Wirtschaft. Durch den Vertrag der Ampel-Koalition bekommt das in Deutschland weiter Momentum. Diese Vorhaben können aber nur gelingen, wenn die entsprechenden Normen mitgedacht und erarbeitet werden. Hier geht es darum, dass Deutschland und Europa Inhalte mitbestimmen und mitgestalten. Es geht um die Gestaltung von Lösungen und von Anforderungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das sind die großen Themen, die anstehen.
Wie können Deutschland und Europa auf die Trendsetzung vonseiten Chinas antworten?
Die für alle Seite beste Lösung ist es, wenn wir gemeinsam bei der internationalen Normung zusammenkommen. Denn nur dann haben wir auch alle Chancen, weiterhin eine wichtige Rolle zu spielen. Es geht nicht darum, China als Gegner zu sehen, sondern uns international zu treffen und chinesische Teilnahme und Führung auch mal willkommen zu heißen. Wenn es damit einen verschärften Wettbewerb gibt, müssen wir diesen seitens Europas und Deutschlands annehmen. Wir müssen in Europa für uns Schlüsseltechnologien identifizieren, in denen wir dann rechtzeitig selbst Themen setzen und Führung übernehmen müssen. Wenn es zum Beispiel heißt, die deutsche Industrie muss grüner werden, dann müssen wir auch schauen, dass wir die entsprechenden Normen international sehr aktiv mitbestimmen. Da ist Deutschland noch nicht im Lead. Wir müssen auch viel schneller Ergebnisse der europäischen Forschung in die internationale Normung bringen.
Denken Sie, China hat einen Vorteil, da dort Dinge einfach durchgepresst werden können?
In gewisser Hinsicht schon. Da kommen wir wieder auf die verschiedenen Normungsphilosophien. Wenn in China die Partei sagt “Jetzt machen wir es so”, dann wird es so gemacht. In einer Demokratie geht das natürlich nicht, wir haben andere Prozesse. Ich glaube, wir müssen in Zukunft Lösungen für die neuen Herausforderungen finden, die durch stärker staatsgetriebene Nationen in die Normung kommen. Unser industriegetriebener Ansatz bleibt die Grundlage. Das ist einfach unsere Tradition und unsere Herangehensweise. Aber wir müssen im Sinne der strategischen Autonomie und digitalen Souveränität in Europa auch prüfen, was getan werden muss, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaft als Ganzes zu sichern. Es gibt diese Tradition in Deutschland und im Wesentlichen auch in Europa, die heißt, die Politik hat sich eigentlich aus der Normung rauszuhalten. Aber die Zeiten ändern sich jetzt durch solche Player wie China. Beim Thema Lithium war die EU-Kommission beispielsweise alarmiert und hat gesehen, dass das ein strategisches Thema für die Elektromobilität in den nächsten Jahren wird.
Haben wir denn in Deutschland und in Europa genügend Experten, die sich damit auskennen? Und investieren wir genug Geld in die Entwicklung von Normen?
Das ist tatsächlich das größte Problem. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, es geht nur um Geld. Klar, Geld ist immer ein Thema, aber ich glaube, die größte Herausforderung sind die Expertinnen und Experten. Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Normung bemerkbar. Wir beklagen schon seit vielen Jahren, dass es zu wenig Experten gibt. An dieser Stelle müssen wir in Deutschland viel mehr in der Ausbildung machen und beispielsweise mehr Anreize für Wissenschaftler haben, in der Standardisierung mitzuarbeiten. Ein Ansatz könnte auch die vermehrte Teilnahme von Behördenvertretern sein.
Welche Möglichkeiten gibt es denn dann zur Zusammenarbeit mit China?
Eine Kooperation gibt es ja schon länger mit der Deutsch-Chinesischen Kommission für Normung. Dort wird auf strategischer Ebene gesprochen, aber auch ganz konkret zu bestimmten Themen wie beispielsweise Elektromobilität, Industrie 4.0 oder autonomes Fahren. Da treffen sich dann bilateral technische Experten aus China und Deutschland und lernen voneinander. Es gibt aber auch Beispiele, wo die Zusammenarbeit nicht gut funktioniert. Beispielsweise, wenn das Thema zentrale Datensammlung ins Spiel kommt. Unternehmen kritisieren, dass China hier in Gremien Dinge festlegen will, die nicht vereinbar wären mit unserer Herangehensweise an Daten, sprich der Datenschutzgrundverordnung.
Sibylle Gabler ist seit 2014 Leiterin für Regierungsbeziehungen bei DIN. Als Sachverständige für Normung berät sie unter anderem den Deutschen Bundestag.

Die Autofahrt über die sechs- und streckenweise auch acht- und zehnspurige Sheikh Zayed Road in Dubai bietet einen faszinierenden Einblick in die Geburt einer Stadt aus der Retorte. Bei Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h bleibt ausreichend Zeit, die klotzigen Fassaden der Wolkenkratzer links und rechts zu bestaunen. Bauwerke der Marke Weltstadt sprudeln wie Öl aus dem Wüstensand.
Es gibt hier überdeutliche Parallelen zu China. Sie sind kein Zufall. Die sieben Staaten der Vereinigten Arabischen Emirate wollen heute ebenfalls Maßstäbe setzen in Sachen Infrastruktur und Modernität, nachdem sie im vergangenen Jahrhundert noch als rückständig galten. Heute ist hier wie dort Geld im Überfluss vorhanden. Vor allem Dubai und Abu Dhabi schöpfen mit ihren Bauprojekten nun aus dem Vollen. China ist Vorbild, Partner und Finanzier. Diese neue Dimension der Partnerschaft bindet die Emirate zugleich immer enger in die Neue Seidenstraße ein.
Die Volksrepublik liefert damit wichtige Bestandteile für die imposante Erscheinung eines neuen Schmelztiegels der Kulturen auf der arabischen Halbinsel. Dass chinesische Unternehmen neue extravagante Hochhäuser bauen, ist dabei nur das oberflächliche Zeichen für eine tiefgehende Entwicklung. Chinas Firmen liefern auch das digitale Gerüst für Smart-City-Konzepte und Verkehrssysteme. Sie stellen die Ausrüstung für Glasfasernetzwerke und bieten technische Komponenten zur Videoüberwachung aller Winkel der Emirate. Sie flankieren den Bau eines riesigen Solarparks mit der Konstruktion eines Kohlekraftwerkes, automatisieren die Logistik der wohlhabenden Konsumgesellschaft und siedeln sich in Form von Start-ups und Techfirmen zu Tausenden entlang der Küste zwischen Dubai und Abu Dhabi an.
Die Emirate sind längst größter Empfänger von chinesischen Direktinvestitionen in der Region. Der bilaterale Handel kletterte vor der Corona-Krise auf über 50 Milliarden US-Dollar. Wer bislang keine Vorstellung hatte, mit welcher Intensität und Entschlossenheit Peking an der Konstruktion seiner Neuen Seidenstraße arbeitet, bekommt in der sogenannten MENA-Region (Middle East and Northern Africa) eine eindrucksvolle Vorstellung davon. Nicht nur in den Emiraten sind zunehmend chinesische Interessen vertreten, auch in Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien oder Ägypten nimmt das Engagement aus der Volksrepublik zu.
Im Zentrum steht dabei neben dem Bausektor vor allem der Transfer neuer Daten- und Telekommunikations-Technologien. Das geschieht schnell und nahezu geräuschlos. Hier entsteht eine Mischung, die ganz im Sinne des großen Geberlands China sein dürfte. Die Emirate profitieren wirtschaftlich, aber es gibt keine Opposition und keine kritische Debatte aus der Zivilgesellschaft. Die engen Beziehungen zu einem zunehmend totalitär agierenden Regime werden so nicht infrage gestellt. Auch die weitreichende Anwendung chinesischer Überwachungstechnik stößt nicht auf Grenzen. Zugleich darf China hier die eigenen Standards exportieren.
China sieht sich hierbei zugleich auch als klug kalkulierender Investor – eine Haltung, die durch den geschäftlichen Erfolg gerechtfertigt ist. “Insbesondere in den letzten Jahren hat sich das Geschäftsumfeld der arabischen Länder verbessert, und die Regierungen haben große Anstrengungen unternommen, um chinesische Investoren anzuziehen”, erklärt Luo Lin vom International and Regional Studies Institute in Peking.
Die Strategie, den Gastgebern chinesische Investitionen schmackhaft zu machen, funktioniert nach dem gleichen universellen Prinzip, das auch in anderen Weltregionen fruchtet. “Die Belt-and-Road-Initiative zwischen China und den arabischen Staaten ist ein Weg zum Aufbau von Frieden, Wohlstand, Öffnung, Innovation und Zivilisation zwischen China und der arabischen Welt”, urteilt Luo. Als Gegenleistung erwarte Peking nur, dass sich die Araber innerhalb international festgelegten Rahmenbedingungen bewegen: “Dafür unterstützen arabische Länder die Regeln des multilateralen Handels im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO, um das Ziel der Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung aller Nationen der Welt zu erreichen.”
Chinas Aufruf zum Multilateralismus unter den Regeln der Welthandelsorganisation beinhaltet stets auch einen Seitenhieb in Richtung der Vereinigten Staaten. Die Botschaft zwischen den Zeilen: Während Washington chinesische Unternehmen vom eigenen Markt verbannt, plädiert China für eine globale Zusammenarbeit zum Wohle aller Nationen der Welt. In den Ländern der MENA-Region gibt es wenig Einwände gegen die chinesische Interpretation der geostrategischen Großwetterlage.
Das Resultat sind etliche Großprojekte auch in den Emiraten, die an chinesische Firmen gehen oder von China finanziert werden. Die Entwicklung der staatlichen Eisenbahngesellschaft Etihad Rail mit einem Volumen von rund zwei Milliarden US-Dollar übernehmen zu großen Teilen Baufirmen aus der Volksrepublik. Den Bau des Kohlekraftwerkes Hassyan für etwa 3,4 Milliarden Dollar stemmen die Scheichs zu großen Teilen mit Krediten chinesischer Banken.
China Petroleum Pipeline Engineering gewann die Ausschreibung für den Entwurf und die Bauvorbereitungen für eine Gaspipeline. Der Ausbau und der Betrieb eines zweiten Containerterminals im Hafen von Abu Dhabi ist in einem Gemeinschaftsunternehmen des lokalen Betreibers und der chinesischen Cosco Shipping Ports für insgesamt 35 Jahre festgeschrieben.
Andere Verträge haben sogar noch eine längere Laufzeit. Der Pachtvertrag für ein Industriegebiet in der Freihandelszone durch die Jiangsu Provincial Overseas Cooperation & Investment Company läuft über 50 Jahre. Unternehmen aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu haben Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen Dollar angekündigt. Chinesisches Geld fließt auch in den Aufbau eines Großmarkts in der Freihandelszone. Dazu kommen Projekte wie die Entwicklung von Industrieflächen oder der Bau einer Anlage zur Herstellung des Industriegases Methanol.
Zwar verdienen auch europäische Firmen an der Entwicklung der Emirate. Beispielsweise liefert Siemens Turbinen für den Eisenbahnbau, und die französische Logistik- und Schifffahrtsgesellschaft CMA CGM betreibt für mehrere Jahrzehnte gemeinsam mit einem lokalen Partner einen weiteren Containerterminal. Doch flächendeckende Investitionen, die alle Kernbereiche von Industrie und Handel abdecken, stammen ausschließlich aus China.
Auch deutsche Beobachter vor Ort registrieren die Hinwendung zu China. “Die wirtschaftlichen Interessen der Volksrepublik werden auch auf der Expo deutlich”, sagt Dietmar Schmitz. Er ist Generaldirektor des deutschen Pavillons bei der Expo2020 in Dubai, die wegen der Corona-Pandemie erst im Oktober dieses Jahres ihre Pforten geöffnet hat. “Chinas Ansatz ist hier viel stärker auf die Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen fokussiert als beispielsweise der deutsche.” Auch die Deutschen wollten mit ihrem Auftritt ihre Unternehmen in der Region fördern. Doch während die Bundesrepublik versucht, über die spielerische Vorstellung ihrer Innovationen der Welt Lust zu machen auf Nachhaltigkeit “Made in Germany”, wirbt China unmittelbar mit Angeboten seiner Unternehmen (China.Table berichtete).
Um dem Wettbewerb und der BRI-Strategie aus China etwas entgegenzusetzen, greift nun aber auch die Europäische Union tief in die Tasche. 300 Milliarden Euro will die EU bereitstellen, um ihrer Gegenkampagne Global Gateway Leben einzuhauchen (China.Table berichtete). Am Mittwoch sollen Einzelheiten des Plans in Brüssel vorgestellt werden. Die Emirate stehen als Sinnbild dafür, dass es höchste Zeit für die Europäer wird, wenn sie chinesischen Interessen in der MENA- und anderen Region der Welt ernsthaft Paroli bieten wollen.
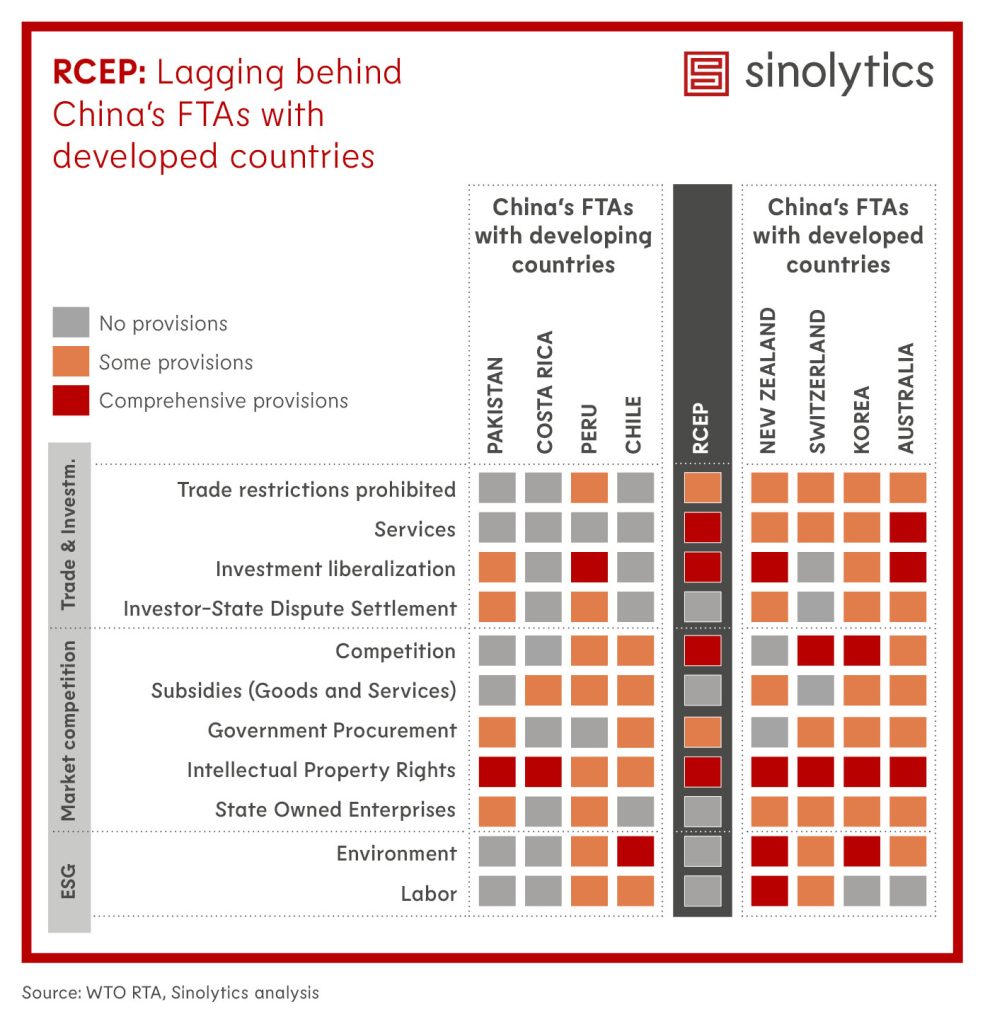
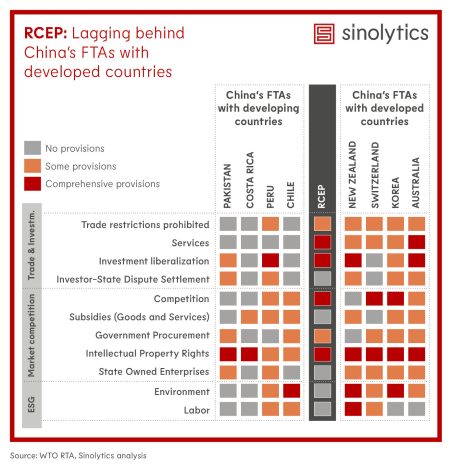
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.
Die zentralchinesische Provinz Henan will Journalisten und ausländische Studenten unter engmaschige Überwachung stellen. Das geht aus Dokumenten hervor, die von der Nachrichtenagentur Reuters analysiert worden sind. Demnach sollen die Bewegungsprofile von Mitgliedern der beiden Gruppen neben anderen “verdächtigen Personen” in Henan künftig präzise nachvollzogen werden.
Eine entsprechende Ausschreibung auf der Internetseite der Provinzregierung von Ende Juli gibt Aufschluss über die Absicht der Behörden, die Betroffenen mithilfe von Technologien zur Gesichtserkennung identifizieren zu wollen. Die Firma Neusoft aus Shenyang liefert die nötige Software, die die Bilder mit relevanten Datenbanken der Sicherheitsbehörden verknüpft und Alarm schlägt, wenn eine verdächtige Person beispielsweise in ein Hotel eincheckt. Laut Reuters kommt ein derartiges System erstmals in der Volksrepublik zum Einsatz.
Journalisten werden demnach in die Kategorien Rot, Gelb und Grün eingeteilt – um die Dringlichkeit der Nachverfolgung zu kennzeichnen. 2.000 Polizisten sollen mit der Überwachung des Systems betraut werden. Die Software integriert 3.000 Kameras, deren Bilder mit den Daten abgeglichen werden können. Die Gesichtserkennung muss laut Ausschreibung auch dann genau sein, wenn beobachtete Personen Gesichtsmasken oder Brillen tragen.
Der Generalverdacht gegen Journalisten und internationale Studenten ist ein weiterer Schritt Chinas in Richtung eines totalitären Überwachungsstaats. Mit einer stetig wachsenden Zahl von Kameras im öffentlichen Raum samt Gesichtserkennung sowie mit der Nutzung von Handy-Ortung wollen die Behörden vermeintliche Gefahren für die nationale Sicherheit frühzeitig erkennen. Während Journalisten wegen ihrer Arbeit grundsätzlich als Gefahrenquelle gelten, brandmarkt die Provinz Henan nun auch alle Studenten aus dem Ausland als mögliche Spione. grz
Mit dem Ausbau einer Reihe von Stützpunkten im Indopazifik wollen sich die USA besser auf potentielle Einsätze gegen Russland und China vorbereiten (China.Table berichtete). Wie das US-Verteidigungsministerium am Montag mitteilte, sollen militärische Einrichtungen auf der Pazifikinsel Guam und in Australien erweitert werden. Dazu gehören vor allem Militärflughäfen und Munitionslager. Zudem will das Pentagon in Australien im Rotationsprinzip neue Kampfflugzeuge und Bomber stationieren und Bodentruppen ausbilden.
Der Ausbau diene unter anderem dem Zweck, “potentielle militärische Angriffe Chinas und Bedrohungen durch Nordkorea abzuwehren”, erklärt Mara Karlin, die für strategische Fragen zuständige Abteilungsleiterin im Pentagon. Mit den erweiterten Anlagen könne Washington schneller und umfassender Truppen in die Region verlegen. Daneben soll die verstärkte US-Präsenz auch dazu beitragen, die Abschreckung gegenüber Russland zu stärken und es den Nato-Streitkräften zu ermöglichen, “effektiver vorzugehen”.
China reagierte mit scharfen Worten auf die Ankündigung. Außenamtssprecher Zhao Lijian erklärte am Dienstag, Washington schaffe, “einen imaginären Feind” und scheue keine Mühe, “um China zu umzingeln und einzugrenzen”. Die chinesische Marine hat in den vergangenen Jahren ihren Einsatzbereich im Indopazifik kontinuierlich ausgeweitet. Vor allem auch die wachsende chinesische Präsenz im Südchinesischen Meer betrachten die USA als Bedrohung ihrer bisher einzigartigen maritimen Machtposition in der Region (China.Table berichtete). fpe
Die Europäische Union macht Fortschritte in neuen Vorgaben für den europäischen Markt, die auch China dazu bewegen sollen, sich im Bereich der öffentlichen Beschaffung zu öffnen. Der Entwurf des sogenannten “International Procurement Instrument” (IPI) wurde am Dienstag im Ausschuss für internationalen Handel des Europaparlaments angenommen. Die Abgeordneten stimmten damit zwei Arten von IPI-Maßnahmen zu, aus denen die EU-Kommission wählen kann, um ungleichen Zugang zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten zu beheben. Die erste Maßnahme ist der von den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagene Preisanpassungsmechanismus. Die zweite mögliche Maßnahme besteht darin, ein Unternehmen ganz von Ausschreibungen auszuschließen.
Darüber hinaus hat der Ausschuss die Zahl der Ausnahmen auf zwei reduziert, bei denen öffentliche Auftraggeber die IPI-Maßnahmen ablehnen können:
Als Beispiele sind die Bereiche der öffentlichen Gesundheit oder des Umweltschutzes genannt. Unternehmen aus Entwicklungsländern sollen von den IPI-Vorgaben ausgenommen werden, heißt es in dem Entwurf. Für die öffentlichen Ausschreibungen sollen verschiedene Schwellenwerte greifen: bei Bau-Ausschreibungen ab zehn Millionen Euro, bei Waren und Dienstleistungen ab fünf Millionen Euro.
Über die Vorlage soll im Januar im Plenum des EU-Parlaments abgestimmt werden. Unstimmigkeiten zwischen dem Europaparlament und dem EU-Rat gebe es noch zur Umsetzungshoheit, erklärte der CDU-Europapolitiker Daniel Caspary, der federführend für die Ausarbeitung der Position des EU-Parlaments zu IPI ist. Der EU-Rat wolle die Entscheidungsmacht in den Mitgliedsstaaten ansiedeln, das EU-Parlament sieht sie bei der EU-Kommission.
Bei IPI handele es nicht um eine Verordnung “gegen China”, betonte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Die Volksrepublik sei bei diesem Thema jedoch der Elefant im Raum. China habe sich nicht an sein Versprechen zur Öffnung des Beschaffungsmarktes gehalten, so Bütikofer. Die neuen Vorgaben müssten nun ohne Schlupflöcher umgesetzt werden. ari
Die Europäische Union hat die chinesischen Behörden aufgefordert, “eine umfassende, faire und transparente Untersuchung” der Vorwürfe der Tennisspielerin Peng Shuai wegen sexueller Übergriffe durch den ehemaligen Vizepremier Zhang Gaoli durchzuführen. In einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme forderte Brüssel die chinesische Regierung zudem auf, “überprüfbare Nachweise über die Sicherheit, das Wohlergehen und den Aufenthaltsort von Peng Shuai vorzulegen”.
China müsse seinen Menschenrechtsverpflichtungen nach nationalem und internationalem Recht nachkommen. Das öffentliche Auftreten der Tennisspielerin habe nicht die Sorgen über ihre Sicherheit und Freiheit ausgeräumt.
Peng war vor gut einer Woche in einem Video-Telefonat mit IOC-Präsident Thomas Bach zu sehen gewesen (China.Table berichtete). Die Sportlerin betonte in dem Gespräch, dass sie wohlauf in ihrem Haus in Peking lebe. Menschenrechtler wie der chinesische Anwalt Teng Biao gehen davon aus, dass Peng zwar nicht körperlich verletzt, aber unter hohen psychischen Druck gesetzt werde (China.Table berichtete). ari
Die China Association of Performing Arts (CAPA) hat weitere 85 Internet-Livestreamer auf eine schwarze Liste gesetzt. Sogenannte “Key Opinion Leader” wie Tie Shankao (铁山靠) oder Guo Laoshi (郭老师) hätten einen schlechten Einfluss auf die Gesellschaft und vor allem auf die Jugend ausgeübt, schreibt die Kulturbehörde in einer offiziellen Mitteilung.
Seit der Einführung des “Blacklist Management-Systems” im Jahr 2018 wurden damit bereits 446 Livestreamer von großen Streamingplattformen des Landes verbannt. Wessen Name auf der schwarzen Liste steht, hat sozusagen Hausverbot, etwa bei Douyin, Chinas Version von Tiktok, aber auch allen anderen populären Anbietern.
Zu den Vorwürfen gegen die Livestreamer zählen Steuerhinterziehung, aber auch “unmoralisches Verhalten”, das nicht den “sozialistisches Kernwerten” entspreche. Die auf Douyin bekannt gewordene Influencerin Guo Laoshi landete offenbar unter anderem deshalb auf der Liste, weil sie vor laufender Kamera an ihren Füßen gerochen hatte. Bereits im September hatte Peking die Medienanstalten des Landes aufgefordert, männliche Stars aus dem Programm zu nehmen, deren Aussehen zu weiblich und “verweichlicht” sei (China.Table berichtete).
Online-Influencer sind als Verkäufer und Markenbotschafter in Chinas E-Commerce-Welt ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor geworden. Im vergangenen Jahr setzte Chinas “Social Commerce”-Sektor 242 Milliarden US-Dollar um, zehnmal so viel wie in den USA. Unter Social Commerce versteht man den Verkauf von Produkten über Social-Media-Plattformen und Live-Streaming-Events. fpe
Bytedance, die Muttergesellschaft der beliebten Social-Media-Plattform Tiktok, hat eine nicht ganz so geheime Geheimwaffe. Ihre leistungsstarken Algorithmen sind in der Lage, die Vorlieben der Nutzer genau vorherzusagen und ihnen Inhalte zu empfehlen, die sie tatsächlich sehen wollen. Das verlängert die Verweildauer an den Bildschirmen erheblich. Aber Bytedance muss auf den Einsatz dieser Waffe vielleicht bald verzichten – oder zumindest ihre Klinge stumpfen.
Die Betreiber von Internetplattformen in China sehen sich mit einer Reihe neuer Datenvorschriften konfrontiert, die die Nutzung von Empfehlungsalgorithmen einschränken könnten. Das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten, das Anfang November in Kraft getreten ist, schreibt den Plattformen vor, dass sie ihren Nutzern die Möglichkeit geben müssen, personalisierte Inhalte und gezielte Werbung abzulehnen.
Doch China könnte bald noch viel weitergehen. Die chinesische Internetaufsichtsbehörde, die Cyberspace Administration of China (CAC), hat vor kurzem einen neuen Richtlinienentwurf veröffentlicht, der eine Reihe von Beschränkungen für die Erhebung und Verarbeitung von Daten und deren grenzüberschreitende Übertragung vorsieht. Insbesondere müssen Apps die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer einholen, bevor sie Daten sammeln oder verwenden, um personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Mit anderen Worten: Der Einzelne muss sich für die Personalisierung entscheiden, anstatt dagegen, wie es derzeit der Fall ist.
Diese Politik könnte dazu beitragen, die Geschäftsmodelle von Online-Plattformen wie Douyin (die in China verwendete Version von Tiktok) und Taobao (eine Online-Einkaufsplattform der Alibaba-Gruppe) zu untergraben. Das kann wiederum weitreichende Auswirkungen auf künftige Innovationen im chinesischen Technologiesektor haben. Der Grund ist einfach: Wenn sie gefragt werden, entscheiden möglicherweise viele Nutzer, dass die personalisierten Empfehlungen es nicht wert sind, ihre Privatsphäre aufzugeben.
Nachfragen macht den Unterschied. Als Apple die Option, das Tracking durch Apps abzulehnen, in seinen komplizierten Datenschutzeinstellungen verbarg, nahmen sich nur 25 Prozent der Nutzer die Zeit, sie zu finden und abzulehnen. Als das Unternehmen jedoch anfing, iPhone-Nutzer aufzufordern, das Tracking abzulehnen, nahmen 84 Prozent diese Möglichkeit wahr.
Die neue Opt-out-Politik von Apple, die das Unternehmen im April letzten Jahres für sein iPhone iOS eingeführt hat, ist für US-Tech-Unternehmen wie Facebook, deren Geschäftsmodelle auf der Sammlung von Nutzerdaten und dem Verkauf gezielter Werbung beruhen, verheerend. Einer Schätzung zufolge kostet die Änderung der Apple-Politik Facebook, Snapchat, Twitter und Youtube in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zusammen fast zehn Milliarden US-Dollar an Einnahmen – oder zwölf Prozent ihrer Gesamteinnahmen. Online-Werber, die nun viel mehr bezahlen müssen, um potenzielle Kunden zu erreichen, geraten in Panik.
Dies ist ein bedrohliches Zeichen für Chinas Technologieunternehmen – nicht zuletzt, weil der Entwurf der CAC-Datenverordnung weit über die neue Regel von Apple hinausgeht. Während Apple verlangt, dass Apps eine Erlaubnis einholen, bevor sie die Daten eines Nutzers an Dritte weitergeben, würden die neuen chinesischen Maßnahmen verlangen, dass Apps das Einverständnis des Nutzers einholen, um die Daten selbst zu verwenden.
Die von China vorgeschlagene Zustimmungspflicht scheint auch strenger zu sein als die Allgemeine Datenschutzverordnung der Europäischen Union – derzeit eine der strengsten Datenschutzvorschriften der Welt. Während die DSGVO von den Plattformen verlangt, dass sie die Zustimmung der Nutzer einholen, bevor sie Daten sammeln und verarbeiten, ist für die Aktivierung von Empfehlungsdiensten keine spezifische Zustimmung erforderlich.
Chinesischen Plattformen werden sich mit ziemlicher Sicherheit bei der Regierung dafür werben, dass die Verordnung nicht umgesetzt wird. Sollte Peking sich weigern, auf sie zu hören, werden sie wahrscheinlich versuchen, die Vorschrift zu umgehen, indem sie die Funktionen ihrer Apps umgestalten, was allerdings Zeit in Anspruch nehmen und ernsthafte Risiken mit sich bringen wird.
Doch für die CAC sind die Schwierigkeiten privater Technologieunternehmen möglicherweise nicht von Belang. Es ist zwar unmöglich, genau zu sagen, was in die Kosten-Nutzen-Analyse der vorgeschlagenen Opt-in-Anforderung eingeflossen ist, aber es scheint klar zu sein, dass die Förderung des Unternehmenswachstums und der technologischen Innovation nicht zum Mandat der CAC gehört. Was aber will sie dann?
Als eine der interventionistischsten Regierungsstellen des Landes untersteht die CAC der Zentralen Kommission für Cyberspace-Angelegenheiten unter dem Vorsitz von Präsident Xi Jinping. Seit 2013 wurde ihre Kompetenz erheblich erweitert, unter anderem durch die Übernahme anderer Cybersicherheitsbehörden.
Im Juli sorgte die CAC für Schlagzeilen, als sie den Mitfahrdienstanbieter Didi Chuxing nur zwei Tage nach dessen Börsengang in New York mit einer Cybersicherheitsprüfung überraschte (China.Table berichtete). In der Folge ordnete die CAC Cybersecurity-Checks für alle datenintensiven Tech-Unternehmen an, die eine Notierung im Ausland planen, und etablierte sich damit als Gatekeeper für die Kapitalbeschaffung im Ausland.
Da Daten das Lebenselixier der Plattformökonomie sind, hat die CAC erheblichen Spielraum, um ihren bürokratischen Zuständigkeitsbereich zu erweitern. Und wenn der neue Verordnungsentwurf ein Hinweis darauf ist, plant sie, genau das zu tun. Sie will die Mauern um die “Gärten” der Internetplattformen einreißen und gegen andere unfaire Preisbildungspraktiken vorgehen. Algorithmen können beispielsweise bestimmen, welche Preise für bestimmte Produkte auf Online-Plattformen angezeigt werden. Je nach Nachfrage und User können sie kurzfristig in die Höhe schießen, was einer algorithmischen Preisdiskriminierung gleichkommt.
Ermutigt durch den Vorstoß der Regierung, die Tech-Giganten zu zügeln, hat die CAC große regulatorische Ambitionen. In den kommenden Jahren werden ihre Bemühungen, diese zu verwirklichen, eine wichtige Rolle dabei spielen, die Entwicklung von Plattformunternehmen – und technologischen Innovationen – in China zu bestimmen.
Angela Huyue Zhang, Juraprofessorin, ist Direktorin des Zentrums für chinesisches Recht an der Universität von Hongkong. Sie ist Autorin von Chinese Antitrust Exceptionalism: How the Rise of China Challenges Global Regulation. Aus dem Englischen von Eva Göllner.
Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org
Li Hongtao wird künftig die Investmentgesellschaft Stratos als Head of Greater China verstärken. Li kommt von Airbus, wo er zuletzt als Vertriebsdirektor China gearbeitet hat. Bei Stratos ist seine Expertise gefragt, weil sich das Unternehmen auf Investitionen in die Luftfahrt spezialisiert hat.

Himmlischer Härtetest: 48 geparkte LKW mit einem Gesamtgewicht von 1680 Tonnen loten die Tragkraft der Yangbaoshan-Brücke in der südwestchinesischen Provinz Guizhou aus. Die Täler überspannende, 650 Meter lange Verbindung ist die erste Brücke Chinas, die mit der sogenannten “Air-Spinning”-Methode errichtet wurde, bei der kleine Drähte zu riesigen Tragseilen zusammengesponnen werden.
technologische Standards haben heute noch nicht die politische Bedeutung, die sie in 20 Jahren haben werden. Einfach aus dem Grund, weil viele Zukunftstechnologien noch keine breite Marktreife erreicht haben. Europa muss aber darauf vorbereitet sein, dass die Volksrepublik China die Entwicklung von Standards in geopolitische Kraft ummünzen wird. Die Erfahrungen während der Corona-Pandemie dienen als Blaupause.
China hat in der Krise gelernt, wie es Verzögerungen und Knappheiten in den globalen Lieferketten politisch zu seinen Gunsten nutzen kann. Auch droht Peking Kritikern immer häufiger ganz unverblümt mit seiner Marktmacht. Sollte die Volksrepublik ihre Standards in Schlüsselindustrien eines Tages durchgesetzt haben, wird ihr politischer Druck auf andere Akteure massiv zunehmen – gerade auch auf Deutschland. Es wäre naiv, daran zu zweifeln.
Im Interview mit China.Table sagt Sibylle Gabler vom Deutschen Institut für Normung: “Chinas Aktivitäten haben hier zugenommen”. Meine Prognose wäre: Das ist erst der Anfang.
In der Praxis verankert die Volksrepublik heute schon das Grundgerüst ihrer Standards in weiten Teilen der Welt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten investieren chinesische Firmen als Akteure der neuen Seidenstraße in nahezu alle künftige Schlüsselindustrien. Wir haben uns die Entwicklung in Dubai vor Ort angeschaut.
Die Erkenntnis: Das globale Infrastruktur-Programm der Europäischen Union namens Global Gateway als Antwort auf die neue Seidenstraße kommt keinen Tag zu früh. Es wird höchste Zeit, dass Europa seine Präsenz dort erhöht, wo die Volksrepublik schon lange begonnen hat, sich auszubreiten.
Ein freundlicher Gruß


Standardisierung gilt eher als trockenes Thema. Warum sollte uns Normung denn überhaupt interessieren?
Dazu gibt es viele Antworten. Zunächst mal ist Standardisierung einfach ein wichtiges Mittel für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Es gilt nach wie vor der Satz: “Wer die Norm macht, hat den Markt”. Wenn Sie also Inhalte in eine Norm bringen können, die für Ihr Unternehmen von Vorteil sind, dann haben Sie es leichter, Ihre Produkte auf deutsche oder eben auch internationale Märkte zu bringen. Und es ist natürlich auch für die Volkswirtschaft als Ganzes wichtig. Denn die Normen sind eine gemeinsame Sprache und Grundlage. Rein nationale Normen können das Gegenteil bewirken. Sie können Märkte abschotten. Und Normen spielen natürlich auch eine Rolle in Sicherheitsthemen und Verbraucherschutz. Normen haben zum Beispiel den Arbeitsschutz im Bergbau verbessert und retten dadurch Menschenleben. Auch beim Thema Umweltschutz kann Standardisierung einen wichtigen Beitrag leisten.
Nun wird China als neue Weltmacht in der Standardisierung gesehen. Wie sehen Sie das? Ist es schon so weit?
Man muss sich die Frage stellen, wie definiert man Macht an dieser Stelle? Wenn wir schauen, wie intensiv China auf internationaler Ebene Positionen übernimmt, kann man jetzt nicht sagen, China wäre übermächtig. Die Volksrepublik kommt da ja letztlich von dem Stand eines Entwicklungslands und ist noch nicht an dem Punkt angelangt, der analog wäre zur jetzigen wirtschaftlichen Bedeutung. Aber sie gehen in Richtung Weltmacht mit großen Schritten und deswegen werden wir auch alle zunehmend aufmerksam, was das betrifft. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Präsidenten bei ISO aus China. Was die Übernahme von Sekretariaten anbetrifft, haben wir eine starke Steigerung von 106 Prozent. Sie sind also schwer im Kommen. Im Geschäft mit China nehmen natürlich auch chinesische Standards eine immer stärkere Bedeutung ein. Das ist für exportorientierte deutsche Unternehmen durchaus eine Herausforderung.
Müssen wir denn jetzt mehr chinesische Normen übernehmen?
Das kann man nicht so pauschal beantworten. Auf internationaler Ebene ist es ja nicht so, dass jemand aus einem Land kommt, eine Norm vorlegt und sagt “So, das ist meine Norm, macht jetzt mal eine internationale Norm daraus und schreibt ISO oder IEC drauf.” So funktioniert das nicht. Sondern man muss das mit den Experten der einzelnen Länder dann entsprechend verhandeln. Insofern ist an der Stelle eine zwingende Übernahme nicht gegeben oder möglich. Aber in dem Moment, in dem man mit China in Handelsbeziehungen tritt, sieht das unter Umständen anders aus. Unternehmen, die starke Geschäftsbeziehungen haben, müssen natürlich schauen, welche Normen in China für ihr Geschäft eine Rolle spielen.
Wie unterscheiden sich die Standardisierungsphilosophien in EU, China und USA?
In den USA gibt es nicht die eine Organisation, wie für Deutschland DIN oder ähnliche nationale Organisationen in den einzelnen Ländern Europas. Sondern es gibt hunderte von Standardisierungs-Organisationen, die zum Beispiel bei Verbänden sind. Dort ist es die Philosophie, dass sich der beste Standard schon durchsetzen wird. Europa und die USA haben eines gemeinsam: den Bottom-up-Ansatz. Die Wirtschaft sagt: “Okay, wir brauchen da jetzt eine Norm und dann machen wir eine.” In Europa haben wir noch die zusätzliche Komponente, dass auch die Europäische Kommission ein Auftraggeber für Normen sein kann und ein wichtiger Mitinitiator ist. Wir erwarten derzeit übrigens die Standardisierungs-Strategie der EU, die bald veröffentlicht werden soll.
Und in China?
Das chinesische System ist seit seiner Reform zweigeteilt, sozusagen in einen mehr staatsgelenkten Teil und einen mehr marktgetriebenen Teil. In diesem marktgetriebenen Teil sind das Wichtigste die Association-Standards, das erinnert am ehesten an das US-amerikanische Modell, wo Normen von einer Vielzahl von Organisationen erarbeitet werden. Diese Normen schnellen zahlenmäßig massiv in die Höhe, da kommen immer mehr. Dann gibt es noch den von der Regierung gelenkten Teil, aus dem nationale Normen entstehen. Einige davon sind verbindlich anzuwenden und daher am ehesten mit unserer technischen Regulierung vergleichbar. Insgesamt ist das chinesische System im Vergleich zu USA und Europa deutlich stärker staatlich gelenkt.
Peking hat vor einigen Wochen seine “Chinese Standards 2035” vorgestellt. Ist das jetzt der große Schlag von China, sich in Sachen Standardisierung einen Vorteil zu verschaffen?
Ich habe eher den Eindruck gewonnen, dass man sich damit so ein bisschen alle Möglichkeiten offen lässt. Es ist weder Abschottung, noch ein komplettes Commitment zur internationalen Normung. Es ist irgendwie ein bisschen beides. Ich denke aber, dass es generell positiv zu bewerten ist, dass es eine Berücksichtigung der internationalen Normung gibt. Man möchte sich weiterhin intensiv international einbringen. Vorgesehen ist auch, dass China 85 Prozent der internationalen Normen national übernehmen will. Das ist letztlich das Entscheidende. China kann natürlich überall mitarbeiten. Wichtig ist, dass die Normen anschließend auch verwendet werden. Ob internationale Normen dann auch wirklich unverändert übernommen werden, bleibt abzuwarten.
Wie bringt sich China denn in den internationalen Organisationen ein? Sie hatten ja bereits über die technischen Komitees oder Sekretariate gesprochen. Könnten Sie uns kurz erklären, warum diese so wichtig sind?
Die eigentliche fachliche Arbeit muss organisatorisch strukturiert werden und da kommen die Technischen Komitees ins Spiel. Das sind bei ISO über 300, wie zum Beispiel Informationstechnologie, Lebensmittel oder Qualitätsmanagement. Es gibt größere und kleinere Komitees und diese sind dann nochmal weiter aufgeteilt, zum Beispiel zur Erarbeitung von Test-Methoden, Sicherheits- oder Qualitätsaspekten. Und dort gibt es nochmal verschiedene Arbeitsgruppen. Im Sekretariat und in der Führung der Technischen Komitees hat man Gestaltungsmöglichkeiten, kann Dinge vorantreiben oder auch nicht. Deutschland war und ist dabei immer ganz gut aufgestellt. Doch nun kommt eben eine aufstrebende Volkswirtschaft wie China und übernimmt in zunehmendem Maße Sekretariate.
Was bedeutet das?
Deutschland ist in manchen Bereichen wie dem Maschinenbau sehr stark in der Normung. Gerade bei digitalen Themen sind wir aber nicht besonders gut aufgestellt. Darin sind die USA sehr stark und eben auch China. Bei Themen wie Seltene Erden, Plastik, Lithium ist China in Führung gegangen. Und damit sind wir natürlich bei Bereichen, die geopolitisch wichtig sind.
Setzt China Normung denn als geopolitisches Mittel ein?
Bei Themen wie den Seltenen Erden oder Lithium geht es auch um Recycling und um Umweltschutz. Wenn Sie da sozusagen bereits Duftmarken gesetzt haben, wie es China hat, dann sind Sie eine Nasenlänge voraus, was die Inhalte betrifft. Hier greift der alte Spruch: Wer schreibt, der bleibt. Wenn Sie Normen initiieren und dann nicht mit einem weißen Blatt Papier kommen, sondern schon etwas aufgeschrieben haben, dann haben Sie bereits gewisse Fakten geschaffen. Und auch das Thema zu setzen, ist natürlich schon politisch. Chinas Aktivitäten haben hier zugenommen. Das betrifft auch andere für China wichtige Themen wie etwa den Schienenverkehr.
Schienenverkehr ist ein gutes Stichwort, wenn es um den Green Deal geht. Wie sieht es aus bei der Standardisierung im Bereich Nachhaltigkeit? Was kommt da auf uns zu?
Das wird natürlich spannend, da wir derzeit zwei großen Umbauten in der Industrie weltweit, aber auch in Europa sehen: Der digitale und der grüne Umbau der Wirtschaft. Durch den Vertrag der Ampel-Koalition bekommt das in Deutschland weiter Momentum. Diese Vorhaben können aber nur gelingen, wenn die entsprechenden Normen mitgedacht und erarbeitet werden. Hier geht es darum, dass Deutschland und Europa Inhalte mitbestimmen und mitgestalten. Es geht um die Gestaltung von Lösungen und von Anforderungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das sind die großen Themen, die anstehen.
Wie können Deutschland und Europa auf die Trendsetzung vonseiten Chinas antworten?
Die für alle Seite beste Lösung ist es, wenn wir gemeinsam bei der internationalen Normung zusammenkommen. Denn nur dann haben wir auch alle Chancen, weiterhin eine wichtige Rolle zu spielen. Es geht nicht darum, China als Gegner zu sehen, sondern uns international zu treffen und chinesische Teilnahme und Führung auch mal willkommen zu heißen. Wenn es damit einen verschärften Wettbewerb gibt, müssen wir diesen seitens Europas und Deutschlands annehmen. Wir müssen in Europa für uns Schlüsseltechnologien identifizieren, in denen wir dann rechtzeitig selbst Themen setzen und Führung übernehmen müssen. Wenn es zum Beispiel heißt, die deutsche Industrie muss grüner werden, dann müssen wir auch schauen, dass wir die entsprechenden Normen international sehr aktiv mitbestimmen. Da ist Deutschland noch nicht im Lead. Wir müssen auch viel schneller Ergebnisse der europäischen Forschung in die internationale Normung bringen.
Denken Sie, China hat einen Vorteil, da dort Dinge einfach durchgepresst werden können?
In gewisser Hinsicht schon. Da kommen wir wieder auf die verschiedenen Normungsphilosophien. Wenn in China die Partei sagt “Jetzt machen wir es so”, dann wird es so gemacht. In einer Demokratie geht das natürlich nicht, wir haben andere Prozesse. Ich glaube, wir müssen in Zukunft Lösungen für die neuen Herausforderungen finden, die durch stärker staatsgetriebene Nationen in die Normung kommen. Unser industriegetriebener Ansatz bleibt die Grundlage. Das ist einfach unsere Tradition und unsere Herangehensweise. Aber wir müssen im Sinne der strategischen Autonomie und digitalen Souveränität in Europa auch prüfen, was getan werden muss, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaft als Ganzes zu sichern. Es gibt diese Tradition in Deutschland und im Wesentlichen auch in Europa, die heißt, die Politik hat sich eigentlich aus der Normung rauszuhalten. Aber die Zeiten ändern sich jetzt durch solche Player wie China. Beim Thema Lithium war die EU-Kommission beispielsweise alarmiert und hat gesehen, dass das ein strategisches Thema für die Elektromobilität in den nächsten Jahren wird.
Haben wir denn in Deutschland und in Europa genügend Experten, die sich damit auskennen? Und investieren wir genug Geld in die Entwicklung von Normen?
Das ist tatsächlich das größte Problem. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, es geht nur um Geld. Klar, Geld ist immer ein Thema, aber ich glaube, die größte Herausforderung sind die Expertinnen und Experten. Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Normung bemerkbar. Wir beklagen schon seit vielen Jahren, dass es zu wenig Experten gibt. An dieser Stelle müssen wir in Deutschland viel mehr in der Ausbildung machen und beispielsweise mehr Anreize für Wissenschaftler haben, in der Standardisierung mitzuarbeiten. Ein Ansatz könnte auch die vermehrte Teilnahme von Behördenvertretern sein.
Welche Möglichkeiten gibt es denn dann zur Zusammenarbeit mit China?
Eine Kooperation gibt es ja schon länger mit der Deutsch-Chinesischen Kommission für Normung. Dort wird auf strategischer Ebene gesprochen, aber auch ganz konkret zu bestimmten Themen wie beispielsweise Elektromobilität, Industrie 4.0 oder autonomes Fahren. Da treffen sich dann bilateral technische Experten aus China und Deutschland und lernen voneinander. Es gibt aber auch Beispiele, wo die Zusammenarbeit nicht gut funktioniert. Beispielsweise, wenn das Thema zentrale Datensammlung ins Spiel kommt. Unternehmen kritisieren, dass China hier in Gremien Dinge festlegen will, die nicht vereinbar wären mit unserer Herangehensweise an Daten, sprich der Datenschutzgrundverordnung.
Sibylle Gabler ist seit 2014 Leiterin für Regierungsbeziehungen bei DIN. Als Sachverständige für Normung berät sie unter anderem den Deutschen Bundestag.

Die Autofahrt über die sechs- und streckenweise auch acht- und zehnspurige Sheikh Zayed Road in Dubai bietet einen faszinierenden Einblick in die Geburt einer Stadt aus der Retorte. Bei Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h bleibt ausreichend Zeit, die klotzigen Fassaden der Wolkenkratzer links und rechts zu bestaunen. Bauwerke der Marke Weltstadt sprudeln wie Öl aus dem Wüstensand.
Es gibt hier überdeutliche Parallelen zu China. Sie sind kein Zufall. Die sieben Staaten der Vereinigten Arabischen Emirate wollen heute ebenfalls Maßstäbe setzen in Sachen Infrastruktur und Modernität, nachdem sie im vergangenen Jahrhundert noch als rückständig galten. Heute ist hier wie dort Geld im Überfluss vorhanden. Vor allem Dubai und Abu Dhabi schöpfen mit ihren Bauprojekten nun aus dem Vollen. China ist Vorbild, Partner und Finanzier. Diese neue Dimension der Partnerschaft bindet die Emirate zugleich immer enger in die Neue Seidenstraße ein.
Die Volksrepublik liefert damit wichtige Bestandteile für die imposante Erscheinung eines neuen Schmelztiegels der Kulturen auf der arabischen Halbinsel. Dass chinesische Unternehmen neue extravagante Hochhäuser bauen, ist dabei nur das oberflächliche Zeichen für eine tiefgehende Entwicklung. Chinas Firmen liefern auch das digitale Gerüst für Smart-City-Konzepte und Verkehrssysteme. Sie stellen die Ausrüstung für Glasfasernetzwerke und bieten technische Komponenten zur Videoüberwachung aller Winkel der Emirate. Sie flankieren den Bau eines riesigen Solarparks mit der Konstruktion eines Kohlekraftwerkes, automatisieren die Logistik der wohlhabenden Konsumgesellschaft und siedeln sich in Form von Start-ups und Techfirmen zu Tausenden entlang der Küste zwischen Dubai und Abu Dhabi an.
Die Emirate sind längst größter Empfänger von chinesischen Direktinvestitionen in der Region. Der bilaterale Handel kletterte vor der Corona-Krise auf über 50 Milliarden US-Dollar. Wer bislang keine Vorstellung hatte, mit welcher Intensität und Entschlossenheit Peking an der Konstruktion seiner Neuen Seidenstraße arbeitet, bekommt in der sogenannten MENA-Region (Middle East and Northern Africa) eine eindrucksvolle Vorstellung davon. Nicht nur in den Emiraten sind zunehmend chinesische Interessen vertreten, auch in Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien oder Ägypten nimmt das Engagement aus der Volksrepublik zu.
Im Zentrum steht dabei neben dem Bausektor vor allem der Transfer neuer Daten- und Telekommunikations-Technologien. Das geschieht schnell und nahezu geräuschlos. Hier entsteht eine Mischung, die ganz im Sinne des großen Geberlands China sein dürfte. Die Emirate profitieren wirtschaftlich, aber es gibt keine Opposition und keine kritische Debatte aus der Zivilgesellschaft. Die engen Beziehungen zu einem zunehmend totalitär agierenden Regime werden so nicht infrage gestellt. Auch die weitreichende Anwendung chinesischer Überwachungstechnik stößt nicht auf Grenzen. Zugleich darf China hier die eigenen Standards exportieren.
China sieht sich hierbei zugleich auch als klug kalkulierender Investor – eine Haltung, die durch den geschäftlichen Erfolg gerechtfertigt ist. “Insbesondere in den letzten Jahren hat sich das Geschäftsumfeld der arabischen Länder verbessert, und die Regierungen haben große Anstrengungen unternommen, um chinesische Investoren anzuziehen”, erklärt Luo Lin vom International and Regional Studies Institute in Peking.
Die Strategie, den Gastgebern chinesische Investitionen schmackhaft zu machen, funktioniert nach dem gleichen universellen Prinzip, das auch in anderen Weltregionen fruchtet. “Die Belt-and-Road-Initiative zwischen China und den arabischen Staaten ist ein Weg zum Aufbau von Frieden, Wohlstand, Öffnung, Innovation und Zivilisation zwischen China und der arabischen Welt”, urteilt Luo. Als Gegenleistung erwarte Peking nur, dass sich die Araber innerhalb international festgelegten Rahmenbedingungen bewegen: “Dafür unterstützen arabische Länder die Regeln des multilateralen Handels im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO, um das Ziel der Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung aller Nationen der Welt zu erreichen.”
Chinas Aufruf zum Multilateralismus unter den Regeln der Welthandelsorganisation beinhaltet stets auch einen Seitenhieb in Richtung der Vereinigten Staaten. Die Botschaft zwischen den Zeilen: Während Washington chinesische Unternehmen vom eigenen Markt verbannt, plädiert China für eine globale Zusammenarbeit zum Wohle aller Nationen der Welt. In den Ländern der MENA-Region gibt es wenig Einwände gegen die chinesische Interpretation der geostrategischen Großwetterlage.
Das Resultat sind etliche Großprojekte auch in den Emiraten, die an chinesische Firmen gehen oder von China finanziert werden. Die Entwicklung der staatlichen Eisenbahngesellschaft Etihad Rail mit einem Volumen von rund zwei Milliarden US-Dollar übernehmen zu großen Teilen Baufirmen aus der Volksrepublik. Den Bau des Kohlekraftwerkes Hassyan für etwa 3,4 Milliarden Dollar stemmen die Scheichs zu großen Teilen mit Krediten chinesischer Banken.
China Petroleum Pipeline Engineering gewann die Ausschreibung für den Entwurf und die Bauvorbereitungen für eine Gaspipeline. Der Ausbau und der Betrieb eines zweiten Containerterminals im Hafen von Abu Dhabi ist in einem Gemeinschaftsunternehmen des lokalen Betreibers und der chinesischen Cosco Shipping Ports für insgesamt 35 Jahre festgeschrieben.
Andere Verträge haben sogar noch eine längere Laufzeit. Der Pachtvertrag für ein Industriegebiet in der Freihandelszone durch die Jiangsu Provincial Overseas Cooperation & Investment Company läuft über 50 Jahre. Unternehmen aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu haben Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen Dollar angekündigt. Chinesisches Geld fließt auch in den Aufbau eines Großmarkts in der Freihandelszone. Dazu kommen Projekte wie die Entwicklung von Industrieflächen oder der Bau einer Anlage zur Herstellung des Industriegases Methanol.
Zwar verdienen auch europäische Firmen an der Entwicklung der Emirate. Beispielsweise liefert Siemens Turbinen für den Eisenbahnbau, und die französische Logistik- und Schifffahrtsgesellschaft CMA CGM betreibt für mehrere Jahrzehnte gemeinsam mit einem lokalen Partner einen weiteren Containerterminal. Doch flächendeckende Investitionen, die alle Kernbereiche von Industrie und Handel abdecken, stammen ausschließlich aus China.
Auch deutsche Beobachter vor Ort registrieren die Hinwendung zu China. “Die wirtschaftlichen Interessen der Volksrepublik werden auch auf der Expo deutlich”, sagt Dietmar Schmitz. Er ist Generaldirektor des deutschen Pavillons bei der Expo2020 in Dubai, die wegen der Corona-Pandemie erst im Oktober dieses Jahres ihre Pforten geöffnet hat. “Chinas Ansatz ist hier viel stärker auf die Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen fokussiert als beispielsweise der deutsche.” Auch die Deutschen wollten mit ihrem Auftritt ihre Unternehmen in der Region fördern. Doch während die Bundesrepublik versucht, über die spielerische Vorstellung ihrer Innovationen der Welt Lust zu machen auf Nachhaltigkeit “Made in Germany”, wirbt China unmittelbar mit Angeboten seiner Unternehmen (China.Table berichtete).
Um dem Wettbewerb und der BRI-Strategie aus China etwas entgegenzusetzen, greift nun aber auch die Europäische Union tief in die Tasche. 300 Milliarden Euro will die EU bereitstellen, um ihrer Gegenkampagne Global Gateway Leben einzuhauchen (China.Table berichtete). Am Mittwoch sollen Einzelheiten des Plans in Brüssel vorgestellt werden. Die Emirate stehen als Sinnbild dafür, dass es höchste Zeit für die Europäer wird, wenn sie chinesischen Interessen in der MENA- und anderen Region der Welt ernsthaft Paroli bieten wollen.
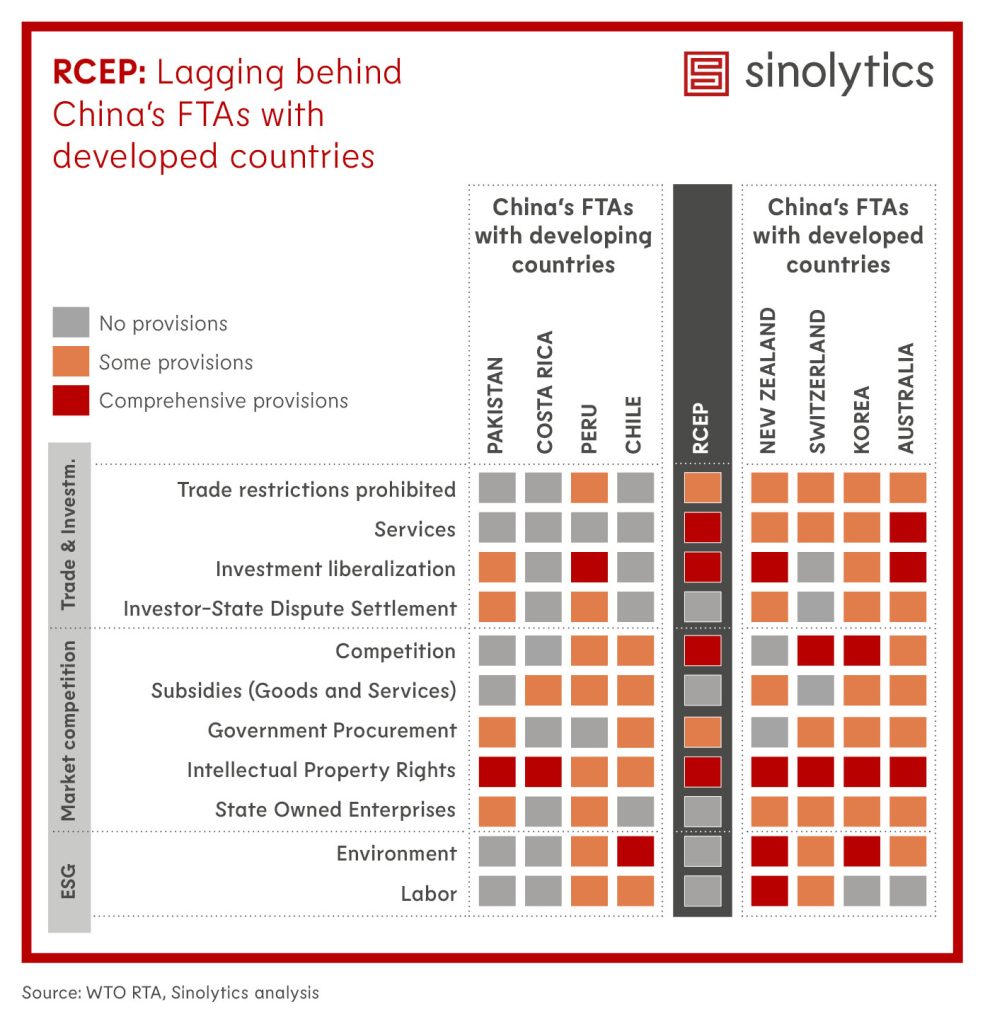
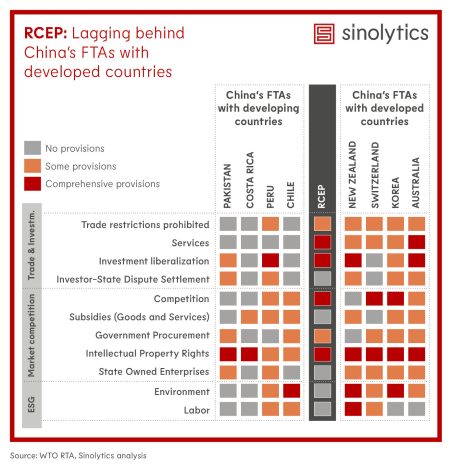
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.
Die zentralchinesische Provinz Henan will Journalisten und ausländische Studenten unter engmaschige Überwachung stellen. Das geht aus Dokumenten hervor, die von der Nachrichtenagentur Reuters analysiert worden sind. Demnach sollen die Bewegungsprofile von Mitgliedern der beiden Gruppen neben anderen “verdächtigen Personen” in Henan künftig präzise nachvollzogen werden.
Eine entsprechende Ausschreibung auf der Internetseite der Provinzregierung von Ende Juli gibt Aufschluss über die Absicht der Behörden, die Betroffenen mithilfe von Technologien zur Gesichtserkennung identifizieren zu wollen. Die Firma Neusoft aus Shenyang liefert die nötige Software, die die Bilder mit relevanten Datenbanken der Sicherheitsbehörden verknüpft und Alarm schlägt, wenn eine verdächtige Person beispielsweise in ein Hotel eincheckt. Laut Reuters kommt ein derartiges System erstmals in der Volksrepublik zum Einsatz.
Journalisten werden demnach in die Kategorien Rot, Gelb und Grün eingeteilt – um die Dringlichkeit der Nachverfolgung zu kennzeichnen. 2.000 Polizisten sollen mit der Überwachung des Systems betraut werden. Die Software integriert 3.000 Kameras, deren Bilder mit den Daten abgeglichen werden können. Die Gesichtserkennung muss laut Ausschreibung auch dann genau sein, wenn beobachtete Personen Gesichtsmasken oder Brillen tragen.
Der Generalverdacht gegen Journalisten und internationale Studenten ist ein weiterer Schritt Chinas in Richtung eines totalitären Überwachungsstaats. Mit einer stetig wachsenden Zahl von Kameras im öffentlichen Raum samt Gesichtserkennung sowie mit der Nutzung von Handy-Ortung wollen die Behörden vermeintliche Gefahren für die nationale Sicherheit frühzeitig erkennen. Während Journalisten wegen ihrer Arbeit grundsätzlich als Gefahrenquelle gelten, brandmarkt die Provinz Henan nun auch alle Studenten aus dem Ausland als mögliche Spione. grz
Mit dem Ausbau einer Reihe von Stützpunkten im Indopazifik wollen sich die USA besser auf potentielle Einsätze gegen Russland und China vorbereiten (China.Table berichtete). Wie das US-Verteidigungsministerium am Montag mitteilte, sollen militärische Einrichtungen auf der Pazifikinsel Guam und in Australien erweitert werden. Dazu gehören vor allem Militärflughäfen und Munitionslager. Zudem will das Pentagon in Australien im Rotationsprinzip neue Kampfflugzeuge und Bomber stationieren und Bodentruppen ausbilden.
Der Ausbau diene unter anderem dem Zweck, “potentielle militärische Angriffe Chinas und Bedrohungen durch Nordkorea abzuwehren”, erklärt Mara Karlin, die für strategische Fragen zuständige Abteilungsleiterin im Pentagon. Mit den erweiterten Anlagen könne Washington schneller und umfassender Truppen in die Region verlegen. Daneben soll die verstärkte US-Präsenz auch dazu beitragen, die Abschreckung gegenüber Russland zu stärken und es den Nato-Streitkräften zu ermöglichen, “effektiver vorzugehen”.
China reagierte mit scharfen Worten auf die Ankündigung. Außenamtssprecher Zhao Lijian erklärte am Dienstag, Washington schaffe, “einen imaginären Feind” und scheue keine Mühe, “um China zu umzingeln und einzugrenzen”. Die chinesische Marine hat in den vergangenen Jahren ihren Einsatzbereich im Indopazifik kontinuierlich ausgeweitet. Vor allem auch die wachsende chinesische Präsenz im Südchinesischen Meer betrachten die USA als Bedrohung ihrer bisher einzigartigen maritimen Machtposition in der Region (China.Table berichtete). fpe
Die Europäische Union macht Fortschritte in neuen Vorgaben für den europäischen Markt, die auch China dazu bewegen sollen, sich im Bereich der öffentlichen Beschaffung zu öffnen. Der Entwurf des sogenannten “International Procurement Instrument” (IPI) wurde am Dienstag im Ausschuss für internationalen Handel des Europaparlaments angenommen. Die Abgeordneten stimmten damit zwei Arten von IPI-Maßnahmen zu, aus denen die EU-Kommission wählen kann, um ungleichen Zugang zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten zu beheben. Die erste Maßnahme ist der von den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagene Preisanpassungsmechanismus. Die zweite mögliche Maßnahme besteht darin, ein Unternehmen ganz von Ausschreibungen auszuschließen.
Darüber hinaus hat der Ausschuss die Zahl der Ausnahmen auf zwei reduziert, bei denen öffentliche Auftraggeber die IPI-Maßnahmen ablehnen können:
Als Beispiele sind die Bereiche der öffentlichen Gesundheit oder des Umweltschutzes genannt. Unternehmen aus Entwicklungsländern sollen von den IPI-Vorgaben ausgenommen werden, heißt es in dem Entwurf. Für die öffentlichen Ausschreibungen sollen verschiedene Schwellenwerte greifen: bei Bau-Ausschreibungen ab zehn Millionen Euro, bei Waren und Dienstleistungen ab fünf Millionen Euro.
Über die Vorlage soll im Januar im Plenum des EU-Parlaments abgestimmt werden. Unstimmigkeiten zwischen dem Europaparlament und dem EU-Rat gebe es noch zur Umsetzungshoheit, erklärte der CDU-Europapolitiker Daniel Caspary, der federführend für die Ausarbeitung der Position des EU-Parlaments zu IPI ist. Der EU-Rat wolle die Entscheidungsmacht in den Mitgliedsstaaten ansiedeln, das EU-Parlament sieht sie bei der EU-Kommission.
Bei IPI handele es nicht um eine Verordnung “gegen China”, betonte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Die Volksrepublik sei bei diesem Thema jedoch der Elefant im Raum. China habe sich nicht an sein Versprechen zur Öffnung des Beschaffungsmarktes gehalten, so Bütikofer. Die neuen Vorgaben müssten nun ohne Schlupflöcher umgesetzt werden. ari
Die Europäische Union hat die chinesischen Behörden aufgefordert, “eine umfassende, faire und transparente Untersuchung” der Vorwürfe der Tennisspielerin Peng Shuai wegen sexueller Übergriffe durch den ehemaligen Vizepremier Zhang Gaoli durchzuführen. In einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme forderte Brüssel die chinesische Regierung zudem auf, “überprüfbare Nachweise über die Sicherheit, das Wohlergehen und den Aufenthaltsort von Peng Shuai vorzulegen”.
China müsse seinen Menschenrechtsverpflichtungen nach nationalem und internationalem Recht nachkommen. Das öffentliche Auftreten der Tennisspielerin habe nicht die Sorgen über ihre Sicherheit und Freiheit ausgeräumt.
Peng war vor gut einer Woche in einem Video-Telefonat mit IOC-Präsident Thomas Bach zu sehen gewesen (China.Table berichtete). Die Sportlerin betonte in dem Gespräch, dass sie wohlauf in ihrem Haus in Peking lebe. Menschenrechtler wie der chinesische Anwalt Teng Biao gehen davon aus, dass Peng zwar nicht körperlich verletzt, aber unter hohen psychischen Druck gesetzt werde (China.Table berichtete). ari
Die China Association of Performing Arts (CAPA) hat weitere 85 Internet-Livestreamer auf eine schwarze Liste gesetzt. Sogenannte “Key Opinion Leader” wie Tie Shankao (铁山靠) oder Guo Laoshi (郭老师) hätten einen schlechten Einfluss auf die Gesellschaft und vor allem auf die Jugend ausgeübt, schreibt die Kulturbehörde in einer offiziellen Mitteilung.
Seit der Einführung des “Blacklist Management-Systems” im Jahr 2018 wurden damit bereits 446 Livestreamer von großen Streamingplattformen des Landes verbannt. Wessen Name auf der schwarzen Liste steht, hat sozusagen Hausverbot, etwa bei Douyin, Chinas Version von Tiktok, aber auch allen anderen populären Anbietern.
Zu den Vorwürfen gegen die Livestreamer zählen Steuerhinterziehung, aber auch “unmoralisches Verhalten”, das nicht den “sozialistisches Kernwerten” entspreche. Die auf Douyin bekannt gewordene Influencerin Guo Laoshi landete offenbar unter anderem deshalb auf der Liste, weil sie vor laufender Kamera an ihren Füßen gerochen hatte. Bereits im September hatte Peking die Medienanstalten des Landes aufgefordert, männliche Stars aus dem Programm zu nehmen, deren Aussehen zu weiblich und “verweichlicht” sei (China.Table berichtete).
Online-Influencer sind als Verkäufer und Markenbotschafter in Chinas E-Commerce-Welt ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor geworden. Im vergangenen Jahr setzte Chinas “Social Commerce”-Sektor 242 Milliarden US-Dollar um, zehnmal so viel wie in den USA. Unter Social Commerce versteht man den Verkauf von Produkten über Social-Media-Plattformen und Live-Streaming-Events. fpe
Bytedance, die Muttergesellschaft der beliebten Social-Media-Plattform Tiktok, hat eine nicht ganz so geheime Geheimwaffe. Ihre leistungsstarken Algorithmen sind in der Lage, die Vorlieben der Nutzer genau vorherzusagen und ihnen Inhalte zu empfehlen, die sie tatsächlich sehen wollen. Das verlängert die Verweildauer an den Bildschirmen erheblich. Aber Bytedance muss auf den Einsatz dieser Waffe vielleicht bald verzichten – oder zumindest ihre Klinge stumpfen.
Die Betreiber von Internetplattformen in China sehen sich mit einer Reihe neuer Datenvorschriften konfrontiert, die die Nutzung von Empfehlungsalgorithmen einschränken könnten. Das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten, das Anfang November in Kraft getreten ist, schreibt den Plattformen vor, dass sie ihren Nutzern die Möglichkeit geben müssen, personalisierte Inhalte und gezielte Werbung abzulehnen.
Doch China könnte bald noch viel weitergehen. Die chinesische Internetaufsichtsbehörde, die Cyberspace Administration of China (CAC), hat vor kurzem einen neuen Richtlinienentwurf veröffentlicht, der eine Reihe von Beschränkungen für die Erhebung und Verarbeitung von Daten und deren grenzüberschreitende Übertragung vorsieht. Insbesondere müssen Apps die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer einholen, bevor sie Daten sammeln oder verwenden, um personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Mit anderen Worten: Der Einzelne muss sich für die Personalisierung entscheiden, anstatt dagegen, wie es derzeit der Fall ist.
Diese Politik könnte dazu beitragen, die Geschäftsmodelle von Online-Plattformen wie Douyin (die in China verwendete Version von Tiktok) und Taobao (eine Online-Einkaufsplattform der Alibaba-Gruppe) zu untergraben. Das kann wiederum weitreichende Auswirkungen auf künftige Innovationen im chinesischen Technologiesektor haben. Der Grund ist einfach: Wenn sie gefragt werden, entscheiden möglicherweise viele Nutzer, dass die personalisierten Empfehlungen es nicht wert sind, ihre Privatsphäre aufzugeben.
Nachfragen macht den Unterschied. Als Apple die Option, das Tracking durch Apps abzulehnen, in seinen komplizierten Datenschutzeinstellungen verbarg, nahmen sich nur 25 Prozent der Nutzer die Zeit, sie zu finden und abzulehnen. Als das Unternehmen jedoch anfing, iPhone-Nutzer aufzufordern, das Tracking abzulehnen, nahmen 84 Prozent diese Möglichkeit wahr.
Die neue Opt-out-Politik von Apple, die das Unternehmen im April letzten Jahres für sein iPhone iOS eingeführt hat, ist für US-Tech-Unternehmen wie Facebook, deren Geschäftsmodelle auf der Sammlung von Nutzerdaten und dem Verkauf gezielter Werbung beruhen, verheerend. Einer Schätzung zufolge kostet die Änderung der Apple-Politik Facebook, Snapchat, Twitter und Youtube in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zusammen fast zehn Milliarden US-Dollar an Einnahmen – oder zwölf Prozent ihrer Gesamteinnahmen. Online-Werber, die nun viel mehr bezahlen müssen, um potenzielle Kunden zu erreichen, geraten in Panik.
Dies ist ein bedrohliches Zeichen für Chinas Technologieunternehmen – nicht zuletzt, weil der Entwurf der CAC-Datenverordnung weit über die neue Regel von Apple hinausgeht. Während Apple verlangt, dass Apps eine Erlaubnis einholen, bevor sie die Daten eines Nutzers an Dritte weitergeben, würden die neuen chinesischen Maßnahmen verlangen, dass Apps das Einverständnis des Nutzers einholen, um die Daten selbst zu verwenden.
Die von China vorgeschlagene Zustimmungspflicht scheint auch strenger zu sein als die Allgemeine Datenschutzverordnung der Europäischen Union – derzeit eine der strengsten Datenschutzvorschriften der Welt. Während die DSGVO von den Plattformen verlangt, dass sie die Zustimmung der Nutzer einholen, bevor sie Daten sammeln und verarbeiten, ist für die Aktivierung von Empfehlungsdiensten keine spezifische Zustimmung erforderlich.
Chinesischen Plattformen werden sich mit ziemlicher Sicherheit bei der Regierung dafür werben, dass die Verordnung nicht umgesetzt wird. Sollte Peking sich weigern, auf sie zu hören, werden sie wahrscheinlich versuchen, die Vorschrift zu umgehen, indem sie die Funktionen ihrer Apps umgestalten, was allerdings Zeit in Anspruch nehmen und ernsthafte Risiken mit sich bringen wird.
Doch für die CAC sind die Schwierigkeiten privater Technologieunternehmen möglicherweise nicht von Belang. Es ist zwar unmöglich, genau zu sagen, was in die Kosten-Nutzen-Analyse der vorgeschlagenen Opt-in-Anforderung eingeflossen ist, aber es scheint klar zu sein, dass die Förderung des Unternehmenswachstums und der technologischen Innovation nicht zum Mandat der CAC gehört. Was aber will sie dann?
Als eine der interventionistischsten Regierungsstellen des Landes untersteht die CAC der Zentralen Kommission für Cyberspace-Angelegenheiten unter dem Vorsitz von Präsident Xi Jinping. Seit 2013 wurde ihre Kompetenz erheblich erweitert, unter anderem durch die Übernahme anderer Cybersicherheitsbehörden.
Im Juli sorgte die CAC für Schlagzeilen, als sie den Mitfahrdienstanbieter Didi Chuxing nur zwei Tage nach dessen Börsengang in New York mit einer Cybersicherheitsprüfung überraschte (China.Table berichtete). In der Folge ordnete die CAC Cybersecurity-Checks für alle datenintensiven Tech-Unternehmen an, die eine Notierung im Ausland planen, und etablierte sich damit als Gatekeeper für die Kapitalbeschaffung im Ausland.
Da Daten das Lebenselixier der Plattformökonomie sind, hat die CAC erheblichen Spielraum, um ihren bürokratischen Zuständigkeitsbereich zu erweitern. Und wenn der neue Verordnungsentwurf ein Hinweis darauf ist, plant sie, genau das zu tun. Sie will die Mauern um die “Gärten” der Internetplattformen einreißen und gegen andere unfaire Preisbildungspraktiken vorgehen. Algorithmen können beispielsweise bestimmen, welche Preise für bestimmte Produkte auf Online-Plattformen angezeigt werden. Je nach Nachfrage und User können sie kurzfristig in die Höhe schießen, was einer algorithmischen Preisdiskriminierung gleichkommt.
Ermutigt durch den Vorstoß der Regierung, die Tech-Giganten zu zügeln, hat die CAC große regulatorische Ambitionen. In den kommenden Jahren werden ihre Bemühungen, diese zu verwirklichen, eine wichtige Rolle dabei spielen, die Entwicklung von Plattformunternehmen – und technologischen Innovationen – in China zu bestimmen.
Angela Huyue Zhang, Juraprofessorin, ist Direktorin des Zentrums für chinesisches Recht an der Universität von Hongkong. Sie ist Autorin von Chinese Antitrust Exceptionalism: How the Rise of China Challenges Global Regulation. Aus dem Englischen von Eva Göllner.
Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org
Li Hongtao wird künftig die Investmentgesellschaft Stratos als Head of Greater China verstärken. Li kommt von Airbus, wo er zuletzt als Vertriebsdirektor China gearbeitet hat. Bei Stratos ist seine Expertise gefragt, weil sich das Unternehmen auf Investitionen in die Luftfahrt spezialisiert hat.

Himmlischer Härtetest: 48 geparkte LKW mit einem Gesamtgewicht von 1680 Tonnen loten die Tragkraft der Yangbaoshan-Brücke in der südwestchinesischen Provinz Guizhou aus. Die Täler überspannende, 650 Meter lange Verbindung ist die erste Brücke Chinas, die mit der sogenannten “Air-Spinning”-Methode errichtet wurde, bei der kleine Drähte zu riesigen Tragseilen zusammengesponnen werden.
