geradezu routiniert präsentierten KMK und BMBF die IGLU-Daten gestern. Das desaströse Zeugnis für die Schulpolitik bewegt die Bildungspolitik hinter den Kulissen aber weit mehr. Die Ergebnisse könnten die Startchancen-Debatte zwischen Bund und Ländern lenken und beschleunigen. So hofft das BMBF, dass sich die Kultusminister im Rückenwind der IGLU-Daten gegen den Königsteiner Schlüssel entscheiden. Bemerkenswert: Für heute hat die KMK eine Präsidiumssitzung einberufen, wie Niklas Prenzel und Holger Schleper berichten.
Neben den offensichtlichen Leselücken zeigen die IGLU-Daten, dass in Deutschland nicht jedes Kind sein Recht auf Selbstverwirklichung verfolgen kann – wegen der schlechten Schulen. Das Problem sind also nicht die Leseschwachen, sondern die Entscheidungsschwachen, analysiert Christian Füller. Er stellt vier Ideen vor, was sich jetzt in Bildungspolitik und Schulen ändern muss.
Die Schulleiterin und Digitalbotschafterin Silke Müller veröffentlichte vor zwei Wochen ein viel beachtetes Buch. Es liest sich wie eine Kampfschrift für mehr digitale Ethik. Die Erwachsenen haben die Jugendlichen längst im Stich gelassen – und müssen schnellstens zu Fachkräften für soziale Medien werden. Ich finde: ein must-read für Eltern, Lehrer und Entscheider.
Wie immer freuen wir uns über Hinweise, Lob und Kritik an bildung@table.media.
Eine spannende Lektüre wünscht


Sabine Döring möchte den Smiley wieder zum Lächeln bringen. Die Staatssekretärin im BMBF malt ein sprachliches Bild, das Grundschüler verstehen, aber auch die breite Öffentlichkeit. Nach dem Pisa-Schock stiegen die Leistungen der Grundschüler, seit 2011 fallen sie. Döring spricht von einer Katastrophe.
Eine Trendwende fordert auch ihre Chefin, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), mit Blick auf die IGLU-Ergebnisse. Genauso wie die CDU-Opposition, die eine “bildungspolitische Trendwende” anmahnt. Es sind Worthülsen, die die Bildungsrepublik kennt. Schlechte Zeugnisse erhält das hiesige Schulsystem im Halbjahrestakt. Was daraus folgt: oft Bestürzung – dann ein “Weiter so”. Doch die Daten fallen diesmal nicht in ein bildungspolitisches schwarzes Loch, sondern könnten laufende Verhandlungen befruchten.
Für das Startchancen-Programm, zentrales bildungspolitisches Vorhaben der Ampel-Koalition, erzeugen die alarmierenden Zahlen der IGLU-Studie weiteren Handlungsdruck. Bundesweit sollen mit dem Programm 4.000 Brennpunktschulen über zehn Jahre gefördert werden. Eine Milliarde Euro jährlich vom Bund sei in der angespannten Haushaltslage “schon mal eine Aussage”, findet Döring.
Unter anderem über den Mechanismus zur Verteilung der Gelder gibt es zwischen Bund und Ländern heftige Kontroversen. Die Länder wollen die Milliarden auch künftig größtenteils nach dem Königsteiner Schlüssel verteilen, 5 Prozent nach einem Sozialindex. Das BMBF hat diesen mühsam errungenen Kompromiss in seinem jüngst bekannt gewordenen Eckpunkte-Papier unberücksichtigt gelassen – und weiß um die Sprengkraft, die das Ganze hat.
“Was wir hier anstreben, ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel”, sagte Döring. Die Mittel nach der Armuts- und Migrationsquote zu verteilen, sei nach den Worten der Staatssekretärin eine klare Empfehlung der Wissenschaft. “Ich appelliere an die Länder, nicht auf dem Schema des Königsteiner Schlüssels zu beharren, sondern auf die Wissenschaft zu hören.” Sie winkt mit der IGLU-Studie – und treibt die Länder.
Dem Vernehmen nach kommt das Präsidium der KMK heute Vormittag zu einer Sitzung zusammen. Das Startchancen-Programm und die Reaktion auf den Appell vonseiten des BMBF dürften dabei zentrale Themen sein. Schon zu Wochenbeginn betonten beide Seiten, dass aktuell in enger Taktung verhandelt werde – nachdem 17 Monate Vorbereitung ins Land gezogen waren.
“Gemeinsames Ziel der Gespräche von Bund und Ländern ist es, bis zum Sommer verbindliche Eckpunkte für das Startchancen-Programm zu vereinbaren”, teilte ein Sprecher des BMBF mit. Ganze drei Tage werde kommende Woche verhandelt, heißt es.
Die Bildungspolitikerinnen der Ampel zeigen, nachdem sie die IGLU-Ergebnisse vernommen hatten, bereits mit den Fingern auf die Länder. “Wenn die Bundesländer jetzt nicht wach werden und beim Startchancen-Programm in einen konstruktiven Arbeitsmodus schalten, gefährden sie die Zukunft unserer Kinder”, so Ria Schröder (FDP). Nina Stahr (Grüne) mahnt: “Für öffentlich ausgetragene Kompetenzrangeleien ist die Lage zu dramatisch.”
Doch die IGLU-Daten dürften auch andere Verhandlungen zwischen den Kultusministern lenken. Bis zum Sommer wollen sie die Vorschläge aus dem Grundschul-Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) in politische Maßnahmen übersetzen. Die Sicherung der Mindeststandards war die Hauptforderung der Wissenschaftler Ende vergangenen Jahres. Dazu gehörte auch: Die Stundentafel im Fach Deutsch einheitlich auf 24 Wochenstunden festzulegen.
Derzeit prüfe die KMK die Empfehlungen. “Unsere Aufgabe ist es, zu schauen, welche wir davon schnellstmöglich umsetzen können”, bekräftigte KMK-Präsidentin Günther-Wünsch. Ein zentraler Punkt betreffe die Lesezeit. Laut IGLU-Studie lesen Grundschüler im Schnitt wöchentlich 60 Minuten weniger als in anderen Staaten. Die ehemalige Schulleiterin spricht von “Sprachbändern”, die sich durch den Schultag und mehrere Fächer ziehen können.
Laut KMK-Präsidentin besteht eine Antwort auf die IGLU-Ergebnisse in besserer Diagnostik und gezielter Förderung. Auch die SWK empfiehlt diese Instrumente für Grundschulen. “Bisher haben wir eher informelle Diagnostik. Das muss sich ändern. Sie muss stärker mit der Wissenschaft verknüpft werden”, sagt Günther-Wünsch. Zu diesem Thema sei eine verpflichtende Fortbildung für Grundschullehrer erforderlich.
Sabine Döring wünscht sich gar bundesweit einheitliche, verpflichtende Tests: von der Kita bis zum Zentralabitur. Das ist Zukunftsmusik. Doch je mehr Hiobsstudien erscheinen, desto stärker ist der Druck auf die Bildungspolitik – und die weiß die Ergebnisse für ihre Verhandlungen zu nutzen.
Der ganz große Aufschrei bleibt an diesem Dienstag indes aus. Gelassen klingt auch Günther-Wünsch: “Bildung geschieht nicht über Nacht,” beteuert sie. Politische Änderungen, die jetzt angestoßen werden, könne man frühestens in fünf Jahren in den Daten sehen. 2026 erscheint die nächste IGLU-Studie. Die viel beschworene Trendwende müsste jetzt angestoßen werden. Niklas Prenzel und Holger Schleper
Lesen Sie die Analyse zu den Ergebnissen der IGLU-Studie.
Der Katzenjammer ist wieder groß. Weil viele deutsche Viertklässler nur rudimentär lesen können, ist lautes Donnern zu vernehmen. Das Lamento über die Schlechtleser wird sich freilich schnell wieder legen. In der Un-Bildungsnation regt man sich stets nur ein paar Tage darüber auf, dass ein Viertel der Schüler, die in die fünfte Klasse kommen, dem Unterricht gar nicht folgen können. Schnell wendet man sich wieder von Unterschichtsfabriken namens Haupt- und Sonderschulen ab. Und setzt das gepflegte Gespräch über Gymnasien und idealistische Bildungsziele fort. Dabei besteht Anlass, einen eklatanten Bruch der Verfassung festzustellen: nicht jedes Kind in Deutschland kann sein Recht auf Selbstverwirklichung verfolgen – wegen der schlechten Schulen. Das ist die Lehre aus IGLU.
Das Ergebnis der IGLU-Studie, also dem Vergleich des Lernstandes von Viertklässlern auf der ganzen Welt, lässt sich auf zweierlei Art einordnen: als Verlust an Renommee. Oder als nicht tolerablen Umgang mit dem Recht auf Bildung, das das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich explizit formuliert hat.
Als die erste Grundschul-Lese-Untersuchung Anfang der 2000er-Jahre ans Licht kam, da lag Deutschland weit oben. Baden-Württembergs Viertklässler landeten in Naturwissenschaften gar auf Platz 3 in der Weltrangliste. Das wirkte wie Balsam für die Seelen der Bildungsbürger! Und ließ den Pisa-Schmerz vergessen. Deutschland war wieder Dichter und Denker.
Dabei geht es bei internationalen Vergleichsstudien gar nicht um das Weltranking. Das spornt nur den Wettbewerb an. Die viel wichtigere Frage für eine demokratische Nation lautet: Wie steht es um die Ungleichheit? Bieten Schulen annähernd gleiche Bildungschancen für alle Kinder? Aus dieser Perspektive ist das IGLU-Ergebnis der Größte Anzunehmende Unfall.
Die Ergebnisse deutscher Zöglinge haben sich, nach kurzem Aufschwung, kontinuierlich verschlechtert. Das ist gerade für eine Gruppe kritisch. Gemeint sind jene Schüler, die nur “rudimentär lesen können”. Hört man ihnen beim Lesen zu, dann versteht man – nichts. Ihr Anteil hat sich seit 2001 verdoppelt. Sechs Prozent der Viertklässler können heute gedruckte Sätze nur stammelnd vortragen. Auf Deutsch: 43.000 junge Menschen können an der Schwelle zur weiterführenden Schule de facto nicht lesen.
Kein Staat der Welt kann sich so etwas wirtschaftlich leisten. Aber die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt? Der Exportweltmeister, der täglich versucht, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stählen, entlässt ein Viertel seiner Viertklässler als Bildungsverlierer – das sind jedes Jahr 180.000 junge Menschen.
Die Bildungspolitik hatte nun fast ein Vierteljahrhundert Zeit, die Schulen zu reparieren. Zwischendurch sah es so aus, als würde es mit dem essenziellsten aller Probleme besser, der fehlenden Chancengleichheit. Die IGLU-Werte zeigen nun, dass diese Wunde wieder aufgerissen ist. Aber was hat die Politik eigentlich dagegen gemacht? Wir schreiten über ein Gräberfeld an Reformen.
Nur, was macht die Politik? Ist es eine Komödie oder eine Tragödie? Das Projekt Startchancen, seit eineinhalb Jahren im Gespräch, hat seitdem keinen Cent an benachteiligte Schulen überwiesen. Stattdessen entstand eine Industrie von krawattentragenden Spindoktoren aus Bund und Ländern. Sie belehren einander auf dem Rücken von Hunderttausenden Chancenlosen – über Chancengleicheit. Sie zanken sich endlos. Und verschicken beinahe täglich Mitteilungen über ein Wolkenkuckucksheim namens Startchancen, das möglicherweise nie gebaut wird.
Schuld daran ist eine Kulturhoheit, die in Wahrheit ein Chaos an Zuständigkeiten von drei, manchmal sogar vier Ebenen ist: Bund, Länder, Kommunen und am Ende die Schulen sind in organisierter Verantwortungslosigkeit innig vereint. Chaos – so nennt es übrigens kein Revoluzzer, sondern der Multi-Minister, Jurist und preußische Hugenotte Thomas de Maizière, seines Zeichens Christdemokrat.
Wenn die verschachtelte wie verantwortungslose Schulpolitik ihre größten Baustellen nicht abschließen kann, dann braucht sie Hilfe. Hilfe aus der Zivilgesellschaft. Die Kulturhoheit benötigt ohnehin einen großen Schuss Bundesgeld. Jetzt sollte die Partizipation derer dazukommen, die sich schon lange über das Lernen für morgen Gedanken machen. Kurz: Es braucht jetzt einen Gesellschaftsvertrag für gute Bildung – und es sind zugleich Sofortmaßnahmen nötig. Denn fast 200.000 radebrechende Schüler können nicht warten, bis das Schulsystem modernisiert ist.
Als im Jahr 2007 das iPhone auf den Markt kam, ist der Weltmarktführer Nokia nicht sofort kollabiert. Aber sehr lange hat es nicht mehr gedauert. Heute tragen nur noch Connaisseure Nokia-Telefone, dieses Datum hat die Welt also verändert. Die Erscheinung von ChatGPT im November 2022 dürfte ein ähnlicher Moment für das Lehr-Lern-Modell der Schulen sein. Inzwischen sprießen adaptierte Anwendungen des Sprachmodells von OpenAI. Gerade hat Google seine ChatGPT-Konkurrenten von der Leine gelassen, der noch mehr kann. Kurzum: Die Möglichkeiten eines Schülers, sich über ein Thema zu informieren, einen informativen Text oder einen Essay zu verfassen, haben sich verändert. Und zwar so fundamental, dass die Prämissen von Schule, wie wir sie kennen, nicht mehr zu halten sind. Hausaufgaben, Hausarbeiten, Klausuren – das ist Schnee von gestern.
Dafür zeichnet die Kultusbürokratie übrigens ausnahmsweise mal nicht verantwortlich. Sie hat ihren Teil der Digitalisierung der Schulen nolens volens erfüllt. Für KI ist sie trotzdem zu langsam. Das ist keine Bosheit, sondern schlicht die Realität.
“Wir müssen uns endlich eingestehen, dass wir zumindest in der digitalen Welt die Werte eines friedvollen Miteinanders verloren haben.” Dieser Satz sagt viel über unsere Gesellschaft. Und er sagt alles darüber, was Silke Müller ihr vorwirft. Sie ist Schulleiterin, seit 2021 die erste Digitalbotschafterin des Landes und die Autorin von Wir verlieren unsere Kinder! Gewalt, Missbrauch, Rassismus – der verstörende Alltag im Klassenchat. Das Buch steht seit zwei Wochen auf Platz 6 der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Müller beschreibt in ihrem Erstlingswerk den Einfluss des digitalen Raums als Lebensrealität junger Menschen. Sie berichtet davon, was Jugendliche in den sozialen Medien beschäftigt, womit sie in Berührung kommen und wie sie das beeinflusst. Und sie kreidet an. Sie kritisiert die negativen Aspekte der digitalen Welt; einem Ort, an dem Unterhaltung und Information auf der einen Seite warten, ungefilterte Grausamkeiten, Dinge, die Kinderaugen nicht sehen sollten und Mobbing auf der anderen.
Weit ausführlicher kritisiert sie allerdings die Gesellschaft, die zulässt, dass es so weit kommen konnte. Dass Kinder im Internet mit Gewaltdarstellungen, Pornografie und Diskriminierung in Berührung kommen und Erwachsene darüber nicht zur Genüge Bescheid wissen. Dass Jugendliche Mobbing und Hass reproduzieren, weil sie sich auf das berufen, was ihnen vorgelebt wird.
Müller erklärt Begriffe und Netzwerke angemessen – TikTok zum Beispiel widmet sie ein ganzes Kapitel, schließlich ist das Netzwerk eines der beliebtesten unter Kindern und Jugendlichen. Sie stellt die realen Gefahren im digitalen Leben junger Menschen dar: Mobbing, Gewalt, Missbrauch – einzig der im Titel so stark betonte Rassismus wird im Buch nur sehr dünn beleuchtet.
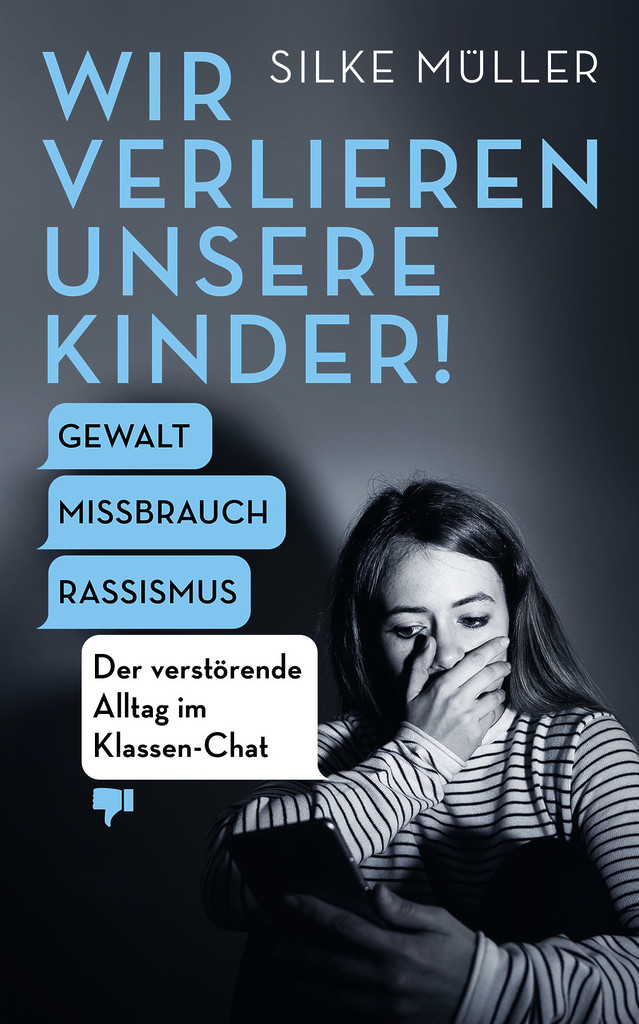
Das erste Kapitel des Buchs ist ein Brief, der sich an “alle, denen Kinder und Jugendliche wichtig sind” richtet. Genau so liest es sich auch, sogar eher wie ein Hilferuf, gespickt mit rhetorischen Fragen und jeder Menge ausdrucksstarken, fast schon theatralischen Metaphern. Die Tatsache, dass sich junge Menschen oft unvorbereitet im digitalen Raum bewegen, beschreibt die Schulleiterin wie folgt: “Wir schicken sie sprichwörtlich mit dem Kinderfahrrad auf eine viel befahrene Autobahn.” Auch als Müller schreibt, dass wir “Gefahr laufen, unsere Kinder im Heranwachsen zu verlieren“, klingt das zunächst dick aufgetragen. Doch dieser Eindruck vergeht in der weiteren Lektüre.
Denn spätestens im dritten Kapitel bringt Müller ihre eigenen Erfahrungen aus Schule und Unterricht ein. In acht Fällen aus dem Schulalltag schildert sie die Realität junger Menschen – und jedem Lesenden wird klar, dass ihre Warnungen nicht zu expressiv sind. Sie berichtet von Schülern, die Memes mit rechtsextremem Inhalt verschicken. Von jungen Menschen, deren Nacktfotos geleakt und herumgeschickt werden. Und sie berichtet von einem 14-jährigen Jungen, der seiner Mitschülerin Marihuana verkauft, wobei sie als Teil einer TikTok-Challenge mit einem Blowjob “bezahlt”. Die Fälle, die sie schildert, spiegeln Gewalt und Missbrauch wider. Sie ergreifen, machen Angst und betroffen. Sie lassen feststellen, dass Erwachsene viel zu wenig über die digitale Realität junger Menschen wissen.
Eben das ist Müllers Kritik. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der solche Dinge passieren. “Würde unsere Generation sich endlich intensiv mit der wirklichen Lebensumwelt der Kinder auseinandersetzen, würden wir endlich verstehen, dass unsere fehlende Werteorientierung im Netz nach und nach alle Mitmenschlichkeit verschwinden lässt”, schreibt Müller. “Wie sollen wir eine digitale Ethik vermitteln, wenn wir sie bei uns nicht in den Fokus stellen?”
Sie plädiert dafür, Medienkompetenz anders – und natürlich stärker – zu lehren als bisher. Eltern zum Beispiel sollen sich vermehrt mit den Erlebnissen ihrer Kinder im digitalen Raum auseinandersetzen, sich den Diskussionen ihrer Kinder stellen und offen über Themen wie Like-Zahlen, Privatsphäre, Fake-News und Co. sprechen. Schulen sollten Social-Media-Sprechstunden einführen, Kinder und Eltern in Diskurse miteinbeziehen und Lehrer zu Fachkräften für soziale Netzwerke werden.
Dass ein Buch wie das Silke Müllers erscheint, wurde Zeit. Sie ist eine überzeugte Digitalistin – und zugleich eine scharfe Kritikerin der fehlenden digitalen Ethik. Alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben – Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter, Verwandte – können aus Wir verlieren unsere Kinder! etwas mitnehmen: Ein Grundverständnis davon, dass Erwachsene hinterherhinken, wenn es um die digitale Lebensrealität junger Menschen geht. Und die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann.
Das niedersächsische Innenministerium hat den eigenen IT-Beauftragten korrigiert. Das Video- und Kommunikationssystem “MS Teams” von Microsoft wird nicht für Schulen zugelassen. “Das Land Niedersachsen plant derzeit weder eine Nutzung des Produktes Teams von Microsoft für Schulen, noch ist dieses bereits als Cloudlösung an diesen eingeführt”, ließ Innenministerin Daniela Behrens (SPD) auf Anfrage von Table.Media mitteilen. Damit widersprach das Haus dem eigenen “Chief Information Officer” Horst Baier. Der hatte nach einer Veranstaltung auf LinkedIn das Signal ausgesendet: Microsoft Teams sei jetzt an Schulen nutzbar.
Für Microsoft ist das Gerangel ein PR-Erfolg. Denn die niedersächsische Datenschutzbeauftragte, Barbara Thiel, griff in die Debatte an keiner Stelle ein. Ihre Behörde ist seit einiger Zeit mit dem Innenministerium und dem IT-Beauftragten über Microsoft im Austausch. In ihrem Haus aber bestand nach Informationen von Table.Media nie ein klarer Wille, dem Innenministerium in die Parade zu fahren. Man sei lediglich mit der Veröffentlichungspolitik von Baier nicht einverstanden, hieß es. Nach einer Veranstaltung mit dem Titel “Cloud-Lösungen für Kommunen und Schulen” hatte CIO-Officer Baier einen Post abgesetzt. “Letzten Freitag ging der Auftrag an Microsoft.” Natürlich hatte sich die verkürzte Information schnell verbreitet. Immerhin hatten die Datenschutzbeauftragten kürzlich einstimmig festgehalten: Microsofts M365 sei in seiner derzeitigen Konfiguration für Schulen “nicht datenschutzrechtskonform zu verwenden”; Niedersachsen stimmte zu. Dieser Konsens war mit Baiers PR und der Lähmung der Datenschutzbeauftragten hinfällig.
Im Umfeld des CIO hieß es sogar, es bestehe ein Nicht-Angriffspakt zwischen Innenministerium und Datenschutzbeauftragter. Die Rechtsauffassungen bezüglich der Nutzbarkeit von MS Teams seien unterschiedlich. Aber die Datenschutzbeauftragte werde nichts unternehmen. Für Schulen ist die entstandene Lage misslich – trotz des eindeutigen Statements. Auf einer großen Veranstaltung der kommunalen Spitzenverbände, welche die Schulträger repräsentieren, wird über die Vorteile eines Microsoft-Produktes räsoniert – und sein Kauf verkündet. Der Datenschutz greift aber nicht etwa gegenüber der mächtigen Innenministerin ein. Er wird aktiv, wenn eine Schule mit MS Teams arbeitet – und sich ein Elternteil beschwert. Das heißt: Der Datenschutz-Konflikt zwischen USA und EU findet auf dem Rücken der Schulleitungen statt.
Der Städtetag Niedersachsens teilte Table.Media als Co-Veranstalter mit, es treffe nicht zu, “dass die kommunalen Spitzenverbände etwas favorisieren würden.” Den Vortrag über Lernwolken für Schulen hielt auf der Veranstaltung allerdings die “Industry Advisor Public Sector” von Microsoft, Cornelia Schneider-Pungs. Der Titel des Microsoft-Referats: “Einsatzszenarien von Clouddiensten in Schulen: Praktische Anwendungsfälle und Referenzen”. Christian Füller
Es gibt jetzt GPTSchule, eine Version der leicht zugänglichen Künstlichen Intelligenz ChatGPT, die speziell für Schulen da ist. Der kleine Leipziger Schulsoftware-Anbieter “Schulverwalter” hat GPTSchule in einer Betaversion herausgebracht, die es Lehrern ermöglicht, den Textgenerator mit Schülern für den Unterricht zu nutzen. Die “Schulverwalter” um Geschäftsführer Julian Dorn lassen die Anfragen über einen Server laufen, der in Deutschland steht; Betreiber ist der deutsche Anbieter Netcup. Sie haben zudem eine Vereinbarung mit OpenAI getroffen, dass das Unternehmen weder personenbezogene Daten von Schülern verarbeitet noch die Eingaben der Schüler zum Training für ChatGPT nutzt. “Wir wollten ChatGPT zunächst für unsere Arbeit als Informatiklehrer nutzen”, sagt “Schulverwalter” Dorn, “aber die explosionsartige Entwicklung hat uns gezeigt, dass wir das als Unternehmen auch für andere Schulen anbieten sollten.”
Umsonst ist die sächsische ChatGPT-Adaption für Schulen allerdings nicht. Pädagogen können eine Million so genannter Token für knapp acht Euro kaufen. Zur Einordnung: Eine 90-minütige Doppelstunde mit ausführlicher Nutzung der KI durch eine Schulklasse verbraucht etwa 100.000 Token. Für eine kurze 20-minütige Unterrichtseinheit benötigen Lehrkraft und Lernende etwa 20.000 Token. Die Frage ist allerdings, wer das bezahlt. Eine Anfrage von Table.Media beim sächsischen Kultusministerium ergab, dass es in Sachsen bislang kein eigenes Schulbudget dafür gibt. Eine Kostenübernahme durch das Kultusministerium für das Angebot sei derzeit nicht vorgesehen. “Die Ausstattung von Schulen mit Lehr- und Lernmitteln ist grundsätzlich Angelegenheit der Schulträger“, sagte eine Sprecherin. Die “Schulverwalter” bezahlen ihrerseits an OpenAI eine Gebühr für die Nutzung der Schnittstelle zu ChatGPT. Der Dienst ist bundesweit nutzbar. Die “Schulverwalter” machten keine Angaben darüber, wie viele Nutzer sie bereits haben.
Der schulische Anwender bekommt bei GPTSchule einen pädagogischen Mehrwert. Lehrkräfte können zum Beispiel große Texte in GPTSchule hochladen. So lassen sich literarische Spielwiesen für gezielte Fragen der Lernenden an ChatGPT eröffnen. Bei OpenAI kann man nicht das ganze Opus “Romeo und Julia” ins Chat-Fenster eingeben. Bei GPTSchule geht das. “Dann können die Schüler auf Grundlage des Manuskripts gezielt zur Balkon-Szene von Romeo und Julia Fragen stellen oder Dialoge beginnen”, sagt Julian Dorn, der selbst noch als Informatiklehrer arbeitet. Gibt man beim Original ChatGPT die Balkonszene ein, so händigt das System zwar einen Dialog aus. Allerdings mit dem Hinweis: “Bitte beachten Sie, dass dies eine sehr vereinfachte Version des Dialogs ist. Die Originalszene ist viel ausführlicher.” Christian Füller
Das Bundesprogramm für IT-Administratoren, das die Kommunen bisher praktisch nicht angefasst haben, kommt endlich in Schwung. Das geht aus einer aktuellen Zusammenstellung der Kultusminister hervor, die Table.Media vorliegt. Danach sind von der halben Milliarde Euro für die Betreuer von Endgeräten und IT inzwischen 245 Millionen vertraglich gebunden. Das Sonderprogramm geht auf ein Gespräch zwischen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und der damaligen Kanzlerin Angela Merkel mit Kultusministern im September 2020 zurück.
Wie vielfach berichtet, war die Zusatzvereinbarung für IT-Administratoren der bisher am schlechtesten abgerufene Teil des “Digitalpakt Schule”. Die Zusatzvereinbarungen für Endgeräte von Schülern und Lehrern sind praktisch zu 100 Prozent ausbezahlt. Nun hat innerhalb eines Quartals auch der Zugriff auf die 500 Millionen Euro für so genannte Turnschuh-Administratoren intensiv zugenommen.
Der Grund für das schnelle Wachstum dürfte darin liegen, dass einige Bundesländer den Kommunen den Abruf der Mittel dadurch schmackhaft gemacht haben, dass sie langfristig mit in die Finanzierung gehen. Bayern etwa übernimmt ab 2025 die Hälfte der Kosten für professionelles IT-Personal an Schulen.
IT-Administratoren gelten als eine Schlüsselstelle der Digitalisierung der Schulen. Bisher machen vor allem Lehrer den Job, meist nebenher, mit einem Deputat von wenigen Stunden. Die 500 Millionen Euro waren deswegen ein wichtiger Impuls – dachte man. Allerdings gibt es bei dem Zuschuss ein Problem: Er ist lebensfremd konstruiert, wie ein Mitarbeiter eines kommunalen Spitzenverbandes Table.Media sagte.
“Das Problem ist nicht, dass die Schulträger das Geld nicht bräuchten, aber die Vorschriften für die Zusätzlichkeit sind zu kompliziert.” Wenn eine Kommune einen IT-Administrator für Schulen einstellt, dann kann sie ihn zudem mit den Bundesmitteln nicht lange bezahlen. Denn das IT-Zusatzprogramm war ausdrücklich einmalig. Um an allen deutschen Schulen einen IT-Experten zu beschäftigen, bräuchte man ungefähr 2 Milliarden Euro – jährlich. Christian Füller
Die Bildungsminister der G7-Staaten möchten die Digitalisierung an den Schulen stärken, die sozial-emotionalen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern fördern und die internationale Mobilität im Bildungsbereich erhöhen. Das geht aus der vierseitigen Abschlusserklärung hervor, die jetzt bei einem viertägigen Treffen der Bildungsminister sowie hochrangiger Vertreter der G7-Staaten in Japan veröffentlicht wurde. Es stand unter der Überschrift “Bildung nach der COVID-19-Pandemie”.
Für Deutschland nahmen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die saarländische Ministerin für Bildung und Kultur Christine Streichert-Clivot (SPD) teil. Sie ist zugleich erste Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz.
In dem Papier heißt es unter anderem, dass die Zusammenarbeit zwischen Schulen und ihrem gesellschaftlichen Umfeld ausgebaut werden soll. Kinder sollen “Erfahrungen in Natur, Kultur und Kunst” sammeln, um ihre sozial-emotionale Entwicklung zu fördern.
Zudem heben die G7-Minister hervor, dass die persönliche Interaktion zwischen Lehrern und Schülern in der Bildung auch künftig die größte Bedeutung haben wird. Ziel müsse es aber auch sein, Bildung zu fördern, “die digitale Technologien effektiv integriert, um den Präsenzunterricht zu unterstützen”. Dafür sollen Lehrkräfte mehr Kompetenzen im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien erlangen.
In den Blick nahmen die Bildungsminister auch die Zahl der Auslandsaufenthalte von Studierenden und Schülern. Die Mobilität soll wieder wachsen, denn durch die Corona-Pandemie ist sie stark zurückgegangen. Ein Fingerzeig ist dabei eine Studie vom Bildungsberatungsdienst weltweiser.de. Ihr zufolge nahmen 2019/-20 rund 16.000 Schüler an Austauschprogrammen teil, die mindestens drei Monate dauern. Ein Jahr später waren es dahingegen nur noch etwas mehr als 5.000.
Weniger einschneidend war zunächst die Entwicklung an den Hochschulen. Aber auch hier gab es nach Daten des Statistischen Bundesamtes bei der Zahl der deutschen Studierenden im Ausland allein 2020 einen Rückgang von 4.500 Personen gegenüber 2019. Die G7-Vertreter wollen diesen Trend umkehren und sogar mehr Mobilität im Bildungssektor als vor der Pandemie. Holger Schleper
99 Frauen waren unter den bundesweit besten Azubis, die die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Montag in Berlin auszeichnete. Insgesamt schafften es 216 Azubis aus 208 Berufen unter die Bundesbesten (Bestenliste zum Download). Der Frauenanteil lag bei 46 Prozent und stieg im Vergleich zur letzten Ehrung 2019 um 11 Prozent. Damit liegt er höher als der Gesamtanteil weiblicher Azubis an allen Auszubildenden 2022 in Industrie- und Handelsberufen.
“Exzellenz in der Ausbildung wird weiblicher“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Im Ländervergleich schnitt Bayern mit 44 Ausgezeichneten am besten ab, gefolgt von NRW (41) und Baden-Württemberg (33). Gleich drei Bundesbeste wurden bei Mercedes-Benz und Volkswagen ausgebildet. Je zwei Beste kamen etwa von Bayer und der Deutschen Post oder vom Blasinstrumente-Hersteller Buffet Crampon Deutschland und der Dr. Johannes Heidenhain Gmbh, einem Hersteller mechatronischer Messgeräte. Anna Parrisius

Als Netzwerkerin will Katja Hintze die zusammenbringen, die sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Ihr Ziel ist “ein Bildungssystem, das allen Menschen offensteht und allen eine individuelle und stärkenorientierte Perspektive eröffnet.” Mit dieser großen Vision gründete Hintze 2012 als eine von zehn Ehrenamtlichen die Stiftung Bildung, eine unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Organisation, die zahlreiche Programme im Auftrag von Bundesministerien betreut. Und zudem auch die Interessen von Spendenorganisation öffentlich vertritt.
Inzwischen ist Hintze seit zehn Jahren hauptberuflich Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Was die mittlerweile rund 140 Ehren- und Hauptamtlichen der Stiftung wollen, lässt sich schnell auf den Punkt bringen. Eine bessere Bildung für alle Kinder und Jugendliche.
Dafür setzen sie sich auf unterschiedlichen Wegen ein. Sie unterstützen bundesweit Bildungsengagement, indem sie Ehrenamtliche vor Ort vernetzen und die Engagierten qualifizieren. Die Stiftung entwickelt eigene Projekte. Sie hilft bei der Gründung von Kita- und Schulfördervereinen und deren Vernetzung. Und sie wirken als Lobbyistinnen und Lobbyisten aktiv auf die Politik ein.
Dazu zählt aktuell eine Debatte über die Entbürokratisierung der Förderpolitik des Bundes. “Wenn die Zivilgesellschaft durch Krisen wie Klima, Krieg, Fachkräftemangel oder Pandemien nun kontinuierlich gefordert ist, dann müssen wir gemeinwohlorientierte Hilfen zuverlässiger und einfacher finanzieren”, sagt Hintze. Was sie damit meint, klingt tatsächlich wie ein Schildbürgerstreich des Staates. Gerade erst habe ihre Stiftung erlebt, dass ein- und dasselbe Ministerium die Auszahlung einer Inflationsausgleichspauschale an Mitarbeiter von Projekten unterschiedlich beurteilt. Um Steuergeld gezielter und systematischer einzusetzen, brauche es daher eine Entbürokratisierung.
“Wir haben uns als junge NGO, als Non-Profit-Unternehmen immer wieder gefragt, warum Bundesministerien oder sogar Abteilungen im gleichen Ministerium Förderrichtlinien ganz unterschiedlich handhaben“, sagt Hintze. Um das zu ändern, haben 20 Stiftungen zusammen mit der Stiftung Bildung einen Brief an diverse Bundesministerien geschrieben – und am Montagabend eine öffentliche Anhörung veranstaltet.
Für Hintze gleicht kein Arbeitstag dem anderen – weil es im Bildungssystem so viele Stellschrauben zu drehen gelte. Ihre Arbeit beschreibt sie als vielschichtig bestehend aus Beratungsgesprächen, juristischen Gutachten, Projektförderungen, Netzwerkarbeit, bis hin zu Kampagnen.
Mit vielen Themen jonglieren, das konnte Hintze schon vor Gründung ihrer Stiftung. Nach dem Abitur machte die 52-Jährige eine Ausbildung zur Buchhändlerin, außerdem studierte sie Wirtschaftsethik, Kommunikationswissenschaften, Publizistik, Kunst und Diversity Studies. Acht Jahre lang arbeitete sie als Kooperations- und Business Development-Managerin in der freien Wirtschaft. “Was ich damals gelernt habe, kann ich heute in der Stiftung anwenden.”
Auch jetzt bemüht Hintze sich um eine bessere Zusammenarbeit und setzt sich beispielsweise dafür ein, dass engagierte Schüler und Schülerinnen, Eltern oder Lehrkräfte die Politik beraten. “Als Bildungsaktivistin- und lobbyistin bringe ich diese große Expertise des Bildungsengagements an die entsprechenden zuständigen Personen und Stellen.”
Es brauche viele, um gute Bildung für alle Kinder zu machen, sagt Hintze. Sie sei die, die Verbindungen schafft. Viel abgewinnen kann sie auch dem Vorschlag der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken nach einem Sondervermögen Bildung über 100 Milliarden Euro.
Motivation für ihre Arbeit nehme sie aus ihrem “Gerechtigkeitssinn und Sozialgefühl.” Sie selbst hat zwei erwachsene Töchter und einen Sohn. Schon lange vor Gründung der Stiftung Bildung rieb sie sich am deutschen Bildungssystem. Als begeisterte Pfadfinderin habe Hintze immer einen Vergleich zur Hand: Vieles, was ich sie dort an Teamgeist erlebt hat, würde sie auch gern im Bildungssystem sehen. Svenja Napp
Research.Table. Saudische Universitäten: Geld für Geltung: Um in Rankings gut dazustehen, sind Universitäten in Saudi-Arabien findig: Sie kooperieren mit viel zitierten Forschern aus anderen Ländern und wirken darauf hin, dass sie in einer wichtigen Datenbank als primäre Affiliation vermerkt sind. Das Spielchen machen immer mehr Wissenschaftler mit, auch deutsche. Mehr
Research.Table. Schwedens Universitätsräte unter politischem Druck: Quasi über Nacht halbierte das schwedische Wissenschaftsministerium die Amtszeit der aktuellen Universitätsräte. Wegen möglicher Spionagegefahr sollen Sicherheitsexperten in die Gremien berufen werden. Für die wissenschaftliche Community ist das ein klarer Eingriff in die Autonomie der Universitäten und Grund zum Widerstand. Mehr
24. Mai 2023, 16:30 Uhr, online
Bundestagsaussprache: Berufsbildungsbericht 2023
Der Bundestag berät erstmals über den Berufsbildungsbericht 2023 der Bundesregierung. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden. INFOS & LIVEÜBERTRAGUNG
25. und 26. Mai 2023, Berlin
Fachtagung: Dimension Digitalisierung
Das Forum Bildung Digitalisierung und die Kultusministerkonferenz wollen mit dieser Fachtagung den länderübergreifenden Austausch rund um Erfahrungen, Konzepte und Strategien zur Gestaltung von Bildung im Kontext der Kultur der Digitalität fördern. INFOS & ANMELDUNG
30. Mai 2023, 16:30 bis 19:00 Uhr, online
Diskussion: ChatGPT im Bildungsbereich
Erzeugt ChatGPT Chaos oder Chancen für Schulen und Hochschulen? In verschiedenen Formaten geht es bei diesem GEW-Event um Themen wie Urheberrecht und Quellenhinweise, pädagogische und didaktische Auswirkungen, aber auch um nicht kommerzielle Alternativen zu ChatGPT. INFOS & ANMELDUNG
31. Mai 2023, 17:45 Uhr, Berlin
Diskussion: Unsichtbare Arbeit und Diskriminierung – Gender, Diversity und ChatGPT
Wie durch KI-Anwendungen eine Neuverteilung von Arbeit stattfindet, ist zentrales Thema dieses Events. Fokus liegt darauf, welches Diskriminierungspotenzial die Neuverteilung mit sich bringt und welche neuen Perspektiven zu Gender und Diversity die Forschung zur Digitalisierung braucht. INFOS & ANMELDUNG
2. bis 4. Juni 2023, Bochum
Festival: Lehramtsfestival
Beim fünften Lehramtsfestival vom Verein Kreidestaub lautet das Motto Gemeinsam für eine nachhaltige Bildung der Zukunft. Workshops finden zu Themen wie Chancengerechtigkeit, kulturelle Bildung, alternative Sprachförderung, Suizidprävention und interkulturelle Kompetenz statt. INFOS & ANMELDUNG
5. Juni 2023, 15:00 bis 16:30 Uhr, online
Vortrag und Workshop: Digitalisierungsbezogene Kompetenzen, die Lehrer:innen benötigen!
Im Zuge der Veranstaltungsreihe Digitalisierung in der Lehrer:innenbildung präsentiert die Uni Leipzig einen Kompetenzkatalog für die Lehrerbildung, der zentrale digitalisierungsbezogene Kompetenzen für die schulischen Aufgabenfelder Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren zusammenträgt. INFOS & ANMELDUNG
5. bis 7. Juni 2023, Berlin
Festival: re:publica
Die re:publica, das Festival für die digitale Gesellschaft, liefert auch in diesem Jahr wieder Input für den Bildungsbereich. Keynotes tragen Titel wie Transformative Bildung: welche (digitalen) Lernräume brauchen wir für die sozial-ökologische Transformation? oder Medienbildung needs Cash – und was noch? MeetUp Medienpädagogik. INFOS & ANMELDUNG
geradezu routiniert präsentierten KMK und BMBF die IGLU-Daten gestern. Das desaströse Zeugnis für die Schulpolitik bewegt die Bildungspolitik hinter den Kulissen aber weit mehr. Die Ergebnisse könnten die Startchancen-Debatte zwischen Bund und Ländern lenken und beschleunigen. So hofft das BMBF, dass sich die Kultusminister im Rückenwind der IGLU-Daten gegen den Königsteiner Schlüssel entscheiden. Bemerkenswert: Für heute hat die KMK eine Präsidiumssitzung einberufen, wie Niklas Prenzel und Holger Schleper berichten.
Neben den offensichtlichen Leselücken zeigen die IGLU-Daten, dass in Deutschland nicht jedes Kind sein Recht auf Selbstverwirklichung verfolgen kann – wegen der schlechten Schulen. Das Problem sind also nicht die Leseschwachen, sondern die Entscheidungsschwachen, analysiert Christian Füller. Er stellt vier Ideen vor, was sich jetzt in Bildungspolitik und Schulen ändern muss.
Die Schulleiterin und Digitalbotschafterin Silke Müller veröffentlichte vor zwei Wochen ein viel beachtetes Buch. Es liest sich wie eine Kampfschrift für mehr digitale Ethik. Die Erwachsenen haben die Jugendlichen längst im Stich gelassen – und müssen schnellstens zu Fachkräften für soziale Medien werden. Ich finde: ein must-read für Eltern, Lehrer und Entscheider.
Wie immer freuen wir uns über Hinweise, Lob und Kritik an bildung@table.media.
Eine spannende Lektüre wünscht


Sabine Döring möchte den Smiley wieder zum Lächeln bringen. Die Staatssekretärin im BMBF malt ein sprachliches Bild, das Grundschüler verstehen, aber auch die breite Öffentlichkeit. Nach dem Pisa-Schock stiegen die Leistungen der Grundschüler, seit 2011 fallen sie. Döring spricht von einer Katastrophe.
Eine Trendwende fordert auch ihre Chefin, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), mit Blick auf die IGLU-Ergebnisse. Genauso wie die CDU-Opposition, die eine “bildungspolitische Trendwende” anmahnt. Es sind Worthülsen, die die Bildungsrepublik kennt. Schlechte Zeugnisse erhält das hiesige Schulsystem im Halbjahrestakt. Was daraus folgt: oft Bestürzung – dann ein “Weiter so”. Doch die Daten fallen diesmal nicht in ein bildungspolitisches schwarzes Loch, sondern könnten laufende Verhandlungen befruchten.
Für das Startchancen-Programm, zentrales bildungspolitisches Vorhaben der Ampel-Koalition, erzeugen die alarmierenden Zahlen der IGLU-Studie weiteren Handlungsdruck. Bundesweit sollen mit dem Programm 4.000 Brennpunktschulen über zehn Jahre gefördert werden. Eine Milliarde Euro jährlich vom Bund sei in der angespannten Haushaltslage “schon mal eine Aussage”, findet Döring.
Unter anderem über den Mechanismus zur Verteilung der Gelder gibt es zwischen Bund und Ländern heftige Kontroversen. Die Länder wollen die Milliarden auch künftig größtenteils nach dem Königsteiner Schlüssel verteilen, 5 Prozent nach einem Sozialindex. Das BMBF hat diesen mühsam errungenen Kompromiss in seinem jüngst bekannt gewordenen Eckpunkte-Papier unberücksichtigt gelassen – und weiß um die Sprengkraft, die das Ganze hat.
“Was wir hier anstreben, ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel”, sagte Döring. Die Mittel nach der Armuts- und Migrationsquote zu verteilen, sei nach den Worten der Staatssekretärin eine klare Empfehlung der Wissenschaft. “Ich appelliere an die Länder, nicht auf dem Schema des Königsteiner Schlüssels zu beharren, sondern auf die Wissenschaft zu hören.” Sie winkt mit der IGLU-Studie – und treibt die Länder.
Dem Vernehmen nach kommt das Präsidium der KMK heute Vormittag zu einer Sitzung zusammen. Das Startchancen-Programm und die Reaktion auf den Appell vonseiten des BMBF dürften dabei zentrale Themen sein. Schon zu Wochenbeginn betonten beide Seiten, dass aktuell in enger Taktung verhandelt werde – nachdem 17 Monate Vorbereitung ins Land gezogen waren.
“Gemeinsames Ziel der Gespräche von Bund und Ländern ist es, bis zum Sommer verbindliche Eckpunkte für das Startchancen-Programm zu vereinbaren”, teilte ein Sprecher des BMBF mit. Ganze drei Tage werde kommende Woche verhandelt, heißt es.
Die Bildungspolitikerinnen der Ampel zeigen, nachdem sie die IGLU-Ergebnisse vernommen hatten, bereits mit den Fingern auf die Länder. “Wenn die Bundesländer jetzt nicht wach werden und beim Startchancen-Programm in einen konstruktiven Arbeitsmodus schalten, gefährden sie die Zukunft unserer Kinder”, so Ria Schröder (FDP). Nina Stahr (Grüne) mahnt: “Für öffentlich ausgetragene Kompetenzrangeleien ist die Lage zu dramatisch.”
Doch die IGLU-Daten dürften auch andere Verhandlungen zwischen den Kultusministern lenken. Bis zum Sommer wollen sie die Vorschläge aus dem Grundschul-Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) in politische Maßnahmen übersetzen. Die Sicherung der Mindeststandards war die Hauptforderung der Wissenschaftler Ende vergangenen Jahres. Dazu gehörte auch: Die Stundentafel im Fach Deutsch einheitlich auf 24 Wochenstunden festzulegen.
Derzeit prüfe die KMK die Empfehlungen. “Unsere Aufgabe ist es, zu schauen, welche wir davon schnellstmöglich umsetzen können”, bekräftigte KMK-Präsidentin Günther-Wünsch. Ein zentraler Punkt betreffe die Lesezeit. Laut IGLU-Studie lesen Grundschüler im Schnitt wöchentlich 60 Minuten weniger als in anderen Staaten. Die ehemalige Schulleiterin spricht von “Sprachbändern”, die sich durch den Schultag und mehrere Fächer ziehen können.
Laut KMK-Präsidentin besteht eine Antwort auf die IGLU-Ergebnisse in besserer Diagnostik und gezielter Förderung. Auch die SWK empfiehlt diese Instrumente für Grundschulen. “Bisher haben wir eher informelle Diagnostik. Das muss sich ändern. Sie muss stärker mit der Wissenschaft verknüpft werden”, sagt Günther-Wünsch. Zu diesem Thema sei eine verpflichtende Fortbildung für Grundschullehrer erforderlich.
Sabine Döring wünscht sich gar bundesweit einheitliche, verpflichtende Tests: von der Kita bis zum Zentralabitur. Das ist Zukunftsmusik. Doch je mehr Hiobsstudien erscheinen, desto stärker ist der Druck auf die Bildungspolitik – und die weiß die Ergebnisse für ihre Verhandlungen zu nutzen.
Der ganz große Aufschrei bleibt an diesem Dienstag indes aus. Gelassen klingt auch Günther-Wünsch: “Bildung geschieht nicht über Nacht,” beteuert sie. Politische Änderungen, die jetzt angestoßen werden, könne man frühestens in fünf Jahren in den Daten sehen. 2026 erscheint die nächste IGLU-Studie. Die viel beschworene Trendwende müsste jetzt angestoßen werden. Niklas Prenzel und Holger Schleper
Lesen Sie die Analyse zu den Ergebnissen der IGLU-Studie.
Der Katzenjammer ist wieder groß. Weil viele deutsche Viertklässler nur rudimentär lesen können, ist lautes Donnern zu vernehmen. Das Lamento über die Schlechtleser wird sich freilich schnell wieder legen. In der Un-Bildungsnation regt man sich stets nur ein paar Tage darüber auf, dass ein Viertel der Schüler, die in die fünfte Klasse kommen, dem Unterricht gar nicht folgen können. Schnell wendet man sich wieder von Unterschichtsfabriken namens Haupt- und Sonderschulen ab. Und setzt das gepflegte Gespräch über Gymnasien und idealistische Bildungsziele fort. Dabei besteht Anlass, einen eklatanten Bruch der Verfassung festzustellen: nicht jedes Kind in Deutschland kann sein Recht auf Selbstverwirklichung verfolgen – wegen der schlechten Schulen. Das ist die Lehre aus IGLU.
Das Ergebnis der IGLU-Studie, also dem Vergleich des Lernstandes von Viertklässlern auf der ganzen Welt, lässt sich auf zweierlei Art einordnen: als Verlust an Renommee. Oder als nicht tolerablen Umgang mit dem Recht auf Bildung, das das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich explizit formuliert hat.
Als die erste Grundschul-Lese-Untersuchung Anfang der 2000er-Jahre ans Licht kam, da lag Deutschland weit oben. Baden-Württembergs Viertklässler landeten in Naturwissenschaften gar auf Platz 3 in der Weltrangliste. Das wirkte wie Balsam für die Seelen der Bildungsbürger! Und ließ den Pisa-Schmerz vergessen. Deutschland war wieder Dichter und Denker.
Dabei geht es bei internationalen Vergleichsstudien gar nicht um das Weltranking. Das spornt nur den Wettbewerb an. Die viel wichtigere Frage für eine demokratische Nation lautet: Wie steht es um die Ungleichheit? Bieten Schulen annähernd gleiche Bildungschancen für alle Kinder? Aus dieser Perspektive ist das IGLU-Ergebnis der Größte Anzunehmende Unfall.
Die Ergebnisse deutscher Zöglinge haben sich, nach kurzem Aufschwung, kontinuierlich verschlechtert. Das ist gerade für eine Gruppe kritisch. Gemeint sind jene Schüler, die nur “rudimentär lesen können”. Hört man ihnen beim Lesen zu, dann versteht man – nichts. Ihr Anteil hat sich seit 2001 verdoppelt. Sechs Prozent der Viertklässler können heute gedruckte Sätze nur stammelnd vortragen. Auf Deutsch: 43.000 junge Menschen können an der Schwelle zur weiterführenden Schule de facto nicht lesen.
Kein Staat der Welt kann sich so etwas wirtschaftlich leisten. Aber die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt? Der Exportweltmeister, der täglich versucht, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stählen, entlässt ein Viertel seiner Viertklässler als Bildungsverlierer – das sind jedes Jahr 180.000 junge Menschen.
Die Bildungspolitik hatte nun fast ein Vierteljahrhundert Zeit, die Schulen zu reparieren. Zwischendurch sah es so aus, als würde es mit dem essenziellsten aller Probleme besser, der fehlenden Chancengleichheit. Die IGLU-Werte zeigen nun, dass diese Wunde wieder aufgerissen ist. Aber was hat die Politik eigentlich dagegen gemacht? Wir schreiten über ein Gräberfeld an Reformen.
Nur, was macht die Politik? Ist es eine Komödie oder eine Tragödie? Das Projekt Startchancen, seit eineinhalb Jahren im Gespräch, hat seitdem keinen Cent an benachteiligte Schulen überwiesen. Stattdessen entstand eine Industrie von krawattentragenden Spindoktoren aus Bund und Ländern. Sie belehren einander auf dem Rücken von Hunderttausenden Chancenlosen – über Chancengleicheit. Sie zanken sich endlos. Und verschicken beinahe täglich Mitteilungen über ein Wolkenkuckucksheim namens Startchancen, das möglicherweise nie gebaut wird.
Schuld daran ist eine Kulturhoheit, die in Wahrheit ein Chaos an Zuständigkeiten von drei, manchmal sogar vier Ebenen ist: Bund, Länder, Kommunen und am Ende die Schulen sind in organisierter Verantwortungslosigkeit innig vereint. Chaos – so nennt es übrigens kein Revoluzzer, sondern der Multi-Minister, Jurist und preußische Hugenotte Thomas de Maizière, seines Zeichens Christdemokrat.
Wenn die verschachtelte wie verantwortungslose Schulpolitik ihre größten Baustellen nicht abschließen kann, dann braucht sie Hilfe. Hilfe aus der Zivilgesellschaft. Die Kulturhoheit benötigt ohnehin einen großen Schuss Bundesgeld. Jetzt sollte die Partizipation derer dazukommen, die sich schon lange über das Lernen für morgen Gedanken machen. Kurz: Es braucht jetzt einen Gesellschaftsvertrag für gute Bildung – und es sind zugleich Sofortmaßnahmen nötig. Denn fast 200.000 radebrechende Schüler können nicht warten, bis das Schulsystem modernisiert ist.
Als im Jahr 2007 das iPhone auf den Markt kam, ist der Weltmarktführer Nokia nicht sofort kollabiert. Aber sehr lange hat es nicht mehr gedauert. Heute tragen nur noch Connaisseure Nokia-Telefone, dieses Datum hat die Welt also verändert. Die Erscheinung von ChatGPT im November 2022 dürfte ein ähnlicher Moment für das Lehr-Lern-Modell der Schulen sein. Inzwischen sprießen adaptierte Anwendungen des Sprachmodells von OpenAI. Gerade hat Google seine ChatGPT-Konkurrenten von der Leine gelassen, der noch mehr kann. Kurzum: Die Möglichkeiten eines Schülers, sich über ein Thema zu informieren, einen informativen Text oder einen Essay zu verfassen, haben sich verändert. Und zwar so fundamental, dass die Prämissen von Schule, wie wir sie kennen, nicht mehr zu halten sind. Hausaufgaben, Hausarbeiten, Klausuren – das ist Schnee von gestern.
Dafür zeichnet die Kultusbürokratie übrigens ausnahmsweise mal nicht verantwortlich. Sie hat ihren Teil der Digitalisierung der Schulen nolens volens erfüllt. Für KI ist sie trotzdem zu langsam. Das ist keine Bosheit, sondern schlicht die Realität.
“Wir müssen uns endlich eingestehen, dass wir zumindest in der digitalen Welt die Werte eines friedvollen Miteinanders verloren haben.” Dieser Satz sagt viel über unsere Gesellschaft. Und er sagt alles darüber, was Silke Müller ihr vorwirft. Sie ist Schulleiterin, seit 2021 die erste Digitalbotschafterin des Landes und die Autorin von Wir verlieren unsere Kinder! Gewalt, Missbrauch, Rassismus – der verstörende Alltag im Klassenchat. Das Buch steht seit zwei Wochen auf Platz 6 der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Müller beschreibt in ihrem Erstlingswerk den Einfluss des digitalen Raums als Lebensrealität junger Menschen. Sie berichtet davon, was Jugendliche in den sozialen Medien beschäftigt, womit sie in Berührung kommen und wie sie das beeinflusst. Und sie kreidet an. Sie kritisiert die negativen Aspekte der digitalen Welt; einem Ort, an dem Unterhaltung und Information auf der einen Seite warten, ungefilterte Grausamkeiten, Dinge, die Kinderaugen nicht sehen sollten und Mobbing auf der anderen.
Weit ausführlicher kritisiert sie allerdings die Gesellschaft, die zulässt, dass es so weit kommen konnte. Dass Kinder im Internet mit Gewaltdarstellungen, Pornografie und Diskriminierung in Berührung kommen und Erwachsene darüber nicht zur Genüge Bescheid wissen. Dass Jugendliche Mobbing und Hass reproduzieren, weil sie sich auf das berufen, was ihnen vorgelebt wird.
Müller erklärt Begriffe und Netzwerke angemessen – TikTok zum Beispiel widmet sie ein ganzes Kapitel, schließlich ist das Netzwerk eines der beliebtesten unter Kindern und Jugendlichen. Sie stellt die realen Gefahren im digitalen Leben junger Menschen dar: Mobbing, Gewalt, Missbrauch – einzig der im Titel so stark betonte Rassismus wird im Buch nur sehr dünn beleuchtet.
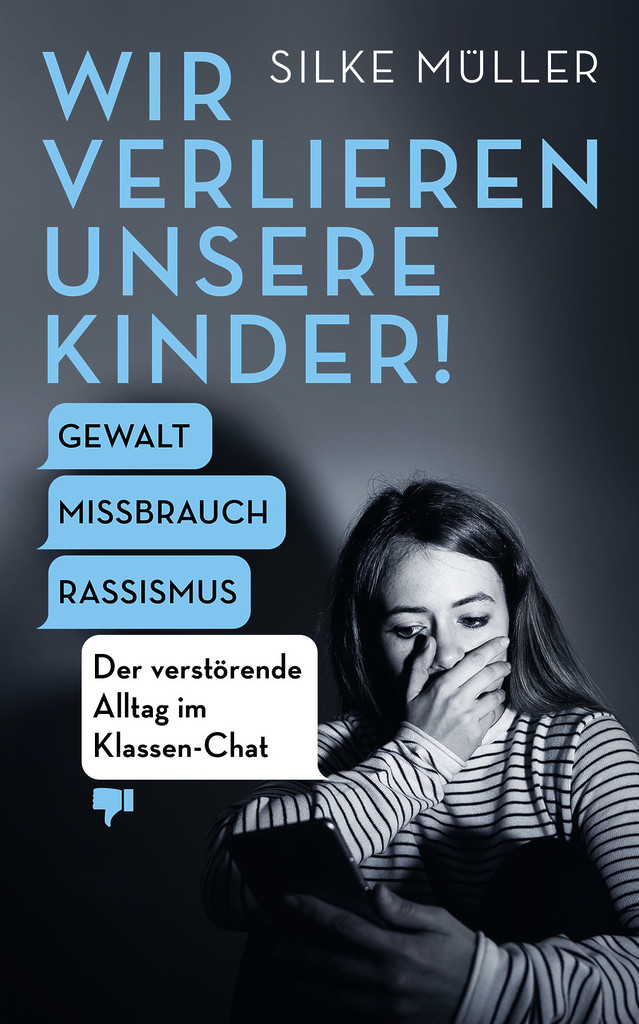
Das erste Kapitel des Buchs ist ein Brief, der sich an “alle, denen Kinder und Jugendliche wichtig sind” richtet. Genau so liest es sich auch, sogar eher wie ein Hilferuf, gespickt mit rhetorischen Fragen und jeder Menge ausdrucksstarken, fast schon theatralischen Metaphern. Die Tatsache, dass sich junge Menschen oft unvorbereitet im digitalen Raum bewegen, beschreibt die Schulleiterin wie folgt: “Wir schicken sie sprichwörtlich mit dem Kinderfahrrad auf eine viel befahrene Autobahn.” Auch als Müller schreibt, dass wir “Gefahr laufen, unsere Kinder im Heranwachsen zu verlieren“, klingt das zunächst dick aufgetragen. Doch dieser Eindruck vergeht in der weiteren Lektüre.
Denn spätestens im dritten Kapitel bringt Müller ihre eigenen Erfahrungen aus Schule und Unterricht ein. In acht Fällen aus dem Schulalltag schildert sie die Realität junger Menschen – und jedem Lesenden wird klar, dass ihre Warnungen nicht zu expressiv sind. Sie berichtet von Schülern, die Memes mit rechtsextremem Inhalt verschicken. Von jungen Menschen, deren Nacktfotos geleakt und herumgeschickt werden. Und sie berichtet von einem 14-jährigen Jungen, der seiner Mitschülerin Marihuana verkauft, wobei sie als Teil einer TikTok-Challenge mit einem Blowjob “bezahlt”. Die Fälle, die sie schildert, spiegeln Gewalt und Missbrauch wider. Sie ergreifen, machen Angst und betroffen. Sie lassen feststellen, dass Erwachsene viel zu wenig über die digitale Realität junger Menschen wissen.
Eben das ist Müllers Kritik. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der solche Dinge passieren. “Würde unsere Generation sich endlich intensiv mit der wirklichen Lebensumwelt der Kinder auseinandersetzen, würden wir endlich verstehen, dass unsere fehlende Werteorientierung im Netz nach und nach alle Mitmenschlichkeit verschwinden lässt”, schreibt Müller. “Wie sollen wir eine digitale Ethik vermitteln, wenn wir sie bei uns nicht in den Fokus stellen?”
Sie plädiert dafür, Medienkompetenz anders – und natürlich stärker – zu lehren als bisher. Eltern zum Beispiel sollen sich vermehrt mit den Erlebnissen ihrer Kinder im digitalen Raum auseinandersetzen, sich den Diskussionen ihrer Kinder stellen und offen über Themen wie Like-Zahlen, Privatsphäre, Fake-News und Co. sprechen. Schulen sollten Social-Media-Sprechstunden einführen, Kinder und Eltern in Diskurse miteinbeziehen und Lehrer zu Fachkräften für soziale Netzwerke werden.
Dass ein Buch wie das Silke Müllers erscheint, wurde Zeit. Sie ist eine überzeugte Digitalistin – und zugleich eine scharfe Kritikerin der fehlenden digitalen Ethik. Alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben – Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter, Verwandte – können aus Wir verlieren unsere Kinder! etwas mitnehmen: Ein Grundverständnis davon, dass Erwachsene hinterherhinken, wenn es um die digitale Lebensrealität junger Menschen geht. Und die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann.
Das niedersächsische Innenministerium hat den eigenen IT-Beauftragten korrigiert. Das Video- und Kommunikationssystem “MS Teams” von Microsoft wird nicht für Schulen zugelassen. “Das Land Niedersachsen plant derzeit weder eine Nutzung des Produktes Teams von Microsoft für Schulen, noch ist dieses bereits als Cloudlösung an diesen eingeführt”, ließ Innenministerin Daniela Behrens (SPD) auf Anfrage von Table.Media mitteilen. Damit widersprach das Haus dem eigenen “Chief Information Officer” Horst Baier. Der hatte nach einer Veranstaltung auf LinkedIn das Signal ausgesendet: Microsoft Teams sei jetzt an Schulen nutzbar.
Für Microsoft ist das Gerangel ein PR-Erfolg. Denn die niedersächsische Datenschutzbeauftragte, Barbara Thiel, griff in die Debatte an keiner Stelle ein. Ihre Behörde ist seit einiger Zeit mit dem Innenministerium und dem IT-Beauftragten über Microsoft im Austausch. In ihrem Haus aber bestand nach Informationen von Table.Media nie ein klarer Wille, dem Innenministerium in die Parade zu fahren. Man sei lediglich mit der Veröffentlichungspolitik von Baier nicht einverstanden, hieß es. Nach einer Veranstaltung mit dem Titel “Cloud-Lösungen für Kommunen und Schulen” hatte CIO-Officer Baier einen Post abgesetzt. “Letzten Freitag ging der Auftrag an Microsoft.” Natürlich hatte sich die verkürzte Information schnell verbreitet. Immerhin hatten die Datenschutzbeauftragten kürzlich einstimmig festgehalten: Microsofts M365 sei in seiner derzeitigen Konfiguration für Schulen “nicht datenschutzrechtskonform zu verwenden”; Niedersachsen stimmte zu. Dieser Konsens war mit Baiers PR und der Lähmung der Datenschutzbeauftragten hinfällig.
Im Umfeld des CIO hieß es sogar, es bestehe ein Nicht-Angriffspakt zwischen Innenministerium und Datenschutzbeauftragter. Die Rechtsauffassungen bezüglich der Nutzbarkeit von MS Teams seien unterschiedlich. Aber die Datenschutzbeauftragte werde nichts unternehmen. Für Schulen ist die entstandene Lage misslich – trotz des eindeutigen Statements. Auf einer großen Veranstaltung der kommunalen Spitzenverbände, welche die Schulträger repräsentieren, wird über die Vorteile eines Microsoft-Produktes räsoniert – und sein Kauf verkündet. Der Datenschutz greift aber nicht etwa gegenüber der mächtigen Innenministerin ein. Er wird aktiv, wenn eine Schule mit MS Teams arbeitet – und sich ein Elternteil beschwert. Das heißt: Der Datenschutz-Konflikt zwischen USA und EU findet auf dem Rücken der Schulleitungen statt.
Der Städtetag Niedersachsens teilte Table.Media als Co-Veranstalter mit, es treffe nicht zu, “dass die kommunalen Spitzenverbände etwas favorisieren würden.” Den Vortrag über Lernwolken für Schulen hielt auf der Veranstaltung allerdings die “Industry Advisor Public Sector” von Microsoft, Cornelia Schneider-Pungs. Der Titel des Microsoft-Referats: “Einsatzszenarien von Clouddiensten in Schulen: Praktische Anwendungsfälle und Referenzen”. Christian Füller
Es gibt jetzt GPTSchule, eine Version der leicht zugänglichen Künstlichen Intelligenz ChatGPT, die speziell für Schulen da ist. Der kleine Leipziger Schulsoftware-Anbieter “Schulverwalter” hat GPTSchule in einer Betaversion herausgebracht, die es Lehrern ermöglicht, den Textgenerator mit Schülern für den Unterricht zu nutzen. Die “Schulverwalter” um Geschäftsführer Julian Dorn lassen die Anfragen über einen Server laufen, der in Deutschland steht; Betreiber ist der deutsche Anbieter Netcup. Sie haben zudem eine Vereinbarung mit OpenAI getroffen, dass das Unternehmen weder personenbezogene Daten von Schülern verarbeitet noch die Eingaben der Schüler zum Training für ChatGPT nutzt. “Wir wollten ChatGPT zunächst für unsere Arbeit als Informatiklehrer nutzen”, sagt “Schulverwalter” Dorn, “aber die explosionsartige Entwicklung hat uns gezeigt, dass wir das als Unternehmen auch für andere Schulen anbieten sollten.”
Umsonst ist die sächsische ChatGPT-Adaption für Schulen allerdings nicht. Pädagogen können eine Million so genannter Token für knapp acht Euro kaufen. Zur Einordnung: Eine 90-minütige Doppelstunde mit ausführlicher Nutzung der KI durch eine Schulklasse verbraucht etwa 100.000 Token. Für eine kurze 20-minütige Unterrichtseinheit benötigen Lehrkraft und Lernende etwa 20.000 Token. Die Frage ist allerdings, wer das bezahlt. Eine Anfrage von Table.Media beim sächsischen Kultusministerium ergab, dass es in Sachsen bislang kein eigenes Schulbudget dafür gibt. Eine Kostenübernahme durch das Kultusministerium für das Angebot sei derzeit nicht vorgesehen. “Die Ausstattung von Schulen mit Lehr- und Lernmitteln ist grundsätzlich Angelegenheit der Schulträger“, sagte eine Sprecherin. Die “Schulverwalter” bezahlen ihrerseits an OpenAI eine Gebühr für die Nutzung der Schnittstelle zu ChatGPT. Der Dienst ist bundesweit nutzbar. Die “Schulverwalter” machten keine Angaben darüber, wie viele Nutzer sie bereits haben.
Der schulische Anwender bekommt bei GPTSchule einen pädagogischen Mehrwert. Lehrkräfte können zum Beispiel große Texte in GPTSchule hochladen. So lassen sich literarische Spielwiesen für gezielte Fragen der Lernenden an ChatGPT eröffnen. Bei OpenAI kann man nicht das ganze Opus “Romeo und Julia” ins Chat-Fenster eingeben. Bei GPTSchule geht das. “Dann können die Schüler auf Grundlage des Manuskripts gezielt zur Balkon-Szene von Romeo und Julia Fragen stellen oder Dialoge beginnen”, sagt Julian Dorn, der selbst noch als Informatiklehrer arbeitet. Gibt man beim Original ChatGPT die Balkonszene ein, so händigt das System zwar einen Dialog aus. Allerdings mit dem Hinweis: “Bitte beachten Sie, dass dies eine sehr vereinfachte Version des Dialogs ist. Die Originalszene ist viel ausführlicher.” Christian Füller
Das Bundesprogramm für IT-Administratoren, das die Kommunen bisher praktisch nicht angefasst haben, kommt endlich in Schwung. Das geht aus einer aktuellen Zusammenstellung der Kultusminister hervor, die Table.Media vorliegt. Danach sind von der halben Milliarde Euro für die Betreuer von Endgeräten und IT inzwischen 245 Millionen vertraglich gebunden. Das Sonderprogramm geht auf ein Gespräch zwischen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und der damaligen Kanzlerin Angela Merkel mit Kultusministern im September 2020 zurück.
Wie vielfach berichtet, war die Zusatzvereinbarung für IT-Administratoren der bisher am schlechtesten abgerufene Teil des “Digitalpakt Schule”. Die Zusatzvereinbarungen für Endgeräte von Schülern und Lehrern sind praktisch zu 100 Prozent ausbezahlt. Nun hat innerhalb eines Quartals auch der Zugriff auf die 500 Millionen Euro für so genannte Turnschuh-Administratoren intensiv zugenommen.
Der Grund für das schnelle Wachstum dürfte darin liegen, dass einige Bundesländer den Kommunen den Abruf der Mittel dadurch schmackhaft gemacht haben, dass sie langfristig mit in die Finanzierung gehen. Bayern etwa übernimmt ab 2025 die Hälfte der Kosten für professionelles IT-Personal an Schulen.
IT-Administratoren gelten als eine Schlüsselstelle der Digitalisierung der Schulen. Bisher machen vor allem Lehrer den Job, meist nebenher, mit einem Deputat von wenigen Stunden. Die 500 Millionen Euro waren deswegen ein wichtiger Impuls – dachte man. Allerdings gibt es bei dem Zuschuss ein Problem: Er ist lebensfremd konstruiert, wie ein Mitarbeiter eines kommunalen Spitzenverbandes Table.Media sagte.
“Das Problem ist nicht, dass die Schulträger das Geld nicht bräuchten, aber die Vorschriften für die Zusätzlichkeit sind zu kompliziert.” Wenn eine Kommune einen IT-Administrator für Schulen einstellt, dann kann sie ihn zudem mit den Bundesmitteln nicht lange bezahlen. Denn das IT-Zusatzprogramm war ausdrücklich einmalig. Um an allen deutschen Schulen einen IT-Experten zu beschäftigen, bräuchte man ungefähr 2 Milliarden Euro – jährlich. Christian Füller
Die Bildungsminister der G7-Staaten möchten die Digitalisierung an den Schulen stärken, die sozial-emotionalen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern fördern und die internationale Mobilität im Bildungsbereich erhöhen. Das geht aus der vierseitigen Abschlusserklärung hervor, die jetzt bei einem viertägigen Treffen der Bildungsminister sowie hochrangiger Vertreter der G7-Staaten in Japan veröffentlicht wurde. Es stand unter der Überschrift “Bildung nach der COVID-19-Pandemie”.
Für Deutschland nahmen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die saarländische Ministerin für Bildung und Kultur Christine Streichert-Clivot (SPD) teil. Sie ist zugleich erste Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz.
In dem Papier heißt es unter anderem, dass die Zusammenarbeit zwischen Schulen und ihrem gesellschaftlichen Umfeld ausgebaut werden soll. Kinder sollen “Erfahrungen in Natur, Kultur und Kunst” sammeln, um ihre sozial-emotionale Entwicklung zu fördern.
Zudem heben die G7-Minister hervor, dass die persönliche Interaktion zwischen Lehrern und Schülern in der Bildung auch künftig die größte Bedeutung haben wird. Ziel müsse es aber auch sein, Bildung zu fördern, “die digitale Technologien effektiv integriert, um den Präsenzunterricht zu unterstützen”. Dafür sollen Lehrkräfte mehr Kompetenzen im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien erlangen.
In den Blick nahmen die Bildungsminister auch die Zahl der Auslandsaufenthalte von Studierenden und Schülern. Die Mobilität soll wieder wachsen, denn durch die Corona-Pandemie ist sie stark zurückgegangen. Ein Fingerzeig ist dabei eine Studie vom Bildungsberatungsdienst weltweiser.de. Ihr zufolge nahmen 2019/-20 rund 16.000 Schüler an Austauschprogrammen teil, die mindestens drei Monate dauern. Ein Jahr später waren es dahingegen nur noch etwas mehr als 5.000.
Weniger einschneidend war zunächst die Entwicklung an den Hochschulen. Aber auch hier gab es nach Daten des Statistischen Bundesamtes bei der Zahl der deutschen Studierenden im Ausland allein 2020 einen Rückgang von 4.500 Personen gegenüber 2019. Die G7-Vertreter wollen diesen Trend umkehren und sogar mehr Mobilität im Bildungssektor als vor der Pandemie. Holger Schleper
99 Frauen waren unter den bundesweit besten Azubis, die die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Montag in Berlin auszeichnete. Insgesamt schafften es 216 Azubis aus 208 Berufen unter die Bundesbesten (Bestenliste zum Download). Der Frauenanteil lag bei 46 Prozent und stieg im Vergleich zur letzten Ehrung 2019 um 11 Prozent. Damit liegt er höher als der Gesamtanteil weiblicher Azubis an allen Auszubildenden 2022 in Industrie- und Handelsberufen.
“Exzellenz in der Ausbildung wird weiblicher“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Im Ländervergleich schnitt Bayern mit 44 Ausgezeichneten am besten ab, gefolgt von NRW (41) und Baden-Württemberg (33). Gleich drei Bundesbeste wurden bei Mercedes-Benz und Volkswagen ausgebildet. Je zwei Beste kamen etwa von Bayer und der Deutschen Post oder vom Blasinstrumente-Hersteller Buffet Crampon Deutschland und der Dr. Johannes Heidenhain Gmbh, einem Hersteller mechatronischer Messgeräte. Anna Parrisius

Als Netzwerkerin will Katja Hintze die zusammenbringen, die sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Ihr Ziel ist “ein Bildungssystem, das allen Menschen offensteht und allen eine individuelle und stärkenorientierte Perspektive eröffnet.” Mit dieser großen Vision gründete Hintze 2012 als eine von zehn Ehrenamtlichen die Stiftung Bildung, eine unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Organisation, die zahlreiche Programme im Auftrag von Bundesministerien betreut. Und zudem auch die Interessen von Spendenorganisation öffentlich vertritt.
Inzwischen ist Hintze seit zehn Jahren hauptberuflich Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Was die mittlerweile rund 140 Ehren- und Hauptamtlichen der Stiftung wollen, lässt sich schnell auf den Punkt bringen. Eine bessere Bildung für alle Kinder und Jugendliche.
Dafür setzen sie sich auf unterschiedlichen Wegen ein. Sie unterstützen bundesweit Bildungsengagement, indem sie Ehrenamtliche vor Ort vernetzen und die Engagierten qualifizieren. Die Stiftung entwickelt eigene Projekte. Sie hilft bei der Gründung von Kita- und Schulfördervereinen und deren Vernetzung. Und sie wirken als Lobbyistinnen und Lobbyisten aktiv auf die Politik ein.
Dazu zählt aktuell eine Debatte über die Entbürokratisierung der Förderpolitik des Bundes. “Wenn die Zivilgesellschaft durch Krisen wie Klima, Krieg, Fachkräftemangel oder Pandemien nun kontinuierlich gefordert ist, dann müssen wir gemeinwohlorientierte Hilfen zuverlässiger und einfacher finanzieren”, sagt Hintze. Was sie damit meint, klingt tatsächlich wie ein Schildbürgerstreich des Staates. Gerade erst habe ihre Stiftung erlebt, dass ein- und dasselbe Ministerium die Auszahlung einer Inflationsausgleichspauschale an Mitarbeiter von Projekten unterschiedlich beurteilt. Um Steuergeld gezielter und systematischer einzusetzen, brauche es daher eine Entbürokratisierung.
“Wir haben uns als junge NGO, als Non-Profit-Unternehmen immer wieder gefragt, warum Bundesministerien oder sogar Abteilungen im gleichen Ministerium Förderrichtlinien ganz unterschiedlich handhaben“, sagt Hintze. Um das zu ändern, haben 20 Stiftungen zusammen mit der Stiftung Bildung einen Brief an diverse Bundesministerien geschrieben – und am Montagabend eine öffentliche Anhörung veranstaltet.
Für Hintze gleicht kein Arbeitstag dem anderen – weil es im Bildungssystem so viele Stellschrauben zu drehen gelte. Ihre Arbeit beschreibt sie als vielschichtig bestehend aus Beratungsgesprächen, juristischen Gutachten, Projektförderungen, Netzwerkarbeit, bis hin zu Kampagnen.
Mit vielen Themen jonglieren, das konnte Hintze schon vor Gründung ihrer Stiftung. Nach dem Abitur machte die 52-Jährige eine Ausbildung zur Buchhändlerin, außerdem studierte sie Wirtschaftsethik, Kommunikationswissenschaften, Publizistik, Kunst und Diversity Studies. Acht Jahre lang arbeitete sie als Kooperations- und Business Development-Managerin in der freien Wirtschaft. “Was ich damals gelernt habe, kann ich heute in der Stiftung anwenden.”
Auch jetzt bemüht Hintze sich um eine bessere Zusammenarbeit und setzt sich beispielsweise dafür ein, dass engagierte Schüler und Schülerinnen, Eltern oder Lehrkräfte die Politik beraten. “Als Bildungsaktivistin- und lobbyistin bringe ich diese große Expertise des Bildungsengagements an die entsprechenden zuständigen Personen und Stellen.”
Es brauche viele, um gute Bildung für alle Kinder zu machen, sagt Hintze. Sie sei die, die Verbindungen schafft. Viel abgewinnen kann sie auch dem Vorschlag der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken nach einem Sondervermögen Bildung über 100 Milliarden Euro.
Motivation für ihre Arbeit nehme sie aus ihrem “Gerechtigkeitssinn und Sozialgefühl.” Sie selbst hat zwei erwachsene Töchter und einen Sohn. Schon lange vor Gründung der Stiftung Bildung rieb sie sich am deutschen Bildungssystem. Als begeisterte Pfadfinderin habe Hintze immer einen Vergleich zur Hand: Vieles, was ich sie dort an Teamgeist erlebt hat, würde sie auch gern im Bildungssystem sehen. Svenja Napp
Research.Table. Saudische Universitäten: Geld für Geltung: Um in Rankings gut dazustehen, sind Universitäten in Saudi-Arabien findig: Sie kooperieren mit viel zitierten Forschern aus anderen Ländern und wirken darauf hin, dass sie in einer wichtigen Datenbank als primäre Affiliation vermerkt sind. Das Spielchen machen immer mehr Wissenschaftler mit, auch deutsche. Mehr
Research.Table. Schwedens Universitätsräte unter politischem Druck: Quasi über Nacht halbierte das schwedische Wissenschaftsministerium die Amtszeit der aktuellen Universitätsräte. Wegen möglicher Spionagegefahr sollen Sicherheitsexperten in die Gremien berufen werden. Für die wissenschaftliche Community ist das ein klarer Eingriff in die Autonomie der Universitäten und Grund zum Widerstand. Mehr
24. Mai 2023, 16:30 Uhr, online
Bundestagsaussprache: Berufsbildungsbericht 2023
Der Bundestag berät erstmals über den Berufsbildungsbericht 2023 der Bundesregierung. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden. INFOS & LIVEÜBERTRAGUNG
25. und 26. Mai 2023, Berlin
Fachtagung: Dimension Digitalisierung
Das Forum Bildung Digitalisierung und die Kultusministerkonferenz wollen mit dieser Fachtagung den länderübergreifenden Austausch rund um Erfahrungen, Konzepte und Strategien zur Gestaltung von Bildung im Kontext der Kultur der Digitalität fördern. INFOS & ANMELDUNG
30. Mai 2023, 16:30 bis 19:00 Uhr, online
Diskussion: ChatGPT im Bildungsbereich
Erzeugt ChatGPT Chaos oder Chancen für Schulen und Hochschulen? In verschiedenen Formaten geht es bei diesem GEW-Event um Themen wie Urheberrecht und Quellenhinweise, pädagogische und didaktische Auswirkungen, aber auch um nicht kommerzielle Alternativen zu ChatGPT. INFOS & ANMELDUNG
31. Mai 2023, 17:45 Uhr, Berlin
Diskussion: Unsichtbare Arbeit und Diskriminierung – Gender, Diversity und ChatGPT
Wie durch KI-Anwendungen eine Neuverteilung von Arbeit stattfindet, ist zentrales Thema dieses Events. Fokus liegt darauf, welches Diskriminierungspotenzial die Neuverteilung mit sich bringt und welche neuen Perspektiven zu Gender und Diversity die Forschung zur Digitalisierung braucht. INFOS & ANMELDUNG
2. bis 4. Juni 2023, Bochum
Festival: Lehramtsfestival
Beim fünften Lehramtsfestival vom Verein Kreidestaub lautet das Motto Gemeinsam für eine nachhaltige Bildung der Zukunft. Workshops finden zu Themen wie Chancengerechtigkeit, kulturelle Bildung, alternative Sprachförderung, Suizidprävention und interkulturelle Kompetenz statt. INFOS & ANMELDUNG
5. Juni 2023, 15:00 bis 16:30 Uhr, online
Vortrag und Workshop: Digitalisierungsbezogene Kompetenzen, die Lehrer:innen benötigen!
Im Zuge der Veranstaltungsreihe Digitalisierung in der Lehrer:innenbildung präsentiert die Uni Leipzig einen Kompetenzkatalog für die Lehrerbildung, der zentrale digitalisierungsbezogene Kompetenzen für die schulischen Aufgabenfelder Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren zusammenträgt. INFOS & ANMELDUNG
5. bis 7. Juni 2023, Berlin
Festival: re:publica
Die re:publica, das Festival für die digitale Gesellschaft, liefert auch in diesem Jahr wieder Input für den Bildungsbereich. Keynotes tragen Titel wie Transformative Bildung: welche (digitalen) Lernräume brauchen wir für die sozial-ökologische Transformation? oder Medienbildung needs Cash – und was noch? MeetUp Medienpädagogik. INFOS & ANMELDUNG
