werden Sie sich mit einem Impfstoff der chinesischen Firma Sinopharm gegen Covid-19 impfen lassen? Spätestens jetzt liegt die Frage auf dem Tisch. Vor dem heutigen Impfgipfel der Bundeskanzlerin ist klar: Wenn die Europäische Genehmigungsbehörde zustimmt, will der Gesundheitsminister den Impfstoff zum Einsatz kommen lassen. Ungarn übrigens wartet darauf nicht, das Brüsseler Impfchaos der letzten Wochen veranlasst den EU-Nachbar bei Sinopharm Millionen Dosen zu bestellen.
Immer deutlicher wird: Der starre Blick auf die 50iger Inzidenz grenzt an Selbsttäuschung. Die Pandemie wird nicht so schnell verschwinden, langfristige Strategien müssen her. Ressentiments und Selbstbezogenheit werden uns dabei nur im Weg stehen. Längst zeigen die Länder Asiens, Demokratien genauso wie Autokratien, dass No-Covid-Strategien die Verbreitung des Virus erfolgreich eindämmen können. Das heißt: Konsequente regionale Lockdowns schon bei geringsten Fallzahlen, digitales Tracking der Ansteckungsketten. Wir werden uns asiatischen Lösungen öffnen müssen. Sie pauschal mit dem Argument abzulehnen, sie seien in unseren liberalen Gesellschaften nicht einsetzbar, wird uns nicht weiterführen.
Gestatten Sie mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Damit wir im Team von China.Table noch besser wissen, was Sie interessiert, nehmen Sie sich doch bitte wenige Minuten für einige Antworten an uns.
Ich danke Ihnen und wünsche eine erfolgreiche Woche,

“Ich denke, die chinesische Regierung hat sehr effizient gehandelt. Jetzt hat jeder einen Gesundheitscode, und die Verwaltungen arbeiten sehr schnell. Vor allem vorbeugende Maßnahmen sind verstärkt worden, und die Nachverfolgung ist sehr wissenschaftlich. Als wir beispielsweise vor einiger Zeit einen am Coronavirus Infizierten aus Shijiazhuang in Wuhan zu Gast hatten, wurde das Viertel, in der sich diese Person aufhielt, abgeriegelt und weiträumig getestet. Damit kann der Alltag woanders weiterlaufen.
In dem Ausstellungsraum, den ich betreibe, dürfen nur noch maximal zehn Menschen zusammenkommen. Generell jedoch ist eine Nervosität entstanden. Schließlich möchte niemand eine Situation entstehen lassen, dass sich Menschenmengen ansammeln. Ansonsten hat sich das Leben weitgehend normalisiert. Aber wir tragen immer und überall Maske. Selbst wenn wir im Büro in kleiner Runde eine Konferenz haben. Restaurants, Cafés und Bars sind wieder geöffnet, aber viele meiner Bekannten sind sehr vorsichtig und gehen nicht gern an Orte mit vielen Menschen. Die Leute achten sehr darauf, dass die Hygieneregeln eingehalten werden, denn sie wissen, dass ihre Freiheit sonst wieder eingeschränkt werden kann. Weil wir uns nicht mehr so häufig treffen, gibt es eine größere Distanz zueinander, die droht, sich noch auszuweiten. Das hat auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander.”
“Man muss der Regierung Chinas den Vorwurf machen, Informationen zurückgehalten zu haben. Damit trägt sie eine Mitverantwortung für die weltweite schnelle Ausbreitung des Virus und dessen verzögerte Bekämpfung. Auch die Gängelung von Journalist*innen, die über die Auswirkungen des Virus berichten wollten, wirft Fragen über die Motive Chinas auf. Dass Anfang Januar den Expert*innen der WHO zunächst die Einreise nach China untersagt wurde, zeugt davon, dass die Führung des Landes nicht an einer wissenschaftlichen Aufarbeitung des Ausbruchsgeschehens interessiert ist.
Auf der einen Seite scheint China bei der Bekämpfung des Virus erfolgreicher zu sein als viele anderen Staaten. Der Preis den die Bürger*innen auf der anderen Seite zu bezahlen haben, ist sehr hoch und in unseren Demokratien nicht vorstellbar: Die soziale Überwachung, die Gängelungen, die Einschränkungen der Freiheiten. Ein solches System wäre nicht vereinbar mit unseren Grundwerten. Die Corona-Krise, ungeklärte Menschenrechtsfragen, der Umgang mit ethnischen und religiösen Minderheiten, die unzulässige Einmischung in die Verwaltung Hongkongs, die Angriffe gegen die pro-demokratische Opposition – all diese Beispiel belasten natürlich das Verhältnis zwischen der EU und der Volksrepublik China. Gut ist, dass die Außenminister der Mitgliedstaaten der EU zusammen mit dem Außenbeauftragten Josep Borrell sich in letzter Zeit geeinter und selbstbewusster gegenüber China aufstellen.”
“Die sehr strenge Kontrolle in den ersten Monaten des Ausbruchs von Covid-19 war wohl die wichtigste politische Entscheidung, die für Chinas starke wirtschaftliche Erholung verantwortlich zeichnet. Infolgedessen ist die Binnenwirtschaft in den letzten drei Quartalen weitgehend auf das normale Niveau zurückgekehrt. Die chinesische Regierung gewährte auch Steuervergünstigungen und betroffenen Unternehmen einige Subventionen. Chinas Finanzpolitik ist jedoch nicht so mutig wie die vieler westlicher Länder. Doch ihre mutige Geldpolitik war diesmal die richtige Entscheidung. Die breite Geldmenge wuchs um zehn Prozent und damit wesentlich schneller als das nominale Wachstum de Bruttoinlandprodukts. Dies stand im Gegensatz zu der viel zu straffen Geldpolitik der vergangenen Jahre.”
“Chinas Wirtschaft wird am Ende des Jahres 2021 zehn Prozent größer sein als vor der Corona-Krise. Die amerikanische Wirtschaft wird ungefähr so groß sein wie vor der Krise. Europas Wirtschaft hingegen wird schrumpfen. Das heißt: Europa fällt zurück. Dennoch taugen Chinas Mittel gegen die Pandemie nicht unbedingt als Vorbild. Dort sind während des Lockdowns Leute nicht mehr aus ihren Wohnungen gelassen worden. Ihnen wurden die Türen verriegelt. Das wollen wir auf keinen Fall. Ein vorausschauender Lockdown und eine relativ zügige Intervention bringen aber schon viel. Kaum zu glauben, aber im Frühjahr haben hierzulande viele noch argumentiert: Es sei schlecht, Masken zu tragen. Dabei lagen längst Belege für ihre Wirksamkeit vor. In China hat man nicht lange diskutiert, ob man jetzt Masken tragen soll oder nicht.
Die Frage ist, wer entscheidet, dass eine Maßnahme sinnvoll ist. Kontroverse Debatten gehören zur Demokratie, sie sind eine Voraussetzung für die Akzeptanz der letztlichen Entscheidungen. In einem Föderalstaat wie Deutschland handeln dann die Bundesländer sogar unterschiedlich. Zentralstaaten wie Frankreich oder Großbritannien haben das übrigens nicht besser gelöst. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen: Wir sind eine ziemlich satte Wohlstandsgesellschaft. Die Menschen sind nicht so leicht bereit, ihre Gewohnheiten zu ändern. Das ist in weniger saturierten Ländern, die auch zuletzt noch sehr viel Wandel durchgemacht haben, anders.”
“Heute ist die Qualität der ostasiatischen Führung der globale Standard. In der Post-Covid-Welt werden andere Länder Ostasien als Vorbild ansehen. Nicht nur was den Umgang mit der Corona-Pandemie betrifft, sondern die Art und Weise, wie man dort regiert.”
“Zu Beginn der Corona-Pandemie in Wuhan wurde zuweilen scharfe Kritik an dem Krisenmanagement der Partei geäußert. Dabei handelte es sich nicht nur um regimekritische Akademiker und Aktivisten. In den Chor der Kritiker reihten sich unter anderem auch eine Poetin und Schriftstellerin, diverse Mediziner, eine führende Mitarbeiterin der Zentralen Parteihochschule sowie ein prominenter Immobilienunternehmer ein. Egal jedoch ob die Kritiker innerhalb oder außerhalb des Systems standen: Sie wurden alle in unterschiedlichem Maße für ihre Kritik von der Partei bestraft. Dies hat dazu geführt, dass in der Volksrepublik China für die Angehörigen von Opfern der Corona-Pandemie keine Möglichkeit besteht, ihre Wut und ihre Trauer öffentlich kund zu tun. Und auch wenn die Kommunistische Partei Chinas (KP China) es bislang verstanden hat die Bevölkerung zu disziplinieren, so waren die sozialen Kosten der Abschottungsmaßnahmen häufig enorm. Aus Wuhan erreichten uns zu Beginn der Corona-Pandemie Aufnahmen, die zeigten dass die Metalltüren von Wohnkomplexen verschweißt wurden, um Anwohner vom Verlassen ihrer Wohnungen abzuhalten.”
“Wir sollten das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen, und uns an den Preis erinnern, den (der verstorbene Arzt und Whistleblower) Li Wenliang und das ganze Land für den Ausbruch gezahlt haben, nachdem die Frühwarnung von Beamten unterdrückt wurde. Hier geht es nicht um das Recht, die Regierung zu kritisieren, sondern darum, Menschen zu inspirieren, Stellung zu beziehen.“
“Covid-19 ist vielleicht ein Wendepunkt für die chinesische Wissenschaft: der Punkt, an dem ihre Arbeit wirklich globale Reichweite hatte und sie den Wert des Teilens erkannt haben.”
Zusammengetragen von Marcel Grzanna, Felix Lee, Amelie Richter, Frank Sieren, Ning Wang
02.02.2021, 16:00-18:00 Uhr (GMT)
Studienvorstellung, AHK China Business Confidence Survey Mehr
02.02.2021, 6:30-7:30 pm (PST)
Annual Gala, Washington State China Relations Council 40th Annual Gala – Resetting U.S.-China Relations Mehr
03.02.2021, 8:30-9:30 Uhr
Vortrag, Chinaforum Bayern TikTok & Douyin – von der Teenie-App zum Marketing-Tool. Anmeldung
03.02.2021, 20:00-21:30 Uhr
Vortrag mit Diskussion, European Chamber of Commerce in China Biden Administration´s China Policy and its impact on EU-China relations Anmeldung
05.02.2021, 10:00-11:30 Uhr
Vortrag, IHK Köln China-Situation und Perspektiven aus Sicht deutscher Unternehmen. Anmeldung
05.02.2021, 10:00 Uhr
Diskussion, Chinakompetenzzentrum TU Berlin Trends in Chinese and European political elites Mehr
Chinas Belt and Road Initiative gilt als Jahrhundertprojekt. Die chinesische Führung kleidet es in Superlative: Die neue Seidenstraße soll Kontinente mit neuer Infrastruktur verbinden, und in die Arktis und den Cyberspace vordringen. Kritiker sehen hingegen imperiale Bemühungen Chinas und eine Schuldenfallendiplomatie. China würde “listig und strategisch in die Zukunft marschieren” und dutzende Länder in die Abhängigkeit treiben.
In seinem Buch “The Emperor’s New Road – China And The Project Of The Century” zeigt Jonathan E. Hillman, Direktor des Reconnecting Asia Projekts der Denkfabrik Center for Strategic & International Relations: Die Neue Seidenstraße muss kritisch begleitet werden. Doch ein zentral gesteuerter Masterplan, um sich die Welt untertan zu machen, sei nicht zu erkennen. Vielmehr bestünden divergierende Interessen, die den Erfolg für die Neue Seidenstraße gefährden. Chinesische Unternehmen – darunter sieben der zehn größten Bauunternehmen der Welt – nutzten die Neue Seidenstraße, um ausländische Märkte zu erobern. Sie kümmerten sich weder um die finanziellen Folgen für die Gastländer, noch um den Rat chinesischer Botschaften, von unprofitablen Projekten abzusehen.
Innerhalb Chinas stritten das Handelsministerium und das Außenministerium um Einfluss auf die Seidenstraße – ersteres mit ökonomischen, letzteres mit politischen Interessen. Und Chinas staatliche Banken nutzten die Neue Seidenstraße, um Exporte zu finanzieren. Die sehr ineffiziente Kreditvergabe der Banken innerhalb Chinas lasse nichts Gutes für den Projekterfolg erahnen, so Hillman. Hinzu kommt: In den Partnerländern regieren nicht selten Autokraten, die glanzvolle Großprojekte nutzen, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren und ihr Prestige zu steigern. Nicht selten sind die von ihnen vorangetriebenen Projekte unprofitabel.
Durch all diese Faktoren trage China maßgeblich zur Erhöhung der Schulden seiner Partnerländer bei. Doch dahinter stecke kein Plan, um Infrastruktur in chinesischen Besitz zu übertragen. Das häufig bemühte Beispiel für eine vermeintliche Schuldenfallendiplomatie – der Hafen Hambantota in Sri Lanka – sei viel mehr Beleg für schlechte Planungen und divergierende Interessenlagen.
Sri Lankas politisch Verantwortliche trieben das teure Hafenprojekt voran, ohne einen größeren Entwicklungsplan für das Land zu verfolgen und obwohl der Hafen in der Hauptstadt Colombo nicht ausgelastet und besser gelegen war. Chinesische Bauunternehmen sahen die Möglichkeit eines schnellen Profits. Und Verantwortliche in China stoppten das unprofitable Hafenprojekt aus Angst vor Prestigeverlusten nicht. Durch Sri Lankas Überschuldung übernahm China den Hafen für eine Pachtdauer von 99 Jahren. Doch es sei falsch, das als Sieg Chinas zu deuten und zu glauben, China gewinne immer, auch wenn die Neue Seidenstraßen-Projekte fehlschlagen, so Hilmann. Der Hafen Hambantota werde vielmehr zu einer Warnung, was beiden Projektpartnern bei schlechter Projektplanung passieren könne.
Eine Weltbank-Analyse ergab, dass bei einem Drittel bis 50 Prozent aller Transportprojekte der Seidenstraße in Eurasien die Kosten die Einnahmen überstiegen. Auch wage sich China in viele Märkte vor, die andere Staaten eher meiden. Viele Seidenstraßenprojekte werden mit korrupten Regimen und Staaten mit sehr schlechtem oder ohne Kreditrating abgeschlossen. Dadurch steige für China das Risiko von Kreditausfällen.
Als Beispiel nennt Hillman Pakistan. Dort scheine China die Fehler vorheriger Großmächte zu wiederholen: Pakistan habe keine stringenten Entwicklungsplan. China dränge nicht auf Reformen, die Hillman jedoch als Grundlage für den Erfolg von Infrastrukturprojekten ansieht. Chinesische Unternehmen, die Neue Seidenstraßen-Projekte in Pakistan durchführen, beklagen sich hingegen über Korruption, Verzögerungen eine schlechte Zahlungsmoral der pakistanischen Partner. Doch nicht immer sind Chinas Partner korrupt oder der Großmacht ausgeliefert. Für südostasiatische Staaten zeigt Hillman auf, dass es kleineren Staaten häufig gelänge, große Partnerländer wie Japan und China gegeneinander auszuspielen und somit gute Kredit- und Projektbedingungen zu verhandeln.
Hillman zeigt, dass China mit vielen Neue Seidenstraßenprojekten Überkapazitäten aufbaue. Es drängt sich der Eindruck auf, China gehe bei der Seidenstraße ähnlich vor wie im eigenen Land. Das chinesische Wachstum wird auf die Partnerländer projiziert. Bei überdimensionierten Projekten wird angenommen, sie würden in Zukunft profitabel werden. Doch das scheint ein Trugschluss und führt zu einem hohen Schuldenrisiko.
Auch drohten China Reputationsverluste, wenn mangelhafte Arbeits- und Umweltstandards zu Konflikten im Partnerland führen. Hillman nennt den Hafen von Piräus, der zwar unter chinesischer Führung äußerst profitabel sei. Nach der Übernahme sanken jedoch die Arbeitsstandards, was zu Unmut bei griechischen Arbeitern führte.
Hillman schlussfolgert, dass China aus Fehlschlägen lernen und die Neue Seidenstraße zu einem durchschlagenden Erfolg werden könne, wenn China multilaterale Projekte starte und höhere Standards für die Kreditvergabe und Projektauswahl anlege. Es sei jedoch wahrscheinlicher, dass Chinas “Fehler bei der Seidenstraße die Welt erschüttern”, schreibt Hillman. Denn Chinas Neue Seidenstraßen-Partner müssten kontinuierlich hohes Wachstum erzielen, um die hohen Schulden zurückzahlen zu können.
Leider geht Hillmans Analyse nicht darauf ein, wie sich ein massiver Kreditausfall auf Chinas eigene Volkswirtschaft und in Folge auf die Weltwirtschaft auswirken würde. Was man in Hillmans Buch auch vermisst, ist ein Blick auf erfolgreiche Seidenstraßen-Projekte und ob China hieraus Rückschlüsse zieht. Ebenso wenig kommt bei Hillman die massive Finanzierung von fossilen Energieprojekten Chinas im Ausland vor und welche zukünftigen Konflikte sich dadurch abzeichnen könnten. Trotz dieser Mängel, gibt Hillmans Buch zahlreiche spannende Denkanstöße, die in der deutschen Debatte über die Neue Seidenstraße allzu häufig übersehen werden.
Nach Jahren aggressiver Expansion ist der südchinesische Reisekonzern und Großinvestor HNA insolvent. Ein Gericht in Hainan habe eine Restrukturierung angeordnet, teilte HNA auf WeChat mit. Die Gruppe sei nicht mehr in Lage, ihre Schulden zu bedienen. Wie hoch die Verbindlichkeiten genau sind, muss sich noch zeigen. Die jüngste Verfügbare Information stammt aus dem Jahr 2019, als das Unternehmen seinen Schuldenstand mit 707 Milliarden Yuan (90 Milliarden Euro) beziffert hat. Im Laufe der Coronavirus-Krise dürfte diese ohnehin hohe Summe noch deutlich angestiegen sein. Noch 2019 haben sich zahlreiche staatliche Banken, darunter die Bank of China, die Agricultural Bank und die ICBC, noch einmal für einen großen Stützungskredit zusammengetan. Jetzt ist die Geduld des Staates und seiner Finanzakteure am Ende. Die überlebensfähigen Tochterfirmen sollen demnächst selbstständig werden.
Die bekannteste Marke der Gruppe ist die Fluglinie Hainan Airlines, die unter deutschen Reisenden als Anbieter einer wichtigen Direktverbindung von Berlin nach Peking bekannt ist. Die HNA-Gruppe ist in Deutschland vor allem als Käufer des Flughafens Hahn bekannt. Von 2017 bis 2019 war sie auch Aktionär der Deutschen Bank und Kurzzeit-Arbeitgeber des Ex-Ministers Philipp Rösler. Das Unternehmen fiel seit der Jahrtausendwende durch seine im Laufe der Zeit immer teurere und aggressivere Expansionsstrategie auf. Mit Mitteln chinesischer Banken und internationaler Anleiheinvestoren wollte es ein weltweites Touristik-Konglomerat zusammenkaufen.
HNA erwarb beispielsweise hohe Anteile an der Hilton-Hotelkette sowie an den Flugdienstleistern Swissport und Gategroup. Insgesamt haben Wirtschaftsdienste Übernahmen im Wert von 50 Milliarden Dollar registriert. Analysten bewerteten jedoch von Anfang an kritisch, dass der Konzern sich nicht auf sein Kerngeschäft konzentrierte, in dem die zugekauften Firmen langfristig vielleicht auch hätten zusammenspielen können. Stattdessen hat das Management auch bei vielen Beteiligungen zugegriffen, die mit Reisen nichts zu tun haben – beispielsweise bei der Deutschen Bank. Die chinesische Gruppe kauft auch dem New Yorker Unternehmer Anthony Scaramucci seine Finanzfirma ab, damit dieser als Sprecher von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus einziehen konnte. Beide Teile des Geschäfts stellen sich als spektakuläre Fehleinschätzungen heraus. Scaramucci scheiterte in seiner Rolle als Sprecher, HNA konnte mit den Anteilen nichts anfangen.
Vor drei Jahren fing es bereits an zu rumoren. Es mehrten sich die Gerüchte, dass HNA bei mehreren Banken und Streckung von Darlehen nachgesucht hatte und immer höhere Kreditlinien benötigte, um seine Altschulden umzuwälzen. Manager der Ningbo Commerce Bank wurden beispielsweise misstrauisch, als sie merkten, dass HNA die gleichen Wertpapiere als Sicherheiten für zwei unterschiedliche Kredite eingereicht hatte. Seitdem rissen die schlechten Nachrichten nicht ab. Corona hat der Firmengruppe nun den Rest gegeben. Die Insolvenz kommt daher wenig überraschend.
Der Airport-Betreiber Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH teilte am Samstag mit, die Insolvenz der Muttergesellschaft habe keine Auswirkungen auf den deutschen Standort. “An unserer Zusammenarbeit mit allen Airlines, Kunden, Behörden und Partnern wird sich nichts ändern.” Das Land Rheinland-Pfalz wolle mit dem chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt Kontakt aufnehmen, um Näheres zu erfahren, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Die Marke Hainan Airlines wird voraussichtlich erhalten bleiben, schließlich ist sie im Luftverkehrsmarkt gut eingeführt. Doch wenn der Mutterkonzern ausgerechnet in der größten Krise des Luftverkehrs seit dem zweiten Weltkrieg pleitegeht, ist eine schwere Zeit garantiert. Die örtliche Regierung scheint derzeit auch keine schützende Hand über das Unternehmen zu halten. Im vergangenen Sommer hat sie die Gründung der örtlichen Konkurrenzfluglinie Sanya International Airlines eingefädelt.
Was für ein Jahr für Tesla und Elon Musk: Um 695 Prozent ging es 2020 mit dem amerikanischen E-Autobauer an der Börse nach oben. Gründer Musk löste dank dieser außerordentlichen Performance Amazon-Chef Jeff Bezos als reichsten Mann der Welt ab, obwohl auch der nicht gerade zu den Verlierern der Corona-Krise zählt.
Tesla hat Erfolg, aber Investoren blicken längst nicht mehr nur auf den amerikanischen Vorreiter. Noch mehr Geld verdienten sie in den vergangenen zwölf Monaten mit dem chinesischen Tesla-Angreifer Nio. Der Marktwert des erst vor sechs Jahren gegründeten E-Auto-Startups schoss im gleichen Zeitraum um mehr als 1000 Prozent in die Höhe. Mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt etwa 80 Milliarden Euro ist das Unternehmen von Gründer William Li damit wertvoller als Daimler oder BMW.
Zwar verkaufen Nio und andere chinesische E-Startups noch deutlich weniger E-Fahrzeuge als die deutschen Luxus-Hersteller Verbrenner. Das Tempo der jüngsten Expansion zeigt aber, wo sie in einigen Jahren stehen könnten.
Nio verdoppelte die Zahl seiner ausgelieferten Fahrzeuge im gerade abgelaufenen Jahr auf knapp 44.000. Der heimische Konkurrent Xpeng verdoppelte seinen Absatz ebenfalls auf rund 27.000 E-Autos. Und Li Auto, der dritte an der New Yorker Börse gelistete chinesische Tesla-Jäger, schaffte in seinem ersten Produktionsjahr den Verkauf von über 32.000 Fahrzeugen.
Nährboden für die chinesische E-Autoindustrie ist ein milliardenschwerer Plan der Regierung in Peking, die schon seit Jahren auf einen massiven Ausbau der Elektromobilität setzt. Hohe Subventionen und gleichzeitige Beschränkungen für Benziner auf den Straßen haben dazu beigetragen, dass dem E-Auto in China schneller der Weg bereitet werden konnte, als im Westen. Zum einen profitierten davon die etablierten chinesischen Hersteller, von denen die meisten bereits seit Jahren eine ganze Palette von E-Modellen im Angebot haben. Die größten Innovationstreiber aber sind junge Firmen wie Nio, die ausschließlich auf E-Autos setzen – oft auf Premiumfahrzeuge.
Ähnlich wie bei Tesla stand auch Nios Existenz schon häufiger auf der Kippe. Als das Shanghaier Startup 2018 sein erstes Modell, den SUV ES8 auf den Markt brachte, waren Auto-Experten noch nicht überzeugt. Technologisch, so der Schluss, hinke das Fahrzeug dem US-Vorbild Tesla um Jahre hinterher. Auch geriet Nio in finanzielle Turbulenzen, weil viel Geld für aufwendiges Marketing ausgegeben wurde, die Verkaufszahlen aber anfangs hinter den Erwartungen zurückblieben.
Die Phase der Kinderkrankheiten scheint überwunden, wie sich Anfang Januar beim “Nio Day” in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zeigte. Wie in jedem Jahr füllte Nio ein ganzes Stadion mit Fans, vor denen es seine neuesten Innovationen präsentierte. Höhepunkt war die Vorstellung der neuen Luxus-Limousine ET7, die 2022 auf dem Markt kommen soll. Auto-Experten bescheinigten dem Wagen nicht nur ein schickes Design, sondern eine äußerst überzeugende technische Ausstattung. Als weltweit erstes Serienfahrzeug überhaupt soll der ET7 mit einer Feststoffbatterie ausgeliefert werden, die eine größere Reichweite ermöglicht.
Das kleinste zur Auswahl stehende Akkupaket soll Reichweiten von rund 500 Kilometern ermöglichen. Deutlich interessanter dürften für die meisten Kunden jedoch die beiden größeren Akkupakete mit 100 kWh und sogar 150 kWh (als Feststoffbatterie) sein, mit denen der Nio ET7 Reichweiten von 700 bis 1000 Kilometern ohne Nachladen schaffen soll. Erstmals soll mit dem ET7 ein Fahrzeug über Technik verfügen, die autonomes Fahren ermöglicht.
Branchenbeobachter überzeugt an Nio, dass es selbstbewusst andere Wege geht. So bietet der Konzern seinen Kunden etwa ein abweichendes Lade-Konzept an. Im ganzen Land werden derzeit so genannte Batterie-Wechselstationen errichtet. Die Stationen sind etwa so groß wie eine Doppel-Garage und strategisch in der Nähe von Autobahnen und Schnellstraßen positioniert.
In den Hightech-Containern, die im ganzen Land verteilt werden sollen, läuft alles automatisch ab: Eine Hebebühne hievt das Auto etwa einen halben Meter in die Höhe. Von unten nähert sich auf einer Schiene ein Roboter, der unter dem Fahrzeug die Schrauben des hunderte Kilo schweren Akkus löst und ihn entfernt. Danach setzt die Maschine eine frische Zelle ein, das Auto senkt sich wieder. Innerhalb einer Stunde lädt die Station den leeren Akku auf und setzt ihn später einem anderen Fahrzeug ein.
Bei seiner großen Produktpräsentation in Chengdu kündigte Nio eine weitere Verfeinerung der Technologie an. So sollen die Fahrzeuge künftig selbständig per Knopfdruck in die Stationen fahren können, müssen also nicht mehr vom Fahrer selbst eingeparkt werden. So würde der Komfort erhöht und gleichzeitig wertvolle Zeit gesparrt.
Anders als die etablierten Autokonzerne setzt Nio außerdem viel stärker darauf eine Community für seine Kunden aufzubauen. Regelmäßig werden Fan-Treffen veranstaltet. Die Fahrzeuge werden nicht in schlichten Autohäusern verkauft, sondern in Glas-Tempeln, die eher an einen Apple Store erinnern. Ein kleines Café gehört zur Grundausstattung der über 50 Nio Houses in China.
Nio werde bei Verbrauchern als Marke bevorzugt, “weil es den Fokus auf Premiumdienste nach dem Kauf legt”, meint der Deutsche Bank-Analyst Edison Yu. Der Branding-Faktor sei einer der am meisten unterschätzten Askpekte des jüngsten Erfolgs. Mit seiner neuen Limousine werde Nio aller Voraussicht nach gegenüber Tesla “viel wettbewerbsfähiger”, auch wenn es bei der Software-Entwicklung der Chinesen noch Luft nach oben gebe. “Im Allgemeinen sind chinesische Kunden (insbesondere jüngere) viel offener geworden, lokale Automarken auszuprobieren”, sagt Yu.
Nio jedoch denkt schon über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Geplant ist, dass in der zweiten Jahreshälfte erste Fahrzeuge in Europa verkauft werden. Anders als frühere Versuche chinesischer Hersteller, die im Zeitalter des Verbrennungsmotors mit mehreren Expansionsversuchen gnadenlos gescheitert sind, werden Nio bessere Erfolgsaussichten eingeräumt. Gregor Koppenburg / Jörn Petring
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schließt auch eine Nutzung russischer und chinesischer Covid-Impfstoffe in Deutschland nicht aus. Kurz vor dem Impfgipfel an diesem Montag sagte Spahn der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”: “Wenn ein Impfstoff sicher und wirksam ist, egal in welchem Land er hergestellt wurde, dann kann er bei der Bewältigung der Pandemie natürlich helfen”. Gegen den Einsatz von chinesischen und russischen Impfstoffen spreche “nichts”, wenn sie eine “reguläre Zulassung nach europäischem Recht” hätten. Zuvor hatte sich auch Bayerns Ministerpräsident Marcus Söder (CSU) offen für den Einsatz russischer und chinesischer Impfstoffe in Deutschland gezeigt.
Die ungarische Regierung hatte am Freitag den Einsatz des Corona-Impfstoffes von Sinopharm zugelassen und bei dem chinesischen Hersteller fünf Millionen Dosen bestellt. Zuvor hatte Ministerpräsident Victor Orban eine Verordnung erlassen, die den Einsatz von Impfstoffen in Ungarn auch dann möglich macht, wenn keine offizielle Zulassung der ungarischen Arzneimittelbehörde vorliegt. asi
Der Allianz-Gruppe ist ein wichtiger Schritt in den chinesischen Vermögensverwaltungsmarkt gelungen. Die Regulierungskommission für Banken und Versicherungen (China Banking and Insurance Regulatory Commission) gab ihre Genehmigung für die vorbereitende Gründung der Allianz Insurance Asset Management (Allianz IAMC), wie aus einer Meldung der Allianz-Gruppe hervorgeht. Die Allianz IAMC wird nach eigenen Angaben die erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Versicherungs-Asset-Management Gesellschaft in China sein. Vor Ort soll ein Investmentmanagement-Team aufgebaut werden, “um die globalen Vermögensverwaltungsbedürfnisse der Kunden besser zu erfüllen” und Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen für Allianz-Schwester-Unternehmen und Drittkunden aus der Versicherungsindustrie anzubieten. Der Markteintritt in China wurde durch Chinas Öffnung im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen ermöglicht. nib
Großbritannien will dem transpazifischen Handelsabkommen CPTPP beitreten, kündigte die Ministerin für internationalen Handel, Liz Truss, nach Meldungen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa an. Der Freihandelszone Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) gehören bislang elf Staaten an. Sie umfasst unter anderem die Märkte Australiens, Kanadas, Chiles, Mexikos und Japans. China ist kein Mitglied des Abkommens. Die CPTPP-Vereinbarung war als Antwort auf den Austritt der USA aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aus der Taufe gehoben worden. CPTPP umfasst einen Binnenmarkt mit etwa 500 Millionen Menschen, in dem 13 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet wird. asi
Nach Informationen der FAZ hat die chinesische Regierung scharfe Kritik an einem neuen Einreiseprogramm Großbritanniens für Hongkonger geübt. Infolge des von China verordneten “nationalen Sicherheitsgesetzes” für Hongkong hatte London bereits im Sommer letzten Jahres Maßnahmen angekündigt. Die Johnson-Regierung ermöglicht Hongkonger Bürgern nun die Einreise für bis zu fünf Jahre. Danach ist ein Antrag auf britische Staatsbürgerschaft möglich. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, Großbritannien ignoriere “die Tatsache, dass Hongkong schon vor 24 Jahren zu China zurückgekehrt ist”, so die FAZ. Peking droht mit Gegenmaßnahmen und erachtet das Einreiseprogramm als Verstoß gegen die “Gemeinsame Erklärung” zwischen Großbritannien und China von 1984. Der britische Premier Boris Johnson sagte: “Wir stehen für Freiheit und Autonomie ein – Werte, die sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Hongkong hochgehalten werden.” Man erwarte, dass ungefähr 300.000 Hongkonger die Einreisemöglichkeit wahrnehmen. nib

Einen Ratschlag, den Henry Kissinger Joe Biden mit auf den Weg gegeben hat, ist es, alles zu tun, um einen Krieg mit China zu vermeiden. Dieser würde eine Katastrophe vom Ausmaß des ersten Weltkrieges bedeuten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Konflikts zwischen den USA und China und welche Rolle soll Europa einnehmen?
Als Präsident Nixon und Henry Kissinger Anfang der 1970er Jahre vor dem Hintergrund des Kalten Krieges die Annäherung an China betrieben, stand das Land vor dem Abgrund: der Anteil am globalen Bruttosozialprodukt lag bei unter 5 Prozent, im Welthandel war China ein Zwerg, es war international vollkommen abgeschottet und technologisch ein hoffnungslos rückständiger Fall.
Die von Deng Xiaoping 1978 initiierten Reformen machten das Land binnen einer Generation zur weltweit zweitgrößten Wirtschaftsmacht. Heute ist das von Präsident Xi Jinping ausgegebene Ziel, die USA bis 2049 ein- wenn nicht gar zu überholen, China seinen gerechtfertigten Platz im Zentrum der Weltbühne zu geben und die Erneuerung des chinesischen Traums zu verwirklichen.
Mit der wirtschaftlichen Entwicklung ging ein Erstarken der militärischen Kraft einher, das China zu geostrategischen Initiativen veranlasst hat, die aus chinesischer Sicht vollkommen legitim sind, von den USA jedoch als Bedrohung seines Status angesehen werden. Peking beansprucht weite Teile des südchinesischen Meeres, hat eine Militärbasis in Dschibuti aufgebaut, die zwar noch klein ist, aber als Basis für eine weitere Expansion gilt und es hat mit der Belt and Road Initiative Abhängigkeiten erzeugt, aufgrund derer die eigene Vision der Welt unterstützt wird.
Die heutige Auseinandersetzung zwischen den USA und China spiegelt laut dem Historiker Graham Allison viele geschichtliche Konflikte zwischen Großmächten wider. Allison hat über die letzten 500 Jahre 16 Fälle untersucht, in denen eine neu aufstrebende Macht den Status Quo einer existierenden Macht in Frage stellte. In zwölf dieser Fälle kam es zum Krieg und in nur vier Fällen konnte ein solcher vermieden werden.
China sieht sich als die zweitgrößte und in absehbarer Zeit sogar als größte Wirtschaftsmacht der Welt berechtigt eine Neuausrichtung der internationalen Ordnung zu fordern, die seinen Kerninteressen Rechnung trägt. Es ist in einen Wettbewerb der Systeme getreten und will die eigene Gesellschaftsordnung einbringen. Gleichzeitig sucht es Revanche für die Erniedrigung, die dem Land durch die Kolonisierung im 19. Jahrhundert zugefügt wurde und es ist mangelndem Respekt gegenüber in einem Maße sensibel, das vielfach Erstaunen hervorruft.
Die USA werfen China Undankbarkeit für die Unterstützung beim wirtschaftlichen Aufbau vor und behaupten, dass Peking die Weltordnung verändern will, um autoritäre Ziele und seinen Hegemonieanspruch zu verwirklichen. Außerdem investiere China große Summen in die Entwicklung erstklassiger Streitkräfte, um die USA zu übertreffen. Somit stelle es eine erhebliche Bedrohung für Frieden und Freiheit in der Welt dar.
Allisons Forschung zeigt: So unwahrscheinlich und unerwünscht ein militärischer Konflikt auch sein mag und so katastrophal seine absehbaren Konsequenzen – dies konnte in der Vergangenheit einen Krieg nicht verhindern und das dürfte auch heute noch gelten. Voraussetzung für einen militärischen Konflikt sind nicht die Intentionen der aufkommenden Macht. Es ist die potentielle Bedrohung für die etablierte Macht und die Unvereinbarkeit dieser Bedrohung mit dem Status Quo. Es braucht für den Ausbruch eines Krieges keine ‘großen Anlässe’. Meinungsverschiedenheiten auf Nebenschauplätzen sind oft genug eskaliert und in einen Krieg gemündet.
Zu den wichtigen geostrategischen Herausforderungen unserer Zeit gehört der Druck, den das Aufkommen einer Nation mit einer Jahrtausende alten Zivilisation und einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen auf die etablierte internationale Ordnung ausübt. Noch nie ist ein Land so schnell in so viele Dimensionen der Macht vorgestoßen und zwingt mit seiner schieren Größe der Welt ein neues Gleichgewicht auf. Dabei ist davon auszugehen, dass das Reich der Mitte das Selbstverständnis und die Ambition hat, nicht nur in Asien, sondern auch weltweit die führende Nation zu sein und die USA in dieser Rolle zu ersetzen.
Aus historischer Sicht ist ein militärischer Konflikt zwischen beiden Mächten nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlicher als ein friedlicher Ausgang. Es wird im laufenden Jahrzehnt von entscheidender Bedeutung sein wie die USA und China das Spanungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Kooperation ausleben. Ein Unterschied zur Historie sind die globalen Probleme unserer Zeit. Die daraus resultierenden Interdependenzen und das Vertrauen, das bei der gemeinsamen Suche nach Lösungen entstehen sollte, sind positive Faktoren. Eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung eines Krieges kommt den Kommunikationslinien zwischen den Regierungen beider Länder zu. Hier muss Präsident Biden für belastbare Strukturen sorgen. Europa muss es vermeiden, zum Spielball der Mächte zu werden. Es steht unzweideutig an der Seite der USA und würde in einen Krieg mit hineingezogen. Die Rolle Europas besteht darin, auf der Grundlage einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit seinen gebührlichen Platz zwischen den USA und China einzunehmen, seine guten Beziehungen zum Reich der Mitte einzubringen und als Vermittler zwischen den Kontrahenten zu agieren.
Dr. Gerhard Hinterhäuser ist Partner bei der Unternehmensberatungsgesellschaft Bingmann Pflüger International. Er lebt in Asien und Deutschland und war von 2006 bis 2014 Mitglied der Geschäftsführung der staatseigenen Firma PICC Asset Management Co. Ltd. in Shanghai.
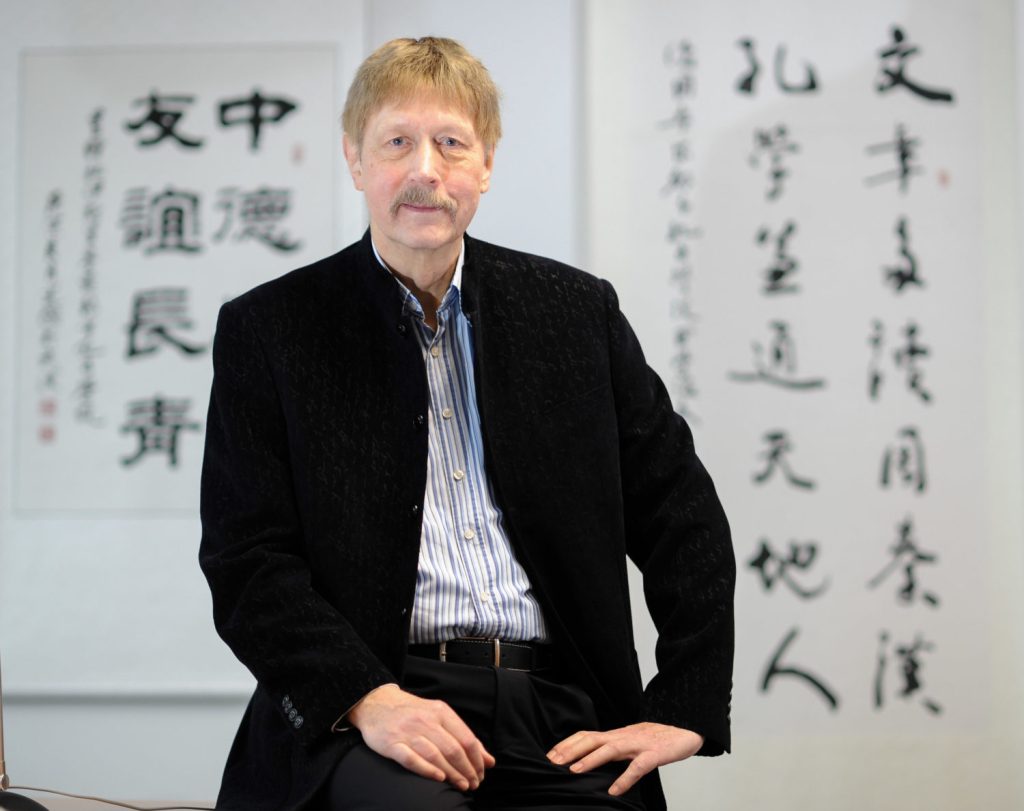
Seit mehr als vier Jahrzehnten reist Thomas Heberer jedes Jahr für Feldforschungen nach China. Der Politik- und Ostasienwissenschaftler, der an der Universität Duisburg-Essen eine Seniorprofessur hält, gilt als einer der profiliertesten China-Kenner weltweit. Sein Wissen und Gespür für die Menschen Chinas erlangte er durch seine vielen oft monatelangen Forschungsreisen quer durchs ganze Land. Das verschafft ihm einen differenzierten Innenblick auf diese riesige, sich schnell verändernde Weltmacht.
Die Coronavirus-Pandemie verhindert nun Heberers China-Besuche. “Es passiert derzeit so viel in der Volksrepublik”, sagt er, “aber leider bekomme ich wenig mit von der Stimmung der Menschen im Land”. Es würde ihn brennend interessieren, was die Menschen zu Chinas Pandemie-Management zu sagen hätten, zu Hongkong oder zu Xinjiang. Da er mit seinem Netzwerk in China jedoch nur über digitale Kanäle Kontakt halten kann, sei die Kommunikation stark eingeschränkt.
Wie der chinesische Staat versucht das eigene Volk als Teil eines großen Modernisierungsprozesses sozial zu disziplinieren, ist einer von Thomas Heberers aktuellen Forschungsschwerpunkten. Maßnahmen wie das Sozialkredit-System, detaillierte Verhaltensregeln, die Überwachung des Internets und öffentlicher Orte sind letztlich Teil dieses Versuch, nicht nur die Wirtschaft und die Gesellschaft sondern auch das Denken und Verhalten der Menschen zu kontrollieren. Während dazu in Europa historisch nebst Staaten auch Religion und Kirche eine große Rolle spielten, sei es in China allein der Staat, der die Disziplinierung von oben nach unten verordnet, sagt Heberer. “China will damit bis 2050 ein allumfassendes, modernes Gemeinwesen und eine Weltmacht schaffen, gleichauf mit den USA.”
Eigentlich hätte Thomas Heberer bereits im Jahr 2013 in den Ruhestand gehen können. “Darauf habe ich aber noch keine Lust”, sagt er. Zu sehr fasziniert ihn die Forschung in diesem schwer zu verstehenden Land. Das rätselhafte China fiel ihm schon als Kind auf, nachdem ihm seine Mutter ein Geographiebuch geschenkt hatte. “Den Band habe ich heute noch”, sagt er.
Erstmals reiste Thomas Heberer 1975 als Doktorand nach China, zur Zeit der Kulturrevolution. Zwei Jahre später wird er Lektor und Übersetzer am Verlag für Fremdsprachige Literatur in Peking. Die Frühphase von Chinas Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping erlebt er als Zeitzeuge hautnah. “Auf einmal entfaltete sich eine enorme wirtschaftliche Triebkraft”, sagt er. “Und auf einmal öffneten sich auch die Menschen und begannen zu sprechen.”
Die Erfahrung hat ihn wesentlich geprägt. Zu verstehen, wie die unterschiedlichen Menschen in China denken und fühlen, die Enträtselung dieser für Außenstehende schwer verständlichen Gesellschaft und Nation – das treibt ihn noch immer an. Adrian Meyer

werden Sie sich mit einem Impfstoff der chinesischen Firma Sinopharm gegen Covid-19 impfen lassen? Spätestens jetzt liegt die Frage auf dem Tisch. Vor dem heutigen Impfgipfel der Bundeskanzlerin ist klar: Wenn die Europäische Genehmigungsbehörde zustimmt, will der Gesundheitsminister den Impfstoff zum Einsatz kommen lassen. Ungarn übrigens wartet darauf nicht, das Brüsseler Impfchaos der letzten Wochen veranlasst den EU-Nachbar bei Sinopharm Millionen Dosen zu bestellen.
Immer deutlicher wird: Der starre Blick auf die 50iger Inzidenz grenzt an Selbsttäuschung. Die Pandemie wird nicht so schnell verschwinden, langfristige Strategien müssen her. Ressentiments und Selbstbezogenheit werden uns dabei nur im Weg stehen. Längst zeigen die Länder Asiens, Demokratien genauso wie Autokratien, dass No-Covid-Strategien die Verbreitung des Virus erfolgreich eindämmen können. Das heißt: Konsequente regionale Lockdowns schon bei geringsten Fallzahlen, digitales Tracking der Ansteckungsketten. Wir werden uns asiatischen Lösungen öffnen müssen. Sie pauschal mit dem Argument abzulehnen, sie seien in unseren liberalen Gesellschaften nicht einsetzbar, wird uns nicht weiterführen.
Gestatten Sie mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Damit wir im Team von China.Table noch besser wissen, was Sie interessiert, nehmen Sie sich doch bitte wenige Minuten für einige Antworten an uns.
Ich danke Ihnen und wünsche eine erfolgreiche Woche,

“Ich denke, die chinesische Regierung hat sehr effizient gehandelt. Jetzt hat jeder einen Gesundheitscode, und die Verwaltungen arbeiten sehr schnell. Vor allem vorbeugende Maßnahmen sind verstärkt worden, und die Nachverfolgung ist sehr wissenschaftlich. Als wir beispielsweise vor einiger Zeit einen am Coronavirus Infizierten aus Shijiazhuang in Wuhan zu Gast hatten, wurde das Viertel, in der sich diese Person aufhielt, abgeriegelt und weiträumig getestet. Damit kann der Alltag woanders weiterlaufen.
In dem Ausstellungsraum, den ich betreibe, dürfen nur noch maximal zehn Menschen zusammenkommen. Generell jedoch ist eine Nervosität entstanden. Schließlich möchte niemand eine Situation entstehen lassen, dass sich Menschenmengen ansammeln. Ansonsten hat sich das Leben weitgehend normalisiert. Aber wir tragen immer und überall Maske. Selbst wenn wir im Büro in kleiner Runde eine Konferenz haben. Restaurants, Cafés und Bars sind wieder geöffnet, aber viele meiner Bekannten sind sehr vorsichtig und gehen nicht gern an Orte mit vielen Menschen. Die Leute achten sehr darauf, dass die Hygieneregeln eingehalten werden, denn sie wissen, dass ihre Freiheit sonst wieder eingeschränkt werden kann. Weil wir uns nicht mehr so häufig treffen, gibt es eine größere Distanz zueinander, die droht, sich noch auszuweiten. Das hat auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander.”
“Man muss der Regierung Chinas den Vorwurf machen, Informationen zurückgehalten zu haben. Damit trägt sie eine Mitverantwortung für die weltweite schnelle Ausbreitung des Virus und dessen verzögerte Bekämpfung. Auch die Gängelung von Journalist*innen, die über die Auswirkungen des Virus berichten wollten, wirft Fragen über die Motive Chinas auf. Dass Anfang Januar den Expert*innen der WHO zunächst die Einreise nach China untersagt wurde, zeugt davon, dass die Führung des Landes nicht an einer wissenschaftlichen Aufarbeitung des Ausbruchsgeschehens interessiert ist.
Auf der einen Seite scheint China bei der Bekämpfung des Virus erfolgreicher zu sein als viele anderen Staaten. Der Preis den die Bürger*innen auf der anderen Seite zu bezahlen haben, ist sehr hoch und in unseren Demokratien nicht vorstellbar: Die soziale Überwachung, die Gängelungen, die Einschränkungen der Freiheiten. Ein solches System wäre nicht vereinbar mit unseren Grundwerten. Die Corona-Krise, ungeklärte Menschenrechtsfragen, der Umgang mit ethnischen und religiösen Minderheiten, die unzulässige Einmischung in die Verwaltung Hongkongs, die Angriffe gegen die pro-demokratische Opposition – all diese Beispiel belasten natürlich das Verhältnis zwischen der EU und der Volksrepublik China. Gut ist, dass die Außenminister der Mitgliedstaaten der EU zusammen mit dem Außenbeauftragten Josep Borrell sich in letzter Zeit geeinter und selbstbewusster gegenüber China aufstellen.”
“Die sehr strenge Kontrolle in den ersten Monaten des Ausbruchs von Covid-19 war wohl die wichtigste politische Entscheidung, die für Chinas starke wirtschaftliche Erholung verantwortlich zeichnet. Infolgedessen ist die Binnenwirtschaft in den letzten drei Quartalen weitgehend auf das normale Niveau zurückgekehrt. Die chinesische Regierung gewährte auch Steuervergünstigungen und betroffenen Unternehmen einige Subventionen. Chinas Finanzpolitik ist jedoch nicht so mutig wie die vieler westlicher Länder. Doch ihre mutige Geldpolitik war diesmal die richtige Entscheidung. Die breite Geldmenge wuchs um zehn Prozent und damit wesentlich schneller als das nominale Wachstum de Bruttoinlandprodukts. Dies stand im Gegensatz zu der viel zu straffen Geldpolitik der vergangenen Jahre.”
“Chinas Wirtschaft wird am Ende des Jahres 2021 zehn Prozent größer sein als vor der Corona-Krise. Die amerikanische Wirtschaft wird ungefähr so groß sein wie vor der Krise. Europas Wirtschaft hingegen wird schrumpfen. Das heißt: Europa fällt zurück. Dennoch taugen Chinas Mittel gegen die Pandemie nicht unbedingt als Vorbild. Dort sind während des Lockdowns Leute nicht mehr aus ihren Wohnungen gelassen worden. Ihnen wurden die Türen verriegelt. Das wollen wir auf keinen Fall. Ein vorausschauender Lockdown und eine relativ zügige Intervention bringen aber schon viel. Kaum zu glauben, aber im Frühjahr haben hierzulande viele noch argumentiert: Es sei schlecht, Masken zu tragen. Dabei lagen längst Belege für ihre Wirksamkeit vor. In China hat man nicht lange diskutiert, ob man jetzt Masken tragen soll oder nicht.
Die Frage ist, wer entscheidet, dass eine Maßnahme sinnvoll ist. Kontroverse Debatten gehören zur Demokratie, sie sind eine Voraussetzung für die Akzeptanz der letztlichen Entscheidungen. In einem Föderalstaat wie Deutschland handeln dann die Bundesländer sogar unterschiedlich. Zentralstaaten wie Frankreich oder Großbritannien haben das übrigens nicht besser gelöst. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen: Wir sind eine ziemlich satte Wohlstandsgesellschaft. Die Menschen sind nicht so leicht bereit, ihre Gewohnheiten zu ändern. Das ist in weniger saturierten Ländern, die auch zuletzt noch sehr viel Wandel durchgemacht haben, anders.”
“Heute ist die Qualität der ostasiatischen Führung der globale Standard. In der Post-Covid-Welt werden andere Länder Ostasien als Vorbild ansehen. Nicht nur was den Umgang mit der Corona-Pandemie betrifft, sondern die Art und Weise, wie man dort regiert.”
“Zu Beginn der Corona-Pandemie in Wuhan wurde zuweilen scharfe Kritik an dem Krisenmanagement der Partei geäußert. Dabei handelte es sich nicht nur um regimekritische Akademiker und Aktivisten. In den Chor der Kritiker reihten sich unter anderem auch eine Poetin und Schriftstellerin, diverse Mediziner, eine führende Mitarbeiterin der Zentralen Parteihochschule sowie ein prominenter Immobilienunternehmer ein. Egal jedoch ob die Kritiker innerhalb oder außerhalb des Systems standen: Sie wurden alle in unterschiedlichem Maße für ihre Kritik von der Partei bestraft. Dies hat dazu geführt, dass in der Volksrepublik China für die Angehörigen von Opfern der Corona-Pandemie keine Möglichkeit besteht, ihre Wut und ihre Trauer öffentlich kund zu tun. Und auch wenn die Kommunistische Partei Chinas (KP China) es bislang verstanden hat die Bevölkerung zu disziplinieren, so waren die sozialen Kosten der Abschottungsmaßnahmen häufig enorm. Aus Wuhan erreichten uns zu Beginn der Corona-Pandemie Aufnahmen, die zeigten dass die Metalltüren von Wohnkomplexen verschweißt wurden, um Anwohner vom Verlassen ihrer Wohnungen abzuhalten.”
“Wir sollten das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen, und uns an den Preis erinnern, den (der verstorbene Arzt und Whistleblower) Li Wenliang und das ganze Land für den Ausbruch gezahlt haben, nachdem die Frühwarnung von Beamten unterdrückt wurde. Hier geht es nicht um das Recht, die Regierung zu kritisieren, sondern darum, Menschen zu inspirieren, Stellung zu beziehen.“
“Covid-19 ist vielleicht ein Wendepunkt für die chinesische Wissenschaft: der Punkt, an dem ihre Arbeit wirklich globale Reichweite hatte und sie den Wert des Teilens erkannt haben.”
Zusammengetragen von Marcel Grzanna, Felix Lee, Amelie Richter, Frank Sieren, Ning Wang
02.02.2021, 16:00-18:00 Uhr (GMT)
Studienvorstellung, AHK China Business Confidence Survey Mehr
02.02.2021, 6:30-7:30 pm (PST)
Annual Gala, Washington State China Relations Council 40th Annual Gala – Resetting U.S.-China Relations Mehr
03.02.2021, 8:30-9:30 Uhr
Vortrag, Chinaforum Bayern TikTok & Douyin – von der Teenie-App zum Marketing-Tool. Anmeldung
03.02.2021, 20:00-21:30 Uhr
Vortrag mit Diskussion, European Chamber of Commerce in China Biden Administration´s China Policy and its impact on EU-China relations Anmeldung
05.02.2021, 10:00-11:30 Uhr
Vortrag, IHK Köln China-Situation und Perspektiven aus Sicht deutscher Unternehmen. Anmeldung
05.02.2021, 10:00 Uhr
Diskussion, Chinakompetenzzentrum TU Berlin Trends in Chinese and European political elites Mehr
Chinas Belt and Road Initiative gilt als Jahrhundertprojekt. Die chinesische Führung kleidet es in Superlative: Die neue Seidenstraße soll Kontinente mit neuer Infrastruktur verbinden, und in die Arktis und den Cyberspace vordringen. Kritiker sehen hingegen imperiale Bemühungen Chinas und eine Schuldenfallendiplomatie. China würde “listig und strategisch in die Zukunft marschieren” und dutzende Länder in die Abhängigkeit treiben.
In seinem Buch “The Emperor’s New Road – China And The Project Of The Century” zeigt Jonathan E. Hillman, Direktor des Reconnecting Asia Projekts der Denkfabrik Center for Strategic & International Relations: Die Neue Seidenstraße muss kritisch begleitet werden. Doch ein zentral gesteuerter Masterplan, um sich die Welt untertan zu machen, sei nicht zu erkennen. Vielmehr bestünden divergierende Interessen, die den Erfolg für die Neue Seidenstraße gefährden. Chinesische Unternehmen – darunter sieben der zehn größten Bauunternehmen der Welt – nutzten die Neue Seidenstraße, um ausländische Märkte zu erobern. Sie kümmerten sich weder um die finanziellen Folgen für die Gastländer, noch um den Rat chinesischer Botschaften, von unprofitablen Projekten abzusehen.
Innerhalb Chinas stritten das Handelsministerium und das Außenministerium um Einfluss auf die Seidenstraße – ersteres mit ökonomischen, letzteres mit politischen Interessen. Und Chinas staatliche Banken nutzten die Neue Seidenstraße, um Exporte zu finanzieren. Die sehr ineffiziente Kreditvergabe der Banken innerhalb Chinas lasse nichts Gutes für den Projekterfolg erahnen, so Hillman. Hinzu kommt: In den Partnerländern regieren nicht selten Autokraten, die glanzvolle Großprojekte nutzen, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren und ihr Prestige zu steigern. Nicht selten sind die von ihnen vorangetriebenen Projekte unprofitabel.
Durch all diese Faktoren trage China maßgeblich zur Erhöhung der Schulden seiner Partnerländer bei. Doch dahinter stecke kein Plan, um Infrastruktur in chinesischen Besitz zu übertragen. Das häufig bemühte Beispiel für eine vermeintliche Schuldenfallendiplomatie – der Hafen Hambantota in Sri Lanka – sei viel mehr Beleg für schlechte Planungen und divergierende Interessenlagen.
Sri Lankas politisch Verantwortliche trieben das teure Hafenprojekt voran, ohne einen größeren Entwicklungsplan für das Land zu verfolgen und obwohl der Hafen in der Hauptstadt Colombo nicht ausgelastet und besser gelegen war. Chinesische Bauunternehmen sahen die Möglichkeit eines schnellen Profits. Und Verantwortliche in China stoppten das unprofitable Hafenprojekt aus Angst vor Prestigeverlusten nicht. Durch Sri Lankas Überschuldung übernahm China den Hafen für eine Pachtdauer von 99 Jahren. Doch es sei falsch, das als Sieg Chinas zu deuten und zu glauben, China gewinne immer, auch wenn die Neue Seidenstraßen-Projekte fehlschlagen, so Hilmann. Der Hafen Hambantota werde vielmehr zu einer Warnung, was beiden Projektpartnern bei schlechter Projektplanung passieren könne.
Eine Weltbank-Analyse ergab, dass bei einem Drittel bis 50 Prozent aller Transportprojekte der Seidenstraße in Eurasien die Kosten die Einnahmen überstiegen. Auch wage sich China in viele Märkte vor, die andere Staaten eher meiden. Viele Seidenstraßenprojekte werden mit korrupten Regimen und Staaten mit sehr schlechtem oder ohne Kreditrating abgeschlossen. Dadurch steige für China das Risiko von Kreditausfällen.
Als Beispiel nennt Hillman Pakistan. Dort scheine China die Fehler vorheriger Großmächte zu wiederholen: Pakistan habe keine stringenten Entwicklungsplan. China dränge nicht auf Reformen, die Hillman jedoch als Grundlage für den Erfolg von Infrastrukturprojekten ansieht. Chinesische Unternehmen, die Neue Seidenstraßen-Projekte in Pakistan durchführen, beklagen sich hingegen über Korruption, Verzögerungen eine schlechte Zahlungsmoral der pakistanischen Partner. Doch nicht immer sind Chinas Partner korrupt oder der Großmacht ausgeliefert. Für südostasiatische Staaten zeigt Hillman auf, dass es kleineren Staaten häufig gelänge, große Partnerländer wie Japan und China gegeneinander auszuspielen und somit gute Kredit- und Projektbedingungen zu verhandeln.
Hillman zeigt, dass China mit vielen Neue Seidenstraßenprojekten Überkapazitäten aufbaue. Es drängt sich der Eindruck auf, China gehe bei der Seidenstraße ähnlich vor wie im eigenen Land. Das chinesische Wachstum wird auf die Partnerländer projiziert. Bei überdimensionierten Projekten wird angenommen, sie würden in Zukunft profitabel werden. Doch das scheint ein Trugschluss und führt zu einem hohen Schuldenrisiko.
Auch drohten China Reputationsverluste, wenn mangelhafte Arbeits- und Umweltstandards zu Konflikten im Partnerland führen. Hillman nennt den Hafen von Piräus, der zwar unter chinesischer Führung äußerst profitabel sei. Nach der Übernahme sanken jedoch die Arbeitsstandards, was zu Unmut bei griechischen Arbeitern führte.
Hillman schlussfolgert, dass China aus Fehlschlägen lernen und die Neue Seidenstraße zu einem durchschlagenden Erfolg werden könne, wenn China multilaterale Projekte starte und höhere Standards für die Kreditvergabe und Projektauswahl anlege. Es sei jedoch wahrscheinlicher, dass Chinas “Fehler bei der Seidenstraße die Welt erschüttern”, schreibt Hillman. Denn Chinas Neue Seidenstraßen-Partner müssten kontinuierlich hohes Wachstum erzielen, um die hohen Schulden zurückzahlen zu können.
Leider geht Hillmans Analyse nicht darauf ein, wie sich ein massiver Kreditausfall auf Chinas eigene Volkswirtschaft und in Folge auf die Weltwirtschaft auswirken würde. Was man in Hillmans Buch auch vermisst, ist ein Blick auf erfolgreiche Seidenstraßen-Projekte und ob China hieraus Rückschlüsse zieht. Ebenso wenig kommt bei Hillman die massive Finanzierung von fossilen Energieprojekten Chinas im Ausland vor und welche zukünftigen Konflikte sich dadurch abzeichnen könnten. Trotz dieser Mängel, gibt Hillmans Buch zahlreiche spannende Denkanstöße, die in der deutschen Debatte über die Neue Seidenstraße allzu häufig übersehen werden.
Nach Jahren aggressiver Expansion ist der südchinesische Reisekonzern und Großinvestor HNA insolvent. Ein Gericht in Hainan habe eine Restrukturierung angeordnet, teilte HNA auf WeChat mit. Die Gruppe sei nicht mehr in Lage, ihre Schulden zu bedienen. Wie hoch die Verbindlichkeiten genau sind, muss sich noch zeigen. Die jüngste Verfügbare Information stammt aus dem Jahr 2019, als das Unternehmen seinen Schuldenstand mit 707 Milliarden Yuan (90 Milliarden Euro) beziffert hat. Im Laufe der Coronavirus-Krise dürfte diese ohnehin hohe Summe noch deutlich angestiegen sein. Noch 2019 haben sich zahlreiche staatliche Banken, darunter die Bank of China, die Agricultural Bank und die ICBC, noch einmal für einen großen Stützungskredit zusammengetan. Jetzt ist die Geduld des Staates und seiner Finanzakteure am Ende. Die überlebensfähigen Tochterfirmen sollen demnächst selbstständig werden.
Die bekannteste Marke der Gruppe ist die Fluglinie Hainan Airlines, die unter deutschen Reisenden als Anbieter einer wichtigen Direktverbindung von Berlin nach Peking bekannt ist. Die HNA-Gruppe ist in Deutschland vor allem als Käufer des Flughafens Hahn bekannt. Von 2017 bis 2019 war sie auch Aktionär der Deutschen Bank und Kurzzeit-Arbeitgeber des Ex-Ministers Philipp Rösler. Das Unternehmen fiel seit der Jahrtausendwende durch seine im Laufe der Zeit immer teurere und aggressivere Expansionsstrategie auf. Mit Mitteln chinesischer Banken und internationaler Anleiheinvestoren wollte es ein weltweites Touristik-Konglomerat zusammenkaufen.
HNA erwarb beispielsweise hohe Anteile an der Hilton-Hotelkette sowie an den Flugdienstleistern Swissport und Gategroup. Insgesamt haben Wirtschaftsdienste Übernahmen im Wert von 50 Milliarden Dollar registriert. Analysten bewerteten jedoch von Anfang an kritisch, dass der Konzern sich nicht auf sein Kerngeschäft konzentrierte, in dem die zugekauften Firmen langfristig vielleicht auch hätten zusammenspielen können. Stattdessen hat das Management auch bei vielen Beteiligungen zugegriffen, die mit Reisen nichts zu tun haben – beispielsweise bei der Deutschen Bank. Die chinesische Gruppe kauft auch dem New Yorker Unternehmer Anthony Scaramucci seine Finanzfirma ab, damit dieser als Sprecher von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus einziehen konnte. Beide Teile des Geschäfts stellen sich als spektakuläre Fehleinschätzungen heraus. Scaramucci scheiterte in seiner Rolle als Sprecher, HNA konnte mit den Anteilen nichts anfangen.
Vor drei Jahren fing es bereits an zu rumoren. Es mehrten sich die Gerüchte, dass HNA bei mehreren Banken und Streckung von Darlehen nachgesucht hatte und immer höhere Kreditlinien benötigte, um seine Altschulden umzuwälzen. Manager der Ningbo Commerce Bank wurden beispielsweise misstrauisch, als sie merkten, dass HNA die gleichen Wertpapiere als Sicherheiten für zwei unterschiedliche Kredite eingereicht hatte. Seitdem rissen die schlechten Nachrichten nicht ab. Corona hat der Firmengruppe nun den Rest gegeben. Die Insolvenz kommt daher wenig überraschend.
Der Airport-Betreiber Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH teilte am Samstag mit, die Insolvenz der Muttergesellschaft habe keine Auswirkungen auf den deutschen Standort. “An unserer Zusammenarbeit mit allen Airlines, Kunden, Behörden und Partnern wird sich nichts ändern.” Das Land Rheinland-Pfalz wolle mit dem chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt Kontakt aufnehmen, um Näheres zu erfahren, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Die Marke Hainan Airlines wird voraussichtlich erhalten bleiben, schließlich ist sie im Luftverkehrsmarkt gut eingeführt. Doch wenn der Mutterkonzern ausgerechnet in der größten Krise des Luftverkehrs seit dem zweiten Weltkrieg pleitegeht, ist eine schwere Zeit garantiert. Die örtliche Regierung scheint derzeit auch keine schützende Hand über das Unternehmen zu halten. Im vergangenen Sommer hat sie die Gründung der örtlichen Konkurrenzfluglinie Sanya International Airlines eingefädelt.
Was für ein Jahr für Tesla und Elon Musk: Um 695 Prozent ging es 2020 mit dem amerikanischen E-Autobauer an der Börse nach oben. Gründer Musk löste dank dieser außerordentlichen Performance Amazon-Chef Jeff Bezos als reichsten Mann der Welt ab, obwohl auch der nicht gerade zu den Verlierern der Corona-Krise zählt.
Tesla hat Erfolg, aber Investoren blicken längst nicht mehr nur auf den amerikanischen Vorreiter. Noch mehr Geld verdienten sie in den vergangenen zwölf Monaten mit dem chinesischen Tesla-Angreifer Nio. Der Marktwert des erst vor sechs Jahren gegründeten E-Auto-Startups schoss im gleichen Zeitraum um mehr als 1000 Prozent in die Höhe. Mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt etwa 80 Milliarden Euro ist das Unternehmen von Gründer William Li damit wertvoller als Daimler oder BMW.
Zwar verkaufen Nio und andere chinesische E-Startups noch deutlich weniger E-Fahrzeuge als die deutschen Luxus-Hersteller Verbrenner. Das Tempo der jüngsten Expansion zeigt aber, wo sie in einigen Jahren stehen könnten.
Nio verdoppelte die Zahl seiner ausgelieferten Fahrzeuge im gerade abgelaufenen Jahr auf knapp 44.000. Der heimische Konkurrent Xpeng verdoppelte seinen Absatz ebenfalls auf rund 27.000 E-Autos. Und Li Auto, der dritte an der New Yorker Börse gelistete chinesische Tesla-Jäger, schaffte in seinem ersten Produktionsjahr den Verkauf von über 32.000 Fahrzeugen.
Nährboden für die chinesische E-Autoindustrie ist ein milliardenschwerer Plan der Regierung in Peking, die schon seit Jahren auf einen massiven Ausbau der Elektromobilität setzt. Hohe Subventionen und gleichzeitige Beschränkungen für Benziner auf den Straßen haben dazu beigetragen, dass dem E-Auto in China schneller der Weg bereitet werden konnte, als im Westen. Zum einen profitierten davon die etablierten chinesischen Hersteller, von denen die meisten bereits seit Jahren eine ganze Palette von E-Modellen im Angebot haben. Die größten Innovationstreiber aber sind junge Firmen wie Nio, die ausschließlich auf E-Autos setzen – oft auf Premiumfahrzeuge.
Ähnlich wie bei Tesla stand auch Nios Existenz schon häufiger auf der Kippe. Als das Shanghaier Startup 2018 sein erstes Modell, den SUV ES8 auf den Markt brachte, waren Auto-Experten noch nicht überzeugt. Technologisch, so der Schluss, hinke das Fahrzeug dem US-Vorbild Tesla um Jahre hinterher. Auch geriet Nio in finanzielle Turbulenzen, weil viel Geld für aufwendiges Marketing ausgegeben wurde, die Verkaufszahlen aber anfangs hinter den Erwartungen zurückblieben.
Die Phase der Kinderkrankheiten scheint überwunden, wie sich Anfang Januar beim “Nio Day” in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zeigte. Wie in jedem Jahr füllte Nio ein ganzes Stadion mit Fans, vor denen es seine neuesten Innovationen präsentierte. Höhepunkt war die Vorstellung der neuen Luxus-Limousine ET7, die 2022 auf dem Markt kommen soll. Auto-Experten bescheinigten dem Wagen nicht nur ein schickes Design, sondern eine äußerst überzeugende technische Ausstattung. Als weltweit erstes Serienfahrzeug überhaupt soll der ET7 mit einer Feststoffbatterie ausgeliefert werden, die eine größere Reichweite ermöglicht.
Das kleinste zur Auswahl stehende Akkupaket soll Reichweiten von rund 500 Kilometern ermöglichen. Deutlich interessanter dürften für die meisten Kunden jedoch die beiden größeren Akkupakete mit 100 kWh und sogar 150 kWh (als Feststoffbatterie) sein, mit denen der Nio ET7 Reichweiten von 700 bis 1000 Kilometern ohne Nachladen schaffen soll. Erstmals soll mit dem ET7 ein Fahrzeug über Technik verfügen, die autonomes Fahren ermöglicht.
Branchenbeobachter überzeugt an Nio, dass es selbstbewusst andere Wege geht. So bietet der Konzern seinen Kunden etwa ein abweichendes Lade-Konzept an. Im ganzen Land werden derzeit so genannte Batterie-Wechselstationen errichtet. Die Stationen sind etwa so groß wie eine Doppel-Garage und strategisch in der Nähe von Autobahnen und Schnellstraßen positioniert.
In den Hightech-Containern, die im ganzen Land verteilt werden sollen, läuft alles automatisch ab: Eine Hebebühne hievt das Auto etwa einen halben Meter in die Höhe. Von unten nähert sich auf einer Schiene ein Roboter, der unter dem Fahrzeug die Schrauben des hunderte Kilo schweren Akkus löst und ihn entfernt. Danach setzt die Maschine eine frische Zelle ein, das Auto senkt sich wieder. Innerhalb einer Stunde lädt die Station den leeren Akku auf und setzt ihn später einem anderen Fahrzeug ein.
Bei seiner großen Produktpräsentation in Chengdu kündigte Nio eine weitere Verfeinerung der Technologie an. So sollen die Fahrzeuge künftig selbständig per Knopfdruck in die Stationen fahren können, müssen also nicht mehr vom Fahrer selbst eingeparkt werden. So würde der Komfort erhöht und gleichzeitig wertvolle Zeit gesparrt.
Anders als die etablierten Autokonzerne setzt Nio außerdem viel stärker darauf eine Community für seine Kunden aufzubauen. Regelmäßig werden Fan-Treffen veranstaltet. Die Fahrzeuge werden nicht in schlichten Autohäusern verkauft, sondern in Glas-Tempeln, die eher an einen Apple Store erinnern. Ein kleines Café gehört zur Grundausstattung der über 50 Nio Houses in China.
Nio werde bei Verbrauchern als Marke bevorzugt, “weil es den Fokus auf Premiumdienste nach dem Kauf legt”, meint der Deutsche Bank-Analyst Edison Yu. Der Branding-Faktor sei einer der am meisten unterschätzten Askpekte des jüngsten Erfolgs. Mit seiner neuen Limousine werde Nio aller Voraussicht nach gegenüber Tesla “viel wettbewerbsfähiger”, auch wenn es bei der Software-Entwicklung der Chinesen noch Luft nach oben gebe. “Im Allgemeinen sind chinesische Kunden (insbesondere jüngere) viel offener geworden, lokale Automarken auszuprobieren”, sagt Yu.
Nio jedoch denkt schon über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Geplant ist, dass in der zweiten Jahreshälfte erste Fahrzeuge in Europa verkauft werden. Anders als frühere Versuche chinesischer Hersteller, die im Zeitalter des Verbrennungsmotors mit mehreren Expansionsversuchen gnadenlos gescheitert sind, werden Nio bessere Erfolgsaussichten eingeräumt. Gregor Koppenburg / Jörn Petring
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schließt auch eine Nutzung russischer und chinesischer Covid-Impfstoffe in Deutschland nicht aus. Kurz vor dem Impfgipfel an diesem Montag sagte Spahn der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”: “Wenn ein Impfstoff sicher und wirksam ist, egal in welchem Land er hergestellt wurde, dann kann er bei der Bewältigung der Pandemie natürlich helfen”. Gegen den Einsatz von chinesischen und russischen Impfstoffen spreche “nichts”, wenn sie eine “reguläre Zulassung nach europäischem Recht” hätten. Zuvor hatte sich auch Bayerns Ministerpräsident Marcus Söder (CSU) offen für den Einsatz russischer und chinesischer Impfstoffe in Deutschland gezeigt.
Die ungarische Regierung hatte am Freitag den Einsatz des Corona-Impfstoffes von Sinopharm zugelassen und bei dem chinesischen Hersteller fünf Millionen Dosen bestellt. Zuvor hatte Ministerpräsident Victor Orban eine Verordnung erlassen, die den Einsatz von Impfstoffen in Ungarn auch dann möglich macht, wenn keine offizielle Zulassung der ungarischen Arzneimittelbehörde vorliegt. asi
Der Allianz-Gruppe ist ein wichtiger Schritt in den chinesischen Vermögensverwaltungsmarkt gelungen. Die Regulierungskommission für Banken und Versicherungen (China Banking and Insurance Regulatory Commission) gab ihre Genehmigung für die vorbereitende Gründung der Allianz Insurance Asset Management (Allianz IAMC), wie aus einer Meldung der Allianz-Gruppe hervorgeht. Die Allianz IAMC wird nach eigenen Angaben die erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Versicherungs-Asset-Management Gesellschaft in China sein. Vor Ort soll ein Investmentmanagement-Team aufgebaut werden, “um die globalen Vermögensverwaltungsbedürfnisse der Kunden besser zu erfüllen” und Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen für Allianz-Schwester-Unternehmen und Drittkunden aus der Versicherungsindustrie anzubieten. Der Markteintritt in China wurde durch Chinas Öffnung im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen ermöglicht. nib
Großbritannien will dem transpazifischen Handelsabkommen CPTPP beitreten, kündigte die Ministerin für internationalen Handel, Liz Truss, nach Meldungen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa an. Der Freihandelszone Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) gehören bislang elf Staaten an. Sie umfasst unter anderem die Märkte Australiens, Kanadas, Chiles, Mexikos und Japans. China ist kein Mitglied des Abkommens. Die CPTPP-Vereinbarung war als Antwort auf den Austritt der USA aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aus der Taufe gehoben worden. CPTPP umfasst einen Binnenmarkt mit etwa 500 Millionen Menschen, in dem 13 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet wird. asi
Nach Informationen der FAZ hat die chinesische Regierung scharfe Kritik an einem neuen Einreiseprogramm Großbritanniens für Hongkonger geübt. Infolge des von China verordneten “nationalen Sicherheitsgesetzes” für Hongkong hatte London bereits im Sommer letzten Jahres Maßnahmen angekündigt. Die Johnson-Regierung ermöglicht Hongkonger Bürgern nun die Einreise für bis zu fünf Jahre. Danach ist ein Antrag auf britische Staatsbürgerschaft möglich. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, Großbritannien ignoriere “die Tatsache, dass Hongkong schon vor 24 Jahren zu China zurückgekehrt ist”, so die FAZ. Peking droht mit Gegenmaßnahmen und erachtet das Einreiseprogramm als Verstoß gegen die “Gemeinsame Erklärung” zwischen Großbritannien und China von 1984. Der britische Premier Boris Johnson sagte: “Wir stehen für Freiheit und Autonomie ein – Werte, die sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Hongkong hochgehalten werden.” Man erwarte, dass ungefähr 300.000 Hongkonger die Einreisemöglichkeit wahrnehmen. nib

Einen Ratschlag, den Henry Kissinger Joe Biden mit auf den Weg gegeben hat, ist es, alles zu tun, um einen Krieg mit China zu vermeiden. Dieser würde eine Katastrophe vom Ausmaß des ersten Weltkrieges bedeuten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Konflikts zwischen den USA und China und welche Rolle soll Europa einnehmen?
Als Präsident Nixon und Henry Kissinger Anfang der 1970er Jahre vor dem Hintergrund des Kalten Krieges die Annäherung an China betrieben, stand das Land vor dem Abgrund: der Anteil am globalen Bruttosozialprodukt lag bei unter 5 Prozent, im Welthandel war China ein Zwerg, es war international vollkommen abgeschottet und technologisch ein hoffnungslos rückständiger Fall.
Die von Deng Xiaoping 1978 initiierten Reformen machten das Land binnen einer Generation zur weltweit zweitgrößten Wirtschaftsmacht. Heute ist das von Präsident Xi Jinping ausgegebene Ziel, die USA bis 2049 ein- wenn nicht gar zu überholen, China seinen gerechtfertigten Platz im Zentrum der Weltbühne zu geben und die Erneuerung des chinesischen Traums zu verwirklichen.
Mit der wirtschaftlichen Entwicklung ging ein Erstarken der militärischen Kraft einher, das China zu geostrategischen Initiativen veranlasst hat, die aus chinesischer Sicht vollkommen legitim sind, von den USA jedoch als Bedrohung seines Status angesehen werden. Peking beansprucht weite Teile des südchinesischen Meeres, hat eine Militärbasis in Dschibuti aufgebaut, die zwar noch klein ist, aber als Basis für eine weitere Expansion gilt und es hat mit der Belt and Road Initiative Abhängigkeiten erzeugt, aufgrund derer die eigene Vision der Welt unterstützt wird.
Die heutige Auseinandersetzung zwischen den USA und China spiegelt laut dem Historiker Graham Allison viele geschichtliche Konflikte zwischen Großmächten wider. Allison hat über die letzten 500 Jahre 16 Fälle untersucht, in denen eine neu aufstrebende Macht den Status Quo einer existierenden Macht in Frage stellte. In zwölf dieser Fälle kam es zum Krieg und in nur vier Fällen konnte ein solcher vermieden werden.
China sieht sich als die zweitgrößte und in absehbarer Zeit sogar als größte Wirtschaftsmacht der Welt berechtigt eine Neuausrichtung der internationalen Ordnung zu fordern, die seinen Kerninteressen Rechnung trägt. Es ist in einen Wettbewerb der Systeme getreten und will die eigene Gesellschaftsordnung einbringen. Gleichzeitig sucht es Revanche für die Erniedrigung, die dem Land durch die Kolonisierung im 19. Jahrhundert zugefügt wurde und es ist mangelndem Respekt gegenüber in einem Maße sensibel, das vielfach Erstaunen hervorruft.
Die USA werfen China Undankbarkeit für die Unterstützung beim wirtschaftlichen Aufbau vor und behaupten, dass Peking die Weltordnung verändern will, um autoritäre Ziele und seinen Hegemonieanspruch zu verwirklichen. Außerdem investiere China große Summen in die Entwicklung erstklassiger Streitkräfte, um die USA zu übertreffen. Somit stelle es eine erhebliche Bedrohung für Frieden und Freiheit in der Welt dar.
Allisons Forschung zeigt: So unwahrscheinlich und unerwünscht ein militärischer Konflikt auch sein mag und so katastrophal seine absehbaren Konsequenzen – dies konnte in der Vergangenheit einen Krieg nicht verhindern und das dürfte auch heute noch gelten. Voraussetzung für einen militärischen Konflikt sind nicht die Intentionen der aufkommenden Macht. Es ist die potentielle Bedrohung für die etablierte Macht und die Unvereinbarkeit dieser Bedrohung mit dem Status Quo. Es braucht für den Ausbruch eines Krieges keine ‘großen Anlässe’. Meinungsverschiedenheiten auf Nebenschauplätzen sind oft genug eskaliert und in einen Krieg gemündet.
Zu den wichtigen geostrategischen Herausforderungen unserer Zeit gehört der Druck, den das Aufkommen einer Nation mit einer Jahrtausende alten Zivilisation und einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen auf die etablierte internationale Ordnung ausübt. Noch nie ist ein Land so schnell in so viele Dimensionen der Macht vorgestoßen und zwingt mit seiner schieren Größe der Welt ein neues Gleichgewicht auf. Dabei ist davon auszugehen, dass das Reich der Mitte das Selbstverständnis und die Ambition hat, nicht nur in Asien, sondern auch weltweit die führende Nation zu sein und die USA in dieser Rolle zu ersetzen.
Aus historischer Sicht ist ein militärischer Konflikt zwischen beiden Mächten nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlicher als ein friedlicher Ausgang. Es wird im laufenden Jahrzehnt von entscheidender Bedeutung sein wie die USA und China das Spanungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Kooperation ausleben. Ein Unterschied zur Historie sind die globalen Probleme unserer Zeit. Die daraus resultierenden Interdependenzen und das Vertrauen, das bei der gemeinsamen Suche nach Lösungen entstehen sollte, sind positive Faktoren. Eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung eines Krieges kommt den Kommunikationslinien zwischen den Regierungen beider Länder zu. Hier muss Präsident Biden für belastbare Strukturen sorgen. Europa muss es vermeiden, zum Spielball der Mächte zu werden. Es steht unzweideutig an der Seite der USA und würde in einen Krieg mit hineingezogen. Die Rolle Europas besteht darin, auf der Grundlage einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit seinen gebührlichen Platz zwischen den USA und China einzunehmen, seine guten Beziehungen zum Reich der Mitte einzubringen und als Vermittler zwischen den Kontrahenten zu agieren.
Dr. Gerhard Hinterhäuser ist Partner bei der Unternehmensberatungsgesellschaft Bingmann Pflüger International. Er lebt in Asien und Deutschland und war von 2006 bis 2014 Mitglied der Geschäftsführung der staatseigenen Firma PICC Asset Management Co. Ltd. in Shanghai.
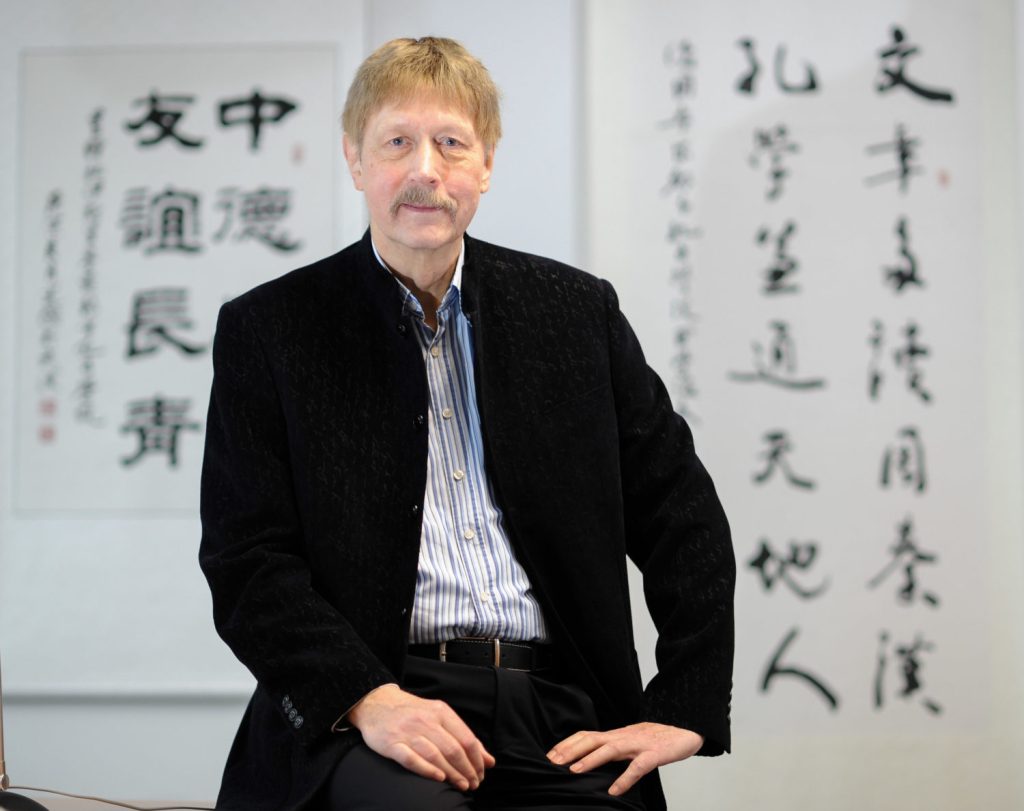
Seit mehr als vier Jahrzehnten reist Thomas Heberer jedes Jahr für Feldforschungen nach China. Der Politik- und Ostasienwissenschaftler, der an der Universität Duisburg-Essen eine Seniorprofessur hält, gilt als einer der profiliertesten China-Kenner weltweit. Sein Wissen und Gespür für die Menschen Chinas erlangte er durch seine vielen oft monatelangen Forschungsreisen quer durchs ganze Land. Das verschafft ihm einen differenzierten Innenblick auf diese riesige, sich schnell verändernde Weltmacht.
Die Coronavirus-Pandemie verhindert nun Heberers China-Besuche. “Es passiert derzeit so viel in der Volksrepublik”, sagt er, “aber leider bekomme ich wenig mit von der Stimmung der Menschen im Land”. Es würde ihn brennend interessieren, was die Menschen zu Chinas Pandemie-Management zu sagen hätten, zu Hongkong oder zu Xinjiang. Da er mit seinem Netzwerk in China jedoch nur über digitale Kanäle Kontakt halten kann, sei die Kommunikation stark eingeschränkt.
Wie der chinesische Staat versucht das eigene Volk als Teil eines großen Modernisierungsprozesses sozial zu disziplinieren, ist einer von Thomas Heberers aktuellen Forschungsschwerpunkten. Maßnahmen wie das Sozialkredit-System, detaillierte Verhaltensregeln, die Überwachung des Internets und öffentlicher Orte sind letztlich Teil dieses Versuch, nicht nur die Wirtschaft und die Gesellschaft sondern auch das Denken und Verhalten der Menschen zu kontrollieren. Während dazu in Europa historisch nebst Staaten auch Religion und Kirche eine große Rolle spielten, sei es in China allein der Staat, der die Disziplinierung von oben nach unten verordnet, sagt Heberer. “China will damit bis 2050 ein allumfassendes, modernes Gemeinwesen und eine Weltmacht schaffen, gleichauf mit den USA.”
Eigentlich hätte Thomas Heberer bereits im Jahr 2013 in den Ruhestand gehen können. “Darauf habe ich aber noch keine Lust”, sagt er. Zu sehr fasziniert ihn die Forschung in diesem schwer zu verstehenden Land. Das rätselhafte China fiel ihm schon als Kind auf, nachdem ihm seine Mutter ein Geographiebuch geschenkt hatte. “Den Band habe ich heute noch”, sagt er.
Erstmals reiste Thomas Heberer 1975 als Doktorand nach China, zur Zeit der Kulturrevolution. Zwei Jahre später wird er Lektor und Übersetzer am Verlag für Fremdsprachige Literatur in Peking. Die Frühphase von Chinas Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping erlebt er als Zeitzeuge hautnah. “Auf einmal entfaltete sich eine enorme wirtschaftliche Triebkraft”, sagt er. “Und auf einmal öffneten sich auch die Menschen und begannen zu sprechen.”
Die Erfahrung hat ihn wesentlich geprägt. Zu verstehen, wie die unterschiedlichen Menschen in China denken und fühlen, die Enträtselung dieser für Außenstehende schwer verständlichen Gesellschaft und Nation – das treibt ihn noch immer an. Adrian Meyer

