vor gut einer Woche hat eine exklusive Umfrage von China.Table beim Marktforschungsinstitut Civey gezeigt, dass immer mehr Menschen Waren aus Zwangsarbeit ablehnen. Die Politik reagiert auf diese Haltung mit Gesetzen zu Lieferketten wie Deutschland und Europa oder dem Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit durch Uiguren in den USA.
In unserer heutigen Ausgabe geht es nun um die Herstellung jener Waren: Marcel Grzanna hat mit Menschen gesprochen, die in chinesischen Fabriken unter Zwang arbeiten mussten. Wer vom Schicksal von Gulzira Auyelkhan liest, erkennt, wie weit das System reicht: Es geht um willkürliche Verhaftungen, um Stromrechnungen für Mitarbeiter und um Kredite, bei denen Menschen zwar nie das Geld erhalten und dennoch riesige Schulden abarbeiten müssen. Am Ende bleibt ein kümmerlicher Lohn für viel harte Arbeit: rund 15 Euro im Monat.
Unsere zweite Analyse widmet sich der Zukunft von Mobilität. So manch einer sieht dem Boom des Elektro-Antriebs sehr skeptisch gegenüber und sieht in Wasserstoff eine weitaus zukunftsträchtigere Alternative. Entsprechend hat sich Christian Domke Seidel angeschaut, wie weit China im Bereich Wasserstoff-Mobilität bereits gekommen ist. Schließlich wurde bei den Olympischen Spielen in Peking öffentlichkeitswirksam der reibungslose Einsatz von Bussen und Shuttles mit Wasserstoffantrieb angepriesen.
Doch bei genauerem Hinsehen wird klar: Pekings Wasserstoff-Pläne sind zwar mehr als ambitioniert. Doch in naher Zukunft wird Wasserstoff noch nicht für Autos genutzt werden. Die Energie wird aktuell vielmehr in anderen Bereichen benötigt.
Vor wenigen Tagen hat Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich übernommen. Wir blicken darauf, was das für die EU-China-Politik bedeuten könnte. Denn obwohl Tschechien im Gegensatz zu Frankreich Teil von Pekings “16+1”-Format ist, sind die Fronten alles andere als eindeutig. Unter dem Vorsitz des mit Kiew sympathisierenden Prags wird die EU vor allem das Verhältnis zwischen Peking und Moskau genau im Blick behalten. Weitere potenzielle Reizthemen sind Taiwan, Litauen sowie engere Beziehungen zu Indo-Pazifik-Anrainern wie Australien, Korea und Indien.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wer Hunger hatte, durfte sich an gekochtem Reis satt essen – geschmacklos, ohne Beilagen, wenig Nährstoffe. Doch in der Weberei des Textilindustrieparks im Landkreis Yining im Nordwesten Xinjiangs an der Grenze zu Kasachstan bot die Küche auch Alternativen. Gefüllte Teigtaschen zum Beispiel mit Gemüse, dazu leckere Soßen – allerdings nur gegen Bezahlung. Ähnlich wie in der Kantine eines deutschen Unternehmens, könnte man meinen.
Doch die Arbeiterinnen im Industriepark Yining können sich die anständigen Mahlzeiten nicht leisten. Der Lohn, der der ehemaligen Mitarbeiterin Gulzira Auyelkhan seinerzeit zugesagt wurde, betrug 600 Yuan pro Monat, damals rund 75 Euro. Das sind fast 1.000 Yuan weniger als der gesetzlichen Mindestlohn in der Region. Selbst im abgelegenen Yining sind 75 Euro für einen Monat Arbeit sehr dürftig. Auf die Teigtaschen musste Gulzira Auyelkhan deshalb verzichten.
Die Kasachin nähte von morgens bis abends Lammfell-Handschuhe. Sie machte die schlecht bezahlte Arbeit nicht freiwillig. Sie sei von chinesischen Behörden dazu gezwungen worden, sagt sie im Gespräch mit China.Table. Heute lebt sie am Stadtrand von Washington. Die USA gewährten ihr politisches Asyl. Sie gehört zu jenen Geflüchteten, die dem US-Senat später über die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang öffentlich Auskunft gaben.
Eine Expertenkommission der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) hatte der Volksrepublik China Ende vergangenen Jahres vorgeworfen, durch ein “weit verbreitetes und systematisches” Zwangsarbeitsprogramm gegen internationale Konventionen zu verstoßen. Davon betroffen sind in erster Linie Uiguren und andere muslimische Minderheiten.
Besonders Branchen wie die Textilindustrie, die Landwirtschaft oder die Solarindustrie gelten als Risikosektoren, in denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Zwangsarbeit in die Wertschöpfung einfließt. Vor allem in Xinjiang sei das Problem markant. Laut IAO-Bericht seien zudem rund 80.000 Uiguren in andere Landesteile deportiert worden, um auch dort für minimale Löhne arbeiten zu müssen.
China.Table liegen auch Aussagen von Behördenvertretern vor, die mit der Organisation der Zwangsarbeit befasst waren. “Um der Zwangsarbeit einen Anstrich der Legalität zu verpassen, nötigten die Behörden die Frauen in Yining dazu, einen Kredit bis zu einer Höhe von 10.000 Yuan bei einer örtlichen Bank zu beantragen“, sagt Gulipiyan Hazibek.
Die gelernte Medizinerin hat ebenfalls kasachische Wurzeln, sie wurde als studierte Kraft in den chinesischen Staatsdienst bestellt. 22 Jahre lang arbeitete sie für die chinesische Verwaltung, ehe sie aus gesundheitlichen Gründen als ethnische Kasachin nach Kasachstan ausreisen durfte und die dortige Staatsbürgerschaft annahm.
Zuletzt war sie dafür zuständig, Frauen aus den Dörfern der Region aufzutreiben, um sie für die Arbeit in den Fabriken zu rekrutieren. “Ich musste die Frauen dazu zwingen, mitzukommen. Auch alte Frauen, kranke oder gehandicapte. Wer sich weigerte, musste mit harten Strafen rechnen“, sagt Hazibek im Gespräch mit China.Table. Je nach Leistungsfähigkeit wurden die Frauen für verschiedene Tätigkeiten in der Produktion eingesetzt.
Der Knackpunkt war nun der Kreditvertrag, den die Frauen bereits unterschrieben hatten. Das Geld sei nach der Unterzeichnung der Papiere nie geflossen, sagt Hazibek. Dennoch seien die Frauen verschuldet gewesen, und zwar so hoch, dass eine Rückzahlung fast immer unmöglich war. Um ihre Zwangsanstellung zu rechtfertigen, argumentierten die Behörden, die Frauen müssten die Summe in den örtlichen Fabriken abarbeiten.
Auch die Handschuh-Näherin Gulzira Auyelkhan sollte ein solches Papier unterschreiben. Im Juli 2017 war sie aus Kasachstan nach Xinjiang eingereist, um in ihrem Heimatdorf ihren kranken Vater zu besuchen. Drei Jahre zuvor hatte sie die Volksrepublik mit ihrem Ehemann und ihren Kindern verlassen, um in Kasachstan ein neues Leben zu beginnen. Damals, 2014, hatte die chinesische Regierung den “Harten Schlag gegen gewaltbereiten Terrorismus” (严厉打击暴力恐怖活动专项行动) begonnen. Die Kampagne richtete sich gegen Uiguren und andere Minderheiten in Xinjiang.
Nach ihrer Ausreise hatte Auyelkhan die kasachische Staatsbürgerschaft angenommen und glaubte deswegen, in Xinjiang sicher zu sein, als sie erstmals wieder dorthin zurückkehrte. Doch sie irrte. Kurz hinter der Grenze nahm man sie fest und internierte sie. “Man warf mir vor, nicht so zu denken, wie die Kommunistische Partei es gerne hätte. Deshalb wurde entschieden, mich umzuerziehen”, sagt sie China.Table. 15 Monate lang steckte man sie in ein Internierungslager.
Als Kasachin hatte sie stets die Hoffnung gehabt, durch internationalen Druck freizukommen. Auch deshalb widersetzte sich Auyelkhan, einen Kreditvertrag zu unterschreiben. Uigurischen Frauen mit chinesischer Staatsbürgerschaft dagegen wurde gedroht, sie lange einzusperren. Der Zwangsarbeit entkam Auyelkhan dennoch nicht. Nach der Zeit im Lager arbeitete sie auf behördliche Anordnung vom 14. Oktober 2018 bis zum 29. Dezember desselben Jahres mindestens zwölf, manchmal 16 Stunden täglich.
Auch während dieser Zeit standen die Frauen unter strenger Überwachung. Die Arbeit in der Fabrik ähnelte sehr der Internierung im Lager. Die Zeit nach der Arbeit verbrachten sie in Gemeinschaftsunterkünften, drei Kilometer von der Fabrik entfernt. Manchmal waren die Arbeitstage derart lang, dass die Frauen direkt in der Fabrik schliefen. Es war ihnen verboten, allein in den Schlafsaal zurückzukehren.
Ihr verdientes Geld floss auf eigens eingerichtete Bankkonten der Arbeiterinnen. Doch Zugriff darauf bekamen sie nicht. Stattdessen wurden Kosten für ihre Unterkunft samt Nebenkosten für Strom automatisch abgebucht. Auch die Pendelei zwischen Unterkunft und Fabrik mussten sie bezahlen, sodass am Ende kaum noch Geld übrig blieb. Die Arbeiterinnen waren der Willkür der Behörden schutzlos ausgesetzt.
Die chinesische Regierung lehnt die Vorwürfe systematischer Zwangsarbeit kategorisch ab und wähnt sich als Opfer einer Schmierkampagne. Erst zu Beginn des Jahres hat das Land zwei UN-Konventionen der IAO gegen Zwangsarbeit unterschrieben. Zur Aufklärung vor Ort wäre chinesische Unterstützung unverzichtbar. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass die Behörden kooperieren werden.
Die IAO beschloss bei ihrer Jahreskonferenz vor wenigen Wochen, eine technische Beratungskommission in die Volksrepublik zu entsenden. Eine Untersuchung der Vorwürfe ist einer solchen Kommission jedoch nicht gestattet. Sie kann lediglich unterstützend auf die Einhaltung von Konventionen dringen. Um das Problem zu bekämpfen, sollen Lieferkettengesetze in Deutschland und Europa oder der Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA die Produzenten so stark unter Druck setzen, dass sie das System der Zwangsarbeit einstellen.
Gulzira Auyelkhan wurde am 30. Dezember 2018 freigelassen und fünf Tage später an die kasachische Grenze gebracht, um nach Hause zurückzukehren. Ihr Mann hatte aus Kasachstan heraus politischen Druck organisiert, der schließlich zum Erfolg führte. Als sie freikam, zahlte man ihr für die gesamte Zeit in der Fabrik 250 Yuan aus, etwas mehr als 30 Euro.

In der individuellen Mobilität wird Wasserstoff in absehbarer Zeit keine Rolle spielen. Auch nicht in China. Dafür sind Technologie und Infrastruktur im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge zu weit fortgeschritten. Nennenswerte Marktchancen gibt es nur im Bereich der Lkw und Busse. So fasst Dirk Niemeier den Wasserstoff-Markt in der Volksrepublik China zusammen. Niemeier ist Direktor von Strategy&, der Strategieberatung von PricewaterhouseCoopers (PwC). Der vorhandene Wasserstoff werde an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt. Das gelte auch für die Unmengen an Energie, die zu seiner Produktion benötigt werden.
China setzt durchaus auf Wasserstoff als universellen Energieträger. “Es ist in diesem Bereich ein ähnliches Wachstum geplant wie in Europa. Allerdings sehr viel später, weil es noch wenig Regularien und Förderungen gibt”, sagte Niemeier gegenüber Table.Media. Es gebe langfristige Zielsetzungen, aber noch keine aktuellen Gesetze, die den Einsatz im größeren Stil in der Industrie forcieren.
Chinas Pläne im Bereich des Wasserstoffs klingen ambitioniert. Ab dem Jahr 2025 sollen jährlich 100.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden (China.Table berichtete). Im gleichen Zeitraum sollen 30 Gigawatt Speicherkapazität entstehen. Parallel entstehen Versuchsflotten von Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Bei den Olympischen Spielen fuhren bereits entsprechende Busse und Shuttles. Bis 2025 sollen insgesamt 50.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf der Straße sein. Diese Zahl teilt sich in 40.000 Pkw und 10.000 Lkw auf.
Aktuell produziert China 33 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr – hauptsächlich grauer Wasserstoff, der aus Erdgas, Kohle und Öl erzeugt wird (China.Table berichtete). Der Wasserstoff geht nahezu vollständig in die Chemieindustrie, wo er als Ausgangsstoff dient. Auch die versprochenen 30 Gigawatt Speicherkapazität sind gerade einmal vier Prozent der ebenfalls geplanten 800 Gigawatt an zusätzlichen Erzeugungsmenge.
Dazu kommen die ambitionierten Ziele bei der Reduktion der Treibhausgase. China möchte bis 2060 klimaneutral sein. Der größte Stolperstein dabei ist die Abhängigkeit von Kohlekraftwerken. Die geplanten Solar- und Windkraftanlagen müssen also langfristig die Energie der Kohlekraftwerke ersetzen. Das heißt, sie steht nicht für extrem energieaufwändige Zusatzprojekte wie den Ausbau der Wasserstoffindustrie zur Verfügung, wie Niemeyer erklärt.
Während Kohlekraftwerke zwischen 7.000 und 8.000 Stunden im Jahr Strom produzieren, tun Windräder das nur an etwa 2.500 Stunden pro Jahr. Das bedeutet, dass für die gleiche Menge Strom sehr viel mehr Leistung installiert werden muss. Zudem sind riesige Energiespeicher notwendig. Das führt zu einem Marktnachteil: “Grüner Wasserstoff ist derzeit noch deutlich teurer als grauer Wasserstoff. Insbesondere, wenn es keinen CO2-Preis für die fossilen Ausgangsprodukte gibt”, sagt Niemeier. Solange dieser Unterschied bestehe, rechne PwC mit Stagnation des Geschäfts.
Doch natürlich wird auch in China die Erforschung von Wasserstoff vorangetrieben. “Es gibt fünf Citycluster, in denen die Erzeugung und Verwendung von grünem Wasserstoff und Fuelcell-Fahrzeugen forciert wird”, erklärt Niemeier. “Weil deren Wasserstoffbedarf geringer ist, lässt sich dieser Bereich leichter mit kleineren dezentralen Anlagen entwickeln.”
Mit entsprechenden Erfolgen. “In China kommen deutlich günstigere Geräte und Aggregate zum Einsatz. Allerdings ist ihr Wirkungsgrad geringer.” Falls der Markt zukünftig stark wachse, könnten die günstigeren Geräte eine Rolle spielen. Ausländische Investoren und Firmen sind dabei nicht vorgesehen. Die Förderungen in diesem Bereich zielen darauf ab, eine lokale Wertschöpfung zu erhalten, während Elektroautos noch mit der Gießkanne gefördert wurden.
Entsprechend weit sind auch Brennstoffzellen-Fahrzeuge davon entfernt, im Alltag eine Rolle zu spielen. “Nach unserer Einschätzung werden batterieelektrische Pkw nicht von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen abgelöst werden.” Vor allem auch, weil die notwendige Infrastruktur nicht existiert, die Elektro-Ladeinfrastruktur aber sehr wohl. Zwar arbeitet die Kommunistische Partei am Aufbau eines Tankstellennetzes, das jedoch in erster Linie für Busse und Lkw gedacht sei. Diese seien technisch jedoch ungeeignet, auch Pkw zu bedienen, so Niemeier.
Vor wenigen Tagen hat Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich übernommen. Auch in der zweiten Jahreshälfte wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen die Tagesordnungen dominieren. Indirekt hat das auch weiterhin Auswirkungen auf die China-Politik der EU-Staaten – denn unter dem Vorsitz des mit Kiew sympathisierenden Prags wird die EU das Verhältnis zwischen Peking und Moskau genau beobachten. Unklarer steht es um die bilateralen Beziehungen. Denn in Prag selbst gibt es unterschiedliche Ansichten, wie mit Peking umgegangen werden soll.
Tschechien hat “Europe as a Task: Rethink, Rebuild, Repower” (auf Deutsch: “Europa als Aufgabe: Umdenken, umbauen, umgestalten”) als Leitsatz für den Vorsitz gewählt. Das Motto verweist auf ein gleichnamiges Werk von Menschenrechtler und Politiker Václav Havel. Die Stärkung der Demokratie und wie sich diese gegen Autokratien aufstellen kann, ist damit als ein Rahmen der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft zu erwarten. Peking könnte diese Gegenüberstellung eher weniger gefallen.
Für das EU-China-Verhältnis wichtige Punkte des tschechischen Ratsvorsitzes:
Auf dem Schwarzmarkt für Daten sind persönliche Informationen von rund einer Milliarde chinesischer Bürger aufgetaucht. Zum Preis von zehn Bitcoin (gut 180.000 Euro) bieten die unbekannten Hacker den Daten-Schatz feil. Die Kryptowährungs-Plattform Binance machte das Angebot am Sonntag über Twitter öffentlich. Auf Chinas Sozialmedien sind seit Montag die Suche nach “Datenleck” blockiert.
Besonders heikel ist die angebliche Quelle der Datensätze. Sie sollen aus der Dienststelle des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (公安部) in Shanghai stammen. Das würde bedeuten: Chinas mächtige Staatssicherheit wurde gehackt. Laut Binance-Chef Zhao Changpeng hat ein Behörden-Programmierer in seinem persönlichen Blog einen Anfängerfehler gemacht, was den Zugriff auf die Server seines Arbeitgebers möglich gemacht habe.
Zu den gestohlenen Daten gehören Name, Adresse, Personalausweisnummer, Geburtsort, Telefonnummer und dergleichen. Die Personalausweisnummer und die Telefonnummer dienen in China der universellen Identifikation zum Beispiel bei Bankgeschäften in der App, beim Online-Kauf von Waren oder Fahrkarten – oder gegenüber den Behörden. Binance selbst verlangt von betroffenen Nutzern daher jetzt eine zusätzliche Authentifizierung. fin
Das Europaparlament befasst sich in seiner aktuellen Sitzungswoche mit der Verhaftung des römisch-katholischen Kardinals Joseph Zen in Hongkong. Die Abgeordneten werden am Mittwoch mit der EU-Kommission über die aktuelle Lage in Hongkong und die Festnahme des 90 Jahre alten Geistlichen sowie Mitglieder des “612 Humanitarian Relief Fund” Ende Mai debattieren. Aller Voraussicht nach wird das Vorgehen gegen Zen und die weiteren Inhaftierten in einer Resolution am Donnerstag zur Abstimmung kommen. In dieser wird ihre Freilassung gefordert, wie aus einem Entwurf des Papiers hervorgeht.
Kardinal Zen wird vorgeworfen, gegen das Nationale Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, indem er sich mit ausländischen Kräften gegen die nationalen Interessen der Stadt verschworen habe. Hintergrund für den Vorwurf ist Zens Rolle als Treuhänder des “612 Humanitarian Relief Fund”, der Geld gesammelt hat, um angeklagten Mitgliedern der Hongkonger Protestbewegung rechtlichen Beistand zu finanzieren (China.Table berichtete). Die Abstimmungen des EU-Parlaments stellen den Standpunkt der Abgeordneten dar und geben der Kommission eine Handlungsempfehlung. Sie sind allerdings nicht bindend. ari
China Southern Airlines plant, 96 Airbus A320neo-Jets zu ordern. Dabei handelt es sich um die größte Bestellung neuer Flugzeuge seit Beginn der Corona-Pandemie, die für die Flugzeug- und Reisebranche beispiellose Einbrüche gebracht hatte. Für Airbus selbst bedeutet die Lieferung einen bemerkenswerten Schub im chinesischen Markt. Der Auftrag war China Southern Airlines zufolge rund 12,25 Milliarden US-Dollar wert.
Die Auslieferungen sollen von 2024 bis 2027 erfolgen: 30 Jets im Jahr 2024, 40 im Jahr 2025, 19 im Jahr 2026 und sieben im Jahr 2027. “Der Vorstand ist der Ansicht, dass der Flugzeugkauf mit der im 14. Fünfjahresplan des Unternehmens festgelegten Flottenstrategie übereinstimmt”, teilte die Fluggesellschaft mit und fügte an, dass der Kauf zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen werde. ari/rtr
Bill Nelson, der Chef der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa, hält Chinas Raumfahrt-Programm für militärisch motiviert. Das erklärte der 79-Jährige am Samstag in einem Interview mit der Bild-Zeitung. “Wir müssen sehr besorgt darüber sein, dass China auf dem Mond landet und sagt: Das gehört jetzt uns, und ihr bleibt draußen”, so der ehemalige Astronaut.
Anders als beim “Artemis”-Programm der Amerikaner seien die Chinesen nicht gewillt, ihre Forschungsergebnisse zu teilen und den Mond gemeinsam zu nutzen. “Es gibt ein neues Rennen zum Weltraum – diesmal mit China”, so der Nasa-Chef. Mit dem “Artemis”-Programm will die amerikanische Raumfahrtbehörde zum ersten Mal seit 50 Jahren amerikanische Astronauten auf den Mond bringen.
China hat bereits mehrfach Forschungsroboter auf die Mondoberfläche geschickt. Bemannte Mondmissionen sind in Planung. In den 2030er-Jahren wollen die Chinesen dann eine permanente Raumstation auf dem Mond errichten. Nasa-Chef Nelson vermutet, dass diese dazu dienen könnte, die Satelliten von anderen Nationen zu zerstören. Auch eine chinesische Zusammenarbeit mit Russland hält Nelson für denkbar. rtr/fpe
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt vor einer zu großen Abhängigkeit Deutschlands von China. “Auf manchen strategisch wichtigen Feldern ist unsere Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen deutlich größer als unsere Abhängigkeit von russischem Gas“, sagte Steinmeier in Hamburg beim Festakt zum 100. Geburtstags des Überseeclubs, der sich für Demokratie und Völkerverständigung einsetzt. Zu abhängig sei Deutschland etwa bei pharmazeutischen Produkten und “Technologien, die für die Energie- und Mobilitätswende unverzichtbar” seien.
Um sich aus der Abhängigkeit zu befreien, müsse Deutschland etwa “Metalle der seltenen Erden auch und ergänzend aus anderen Quellen” beziehen, sie recyceln oder ersetzen, so der Bundespräsident weiter. Deutschland dürfe von keinem Land der Welt erpressbar sein. China sei und bleibe ein wichtiger Partner, so Steinmeier weiter. Gleichzeitig plädiere er für neue Freihandelsabkommen mit Ländern wie Kanada, den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile “und vielen anderen”. “Vernetzung ausbauen, Verwundbarkeit abbauen, genau das muss die Maxime unseres Handelns sein und werden.” fpe
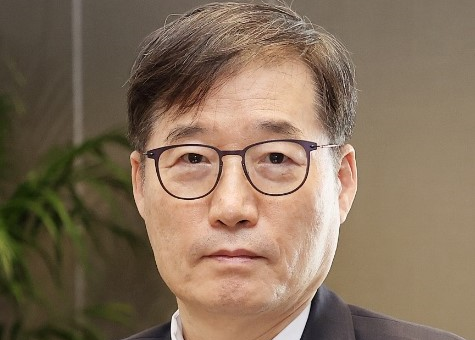
Als Joe Biden im vergangenen Monat – bei seinem ersten dortigen Amtsbesuch als US-Präsident – in Südkorea landete, fuhr er direkt zu Samsungs riesiger Halbleiterfabrik außerhalb von Seoul. Hier traf der den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol und den Samsung-Vizevorsitzenden Lee Jae-yong, und lobte den Bau einer 17-Milliarden-Dollar-Chipfabrik in Texas. Damit hätte er die wirtschaftliche und strategische Bedeutung von Halbleitern kaum klarer betonen können.
Während der Covid-19-Pandemie mussten einige industrielle Sektoren – von Automobilen bis hin zur Konsumelektronik – aufgrund der Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern ihre Herstellung verlangsamen oder gar stoppen. Ein verlässliches Angebot dieser Bauteile, so wurde klar, ist für die Widerstandskraft der Wirtschaft eines Landes von entscheidender Bedeutung. Und für die Vereinigten Staaten und China sind sie auch hinsichtlich ihres strategischen Wettbewerbs wichtig, bei dem technologische Führerschaft eine bedeutende Rolle spielt.
Momentan verfügen die USA über ein größeres Stück des globalen Halbleiterkuchens, da sie in der Chip-Architektur und im Entwurfssegment des Sektors stärker sind. Aber die überwiegende Mehrheit der Chips wird weit weg von Amerika hergestellt, darunter auch in der Samsung-Fabrik in Xi’an, der Heimatstadt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. China – der weltweit größte Halbleitermarkt – bemüht sich, Innovationen im eigenen Land zu fördern, und investiert deshalb massiv in diesen Sektor. Werden die USA also ihren Halbleitervorsprung verlieren?
Bis jetzt hatte China Mühe, in diesem Bereich aufzuholen. Erstens kann die typische Nachzüglerstrategie – mit ihrem Schwerpunkt auf die Herstellung günstigerer, weniger hochwertiger Produkte – nicht auf Halbleiter übertragen werden, da ein fortschrittlicherer Speicherchip der “nächsten Generation” meist genauso viel oder wenig kostet wie seine Vorgänger. Ältere Chips sind daher so gut wie wertlos.
Dies bedeutet nicht, dass die Marktstellung der etablierten Konzerne uneinholbar ist. Immerhin haben es südkoreanische Firmen wie Samsung geschafft, im Halbleiterbereich japanische Konzerne wie Toshiba zu überholen. Entscheidend dafür ist eine so genannte “Leapfrogging”-Strategie: die Entwicklung fortschrittlicherer Versionen einer Technologie, bevor es der Marktführer tut. Eine solche Strategie setzt voraus, dass die Entwicklung einem relativ gut vorhersehbaren Weg folgt – im Fall von Chips beispielsweise der Vergrößerung der Kapazität von einem Kilobyte auf zwei oder vier usw. – und dass die Unternehmen Zugang zu ausländischen Technologien haben.
Südkoreanische Konzerne wie Samsung haben nie die Chips mit der geringsten Kapazität hergestellt. Stattdessen haben sie, um direkt bei ihrem Markteintritt 64K-Chips entwickeln zu können, Maschinen und Geräte von Sharp aus Japan verwendet und importiert, und die Lizenz für das Halbleiterdesign kam vom US-Unternehmen Micron Technology.
Später hat Samsung dann eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung im kalifornischen Silicon Valley aufgebaut, um noch vor den japanischen Firmen Chips mit hoher Kapazität (256K) zu entwerfen. Unterstützt wurde der Konzern dabei durch seine “Stapelmethode” für mehr Komplexität der Chips, die der “Trenching-Methode” von Firmen wie Toshiba überlegen war. Aber Samsung verwendet immer noch Hochtechnologiekomponenten, -teile und -vorprodukte aus Japan oder anderen Ländern und verlässt sich auf Software aus den USA.
In einer Zeit, in der China immer weniger Zugang zu ausländischen Technologien und Vorprodukten hat, wird es dem Land schwerfallen, die Leapfrogging-Strategie nachzuahmen. Halbleiter und andere hochmoderne Sektoren werden von einer sehr kleinen Anzahl von Unternehmen dominiert. In manchen Fällen kann ein bestimmtes Produkt oder Vorprodukt von nur einer oder zwei Firmen geliefert werden.
Diese Unternehmen sitzen größtenteils in den USA oder Europa. So ist das niederländische Unternehmen ASML der einzige Hersteller von Extrem-Ultraviolett-Lithografiemaschinen (EUV), die für den Chipherstellungsprozess entscheidend sind, und die Software wird von US-Konzernen dominiert.
Dies bedeutet nicht, dass China keine Chance hat, eine fortschrittliche – oder gar weltweit führende – Halbleiterindustrie zu entwickeln. Auch wenn dies sicherlich nicht über Nacht geschieht, gibt es für das Land Möglichkeiten, seine Aussichten zu verbessern.
Zunächst einmal ist der Markt für Speicherchips zwar einheitlich – also ohne hoch- oder geringwertige Segmente -, aber der Markt für Systemchips (oder anwendungsspezifische integrierte Schaltkreis-Chips) ist je nach Anwendung segmentiert. Automobilkonzerne beispielsweise benötigen nicht die fortschrittlichsten Produktlinien, die durch die lithografische Herstellung im Bereich von unter zehn Nanometern gekennzeichnet sind. Stattdessen setzen sie 20 Nanometer- oder 30 Nanometer-Prozesstechnologien ein, deren Transfer nicht so streng kontrolliert wird. In diesem Segment erzielt der chinesische Hersteller SMIC enorme Gewinne, die wiederum in fortschrittlichere Chips der zukünftigen Generationen investiert werden können.
Echte “Leapfrogging”-Erfolge werden die Chinesen allerdings erst erzielen, wenn sie einen neuen technologischen Weg finden, der von dem der Marktführer abweicht und damit weniger von westlichen Technologien abhängig ist. Beispielsweise behauptet Micron Technology, Chips der nächsten Generation könnten – anstatt mit EUV – auch mit den neuesten Maschinen mithilfe von “tiefer ultravioletter Lithografie” (DUV) hergestellt werden. Diese Art alternativen Denkens könnte stark dazu beitragen, Chinas Aussichten im Halbleiterbereich zu verbessern.
Hier sind auch die schnell wachsenden wissenschaftlichen Fähigkeiten des Landes von Vorteil. Zwischen 2013 und 2018 ist der chinesische Anteil von Artikeln in informationstechnischen Zeitschriften von 22,4 Prozent auf fast 40 Prozent gestiegen, während der amerikanische von über 20 Prozent auf 16 Prozent gesunken ist.
Außerdem könnten die Restriktionen gegen Chinas Zugang zu ausländischen Technologien bald gelockert werden. Manche argumentieren, diese Maßnahmen gegen chinesische Hersteller, darunter auch Halbleiterhersteller, förderten über das verminderte Angebot die schnell steigende US-Inflation. Diesem Effekt soll durch ein neues US-Innovations- und Wettbewerbsgesetz entgegengewirkt werden. Demnach sollen Halbleiterfirmen mit 50 Milliarden Dollar subventioniert werden sollen, was auch ausländische Konzerne wie Samsung oder TSMC mit einschließen könnte. Aber Kritiker weisen darauf hin, dass die Unternehmen diese Subventionen, anstatt sie in Produktionsstätten zu investieren, durch andere Maßnahmen wie Aktienrückkäufe verschwenden könnten. Und es ist noch nicht klar, ob das Gesetz überhaupt eingeführt wird.
Kurz vor den Zwischenwahlen steht die Biden-Regierung vor einem Dilemma: Lockert sie die Restriktionen gegen chinesische Unternehmen wie Chiphersteller, könnte dies den Inflationsdruck lindern, was laut Biden “innenpolitisch oberste Priorität” besitzt. Gleichzeitig könnten sie es China damit aber ermöglichen, bei seiner Innovationsstrategie Fortschritte zu machen. Bleiben die Restriktionen, wird die Halbleiterknappheit wahrscheinlich weiterhin zur Verstärkung der Inflation beitragen, und China könnte letztlich trotzdem seinen eigenen alternativen Weg zur Spitze finden.
Keun Lee, Vizevorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats für den südkoreanischen Präsidenten, ist Professor für Ökonomie an der Nationaluniversität von Seoul und Verfasser von China’s Technological Leapfrogging and Economic Catch-up: A Schumpeterian Perspective (Oxford University Press, 2022).
Übersetzung: Harald Eckhoff. Copyright: Project Syndicate, 2022.
www.project-syndicate.org
vor gut einer Woche hat eine exklusive Umfrage von China.Table beim Marktforschungsinstitut Civey gezeigt, dass immer mehr Menschen Waren aus Zwangsarbeit ablehnen. Die Politik reagiert auf diese Haltung mit Gesetzen zu Lieferketten wie Deutschland und Europa oder dem Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit durch Uiguren in den USA.
In unserer heutigen Ausgabe geht es nun um die Herstellung jener Waren: Marcel Grzanna hat mit Menschen gesprochen, die in chinesischen Fabriken unter Zwang arbeiten mussten. Wer vom Schicksal von Gulzira Auyelkhan liest, erkennt, wie weit das System reicht: Es geht um willkürliche Verhaftungen, um Stromrechnungen für Mitarbeiter und um Kredite, bei denen Menschen zwar nie das Geld erhalten und dennoch riesige Schulden abarbeiten müssen. Am Ende bleibt ein kümmerlicher Lohn für viel harte Arbeit: rund 15 Euro im Monat.
Unsere zweite Analyse widmet sich der Zukunft von Mobilität. So manch einer sieht dem Boom des Elektro-Antriebs sehr skeptisch gegenüber und sieht in Wasserstoff eine weitaus zukunftsträchtigere Alternative. Entsprechend hat sich Christian Domke Seidel angeschaut, wie weit China im Bereich Wasserstoff-Mobilität bereits gekommen ist. Schließlich wurde bei den Olympischen Spielen in Peking öffentlichkeitswirksam der reibungslose Einsatz von Bussen und Shuttles mit Wasserstoffantrieb angepriesen.
Doch bei genauerem Hinsehen wird klar: Pekings Wasserstoff-Pläne sind zwar mehr als ambitioniert. Doch in naher Zukunft wird Wasserstoff noch nicht für Autos genutzt werden. Die Energie wird aktuell vielmehr in anderen Bereichen benötigt.
Vor wenigen Tagen hat Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich übernommen. Wir blicken darauf, was das für die EU-China-Politik bedeuten könnte. Denn obwohl Tschechien im Gegensatz zu Frankreich Teil von Pekings “16+1”-Format ist, sind die Fronten alles andere als eindeutig. Unter dem Vorsitz des mit Kiew sympathisierenden Prags wird die EU vor allem das Verhältnis zwischen Peking und Moskau genau im Blick behalten. Weitere potenzielle Reizthemen sind Taiwan, Litauen sowie engere Beziehungen zu Indo-Pazifik-Anrainern wie Australien, Korea und Indien.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wer Hunger hatte, durfte sich an gekochtem Reis satt essen – geschmacklos, ohne Beilagen, wenig Nährstoffe. Doch in der Weberei des Textilindustrieparks im Landkreis Yining im Nordwesten Xinjiangs an der Grenze zu Kasachstan bot die Küche auch Alternativen. Gefüllte Teigtaschen zum Beispiel mit Gemüse, dazu leckere Soßen – allerdings nur gegen Bezahlung. Ähnlich wie in der Kantine eines deutschen Unternehmens, könnte man meinen.
Doch die Arbeiterinnen im Industriepark Yining können sich die anständigen Mahlzeiten nicht leisten. Der Lohn, der der ehemaligen Mitarbeiterin Gulzira Auyelkhan seinerzeit zugesagt wurde, betrug 600 Yuan pro Monat, damals rund 75 Euro. Das sind fast 1.000 Yuan weniger als der gesetzlichen Mindestlohn in der Region. Selbst im abgelegenen Yining sind 75 Euro für einen Monat Arbeit sehr dürftig. Auf die Teigtaschen musste Gulzira Auyelkhan deshalb verzichten.
Die Kasachin nähte von morgens bis abends Lammfell-Handschuhe. Sie machte die schlecht bezahlte Arbeit nicht freiwillig. Sie sei von chinesischen Behörden dazu gezwungen worden, sagt sie im Gespräch mit China.Table. Heute lebt sie am Stadtrand von Washington. Die USA gewährten ihr politisches Asyl. Sie gehört zu jenen Geflüchteten, die dem US-Senat später über die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang öffentlich Auskunft gaben.
Eine Expertenkommission der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) hatte der Volksrepublik China Ende vergangenen Jahres vorgeworfen, durch ein “weit verbreitetes und systematisches” Zwangsarbeitsprogramm gegen internationale Konventionen zu verstoßen. Davon betroffen sind in erster Linie Uiguren und andere muslimische Minderheiten.
Besonders Branchen wie die Textilindustrie, die Landwirtschaft oder die Solarindustrie gelten als Risikosektoren, in denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Zwangsarbeit in die Wertschöpfung einfließt. Vor allem in Xinjiang sei das Problem markant. Laut IAO-Bericht seien zudem rund 80.000 Uiguren in andere Landesteile deportiert worden, um auch dort für minimale Löhne arbeiten zu müssen.
China.Table liegen auch Aussagen von Behördenvertretern vor, die mit der Organisation der Zwangsarbeit befasst waren. “Um der Zwangsarbeit einen Anstrich der Legalität zu verpassen, nötigten die Behörden die Frauen in Yining dazu, einen Kredit bis zu einer Höhe von 10.000 Yuan bei einer örtlichen Bank zu beantragen“, sagt Gulipiyan Hazibek.
Die gelernte Medizinerin hat ebenfalls kasachische Wurzeln, sie wurde als studierte Kraft in den chinesischen Staatsdienst bestellt. 22 Jahre lang arbeitete sie für die chinesische Verwaltung, ehe sie aus gesundheitlichen Gründen als ethnische Kasachin nach Kasachstan ausreisen durfte und die dortige Staatsbürgerschaft annahm.
Zuletzt war sie dafür zuständig, Frauen aus den Dörfern der Region aufzutreiben, um sie für die Arbeit in den Fabriken zu rekrutieren. “Ich musste die Frauen dazu zwingen, mitzukommen. Auch alte Frauen, kranke oder gehandicapte. Wer sich weigerte, musste mit harten Strafen rechnen“, sagt Hazibek im Gespräch mit China.Table. Je nach Leistungsfähigkeit wurden die Frauen für verschiedene Tätigkeiten in der Produktion eingesetzt.
Der Knackpunkt war nun der Kreditvertrag, den die Frauen bereits unterschrieben hatten. Das Geld sei nach der Unterzeichnung der Papiere nie geflossen, sagt Hazibek. Dennoch seien die Frauen verschuldet gewesen, und zwar so hoch, dass eine Rückzahlung fast immer unmöglich war. Um ihre Zwangsanstellung zu rechtfertigen, argumentierten die Behörden, die Frauen müssten die Summe in den örtlichen Fabriken abarbeiten.
Auch die Handschuh-Näherin Gulzira Auyelkhan sollte ein solches Papier unterschreiben. Im Juli 2017 war sie aus Kasachstan nach Xinjiang eingereist, um in ihrem Heimatdorf ihren kranken Vater zu besuchen. Drei Jahre zuvor hatte sie die Volksrepublik mit ihrem Ehemann und ihren Kindern verlassen, um in Kasachstan ein neues Leben zu beginnen. Damals, 2014, hatte die chinesische Regierung den “Harten Schlag gegen gewaltbereiten Terrorismus” (严厉打击暴力恐怖活动专项行动) begonnen. Die Kampagne richtete sich gegen Uiguren und andere Minderheiten in Xinjiang.
Nach ihrer Ausreise hatte Auyelkhan die kasachische Staatsbürgerschaft angenommen und glaubte deswegen, in Xinjiang sicher zu sein, als sie erstmals wieder dorthin zurückkehrte. Doch sie irrte. Kurz hinter der Grenze nahm man sie fest und internierte sie. “Man warf mir vor, nicht so zu denken, wie die Kommunistische Partei es gerne hätte. Deshalb wurde entschieden, mich umzuerziehen”, sagt sie China.Table. 15 Monate lang steckte man sie in ein Internierungslager.
Als Kasachin hatte sie stets die Hoffnung gehabt, durch internationalen Druck freizukommen. Auch deshalb widersetzte sich Auyelkhan, einen Kreditvertrag zu unterschreiben. Uigurischen Frauen mit chinesischer Staatsbürgerschaft dagegen wurde gedroht, sie lange einzusperren. Der Zwangsarbeit entkam Auyelkhan dennoch nicht. Nach der Zeit im Lager arbeitete sie auf behördliche Anordnung vom 14. Oktober 2018 bis zum 29. Dezember desselben Jahres mindestens zwölf, manchmal 16 Stunden täglich.
Auch während dieser Zeit standen die Frauen unter strenger Überwachung. Die Arbeit in der Fabrik ähnelte sehr der Internierung im Lager. Die Zeit nach der Arbeit verbrachten sie in Gemeinschaftsunterkünften, drei Kilometer von der Fabrik entfernt. Manchmal waren die Arbeitstage derart lang, dass die Frauen direkt in der Fabrik schliefen. Es war ihnen verboten, allein in den Schlafsaal zurückzukehren.
Ihr verdientes Geld floss auf eigens eingerichtete Bankkonten der Arbeiterinnen. Doch Zugriff darauf bekamen sie nicht. Stattdessen wurden Kosten für ihre Unterkunft samt Nebenkosten für Strom automatisch abgebucht. Auch die Pendelei zwischen Unterkunft und Fabrik mussten sie bezahlen, sodass am Ende kaum noch Geld übrig blieb. Die Arbeiterinnen waren der Willkür der Behörden schutzlos ausgesetzt.
Die chinesische Regierung lehnt die Vorwürfe systematischer Zwangsarbeit kategorisch ab und wähnt sich als Opfer einer Schmierkampagne. Erst zu Beginn des Jahres hat das Land zwei UN-Konventionen der IAO gegen Zwangsarbeit unterschrieben. Zur Aufklärung vor Ort wäre chinesische Unterstützung unverzichtbar. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass die Behörden kooperieren werden.
Die IAO beschloss bei ihrer Jahreskonferenz vor wenigen Wochen, eine technische Beratungskommission in die Volksrepublik zu entsenden. Eine Untersuchung der Vorwürfe ist einer solchen Kommission jedoch nicht gestattet. Sie kann lediglich unterstützend auf die Einhaltung von Konventionen dringen. Um das Problem zu bekämpfen, sollen Lieferkettengesetze in Deutschland und Europa oder der Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA die Produzenten so stark unter Druck setzen, dass sie das System der Zwangsarbeit einstellen.
Gulzira Auyelkhan wurde am 30. Dezember 2018 freigelassen und fünf Tage später an die kasachische Grenze gebracht, um nach Hause zurückzukehren. Ihr Mann hatte aus Kasachstan heraus politischen Druck organisiert, der schließlich zum Erfolg führte. Als sie freikam, zahlte man ihr für die gesamte Zeit in der Fabrik 250 Yuan aus, etwas mehr als 30 Euro.

In der individuellen Mobilität wird Wasserstoff in absehbarer Zeit keine Rolle spielen. Auch nicht in China. Dafür sind Technologie und Infrastruktur im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge zu weit fortgeschritten. Nennenswerte Marktchancen gibt es nur im Bereich der Lkw und Busse. So fasst Dirk Niemeier den Wasserstoff-Markt in der Volksrepublik China zusammen. Niemeier ist Direktor von Strategy&, der Strategieberatung von PricewaterhouseCoopers (PwC). Der vorhandene Wasserstoff werde an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt. Das gelte auch für die Unmengen an Energie, die zu seiner Produktion benötigt werden.
China setzt durchaus auf Wasserstoff als universellen Energieträger. “Es ist in diesem Bereich ein ähnliches Wachstum geplant wie in Europa. Allerdings sehr viel später, weil es noch wenig Regularien und Förderungen gibt”, sagte Niemeier gegenüber Table.Media. Es gebe langfristige Zielsetzungen, aber noch keine aktuellen Gesetze, die den Einsatz im größeren Stil in der Industrie forcieren.
Chinas Pläne im Bereich des Wasserstoffs klingen ambitioniert. Ab dem Jahr 2025 sollen jährlich 100.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden (China.Table berichtete). Im gleichen Zeitraum sollen 30 Gigawatt Speicherkapazität entstehen. Parallel entstehen Versuchsflotten von Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Bei den Olympischen Spielen fuhren bereits entsprechende Busse und Shuttles. Bis 2025 sollen insgesamt 50.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf der Straße sein. Diese Zahl teilt sich in 40.000 Pkw und 10.000 Lkw auf.
Aktuell produziert China 33 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr – hauptsächlich grauer Wasserstoff, der aus Erdgas, Kohle und Öl erzeugt wird (China.Table berichtete). Der Wasserstoff geht nahezu vollständig in die Chemieindustrie, wo er als Ausgangsstoff dient. Auch die versprochenen 30 Gigawatt Speicherkapazität sind gerade einmal vier Prozent der ebenfalls geplanten 800 Gigawatt an zusätzlichen Erzeugungsmenge.
Dazu kommen die ambitionierten Ziele bei der Reduktion der Treibhausgase. China möchte bis 2060 klimaneutral sein. Der größte Stolperstein dabei ist die Abhängigkeit von Kohlekraftwerken. Die geplanten Solar- und Windkraftanlagen müssen also langfristig die Energie der Kohlekraftwerke ersetzen. Das heißt, sie steht nicht für extrem energieaufwändige Zusatzprojekte wie den Ausbau der Wasserstoffindustrie zur Verfügung, wie Niemeyer erklärt.
Während Kohlekraftwerke zwischen 7.000 und 8.000 Stunden im Jahr Strom produzieren, tun Windräder das nur an etwa 2.500 Stunden pro Jahr. Das bedeutet, dass für die gleiche Menge Strom sehr viel mehr Leistung installiert werden muss. Zudem sind riesige Energiespeicher notwendig. Das führt zu einem Marktnachteil: “Grüner Wasserstoff ist derzeit noch deutlich teurer als grauer Wasserstoff. Insbesondere, wenn es keinen CO2-Preis für die fossilen Ausgangsprodukte gibt”, sagt Niemeier. Solange dieser Unterschied bestehe, rechne PwC mit Stagnation des Geschäfts.
Doch natürlich wird auch in China die Erforschung von Wasserstoff vorangetrieben. “Es gibt fünf Citycluster, in denen die Erzeugung und Verwendung von grünem Wasserstoff und Fuelcell-Fahrzeugen forciert wird”, erklärt Niemeier. “Weil deren Wasserstoffbedarf geringer ist, lässt sich dieser Bereich leichter mit kleineren dezentralen Anlagen entwickeln.”
Mit entsprechenden Erfolgen. “In China kommen deutlich günstigere Geräte und Aggregate zum Einsatz. Allerdings ist ihr Wirkungsgrad geringer.” Falls der Markt zukünftig stark wachse, könnten die günstigeren Geräte eine Rolle spielen. Ausländische Investoren und Firmen sind dabei nicht vorgesehen. Die Förderungen in diesem Bereich zielen darauf ab, eine lokale Wertschöpfung zu erhalten, während Elektroautos noch mit der Gießkanne gefördert wurden.
Entsprechend weit sind auch Brennstoffzellen-Fahrzeuge davon entfernt, im Alltag eine Rolle zu spielen. “Nach unserer Einschätzung werden batterieelektrische Pkw nicht von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen abgelöst werden.” Vor allem auch, weil die notwendige Infrastruktur nicht existiert, die Elektro-Ladeinfrastruktur aber sehr wohl. Zwar arbeitet die Kommunistische Partei am Aufbau eines Tankstellennetzes, das jedoch in erster Linie für Busse und Lkw gedacht sei. Diese seien technisch jedoch ungeeignet, auch Pkw zu bedienen, so Niemeier.
Vor wenigen Tagen hat Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich übernommen. Auch in der zweiten Jahreshälfte wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen die Tagesordnungen dominieren. Indirekt hat das auch weiterhin Auswirkungen auf die China-Politik der EU-Staaten – denn unter dem Vorsitz des mit Kiew sympathisierenden Prags wird die EU das Verhältnis zwischen Peking und Moskau genau beobachten. Unklarer steht es um die bilateralen Beziehungen. Denn in Prag selbst gibt es unterschiedliche Ansichten, wie mit Peking umgegangen werden soll.
Tschechien hat “Europe as a Task: Rethink, Rebuild, Repower” (auf Deutsch: “Europa als Aufgabe: Umdenken, umbauen, umgestalten”) als Leitsatz für den Vorsitz gewählt. Das Motto verweist auf ein gleichnamiges Werk von Menschenrechtler und Politiker Václav Havel. Die Stärkung der Demokratie und wie sich diese gegen Autokratien aufstellen kann, ist damit als ein Rahmen der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft zu erwarten. Peking könnte diese Gegenüberstellung eher weniger gefallen.
Für das EU-China-Verhältnis wichtige Punkte des tschechischen Ratsvorsitzes:
Auf dem Schwarzmarkt für Daten sind persönliche Informationen von rund einer Milliarde chinesischer Bürger aufgetaucht. Zum Preis von zehn Bitcoin (gut 180.000 Euro) bieten die unbekannten Hacker den Daten-Schatz feil. Die Kryptowährungs-Plattform Binance machte das Angebot am Sonntag über Twitter öffentlich. Auf Chinas Sozialmedien sind seit Montag die Suche nach “Datenleck” blockiert.
Besonders heikel ist die angebliche Quelle der Datensätze. Sie sollen aus der Dienststelle des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (公安部) in Shanghai stammen. Das würde bedeuten: Chinas mächtige Staatssicherheit wurde gehackt. Laut Binance-Chef Zhao Changpeng hat ein Behörden-Programmierer in seinem persönlichen Blog einen Anfängerfehler gemacht, was den Zugriff auf die Server seines Arbeitgebers möglich gemacht habe.
Zu den gestohlenen Daten gehören Name, Adresse, Personalausweisnummer, Geburtsort, Telefonnummer und dergleichen. Die Personalausweisnummer und die Telefonnummer dienen in China der universellen Identifikation zum Beispiel bei Bankgeschäften in der App, beim Online-Kauf von Waren oder Fahrkarten – oder gegenüber den Behörden. Binance selbst verlangt von betroffenen Nutzern daher jetzt eine zusätzliche Authentifizierung. fin
Das Europaparlament befasst sich in seiner aktuellen Sitzungswoche mit der Verhaftung des römisch-katholischen Kardinals Joseph Zen in Hongkong. Die Abgeordneten werden am Mittwoch mit der EU-Kommission über die aktuelle Lage in Hongkong und die Festnahme des 90 Jahre alten Geistlichen sowie Mitglieder des “612 Humanitarian Relief Fund” Ende Mai debattieren. Aller Voraussicht nach wird das Vorgehen gegen Zen und die weiteren Inhaftierten in einer Resolution am Donnerstag zur Abstimmung kommen. In dieser wird ihre Freilassung gefordert, wie aus einem Entwurf des Papiers hervorgeht.
Kardinal Zen wird vorgeworfen, gegen das Nationale Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, indem er sich mit ausländischen Kräften gegen die nationalen Interessen der Stadt verschworen habe. Hintergrund für den Vorwurf ist Zens Rolle als Treuhänder des “612 Humanitarian Relief Fund”, der Geld gesammelt hat, um angeklagten Mitgliedern der Hongkonger Protestbewegung rechtlichen Beistand zu finanzieren (China.Table berichtete). Die Abstimmungen des EU-Parlaments stellen den Standpunkt der Abgeordneten dar und geben der Kommission eine Handlungsempfehlung. Sie sind allerdings nicht bindend. ari
China Southern Airlines plant, 96 Airbus A320neo-Jets zu ordern. Dabei handelt es sich um die größte Bestellung neuer Flugzeuge seit Beginn der Corona-Pandemie, die für die Flugzeug- und Reisebranche beispiellose Einbrüche gebracht hatte. Für Airbus selbst bedeutet die Lieferung einen bemerkenswerten Schub im chinesischen Markt. Der Auftrag war China Southern Airlines zufolge rund 12,25 Milliarden US-Dollar wert.
Die Auslieferungen sollen von 2024 bis 2027 erfolgen: 30 Jets im Jahr 2024, 40 im Jahr 2025, 19 im Jahr 2026 und sieben im Jahr 2027. “Der Vorstand ist der Ansicht, dass der Flugzeugkauf mit der im 14. Fünfjahresplan des Unternehmens festgelegten Flottenstrategie übereinstimmt”, teilte die Fluggesellschaft mit und fügte an, dass der Kauf zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen werde. ari/rtr
Bill Nelson, der Chef der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa, hält Chinas Raumfahrt-Programm für militärisch motiviert. Das erklärte der 79-Jährige am Samstag in einem Interview mit der Bild-Zeitung. “Wir müssen sehr besorgt darüber sein, dass China auf dem Mond landet und sagt: Das gehört jetzt uns, und ihr bleibt draußen”, so der ehemalige Astronaut.
Anders als beim “Artemis”-Programm der Amerikaner seien die Chinesen nicht gewillt, ihre Forschungsergebnisse zu teilen und den Mond gemeinsam zu nutzen. “Es gibt ein neues Rennen zum Weltraum – diesmal mit China”, so der Nasa-Chef. Mit dem “Artemis”-Programm will die amerikanische Raumfahrtbehörde zum ersten Mal seit 50 Jahren amerikanische Astronauten auf den Mond bringen.
China hat bereits mehrfach Forschungsroboter auf die Mondoberfläche geschickt. Bemannte Mondmissionen sind in Planung. In den 2030er-Jahren wollen die Chinesen dann eine permanente Raumstation auf dem Mond errichten. Nasa-Chef Nelson vermutet, dass diese dazu dienen könnte, die Satelliten von anderen Nationen zu zerstören. Auch eine chinesische Zusammenarbeit mit Russland hält Nelson für denkbar. rtr/fpe
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt vor einer zu großen Abhängigkeit Deutschlands von China. “Auf manchen strategisch wichtigen Feldern ist unsere Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen deutlich größer als unsere Abhängigkeit von russischem Gas“, sagte Steinmeier in Hamburg beim Festakt zum 100. Geburtstags des Überseeclubs, der sich für Demokratie und Völkerverständigung einsetzt. Zu abhängig sei Deutschland etwa bei pharmazeutischen Produkten und “Technologien, die für die Energie- und Mobilitätswende unverzichtbar” seien.
Um sich aus der Abhängigkeit zu befreien, müsse Deutschland etwa “Metalle der seltenen Erden auch und ergänzend aus anderen Quellen” beziehen, sie recyceln oder ersetzen, so der Bundespräsident weiter. Deutschland dürfe von keinem Land der Welt erpressbar sein. China sei und bleibe ein wichtiger Partner, so Steinmeier weiter. Gleichzeitig plädiere er für neue Freihandelsabkommen mit Ländern wie Kanada, den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile “und vielen anderen”. “Vernetzung ausbauen, Verwundbarkeit abbauen, genau das muss die Maxime unseres Handelns sein und werden.” fpe
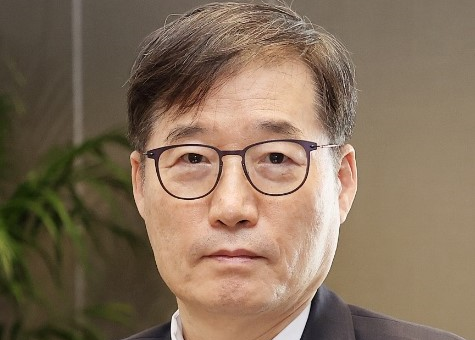
Als Joe Biden im vergangenen Monat – bei seinem ersten dortigen Amtsbesuch als US-Präsident – in Südkorea landete, fuhr er direkt zu Samsungs riesiger Halbleiterfabrik außerhalb von Seoul. Hier traf der den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol und den Samsung-Vizevorsitzenden Lee Jae-yong, und lobte den Bau einer 17-Milliarden-Dollar-Chipfabrik in Texas. Damit hätte er die wirtschaftliche und strategische Bedeutung von Halbleitern kaum klarer betonen können.
Während der Covid-19-Pandemie mussten einige industrielle Sektoren – von Automobilen bis hin zur Konsumelektronik – aufgrund der Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern ihre Herstellung verlangsamen oder gar stoppen. Ein verlässliches Angebot dieser Bauteile, so wurde klar, ist für die Widerstandskraft der Wirtschaft eines Landes von entscheidender Bedeutung. Und für die Vereinigten Staaten und China sind sie auch hinsichtlich ihres strategischen Wettbewerbs wichtig, bei dem technologische Führerschaft eine bedeutende Rolle spielt.
Momentan verfügen die USA über ein größeres Stück des globalen Halbleiterkuchens, da sie in der Chip-Architektur und im Entwurfssegment des Sektors stärker sind. Aber die überwiegende Mehrheit der Chips wird weit weg von Amerika hergestellt, darunter auch in der Samsung-Fabrik in Xi’an, der Heimatstadt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. China – der weltweit größte Halbleitermarkt – bemüht sich, Innovationen im eigenen Land zu fördern, und investiert deshalb massiv in diesen Sektor. Werden die USA also ihren Halbleitervorsprung verlieren?
Bis jetzt hatte China Mühe, in diesem Bereich aufzuholen. Erstens kann die typische Nachzüglerstrategie – mit ihrem Schwerpunkt auf die Herstellung günstigerer, weniger hochwertiger Produkte – nicht auf Halbleiter übertragen werden, da ein fortschrittlicherer Speicherchip der “nächsten Generation” meist genauso viel oder wenig kostet wie seine Vorgänger. Ältere Chips sind daher so gut wie wertlos.
Dies bedeutet nicht, dass die Marktstellung der etablierten Konzerne uneinholbar ist. Immerhin haben es südkoreanische Firmen wie Samsung geschafft, im Halbleiterbereich japanische Konzerne wie Toshiba zu überholen. Entscheidend dafür ist eine so genannte “Leapfrogging”-Strategie: die Entwicklung fortschrittlicherer Versionen einer Technologie, bevor es der Marktführer tut. Eine solche Strategie setzt voraus, dass die Entwicklung einem relativ gut vorhersehbaren Weg folgt – im Fall von Chips beispielsweise der Vergrößerung der Kapazität von einem Kilobyte auf zwei oder vier usw. – und dass die Unternehmen Zugang zu ausländischen Technologien haben.
Südkoreanische Konzerne wie Samsung haben nie die Chips mit der geringsten Kapazität hergestellt. Stattdessen haben sie, um direkt bei ihrem Markteintritt 64K-Chips entwickeln zu können, Maschinen und Geräte von Sharp aus Japan verwendet und importiert, und die Lizenz für das Halbleiterdesign kam vom US-Unternehmen Micron Technology.
Später hat Samsung dann eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung im kalifornischen Silicon Valley aufgebaut, um noch vor den japanischen Firmen Chips mit hoher Kapazität (256K) zu entwerfen. Unterstützt wurde der Konzern dabei durch seine “Stapelmethode” für mehr Komplexität der Chips, die der “Trenching-Methode” von Firmen wie Toshiba überlegen war. Aber Samsung verwendet immer noch Hochtechnologiekomponenten, -teile und -vorprodukte aus Japan oder anderen Ländern und verlässt sich auf Software aus den USA.
In einer Zeit, in der China immer weniger Zugang zu ausländischen Technologien und Vorprodukten hat, wird es dem Land schwerfallen, die Leapfrogging-Strategie nachzuahmen. Halbleiter und andere hochmoderne Sektoren werden von einer sehr kleinen Anzahl von Unternehmen dominiert. In manchen Fällen kann ein bestimmtes Produkt oder Vorprodukt von nur einer oder zwei Firmen geliefert werden.
Diese Unternehmen sitzen größtenteils in den USA oder Europa. So ist das niederländische Unternehmen ASML der einzige Hersteller von Extrem-Ultraviolett-Lithografiemaschinen (EUV), die für den Chipherstellungsprozess entscheidend sind, und die Software wird von US-Konzernen dominiert.
Dies bedeutet nicht, dass China keine Chance hat, eine fortschrittliche – oder gar weltweit führende – Halbleiterindustrie zu entwickeln. Auch wenn dies sicherlich nicht über Nacht geschieht, gibt es für das Land Möglichkeiten, seine Aussichten zu verbessern.
Zunächst einmal ist der Markt für Speicherchips zwar einheitlich – also ohne hoch- oder geringwertige Segmente -, aber der Markt für Systemchips (oder anwendungsspezifische integrierte Schaltkreis-Chips) ist je nach Anwendung segmentiert. Automobilkonzerne beispielsweise benötigen nicht die fortschrittlichsten Produktlinien, die durch die lithografische Herstellung im Bereich von unter zehn Nanometern gekennzeichnet sind. Stattdessen setzen sie 20 Nanometer- oder 30 Nanometer-Prozesstechnologien ein, deren Transfer nicht so streng kontrolliert wird. In diesem Segment erzielt der chinesische Hersteller SMIC enorme Gewinne, die wiederum in fortschrittlichere Chips der zukünftigen Generationen investiert werden können.
Echte “Leapfrogging”-Erfolge werden die Chinesen allerdings erst erzielen, wenn sie einen neuen technologischen Weg finden, der von dem der Marktführer abweicht und damit weniger von westlichen Technologien abhängig ist. Beispielsweise behauptet Micron Technology, Chips der nächsten Generation könnten – anstatt mit EUV – auch mit den neuesten Maschinen mithilfe von “tiefer ultravioletter Lithografie” (DUV) hergestellt werden. Diese Art alternativen Denkens könnte stark dazu beitragen, Chinas Aussichten im Halbleiterbereich zu verbessern.
Hier sind auch die schnell wachsenden wissenschaftlichen Fähigkeiten des Landes von Vorteil. Zwischen 2013 und 2018 ist der chinesische Anteil von Artikeln in informationstechnischen Zeitschriften von 22,4 Prozent auf fast 40 Prozent gestiegen, während der amerikanische von über 20 Prozent auf 16 Prozent gesunken ist.
Außerdem könnten die Restriktionen gegen Chinas Zugang zu ausländischen Technologien bald gelockert werden. Manche argumentieren, diese Maßnahmen gegen chinesische Hersteller, darunter auch Halbleiterhersteller, förderten über das verminderte Angebot die schnell steigende US-Inflation. Diesem Effekt soll durch ein neues US-Innovations- und Wettbewerbsgesetz entgegengewirkt werden. Demnach sollen Halbleiterfirmen mit 50 Milliarden Dollar subventioniert werden sollen, was auch ausländische Konzerne wie Samsung oder TSMC mit einschließen könnte. Aber Kritiker weisen darauf hin, dass die Unternehmen diese Subventionen, anstatt sie in Produktionsstätten zu investieren, durch andere Maßnahmen wie Aktienrückkäufe verschwenden könnten. Und es ist noch nicht klar, ob das Gesetz überhaupt eingeführt wird.
Kurz vor den Zwischenwahlen steht die Biden-Regierung vor einem Dilemma: Lockert sie die Restriktionen gegen chinesische Unternehmen wie Chiphersteller, könnte dies den Inflationsdruck lindern, was laut Biden “innenpolitisch oberste Priorität” besitzt. Gleichzeitig könnten sie es China damit aber ermöglichen, bei seiner Innovationsstrategie Fortschritte zu machen. Bleiben die Restriktionen, wird die Halbleiterknappheit wahrscheinlich weiterhin zur Verstärkung der Inflation beitragen, und China könnte letztlich trotzdem seinen eigenen alternativen Weg zur Spitze finden.
Keun Lee, Vizevorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats für den südkoreanischen Präsidenten, ist Professor für Ökonomie an der Nationaluniversität von Seoul und Verfasser von China’s Technological Leapfrogging and Economic Catch-up: A Schumpeterian Perspective (Oxford University Press, 2022).
Übersetzung: Harald Eckhoff. Copyright: Project Syndicate, 2022.
www.project-syndicate.org
