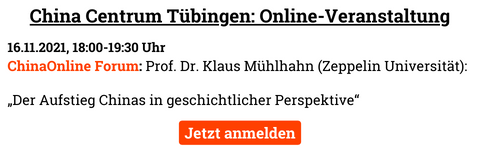In China gelten Wissenschaft, Innovation und Forschung als die entscheidenden Triebkräfte des wirtschaftlichen Fortschritts. Ruth Schimanowski vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) betont, Deutschland solle davon lernen. Im CEO-Talk mit Frank Sieren plädiert sie für den Aufbau von China-Kompetenz in der Bundesrepublik. Und auch die akademische Kooperation zwischen den beiden Staaten müsse gestärkt werden. Allerdings bremst Chinas “No-Covid”-Strategie und das häufig bürokratische Vorgehen chinesischer Hochschulen den akademischen Austausch, sagt Schimanowski, die seit 20 Jahren im Land ist.
Pekings strenge “No-Covid”-Strategie haben sich Jörn Petring und Gregor Koppenburg angeschaut. Während viele Regierungen die Corona-Maßnahmen lockern, verfolgt Peking noch immer den Ansatz, das Virus komplett aus dem Land zu halten. Die Abschottung wird eher verschärft, wie der Winterflugplan in die Volksrepublik jüngst zeigte. Es ist noch lange mit Einschränkungen zu rechnen.
Bisher fahren nur gut 1.000 Aiways U5 auf deutschen Straßen. Doch laut Christian Domke Seidel könnte sich das bald schon ändern. Der E-SUV der chinesischen Marke hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und überzeugt schon in vielen Belangen, so das Fazit nach der Testfahrt. Wenn die Probleme beim Crashtest und die Mängel bei der Digitalisierung behoben werden, könnte der Aiways deutschen Anbietern schon bald Konkurrenz machen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!


Ruth Schimanowski hat einen großen Teil ihrer Kindheit in Afrika verbracht. Erst mit 15 kehrte sie nach Deutschland zurück und machte dort das Abitur. Danach zog es sie gleich wieder raus – nach Taipeh, um dort Mandarin zu lernen. Dann wieder zurück nach Berlin, wo sie ein Physikstudium und mehreren Stationen im Ausland absolvierte: Nach Peking kam sie erstmals als DAAD-Stipendiatin. Zwischendurch ging sie nach New Orleans für biophysikalische Experimente. Heute lebt sie jedoch schon seit über 20 Jahren in der chinesischen Hauptstadt.
Nicht nur Schimanowskis Lebensmittelpunkte im Laufe der Jahre, sondern auch ihre beruflichen Abschnitte sind vielfältig: Sie hat bei dem Pharmariesen Boehringer Ingelheim und im Kulturreferat der Deutschen Botschaft Peking gearbeitet. Sie war Leiterin des Verbindungsbüros des bischöflichen Hilfswerks Misereor in China und Geschäftsführerin des German Centre Beijing der LBBW. Inzwischen leitet sie die drei DAAD-Büros in China. Das Interview können Sie in voller Länger als Video ansehen.
Was sollten chinesische und deutsche Akademiker voneinander lernen?
Eine ganze Menge. Deutsche Akademiker können von chinesischen Akademikern lernen, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Wir haben hier eine unheimliche Dynamik. Das, was ich gestern gelernt habe, gilt heute nicht mehr. Man ist hier viel öfter gezwungen, auf Basis einer dünnen, intransparenten Faktenlage Entscheidungen zu treffen, die sich dann wiederum schnell überholen. Wenn ich hier etwas gelernt habe, dann zügig und instinktsicher zu entscheiden, worüber zuvor noch nie entschieden werden musste. Wenn man das kann, wächst der Optimismus, das Vertrauen in die Zukunft. Nach dem Motto: Zwar stand noch kein anderer zuvor vor dieser Herausforderung, aber wir finden eine Lösung. Dieses neue Selbstvertrauen prägt dieses Land.
Aber derzeit ist auch sehr viel im Argen in China. Wie kann man dabei optimistisch bleiben?
Aus der Sicht der meisten Menschen hier ist der Entwicklungsstand heute trotz aller Probleme sehr viel besser als das, was sie von ihren Eltern und ihren Großeltern gehört oder noch selbst erlebt haben. Viele meiner chinesischen Freunde sagen zum Beispiel heute: Ich heirate nicht. Das ist ihre Freiheit und war noch vor 20 Jahren undenkbar. Und davor konnte man sich nicht einmal aussuchen, wen man heiratet. Die Chinesen können ins Ausland gehen, mit neuen Eindrücken zurückkehren und dann entscheiden, so oder so möchte ich leben.
Und was bedeutet das für den akademischen Austausch?
Das gesellschaftliche Umfeld färbt selbstverständlich auch auf die Wissenschaft ab. In China ist der Mut und die Notwendigkeit größer, bekannte Wege zu verlassen, Neues zu denken und es auszuprobieren.
Wie wichtig sind für solche Wissenschaftler die deutschen, weltweit renommierten Forschungsstationen, wie Helmholtz, Fraunhofer oder Max Planck, die im Zweifel in der Grundlagenforschung viel weiter sind.
Sie erhöhen mit ihrer Offenheit, ihrer Neugier und ihrem Lerneifer die Vielfalt unserer Forschungslandschaft und das ist wichtig für uns. Man ist zusammen besser, wenn man unterschiedliche Denkansätze und Mentalitäten kombiniert. Wir denken noch zu sehr in Wettbewerbskategorien: Die oder wir? Wer ist schneller? Dabei sind wir gemeinsam am besten. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein gutes Beispiel dafür.
Was lernen Chinesen von uns?
Sehr viel, zumal der akademische Austausch ja schon seit über 40 Jahren läuft. Sehr lange hatte der Knowhow-Transfer eine klare Richtung: Die alte Dame Bundesrepublik hat Stipendien vergeben und damit einen großen Beitrag zur Entwicklung Chinas geleistet. Ich spüre bis heute eine große Dankbarkeit gegenüber Deutschland und auch dem DAAD dafür, gerade bei den chinesischen Deutschland-Alumni.
Warum kommen sie zu uns?
Sie kommen zu uns, weil unsere Universitäten und Forschungsstätten international ein gutes Renommee haben. Einer unserer größten Vorteile ist neben praxisorientierter Hochschulbildung die enge Verzahnung zwischen Wirtschaft und Forschung. Daraus sind unsere Hidden Champions hervorgegangen.
Sind Stipendien heute eigentlich noch wichtig?
Wir haben noch sehr vielen Stipendienprogramme, aber es ist nicht mehr so wichtig, dass der DAAD den Aufenthalt bezahlt. Anders als früher werden wir heutzutage fast überrannt von sogenannten Selbstzahlern, also Chinesen, die nach Deutschland gehen wollen und das Studium komplett selber bezahlen. Das bedeutet, sie sind nicht mehr auf unsere Stipendien angewiesen. Damit ändert sich auch unser Fokus. Viel wichtiger als früher sind inzwischen die Deutschland-Alumni. Wir finanzieren Konferenzen oder Publikationen, sorgen dafür, dass die Alumni weiter in engem Austausch bleiben. In 40 Jahren ist so ein ziemlich beeindruckendes Netzwerk entstanden.
Wie steht es mit Deutsch als Fremdsprache in China? Darum kümmert sich der DAAD ja auch. Ist das ein Auslaufmodell?
Im Gegenteil. Bei der jüngsten Deutschlernerhebung, die das Goethe-Institut und der DAAD gemeinsam mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen alle fünf Jahre durchführen, ist der Anteil der Deutschlerner in den Schulen in den letzten fünf Jahren um 33 Prozent gewachsen. Das ist sehr ermutigend und bedeutet auch mehr potenzielle Mitarbeiter für deutsche Firmen.
Das ist überraschend. Woran liegt das neue Interesse an Deutsch?
Ich würde jetzt gerne antworten, weil die Deutschen so toll Fußball spielen oder unsere Autos und deutschen Firmen so attraktiv sind. Der eigentliche Grund ist jedoch ein anderer: Die chinesische Regierung hat die Mehrsprachigkeit an den Schulen eingeführt, also nicht nur Englisch, sondern auch kleinere Sprachen. Dazu gehören Japanisch, Deutsch, Französisch, und Russisch. Das heißt, man kann an chinesischen Schulen nun eine zweite Fremdsprache lernen.
Warum hat man das gemacht?
Man will womöglich die Abhängigkeit vom angelsächsischen Raum verringern. Und: Bei uns ist es auch üblich, dass die Kinder zwei und mehr Fremdsprachen lernen. Mit dieser Entwicklung ist die Nachfrage nach Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern stark gestiegen. Dem begegnen wir mit entsprechenden Programmen.
Allerdings ist der persönliche Austausch mit Deutschland durch die Corona-Strategie Pekings praktisch komplett zum Erliegen gekommen. Wann öffnet sich das Land wieder?
Die Einreisesperre ist tatsächlich eine Katastrophe für uns, digitaler Austausch ist nicht mit einem Aufenthalt im Land zu vergleichen. Wenn ein junger Mensch an eine ausländische Universität geht, will er dort nicht nur studieren, sondern zum Beispiel eine Megametropole wie Schanghai erleben, Menschen und fremde Kulturen kennenlernen. Leider sehe ich derzeit überhaupt keinen Grund für Optimismus. China hält eisern an seiner Null-Infektionen-Strategie fest. Für Studierende rechne ich frühestens für das Wintersemester 2022/23 mit einer Entspannung. Immerhin können Chinesen nach Deutschland reisen. In dieser Richtung funktioniert der Austausch weiterhin.
Auf dem gleichen Niveau?
Nein. Vor allem die Kurzzeit-Aufenthalte unter 90 Tage fallen weg. Und viele Austauschprogramme wurden eingestellt oder verschoben. Generell ist allerdings unser Eindruck, dass durch die Spannungen zwischen China und den USA, Europa und insbesondere Deutschland wieder stärker in den Fokus für Auslandsstudien gerückt sind. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach den Studien- und Forschungsaufenthalten in Deutschland. Es waren zum WS 2019/20 rund 45.000 chinesische Studierende an deutschen Universitäten eingeschrieben. Die Zahl wird wegen Corona sicherlich ein wenig zurückgehen, aber langfristig eher steigen als fallen.
Das bedeutet, es interessieren sich mehr Chinesen für Deutschland als Deutsche für China.
Wir brauchen sicherlich mehr China-Kompetenz. Allerdings sind die Zahlen nicht so schlecht wie oft vermutet wird: 2018 waren laut Angaben des chinesischen Bildungsministeriums sogar rund 8.000 deutsche Studierende in China. Das ist schon eine beachtliche Zahl für die wenigen 80 Millionen Einwohner, die Deutschland im Vergleich zu China hat. Damit ist die Volksrepublik das zweitbeliebteste außereuropäische Gastland für deutsche Studierende, direkt hinter den USA.
Die klassische deutsche Sinologie hat allerdings immer weniger Zulauf.
Die Sinologie ist an vielen Universitäten ein Orchideenfach. Nichts gegen Tang-Gedichte. Aber wir brauchen China-Kompetenz in den Ingenieurwissenschaften, BWL oder in den Politikwissenschaftlern. Mehr Nicht-Sinologen müssen in China leben, ein wenig Chinesisch lernen und in ihrem Bereich weiter forschen und arbeiten.
Sie haben Physik studiert und sind in Afrika aufgewachsen, da liegt es ja nicht nahe, nach China zu gehen und 20 Jahre zu bleiben?
Ich muss zugeben, es war nicht von Anfang an geplant, so lange zu bleiben. Ich wollte eigentlich nur ein wenig Chinesisch lernen und habe dann zufällig meinen Mann in Peking kennengelernt. Ein begeisterter Halb-Sinologe und dann sind wir eben hiergeblieben. Für die Kinder war es ja durchaus ein Vorteil zweisprachig aufzuwachsen, obwohl wir beide Deutsche sind. Sie haben als Kinder erst Chinesisch gesprochen und danach Deutsch. Was sie aber durchaus geprägt hat, ist der chinesische Optimismus. Das finde ich sehr schön. Denn der ist ja auch außerhalb Chinas nützlich.
Dieser Optimismus hängt ja auch eng mit einer Neugier auf die Zukunft zusammen. Hat Wissenschaft deshalb in China eine andere Bedeutung?
Für die Politik und Staatsführung jedenfalls eine größere als in Deutschland. Wenn man sich Chinas 14. Fünfjahresplan anschaut, wird klar: Wissenschaft gilt als zentraler Treiber des wirtschaftlichen Wachstums und der Innovationskraft. Dafür ist Geld und politische Gestaltungskraft da. In dieser Frage müssen wir in Deutschland nachbessern. Um enger miteinander kooperieren zu können, müssen administrativen Hürden, die das erschweren, abgebaut werden. In China ebenso wie in Deutschland.
Ein Beispiel für solche Hürden in China?
Es hat Fälle gegeben, da verlangt eine Universität, dass der deutsche Gastdozent erst einen Arbeitsvertrag bekommt, wenn er im universitätseigenen Krankenhaus untersucht wurde. Er bekommt jedoch nur ein Visum, um nach China einzureisen, wenn er einen Arbeitsvertrag hat. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das Verrückte dabei: Diese Uni will gar nicht verhindern, dass deutsche Wissenschaftler kommen, aber sie kann ihre unsinnigen Regeln nicht umgehen. Wir haben eine ganze Reihe ähnlich gelagerte Fälle.
Und es gibt auch ideologische Hürden. Wie verhält man sich in dieser Wissenslandschaft, in der der Staat einerseits zu höherem Tempo bei Innovation antreibt und andererseits mehr kontrolliert, zensiert und ideologisch im Gleichschritt laufen lässt?
Erst einmal müssen wir verstehen, dass die Rolle einer Universität in China und auch die Rolle der Forschung eine andere ist. Die Forschung ist kein Selbstzweck, sondern sie soll der Entwicklung der Gesellschaft und am Ende den Interessen der Kommunistischen Partei dienen. In vielen Fällen ist das kein Problem, wenn es beispielsweise darum geht, E-Auto-Batterien zu entwickeln. In manchen Fällen kann sich das aber nicht mit unseren Vorstellungen wissenschaftlicher Freiheit decken, weil es darum geht, Patriotismus und vor allem die Ideologie der Partei bis in den letzten Winkel zu tragen und umzusetzen.
Was ist, wenn deutsche Forscher zwar in China, aber nicht in einem solchen, ideologischen Umfeld arbeiten wollen?
Dann müssten sie woanders arbeiten. Die Ideologie macht vor der Wissenschaft nicht halt. Dabei darf man nicht vergessen, dass Ausländer an den Universitäten meistens mehr Freiheiten haben als ihre chinesischen Kollegen. Sie unterliegen einer anderen Kontrollnorm und genießen eine Art Narrenfreiheit, die in Zeiten schrumpfender Freiräume das allgemeine Klima durchaus beleben kann. Da gibt es Freiräume, die wir ausfüllen sollten. Aber wir dürfen uns dabei auch nicht überschätzen. Von oben herab erreichen wir in China nichts mehr. Unsere Deutungshoheit wird immer schwächer. Das müssen wir vielleicht doch ein wenig realistischer einschätzen.
Aber können Sie anderseits auch nachvollziehen, dass Wissenschaftler sagen: Angesichts der Entwicklungen in Hongkong, Xinjiang, der Zensur, möchte ich in dem Land nicht arbeiten?
Das kann ich nachvollziehen. Nur andererseits: Etwas ändern können wir nur im Dialog und nicht dadurch, dass wir uns von China abwenden. Wenn wir von Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Wissenschaftsfreiheit oder Zivilgesellschaft überzeugt sind, und das bin ich, sollten wir eine Debatte darüber selbstbewusst führen. Eines muss dabei wie gesagt klar sein: Wir können China zu nichts mehr zwingen, aber wir können überzeugende Argumente liefern, die China motivieren sich aus sich selbst heraus zu ändern.
Die Welt hat sich entschieden, mit dem Coronavirus zu leben. Sehr viele Nationen, die bisher eine “No-Covid”-Strategie gefahren haben, ändern nun ihren Kurs: Australien und Neuseeland schicken nicht mehr ganze Städte in den Lockdown, sollten auch nur wenige Corona-Fälle auftreten. Auch Singapur lässt nach mehr als eineinhalb Jahren wieder Besucher ohne Quarantäne einreisen. Taiwan, Südkorea und Japan lockerten trotz steigender Infektionszahlen ebenfalls zuletzt ihre Maßnahmen. Reihenweise haben die “vorsichtigen Asiaten” ihre Strategie geändert. Die letzte große Ausnahme ist China.
Erst am Samstag bestätigte Wu Liangyou, ein Beamter der Nationalen Gesundheitskommission Chinas, dass die Volksrepublik ihren No-Covid-Kurs nicht ändern werde.” Die Ausbrüche in Chinas Nachbarländern und auf der ganzen Welt sind nach wie vor hoch, was diesen Winter und das nächste Frühjahr zu einer komplizierten und ernsten Herausforderung macht”, sagte Wu laut Bloomberg am Samstag.
Die politische Führung in Peking ist weiterhin nicht bereit, dem Coronavirus Raum zu lassen. Deutsche Expats haben sich daran gewöhnen müssen, dass sie das Land nur verlassen können, wenn sie nach ihrer Rückkehr bereit sind, eine mindestens zweiwöchige Quarantäne im Hotel über sich ergehen zu lassen. In den meisten Fällen wird man mittlerweile trotz doppelter Impfung und mehrfacher Corona-Tests sogar für drei Wochen weggesperrt. Groß ist die Freude, wenn das Zimmer dann wenigstens einen Balkon hat.
Der Erfolg der strengen Maßnahmen war lange Zeit sichtbar: Von einigen lokalen Ausbrüchen abgesehen war China in den vergangenen eineinhalb Jahren nach dem ursprünglichen Ausbruch in Wuhan tatsächlich weitgehend frei von Corona. Doch durch die ansteckendere Delta-Variante haben sich die Spielregeln geändert. Die Abstände zwischen den Wellen werden immer kürzer. Den jüngsten Ausbruch hatte die Volksrepublik erst Ende September für beendet erklärt.
Doch den Menschen blieben nur wenige Wochen Zeit, um durchzuatmen. Am 16. Oktober folgte bereits der nächste Ausbruch, der sich nun bereits auf 20 der 31 Provinzen ausgeweitet hat. Es handelt sich um den umfangreichsten Ausbruch in der Volksrepublik seit dem ersten Auftreten des Erregers in Wuhan Ende 2019. Dass die Zahl der Infektionen erneut bislang auf lediglich rund 600 begrenzt werden konnte, hängt mit den drakonischen Maßnahmen der Behörden zusammen. Sobald auch nur ein einziger Fall auftritt, werden ganze Stadtteile in den Lockdown geschickt.
So geschehen etwa in der Vier-Millionen-Metropole Lanzhou, in der die Menschen nun eine strenge Ausgangssperre über sich ergehen lassen müssen. Nicht nur dürfen sie nicht mehr vor die Tür. Jeder wurde mittlerweile fünfmal auf das Virus getestet. Einen Schock erlebten zuletzt auch die Besucher des Disneylands in Shanghai. Zehntausende wurden fast den gesamten Tag auf dem Gelände festgehalten, weil es unter den Besuchern einen Verdachtsfall gab. Erst, nachdem alle getestet waren, wurden die Tore wieder geöffnet. Zum Abschied gab es dann immerhin ein Feuerwerk.
Kritik an den harten Maßnahmen trotz einer Impfquote von 76 Prozent findet in den streng zensierten Staatsmedien nicht statt. Stattdessen wird die Führung überschwänglich gelobt: “Unter der starken Führung des Zentralkomitees der Partei mit Genossen Xi Jinping als Kern hat unser Land die Auswirkungen der Pandemie überwunden”, kommentierte etwa am Dienstag die Volkszeitung auf ihrer Titelseite. Der Artikel fügte hinzu, dass China die einzige große Volkswirtschaft sei, die im Jahr 2020 ein Wirtschaftswachstum verzeichnen konnte. Die strikten Maßnahmen zu beenden, würde in “eine Katastrophe führen”, schrieb die ebenfalls parteinahe Zeitung Global Times nur einen Tag später.
Immer mehr Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass China selbst nach den Olympischen Winterspielen in Peking und dem wichtigen Parteikongress im kommenden Herbst seine Grenzen nicht wieder vollständig öffnen wird. Befeuert werden diese Spekulationen von den jüngsten Aussagen des chinesischen Top-Virologen Zhong Nanshan, einem wichtigen Corona-Berater der Regierung.
Auf die Frage, wie lange China die Reisebeschränkungen noch aufrechterhalten wird, antwortete Zhong kürzlich in einem Fernsehinterview: “Ziemlich lange”. Die genaue Dauer würde davon abhängen, wie gut andere Länder bei der Eindämmung des Virus abschneiden. “Egal wie gut China abschneidet, sobald es sich öffnet und Fälle importiert, wird die Übertragung definitiv im Land erfolgen”, argumentiert Zhong. Eine “Zero-Covid”-Strategie sei auch für die Wirtschaft weniger kostspielig, als sich zu öffnen und einen wirklich großen Ausbruch zuzulassen. Gregor Koppenburg/Joern Petring

Der wichtigste Punkt am Aiways U5 ist gar nicht mal der Preis. Zwar biegt das Elektro-SUV abzüglich der Förderungen durch Bund und Länder für unter 30.000 Euro in die heimische Garage ein, der wichtigste Punkt ist vielmehr das Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn für diese Summe gibt es ein Auto, das mit beinahe doppelt so teuren Modellen fast schon auf Augenhöhe fährt. Der Aiways U5 steht damit für den Trend, dass in der Mobilitätsrevolution neue Konzepte aus jungen Autonationen konkurrenzfähig neben den Traditionsmarken stehen. Der Automarkt wird dadurch merklich vielfältiger.
Aiways wurde erst im Jahr 2017 als Start-up gegründet. Den U5 gibt es seit 2019 als erstes Modell des Unternehmens. Das Start-up hat mehrere Strategien angewandt, um sich aus dem Stand unter die echten Autohersteller zu katapultieren. So hat Aiways die Hälfte der schon lange existierenden Jiangling Motors Corporation übernommen – um eine Lizenz für den Bau zu bekommen und um die Fabrik nutzen zu dürfen. China verknappt Lizenzen zum Bau von Elektroautos gezielt, um den Wildwuchs der Hersteller einzudämmen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Inzwischen sind die eingekauften Fähigkeiten allerdings schon nicht mehr nötig, Aiways steht bereits auf eigenen Füßen. Das Unternehmen unterhält heute in der südostchinesischen Stadt Shangrao eine eigene Fabrik. Voll ausgebaut soll sie auf eine Kapazität von 300.000 Autos im Jahr kommen. In Hinblick auf künftige Modelleinführungen hat sich das Unternehmen eine Elektro-Plattform erdacht, bei der sich die Größe der Fahrzeuge, der Antrieb und die Batteriekapazität leicht anpassen lässt.
Durch diese technische Basis kann ein junges Unternehmen wie Aiways ein neues Modell pro Jahr versprechen. Schon 2022 soll der U6 kommen. Schon zu haben ist der U5. Das Elektro-SUV ist mit 4,68 Metern etwa acht Zentimeter kürzer als ein Mercedes EQC (ab 66.000 Euro) und fünf Zentimeter länger als ein Hyundai Ioniq 5 (ab 41.900 Euro). In Deutschland fahren bereits gut 1.000 Exemplare des U5 durch die Straßen.
Größtes Handicap des U5 ist der Crashtest. Nur drei Sterne gab es vom Euro NCAP im Jahr 2019. Das bedeutet zwar, dass das Fahrzeug sicher ist, in Europa werden aber von Fahrzeugen, die sich nicht allein über den Preis oder andere Alleinstellungsmerkmale verkaufen wollen, gemeinhin fünf Sterne erwartet. Allerdings bekam der U5 den Abzug für elektronische Unzulänglichkeiten, die mittlerweile behoben seien, wie das Unternehmen versichert. So löse beispielsweise der Beifahrerairbag jetzt schneller aus. Der kommende U6 werde die Bestbewertung erhalten, verspricht der Hersteller. Wir werden ihn an diese Ankündigung messen.

Das Battery Pack im Aiways U5 hat eine Kapazität von 63 Kilowattstunden. Das ist mehr als im Hyundai Ioniq 5, dessen Batterie 58 Kilowattstunden aufnehmen kann. Es ist weniger als im Mercedes EQC, der auf 80 Kilowattstunden kommt. In der Praxis reicht der Akku im Alltag für rund 300 Kilometer. Der Aiways kommt mit 204 PS ziemlich genau auf die halbe Leistung des Mercedes.
Dass der Aiways U5 ein Elektroauto ist, das in China erdacht wurde, wird mit dem ersten Probesitzen klar. Der Platz auf der Rücksitzbank ist enorm. Klar – in der Volksrepublik sitzen hier oft die Fahrzeugbesitzer, während ein Chauffeur den Rest erledigt. Darunter leidet ein wenig der Kofferraum, der mit 432 Litern allerdings deutlich mehr schluckt als der des Mercedes.
Sehr chinesisch geht es beim Bordcomputer weiter. Das Auto ist komplett digitalisiert. Fenster, Schiebedach und Kofferraum – nichts, was sich nicht über den zentralen Touchscreen steuern ließe. Wenn auch noch mit Ungenauigkeiten bei der Übersetzung. So wird das Dachfenster zwar geöffnet, wer es schließen will, muss es aber “deaktivieren”.
Weil in China das Handy Dreh- und Angelpunkt des täglichen Lebens und der Mobilität ist, gibt es auch kein Navigationsgerät. Per App soll stattdessen das Handy mit dem System gekoppelt werden. Schließlich können Handys heute meist besser navigieren als Navigationssysteme. Bei IOS-Smartphones funktioniert das einwandfrei, bei Android hakt es.
Grundsätzlich ist die Einbindung des Handys aber kein dummer Gedanke – gerade im Hinblick auf die Elektromobilität. Die freien Anbieter aus dem App-Store bieten meist kostenlos Lösungen an, die in vielerlei Hinsicht detaillierter, umfangreicher und aktueller sind, als die Werksanwendungen vieler Hersteller. Sie sind zum Beispiel oft besser darin, Ladestationen entlang der Strecke zu finden.
Der Aiways U5 kann mit der hiesigen Konkurrenz mithalten und sich als Alternative etablieren. Für eine Marke, die gerade einmal vier Jahre alt ist, ist das ein erstaunlicher Erfolg. Er zeigt, wie dynamisch das Segment ist. Der Vorsprung der großen, traditionellen Konzerne schwindet im Bereich der Elektromobilität besonders schnell. Das eröffnet Angreifern aus China trotz der etablierten Konkurrenz Chancen auf dem europäischen Markt. Christian Domke Seidel
Die Stromkrise in China beginnt sich zu entspannen. Nur noch fünf Provinzen in der Volksrepublik haben mit größeren Stromausfällen zu kämpfen, wie Bloomberg berichtet. Mitte Oktober wurde der Strom noch in 20 Provinzen rationiert und es kam mitunter zu stundenlangen Stromabschaltungen (China.Table berichtete). Nachdem die Zentralregierung Kohlebergwerke angewiesen hatte, die Produktion zu erhöhen, konnte Kraftwerke und große industrielle Stromverbraucher ihre Kohlelager wieder auffüllen.
Chinas tägliche Kohleproduktion ist demnach in den letzten Wochen um mehr als eine Million Tonnen auf zuletzt fast 11,7 Millionen Tonnen gestiegen. Analysten zufolge übertrifft der Produktionsanstieg die Erwartungen. “Die Stromknappheit hat sich gelockert. Alle fahren ihre Kohleproduktion hoch. Das Tempo ist ziemlich beeindruckend”, sagt Michelle Leung von Bloomberg Intelligence. Doch in einigen Industriezweigen mit hohem Energieverbrauch würde die Stromversorgung weiterhin eingeschränkt. Und durch die staatliche Liberalisierung der Strompreise müssen diese Sektoren mit erheblich höheren Stromkosten rechnen (China.Table berichtete). Noch sei einer Analystin zufolge unklar, ob die Stromversorgung über den ganzen Winter sichergestellt werden kann.
Auch der größte Netzbetreiber des Landes State Grid signalisiert Entspannung. Der Stromengpass habe sich dem Unternehmen nach signifikant reduziert. Allerdings werde sich das Stromnetz im Winter und Frühling in einer “insgesamt angespannten Balance mit teilweisen Lücken” befinden, so State Grid, dessen Netz laut Firmenangaben 1,1 Milliarden Menschen versorgt und 88 Prozent des chinesischen Territoriums abdeckt. nib
China ist bereit, Zölle zu senken, wenn das regionale Handelsabkommen RCEP am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, wie Bloomberg berichtet. Demnach habe das Handelsministerium sich für eine rasche vollständige Umsetzung des Abkommens ausgesprochen. Die Regional Comprehensive Economic Partnership wurde im November 2020 von 15 Staaten der Region beschlossen, darunter China, Japan, Südkorea, Australien, Vietnam und den Philippinen. Bisher haben zehn Staaten das Abkommen ratifiziert. Die Senkung der Zölle zwischen den Partnern ist eines der zentralen Ziele von RCEP. Zudem sollen Investitionen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten gestärkt werden.
Die RCEP ist die größte Freihandelszone der Welt. Sie repräsentiert über 30 Prozent des Welthandels mit einer Bevölkerung von rund 2,2 Milliarden Menschen. nib
China hat im Oktober einen Rekord-Handelsüberschuss verzeichnet. Die Exporte wuchsen im Oktober mit 27,1 Prozent auf 300,2 Milliarden US-Dollar (259,3 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahresmonat stärker als erwartet, wie Reuters berichtet. Als Ursachen werden die steigende weltweite Nachfrage zur Weihnachtssaison, die nachlassende Stromknappheit und weniger Unterbrechungen in den Lieferketten angeführt. Die Importe der Volksrepublik lagen hingegen mit einem Plus von 20,6 Prozent fast fünf Prozentpunkte hinter den Erwartungen. Dafür wird die generelle Schwache der inländischen Nachfrage angeführt. Der Handelsüberschuss Chinas lag im Oktober bei 84,5 Milliarden US-Dollar und somit gut 18 Milliarden Dollar über dem September-Wert. nib
Eine Delegation von EU-Abgeordneten hat einen viel beachteten Besuch in Taipeh beendet (China.Table berichtet). Bei einer Pressekonferenz betonten die Europa-Politiker, dass die Reise keine Provokation in Richtung Peking sei. “Wir definieren unsere Politik nicht gegen irgendjemanden, sondern unterstützen unsere Freunde und unsere Prinzipien”, sagte Delegationsleiter Raphaël Glucksmann. Der Franzose betonte, dass in den kommenden Monaten “immer mehr hochrangige Partnerschaften und Kooperationen” zwischen der Europäischen Union und Taipeh zu erwarten seien. Auch der griechische EU-Abgeordnete Georgios Kyrtsos erklärte: “Wir provozieren niemanden. Wir sind nicht gegen China, wir sind für Taiwan.” Das Interesse der Delegation gelte der Wirtschaft Taiwans und seiner Rolle beim digitalen Wandel, so Kyrtsos.
Die Europa-Politiker hatten zuvor Taiwans Digitalministerin Audrey Tang getroffen. Sie habe sich über eine Einladung nach Brüssel gefreut und diese angenommen, schrieb Tang auf Twitter. Die Delegation und Tang sprachen demnach über die Bekämpfung von Desinformation. Die EU könne in dieser Hinsicht viel von Taiwan lernen, erklärten die Europa-Abgeordneten. Auch ein informeller jährlicher EU-Taiwan-Dialog sei besprochen worden, sagte der litauische Politiker Andrius Kubilius. Sein Heimatland erfährt seit der Entscheidung, in Vilnius ein “Taiwan”-Büro einzurichten, wirtschaftlichen Druck aus Peking. Dieser werde das Vorhaben Litauens aber nicht ändern, sagte Kubilius.
Die tschechische EU-Abgeordnete Markéta Gregorová sprach sich für ein Umdenken in der EU-Taiwan-Politik aus: “Es ist an der Zeit, Taiwan als Taiwan zu betrachten, nicht durch die Linse EU-China, und uns darauf zu konzentrieren, was wir voneinander wollen.” Das bedeute nicht, die “One-China-Politik” Brüssels abzuschaffen, so Gregorová.
Der Besuch der Abgeordneten in Taiwan war der erste einer offiziellen Delegation des Europaparlaments. Die EU-Politiker sind Mitglieder des Sonderausschusses für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE). Das EU-Parlament hat bereits im Oktober für eine engere Beziehung zu Taiwan gestimmt – die offizielle Linie Brüssels wird jedoch primär von der EU-Kommission und dem EU-Rat bestimmt. ari
Die Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns Kaisa Group sowie von drei Tochterunternehmen wurden am Freitag vom Handel ausgesetzt. Kaisa teilte mit, es stehe aufgrund des schwierigen Immobilienmarktes und der Herabstufung seines Kredit-Ratings unter beispiellosem Liquiditätsdruck, wie Reuters berichtet. Der Konzern hatte wie andere Immobilienentwickler Vermögensprodukte aufgelegt und konnte in diesem Zusammenhang eine fällige Zahlung nicht leisten.
Kaisa muss innerhalb des nächsten Jahres umgerechnet mehr als 2,7 Milliarden Euro an Auslandsanleihen bedienen. Nach dem ebenfalls in Finanzproblemen steckenden Evergrande ist Kaisa der am meisten im Ausland verschuldete chinesische Immobilienentwickler, so Reuters. Um die Vermögensprodukte ablösen zu können, sollen demnach bis Ende 2022 Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet elf Milliarden Euro veräußert werden. Der Großteil bestehe aus Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien. Nach Hausverkäufen gemessen, liegtder chinesische Immobilienkonzern auf Rang 25 der größten Immobilienentwickler Chinas. nib

Ich halte den analytischen Ansatz der Autoren für praxisfern und herrschaftsunkritisch. Studien wie diese werden die Krise des öffentlichen Vertrauens in das professionelle Wissen von China-Wissenschaftlern noch weiter vertiefen. Während von deutschen Sinologen häufig mehr China-Kompetenz in Staat und Gesellschaft gefordert wird, stellt sich für mich vielmehr die Frage, was für eine Analyse der Volksrepublik China bislang betrieben wird.
Meine eigene Forschung zum Thema Wissenschaftsfreiheit und die Rolle Chinas hat ergeben, dass in der deutschen Wissenschaft die politische Zensur und die daraus resultierende Selbstzensur ein Tabuthema darstellt. Dies hat negative Auswirkungen auf den akademischen und öffentlichen China-Diskurs in Deutschland. Die vorliegende Studie ist ein Beispiel hierfür.
Die Praxisferne wird bereits im Vorwort deutlich. Es klagt über “unterkomplexe” deutsche Medienberichte und über fehlende Nuancen. Politikentscheidungen würden zu selten aus chinesischer Logik heraus verständlich gemacht. Weiter heißt es: Beschreibungen, Verortungen und Definitionen schafften “Realitäten”, was besonders für die Auslandsberichterstattung gelte, “da wir in anderen Ländern selbst keine unmittelbaren Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, dort keine Gespräche und Diskussionen geführt, keine eigenen Interessen und auch keine weitergehenden Kenntnisse über Geschichte, Kultur und spezifische Problemstellungen erworben haben, die wir mit einem massenmedial vermittelten Narrativ positiv oder negativ in Beziehung setzen könnten.”
Diese Formulierungen, die den Ausgangspunkt der Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung erläutern, verwundern schon sehr. Keine Gespräche und keine Diskussionen? Keine eigenen Interessen und auch keine weitergehenden Kenntnisse über Geschichte, Kultur und spezifische Problemstellungen? In diesem Vorwort wird so getan, als hätte es in den letzten vierzig Jahren kein praktisches westliches China-Engagement gegeben. Es entsteht der Eindruck, als seien für das Chinabild in Deutschland ausschließlich die Medien verantwortlich. Die Realität sieht allerdings völlig anders aus.
Unzählige deutsche Politiker, Wirtschaftslenker, Journalisten, Kulturschaffende, Akademiker und Studenten haben die Volksrepublik China seit dem Beginn der 1980er-Jahre besucht oder befinden sich in konstantem Austausch mit Partnern vor Ort. Viele Zehntausende deutsche Staatsbürger haben zudem lange in Festlandchina gelebt und gearbeitet. China auf politische beziehungsweise akademische Diskurse zu begrenzen, wird daher der Fülle an Erfahrungen auf deutscher Seite in keinster Weise gerecht.
Stattdessen wird von der Herausgeberin der Studie so getan, als bliebe die Volksrepublik China trotz des intensiven westlichen China-Engagements ein Buch mit sieben Siegeln, und die Medien würden das Land nun in die Rolle des Feindes pressen. Das ist zu kurz gedacht. Denn eben, weil wir zunehmend Erfahrungen sammeln im Umgang mit der Volksrepublik, spiegeln die Medien im Wesentlichen das wider, was sich an Erkenntnissen aus diesem Umgang ergibt.
Meiner Einschätzung nach gehören viele westliche Journalisten mit langer akademischer und praktischer China-Erfahrung sogar zu den besten China-Kennern. Viele besitzen einen hohen Grad an Empathie und Einfühlungsvermögen, viele sprechen gut, manche fließend Chinesisch. Sie kennen chinesische Binnenperspektiven besser als viele andere, die das Land kennengelernt haben oder dort leben.
Ich traue diesen Journalisten sehr wohl zu, den Einparteienstaat realistisch einzuschätzen. Sie sind sich bewusst, was passiert, wenn aufgrund von politischen Zensurvorgaben Informationsströme innerhalb Chinas versiegen.
Gerade zu Beginn der Covid-Pandemie konnten wir beobachten, wie innerhalb Chinas massive Konflikte um Meinungsfreiheit ausbrachen. Verantwortungsbewusste Mediziner wie Dr. Li Wenliang wurden daran gehindert, Kollegen vor dem Virus zu warnen. Chinesische Kritiker am Krisenmanagement Xi Jinpings wurden mundtot gemacht oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Mittlerweile wird chinesische Forschung zu Covid-19 vor ihrer Publikation von Regierungsbeamten nach politischen Kriterien geprüft. Wie sonst außer “kritisch” bis “sehr kritisch” sollte eine Berichterstattung in diesem Kontext aussehen? Doch die Studie liefert einen solchen Kontext nicht.
Die Opfer des Xi-Regimes spielen in der gesamten Einschätzung der Berichterstattung überhaupt keine Rolle. China wird stattdessen vorwiegend aus Sicht der Herrschenden analysiert. Und auch wenn es legitim ist, sich mit dem “offiziellen China” analytisch auseinanderzusetzen, so sollte eine solche Befassung nicht auf Kosten des “inoffiziellen Chinas” gehen.
Die Studie vermittelt den Eindruck, als gäbe es in Festlandchina kaum Kritiker an Xis Krisenmanagement, und deutsche Medien würden diese Harmonie im Land schlicht ignorieren, weil sie nicht in das Weltbild der Autoren passe, oder sie die öffentlichen Debatten nicht verfolgten. Es wird so getan, als würde es nur in Hongkong ein paar Aktivisten geben, und Medien nicht anerkennen wollen, dass es sich um eine “terroristische Bande” handle, so zumindest die Lesart der chinesischen Regierung.
Die Studie ignoriert dabei die vielen Dissidenten im Land wie den Immobilien-Unternehmer Ren Zhiqiang, der für seine Kritik an der Staatsführung unter Vorwand der Korruption zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde. Die Autoren ignorieren auch die ehemalige Professorin an der Parteihochschule, Cai Xia, die in Folge ihrer Regime-Kritik aus der Partei ausgeschlossen wurde und keine Pension mehr erhält. Der chinesische Bürgerjournalist Chen Qiushi wird ebenfalls nicht erwähnt. In Folge seiner Berichterstattung in Wuhan verschwand er für 600 Tage von der Bildfläche. Die Bürgerjournalistin Zhang Zhan hingegen landete für ihr Engagement im Gefängnis. Sie ist derzeit in einem Hungerstreik. Ihr Gesundheitszustand gilt seit Monaten als kritisch.
Es ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar, wenn die Autoren von “einem letztlich erfolgreichen Zusammenspiel politischen und gesellschaftlichen Handelns” sprechen. Wenn in der Studie Vertreter des “inoffiziellen Chinas” einmal benannt werden, so ist deren Position häufig nur einen kurzen Halbsatz wert, und ihr jeweiliges Engagement wird negativ konnotiert.
So wie das der chinesischen Schriftstellerin Fang Fang, die für ihr Wuhan-Tagebuch von Nationalisten angegriffen wurde. In der Studie wird sie nur kurz dafür erwähnt, dass mit Bezug auf Fang Fang in der deutschen Berichterstattung das “Behördenversagen in der Frühphase angeprangert” werde. Professor Xu Zhangrun, der im Zuge seiner Kritik an Xis Umgang mit Covid seinen Job an der Tsinghua University verlor, wird derweil nur zitiert, um mediale Kritik am autokratischen Führungsstil Xis infrage zu stellen.
Die Studie muss sich also selbst den Vorwurf fehlender Nuancen gefallen lassen, die sie der China-Berichterstattung vorwirft.
An der Person Xi Jinpings wird besonders deutlich, wie herrschaftsunkritisch die drei Autoren China analysieren. In der Studie sprechen sie von einem “Narrativ vom kommunistischen Diktator”. Aber es gibt natürlich auch so etwas wie politische Realität.
Xi Jinping hat in der historischen Wirklichkeit einen Personenkult geschaffen, die kollektive Führung im Ständigen Komitee des Politbüros beendet und mit dem Dokument Nr. 9 jeder Liberalisierung und Demokratisierung des Landes eine deutliche Absage erteilt. Aus politikwissenschaftlicher Sicht lässt sich das Xi-Regime als personalisierte Diktatur bezeichnen. Es ist daher völlig legitim, wenn deutsche Journalisten diesen Umstand in ihrer China-Berichterstattung auch so deutlich ansprechen.
Aufgrund der benannten Praxisferne sowie der mangelnden Herrschaftskritik halte ich die Studie für wenig gewinnbringend.
Zhang Ruimin tritt als Vorsitzender der Haier Group zurück. Der 72-Jährige Gründer des Haushaltsgeräte- und Elektronikkonzerns mit 70.000 Angestellten wird dem Unternehmen als Ehrenvorsitzender erhalten bleiben. Zhou Yunjie, vormals “President” bei Haier, wird Zhang als Vorsitzender und CEO ablösen. Liang Haishan wird vom “Vize-President” zum “President”.
Zuo Fang, Gründer der einflussreichen Wochenzeitung Southern Weekly, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war bis 1994 Chefredakteur und arbeitete danach noch vier weitere Jahre für die Zeitung. Die Zeitung erscheint seit 1984 und hat eine Auflage von 1,3 Millionen.
Jacquelien Postigo Brussee ist neue China-CEO der Designagentur Jones Knowles Ritchie (JKR). Die Position wurde neu geschaffen. Brussee hat mehr als zehn Jahre in China gearbeitet. Unter anderem leitete sie das Asienpazifik-Team für Marketing und Kommunikation von RH Marine (ehemals Royal Imtech).

Zugegeben: Wir sind generell Tier-Fans beim China.Table. Aber zu diesem Shiba Inu gibt es einfach eine zu schöne Geschichte, um ihn nicht in das “Dessert” zu heben. Der Hund wurde jüngst für umgerechnet 25.000 US-Dollar versteigert. Denn Deng Deng, so sein Name, ist in China eine Internetberühmtheit. 2014 wurde er Medienberichten zufolge von seinem Besitzer in einer Tierschule zurückgelassen. Bereits 2018 wurde Deng Deng zur Versteigerung angeboten – der bis dato verschollene Besitzer meldete sich jedoch und verhinderte die Auktion. Seine Schulden bei der Tierschule bezahlte er laut Bericht aber nicht, der Shiba Inu wurde also wieder zur Versteigerung angeboten. Nachdem das zuständige Gericht die Auktion des Hundes publik gemacht hatte, kannte die Begeisterung auf Weibo und Wechat nun keine Grenzen mehr – und Internetstar Deng Deng hat nun ein neues Zuhause bei einem viel bietendem Hundefreund.
In China gelten Wissenschaft, Innovation und Forschung als die entscheidenden Triebkräfte des wirtschaftlichen Fortschritts. Ruth Schimanowski vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) betont, Deutschland solle davon lernen. Im CEO-Talk mit Frank Sieren plädiert sie für den Aufbau von China-Kompetenz in der Bundesrepublik. Und auch die akademische Kooperation zwischen den beiden Staaten müsse gestärkt werden. Allerdings bremst Chinas “No-Covid”-Strategie und das häufig bürokratische Vorgehen chinesischer Hochschulen den akademischen Austausch, sagt Schimanowski, die seit 20 Jahren im Land ist.
Pekings strenge “No-Covid”-Strategie haben sich Jörn Petring und Gregor Koppenburg angeschaut. Während viele Regierungen die Corona-Maßnahmen lockern, verfolgt Peking noch immer den Ansatz, das Virus komplett aus dem Land zu halten. Die Abschottung wird eher verschärft, wie der Winterflugplan in die Volksrepublik jüngst zeigte. Es ist noch lange mit Einschränkungen zu rechnen.
Bisher fahren nur gut 1.000 Aiways U5 auf deutschen Straßen. Doch laut Christian Domke Seidel könnte sich das bald schon ändern. Der E-SUV der chinesischen Marke hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und überzeugt schon in vielen Belangen, so das Fazit nach der Testfahrt. Wenn die Probleme beim Crashtest und die Mängel bei der Digitalisierung behoben werden, könnte der Aiways deutschen Anbietern schon bald Konkurrenz machen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!


Ruth Schimanowski hat einen großen Teil ihrer Kindheit in Afrika verbracht. Erst mit 15 kehrte sie nach Deutschland zurück und machte dort das Abitur. Danach zog es sie gleich wieder raus – nach Taipeh, um dort Mandarin zu lernen. Dann wieder zurück nach Berlin, wo sie ein Physikstudium und mehreren Stationen im Ausland absolvierte: Nach Peking kam sie erstmals als DAAD-Stipendiatin. Zwischendurch ging sie nach New Orleans für biophysikalische Experimente. Heute lebt sie jedoch schon seit über 20 Jahren in der chinesischen Hauptstadt.
Nicht nur Schimanowskis Lebensmittelpunkte im Laufe der Jahre, sondern auch ihre beruflichen Abschnitte sind vielfältig: Sie hat bei dem Pharmariesen Boehringer Ingelheim und im Kulturreferat der Deutschen Botschaft Peking gearbeitet. Sie war Leiterin des Verbindungsbüros des bischöflichen Hilfswerks Misereor in China und Geschäftsführerin des German Centre Beijing der LBBW. Inzwischen leitet sie die drei DAAD-Büros in China. Das Interview können Sie in voller Länger als Video ansehen.
Was sollten chinesische und deutsche Akademiker voneinander lernen?
Eine ganze Menge. Deutsche Akademiker können von chinesischen Akademikern lernen, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Wir haben hier eine unheimliche Dynamik. Das, was ich gestern gelernt habe, gilt heute nicht mehr. Man ist hier viel öfter gezwungen, auf Basis einer dünnen, intransparenten Faktenlage Entscheidungen zu treffen, die sich dann wiederum schnell überholen. Wenn ich hier etwas gelernt habe, dann zügig und instinktsicher zu entscheiden, worüber zuvor noch nie entschieden werden musste. Wenn man das kann, wächst der Optimismus, das Vertrauen in die Zukunft. Nach dem Motto: Zwar stand noch kein anderer zuvor vor dieser Herausforderung, aber wir finden eine Lösung. Dieses neue Selbstvertrauen prägt dieses Land.
Aber derzeit ist auch sehr viel im Argen in China. Wie kann man dabei optimistisch bleiben?
Aus der Sicht der meisten Menschen hier ist der Entwicklungsstand heute trotz aller Probleme sehr viel besser als das, was sie von ihren Eltern und ihren Großeltern gehört oder noch selbst erlebt haben. Viele meiner chinesischen Freunde sagen zum Beispiel heute: Ich heirate nicht. Das ist ihre Freiheit und war noch vor 20 Jahren undenkbar. Und davor konnte man sich nicht einmal aussuchen, wen man heiratet. Die Chinesen können ins Ausland gehen, mit neuen Eindrücken zurückkehren und dann entscheiden, so oder so möchte ich leben.
Und was bedeutet das für den akademischen Austausch?
Das gesellschaftliche Umfeld färbt selbstverständlich auch auf die Wissenschaft ab. In China ist der Mut und die Notwendigkeit größer, bekannte Wege zu verlassen, Neues zu denken und es auszuprobieren.
Wie wichtig sind für solche Wissenschaftler die deutschen, weltweit renommierten Forschungsstationen, wie Helmholtz, Fraunhofer oder Max Planck, die im Zweifel in der Grundlagenforschung viel weiter sind.
Sie erhöhen mit ihrer Offenheit, ihrer Neugier und ihrem Lerneifer die Vielfalt unserer Forschungslandschaft und das ist wichtig für uns. Man ist zusammen besser, wenn man unterschiedliche Denkansätze und Mentalitäten kombiniert. Wir denken noch zu sehr in Wettbewerbskategorien: Die oder wir? Wer ist schneller? Dabei sind wir gemeinsam am besten. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein gutes Beispiel dafür.
Was lernen Chinesen von uns?
Sehr viel, zumal der akademische Austausch ja schon seit über 40 Jahren läuft. Sehr lange hatte der Knowhow-Transfer eine klare Richtung: Die alte Dame Bundesrepublik hat Stipendien vergeben und damit einen großen Beitrag zur Entwicklung Chinas geleistet. Ich spüre bis heute eine große Dankbarkeit gegenüber Deutschland und auch dem DAAD dafür, gerade bei den chinesischen Deutschland-Alumni.
Warum kommen sie zu uns?
Sie kommen zu uns, weil unsere Universitäten und Forschungsstätten international ein gutes Renommee haben. Einer unserer größten Vorteile ist neben praxisorientierter Hochschulbildung die enge Verzahnung zwischen Wirtschaft und Forschung. Daraus sind unsere Hidden Champions hervorgegangen.
Sind Stipendien heute eigentlich noch wichtig?
Wir haben noch sehr vielen Stipendienprogramme, aber es ist nicht mehr so wichtig, dass der DAAD den Aufenthalt bezahlt. Anders als früher werden wir heutzutage fast überrannt von sogenannten Selbstzahlern, also Chinesen, die nach Deutschland gehen wollen und das Studium komplett selber bezahlen. Das bedeutet, sie sind nicht mehr auf unsere Stipendien angewiesen. Damit ändert sich auch unser Fokus. Viel wichtiger als früher sind inzwischen die Deutschland-Alumni. Wir finanzieren Konferenzen oder Publikationen, sorgen dafür, dass die Alumni weiter in engem Austausch bleiben. In 40 Jahren ist so ein ziemlich beeindruckendes Netzwerk entstanden.
Wie steht es mit Deutsch als Fremdsprache in China? Darum kümmert sich der DAAD ja auch. Ist das ein Auslaufmodell?
Im Gegenteil. Bei der jüngsten Deutschlernerhebung, die das Goethe-Institut und der DAAD gemeinsam mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen alle fünf Jahre durchführen, ist der Anteil der Deutschlerner in den Schulen in den letzten fünf Jahren um 33 Prozent gewachsen. Das ist sehr ermutigend und bedeutet auch mehr potenzielle Mitarbeiter für deutsche Firmen.
Das ist überraschend. Woran liegt das neue Interesse an Deutsch?
Ich würde jetzt gerne antworten, weil die Deutschen so toll Fußball spielen oder unsere Autos und deutschen Firmen so attraktiv sind. Der eigentliche Grund ist jedoch ein anderer: Die chinesische Regierung hat die Mehrsprachigkeit an den Schulen eingeführt, also nicht nur Englisch, sondern auch kleinere Sprachen. Dazu gehören Japanisch, Deutsch, Französisch, und Russisch. Das heißt, man kann an chinesischen Schulen nun eine zweite Fremdsprache lernen.
Warum hat man das gemacht?
Man will womöglich die Abhängigkeit vom angelsächsischen Raum verringern. Und: Bei uns ist es auch üblich, dass die Kinder zwei und mehr Fremdsprachen lernen. Mit dieser Entwicklung ist die Nachfrage nach Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern stark gestiegen. Dem begegnen wir mit entsprechenden Programmen.
Allerdings ist der persönliche Austausch mit Deutschland durch die Corona-Strategie Pekings praktisch komplett zum Erliegen gekommen. Wann öffnet sich das Land wieder?
Die Einreisesperre ist tatsächlich eine Katastrophe für uns, digitaler Austausch ist nicht mit einem Aufenthalt im Land zu vergleichen. Wenn ein junger Mensch an eine ausländische Universität geht, will er dort nicht nur studieren, sondern zum Beispiel eine Megametropole wie Schanghai erleben, Menschen und fremde Kulturen kennenlernen. Leider sehe ich derzeit überhaupt keinen Grund für Optimismus. China hält eisern an seiner Null-Infektionen-Strategie fest. Für Studierende rechne ich frühestens für das Wintersemester 2022/23 mit einer Entspannung. Immerhin können Chinesen nach Deutschland reisen. In dieser Richtung funktioniert der Austausch weiterhin.
Auf dem gleichen Niveau?
Nein. Vor allem die Kurzzeit-Aufenthalte unter 90 Tage fallen weg. Und viele Austauschprogramme wurden eingestellt oder verschoben. Generell ist allerdings unser Eindruck, dass durch die Spannungen zwischen China und den USA, Europa und insbesondere Deutschland wieder stärker in den Fokus für Auslandsstudien gerückt sind. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach den Studien- und Forschungsaufenthalten in Deutschland. Es waren zum WS 2019/20 rund 45.000 chinesische Studierende an deutschen Universitäten eingeschrieben. Die Zahl wird wegen Corona sicherlich ein wenig zurückgehen, aber langfristig eher steigen als fallen.
Das bedeutet, es interessieren sich mehr Chinesen für Deutschland als Deutsche für China.
Wir brauchen sicherlich mehr China-Kompetenz. Allerdings sind die Zahlen nicht so schlecht wie oft vermutet wird: 2018 waren laut Angaben des chinesischen Bildungsministeriums sogar rund 8.000 deutsche Studierende in China. Das ist schon eine beachtliche Zahl für die wenigen 80 Millionen Einwohner, die Deutschland im Vergleich zu China hat. Damit ist die Volksrepublik das zweitbeliebteste außereuropäische Gastland für deutsche Studierende, direkt hinter den USA.
Die klassische deutsche Sinologie hat allerdings immer weniger Zulauf.
Die Sinologie ist an vielen Universitäten ein Orchideenfach. Nichts gegen Tang-Gedichte. Aber wir brauchen China-Kompetenz in den Ingenieurwissenschaften, BWL oder in den Politikwissenschaftlern. Mehr Nicht-Sinologen müssen in China leben, ein wenig Chinesisch lernen und in ihrem Bereich weiter forschen und arbeiten.
Sie haben Physik studiert und sind in Afrika aufgewachsen, da liegt es ja nicht nahe, nach China zu gehen und 20 Jahre zu bleiben?
Ich muss zugeben, es war nicht von Anfang an geplant, so lange zu bleiben. Ich wollte eigentlich nur ein wenig Chinesisch lernen und habe dann zufällig meinen Mann in Peking kennengelernt. Ein begeisterter Halb-Sinologe und dann sind wir eben hiergeblieben. Für die Kinder war es ja durchaus ein Vorteil zweisprachig aufzuwachsen, obwohl wir beide Deutsche sind. Sie haben als Kinder erst Chinesisch gesprochen und danach Deutsch. Was sie aber durchaus geprägt hat, ist der chinesische Optimismus. Das finde ich sehr schön. Denn der ist ja auch außerhalb Chinas nützlich.
Dieser Optimismus hängt ja auch eng mit einer Neugier auf die Zukunft zusammen. Hat Wissenschaft deshalb in China eine andere Bedeutung?
Für die Politik und Staatsführung jedenfalls eine größere als in Deutschland. Wenn man sich Chinas 14. Fünfjahresplan anschaut, wird klar: Wissenschaft gilt als zentraler Treiber des wirtschaftlichen Wachstums und der Innovationskraft. Dafür ist Geld und politische Gestaltungskraft da. In dieser Frage müssen wir in Deutschland nachbessern. Um enger miteinander kooperieren zu können, müssen administrativen Hürden, die das erschweren, abgebaut werden. In China ebenso wie in Deutschland.
Ein Beispiel für solche Hürden in China?
Es hat Fälle gegeben, da verlangt eine Universität, dass der deutsche Gastdozent erst einen Arbeitsvertrag bekommt, wenn er im universitätseigenen Krankenhaus untersucht wurde. Er bekommt jedoch nur ein Visum, um nach China einzureisen, wenn er einen Arbeitsvertrag hat. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das Verrückte dabei: Diese Uni will gar nicht verhindern, dass deutsche Wissenschaftler kommen, aber sie kann ihre unsinnigen Regeln nicht umgehen. Wir haben eine ganze Reihe ähnlich gelagerte Fälle.
Und es gibt auch ideologische Hürden. Wie verhält man sich in dieser Wissenslandschaft, in der der Staat einerseits zu höherem Tempo bei Innovation antreibt und andererseits mehr kontrolliert, zensiert und ideologisch im Gleichschritt laufen lässt?
Erst einmal müssen wir verstehen, dass die Rolle einer Universität in China und auch die Rolle der Forschung eine andere ist. Die Forschung ist kein Selbstzweck, sondern sie soll der Entwicklung der Gesellschaft und am Ende den Interessen der Kommunistischen Partei dienen. In vielen Fällen ist das kein Problem, wenn es beispielsweise darum geht, E-Auto-Batterien zu entwickeln. In manchen Fällen kann sich das aber nicht mit unseren Vorstellungen wissenschaftlicher Freiheit decken, weil es darum geht, Patriotismus und vor allem die Ideologie der Partei bis in den letzten Winkel zu tragen und umzusetzen.
Was ist, wenn deutsche Forscher zwar in China, aber nicht in einem solchen, ideologischen Umfeld arbeiten wollen?
Dann müssten sie woanders arbeiten. Die Ideologie macht vor der Wissenschaft nicht halt. Dabei darf man nicht vergessen, dass Ausländer an den Universitäten meistens mehr Freiheiten haben als ihre chinesischen Kollegen. Sie unterliegen einer anderen Kontrollnorm und genießen eine Art Narrenfreiheit, die in Zeiten schrumpfender Freiräume das allgemeine Klima durchaus beleben kann. Da gibt es Freiräume, die wir ausfüllen sollten. Aber wir dürfen uns dabei auch nicht überschätzen. Von oben herab erreichen wir in China nichts mehr. Unsere Deutungshoheit wird immer schwächer. Das müssen wir vielleicht doch ein wenig realistischer einschätzen.
Aber können Sie anderseits auch nachvollziehen, dass Wissenschaftler sagen: Angesichts der Entwicklungen in Hongkong, Xinjiang, der Zensur, möchte ich in dem Land nicht arbeiten?
Das kann ich nachvollziehen. Nur andererseits: Etwas ändern können wir nur im Dialog und nicht dadurch, dass wir uns von China abwenden. Wenn wir von Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Wissenschaftsfreiheit oder Zivilgesellschaft überzeugt sind, und das bin ich, sollten wir eine Debatte darüber selbstbewusst führen. Eines muss dabei wie gesagt klar sein: Wir können China zu nichts mehr zwingen, aber wir können überzeugende Argumente liefern, die China motivieren sich aus sich selbst heraus zu ändern.
Die Welt hat sich entschieden, mit dem Coronavirus zu leben. Sehr viele Nationen, die bisher eine “No-Covid”-Strategie gefahren haben, ändern nun ihren Kurs: Australien und Neuseeland schicken nicht mehr ganze Städte in den Lockdown, sollten auch nur wenige Corona-Fälle auftreten. Auch Singapur lässt nach mehr als eineinhalb Jahren wieder Besucher ohne Quarantäne einreisen. Taiwan, Südkorea und Japan lockerten trotz steigender Infektionszahlen ebenfalls zuletzt ihre Maßnahmen. Reihenweise haben die “vorsichtigen Asiaten” ihre Strategie geändert. Die letzte große Ausnahme ist China.
Erst am Samstag bestätigte Wu Liangyou, ein Beamter der Nationalen Gesundheitskommission Chinas, dass die Volksrepublik ihren No-Covid-Kurs nicht ändern werde.” Die Ausbrüche in Chinas Nachbarländern und auf der ganzen Welt sind nach wie vor hoch, was diesen Winter und das nächste Frühjahr zu einer komplizierten und ernsten Herausforderung macht”, sagte Wu laut Bloomberg am Samstag.
Die politische Führung in Peking ist weiterhin nicht bereit, dem Coronavirus Raum zu lassen. Deutsche Expats haben sich daran gewöhnen müssen, dass sie das Land nur verlassen können, wenn sie nach ihrer Rückkehr bereit sind, eine mindestens zweiwöchige Quarantäne im Hotel über sich ergehen zu lassen. In den meisten Fällen wird man mittlerweile trotz doppelter Impfung und mehrfacher Corona-Tests sogar für drei Wochen weggesperrt. Groß ist die Freude, wenn das Zimmer dann wenigstens einen Balkon hat.
Der Erfolg der strengen Maßnahmen war lange Zeit sichtbar: Von einigen lokalen Ausbrüchen abgesehen war China in den vergangenen eineinhalb Jahren nach dem ursprünglichen Ausbruch in Wuhan tatsächlich weitgehend frei von Corona. Doch durch die ansteckendere Delta-Variante haben sich die Spielregeln geändert. Die Abstände zwischen den Wellen werden immer kürzer. Den jüngsten Ausbruch hatte die Volksrepublik erst Ende September für beendet erklärt.
Doch den Menschen blieben nur wenige Wochen Zeit, um durchzuatmen. Am 16. Oktober folgte bereits der nächste Ausbruch, der sich nun bereits auf 20 der 31 Provinzen ausgeweitet hat. Es handelt sich um den umfangreichsten Ausbruch in der Volksrepublik seit dem ersten Auftreten des Erregers in Wuhan Ende 2019. Dass die Zahl der Infektionen erneut bislang auf lediglich rund 600 begrenzt werden konnte, hängt mit den drakonischen Maßnahmen der Behörden zusammen. Sobald auch nur ein einziger Fall auftritt, werden ganze Stadtteile in den Lockdown geschickt.
So geschehen etwa in der Vier-Millionen-Metropole Lanzhou, in der die Menschen nun eine strenge Ausgangssperre über sich ergehen lassen müssen. Nicht nur dürfen sie nicht mehr vor die Tür. Jeder wurde mittlerweile fünfmal auf das Virus getestet. Einen Schock erlebten zuletzt auch die Besucher des Disneylands in Shanghai. Zehntausende wurden fast den gesamten Tag auf dem Gelände festgehalten, weil es unter den Besuchern einen Verdachtsfall gab. Erst, nachdem alle getestet waren, wurden die Tore wieder geöffnet. Zum Abschied gab es dann immerhin ein Feuerwerk.
Kritik an den harten Maßnahmen trotz einer Impfquote von 76 Prozent findet in den streng zensierten Staatsmedien nicht statt. Stattdessen wird die Führung überschwänglich gelobt: “Unter der starken Führung des Zentralkomitees der Partei mit Genossen Xi Jinping als Kern hat unser Land die Auswirkungen der Pandemie überwunden”, kommentierte etwa am Dienstag die Volkszeitung auf ihrer Titelseite. Der Artikel fügte hinzu, dass China die einzige große Volkswirtschaft sei, die im Jahr 2020 ein Wirtschaftswachstum verzeichnen konnte. Die strikten Maßnahmen zu beenden, würde in “eine Katastrophe führen”, schrieb die ebenfalls parteinahe Zeitung Global Times nur einen Tag später.
Immer mehr Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass China selbst nach den Olympischen Winterspielen in Peking und dem wichtigen Parteikongress im kommenden Herbst seine Grenzen nicht wieder vollständig öffnen wird. Befeuert werden diese Spekulationen von den jüngsten Aussagen des chinesischen Top-Virologen Zhong Nanshan, einem wichtigen Corona-Berater der Regierung.
Auf die Frage, wie lange China die Reisebeschränkungen noch aufrechterhalten wird, antwortete Zhong kürzlich in einem Fernsehinterview: “Ziemlich lange”. Die genaue Dauer würde davon abhängen, wie gut andere Länder bei der Eindämmung des Virus abschneiden. “Egal wie gut China abschneidet, sobald es sich öffnet und Fälle importiert, wird die Übertragung definitiv im Land erfolgen”, argumentiert Zhong. Eine “Zero-Covid”-Strategie sei auch für die Wirtschaft weniger kostspielig, als sich zu öffnen und einen wirklich großen Ausbruch zuzulassen. Gregor Koppenburg/Joern Petring

Der wichtigste Punkt am Aiways U5 ist gar nicht mal der Preis. Zwar biegt das Elektro-SUV abzüglich der Förderungen durch Bund und Länder für unter 30.000 Euro in die heimische Garage ein, der wichtigste Punkt ist vielmehr das Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn für diese Summe gibt es ein Auto, das mit beinahe doppelt so teuren Modellen fast schon auf Augenhöhe fährt. Der Aiways U5 steht damit für den Trend, dass in der Mobilitätsrevolution neue Konzepte aus jungen Autonationen konkurrenzfähig neben den Traditionsmarken stehen. Der Automarkt wird dadurch merklich vielfältiger.
Aiways wurde erst im Jahr 2017 als Start-up gegründet. Den U5 gibt es seit 2019 als erstes Modell des Unternehmens. Das Start-up hat mehrere Strategien angewandt, um sich aus dem Stand unter die echten Autohersteller zu katapultieren. So hat Aiways die Hälfte der schon lange existierenden Jiangling Motors Corporation übernommen – um eine Lizenz für den Bau zu bekommen und um die Fabrik nutzen zu dürfen. China verknappt Lizenzen zum Bau von Elektroautos gezielt, um den Wildwuchs der Hersteller einzudämmen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Inzwischen sind die eingekauften Fähigkeiten allerdings schon nicht mehr nötig, Aiways steht bereits auf eigenen Füßen. Das Unternehmen unterhält heute in der südostchinesischen Stadt Shangrao eine eigene Fabrik. Voll ausgebaut soll sie auf eine Kapazität von 300.000 Autos im Jahr kommen. In Hinblick auf künftige Modelleinführungen hat sich das Unternehmen eine Elektro-Plattform erdacht, bei der sich die Größe der Fahrzeuge, der Antrieb und die Batteriekapazität leicht anpassen lässt.
Durch diese technische Basis kann ein junges Unternehmen wie Aiways ein neues Modell pro Jahr versprechen. Schon 2022 soll der U6 kommen. Schon zu haben ist der U5. Das Elektro-SUV ist mit 4,68 Metern etwa acht Zentimeter kürzer als ein Mercedes EQC (ab 66.000 Euro) und fünf Zentimeter länger als ein Hyundai Ioniq 5 (ab 41.900 Euro). In Deutschland fahren bereits gut 1.000 Exemplare des U5 durch die Straßen.
Größtes Handicap des U5 ist der Crashtest. Nur drei Sterne gab es vom Euro NCAP im Jahr 2019. Das bedeutet zwar, dass das Fahrzeug sicher ist, in Europa werden aber von Fahrzeugen, die sich nicht allein über den Preis oder andere Alleinstellungsmerkmale verkaufen wollen, gemeinhin fünf Sterne erwartet. Allerdings bekam der U5 den Abzug für elektronische Unzulänglichkeiten, die mittlerweile behoben seien, wie das Unternehmen versichert. So löse beispielsweise der Beifahrerairbag jetzt schneller aus. Der kommende U6 werde die Bestbewertung erhalten, verspricht der Hersteller. Wir werden ihn an diese Ankündigung messen.

Das Battery Pack im Aiways U5 hat eine Kapazität von 63 Kilowattstunden. Das ist mehr als im Hyundai Ioniq 5, dessen Batterie 58 Kilowattstunden aufnehmen kann. Es ist weniger als im Mercedes EQC, der auf 80 Kilowattstunden kommt. In der Praxis reicht der Akku im Alltag für rund 300 Kilometer. Der Aiways kommt mit 204 PS ziemlich genau auf die halbe Leistung des Mercedes.
Dass der Aiways U5 ein Elektroauto ist, das in China erdacht wurde, wird mit dem ersten Probesitzen klar. Der Platz auf der Rücksitzbank ist enorm. Klar – in der Volksrepublik sitzen hier oft die Fahrzeugbesitzer, während ein Chauffeur den Rest erledigt. Darunter leidet ein wenig der Kofferraum, der mit 432 Litern allerdings deutlich mehr schluckt als der des Mercedes.
Sehr chinesisch geht es beim Bordcomputer weiter. Das Auto ist komplett digitalisiert. Fenster, Schiebedach und Kofferraum – nichts, was sich nicht über den zentralen Touchscreen steuern ließe. Wenn auch noch mit Ungenauigkeiten bei der Übersetzung. So wird das Dachfenster zwar geöffnet, wer es schließen will, muss es aber “deaktivieren”.
Weil in China das Handy Dreh- und Angelpunkt des täglichen Lebens und der Mobilität ist, gibt es auch kein Navigationsgerät. Per App soll stattdessen das Handy mit dem System gekoppelt werden. Schließlich können Handys heute meist besser navigieren als Navigationssysteme. Bei IOS-Smartphones funktioniert das einwandfrei, bei Android hakt es.
Grundsätzlich ist die Einbindung des Handys aber kein dummer Gedanke – gerade im Hinblick auf die Elektromobilität. Die freien Anbieter aus dem App-Store bieten meist kostenlos Lösungen an, die in vielerlei Hinsicht detaillierter, umfangreicher und aktueller sind, als die Werksanwendungen vieler Hersteller. Sie sind zum Beispiel oft besser darin, Ladestationen entlang der Strecke zu finden.
Der Aiways U5 kann mit der hiesigen Konkurrenz mithalten und sich als Alternative etablieren. Für eine Marke, die gerade einmal vier Jahre alt ist, ist das ein erstaunlicher Erfolg. Er zeigt, wie dynamisch das Segment ist. Der Vorsprung der großen, traditionellen Konzerne schwindet im Bereich der Elektromobilität besonders schnell. Das eröffnet Angreifern aus China trotz der etablierten Konkurrenz Chancen auf dem europäischen Markt. Christian Domke Seidel
Die Stromkrise in China beginnt sich zu entspannen. Nur noch fünf Provinzen in der Volksrepublik haben mit größeren Stromausfällen zu kämpfen, wie Bloomberg berichtet. Mitte Oktober wurde der Strom noch in 20 Provinzen rationiert und es kam mitunter zu stundenlangen Stromabschaltungen (China.Table berichtete). Nachdem die Zentralregierung Kohlebergwerke angewiesen hatte, die Produktion zu erhöhen, konnte Kraftwerke und große industrielle Stromverbraucher ihre Kohlelager wieder auffüllen.
Chinas tägliche Kohleproduktion ist demnach in den letzten Wochen um mehr als eine Million Tonnen auf zuletzt fast 11,7 Millionen Tonnen gestiegen. Analysten zufolge übertrifft der Produktionsanstieg die Erwartungen. “Die Stromknappheit hat sich gelockert. Alle fahren ihre Kohleproduktion hoch. Das Tempo ist ziemlich beeindruckend”, sagt Michelle Leung von Bloomberg Intelligence. Doch in einigen Industriezweigen mit hohem Energieverbrauch würde die Stromversorgung weiterhin eingeschränkt. Und durch die staatliche Liberalisierung der Strompreise müssen diese Sektoren mit erheblich höheren Stromkosten rechnen (China.Table berichtete). Noch sei einer Analystin zufolge unklar, ob die Stromversorgung über den ganzen Winter sichergestellt werden kann.
Auch der größte Netzbetreiber des Landes State Grid signalisiert Entspannung. Der Stromengpass habe sich dem Unternehmen nach signifikant reduziert. Allerdings werde sich das Stromnetz im Winter und Frühling in einer “insgesamt angespannten Balance mit teilweisen Lücken” befinden, so State Grid, dessen Netz laut Firmenangaben 1,1 Milliarden Menschen versorgt und 88 Prozent des chinesischen Territoriums abdeckt. nib
China ist bereit, Zölle zu senken, wenn das regionale Handelsabkommen RCEP am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, wie Bloomberg berichtet. Demnach habe das Handelsministerium sich für eine rasche vollständige Umsetzung des Abkommens ausgesprochen. Die Regional Comprehensive Economic Partnership wurde im November 2020 von 15 Staaten der Region beschlossen, darunter China, Japan, Südkorea, Australien, Vietnam und den Philippinen. Bisher haben zehn Staaten das Abkommen ratifiziert. Die Senkung der Zölle zwischen den Partnern ist eines der zentralen Ziele von RCEP. Zudem sollen Investitionen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten gestärkt werden.
Die RCEP ist die größte Freihandelszone der Welt. Sie repräsentiert über 30 Prozent des Welthandels mit einer Bevölkerung von rund 2,2 Milliarden Menschen. nib
China hat im Oktober einen Rekord-Handelsüberschuss verzeichnet. Die Exporte wuchsen im Oktober mit 27,1 Prozent auf 300,2 Milliarden US-Dollar (259,3 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahresmonat stärker als erwartet, wie Reuters berichtet. Als Ursachen werden die steigende weltweite Nachfrage zur Weihnachtssaison, die nachlassende Stromknappheit und weniger Unterbrechungen in den Lieferketten angeführt. Die Importe der Volksrepublik lagen hingegen mit einem Plus von 20,6 Prozent fast fünf Prozentpunkte hinter den Erwartungen. Dafür wird die generelle Schwache der inländischen Nachfrage angeführt. Der Handelsüberschuss Chinas lag im Oktober bei 84,5 Milliarden US-Dollar und somit gut 18 Milliarden Dollar über dem September-Wert. nib
Eine Delegation von EU-Abgeordneten hat einen viel beachteten Besuch in Taipeh beendet (China.Table berichtet). Bei einer Pressekonferenz betonten die Europa-Politiker, dass die Reise keine Provokation in Richtung Peking sei. “Wir definieren unsere Politik nicht gegen irgendjemanden, sondern unterstützen unsere Freunde und unsere Prinzipien”, sagte Delegationsleiter Raphaël Glucksmann. Der Franzose betonte, dass in den kommenden Monaten “immer mehr hochrangige Partnerschaften und Kooperationen” zwischen der Europäischen Union und Taipeh zu erwarten seien. Auch der griechische EU-Abgeordnete Georgios Kyrtsos erklärte: “Wir provozieren niemanden. Wir sind nicht gegen China, wir sind für Taiwan.” Das Interesse der Delegation gelte der Wirtschaft Taiwans und seiner Rolle beim digitalen Wandel, so Kyrtsos.
Die Europa-Politiker hatten zuvor Taiwans Digitalministerin Audrey Tang getroffen. Sie habe sich über eine Einladung nach Brüssel gefreut und diese angenommen, schrieb Tang auf Twitter. Die Delegation und Tang sprachen demnach über die Bekämpfung von Desinformation. Die EU könne in dieser Hinsicht viel von Taiwan lernen, erklärten die Europa-Abgeordneten. Auch ein informeller jährlicher EU-Taiwan-Dialog sei besprochen worden, sagte der litauische Politiker Andrius Kubilius. Sein Heimatland erfährt seit der Entscheidung, in Vilnius ein “Taiwan”-Büro einzurichten, wirtschaftlichen Druck aus Peking. Dieser werde das Vorhaben Litauens aber nicht ändern, sagte Kubilius.
Die tschechische EU-Abgeordnete Markéta Gregorová sprach sich für ein Umdenken in der EU-Taiwan-Politik aus: “Es ist an der Zeit, Taiwan als Taiwan zu betrachten, nicht durch die Linse EU-China, und uns darauf zu konzentrieren, was wir voneinander wollen.” Das bedeute nicht, die “One-China-Politik” Brüssels abzuschaffen, so Gregorová.
Der Besuch der Abgeordneten in Taiwan war der erste einer offiziellen Delegation des Europaparlaments. Die EU-Politiker sind Mitglieder des Sonderausschusses für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE). Das EU-Parlament hat bereits im Oktober für eine engere Beziehung zu Taiwan gestimmt – die offizielle Linie Brüssels wird jedoch primär von der EU-Kommission und dem EU-Rat bestimmt. ari
Die Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns Kaisa Group sowie von drei Tochterunternehmen wurden am Freitag vom Handel ausgesetzt. Kaisa teilte mit, es stehe aufgrund des schwierigen Immobilienmarktes und der Herabstufung seines Kredit-Ratings unter beispiellosem Liquiditätsdruck, wie Reuters berichtet. Der Konzern hatte wie andere Immobilienentwickler Vermögensprodukte aufgelegt und konnte in diesem Zusammenhang eine fällige Zahlung nicht leisten.
Kaisa muss innerhalb des nächsten Jahres umgerechnet mehr als 2,7 Milliarden Euro an Auslandsanleihen bedienen. Nach dem ebenfalls in Finanzproblemen steckenden Evergrande ist Kaisa der am meisten im Ausland verschuldete chinesische Immobilienentwickler, so Reuters. Um die Vermögensprodukte ablösen zu können, sollen demnach bis Ende 2022 Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet elf Milliarden Euro veräußert werden. Der Großteil bestehe aus Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien. Nach Hausverkäufen gemessen, liegtder chinesische Immobilienkonzern auf Rang 25 der größten Immobilienentwickler Chinas. nib

Ich halte den analytischen Ansatz der Autoren für praxisfern und herrschaftsunkritisch. Studien wie diese werden die Krise des öffentlichen Vertrauens in das professionelle Wissen von China-Wissenschaftlern noch weiter vertiefen. Während von deutschen Sinologen häufig mehr China-Kompetenz in Staat und Gesellschaft gefordert wird, stellt sich für mich vielmehr die Frage, was für eine Analyse der Volksrepublik China bislang betrieben wird.
Meine eigene Forschung zum Thema Wissenschaftsfreiheit und die Rolle Chinas hat ergeben, dass in der deutschen Wissenschaft die politische Zensur und die daraus resultierende Selbstzensur ein Tabuthema darstellt. Dies hat negative Auswirkungen auf den akademischen und öffentlichen China-Diskurs in Deutschland. Die vorliegende Studie ist ein Beispiel hierfür.
Die Praxisferne wird bereits im Vorwort deutlich. Es klagt über “unterkomplexe” deutsche Medienberichte und über fehlende Nuancen. Politikentscheidungen würden zu selten aus chinesischer Logik heraus verständlich gemacht. Weiter heißt es: Beschreibungen, Verortungen und Definitionen schafften “Realitäten”, was besonders für die Auslandsberichterstattung gelte, “da wir in anderen Ländern selbst keine unmittelbaren Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, dort keine Gespräche und Diskussionen geführt, keine eigenen Interessen und auch keine weitergehenden Kenntnisse über Geschichte, Kultur und spezifische Problemstellungen erworben haben, die wir mit einem massenmedial vermittelten Narrativ positiv oder negativ in Beziehung setzen könnten.”
Diese Formulierungen, die den Ausgangspunkt der Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung erläutern, verwundern schon sehr. Keine Gespräche und keine Diskussionen? Keine eigenen Interessen und auch keine weitergehenden Kenntnisse über Geschichte, Kultur und spezifische Problemstellungen? In diesem Vorwort wird so getan, als hätte es in den letzten vierzig Jahren kein praktisches westliches China-Engagement gegeben. Es entsteht der Eindruck, als seien für das Chinabild in Deutschland ausschließlich die Medien verantwortlich. Die Realität sieht allerdings völlig anders aus.
Unzählige deutsche Politiker, Wirtschaftslenker, Journalisten, Kulturschaffende, Akademiker und Studenten haben die Volksrepublik China seit dem Beginn der 1980er-Jahre besucht oder befinden sich in konstantem Austausch mit Partnern vor Ort. Viele Zehntausende deutsche Staatsbürger haben zudem lange in Festlandchina gelebt und gearbeitet. China auf politische beziehungsweise akademische Diskurse zu begrenzen, wird daher der Fülle an Erfahrungen auf deutscher Seite in keinster Weise gerecht.
Stattdessen wird von der Herausgeberin der Studie so getan, als bliebe die Volksrepublik China trotz des intensiven westlichen China-Engagements ein Buch mit sieben Siegeln, und die Medien würden das Land nun in die Rolle des Feindes pressen. Das ist zu kurz gedacht. Denn eben, weil wir zunehmend Erfahrungen sammeln im Umgang mit der Volksrepublik, spiegeln die Medien im Wesentlichen das wider, was sich an Erkenntnissen aus diesem Umgang ergibt.
Meiner Einschätzung nach gehören viele westliche Journalisten mit langer akademischer und praktischer China-Erfahrung sogar zu den besten China-Kennern. Viele besitzen einen hohen Grad an Empathie und Einfühlungsvermögen, viele sprechen gut, manche fließend Chinesisch. Sie kennen chinesische Binnenperspektiven besser als viele andere, die das Land kennengelernt haben oder dort leben.
Ich traue diesen Journalisten sehr wohl zu, den Einparteienstaat realistisch einzuschätzen. Sie sind sich bewusst, was passiert, wenn aufgrund von politischen Zensurvorgaben Informationsströme innerhalb Chinas versiegen.
Gerade zu Beginn der Covid-Pandemie konnten wir beobachten, wie innerhalb Chinas massive Konflikte um Meinungsfreiheit ausbrachen. Verantwortungsbewusste Mediziner wie Dr. Li Wenliang wurden daran gehindert, Kollegen vor dem Virus zu warnen. Chinesische Kritiker am Krisenmanagement Xi Jinpings wurden mundtot gemacht oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Mittlerweile wird chinesische Forschung zu Covid-19 vor ihrer Publikation von Regierungsbeamten nach politischen Kriterien geprüft. Wie sonst außer “kritisch” bis “sehr kritisch” sollte eine Berichterstattung in diesem Kontext aussehen? Doch die Studie liefert einen solchen Kontext nicht.
Die Opfer des Xi-Regimes spielen in der gesamten Einschätzung der Berichterstattung überhaupt keine Rolle. China wird stattdessen vorwiegend aus Sicht der Herrschenden analysiert. Und auch wenn es legitim ist, sich mit dem “offiziellen China” analytisch auseinanderzusetzen, so sollte eine solche Befassung nicht auf Kosten des “inoffiziellen Chinas” gehen.
Die Studie vermittelt den Eindruck, als gäbe es in Festlandchina kaum Kritiker an Xis Krisenmanagement, und deutsche Medien würden diese Harmonie im Land schlicht ignorieren, weil sie nicht in das Weltbild der Autoren passe, oder sie die öffentlichen Debatten nicht verfolgten. Es wird so getan, als würde es nur in Hongkong ein paar Aktivisten geben, und Medien nicht anerkennen wollen, dass es sich um eine “terroristische Bande” handle, so zumindest die Lesart der chinesischen Regierung.
Die Studie ignoriert dabei die vielen Dissidenten im Land wie den Immobilien-Unternehmer Ren Zhiqiang, der für seine Kritik an der Staatsführung unter Vorwand der Korruption zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde. Die Autoren ignorieren auch die ehemalige Professorin an der Parteihochschule, Cai Xia, die in Folge ihrer Regime-Kritik aus der Partei ausgeschlossen wurde und keine Pension mehr erhält. Der chinesische Bürgerjournalist Chen Qiushi wird ebenfalls nicht erwähnt. In Folge seiner Berichterstattung in Wuhan verschwand er für 600 Tage von der Bildfläche. Die Bürgerjournalistin Zhang Zhan hingegen landete für ihr Engagement im Gefängnis. Sie ist derzeit in einem Hungerstreik. Ihr Gesundheitszustand gilt seit Monaten als kritisch.
Es ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar, wenn die Autoren von “einem letztlich erfolgreichen Zusammenspiel politischen und gesellschaftlichen Handelns” sprechen. Wenn in der Studie Vertreter des “inoffiziellen Chinas” einmal benannt werden, so ist deren Position häufig nur einen kurzen Halbsatz wert, und ihr jeweiliges Engagement wird negativ konnotiert.
So wie das der chinesischen Schriftstellerin Fang Fang, die für ihr Wuhan-Tagebuch von Nationalisten angegriffen wurde. In der Studie wird sie nur kurz dafür erwähnt, dass mit Bezug auf Fang Fang in der deutschen Berichterstattung das “Behördenversagen in der Frühphase angeprangert” werde. Professor Xu Zhangrun, der im Zuge seiner Kritik an Xis Umgang mit Covid seinen Job an der Tsinghua University verlor, wird derweil nur zitiert, um mediale Kritik am autokratischen Führungsstil Xis infrage zu stellen.
Die Studie muss sich also selbst den Vorwurf fehlender Nuancen gefallen lassen, die sie der China-Berichterstattung vorwirft.
An der Person Xi Jinpings wird besonders deutlich, wie herrschaftsunkritisch die drei Autoren China analysieren. In der Studie sprechen sie von einem “Narrativ vom kommunistischen Diktator”. Aber es gibt natürlich auch so etwas wie politische Realität.
Xi Jinping hat in der historischen Wirklichkeit einen Personenkult geschaffen, die kollektive Führung im Ständigen Komitee des Politbüros beendet und mit dem Dokument Nr. 9 jeder Liberalisierung und Demokratisierung des Landes eine deutliche Absage erteilt. Aus politikwissenschaftlicher Sicht lässt sich das Xi-Regime als personalisierte Diktatur bezeichnen. Es ist daher völlig legitim, wenn deutsche Journalisten diesen Umstand in ihrer China-Berichterstattung auch so deutlich ansprechen.
Aufgrund der benannten Praxisferne sowie der mangelnden Herrschaftskritik halte ich die Studie für wenig gewinnbringend.
Zhang Ruimin tritt als Vorsitzender der Haier Group zurück. Der 72-Jährige Gründer des Haushaltsgeräte- und Elektronikkonzerns mit 70.000 Angestellten wird dem Unternehmen als Ehrenvorsitzender erhalten bleiben. Zhou Yunjie, vormals “President” bei Haier, wird Zhang als Vorsitzender und CEO ablösen. Liang Haishan wird vom “Vize-President” zum “President”.
Zuo Fang, Gründer der einflussreichen Wochenzeitung Southern Weekly, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war bis 1994 Chefredakteur und arbeitete danach noch vier weitere Jahre für die Zeitung. Die Zeitung erscheint seit 1984 und hat eine Auflage von 1,3 Millionen.
Jacquelien Postigo Brussee ist neue China-CEO der Designagentur Jones Knowles Ritchie (JKR). Die Position wurde neu geschaffen. Brussee hat mehr als zehn Jahre in China gearbeitet. Unter anderem leitete sie das Asienpazifik-Team für Marketing und Kommunikation von RH Marine (ehemals Royal Imtech).

Zugegeben: Wir sind generell Tier-Fans beim China.Table. Aber zu diesem Shiba Inu gibt es einfach eine zu schöne Geschichte, um ihn nicht in das “Dessert” zu heben. Der Hund wurde jüngst für umgerechnet 25.000 US-Dollar versteigert. Denn Deng Deng, so sein Name, ist in China eine Internetberühmtheit. 2014 wurde er Medienberichten zufolge von seinem Besitzer in einer Tierschule zurückgelassen. Bereits 2018 wurde Deng Deng zur Versteigerung angeboten – der bis dato verschollene Besitzer meldete sich jedoch und verhinderte die Auktion. Seine Schulden bei der Tierschule bezahlte er laut Bericht aber nicht, der Shiba Inu wurde also wieder zur Versteigerung angeboten. Nachdem das zuständige Gericht die Auktion des Hundes publik gemacht hatte, kannte die Begeisterung auf Weibo und Wechat nun keine Grenzen mehr – und Internetstar Deng Deng hat nun ein neues Zuhause bei einem viel bietendem Hundefreund.