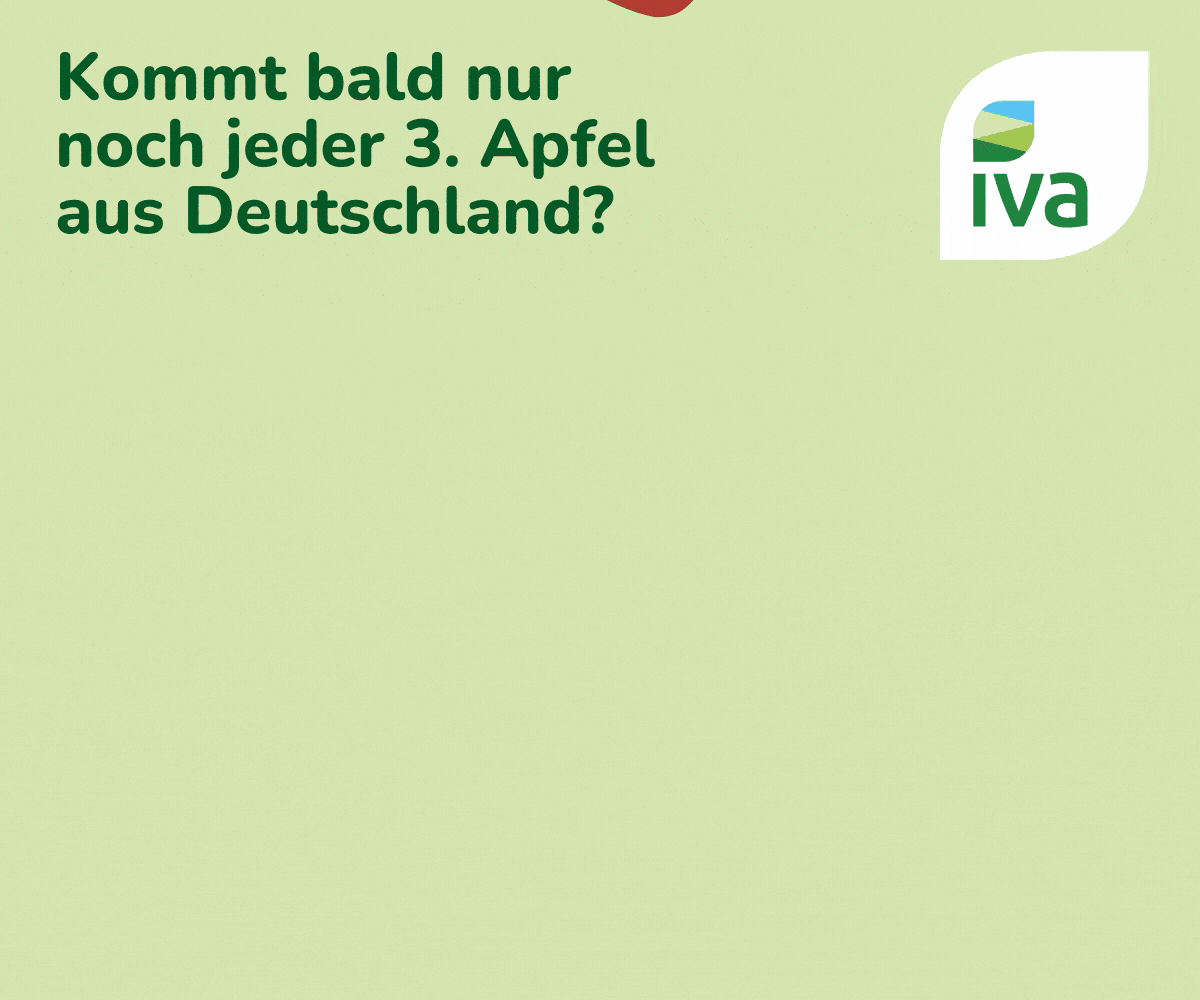Konsumkrise statt Kauflaune?
Wie privater Konsum wieder Konjunkturmotor werden kann, diskutieren Spitzen aus Wirtschaft, Politik und Forschung beim Konsumklima Summit 2025 – am 27. November im AXICA in Berlin.
Kostenfreie Teilnahme – jetzt Zugang anfragen.

Neue Kandidatin für das Verfassungsgericht: Warum es Sigrid Emmenegger wahrscheinlich schaffen wird
Nach dem Debakel um Frauke Brosius-Gersdorf müsse es jetzt glattgehen, das hatten sich die Koalitionäre fest vorgenommen. Deswegen hat die SPD in Abstimmung mit der Union eine Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht ausgewählt, die über jeden Zweifel erhaben ist: Sigrid Emmenegger, Richterin am Bundesverwaltungsgericht.
Nur der engste Kreis war eingeweiht, am Mittwoch hatte der Name auch einzelne Grüne und Linke erreicht. Am Nachmittag informierten die Parlamentarischen Geschäftsführer von Union und SPD, Steffen Bilger und Dirk Wiese, ihre Fraktionen über den Namen der Kandidatin. „Die Fraktionsführungen haben jeweils in persönlichen Gesprächen ein sehr positives Bild von Frau Dr. Emmenegger gewinnen können und sich von ihrer persönlichen und fachlichen Geeignetheit überzeugt“, heißt es in dem Brief. Das war eine klare Ansage an die eigenen Leute: Niemand soll nun öffentlich Zweifel äußern, der Wahlprozess für das höchste Gericht soll nicht weiter beschädigt werden.
Die Koalition plant die Abstimmung im Bundestagsplenum für den 26. September. Dann sollen neben Emmenegger, die im Zweiten Senat auf die ausscheidende Vizepräsidentin Doris König folgen soll, auch über die anderen beiden Kandidaten gewählt werden: Ann-Katrin Kaufhold, ebenfalls auf Vorschlag der SPD für den Zweiten Senat, und Günter Spinner auf Vorschlag der Union für den Ersten Senat. Für die Zweidrittelmehrheit sind SPD und Union auf Stimmen von Grünen und Linken angewiesen. Am Mittwoch gab es dazu noch keine Festlegungen.
Die Grünen sind verschnupft, dass Schwarz-Rot sie bislang nicht eingebunden hat. „Dass man nicht auf unsere Rückmeldung wartet, ist reichlich unprofessionell angesichts der Vorgeschichte“, teilte die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann mit. Die Spitzen der Grünen-Fraktion wollen Emmenegger noch kennenlernen. Auch das Verfahren müsse im Konsens beschlossen werden, wenn es eine demokratische Mehrheit geben solle, hieß es bei den Grünen. Die Linke fordert, dass Vertreter von CDU/CSU mit ihnen über die Richterwahl sprechen. Das stellt die Union abermals vor die Schwierigkeit, die Mehrheit zu sichern und dabei nicht gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss zu verstoßen. Am kommenden Montag will sich die Linke in ihrer Fraktionssitzung mit der Personalie Emmenegger befassen.
Trotzdem: Ernste Sorgen um die Zweidrittelmehrheit muss sich die Koalition wohl nicht machen. Die Zustimmung von Grünen und Linken für die SPD-Kandidatinnen gilt als sehr wahrscheinlich, bei der Wahl Spinners könnte es einige Abweichler geben. Union, SPD, Grüne und Linke haben zusammen 477 Sitze, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 420 – wobei es auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder des Bundestags ankommt.
Emmenegger, Jahrgang 1976, ist seit Januar 2021 Richterin am Bundesverwaltungsgericht, dort unter anderem zuständig für Bau- und Bodenrecht, das Recht des Ausbaus von Energieleitungen und Denkmalschutzrecht. Zuvor war die Juristin Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Koblenz. Sie wurde mit einer viel gelobten theoriegeschichtlichen Arbeit mit dem Titel „Gesetzgebungskunst“ an der Universität Freiburg promoviert. Ihr Doktorvater ist derselbe wie der von Ann-Katrin Kaufhold: der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle.