nicht nur in der Ukraine, in ganz Europa werden sich viele Menschen an den Moment erinnern, an dem sie erfuhren, dass russische Panzer Richtung Kiew rollen und russische Raketen in zahlreichen Städten der Ukraine einschlagen. Ein halbes Jahr ist der 24. Februar 2022 nun her. Im Schatten des russischen Angriffskrieges beging die Ukraine gestern ihren Nationalfeiertag. Vor 31 Jahren, am 24. August 1991, hatte die damalige Sowjetrepublik ihre Unabhängigkeit erklärt. Auch in Brüssel erinnerte man daran. Auf dem Grand-Place wurde eine 30 Meter lange Flagge des Landes entrollt, unter andere im Beisein von Ursula von der Leyen. Europa stehe heute und langfristig an der Seite der Ukraine, hatte die EU-Kommissionspräsidentin am Morgen in einer Videobotschaft gesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte die Zugehörigkeit der Ukraine zur EU, US-Präsident Joe Biden sagte weitere Militärhilfen zu. Mehr lesen Sie in den News.
Das gemeinsame Ziel der Mitgliedstaaten zum Gassparen hat die Energiemärkte nur kurz beruhigt, zuletzt sind Strom- und Gaspreis wieder deutlich angestiegen. Nun kommt von der tschechischen Ratspräsidentschaft ein Vorschlag, mit dem sich das Problem der hohen Preise gesamteuropäisch angehen lasse – in Form eines Höchstpreises für Energie. Das spanische Modell eines Energie-Preisdeckels werde zurzeit in der EU diskutiert, sagte gestern Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Expertinnen und Experten halten von dieser Idee jedoch nichts, wie Manuel Berkel erfahren hat.
Es ist nicht nur der Mangel an russischem Gas, der die Energiemärkte in Aufruhr versetzt. Die Dürre und die extreme Hitze beeinträchtigen die Stromerzeugung in zahlreichen europäischen Ländern. So hat der Stromexporteur Norwegen angekündigt, seine Lieferungen in die EU in den nächsten Monaten möglicherweise einzustellen. Denn die Wasserreservoirs des nordischen Landes sind ungewöhnlich leer. Beunruhigende Nachrichten kommen auch aus Frankreich und Italien. Nun zeige sich, wie anfällig die Stromversorgung für die Folgen des Klimawandels sei, schreibt Claire Stam. Aufgrund der engen Verflechtung der europäischen Energiemärkte drohe ein Domino-Effekt.

Gazprom hat es wieder einmal geschafft, für Alarmstimmung in den europäischen Hauptstädten zu sorgen. Seit der jüngsten Ankündigung einer angeblichen Turbinenwartung ist der Gaspreis für Dezember um über 14 Prozent gestiegen, der Strompreis fürs kommende Jahr um fast 19 Prozent. Die tschechische Ratspräsidentschaft erwägt nun einen außerordentlichen Energierat. Das meldete gestern die Nachrichtenagentur ČTK nach einem Pressegespräch des Ministers für Industrie und Handel, Jozef Síkela. Der war erst Ende Juli für seinen Verhandlungserfolg gefeiert worden, als sich die EU-Energieminister auf ein gemeinsames Gassparziel einigten.
Die Märkte hatte die Einigkeit nur kurz beruhigt. Die hohen Energiepreise seien ein gesamteuropäisches Problem, für das eine gesamteuropäische Lösung gefunden werden sollte, wird Síkela nun zitiert. Aufhorchen lässt ein Vorschlag des ehemaligen Bankiers: Eine der möglichen Lösungen sei die Festlegung eines Höchstpreises für Energie. Tschechien sei sicherlich eins der Länder, die diesen Weg unterstützen würden, sagte Síkela. Der nächste Energierat war bisher erst für den 25. Oktober angesetzt.
Auf vergangenen EU-Gipfeln waren unionsweite Preisobergrenzen noch stets abgewehrt worden. Die Kommission hatte zwar selbst nationale Preisobergrenzen als eine mögliche Antwort ins Spiel gebracht, billigte aber nur fallweise Beihilfen einzelner Staaten und verabschiedete sich für grundsätzliche Lösungen in einen fortwährenden Prüfprozess.
Die ersten nationalen Maßnahmen laufen demnächst schon wieder aus, in Frankreich werden es im Winter die staatlichen Höchstpreise für Strom und Gas sein. Die milliardenschweren Zuschüsse werde die Regierung nicht aufrechterhalten können, erklärte gestern ein Sprecher. Präsident Emmanuel Macron schwor seine Landsleute angesichts des Ukraine-Krieges und des Klimawandels auf ein “Ende des Überflusses, der Sorglosigkeit und der Gewissheiten” ein. Im September will Premierministerin Élisabeth Borne ein Konzept zum Energiesparen und zur künftigen Energieversorgung vorlegen.
Seitdem auch die Strompreise an vielen Börsen schwindelerregende Höhen erreicht haben, schielt man in einigen Hauptstädten offenbar zunehmend auf die Sonderregeln für Spanien und Portugal. Im Juni hatte die Kommission Beihilfen in Höhe von 8,4 Milliarden Euro genehmigt. Bis Ende Mai nächsten Jahres gelten für den Brennstoff von Gaskraftwerken Höchstpreise, die Differenz zum Marktwert dürfen die Regierungen als Zuschüsse zahlen – wobei die Verbraucher einen Großteil der Subvention über eine Umlage selbst finanzieren.
Die Kommission hatte Spanien und Portugal aber stets als Sonderfall dargestellt, weil die Strom- und Gasverbindungen über die Pyrenäen nur schwach ausgebaut sind. Sollte heißen: Die Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt seien begrenzt. Nun wachsen andernorts die Begehrlichkeiten.
Derzeit werde in der EU diskutiert, ob das spanische Modell auf ganz Europa ausgerollt werden könne und solle, sagte gestern der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, bei einer öffentlichen Diskussion. Es gehe darum, Lösungen für die Hochpreisphase der nächsten 18 bis 24 Monate zu finden, so der Spitzenbeamte weiter. Das lässt sich als Hinweis deuten, dass Berlin auf absehbare Zeit am Strommarktmodell festhalten will, das zuletzt heftigst in der Kritik stand, weil teure Gaskraftwerke den Preis für die gesamte Stromerzeugung setzen.
Allerdings schließt das Wirtschaftsministerium einen EU-weiten Strompreisdeckel nicht aus. Man gucke sich alle Vorschläge sehr genau an, sagte Graichen.
Ökonomen aber halten einen Preisdeckel wie in Spanien weiterhin für das falsche Signal. “Der Eingriff hat eine Reihe von Nebenwirkungen, zum Beispiel wird ein Teil des subventionierten Stroms exportiert“, sagt Lion Hirth von der Hertie School. Damit das Instrument halbwegs funktioniert, müssten laut dem Strommarktexperten zumindest drei Voraussetzungen erfüllt sein.
Es dürfe nur geringe Leitungskapazitäten in Nachbarstaaten geben, der zusätzliche Gasbedarf für die Verstromung müssen über Importe auch tatsächlich beschafft werden können und der Stromhandel müsse im Wesentlichen auf dem kurzfristigen Spotmarkt stattfinden. “Alle drei Bedingungen sind in Spanien einigermaßen erfüllt – in Deutschland keine einzige. Eine Anwendung des spanischen Instruments in Deutschland oder auch in der ganzen EU halte ich deshalb für extrem problematisch“, sagt Hirth.
Kritik kommt auch von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm von der Universität Erlangen-Nürnberg. “Eine Senkung der Brennstoffkosten durch Zuschüsse ist in der aktuellen Situation nicht zielführend. Dies heizt unnötig den Verbrauch der teuren fossilen Energieträger an und läuft damit der Notwendigkeit des Gassparens zuwider”, sagte Grimm gestern zu Europe.Table. “Besser wäre es, den Kunden durch Einmalzahlungen die Preisdifferenz für einen Grundverbrauch zu erstatten, die hohen Preise aber wirken zu lassen.”
Nach Ansicht der Sachverständigen ist der Ernst der Lage noch immer nicht angekommen: “Wenn wir uns in die Lage versetzen wollen, einen russischen Gas-Lieferstopp ohne eine Gasmangellage zu meistern, dann müssen wir beim Gassparen wirklich alle Hebel in Bewegung setzen. Jede Maßnahme, die den Gasspar-Bemühungen zuwiderläuft, schadet. Die Härten lassen sich durchaus abfedern, ohne die Preise zu beeinflussen.”
Fraglich ist bloß, wie lange die Volkswirtschaften die hohen Energiepreise durchhalten. Von einer Rückkehr zu alten Verhältnissen schon in 24 Monaten wie Staatssekretär Graichen gehen die Marktteilnehmer derzeit jedenfalls nicht aus. Strom für das Kalenderjahr 2026 wurde am Dienstag für über 200 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Das ist zwar weit niedriger als der Preis für 2023, der zuletzt über 600 Euro notierte. Doch von den lange Zeit gewohnten Preisen deutlich unter 100 Euro sind auch diese Erwartungen noch weit entfernt. Mit dpa, rtr
Es ist eine weitere schlechte Nachricht für die europäischen Verbraucher: Norwegen, ein großer Stromexporteur, hat angekündigt, seine Lieferungen in die EU in den nächsten Monaten möglicherweise einzustellen. Der Grund: Die ungewöhnlich leeren Wasserreservoirs, aus denen die 1700 Wasserkraftwerke des Landes gespeist werden. Sie liefern mehr 90 Prozent des erzeugten Stroms.
Laut der norwegischen Behörde für Wasserressourcen und Energie (NVE) waren die Stauseen oberhalb der Staudämme zuletzt zu 68,4 Prozent gefüllt, rund zehn Prozentpunkte weniger als üblich. Im Südwesten des Landes sind die Reservoirs sogar nur zu gut 50 Prozent gefüllt. Aus eben dieser Region liefert das Land aber einen Großteil des Stroms an seine Nachbarn. Norwegen könnte deshalb im Winter eine Notlage erklären – und auf dieser Grundlage seine Exporte über längere Zeit einstellen.
Ursache für die Wasserknappheit sind die außergewöhnlich niedrigen Niederschlagsmengen der vergangenen beiden Jahre. Die Dürre, die derzeit weite Teile Europas beherrscht (Europe.Table berichtete), schlägt so direkt auf den europäischen Energiemarkt durch. Neben der Gaskrise droht dem Kontinent nun auch noch eine Explosion der Strompreise (siehe voriger Artikel in dieser Ausgabe).
Der Fall Norwegen zeigt, wie etliche andere, wie anfällig die Stromversorgung für die Folgen des Klimawandels ist. “Die klimatischen Bedingungen wirken sich auf die Erzeugung aus”, sagt Thibault Laconde, Ingenieur und Leiter von Callendar, einem auf Klimarisiken spezialisierten Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Paris. Hitze und Niederschlagsmangel beeinflussen die Stromproduktion durch Wasserkraft und Kernenergie, aber ebenso die Kohleverstromung, weil der Brennstoff auf dem Wasserweg transportiert wird.
Die extrem hohen Temperaturen beeinträchtigen sogar die Solarenergie: “Bei Photovoltaikanlagen wurde aufgrund der Hitzewellen ein Rückgang des Wirkungsgrades und der Produktion beobachtet”, sagt Gregorio Fernández, Projektleiter am spanischen Forschungszentrum CIRCE.
Die klimatischen Bedingungen beeinträchtigen die Stromerzeugung in etlichen europäischen Ländern. In Italien seien die Auswirkungen der Dürre gravierend, vor allem weil das Land stark von der Wasserkraft abhängig sei, sagt Michele Governatori, Leiter des Programms für Strom und Gas beim italienischen Think-Tank Ecco. Diese mache rund ein Drittel der insgesamt an erneuerbaren Energien installierten Leistung von 65 GW aus.
In Frankreich macht die Wasserkraft zwar nur zehn bis 15 Prozent des Energiemixes des Landes aus. Aber “sie hat eine wichtigere Rolle, als dieser Prozentsatz vielleicht vermuten lässt, nämlich als Speicher“, sagt Thibault Laconde. Die Wasserkraft könne unvorhergesehene Ereignisse in der Energieversorgung relativ schnell ausgleichen. Außerdem ermögliche sie die Regulierung des Wasserstandes in Flüssen, was zum Beispiel für Kernkraftwerke nützlich sein könne.
Paris hat bereits die Temperaturschwelle ausgesetzt, oberhalb derer die Kraftwerke das Flusswasser, das sie zur Kühlung ihrer Reaktoren verwenden, nicht mehr ableiten dürfen. Das erwärmte Wasser hat negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Diese Notmaßnahme wurde ergriffen, um die Stromproduktion zu entlasten. Wegen der Abschaltung von mehr als der Hälfte der Kernkraftwerke wegen Wartungsarbeiten steht diese bereits enorm unter Stress (Europe.Table berichtete). Die Atomkraft steht für 70 Prozent des Energiemixes in Frankreich.
Durch die Maßnahme habe die Regierung den Rückgang der Stromerzeugung deutlich abgemildert, sagt Thibault Laconde. Es handele sich jedoch um eine vorübergehende Lösung. “Der September ist normalerweise die Zeit, in der die Wassermenge am geringsten ist. Diese Periode kann bis in den November hineinreichen, was auf mögliche Einschränkungen der Kernkraftwerke hindeutet”, so der Ingenieur.
Laconde betont außerdem die “sehr hohe Temperatursensibilität” Frankreichs aufgrund des hohen Anteils an Elektroheizungen im Land. Die Sensibilität bezieht sich auf die Veränderung des Stromverbrauchs, die durch einen Temperaturrückgang hervorgerufen wird. “In Frankreich haben wir einen Anstieg (des Verbrauchs) von 1900 MW pro Grad, was der Aktivierung von zwei zusätzlichen Atomreaktoren entspricht”, erklärt er.
Dieses Szenario geht jedoch von einem funktionierenden Kernkraftwerkspark aus, was in Frankreich derzeit nicht der Fall ist. Daher ist Frankreich in diesem Sommer von einem Stromexporteur zu einem Stromimporteur geworden. “Dass wir den Sommer überstehen konnten, haben wir unseren Nachbarn zu verdanken. Es ist nicht sicher, dass dieses Szenario so weitergehen wird”, sagt Laconde.
Dabei weist er auf die Verflechtung der nationalen Energiemärkte untereinander hin und die Gefahr eines Dominoeffekts: “Man muss beachten, dass in Spanien der Gaspreis gesetzlich begrenzt wurde, also kauft Frankreich seltsamerweise billigere Energie in Spanien und importiert sie.” Daher sei die Exportkapazität von Spanien nach Frankreich im Juli 2022 ausgeschöpft worden, was etwa im Februar 2022 nicht der Fall gewesen sei, sagt Gregorio Fernández.
Dieser Dominoeffekt erhöht das Risiko einer Stromknappheit für die europäischen Verbraucher. Diese kann nicht einmal durch einen drastischen Preisanstieg ausgeglichen werden.
So hat Fingrid Oyj, der Betreiber des finnischen Übertragungsnetzes, gerade erst eine Mitteilung veröffentlicht, in der er die Finnen auffordert, sich auf mögliche Stromengpässe im nächsten Winter einzustellen. “Der Krieg in Europa und die außergewöhnliche Situation auf dem Energiemarkt haben die Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit von Strom erhöht”, hieß es in der Erklärung.
Beim Europäischen Netzwerk der Übertragungsnetzbetreiber, Entso-E, ist man nicht viel optimistischer. “Der Stand der Wasserkraftspeicher am Ende des Sommers wird sich auf die Bewertung der Winterprognose auswirken”, stellt die Organisation in ihrem Summer Outlook Report 2022 nüchtern fest. “Die Prognosen für die hydrologischen Bedingungen sind nicht optimistisch, was die Eignungssituation für den Winter 2022-2023 in dieser Region [Südeuropa] beeinflussen könnte. Daher die Notwendigkeit einer genauen Beobachtung in den kommenden Wochen und Monaten.”
Michele Governatori vom italienischen Think-Tank Ecco schließt ebenfalls nicht aus, dass es im nächsten Winter zu einer Energieknappheit kommen könnte, da die Mittel für die staatlichen Stützungsmaßnahmen bald aufgebraucht sein könnten. “Die Regierung hat sich lange Zeit auf neue Gasquellen und -infrastrukturen verlassen, anstatt Energiesparmaßnahmen zu aktivieren.”
Dänemark richtet in der kommenden Woche ein Gipfeltreffen zum Ausbau der Windenergie in der Ostsee aus. Zu dem Treffen auf der Insel Bornholm am kommenden Dienstag werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Staats- oder Regierungschefs aus Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland erwartet, teilte das Büro der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch mit. Außerdem sollen Energieminister sowie Vertreter der Netzbetreiber und Energieversorger aus Ostsee-Anrainerstaaten teilnehmen. Wer aus Deutschland anreist, ging aus der Mitteilung nicht hervor.
Bei dem Treffen wollen die Ostsee-Länder demnach beraten, wie sie unter anderem durch den Ausbau erneuerbarer Energien für mehr Energiesicherheit in Europa sorgen und zum Erreichen der EU-Klimaziele beitragen können. Das Treffen solle die Unabhängigkeit von russischem Gas fördern und den grünen Wandel beschleunigen, erklärte Frederiksen laut Mitteilung: “Wir müssen in der Ostseeregion Schulter an Schulter stehen und mit Blick auf unsere Energieversorgung viel enger zusammenarbeiten.”
Im Mai hatte Dänemark bereits einen Gipfel zur Windenergie in der Nordsee ausgerichtet, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz angereist war. Dort hatten sich Scholz und seine Amtskollegen aus Dänemark, Belgien und den Niederlanden darauf geeinigt, den Ausbau der Offshore-Windenergie anzukurbeln und dabei enger zusammenzuarbeiten. dpa
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht noch einen langen Weg beim Energiesparen angesichts der starken Drosselung russischer Gaslieferungen. Habeck sagte am Mittwoch in Berlin mit Blick auf zwei vom Kabinett gebilligte Energieeinsparverordnungen, damit werde der Gasverbrauch ungefähr im Umfang von zwei bis zweieinhalb Prozent gesenkt. Man könne sich aber nun nicht zurücklehnen. “Wir haben noch einen langen Weg vor uns.” Habeck nannte die Situation in Deutschland erneut angespannt.
Um Energie zu sparen, sollen öffentliche Gebäude ab September in der Regel nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Das sieht eine der Verordnungen vor. Bisher lag die empfohlene Mindesttemperatur für Büros bei 20 Grad. Weiter ist nun vorgeschrieben, dass spätestens zum Beginn der Heizsaison Gasversorger und Besitzer größerer Wohngebäude Kunden beziehungsweise Mieter über den zu erwartenden Energieverbrauch und damit verbundene Kosten und Einsparmöglichkeiten informieren müssen. dpa
Die Ukraine soll nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz Mitglied der Europäischen Union werden. “Die Ukraine hat einen festen Platz in Europa und zwar als Mitglied in der EU”, betonte Scholz in einer Video-Botschaft zum Unabhängigkeitstag des Landes. Er erinnerte an einen Beschluss des EU-Gipfels im Juni, der die Tür für ein Aufnahmeverfahren öffnete.
Scholz versicherte wie andere westliche Spitzenpolitiker, man werde die Ukraine so lange unterstützen in ihrem Kampf gegen die Invasion Russlands, wie dies nötig sei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach zudem Unterstützung beim Wiederaufbau: “Gemeinsam werden wir die Städte Stein für Stein wieder aufbauen und die Gärten und Felder Samen für Samen neu anlegen”, sagte sie.
US-Präsident Joe Biden sagte der Ukraine weitere Militärhilfe im Volumen von rund drei Milliarden Dollar zu. Dabei handelt es sich der Washingtoner Regierung zufolge um das bislang größte derartige Hilfspaket der USA seit Beginn der russischen Invasion vor sechs Monaten. “Die Vereinigten Staaten von Amerika sind entschlossen, das ukrainische Volk bei seiner anhaltenden Verteidigung der Souveränität zu unterstützen”, sagte Biden.
Auch die Bundesregierung hat ein neues Paket an Waffenlieferungen geschnürt. Es hat einen Wert von mehr als 500 Millionen Euro beinhaltet unter anderem Luftabwehrsysteme, Bergepanzer und Raketenwerfer. rtr/dpa
Die Kommission hat einen Antrag auf eine Bürgerinitiative gegen Nikotin, Zigaretten und den Gebrauch von Tabakprodukten zugelassen. Die Initiatoren wollen erreichen, dass die Kommission Rechtsvorschriften erlässt, mit denen die jüngere Generation vom Rauchen abgehalten und die Umwelt besser vor den Folgen des Tabakkonsums geschützt wird.
Die Bürgerinitiative, die in Spanien gestartet wurde, trägt den Titel: “Aufruf zur Schaffung einer tabakfreien Umwelt und der ersten tabakfreien Generation in Europa bis 2030”. Mit der formalen Zulassung der Bürgerinitiative durch die Kommission haben die Organisatoren nun sechs Monate Zeit, mit dem Sammeln von Unterschriften zu beginnen. Wenn die Initiative innerhalb von zwölf Monaten eine Million Unterschriften von Bürgern zusammenbekommt, die aus mindestens sieben Mitgliedstaaten kommen, muss die Kommission reagieren. Sie kann rechtliche Maßnahmen vorschlagen. Wenn sie es nicht tut, muss sie die Ablehnung begründen.
Die Initiatoren verlangen von der EU-Kommission rechtliche Schritte, um den Verkauf von Tabak und Nikotinprodukten an alle EU-Bürger zu unterbinden, die 2010 oder später geboren wurden. Außerdem soll die Kommission dafür sorgen, dass Flussufer und Strände frei von weggeworfenen Zigarettenkippen sind. Auch in Nationalparks sollen es keine Stummel mehr geben. Qualm- und dampffreie Räume in der Öffentlichkeit sollen ausgeweitet werden. Zigaretten und Rauchprodukte sollen auch aus audiovisuellen Produkten und aus den Sozialen Medien verschwinden.
Das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative wurde durch den Lissaboner Vertrag geschaffen, um die Bürgerbeteiligung zu erhöhen. Seit 2012 sind bei der Kommission 118 Anträge eingegangen, 91 wurden zugelassen. Die erste Bürgerinitiative, die die Kriterien erfüllt hat, war “Wasser ist ein Menschenrecht”, die 2013 mehr als 1,6 Millionen Unterschriften gesammelt hat. mgr
Google soll gegen ein Gerichtsurteil der Europäischen Union verstoßen haben, indem es unerwünschte Werbe-E-Mails direkt an den Posteingang von Gmail-Nutzern verschickt. Das wirft die europäische Interessengruppe Noyb dem amerikanischen Internetkonzern vor und hat am Mittwoch eine entsprechende Beschwerde bei der französischen Datenschutzbehörde Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) eingereicht.
Noyb (Non Of Your Business), gegründet vom Datenschutz-Aktivisten Max Schrems, ist der Meinung, dass Google seine Gmail-Nutzer vorher um ihre Zustimmung bitten muss, bevor es ihnen Direktmarketing-E-Mails schicken darf. Dabei beruft sich Noyb auf eine Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2021.
Online-Werbung ist die Haupteinnahmequelle von Google. Die Werbe-E-Mails sähen zwar wie normale E-Mails aus, enthielten aber das Wort “Ad” in grüner Schrift auf der linken Seite unterhalb des Betreffs der E-Mail, schreibt Noyb in seiner Beschwerde. Außerdem enthielten sie kein Datum.
“Es ist so, als ob der Postbote dafür bezahlt wurde, die Werbung aus Ihrem Postfach zu entfernen und stattdessen seine eigene Werbung zu platzieren”, sagte Romain Robert, Programmdirektor bei Noyb, und verwies dabei auf die Anti-Spam-Filter von Google Mail, die die meisten unerwünschten E-Mails in einen separaten Ordner verschieben. Google reagierte nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar. Ein Sprecher der CNIL bestätigte, dass die Behörde die Beschwerde erhalten habe und diese registriert werde.
Noyb, ansässig in Wien, wählte die CNIL neben anderen nationalen Datenschutzbehörden aus, weil sie dafür bekannt ist, eine der lautstärksten Aufsichtsbehörden innerhalb der EU zu sein, sagte Robert. Eine Entscheidung der CNIL würde zwar nur in Frankreich gelten, könnte Google aber dazu zwingen, seine Praktiken zu überdenken. Die CNIL verhängte Anfang des Jahres eine Rekordstrafe von 150 Millionen Euro gegen Google, weil es Internetnutzern schwer gemacht wurde, Online-Tracker abzulehnen. rtr
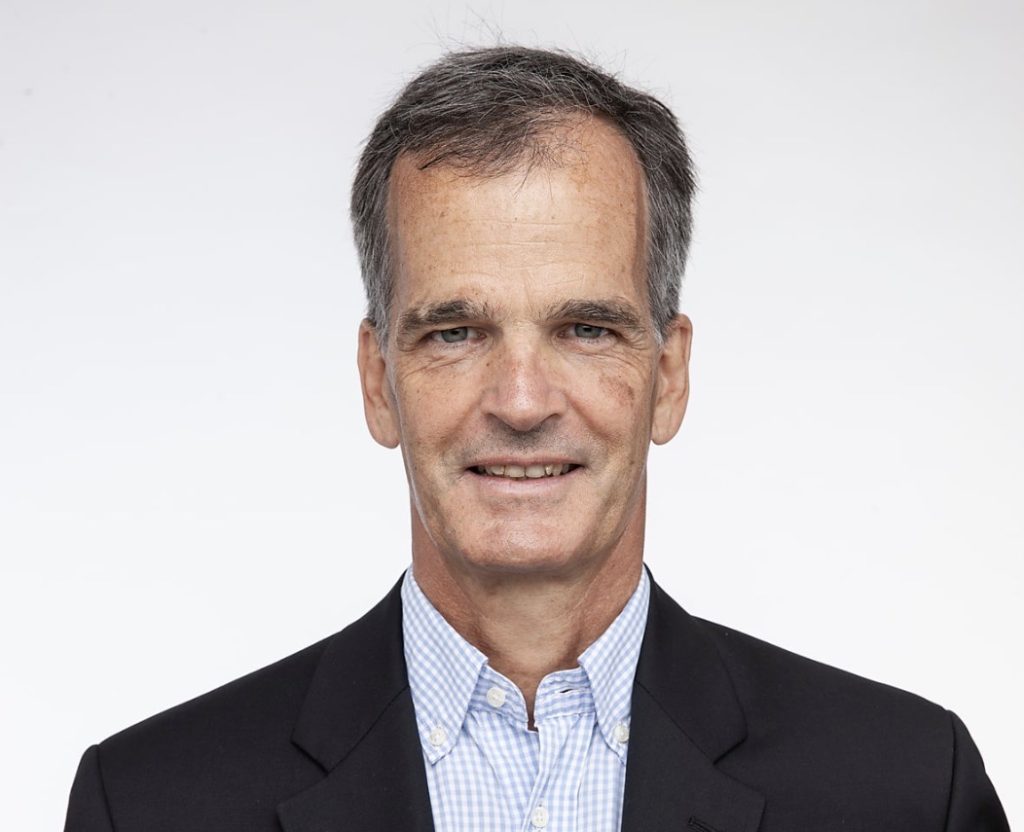
Die Kostenschätzungen für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg schwanken stark. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal nannte vor kurzem einen voraussichtlichen Betrag von 750 Milliarden Dollar, während der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer der Ansicht ist, dass das Land 1,1 Billionen Dollar benötigen könnte. Und mit jedem weiteren Kriegstag steigt dieser Betrag.
Die Ukraine wird ihre Kraftwerke, Stromnetze sowie wichtige Wasser-, Abwasser- und Verkehrsinfrastruktur wieder aufbauen müssen. Die Industrie wird Investitionen benötigen, und viele Häuser werden noch vor Einbruch des Winters wieder aufgebaut und repariert werden müssen. Viele Städte und Dörfer wurden vollständig zerstört.
Doch wird die Ukraine ein derart enormes Investitionsprogramm nicht allein finanzieren können, und auf Reparationen aus Russland sollte sie nicht zählen. Das Geld muss daher von multilateralen Entwicklungseinrichtungen wie der Weltbank, der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung kommen. Auch die westlichen Regierungen werden einen Beitrag leisten müssen, und die Europäische Union ebenso.
Das größte Problem ist, dass die Ukraine das Geld unmittelbar nach Kriegsende brauchen wird. Weil das Land selbst nicht über ausreichende Rücklagen verfügt, wird es Kredite aufnehmen müssen. Doch wird seine staatliche Kreditwürdigkeit nach dem Krieg auf einem Tiefstpunkt stehen, auch wenn Fitch Ratings das Länderrating der Ukraine vor kurzem von RD (eingeschränkter Kreditausfall) auf CC angehoben hat.
Darüber hinaus werden die westlichen Regierungen nicht in der Lage sein, der Ukraine über Nacht so einfach eine erste Rate von 100 Milliarden Dollar zu überweisen. Ihre Finanzen leiden noch immer unter den Haushaltsmaßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der plötzlichen Erkenntnis, dass sie mehr für die Verteidigung ausgeben müssen. Allein Deutschland beabsichtigt, zusätzliche 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren.
Doch können innovative Finanzierungsmechanismen dazu beitragen, zumindest einen Teil der enormen Finanzlücke der Ukraine zu schließen. Die politischen Entscheidungsträger sollten dabei insbesondere zwei jüngste Präzedenzfälle in Betracht ziehen.
Eine vielversprechende Option besteht in der Einrichtung einer Internationalen Finanzfazilität für den Wiederaufbau der Ukraine (IFFRU). Diese würde sich am Vorbild der Internationalen Finanzfazilität für Impfprogramme (IFFIm) orientieren, die 2006 von einer Reihe von Geberländern unter Führung Großbritanniens eingerichtet wurde, um die Impfung von Kindern in den weltärmsten Ländern vorzufinanzieren.
Die IFFIm erhielt von Regierungen mit hoher Bonität rechtlich bindende mehrjährige Zusagen im Gesamtvolumen von über sechs Milliarden Dollar, was sie in die Lage versetzte, ein AAA-Rating zu erlangen und Geld an den internationalen Anleihemärkten aufzunehmen. Die aufgenommenen Kreditmittel – die erste Anleiheemission der IFFIm belief sich auf eine Milliarde Dollar – wurden an die Impfallianz Gavi überwiesen, um sofortige umfangreiche Impfungen zu finanzieren.
Die steuerbefreite IFFRU hätte ihren Sitz außerhalb der Ukraine und würde im Einklang mit bewährten Betriebs- und Steuerungsstandards geführt. Und statt enorme Summen aus ihren aktuellen Haushalten umzulenken, würden viele westliche Regierungen in der Lage sein, rechtlich bindende Zusagen über 20 Jahre abzugeben. Bei korrekter Strukturierung würden die Beträge nur in den Jahren ihrer jeweiligen Fälligkeit in den Haushalten der betreffenden Regierungen erscheinen.
Je nach Bonität der Geberländer und den Finanzrichtlinien der IFFRU könnte diese so ein Rating von AA oder besser erhalten. Dies würde sie in die Lage versetzen, die internationalen Anleihemärkte anzuzapfen, die Maßnahmen in der Ukraine vorzufinanzieren und nach Bedarf Geld auszuschütten, wann immer das Land dieses benötigt. Auf diese Weise könnten die Infrastruktur und dringend benötigter Wohnraum für die vertriebene Bevölkerung der Ukraine rasch wieder aufgebaut werden.
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass die Ukraine Brady-Bonds begibt. Sie würde damit dem Beispiel einiger Schwellenmärkte – darunter mehrerer lateinamerikanischer Länder, Bulgariens, Marokkos, Nigerias, Polens und der Philippinen – nach deren Kreditausfällen gegenüber den Banken vor drei Jahrzehnten folgen. Um die Krise beizulegen, akzeptierten die Banken damals einen Schuldenschnitt, und die Restschulden wurden dann in handelbare Staatsanleihen umgewandelt, wobei die Tilgungszahlungen besichert und durch speziell ausgegebene Staatspapiere unterlegt wurden.
Im Falle der in Dollar denominierten Brady-Bonds gab das US-Finanzministerium als Sicherheiten spezielle Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren aus, was die Brady-Bonds für die Anleger attraktiv machte.
Die Ukraine, deren CC-Rating sie daran hindern wird, die internationalen Schuldenmärkte allein anzuzapfen, könnte eine ähnliche Struktur nutzen, um ihr Anleiheemissionsprogramm anzustoßen. Die Regierung wäre verantwortlich für die Zinszahlungen auf ihre Brady-Bonds – wobei die notwendigen Devisen von den Steuerzahlern des Landes kämen -, und die Tilgungszahlungen würden mit Sicherheiten unterlegt oder über Nullkupon-Anleihen garantiert, die von Regierungen mit hoher Bonität, der EU oder anderen Organisationen ausgegeben würden. Die Ukraine müsste diese Nullkupon-Anleihen kaufen. Oder Regierungen, die den Wiederaufbau des Landes unterstützen möchten, könnten sie spenden.
Steigende Zinssätze und klamme Staatshaushalte haben zur Folge, dass die für den Wiederaufbau benötigten hohen Summen nicht in einem Rutsch aufgebracht werden können. Doch können kreative Finanzierungsmechanismen helfen, die Belastung zu verringern und den Wiederaufbau des Landes zu beschleunigen.
Aus dem Englischen von Jan Doolan. In Kooperation mit Project Syndicate.
nicht nur in der Ukraine, in ganz Europa werden sich viele Menschen an den Moment erinnern, an dem sie erfuhren, dass russische Panzer Richtung Kiew rollen und russische Raketen in zahlreichen Städten der Ukraine einschlagen. Ein halbes Jahr ist der 24. Februar 2022 nun her. Im Schatten des russischen Angriffskrieges beging die Ukraine gestern ihren Nationalfeiertag. Vor 31 Jahren, am 24. August 1991, hatte die damalige Sowjetrepublik ihre Unabhängigkeit erklärt. Auch in Brüssel erinnerte man daran. Auf dem Grand-Place wurde eine 30 Meter lange Flagge des Landes entrollt, unter andere im Beisein von Ursula von der Leyen. Europa stehe heute und langfristig an der Seite der Ukraine, hatte die EU-Kommissionspräsidentin am Morgen in einer Videobotschaft gesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte die Zugehörigkeit der Ukraine zur EU, US-Präsident Joe Biden sagte weitere Militärhilfen zu. Mehr lesen Sie in den News.
Das gemeinsame Ziel der Mitgliedstaaten zum Gassparen hat die Energiemärkte nur kurz beruhigt, zuletzt sind Strom- und Gaspreis wieder deutlich angestiegen. Nun kommt von der tschechischen Ratspräsidentschaft ein Vorschlag, mit dem sich das Problem der hohen Preise gesamteuropäisch angehen lasse – in Form eines Höchstpreises für Energie. Das spanische Modell eines Energie-Preisdeckels werde zurzeit in der EU diskutiert, sagte gestern Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Expertinnen und Experten halten von dieser Idee jedoch nichts, wie Manuel Berkel erfahren hat.
Es ist nicht nur der Mangel an russischem Gas, der die Energiemärkte in Aufruhr versetzt. Die Dürre und die extreme Hitze beeinträchtigen die Stromerzeugung in zahlreichen europäischen Ländern. So hat der Stromexporteur Norwegen angekündigt, seine Lieferungen in die EU in den nächsten Monaten möglicherweise einzustellen. Denn die Wasserreservoirs des nordischen Landes sind ungewöhnlich leer. Beunruhigende Nachrichten kommen auch aus Frankreich und Italien. Nun zeige sich, wie anfällig die Stromversorgung für die Folgen des Klimawandels sei, schreibt Claire Stam. Aufgrund der engen Verflechtung der europäischen Energiemärkte drohe ein Domino-Effekt.

Gazprom hat es wieder einmal geschafft, für Alarmstimmung in den europäischen Hauptstädten zu sorgen. Seit der jüngsten Ankündigung einer angeblichen Turbinenwartung ist der Gaspreis für Dezember um über 14 Prozent gestiegen, der Strompreis fürs kommende Jahr um fast 19 Prozent. Die tschechische Ratspräsidentschaft erwägt nun einen außerordentlichen Energierat. Das meldete gestern die Nachrichtenagentur ČTK nach einem Pressegespräch des Ministers für Industrie und Handel, Jozef Síkela. Der war erst Ende Juli für seinen Verhandlungserfolg gefeiert worden, als sich die EU-Energieminister auf ein gemeinsames Gassparziel einigten.
Die Märkte hatte die Einigkeit nur kurz beruhigt. Die hohen Energiepreise seien ein gesamteuropäisches Problem, für das eine gesamteuropäische Lösung gefunden werden sollte, wird Síkela nun zitiert. Aufhorchen lässt ein Vorschlag des ehemaligen Bankiers: Eine der möglichen Lösungen sei die Festlegung eines Höchstpreises für Energie. Tschechien sei sicherlich eins der Länder, die diesen Weg unterstützen würden, sagte Síkela. Der nächste Energierat war bisher erst für den 25. Oktober angesetzt.
Auf vergangenen EU-Gipfeln waren unionsweite Preisobergrenzen noch stets abgewehrt worden. Die Kommission hatte zwar selbst nationale Preisobergrenzen als eine mögliche Antwort ins Spiel gebracht, billigte aber nur fallweise Beihilfen einzelner Staaten und verabschiedete sich für grundsätzliche Lösungen in einen fortwährenden Prüfprozess.
Die ersten nationalen Maßnahmen laufen demnächst schon wieder aus, in Frankreich werden es im Winter die staatlichen Höchstpreise für Strom und Gas sein. Die milliardenschweren Zuschüsse werde die Regierung nicht aufrechterhalten können, erklärte gestern ein Sprecher. Präsident Emmanuel Macron schwor seine Landsleute angesichts des Ukraine-Krieges und des Klimawandels auf ein “Ende des Überflusses, der Sorglosigkeit und der Gewissheiten” ein. Im September will Premierministerin Élisabeth Borne ein Konzept zum Energiesparen und zur künftigen Energieversorgung vorlegen.
Seitdem auch die Strompreise an vielen Börsen schwindelerregende Höhen erreicht haben, schielt man in einigen Hauptstädten offenbar zunehmend auf die Sonderregeln für Spanien und Portugal. Im Juni hatte die Kommission Beihilfen in Höhe von 8,4 Milliarden Euro genehmigt. Bis Ende Mai nächsten Jahres gelten für den Brennstoff von Gaskraftwerken Höchstpreise, die Differenz zum Marktwert dürfen die Regierungen als Zuschüsse zahlen – wobei die Verbraucher einen Großteil der Subvention über eine Umlage selbst finanzieren.
Die Kommission hatte Spanien und Portugal aber stets als Sonderfall dargestellt, weil die Strom- und Gasverbindungen über die Pyrenäen nur schwach ausgebaut sind. Sollte heißen: Die Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt seien begrenzt. Nun wachsen andernorts die Begehrlichkeiten.
Derzeit werde in der EU diskutiert, ob das spanische Modell auf ganz Europa ausgerollt werden könne und solle, sagte gestern der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, bei einer öffentlichen Diskussion. Es gehe darum, Lösungen für die Hochpreisphase der nächsten 18 bis 24 Monate zu finden, so der Spitzenbeamte weiter. Das lässt sich als Hinweis deuten, dass Berlin auf absehbare Zeit am Strommarktmodell festhalten will, das zuletzt heftigst in der Kritik stand, weil teure Gaskraftwerke den Preis für die gesamte Stromerzeugung setzen.
Allerdings schließt das Wirtschaftsministerium einen EU-weiten Strompreisdeckel nicht aus. Man gucke sich alle Vorschläge sehr genau an, sagte Graichen.
Ökonomen aber halten einen Preisdeckel wie in Spanien weiterhin für das falsche Signal. “Der Eingriff hat eine Reihe von Nebenwirkungen, zum Beispiel wird ein Teil des subventionierten Stroms exportiert“, sagt Lion Hirth von der Hertie School. Damit das Instrument halbwegs funktioniert, müssten laut dem Strommarktexperten zumindest drei Voraussetzungen erfüllt sein.
Es dürfe nur geringe Leitungskapazitäten in Nachbarstaaten geben, der zusätzliche Gasbedarf für die Verstromung müssen über Importe auch tatsächlich beschafft werden können und der Stromhandel müsse im Wesentlichen auf dem kurzfristigen Spotmarkt stattfinden. “Alle drei Bedingungen sind in Spanien einigermaßen erfüllt – in Deutschland keine einzige. Eine Anwendung des spanischen Instruments in Deutschland oder auch in der ganzen EU halte ich deshalb für extrem problematisch“, sagt Hirth.
Kritik kommt auch von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm von der Universität Erlangen-Nürnberg. “Eine Senkung der Brennstoffkosten durch Zuschüsse ist in der aktuellen Situation nicht zielführend. Dies heizt unnötig den Verbrauch der teuren fossilen Energieträger an und läuft damit der Notwendigkeit des Gassparens zuwider”, sagte Grimm gestern zu Europe.Table. “Besser wäre es, den Kunden durch Einmalzahlungen die Preisdifferenz für einen Grundverbrauch zu erstatten, die hohen Preise aber wirken zu lassen.”
Nach Ansicht der Sachverständigen ist der Ernst der Lage noch immer nicht angekommen: “Wenn wir uns in die Lage versetzen wollen, einen russischen Gas-Lieferstopp ohne eine Gasmangellage zu meistern, dann müssen wir beim Gassparen wirklich alle Hebel in Bewegung setzen. Jede Maßnahme, die den Gasspar-Bemühungen zuwiderläuft, schadet. Die Härten lassen sich durchaus abfedern, ohne die Preise zu beeinflussen.”
Fraglich ist bloß, wie lange die Volkswirtschaften die hohen Energiepreise durchhalten. Von einer Rückkehr zu alten Verhältnissen schon in 24 Monaten wie Staatssekretär Graichen gehen die Marktteilnehmer derzeit jedenfalls nicht aus. Strom für das Kalenderjahr 2026 wurde am Dienstag für über 200 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Das ist zwar weit niedriger als der Preis für 2023, der zuletzt über 600 Euro notierte. Doch von den lange Zeit gewohnten Preisen deutlich unter 100 Euro sind auch diese Erwartungen noch weit entfernt. Mit dpa, rtr
Es ist eine weitere schlechte Nachricht für die europäischen Verbraucher: Norwegen, ein großer Stromexporteur, hat angekündigt, seine Lieferungen in die EU in den nächsten Monaten möglicherweise einzustellen. Der Grund: Die ungewöhnlich leeren Wasserreservoirs, aus denen die 1700 Wasserkraftwerke des Landes gespeist werden. Sie liefern mehr 90 Prozent des erzeugten Stroms.
Laut der norwegischen Behörde für Wasserressourcen und Energie (NVE) waren die Stauseen oberhalb der Staudämme zuletzt zu 68,4 Prozent gefüllt, rund zehn Prozentpunkte weniger als üblich. Im Südwesten des Landes sind die Reservoirs sogar nur zu gut 50 Prozent gefüllt. Aus eben dieser Region liefert das Land aber einen Großteil des Stroms an seine Nachbarn. Norwegen könnte deshalb im Winter eine Notlage erklären – und auf dieser Grundlage seine Exporte über längere Zeit einstellen.
Ursache für die Wasserknappheit sind die außergewöhnlich niedrigen Niederschlagsmengen der vergangenen beiden Jahre. Die Dürre, die derzeit weite Teile Europas beherrscht (Europe.Table berichtete), schlägt so direkt auf den europäischen Energiemarkt durch. Neben der Gaskrise droht dem Kontinent nun auch noch eine Explosion der Strompreise (siehe voriger Artikel in dieser Ausgabe).
Der Fall Norwegen zeigt, wie etliche andere, wie anfällig die Stromversorgung für die Folgen des Klimawandels ist. “Die klimatischen Bedingungen wirken sich auf die Erzeugung aus”, sagt Thibault Laconde, Ingenieur und Leiter von Callendar, einem auf Klimarisiken spezialisierten Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Paris. Hitze und Niederschlagsmangel beeinflussen die Stromproduktion durch Wasserkraft und Kernenergie, aber ebenso die Kohleverstromung, weil der Brennstoff auf dem Wasserweg transportiert wird.
Die extrem hohen Temperaturen beeinträchtigen sogar die Solarenergie: “Bei Photovoltaikanlagen wurde aufgrund der Hitzewellen ein Rückgang des Wirkungsgrades und der Produktion beobachtet”, sagt Gregorio Fernández, Projektleiter am spanischen Forschungszentrum CIRCE.
Die klimatischen Bedingungen beeinträchtigen die Stromerzeugung in etlichen europäischen Ländern. In Italien seien die Auswirkungen der Dürre gravierend, vor allem weil das Land stark von der Wasserkraft abhängig sei, sagt Michele Governatori, Leiter des Programms für Strom und Gas beim italienischen Think-Tank Ecco. Diese mache rund ein Drittel der insgesamt an erneuerbaren Energien installierten Leistung von 65 GW aus.
In Frankreich macht die Wasserkraft zwar nur zehn bis 15 Prozent des Energiemixes des Landes aus. Aber “sie hat eine wichtigere Rolle, als dieser Prozentsatz vielleicht vermuten lässt, nämlich als Speicher“, sagt Thibault Laconde. Die Wasserkraft könne unvorhergesehene Ereignisse in der Energieversorgung relativ schnell ausgleichen. Außerdem ermögliche sie die Regulierung des Wasserstandes in Flüssen, was zum Beispiel für Kernkraftwerke nützlich sein könne.
Paris hat bereits die Temperaturschwelle ausgesetzt, oberhalb derer die Kraftwerke das Flusswasser, das sie zur Kühlung ihrer Reaktoren verwenden, nicht mehr ableiten dürfen. Das erwärmte Wasser hat negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Diese Notmaßnahme wurde ergriffen, um die Stromproduktion zu entlasten. Wegen der Abschaltung von mehr als der Hälfte der Kernkraftwerke wegen Wartungsarbeiten steht diese bereits enorm unter Stress (Europe.Table berichtete). Die Atomkraft steht für 70 Prozent des Energiemixes in Frankreich.
Durch die Maßnahme habe die Regierung den Rückgang der Stromerzeugung deutlich abgemildert, sagt Thibault Laconde. Es handele sich jedoch um eine vorübergehende Lösung. “Der September ist normalerweise die Zeit, in der die Wassermenge am geringsten ist. Diese Periode kann bis in den November hineinreichen, was auf mögliche Einschränkungen der Kernkraftwerke hindeutet”, so der Ingenieur.
Laconde betont außerdem die “sehr hohe Temperatursensibilität” Frankreichs aufgrund des hohen Anteils an Elektroheizungen im Land. Die Sensibilität bezieht sich auf die Veränderung des Stromverbrauchs, die durch einen Temperaturrückgang hervorgerufen wird. “In Frankreich haben wir einen Anstieg (des Verbrauchs) von 1900 MW pro Grad, was der Aktivierung von zwei zusätzlichen Atomreaktoren entspricht”, erklärt er.
Dieses Szenario geht jedoch von einem funktionierenden Kernkraftwerkspark aus, was in Frankreich derzeit nicht der Fall ist. Daher ist Frankreich in diesem Sommer von einem Stromexporteur zu einem Stromimporteur geworden. “Dass wir den Sommer überstehen konnten, haben wir unseren Nachbarn zu verdanken. Es ist nicht sicher, dass dieses Szenario so weitergehen wird”, sagt Laconde.
Dabei weist er auf die Verflechtung der nationalen Energiemärkte untereinander hin und die Gefahr eines Dominoeffekts: “Man muss beachten, dass in Spanien der Gaspreis gesetzlich begrenzt wurde, also kauft Frankreich seltsamerweise billigere Energie in Spanien und importiert sie.” Daher sei die Exportkapazität von Spanien nach Frankreich im Juli 2022 ausgeschöpft worden, was etwa im Februar 2022 nicht der Fall gewesen sei, sagt Gregorio Fernández.
Dieser Dominoeffekt erhöht das Risiko einer Stromknappheit für die europäischen Verbraucher. Diese kann nicht einmal durch einen drastischen Preisanstieg ausgeglichen werden.
So hat Fingrid Oyj, der Betreiber des finnischen Übertragungsnetzes, gerade erst eine Mitteilung veröffentlicht, in der er die Finnen auffordert, sich auf mögliche Stromengpässe im nächsten Winter einzustellen. “Der Krieg in Europa und die außergewöhnliche Situation auf dem Energiemarkt haben die Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit von Strom erhöht”, hieß es in der Erklärung.
Beim Europäischen Netzwerk der Übertragungsnetzbetreiber, Entso-E, ist man nicht viel optimistischer. “Der Stand der Wasserkraftspeicher am Ende des Sommers wird sich auf die Bewertung der Winterprognose auswirken”, stellt die Organisation in ihrem Summer Outlook Report 2022 nüchtern fest. “Die Prognosen für die hydrologischen Bedingungen sind nicht optimistisch, was die Eignungssituation für den Winter 2022-2023 in dieser Region [Südeuropa] beeinflussen könnte. Daher die Notwendigkeit einer genauen Beobachtung in den kommenden Wochen und Monaten.”
Michele Governatori vom italienischen Think-Tank Ecco schließt ebenfalls nicht aus, dass es im nächsten Winter zu einer Energieknappheit kommen könnte, da die Mittel für die staatlichen Stützungsmaßnahmen bald aufgebraucht sein könnten. “Die Regierung hat sich lange Zeit auf neue Gasquellen und -infrastrukturen verlassen, anstatt Energiesparmaßnahmen zu aktivieren.”
Dänemark richtet in der kommenden Woche ein Gipfeltreffen zum Ausbau der Windenergie in der Ostsee aus. Zu dem Treffen auf der Insel Bornholm am kommenden Dienstag werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Staats- oder Regierungschefs aus Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland erwartet, teilte das Büro der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch mit. Außerdem sollen Energieminister sowie Vertreter der Netzbetreiber und Energieversorger aus Ostsee-Anrainerstaaten teilnehmen. Wer aus Deutschland anreist, ging aus der Mitteilung nicht hervor.
Bei dem Treffen wollen die Ostsee-Länder demnach beraten, wie sie unter anderem durch den Ausbau erneuerbarer Energien für mehr Energiesicherheit in Europa sorgen und zum Erreichen der EU-Klimaziele beitragen können. Das Treffen solle die Unabhängigkeit von russischem Gas fördern und den grünen Wandel beschleunigen, erklärte Frederiksen laut Mitteilung: “Wir müssen in der Ostseeregion Schulter an Schulter stehen und mit Blick auf unsere Energieversorgung viel enger zusammenarbeiten.”
Im Mai hatte Dänemark bereits einen Gipfel zur Windenergie in der Nordsee ausgerichtet, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz angereist war. Dort hatten sich Scholz und seine Amtskollegen aus Dänemark, Belgien und den Niederlanden darauf geeinigt, den Ausbau der Offshore-Windenergie anzukurbeln und dabei enger zusammenzuarbeiten. dpa
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht noch einen langen Weg beim Energiesparen angesichts der starken Drosselung russischer Gaslieferungen. Habeck sagte am Mittwoch in Berlin mit Blick auf zwei vom Kabinett gebilligte Energieeinsparverordnungen, damit werde der Gasverbrauch ungefähr im Umfang von zwei bis zweieinhalb Prozent gesenkt. Man könne sich aber nun nicht zurücklehnen. “Wir haben noch einen langen Weg vor uns.” Habeck nannte die Situation in Deutschland erneut angespannt.
Um Energie zu sparen, sollen öffentliche Gebäude ab September in der Regel nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Das sieht eine der Verordnungen vor. Bisher lag die empfohlene Mindesttemperatur für Büros bei 20 Grad. Weiter ist nun vorgeschrieben, dass spätestens zum Beginn der Heizsaison Gasversorger und Besitzer größerer Wohngebäude Kunden beziehungsweise Mieter über den zu erwartenden Energieverbrauch und damit verbundene Kosten und Einsparmöglichkeiten informieren müssen. dpa
Die Ukraine soll nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz Mitglied der Europäischen Union werden. “Die Ukraine hat einen festen Platz in Europa und zwar als Mitglied in der EU”, betonte Scholz in einer Video-Botschaft zum Unabhängigkeitstag des Landes. Er erinnerte an einen Beschluss des EU-Gipfels im Juni, der die Tür für ein Aufnahmeverfahren öffnete.
Scholz versicherte wie andere westliche Spitzenpolitiker, man werde die Ukraine so lange unterstützen in ihrem Kampf gegen die Invasion Russlands, wie dies nötig sei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach zudem Unterstützung beim Wiederaufbau: “Gemeinsam werden wir die Städte Stein für Stein wieder aufbauen und die Gärten und Felder Samen für Samen neu anlegen”, sagte sie.
US-Präsident Joe Biden sagte der Ukraine weitere Militärhilfe im Volumen von rund drei Milliarden Dollar zu. Dabei handelt es sich der Washingtoner Regierung zufolge um das bislang größte derartige Hilfspaket der USA seit Beginn der russischen Invasion vor sechs Monaten. “Die Vereinigten Staaten von Amerika sind entschlossen, das ukrainische Volk bei seiner anhaltenden Verteidigung der Souveränität zu unterstützen”, sagte Biden.
Auch die Bundesregierung hat ein neues Paket an Waffenlieferungen geschnürt. Es hat einen Wert von mehr als 500 Millionen Euro beinhaltet unter anderem Luftabwehrsysteme, Bergepanzer und Raketenwerfer. rtr/dpa
Die Kommission hat einen Antrag auf eine Bürgerinitiative gegen Nikotin, Zigaretten und den Gebrauch von Tabakprodukten zugelassen. Die Initiatoren wollen erreichen, dass die Kommission Rechtsvorschriften erlässt, mit denen die jüngere Generation vom Rauchen abgehalten und die Umwelt besser vor den Folgen des Tabakkonsums geschützt wird.
Die Bürgerinitiative, die in Spanien gestartet wurde, trägt den Titel: “Aufruf zur Schaffung einer tabakfreien Umwelt und der ersten tabakfreien Generation in Europa bis 2030”. Mit der formalen Zulassung der Bürgerinitiative durch die Kommission haben die Organisatoren nun sechs Monate Zeit, mit dem Sammeln von Unterschriften zu beginnen. Wenn die Initiative innerhalb von zwölf Monaten eine Million Unterschriften von Bürgern zusammenbekommt, die aus mindestens sieben Mitgliedstaaten kommen, muss die Kommission reagieren. Sie kann rechtliche Maßnahmen vorschlagen. Wenn sie es nicht tut, muss sie die Ablehnung begründen.
Die Initiatoren verlangen von der EU-Kommission rechtliche Schritte, um den Verkauf von Tabak und Nikotinprodukten an alle EU-Bürger zu unterbinden, die 2010 oder später geboren wurden. Außerdem soll die Kommission dafür sorgen, dass Flussufer und Strände frei von weggeworfenen Zigarettenkippen sind. Auch in Nationalparks sollen es keine Stummel mehr geben. Qualm- und dampffreie Räume in der Öffentlichkeit sollen ausgeweitet werden. Zigaretten und Rauchprodukte sollen auch aus audiovisuellen Produkten und aus den Sozialen Medien verschwinden.
Das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative wurde durch den Lissaboner Vertrag geschaffen, um die Bürgerbeteiligung zu erhöhen. Seit 2012 sind bei der Kommission 118 Anträge eingegangen, 91 wurden zugelassen. Die erste Bürgerinitiative, die die Kriterien erfüllt hat, war “Wasser ist ein Menschenrecht”, die 2013 mehr als 1,6 Millionen Unterschriften gesammelt hat. mgr
Google soll gegen ein Gerichtsurteil der Europäischen Union verstoßen haben, indem es unerwünschte Werbe-E-Mails direkt an den Posteingang von Gmail-Nutzern verschickt. Das wirft die europäische Interessengruppe Noyb dem amerikanischen Internetkonzern vor und hat am Mittwoch eine entsprechende Beschwerde bei der französischen Datenschutzbehörde Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) eingereicht.
Noyb (Non Of Your Business), gegründet vom Datenschutz-Aktivisten Max Schrems, ist der Meinung, dass Google seine Gmail-Nutzer vorher um ihre Zustimmung bitten muss, bevor es ihnen Direktmarketing-E-Mails schicken darf. Dabei beruft sich Noyb auf eine Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2021.
Online-Werbung ist die Haupteinnahmequelle von Google. Die Werbe-E-Mails sähen zwar wie normale E-Mails aus, enthielten aber das Wort “Ad” in grüner Schrift auf der linken Seite unterhalb des Betreffs der E-Mail, schreibt Noyb in seiner Beschwerde. Außerdem enthielten sie kein Datum.
“Es ist so, als ob der Postbote dafür bezahlt wurde, die Werbung aus Ihrem Postfach zu entfernen und stattdessen seine eigene Werbung zu platzieren”, sagte Romain Robert, Programmdirektor bei Noyb, und verwies dabei auf die Anti-Spam-Filter von Google Mail, die die meisten unerwünschten E-Mails in einen separaten Ordner verschieben. Google reagierte nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar. Ein Sprecher der CNIL bestätigte, dass die Behörde die Beschwerde erhalten habe und diese registriert werde.
Noyb, ansässig in Wien, wählte die CNIL neben anderen nationalen Datenschutzbehörden aus, weil sie dafür bekannt ist, eine der lautstärksten Aufsichtsbehörden innerhalb der EU zu sein, sagte Robert. Eine Entscheidung der CNIL würde zwar nur in Frankreich gelten, könnte Google aber dazu zwingen, seine Praktiken zu überdenken. Die CNIL verhängte Anfang des Jahres eine Rekordstrafe von 150 Millionen Euro gegen Google, weil es Internetnutzern schwer gemacht wurde, Online-Tracker abzulehnen. rtr
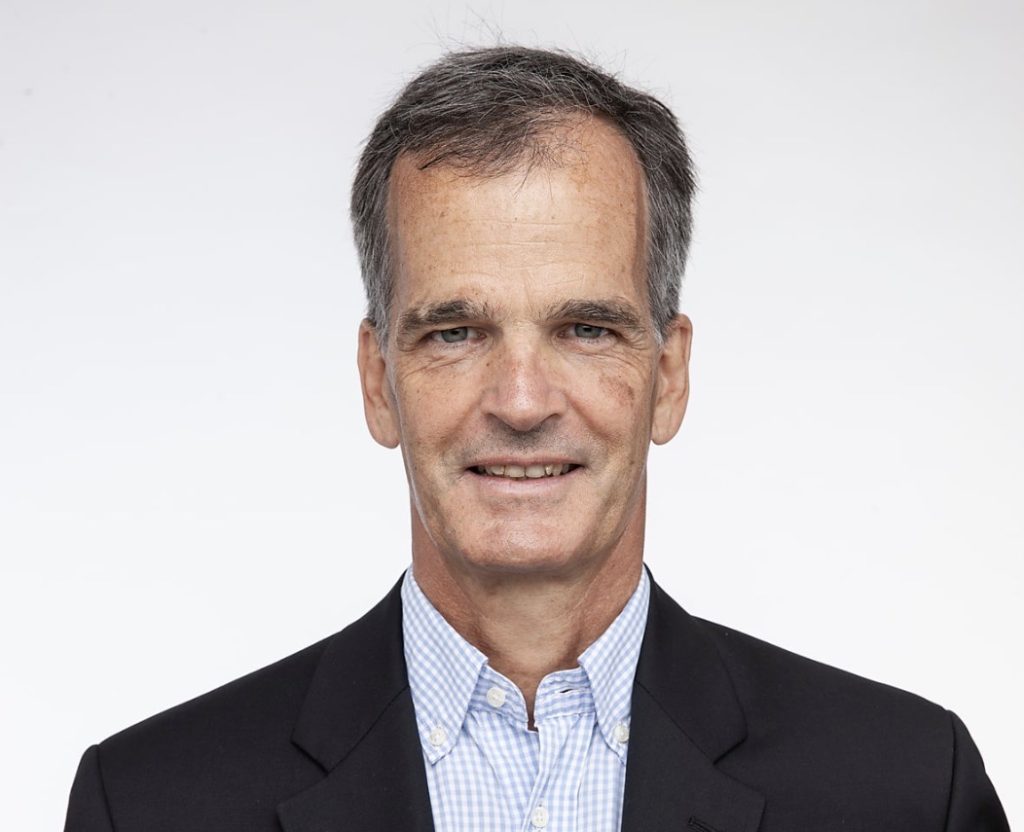
Die Kostenschätzungen für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg schwanken stark. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal nannte vor kurzem einen voraussichtlichen Betrag von 750 Milliarden Dollar, während der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer der Ansicht ist, dass das Land 1,1 Billionen Dollar benötigen könnte. Und mit jedem weiteren Kriegstag steigt dieser Betrag.
Die Ukraine wird ihre Kraftwerke, Stromnetze sowie wichtige Wasser-, Abwasser- und Verkehrsinfrastruktur wieder aufbauen müssen. Die Industrie wird Investitionen benötigen, und viele Häuser werden noch vor Einbruch des Winters wieder aufgebaut und repariert werden müssen. Viele Städte und Dörfer wurden vollständig zerstört.
Doch wird die Ukraine ein derart enormes Investitionsprogramm nicht allein finanzieren können, und auf Reparationen aus Russland sollte sie nicht zählen. Das Geld muss daher von multilateralen Entwicklungseinrichtungen wie der Weltbank, der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung kommen. Auch die westlichen Regierungen werden einen Beitrag leisten müssen, und die Europäische Union ebenso.
Das größte Problem ist, dass die Ukraine das Geld unmittelbar nach Kriegsende brauchen wird. Weil das Land selbst nicht über ausreichende Rücklagen verfügt, wird es Kredite aufnehmen müssen. Doch wird seine staatliche Kreditwürdigkeit nach dem Krieg auf einem Tiefstpunkt stehen, auch wenn Fitch Ratings das Länderrating der Ukraine vor kurzem von RD (eingeschränkter Kreditausfall) auf CC angehoben hat.
Darüber hinaus werden die westlichen Regierungen nicht in der Lage sein, der Ukraine über Nacht so einfach eine erste Rate von 100 Milliarden Dollar zu überweisen. Ihre Finanzen leiden noch immer unter den Haushaltsmaßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der plötzlichen Erkenntnis, dass sie mehr für die Verteidigung ausgeben müssen. Allein Deutschland beabsichtigt, zusätzliche 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren.
Doch können innovative Finanzierungsmechanismen dazu beitragen, zumindest einen Teil der enormen Finanzlücke der Ukraine zu schließen. Die politischen Entscheidungsträger sollten dabei insbesondere zwei jüngste Präzedenzfälle in Betracht ziehen.
Eine vielversprechende Option besteht in der Einrichtung einer Internationalen Finanzfazilität für den Wiederaufbau der Ukraine (IFFRU). Diese würde sich am Vorbild der Internationalen Finanzfazilität für Impfprogramme (IFFIm) orientieren, die 2006 von einer Reihe von Geberländern unter Führung Großbritanniens eingerichtet wurde, um die Impfung von Kindern in den weltärmsten Ländern vorzufinanzieren.
Die IFFIm erhielt von Regierungen mit hoher Bonität rechtlich bindende mehrjährige Zusagen im Gesamtvolumen von über sechs Milliarden Dollar, was sie in die Lage versetzte, ein AAA-Rating zu erlangen und Geld an den internationalen Anleihemärkten aufzunehmen. Die aufgenommenen Kreditmittel – die erste Anleiheemission der IFFIm belief sich auf eine Milliarde Dollar – wurden an die Impfallianz Gavi überwiesen, um sofortige umfangreiche Impfungen zu finanzieren.
Die steuerbefreite IFFRU hätte ihren Sitz außerhalb der Ukraine und würde im Einklang mit bewährten Betriebs- und Steuerungsstandards geführt. Und statt enorme Summen aus ihren aktuellen Haushalten umzulenken, würden viele westliche Regierungen in der Lage sein, rechtlich bindende Zusagen über 20 Jahre abzugeben. Bei korrekter Strukturierung würden die Beträge nur in den Jahren ihrer jeweiligen Fälligkeit in den Haushalten der betreffenden Regierungen erscheinen.
Je nach Bonität der Geberländer und den Finanzrichtlinien der IFFRU könnte diese so ein Rating von AA oder besser erhalten. Dies würde sie in die Lage versetzen, die internationalen Anleihemärkte anzuzapfen, die Maßnahmen in der Ukraine vorzufinanzieren und nach Bedarf Geld auszuschütten, wann immer das Land dieses benötigt. Auf diese Weise könnten die Infrastruktur und dringend benötigter Wohnraum für die vertriebene Bevölkerung der Ukraine rasch wieder aufgebaut werden.
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass die Ukraine Brady-Bonds begibt. Sie würde damit dem Beispiel einiger Schwellenmärkte – darunter mehrerer lateinamerikanischer Länder, Bulgariens, Marokkos, Nigerias, Polens und der Philippinen – nach deren Kreditausfällen gegenüber den Banken vor drei Jahrzehnten folgen. Um die Krise beizulegen, akzeptierten die Banken damals einen Schuldenschnitt, und die Restschulden wurden dann in handelbare Staatsanleihen umgewandelt, wobei die Tilgungszahlungen besichert und durch speziell ausgegebene Staatspapiere unterlegt wurden.
Im Falle der in Dollar denominierten Brady-Bonds gab das US-Finanzministerium als Sicherheiten spezielle Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren aus, was die Brady-Bonds für die Anleger attraktiv machte.
Die Ukraine, deren CC-Rating sie daran hindern wird, die internationalen Schuldenmärkte allein anzuzapfen, könnte eine ähnliche Struktur nutzen, um ihr Anleiheemissionsprogramm anzustoßen. Die Regierung wäre verantwortlich für die Zinszahlungen auf ihre Brady-Bonds – wobei die notwendigen Devisen von den Steuerzahlern des Landes kämen -, und die Tilgungszahlungen würden mit Sicherheiten unterlegt oder über Nullkupon-Anleihen garantiert, die von Regierungen mit hoher Bonität, der EU oder anderen Organisationen ausgegeben würden. Die Ukraine müsste diese Nullkupon-Anleihen kaufen. Oder Regierungen, die den Wiederaufbau des Landes unterstützen möchten, könnten sie spenden.
Steigende Zinssätze und klamme Staatshaushalte haben zur Folge, dass die für den Wiederaufbau benötigten hohen Summen nicht in einem Rutsch aufgebracht werden können. Doch können kreative Finanzierungsmechanismen helfen, die Belastung zu verringern und den Wiederaufbau des Landes zu beschleunigen.
Aus dem Englischen von Jan Doolan. In Kooperation mit Project Syndicate.
