Xi Jinping hat derzeit alle Hände voll zu tun: Die Corona-Pandemie ist wieder aufgeflammt, das Wachstum hat sich verlangsamt und ausländische Investoren drohen mit dem Exodus. Also keine Zeit mehr für den Konflikt mit Taiwan? Das wäre ein Trugschluss, warnt Alexander Görlach im Interview mit Michael Radunski. Xi habe das klare Ziel, die Inselrepublik zu seinen Lebzeiten zu annektieren. Aufgrund seines nicht mehr ganz so jugendlichen Alters von 69 Jahren werfen Analysten schon mit möglichen Jahreszahlen einer Invasion um sich. Russlands verlustreicher Einmarsch in der Ukraine werde Xi nicht abschrecken, so Görlach. Man kann das als Alarmismus abtun, weil wir alle nicht in die Zukunft schauen können. Doch auch Putins Einmarsch in die Ukraine hat viele Beobachter überrascht.
Auch Australien spielt im globalen Mächtespiel um Einfluss im Indopazifik eine wichtige Rolle. “Down Under” hat kürzlich am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenn Peking im eigenen “Hinterhof” aktiv wird. Das chinesische Abkommen mit den Salomonen war ein Schock für Australien. China stößt damit direkt in die Einflusssphäre Canberras vor. Am Sonntag wählen die Australier:innen einen neuen Premierminister und das China-Thema spielt im Wahlkampf eine große Rolle, wie Christiane Kühl berichtet.
Auf diplomatischen Gegenwind aus Fernost kann sich auch die Bundesregierung bald gefasst machen. Der Bundestag hat sich gestern für eine stärkere Einbindung Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation ausgesprochen. Peking ist das ein Dorn im Auge, denn es riecht nach diplomatischer Aufwertung Taiwans.


Chinas Präsident Xi Jinping kann gerade im Ukraine-Krieg mitansehen, wie ein großes und militärisch überlegenes Land möglicherweise an einem vermeintlich unterlegenen Staat scheitert. Viele glauben, dass dadurch ein Krieg Chinas gegen Taiwan unwahrscheinlicher geworden sei. Sie behaupten in ihrem aktuellen Buch “Alarmstufe Rot” das Gegenteil: China werde schon bald nach Taiwan greifen. Wie kommen Sie darauf?
Weil es viele Parallelen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin gibt. Vielleicht am wichtigsten: Beide glauben, dass sie von der Geschichte auserwählt wurden, ihr Land zu alter Glorie zurückzuführen. Und dadurch entsteht eine gewisse Eile.
Aber China wird im Vergleich zu Taiwan ohnehin immer mächtiger. Man könnte sagen: Die Zeit ist auf der Seite Chinas.
Ja, durchaus. Aber die von mir erwähnte Eile ist nicht objektiv, auch nicht rational, sondern subjektiv empfunden. Xi steht unter dem Druck, seiner geschichtlichen Berufung gerecht zu werden.
Das klingt sehr nach Küchenpsychologie. Alles nur subjektive Wahrnehmung eines Mannes.
Nein, es gibt auch viele rationale Gründe, weshalb für Xi Eile besteht. So prognostiziert die UN, dass Chinas Bevölkerung bis 2100 um rund 600 Millionen Menschen schrumpfen wird. Das bedeutet nicht nur weniger Arbeitskräfte, sondern auch weniger Soldaten für potenzielle Angriffe. Zudem hat Xi angekündigt, dass er Taiwan noch in seiner Lebenszeit erobern wolle. Xi wird im Juni 69 Jahre alt. Sie können sich selbst ausrechnen, dass ihm für den Angriff also nicht mehr allzu viele Jahre bleiben.
Sie glauben also nicht, dass die russischen Probleme im Ukraine-Krieg Xis Pläne beeinflussen?
Natürlich wird es zu einer Evaluierung kommen, zumal die chinesische Armee von den Russen ausgerechnet in Angriffstaktiken, Häuser- und Guerillakampf geschult wird, da die russische Armee im Gegensatz zur chinesischen über reichlich Kampferfahrung verfügt. Aber diese Evaluierung wird nicht zu einer Neuausrichtung der chinesischen Außenpolitik führen.
Wenn ein Krieg um Taiwan so nahe ist, wie ist die Stimmung auf der Insel?
Die Bevölkerung weiß um die Bedrohung, lässt sich im Alltag aber davon nicht allzu sehr beeinflussen. Auch die Regierung verfällt nicht in Panik, sondern verfolgt eine rationale Politik. Präsidentin Tsai Ing-wen hat klargemacht, dass Taiwan seine Demokratie nicht aufgeben wird. Mit Blick auf China hat man das Schicksal Hongkongs vor Augen. Deshalb kauft Taipeh in letzter Zeit verstärkt Waffen ein. Dort ist klar, dass man sich gegen den Angriff Pekings selbst verteidigen muss.
Nun ist die Taiwan-Frage wahrlich nicht neu. Seit Jahrzehnten besteht der Status quo, jeder kann damit leben…
Nein, Xi Jinping nicht. Er ist kein Mann des Status quo, sondern ein Revisionist. Er möchte Chinas Stellung in der Welt verändern, indem er sich an dem von ihm verhassten Westen, ein Partner Taiwans, rächt. Deshalb droht Xi mit dem Einsatz von Waffen und Militär. Ich warne dringend davor, seine Aussagen als leere Worte abzutun. Diesen Fehler haben wir schon bei Putin gemacht.
China weist immer wieder darauf hin, dass man selbst keine Kriege angefangen habe. Das würden nur die Amerikaner tun. Warum unterstellen Sie Peking also so etwas?
Die amerikanische Demokratie steckt seit Jahrzehnten in der Krise. Der ungerechtfertigte Krieg im Irak ist nur ein Beispiel dafür. Drastisch und gefährlich aber ist doch, was Xi aus diesem Befund macht: Er möchte, dass China haargenau so auftritt wie Amerika, weil das seiner Auffassung nach das Gebaren einer Großmacht sei. Weil die USA ein Gefangenenlager auf Guantanamo haben, will Peking nun ganz Xinjiang zu einem Gefängnis umwandeln. Was soll das für eine Logik sein?
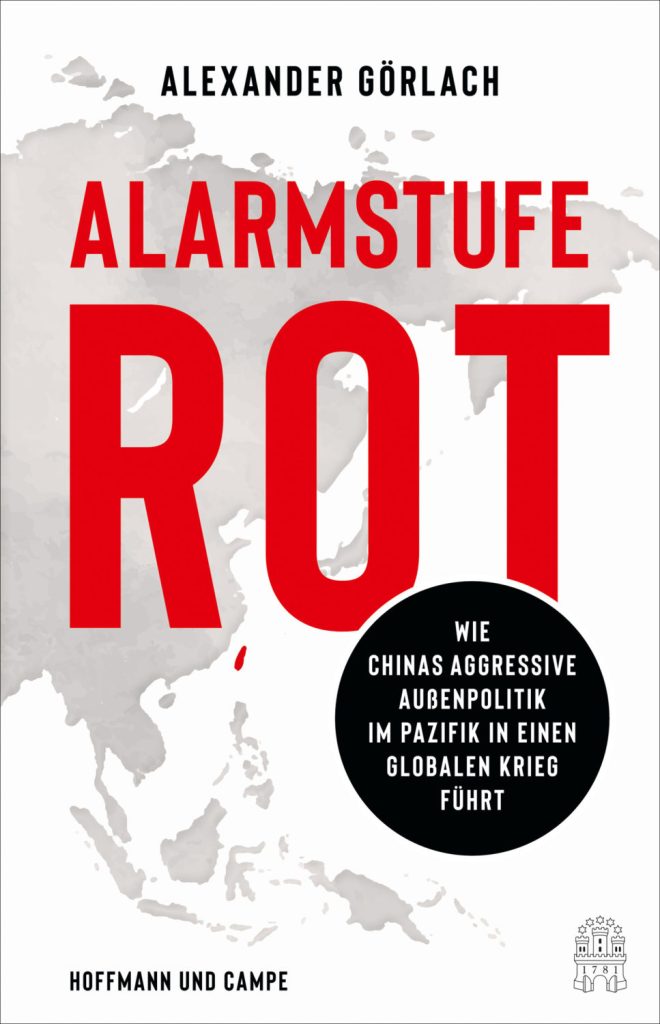
Aber China, und das ist der entscheidende Punkt, hätte doch die Möglichkeit gehabt, es besser zu machen als die USA. Dass Xi das nicht erkannt oder kein Interesse daran hat, ist sein historischer Fehler. Er macht das Land zu einer expansiven, militärischen Macht, die als Hegemon den Pazifik beherrschen will. Wir sollten uns klarmachen: Die Frage ist nicht, ob Taiwan von China angegriffen wird, sondern wann.
Wie lautet dann ihre Prognose?
Militärexperten diskutieren bereits verschiedene Jahreszahlen, die ich auch in meinem Buch erkläre. Es könnte 2027 sein, denn dann ist Chinas Militärreform abgeschlossen. Zwei Lehren aus dem Ukraine-Krieg werden in die Bewertung einfließen: die geschlossene Reaktion des Westens und der Verteidigungswille der Bevölkerung. Auch in Taiwan werden die Menschen nicht am Straßenrand stehen, Blumen streuend und Hosianna singend.
Sie sagten vorhin, China wolle als Hegemon den Pazifik beherrschen.
Richtig. Taiwan ist nur der Anfang, die Pläne von Xi Jinping sind viel weitreichender. China geht es darum, den Westpazifik in sein Gewässer umzuwandeln.
Wie soll das gelingen? Der Westpazifik ist ein internationales Gewässer mit internationalen Seerouten und verschiedenen Staaten, die in der Region ihre eigenen Interessen verfolgen.
Täuschen Sie sich nicht, die ersten Schritte dorthin sind schon gemacht. Es begann damit, Inseln für sich zu reklamieren, sowie Riffe und Felsen zu Stützpunkten auszubauen. Dadurch verschieben sich Landesgrenzen, denn die umliegenden 200 Seemeilen gelten dann nicht mehr als internationales Gewässer, sondern als nationales Gebiet.
Aber Chinas ausufernde Ansprüche im Südchinesischen Meer wurden vom internationalen Schiedsgericht in Den Haag als unberechtigt abgewiesen.
Nur kümmert das Peking nicht. Das zeigt vielmehr, dass China auch unsere regelbasierte Weltordnung angreifen will. China macht sich schlicht seine eigenen Regeln.
Zum Beispiel?
Analog zum Nationalen Sicherheitsgesetz für Hongkong gibt es inzwischen ein Sicherheitsgesetz zur See, welches Peking alle Autorität zuschreibt. Das bedeutet, wenn die chinesische Marine wollte, könnte sie jedes Schiff in diesen Gewässern abschießen.
China beruft sich in seinem Anspruch auf eine ominöse “Nine-Dash-Line” aus der Geschichte. Damit wäre der Umfang seiner Ansprüche klar.
Keinesfalls. Die Nine-Dash-Line hat längst von Pekings Strategen einen weiteren Strich bekommen. Je mächtiger China wird, desto größer wird auch Chinas Verlangen nach neuen Gebieten.
Wo soll das enden?
In der Geschichte sehe ich eine Analogie: Das Römische Reich hat das Mittelmeer einst zu seinem Mare Nostrum gemacht. Nun will China den Westpazifik zu seinem Meer machen.
Welche Rolle kann bei all dem Deutschland spielen?
Ich sehe hier zunächst ein großes Problem: Vielen sind zwar die einzelnen Konflikte bekannt, sei es um Taiwan, mit Indien oder den Philippinen. Aber gerade in unserer Politik gibt es eine gewisse Denkfaulheit. Es fehlt ein holistischer Blick auf China, um zu erkennen, welches Ziel die Volksrepublik in Summe verfolgt.
Deshalb geht es in meinem Buch auch um die digitale Überwachung und die Initiative Neue Seidenstraße. Erst all das zusammen ergibt ein Bild über die Ziele Chinas. Und auf dieser Grundlage muss Deutschland dann seine Rolle finden. Aus meiner Sicht bedarf es einer engen Abstimmung mit den Demokratien vor Ort, wie auch der Weltmacht USA.
Alexander Görlach ist promovierter Linguist und Theologe. Er war als Fellow und Visiting Scholar an der Harvard-Universität und der Universität von Cambridge. 2020 veröffentlichte er “Brennpunkt Hongkong: Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet”. Nun liegt sein neues Buch vor: “Alarmstufe Rot – Wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt”, Hoffmann und Campe, Mai 2022, 240 S., 24 Euro.

Als er 2019 Premierminister wurde, war Scott Morrison ein außenpolitischer Amateur. Und wurde gleich mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert – mit einem selbstbewussten China etwa, und der zunehmenden Rivalität der aufsteigenden Volksrepublik mit den USA. Nun, im Wahlkampf, warnt Morrison: Dies sei nicht die Zeit, die Macht in die Hände eines Unerfahrenen zu legen – er meint seinen Gegenkandidaten von der Labour Party, Anthony Albanese.
Morrison regiert in einer Koalition aus seiner konservativen Liberal Party und der National Party. Er hat die nationale Verteidigung zu einem Schlüsselelement seines Wahlkampfes gemacht. Und darin spielt China eine Hauptrolle. So bezeichnete er Oppositionsführer Anthony Albanese als weich gegenüber Peking – und deutete an, dass nur er selbst hart genug sei, sich gegen den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zu behaupten. “Chinas wachsende Macht und sein wachsender Einfluss sind eine geostrategische Tatsache”, sagte Morrison in einer Rede im März. “Es besteht kein Zweifel, dass China selbstbewusster geworden ist und seine Macht auf eine Weise einsetzt, die Nationen in der gesamten Region und darüber hinaus beunruhigt.”
Seinen Einfluss demonstrierte China erst kürzlich wieder. Vor einigen Wochen unterzeichnete Peking einen Sicherheitspakt mit den Salomonen (China.Table berichtete), rund 2.000 Kilometer nordöstlich von Australien. Das Abkommen erlaubt es Chinas Marine, die Häfen der Salomonen zu nutzen, um dort neue Vorräte aufzunehmen. Die Regierung Morrison sah sich Kritik ausgesetzt, Australiens Hinterhof vernachlässigt zu haben – und reagierte mit martialischen Worten. “Wir werden keine chinesischen Marinestützpunkte in unserer Region, vor unserer Haustür dulden”, warnte Morrison. Verteidigungsminister Peter Dutton schwor die Australier gar auf einen möglichen Krieg ein.
Die Labour Partei warf dem Premier im Gegenzug Untätigkeit vor. Morrison habe einfach zugesehen, als China und die Salomonen das Abkommen schlossen, kritisierte Albaneses Schatten-Außenministerin Penny Wong. Die Regierung der Salomonen in Honiara hat unterdessen eine chinesische Militärbasis öffentlich ausgeschlossen. Australien und auch die USA werben weiter um Kooperation mit Honiara.
Trotz der sicherheitspolitischen Muskelspiele von Morrisons Regierung führt Albaneses Labour-Partei kurz vor der Wahl am Sonntag (21. Mai) in den Umfragen. Grundsätzlich verfolgt sie eine ähnliche China-Politik wie die Regierung – nur mit einer sanfteren Sprache. “Sie beschuldigen die derzeitige Regierung einer spalterischen Rhetorik, mit dem Ziel, zu demonstrieren, wie hart sie gegenüber China vorgehen”, erklärte Natasha Kassam, Direktorin des Programms für öffentliche Meinung und Außenpolitik am Lowy Institute in Sydney.
Doch in der Sache bleibt auch Labour klar: Penny Wong betont, China allein sei für die sich verschlechternden Beziehungen zwischen den beiden Ländern verantwortlich. “Um es ganz klar zu sagen, eine Labour-Regierung Albaneses würde keinen Schritt rückwärts tun, wenn es darum geht, für die Interessen Australiens einzutreten – weder in diesen noch in irgendwelchen anderen Beziehungen”, so Wong. In einer Umfrage des britischen Guardian gaben 37 Prozent der Befragten an, bei den Beziehungen zu China eher Labour zu vertrauen. Nur 28 Prozent vertrauten der konservativen Koalition. Eine große Mehrheit der Wähler (61 Prozent) sieht China zudem als ein komplexes Thema, das es zu bewältigen gilt – und nicht allein als Bedrohung, der man sich stellen muss.
Australierinnen und Australier chinesischer Herkunft machen mehr als fünf Prozent der Bevölkerung aus. Mehr als jeder zwanzigste Australier kommt aus China, Malaysia, Singapur oder Taiwan. Längst nicht alle sind Fans der Kommunistischen Partei Chinas. Viele Einwanderer flohen aus der Volksrepublik, nachdem das Militär im Juni 1989 auf Demonstranten auf dem Tiananmen-Platz geschossen hatte – und viele unterstützen Morrisons starke Sprache gegen Peking.
Nach einer Umfrage der US-Denkfabrik Pew Research hat zwischen 2019 und 2021 eine negative Sicht auf China unter den Australiern stark zugenommen. Statt 57 Prozent sehen nun 78 Prozent die Volksrepublik kritisch. Kein Wunder, denn die Beziehungen zwischen China und Australien befinden sich seit 2018 im Sturzflug. Damals verbannte Australien als erstes Land überhaupt den Telekommunikationsgiganten Huawei aus dem Aufbau seiner 5G-Netze. Außerdem erließ es Gesetze gegen ausländische Einmischung. Ziel der Gesetze: Vor allem China.
Schon im April 2020 forderte Morrison zudem eine unabhängige Untersuchung über die Ursprünge des Coronavirus. Chinas Regierung reagierte wütend – und verhängte Strafzölle etwa auf australisches Rindfleisch und Getreide, später auch auf Wein und Kohle. Staatsmedien überzogen Australien mit Kritik und Häme. Im September 2021 gründete Australien mit Großbritannien und den USA die Militärallianz Aukus, die sich zumindest implizit gegen China richtet. Das neue Bündnis bescherte Canberra unter anderem Atom-U-Boote aus den USA. Im Januar schließlich schloss Australien einen Militärpakt mit Japan (China.Table berichtete).
Trotz der Spannungen hat der bilaterale Handel relativ wenig gelitten. China ist noch immer der mit Abstand größte Handelspartner Australiens. Das liegt vor allem daran, dass China auf Eisenerz aus Australien angewiesen ist. Im Jahr 2020 stammten 60 Prozent von Chinas Eisenerz-Importe aus Australien (China.Table berichtete).
Bloomberg interviewte kürzlich chinesischstämmige Australier im Wahlbezirk Chisholm. Die meisten sagten, sie seien unentschlossen, und alle bezeichneten die Wirtschaft als eines ihrer wichtigsten Anliegen. Manche neigten deshalb zu Morrison und seiner Partei, die sie als bessere Wirtschaftsmanager wahrnahmen. Dennoch äußerten fast alle ein gewisses Unbehagen über die Verschlechterung der Beziehungen zu China. Diese Sorge dürfte auch nach der Wahl nicht abnehmen.
23.05.2022, 8:30-9:30 Uhr (MEZ)
Chinaforum Bayern / Vortrag: Chinas Rolle im Wettlauf um das Autonome Fahren Mehr
23.05.2022, 18:15 Uhr (MEZ)
FU Berlin / Online Seminar: China in der Geopolitik des 21. Jahrhunderts Mehr
24.05.2022, 10:00-11:30 Uhr (MEZ), 16:00-17:30 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: Cybersecurity and Data Protection in China: Compliance, Challenges and Tips Anmeldung
24.05.2022, 10:00-11:30 Uhr (MEZ)
Reach Talent & Technology / BWI: Markteintritt in China: Chancen, Hindernisse und Strategien für deutsche Unternehmen Mehr
24.05.2022, 9:00 AM (PST), 12:00 PM (EST), 18:00 Uhr (MEZ)
Dezan Shira / Webinar: How to Combat Rising Business Costs in China: Best Practices Sharing
25.05.2022, 9:00-11:30 Uhr (MEZ)
TRENT & Umwelttechnik Baden-Württemberg / Workshop: Deutsch-chinesischer Unternehmensworkshop zu Abfallrecycling Mehr
25.05.2022, 10:00-11.00 Uhr (MEZ), 16:00-17:00 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: The ABC of Commercial Dispute Resolution in China Mehr
27.05.2022, 12:00-13:00 Uhr (MEZ)
IHK-AHK China / Webinar: Greater China Business Lunch – Rezepte für das Chinageschäft Anmeldung
Europäische Wissenschaftler kooperieren in tausenden Fällen mit militärischen Forschungseinrichtungen aus China. Das ist das Ergebnis einer investigativen Recherche von Correctiv, Follow the Money und neun weiteren Medien. Die Journalist:innen haben dafür mehr als 350.000 wissenschaftliche Studien aus dem Zeitraum der Jahre 2000 bis 2022 ausgewertet. In fast 3.000 Fällen haben europäische Forscher demnach mit militärischen Forschungseinrichtungen aus China zusammengearbeitet. Für Deutschland fanden die Journalist:innen 349 wissenschaftliche Veröffentlichungen, bei denen deutsche Forscher mit Militäreinrichtungen aus China kooperierten.
Dabei gewinnt die chinesische Seite an “technologischem Wissen und wichtigen Beziehungen”, so die Journalist:innen. Die Kooperationen dienten schließlich dem Aufbau und der Weiterentwicklung des chinesischen Militärs.
In den gemeinsamen Forschungsarbeiten geht es demnach um Bereiche wie Ver- und Entschlüsselungstechnik, Tracking von Personengruppen, Roboternavigation oder Erstellung von 3D-Karten und Gesichtserkennung. Hier kann die chinesische Seite wertvolle Erkenntnisse für militärische und polizeiliche Einsatzbereiche – beispielsweise der Überwachung von Bevölkerungsansammlungen oder Minderheiten – gewinnen. Am häufigsten kooperieren deutsche Wissenschaftler und Universitäten demnach mit der chinesischen National University of Defence Technology. Es käme auch vor, dass chinesische Wissenschaftler ihren wahren Hintergrund verschleiern und europäische Universitäten erst im Nachhinein von deren Verbindungen zu Militäreinrichtungen erfahren.
Die Bundesregierung und Universitäten verweisen bei der Problematik auf die Forschungsfreiheit. Vorschriften zur wissenschaftlichen Kooperation mit China gibt es bisher nicht. Die Regierung wolle die Universitäten und Wissenschaftler jedoch sensibilisieren, so die Correctiv-Recherche. Ob die neue China-Strategie der Bundesregierung auf das Thema der Forschungskooperationen eingeht, ist derzeit noch nicht klar. nib
Die Lage der Menschenrechte in der Volksrepublik hat sich in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich verschlechtert. Aber auch Menschenrechtsverteidiger stünden besonders im Fokus des Staatssicherheitsapparates. Das sagte ein Vertreter der Bundesregierung im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des deutschen Bundestages.
Die chinesischen Sicherheitsbehörden üben demnach eine extreme Kontrolle über Anwältinnen und Anwälte aus, die sich mit Menschenrechtsfällen befassen. Schätzungen zufolge sei ein Drittel der 100 Menschenrechts-Anwälte in China in Haft, oder ihnen wurde die Lizenz entzogen.
Die Repressalien nehmen viele Formen an. Anwälte werden an unbekannte Orte verschleppt, Gerichtsverfahren gegen sie sind intransparent und Haftstrafen werden grundlos verlängert. Auch Angehörige werden laut dem Vertreter des Außenministeriums unter Druck gesetzt.
Die Bundesregierung thematisiere die Inhaftierungen regelmäßig bei bilateralen Gesprächen. Gleichzeitig räumte der Regierungsvertreter ein, dass dies nur eine begrenzte Wirkung entfalte. Zu einem geplanten Besuch der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, in der Provinz Xinjiang, sagte der Regierungsvertreter, unbeeinflusste Gespräche vor Ort seien kaum möglich. Wichtig sei der Besuch dennoch, um im Anschluss den seit 2021 angekündigten Bericht zur Menschenrechtssituation in China zu veröffentlichen.
Bachelet wird voraussichtlich in der kommenden Woche nach China reisen, berichtet Bloomberg bezugnehmend auf anonyme Quellen. Sie wird demnach für sechs bis sieben Tage im Land bleiben. Bachelet muss sich nicht in Quarantäne begeben, da China “Sonderregelungen für hochrangige Besuche ausländischer Würdenträger” hat, wie eine UN-Sprecherin sagte. nib
Der Deutsche Bundestag will Taiwans Status bei der WHO aufwerten. Am Donnerstag wurde ein entsprechender Antrag von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP angenommen. In einer Resolution hatten die Fraktionen die Bundesregierung aufgefordert, sich bei der WHO dafür einzusetzen, dass Taiwan wieder eine Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung und an weiteren Gremien und Aktivitäten der WHO ermöglicht wird. Der Bundestag stellt sich damit offen gegen China, das sich gegen eine diplomatische Aufwertung des von Peking als abtrünnige Provinz betrachteten Landes sperrt.
Die WHO hat bereits einen ähnlichen Antrag von 13 anderen Mitgliedern erhalten, die sich dafür einsetzen, dass Taiwan als Beobachter an der jährlichen Sitzung der Weltgesundheitsversammlung (WHA) teilnehmen kann, die vom 22. bis 28. Mai in Genf stattfindet. Ein Sprecher der WHO teilte mit, dass eine Entscheidung dazu voraussichtlich am kommenden Montag fallen werde, dem zweiten Tag der Sitzung.
In einem Statement beklagt Taiwans Außenministerium, dass die WHO dabei versagt habe, neutral und professionell zu bleiben, und wiederholt die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Taiwans Teilnahme an WHO-Sitzungen und der Weltgesundheitsversammlung ignoriert habe.
Von 2009 bis 2016 konnte Taiwan bereits als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen. Nach der Wahl von Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 blockierte China Taiwans Beobachterstatus und berief sich dabei auf die sogenannte Ein-China-Politik, die auch Deutschland anerkennt.
Die Bundestags-Fraktionen argumentieren, die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass man weltweit zusammenarbeiten müsse. Taiwan galt als besonders erfolgreich in der Pandemie-Bekämpfung. “Nach Auffassung des Deutschen Bundestages dürfen Fragen der globalen Gesundheit nicht politisiert werden, sondern sollen sich ausschließlich auf die Erreichung des globalen Ziels ‘Gesundheit für alle’ konzentrieren”, heißt es. rtr/jul
Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich gegenüber der Biden-Administration für die Abschaffung einiger Zölle auf chinesische Importe ausgesprochen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Einige der Abgaben hätten keinen strategischen Sinn und schadeten US-Firmen und -Konsumenten.
Die unter dem ehemaligen US-Präsidenten Trump eingeführten Zölle haben nichts mit den Problemen zu tun, die die USA mit China haben, so Yellen. Sie bezog sich dabei auf unfaire Handelspraktiken, Fragen der nationalen Sicherheit oder Schwachstellen in der Lieferkette. Innerhalb der Biden-Administration gibt es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai spricht sich für eine Beibehaltung der Zölle aus. Die Zölle in Höhe von bis zu 25 Prozent gelten beispielsweise für Konsumgüter wie Fahrräder oder Bekleidung.
Yellen sprach sich auch für eine Diversifizierung der globalen Lieferketten aus. Die Abhängigkeit von China sei zu hoch, was sich durch die aktuellen Corona-Lockdowns erneut zeige. Unter anderem müsse versucht werden, wichtige Mineralien wie Seltene Erden aus anderen Quellen zu beziehen, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Die USA und die europäischen Verbündeten sollten sich zudem geschlossen gegen fragwürdige Wirtschaftspraktiken der Regierung in Peking stellen. nib/rtr
China will die Schwellenländer-Gruppe Brics erweitern. Außenminister Wang Yi sagte in einem Online-Meeting der Brics-Staaten: “China schlägt vor, den Brics-Erweiterungsprozess zu starten, die Kriterien und Verfahren für die Erweiterung zu untersuchen und schrittweise einen Konsens zu finden”. Die Staatengruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wurde 2009 gegründet. Details zur Erweiterung oder potenziellen Beitrittskandidaten sind bisher noch nicht bekannt.
Es handelt sich bei Brics nicht um ein formelles Bündnis. Die Gruppe hat in den letzten Jahren aber eine gemeinsame Entwicklungsbank gegründet, die auch in Drittstaaten aktiv ist. Zudem gibt es eine Kooperation, um Finanzkrisen abzuwenden. Eine Ausweitung der Brics-Gruppe könnte die Süd-Südkooperation stärken und in Konkurrenz zu westlichen Bündnissen und Institutionen treten. Allerdings gibt es unter den Brics-Staaten auch Grenz- und andere Konflikte. nib
Wegen der strikten Corona-Einreisebeschränkungen hat Chinas Luftfahrt-Industrie im letzten Jahr herbe Verluste erlitten. Die chinesische Flugaufsichtsbehörde beziffert die Einbußen im Jahr 2021 laut einem Bericht von Bloomberg auf umgerechnet fast 12 Milliarden Euro (84 Milliarden Yuan). Die Verluste gingen demnach vor allem auf den internationalen Flugverkehr zurück, der fast zum Erliegen kam. Dagegen sei der Flugverkehr im Inland wieder auf Vor-Pandemie-Niveau gestiegen.
Air China gibt laut einem Bericht der chinesischen Global Times für 2021 ein Minus von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro an (16,6 Milliarden Yuan), bei China Southern Airlines schlagen die Einbußen mit 1,7 Milliarden Euro (12 Milliarden Yuan) zu Buche. Ähnliche Zahlen meldet China Eastern Airlines.
Bei Einreisen aus dem Ausland nach China besteht weiterhin eine dreiwöchige Quarantänepflicht. Reisende aus vielen Ländern müssen zwei negative PCR-Tests vorlegen, die 48 und 24 Stunden vor Abflug durchzuführen sind, sowie ein negatives Schnelltestergebnis, das bei Abflug maximal zwölf Stunden alt ist. Zudem gilt immer noch die Regel, dass Flugrouten ausgesetzt werden, wenn mehrere Passagiere in einem Flugzeug nach Ankunft aus dem Ausland in China positiv auf das Coronavirus getestet werden.
Laut Global Times denkt Chinas Zivilluftfahrtbehörde CAAC darüber nach, die Airlines durch Subventionen zu stützen. Dies könnte allerdings teuer werden: Die möglichen Kosten werden laut dem Bericht auf 700 Millionen Euro geschätzt (fünf Milliarden Yuan). jul

Die Titel, die Haining Feng verliehen bekommt, könnten hochachtungsvoller kaum sein. “Popbotschafterin der Volksrepublik” ist sie genannt worden. In den westlichen Medien wird sie immer wieder als “Blondie Chinas” vorgestellt, und sogar die Anrede “Queen of Beijing” ist in Bezug auf ihre Person keine Seltenheit. Feng selbst, bescheiden lächelnd, hängt ihren Rang hingegen etwas tiefer: “Ein paar Bekannte meinten zu mir, dass ich mittlerweile offiziellen Ahnherrenstatus erreicht hätte – aber den habe ich wahrscheinlich für höchstens zehn Leute. Das ist wohl einfach das, was passiert, wenn man mal mit Musik anfängt und es schafft, lange genug dranzubleiben.”
Seit zwei Jahrzehnten ist sie nun eine prägende Gestalt der chinesischen Alternativszene. In Peking geboren und in den USA aufgewachsen, zieht es sie Anfang der 2000er zurück in die Volksrepublik, als sie von MTV China für einen Job als Moderatorin angeworben wird. Dort findet sie eine Generation junger Chinesen vor, deren subkulturelle Strömungen ohne eine relevante Musikszene auskommen müssen, da aufrührerisch anmutende Genres wie Rock’n’Roll bis vor Kurzem noch auf der Zensurliste standen.
2004 gründet sie die Indiepop-Band Ziyo und wird prompt von Warner Music unter Vertrag genommen. Kurz darauf folgt, parallel zu Ziyo, eine von ihr angeführte Rockgruppe, Pet Conspiracy, die ebenfalls den Durchbruch schafft und 2008 auf einer Europa-Tournee im Westen für Aufsehen sorgt. Dieser Doppelbelastung hält Feng ein paar Jahre lang stand, letzten Endes müssen sich beide Bands aber aus privaten Gründen auflösen.
Da sie ihre Füße aber noch nie lange stillhalten konnte, ruft Feng 2010 direkt ihr nächstes Projekt ins Leben, Nova Heart, für das sie bis heute als Sängerin und Produzentin im Rampenlicht steht – und zwar nicht, wie noch vor kurzem, als Helen Feng, sondern unter ihrem wirklichen Namen, Haining Feng. Helen nannte sie sich in jungen Jahren, um ihrem westlichen Publikum näher zu sein. Heute findet sie jedoch, dass ihre Namensänderung nichts als ein Resultat von internalisiertem Rassismus war, den sie bereits als Kind antrainiert bekam.
Neben ihrer eigenen Musik-Karriere findet sie noch die Zeit, das Plattenlabel Fake Music Media zu betreiben. Die Motivation hierfür rührte aus dem Verlangen, selbst unabhängig zu werden und andere Bands im chinesisch-westlichen Austausch unterstützen zu können. Als ob ihr Organisationstalent damit nicht schon zur Genüge bewiesen wäre, betreut sie noch so etwas wie ein Privatrefugium. Damit ist eine Wohnung in Berlin gemeint, in die sich befreundete Künstler wie der 2017 verstorbene Fotograf Ren Hang, die Schriftstellerin Mian Mian oder der Musikproduzent Rodion in wichtigen Schaffensphasen zurückziehen konnten und können – “ganz im Geiste Berlins, nicht wahr?”
Im Gespräch legt Haining Feng ein so halsbrecherisches Tempo hin, wie ihr Lebenslauf bunt ist. In einem Atemzug kontrastiert sie die Jugendzeit ihrer von Mao in die Mongolei verbannten Eltern mit der aufblühenden Skatekultur, auf die sie in ihrer Zeit bei MTV traf, nur um darauf zurückzukommen, wie ihre Familie die Kommunistische Partei mehr oder weniger mitbegründete, dann aber im Zuge der Kulturrevolution verstoßen wurde. Sie ist genervt davon, im Westen andauernd die gleichen Fragen rund um Zensur und künstlerische Freiheit gestellt zu bekommen, versteht sich aber selbst ohne Zweifel als kritische Stimme: “Ich versuche nicht, den Drachen zu piksen, verpass ihm aber gerne ab und an eine gründliche Massage.” Die nächsten Massagetermine sind für den Sommer anberaumt, in dem sie mit Nova Heart wieder die Bühnen Chinas elektrisieren wird. Julius Schwarzwälder
Sun Haiyan ist neue chinesische Botschafterin in Singapur. Zuvor war sie seit 1997 bei der Abteilung für internationale Verbindungen der Kommunistischen Partei Chinas tätig. Aufgabe dieser Abteilung ist es, die Beziehungen mit Parteien aus anderen Ländern zu pflegen. Sun löst Hong Xiaoyong ab, der vier Jahre lang Chinas Botschafter in Singapur war.

Nicht so zappeln! Zur Feier der Krebssaison stehen die Flusskrebse im Kreis Xuyi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu im Mittelpunkt des Interesses. Die sind eine der bekanntesten Spezialitäten der Region. Auf dem Teller machen sie sich gut – vor der Kamera ebenso.
Xi Jinping hat derzeit alle Hände voll zu tun: Die Corona-Pandemie ist wieder aufgeflammt, das Wachstum hat sich verlangsamt und ausländische Investoren drohen mit dem Exodus. Also keine Zeit mehr für den Konflikt mit Taiwan? Das wäre ein Trugschluss, warnt Alexander Görlach im Interview mit Michael Radunski. Xi habe das klare Ziel, die Inselrepublik zu seinen Lebzeiten zu annektieren. Aufgrund seines nicht mehr ganz so jugendlichen Alters von 69 Jahren werfen Analysten schon mit möglichen Jahreszahlen einer Invasion um sich. Russlands verlustreicher Einmarsch in der Ukraine werde Xi nicht abschrecken, so Görlach. Man kann das als Alarmismus abtun, weil wir alle nicht in die Zukunft schauen können. Doch auch Putins Einmarsch in die Ukraine hat viele Beobachter überrascht.
Auch Australien spielt im globalen Mächtespiel um Einfluss im Indopazifik eine wichtige Rolle. “Down Under” hat kürzlich am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenn Peking im eigenen “Hinterhof” aktiv wird. Das chinesische Abkommen mit den Salomonen war ein Schock für Australien. China stößt damit direkt in die Einflusssphäre Canberras vor. Am Sonntag wählen die Australier:innen einen neuen Premierminister und das China-Thema spielt im Wahlkampf eine große Rolle, wie Christiane Kühl berichtet.
Auf diplomatischen Gegenwind aus Fernost kann sich auch die Bundesregierung bald gefasst machen. Der Bundestag hat sich gestern für eine stärkere Einbindung Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation ausgesprochen. Peking ist das ein Dorn im Auge, denn es riecht nach diplomatischer Aufwertung Taiwans.


Chinas Präsident Xi Jinping kann gerade im Ukraine-Krieg mitansehen, wie ein großes und militärisch überlegenes Land möglicherweise an einem vermeintlich unterlegenen Staat scheitert. Viele glauben, dass dadurch ein Krieg Chinas gegen Taiwan unwahrscheinlicher geworden sei. Sie behaupten in ihrem aktuellen Buch “Alarmstufe Rot” das Gegenteil: China werde schon bald nach Taiwan greifen. Wie kommen Sie darauf?
Weil es viele Parallelen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin gibt. Vielleicht am wichtigsten: Beide glauben, dass sie von der Geschichte auserwählt wurden, ihr Land zu alter Glorie zurückzuführen. Und dadurch entsteht eine gewisse Eile.
Aber China wird im Vergleich zu Taiwan ohnehin immer mächtiger. Man könnte sagen: Die Zeit ist auf der Seite Chinas.
Ja, durchaus. Aber die von mir erwähnte Eile ist nicht objektiv, auch nicht rational, sondern subjektiv empfunden. Xi steht unter dem Druck, seiner geschichtlichen Berufung gerecht zu werden.
Das klingt sehr nach Küchenpsychologie. Alles nur subjektive Wahrnehmung eines Mannes.
Nein, es gibt auch viele rationale Gründe, weshalb für Xi Eile besteht. So prognostiziert die UN, dass Chinas Bevölkerung bis 2100 um rund 600 Millionen Menschen schrumpfen wird. Das bedeutet nicht nur weniger Arbeitskräfte, sondern auch weniger Soldaten für potenzielle Angriffe. Zudem hat Xi angekündigt, dass er Taiwan noch in seiner Lebenszeit erobern wolle. Xi wird im Juni 69 Jahre alt. Sie können sich selbst ausrechnen, dass ihm für den Angriff also nicht mehr allzu viele Jahre bleiben.
Sie glauben also nicht, dass die russischen Probleme im Ukraine-Krieg Xis Pläne beeinflussen?
Natürlich wird es zu einer Evaluierung kommen, zumal die chinesische Armee von den Russen ausgerechnet in Angriffstaktiken, Häuser- und Guerillakampf geschult wird, da die russische Armee im Gegensatz zur chinesischen über reichlich Kampferfahrung verfügt. Aber diese Evaluierung wird nicht zu einer Neuausrichtung der chinesischen Außenpolitik führen.
Wenn ein Krieg um Taiwan so nahe ist, wie ist die Stimmung auf der Insel?
Die Bevölkerung weiß um die Bedrohung, lässt sich im Alltag aber davon nicht allzu sehr beeinflussen. Auch die Regierung verfällt nicht in Panik, sondern verfolgt eine rationale Politik. Präsidentin Tsai Ing-wen hat klargemacht, dass Taiwan seine Demokratie nicht aufgeben wird. Mit Blick auf China hat man das Schicksal Hongkongs vor Augen. Deshalb kauft Taipeh in letzter Zeit verstärkt Waffen ein. Dort ist klar, dass man sich gegen den Angriff Pekings selbst verteidigen muss.
Nun ist die Taiwan-Frage wahrlich nicht neu. Seit Jahrzehnten besteht der Status quo, jeder kann damit leben…
Nein, Xi Jinping nicht. Er ist kein Mann des Status quo, sondern ein Revisionist. Er möchte Chinas Stellung in der Welt verändern, indem er sich an dem von ihm verhassten Westen, ein Partner Taiwans, rächt. Deshalb droht Xi mit dem Einsatz von Waffen und Militär. Ich warne dringend davor, seine Aussagen als leere Worte abzutun. Diesen Fehler haben wir schon bei Putin gemacht.
China weist immer wieder darauf hin, dass man selbst keine Kriege angefangen habe. Das würden nur die Amerikaner tun. Warum unterstellen Sie Peking also so etwas?
Die amerikanische Demokratie steckt seit Jahrzehnten in der Krise. Der ungerechtfertigte Krieg im Irak ist nur ein Beispiel dafür. Drastisch und gefährlich aber ist doch, was Xi aus diesem Befund macht: Er möchte, dass China haargenau so auftritt wie Amerika, weil das seiner Auffassung nach das Gebaren einer Großmacht sei. Weil die USA ein Gefangenenlager auf Guantanamo haben, will Peking nun ganz Xinjiang zu einem Gefängnis umwandeln. Was soll das für eine Logik sein?
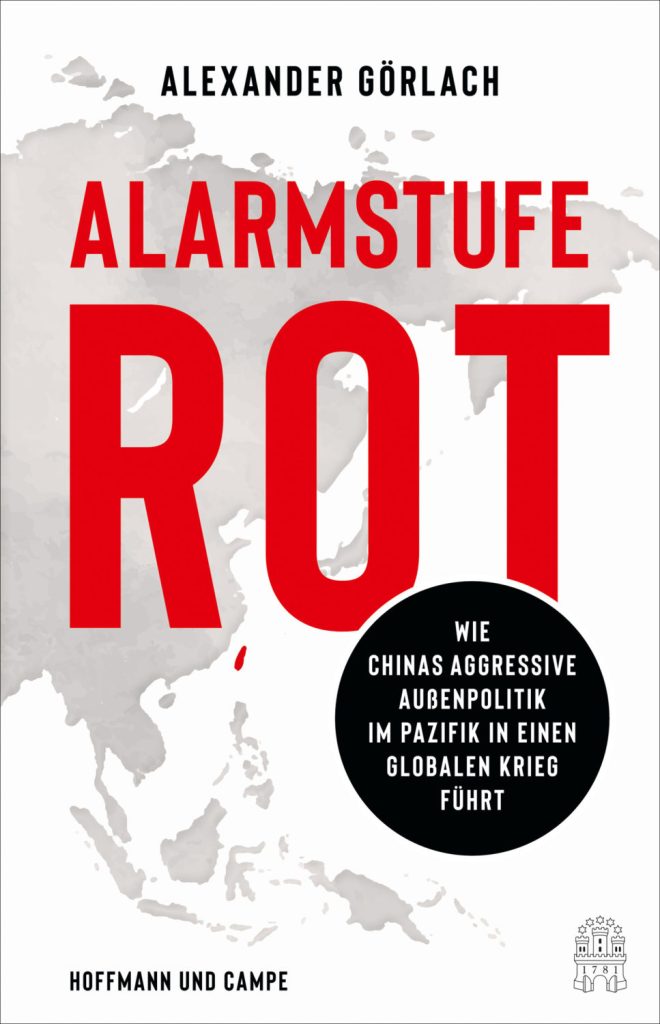
Aber China, und das ist der entscheidende Punkt, hätte doch die Möglichkeit gehabt, es besser zu machen als die USA. Dass Xi das nicht erkannt oder kein Interesse daran hat, ist sein historischer Fehler. Er macht das Land zu einer expansiven, militärischen Macht, die als Hegemon den Pazifik beherrschen will. Wir sollten uns klarmachen: Die Frage ist nicht, ob Taiwan von China angegriffen wird, sondern wann.
Wie lautet dann ihre Prognose?
Militärexperten diskutieren bereits verschiedene Jahreszahlen, die ich auch in meinem Buch erkläre. Es könnte 2027 sein, denn dann ist Chinas Militärreform abgeschlossen. Zwei Lehren aus dem Ukraine-Krieg werden in die Bewertung einfließen: die geschlossene Reaktion des Westens und der Verteidigungswille der Bevölkerung. Auch in Taiwan werden die Menschen nicht am Straßenrand stehen, Blumen streuend und Hosianna singend.
Sie sagten vorhin, China wolle als Hegemon den Pazifik beherrschen.
Richtig. Taiwan ist nur der Anfang, die Pläne von Xi Jinping sind viel weitreichender. China geht es darum, den Westpazifik in sein Gewässer umzuwandeln.
Wie soll das gelingen? Der Westpazifik ist ein internationales Gewässer mit internationalen Seerouten und verschiedenen Staaten, die in der Region ihre eigenen Interessen verfolgen.
Täuschen Sie sich nicht, die ersten Schritte dorthin sind schon gemacht. Es begann damit, Inseln für sich zu reklamieren, sowie Riffe und Felsen zu Stützpunkten auszubauen. Dadurch verschieben sich Landesgrenzen, denn die umliegenden 200 Seemeilen gelten dann nicht mehr als internationales Gewässer, sondern als nationales Gebiet.
Aber Chinas ausufernde Ansprüche im Südchinesischen Meer wurden vom internationalen Schiedsgericht in Den Haag als unberechtigt abgewiesen.
Nur kümmert das Peking nicht. Das zeigt vielmehr, dass China auch unsere regelbasierte Weltordnung angreifen will. China macht sich schlicht seine eigenen Regeln.
Zum Beispiel?
Analog zum Nationalen Sicherheitsgesetz für Hongkong gibt es inzwischen ein Sicherheitsgesetz zur See, welches Peking alle Autorität zuschreibt. Das bedeutet, wenn die chinesische Marine wollte, könnte sie jedes Schiff in diesen Gewässern abschießen.
China beruft sich in seinem Anspruch auf eine ominöse “Nine-Dash-Line” aus der Geschichte. Damit wäre der Umfang seiner Ansprüche klar.
Keinesfalls. Die Nine-Dash-Line hat längst von Pekings Strategen einen weiteren Strich bekommen. Je mächtiger China wird, desto größer wird auch Chinas Verlangen nach neuen Gebieten.
Wo soll das enden?
In der Geschichte sehe ich eine Analogie: Das Römische Reich hat das Mittelmeer einst zu seinem Mare Nostrum gemacht. Nun will China den Westpazifik zu seinem Meer machen.
Welche Rolle kann bei all dem Deutschland spielen?
Ich sehe hier zunächst ein großes Problem: Vielen sind zwar die einzelnen Konflikte bekannt, sei es um Taiwan, mit Indien oder den Philippinen. Aber gerade in unserer Politik gibt es eine gewisse Denkfaulheit. Es fehlt ein holistischer Blick auf China, um zu erkennen, welches Ziel die Volksrepublik in Summe verfolgt.
Deshalb geht es in meinem Buch auch um die digitale Überwachung und die Initiative Neue Seidenstraße. Erst all das zusammen ergibt ein Bild über die Ziele Chinas. Und auf dieser Grundlage muss Deutschland dann seine Rolle finden. Aus meiner Sicht bedarf es einer engen Abstimmung mit den Demokratien vor Ort, wie auch der Weltmacht USA.
Alexander Görlach ist promovierter Linguist und Theologe. Er war als Fellow und Visiting Scholar an der Harvard-Universität und der Universität von Cambridge. 2020 veröffentlichte er “Brennpunkt Hongkong: Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet”. Nun liegt sein neues Buch vor: “Alarmstufe Rot – Wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt”, Hoffmann und Campe, Mai 2022, 240 S., 24 Euro.

Als er 2019 Premierminister wurde, war Scott Morrison ein außenpolitischer Amateur. Und wurde gleich mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert – mit einem selbstbewussten China etwa, und der zunehmenden Rivalität der aufsteigenden Volksrepublik mit den USA. Nun, im Wahlkampf, warnt Morrison: Dies sei nicht die Zeit, die Macht in die Hände eines Unerfahrenen zu legen – er meint seinen Gegenkandidaten von der Labour Party, Anthony Albanese.
Morrison regiert in einer Koalition aus seiner konservativen Liberal Party und der National Party. Er hat die nationale Verteidigung zu einem Schlüsselelement seines Wahlkampfes gemacht. Und darin spielt China eine Hauptrolle. So bezeichnete er Oppositionsführer Anthony Albanese als weich gegenüber Peking – und deutete an, dass nur er selbst hart genug sei, sich gegen den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zu behaupten. “Chinas wachsende Macht und sein wachsender Einfluss sind eine geostrategische Tatsache”, sagte Morrison in einer Rede im März. “Es besteht kein Zweifel, dass China selbstbewusster geworden ist und seine Macht auf eine Weise einsetzt, die Nationen in der gesamten Region und darüber hinaus beunruhigt.”
Seinen Einfluss demonstrierte China erst kürzlich wieder. Vor einigen Wochen unterzeichnete Peking einen Sicherheitspakt mit den Salomonen (China.Table berichtete), rund 2.000 Kilometer nordöstlich von Australien. Das Abkommen erlaubt es Chinas Marine, die Häfen der Salomonen zu nutzen, um dort neue Vorräte aufzunehmen. Die Regierung Morrison sah sich Kritik ausgesetzt, Australiens Hinterhof vernachlässigt zu haben – und reagierte mit martialischen Worten. “Wir werden keine chinesischen Marinestützpunkte in unserer Region, vor unserer Haustür dulden”, warnte Morrison. Verteidigungsminister Peter Dutton schwor die Australier gar auf einen möglichen Krieg ein.
Die Labour Partei warf dem Premier im Gegenzug Untätigkeit vor. Morrison habe einfach zugesehen, als China und die Salomonen das Abkommen schlossen, kritisierte Albaneses Schatten-Außenministerin Penny Wong. Die Regierung der Salomonen in Honiara hat unterdessen eine chinesische Militärbasis öffentlich ausgeschlossen. Australien und auch die USA werben weiter um Kooperation mit Honiara.
Trotz der sicherheitspolitischen Muskelspiele von Morrisons Regierung führt Albaneses Labour-Partei kurz vor der Wahl am Sonntag (21. Mai) in den Umfragen. Grundsätzlich verfolgt sie eine ähnliche China-Politik wie die Regierung – nur mit einer sanfteren Sprache. “Sie beschuldigen die derzeitige Regierung einer spalterischen Rhetorik, mit dem Ziel, zu demonstrieren, wie hart sie gegenüber China vorgehen”, erklärte Natasha Kassam, Direktorin des Programms für öffentliche Meinung und Außenpolitik am Lowy Institute in Sydney.
Doch in der Sache bleibt auch Labour klar: Penny Wong betont, China allein sei für die sich verschlechternden Beziehungen zwischen den beiden Ländern verantwortlich. “Um es ganz klar zu sagen, eine Labour-Regierung Albaneses würde keinen Schritt rückwärts tun, wenn es darum geht, für die Interessen Australiens einzutreten – weder in diesen noch in irgendwelchen anderen Beziehungen”, so Wong. In einer Umfrage des britischen Guardian gaben 37 Prozent der Befragten an, bei den Beziehungen zu China eher Labour zu vertrauen. Nur 28 Prozent vertrauten der konservativen Koalition. Eine große Mehrheit der Wähler (61 Prozent) sieht China zudem als ein komplexes Thema, das es zu bewältigen gilt – und nicht allein als Bedrohung, der man sich stellen muss.
Australierinnen und Australier chinesischer Herkunft machen mehr als fünf Prozent der Bevölkerung aus. Mehr als jeder zwanzigste Australier kommt aus China, Malaysia, Singapur oder Taiwan. Längst nicht alle sind Fans der Kommunistischen Partei Chinas. Viele Einwanderer flohen aus der Volksrepublik, nachdem das Militär im Juni 1989 auf Demonstranten auf dem Tiananmen-Platz geschossen hatte – und viele unterstützen Morrisons starke Sprache gegen Peking.
Nach einer Umfrage der US-Denkfabrik Pew Research hat zwischen 2019 und 2021 eine negative Sicht auf China unter den Australiern stark zugenommen. Statt 57 Prozent sehen nun 78 Prozent die Volksrepublik kritisch. Kein Wunder, denn die Beziehungen zwischen China und Australien befinden sich seit 2018 im Sturzflug. Damals verbannte Australien als erstes Land überhaupt den Telekommunikationsgiganten Huawei aus dem Aufbau seiner 5G-Netze. Außerdem erließ es Gesetze gegen ausländische Einmischung. Ziel der Gesetze: Vor allem China.
Schon im April 2020 forderte Morrison zudem eine unabhängige Untersuchung über die Ursprünge des Coronavirus. Chinas Regierung reagierte wütend – und verhängte Strafzölle etwa auf australisches Rindfleisch und Getreide, später auch auf Wein und Kohle. Staatsmedien überzogen Australien mit Kritik und Häme. Im September 2021 gründete Australien mit Großbritannien und den USA die Militärallianz Aukus, die sich zumindest implizit gegen China richtet. Das neue Bündnis bescherte Canberra unter anderem Atom-U-Boote aus den USA. Im Januar schließlich schloss Australien einen Militärpakt mit Japan (China.Table berichtete).
Trotz der Spannungen hat der bilaterale Handel relativ wenig gelitten. China ist noch immer der mit Abstand größte Handelspartner Australiens. Das liegt vor allem daran, dass China auf Eisenerz aus Australien angewiesen ist. Im Jahr 2020 stammten 60 Prozent von Chinas Eisenerz-Importe aus Australien (China.Table berichtete).
Bloomberg interviewte kürzlich chinesischstämmige Australier im Wahlbezirk Chisholm. Die meisten sagten, sie seien unentschlossen, und alle bezeichneten die Wirtschaft als eines ihrer wichtigsten Anliegen. Manche neigten deshalb zu Morrison und seiner Partei, die sie als bessere Wirtschaftsmanager wahrnahmen. Dennoch äußerten fast alle ein gewisses Unbehagen über die Verschlechterung der Beziehungen zu China. Diese Sorge dürfte auch nach der Wahl nicht abnehmen.
23.05.2022, 8:30-9:30 Uhr (MEZ)
Chinaforum Bayern / Vortrag: Chinas Rolle im Wettlauf um das Autonome Fahren Mehr
23.05.2022, 18:15 Uhr (MEZ)
FU Berlin / Online Seminar: China in der Geopolitik des 21. Jahrhunderts Mehr
24.05.2022, 10:00-11:30 Uhr (MEZ), 16:00-17:30 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: Cybersecurity and Data Protection in China: Compliance, Challenges and Tips Anmeldung
24.05.2022, 10:00-11:30 Uhr (MEZ)
Reach Talent & Technology / BWI: Markteintritt in China: Chancen, Hindernisse und Strategien für deutsche Unternehmen Mehr
24.05.2022, 9:00 AM (PST), 12:00 PM (EST), 18:00 Uhr (MEZ)
Dezan Shira / Webinar: How to Combat Rising Business Costs in China: Best Practices Sharing
25.05.2022, 9:00-11:30 Uhr (MEZ)
TRENT & Umwelttechnik Baden-Württemberg / Workshop: Deutsch-chinesischer Unternehmensworkshop zu Abfallrecycling Mehr
25.05.2022, 10:00-11.00 Uhr (MEZ), 16:00-17:00 Uhr Beijing Time
EU SME Centre / Webinar: The ABC of Commercial Dispute Resolution in China Mehr
27.05.2022, 12:00-13:00 Uhr (MEZ)
IHK-AHK China / Webinar: Greater China Business Lunch – Rezepte für das Chinageschäft Anmeldung
Europäische Wissenschaftler kooperieren in tausenden Fällen mit militärischen Forschungseinrichtungen aus China. Das ist das Ergebnis einer investigativen Recherche von Correctiv, Follow the Money und neun weiteren Medien. Die Journalist:innen haben dafür mehr als 350.000 wissenschaftliche Studien aus dem Zeitraum der Jahre 2000 bis 2022 ausgewertet. In fast 3.000 Fällen haben europäische Forscher demnach mit militärischen Forschungseinrichtungen aus China zusammengearbeitet. Für Deutschland fanden die Journalist:innen 349 wissenschaftliche Veröffentlichungen, bei denen deutsche Forscher mit Militäreinrichtungen aus China kooperierten.
Dabei gewinnt die chinesische Seite an “technologischem Wissen und wichtigen Beziehungen”, so die Journalist:innen. Die Kooperationen dienten schließlich dem Aufbau und der Weiterentwicklung des chinesischen Militärs.
In den gemeinsamen Forschungsarbeiten geht es demnach um Bereiche wie Ver- und Entschlüsselungstechnik, Tracking von Personengruppen, Roboternavigation oder Erstellung von 3D-Karten und Gesichtserkennung. Hier kann die chinesische Seite wertvolle Erkenntnisse für militärische und polizeiliche Einsatzbereiche – beispielsweise der Überwachung von Bevölkerungsansammlungen oder Minderheiten – gewinnen. Am häufigsten kooperieren deutsche Wissenschaftler und Universitäten demnach mit der chinesischen National University of Defence Technology. Es käme auch vor, dass chinesische Wissenschaftler ihren wahren Hintergrund verschleiern und europäische Universitäten erst im Nachhinein von deren Verbindungen zu Militäreinrichtungen erfahren.
Die Bundesregierung und Universitäten verweisen bei der Problematik auf die Forschungsfreiheit. Vorschriften zur wissenschaftlichen Kooperation mit China gibt es bisher nicht. Die Regierung wolle die Universitäten und Wissenschaftler jedoch sensibilisieren, so die Correctiv-Recherche. Ob die neue China-Strategie der Bundesregierung auf das Thema der Forschungskooperationen eingeht, ist derzeit noch nicht klar. nib
Die Lage der Menschenrechte in der Volksrepublik hat sich in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich verschlechtert. Aber auch Menschenrechtsverteidiger stünden besonders im Fokus des Staatssicherheitsapparates. Das sagte ein Vertreter der Bundesregierung im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des deutschen Bundestages.
Die chinesischen Sicherheitsbehörden üben demnach eine extreme Kontrolle über Anwältinnen und Anwälte aus, die sich mit Menschenrechtsfällen befassen. Schätzungen zufolge sei ein Drittel der 100 Menschenrechts-Anwälte in China in Haft, oder ihnen wurde die Lizenz entzogen.
Die Repressalien nehmen viele Formen an. Anwälte werden an unbekannte Orte verschleppt, Gerichtsverfahren gegen sie sind intransparent und Haftstrafen werden grundlos verlängert. Auch Angehörige werden laut dem Vertreter des Außenministeriums unter Druck gesetzt.
Die Bundesregierung thematisiere die Inhaftierungen regelmäßig bei bilateralen Gesprächen. Gleichzeitig räumte der Regierungsvertreter ein, dass dies nur eine begrenzte Wirkung entfalte. Zu einem geplanten Besuch der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, in der Provinz Xinjiang, sagte der Regierungsvertreter, unbeeinflusste Gespräche vor Ort seien kaum möglich. Wichtig sei der Besuch dennoch, um im Anschluss den seit 2021 angekündigten Bericht zur Menschenrechtssituation in China zu veröffentlichen.
Bachelet wird voraussichtlich in der kommenden Woche nach China reisen, berichtet Bloomberg bezugnehmend auf anonyme Quellen. Sie wird demnach für sechs bis sieben Tage im Land bleiben. Bachelet muss sich nicht in Quarantäne begeben, da China “Sonderregelungen für hochrangige Besuche ausländischer Würdenträger” hat, wie eine UN-Sprecherin sagte. nib
Der Deutsche Bundestag will Taiwans Status bei der WHO aufwerten. Am Donnerstag wurde ein entsprechender Antrag von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP angenommen. In einer Resolution hatten die Fraktionen die Bundesregierung aufgefordert, sich bei der WHO dafür einzusetzen, dass Taiwan wieder eine Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung und an weiteren Gremien und Aktivitäten der WHO ermöglicht wird. Der Bundestag stellt sich damit offen gegen China, das sich gegen eine diplomatische Aufwertung des von Peking als abtrünnige Provinz betrachteten Landes sperrt.
Die WHO hat bereits einen ähnlichen Antrag von 13 anderen Mitgliedern erhalten, die sich dafür einsetzen, dass Taiwan als Beobachter an der jährlichen Sitzung der Weltgesundheitsversammlung (WHA) teilnehmen kann, die vom 22. bis 28. Mai in Genf stattfindet. Ein Sprecher der WHO teilte mit, dass eine Entscheidung dazu voraussichtlich am kommenden Montag fallen werde, dem zweiten Tag der Sitzung.
In einem Statement beklagt Taiwans Außenministerium, dass die WHO dabei versagt habe, neutral und professionell zu bleiben, und wiederholt die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Taiwans Teilnahme an WHO-Sitzungen und der Weltgesundheitsversammlung ignoriert habe.
Von 2009 bis 2016 konnte Taiwan bereits als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen. Nach der Wahl von Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 blockierte China Taiwans Beobachterstatus und berief sich dabei auf die sogenannte Ein-China-Politik, die auch Deutschland anerkennt.
Die Bundestags-Fraktionen argumentieren, die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass man weltweit zusammenarbeiten müsse. Taiwan galt als besonders erfolgreich in der Pandemie-Bekämpfung. “Nach Auffassung des Deutschen Bundestages dürfen Fragen der globalen Gesundheit nicht politisiert werden, sondern sollen sich ausschließlich auf die Erreichung des globalen Ziels ‘Gesundheit für alle’ konzentrieren”, heißt es. rtr/jul
Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich gegenüber der Biden-Administration für die Abschaffung einiger Zölle auf chinesische Importe ausgesprochen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Einige der Abgaben hätten keinen strategischen Sinn und schadeten US-Firmen und -Konsumenten.
Die unter dem ehemaligen US-Präsidenten Trump eingeführten Zölle haben nichts mit den Problemen zu tun, die die USA mit China haben, so Yellen. Sie bezog sich dabei auf unfaire Handelspraktiken, Fragen der nationalen Sicherheit oder Schwachstellen in der Lieferkette. Innerhalb der Biden-Administration gibt es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai spricht sich für eine Beibehaltung der Zölle aus. Die Zölle in Höhe von bis zu 25 Prozent gelten beispielsweise für Konsumgüter wie Fahrräder oder Bekleidung.
Yellen sprach sich auch für eine Diversifizierung der globalen Lieferketten aus. Die Abhängigkeit von China sei zu hoch, was sich durch die aktuellen Corona-Lockdowns erneut zeige. Unter anderem müsse versucht werden, wichtige Mineralien wie Seltene Erden aus anderen Quellen zu beziehen, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Die USA und die europäischen Verbündeten sollten sich zudem geschlossen gegen fragwürdige Wirtschaftspraktiken der Regierung in Peking stellen. nib/rtr
China will die Schwellenländer-Gruppe Brics erweitern. Außenminister Wang Yi sagte in einem Online-Meeting der Brics-Staaten: “China schlägt vor, den Brics-Erweiterungsprozess zu starten, die Kriterien und Verfahren für die Erweiterung zu untersuchen und schrittweise einen Konsens zu finden”. Die Staatengruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wurde 2009 gegründet. Details zur Erweiterung oder potenziellen Beitrittskandidaten sind bisher noch nicht bekannt.
Es handelt sich bei Brics nicht um ein formelles Bündnis. Die Gruppe hat in den letzten Jahren aber eine gemeinsame Entwicklungsbank gegründet, die auch in Drittstaaten aktiv ist. Zudem gibt es eine Kooperation, um Finanzkrisen abzuwenden. Eine Ausweitung der Brics-Gruppe könnte die Süd-Südkooperation stärken und in Konkurrenz zu westlichen Bündnissen und Institutionen treten. Allerdings gibt es unter den Brics-Staaten auch Grenz- und andere Konflikte. nib
Wegen der strikten Corona-Einreisebeschränkungen hat Chinas Luftfahrt-Industrie im letzten Jahr herbe Verluste erlitten. Die chinesische Flugaufsichtsbehörde beziffert die Einbußen im Jahr 2021 laut einem Bericht von Bloomberg auf umgerechnet fast 12 Milliarden Euro (84 Milliarden Yuan). Die Verluste gingen demnach vor allem auf den internationalen Flugverkehr zurück, der fast zum Erliegen kam. Dagegen sei der Flugverkehr im Inland wieder auf Vor-Pandemie-Niveau gestiegen.
Air China gibt laut einem Bericht der chinesischen Global Times für 2021 ein Minus von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro an (16,6 Milliarden Yuan), bei China Southern Airlines schlagen die Einbußen mit 1,7 Milliarden Euro (12 Milliarden Yuan) zu Buche. Ähnliche Zahlen meldet China Eastern Airlines.
Bei Einreisen aus dem Ausland nach China besteht weiterhin eine dreiwöchige Quarantänepflicht. Reisende aus vielen Ländern müssen zwei negative PCR-Tests vorlegen, die 48 und 24 Stunden vor Abflug durchzuführen sind, sowie ein negatives Schnelltestergebnis, das bei Abflug maximal zwölf Stunden alt ist. Zudem gilt immer noch die Regel, dass Flugrouten ausgesetzt werden, wenn mehrere Passagiere in einem Flugzeug nach Ankunft aus dem Ausland in China positiv auf das Coronavirus getestet werden.
Laut Global Times denkt Chinas Zivilluftfahrtbehörde CAAC darüber nach, die Airlines durch Subventionen zu stützen. Dies könnte allerdings teuer werden: Die möglichen Kosten werden laut dem Bericht auf 700 Millionen Euro geschätzt (fünf Milliarden Yuan). jul

Die Titel, die Haining Feng verliehen bekommt, könnten hochachtungsvoller kaum sein. “Popbotschafterin der Volksrepublik” ist sie genannt worden. In den westlichen Medien wird sie immer wieder als “Blondie Chinas” vorgestellt, und sogar die Anrede “Queen of Beijing” ist in Bezug auf ihre Person keine Seltenheit. Feng selbst, bescheiden lächelnd, hängt ihren Rang hingegen etwas tiefer: “Ein paar Bekannte meinten zu mir, dass ich mittlerweile offiziellen Ahnherrenstatus erreicht hätte – aber den habe ich wahrscheinlich für höchstens zehn Leute. Das ist wohl einfach das, was passiert, wenn man mal mit Musik anfängt und es schafft, lange genug dranzubleiben.”
Seit zwei Jahrzehnten ist sie nun eine prägende Gestalt der chinesischen Alternativszene. In Peking geboren und in den USA aufgewachsen, zieht es sie Anfang der 2000er zurück in die Volksrepublik, als sie von MTV China für einen Job als Moderatorin angeworben wird. Dort findet sie eine Generation junger Chinesen vor, deren subkulturelle Strömungen ohne eine relevante Musikszene auskommen müssen, da aufrührerisch anmutende Genres wie Rock’n’Roll bis vor Kurzem noch auf der Zensurliste standen.
2004 gründet sie die Indiepop-Band Ziyo und wird prompt von Warner Music unter Vertrag genommen. Kurz darauf folgt, parallel zu Ziyo, eine von ihr angeführte Rockgruppe, Pet Conspiracy, die ebenfalls den Durchbruch schafft und 2008 auf einer Europa-Tournee im Westen für Aufsehen sorgt. Dieser Doppelbelastung hält Feng ein paar Jahre lang stand, letzten Endes müssen sich beide Bands aber aus privaten Gründen auflösen.
Da sie ihre Füße aber noch nie lange stillhalten konnte, ruft Feng 2010 direkt ihr nächstes Projekt ins Leben, Nova Heart, für das sie bis heute als Sängerin und Produzentin im Rampenlicht steht – und zwar nicht, wie noch vor kurzem, als Helen Feng, sondern unter ihrem wirklichen Namen, Haining Feng. Helen nannte sie sich in jungen Jahren, um ihrem westlichen Publikum näher zu sein. Heute findet sie jedoch, dass ihre Namensänderung nichts als ein Resultat von internalisiertem Rassismus war, den sie bereits als Kind antrainiert bekam.
Neben ihrer eigenen Musik-Karriere findet sie noch die Zeit, das Plattenlabel Fake Music Media zu betreiben. Die Motivation hierfür rührte aus dem Verlangen, selbst unabhängig zu werden und andere Bands im chinesisch-westlichen Austausch unterstützen zu können. Als ob ihr Organisationstalent damit nicht schon zur Genüge bewiesen wäre, betreut sie noch so etwas wie ein Privatrefugium. Damit ist eine Wohnung in Berlin gemeint, in die sich befreundete Künstler wie der 2017 verstorbene Fotograf Ren Hang, die Schriftstellerin Mian Mian oder der Musikproduzent Rodion in wichtigen Schaffensphasen zurückziehen konnten und können – “ganz im Geiste Berlins, nicht wahr?”
Im Gespräch legt Haining Feng ein so halsbrecherisches Tempo hin, wie ihr Lebenslauf bunt ist. In einem Atemzug kontrastiert sie die Jugendzeit ihrer von Mao in die Mongolei verbannten Eltern mit der aufblühenden Skatekultur, auf die sie in ihrer Zeit bei MTV traf, nur um darauf zurückzukommen, wie ihre Familie die Kommunistische Partei mehr oder weniger mitbegründete, dann aber im Zuge der Kulturrevolution verstoßen wurde. Sie ist genervt davon, im Westen andauernd die gleichen Fragen rund um Zensur und künstlerische Freiheit gestellt zu bekommen, versteht sich aber selbst ohne Zweifel als kritische Stimme: “Ich versuche nicht, den Drachen zu piksen, verpass ihm aber gerne ab und an eine gründliche Massage.” Die nächsten Massagetermine sind für den Sommer anberaumt, in dem sie mit Nova Heart wieder die Bühnen Chinas elektrisieren wird. Julius Schwarzwälder
Sun Haiyan ist neue chinesische Botschafterin in Singapur. Zuvor war sie seit 1997 bei der Abteilung für internationale Verbindungen der Kommunistischen Partei Chinas tätig. Aufgabe dieser Abteilung ist es, die Beziehungen mit Parteien aus anderen Ländern zu pflegen. Sun löst Hong Xiaoyong ab, der vier Jahre lang Chinas Botschafter in Singapur war.

Nicht so zappeln! Zur Feier der Krebssaison stehen die Flusskrebse im Kreis Xuyi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu im Mittelpunkt des Interesses. Die sind eine der bekanntesten Spezialitäten der Region. Auf dem Teller machen sie sich gut – vor der Kamera ebenso.
