Microsoft schließt den chinesischen Ableger des Berufsnetzes LinkedIn. Eine Reaktion auf ein unerträgliches Maß an Zensur? Jein. Hauptgrund für die Schließung war mangelnder Erfolg des Netzwerks. Unser Autor Frank Sieren erläutert, warum sich damit weder für China noch für Microsoft viel ändert: Chinesische Nutzer verwenden am liebsten einheimische Plattformen. Expats und andere Ausländer wiederum verwenden meist die LinkedIn-Seiten ihrer Heimatländer. Frank Sieren ist selbst Power-User von LinkedIn – und auch er verwendet in China die internationale Version, nicht die chinesische.
Kishore Mahbubani ist einer der angesehensten Diplomaten Asiens. Er war für Singapur Botschafter in den USA und bei der Uno. Zwischenzeitlich ging er unter die Wissenschaftler und lehrte an der National Universiy of Singapore. In allen diesen Rollen pflegte er eine Asien-zentrische Sicht auf die Welt. Im Interview mit dem China.Table provoziert er nun mit der These, dass China genau die Freiheiten hat, die es haben möchte und braucht. Mahbubani vergleicht zudem die Erstürmung des Hongkonger Parlaments durch die dortigen Demokratie-Anhänger mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington durch Trump-Anhänger – beides seien Gesetzesverstöße, beides werde zu Recht bestraft. Auf abstrakter Ebene ist das völlig richtig, wird aber zu einigem Stirnrunzeln führen.
Weniger kontrovers ist dagegen Mahbubanis Diagnose: Die USA befinden sich in erbärmlichem Zustand, haben ihren globalen Führungsanspruch eigentlich schon verspielt – und ein deutlich rationaleres und besser organisiertes China steht bereit, in die Lücke vorzustoßen. Der Führungsstil wird jedoch ein anderer sein: “China will nicht die Welt verändern oder gar missionarisch verbessern. China wird sich nicht in unnötigen Kriegen wie im Irak oder Syrien verheddern.”
Einen produktiven Start in die Woche wünscht

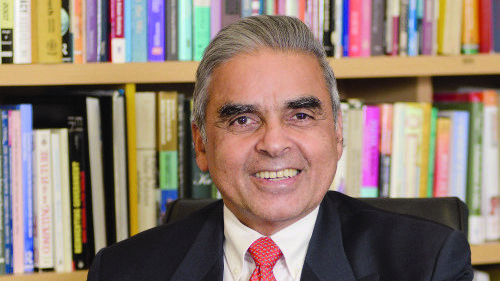
Herr Kishore Mahbubani, Ihr aktuelles Buch “Hat China schon gewonnen? – Chinas Aufstieg zur neuen Supermacht” ist gerade auf Deutsch erschienen. Ein sehr spannendes Buch, in dem Sie viele Annahmen des Westens herausfordern. Wir wollen mit Ihnen über den globalen Konflikt zwischen China und den USA reden. Hat China denn schon gewonnen?
Momentan werden viele Menschen denken: Ja. Doch soweit ist es nicht. Noch nicht. Aber sollten die Vereinigten Staaten so weitermachen wie bisher – ohne eine umfassende Strategie gegenüber China – dann werden sie tatsächlich verlieren.
Für viele ist das eine beängstige Vorhersage, denn im Westen hat man ein klares Bild der Auseinandersetzung: Hier die USA, eine Demokratie, ein Verbündeter, für manche sogar ein Freund. Dort China, böse, herausfordernd und gefährlich.
Ja, mag sein. Nur stimmt das so nicht. China ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt. Die meiste Zeit ihrer 4000 Jahre langen Geschichte war sie führend in der Welt. Nun hatten die Chinesen 200 schlechte Jahre – und der Westen war sehr erfolgreich. Aber nur wegen dieser kurzen Zeit denkt der Westen nun allen Ernstes, dass sich China nun wie der Westen entwickeln müsse? Eine Kopie des Westens werden – das ist ein Trugschluss. Die chinesische Zivilisation ist stärker und selbstbewusster als der Westen. Die Chinesen sehen gar keinen Grund, so zu werden wie der Westen. Das müssen Sie im Westen dringend verstehen.
China muss ja keine Kopie des Westens werden. Aber sollten universelle Rechte und Werte nicht überall auf der Welt gelten?
Ach ja, jetzt sprechen Sie wieder von Demokratie. Ja, Demokratie hat im Westen gut funktioniert. Aber in China weiß man aus der eigenen Geschichte, dass ohne eine starke Zentralregierung die Menschen unendlich leiden. Ohnehin, als China schwach war, hat der Westen kein Interesse gezeigt, dem Land Demokratie zu bringen. Im Gegenteil: Der Westen hat auf China herumgetrampelt und die Schwäche Chinas gnadenlos ausgenutzt. Und jetzt, da China zu alter Stärke zurückfindet, fällt dem Westen plötzlich ein: Ach, warum willst Du nicht so werden wie wir. Ist das ihr Ernst?
Das klingt sehr nach einer chinesischen Revanche.
Nein, überhaupt nicht. Die Chinesen haben kein Bedürfnis nach Revanche. Aber sie sind überrascht darüber, dass der Westen meint, besser zu wissen, was gut für Chinesen ist als die Chinesen selbst. Das ist sehr arrogant. Der Westen meint, alles was der Westen macht, sei richtig, und alles was China macht, sei falsch.
Was denken dann die Chinesen über ihre Situation?
Die Lebensumstände der Chinesen haben sich so stark verbessert wie in den ganzen 4000 Jahren zuvor nicht. Und genau in dem Moment, in dem die Chinesen wieder glücklich sind, kommt der Westen und sagt: So kann es nicht weitergehen.
Sie denken noch immer an den Punkt Demokratie und westliche Regierungssystem. Aber das meine ich nicht. Ich denke an Werte. Was wäre so falsch daran, den Chinesen universelle Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit zu ermöglichen?
Tja, die USA gelten ja als Ort der größten Meinungsfreiheit. Aber wenn ein Politiker aufsteht und sagt: Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass unser Land eventuell nicht länger die Nummer Eins in der Welt sein wird, dann ist er politisch tot – im Land der freien Rede. Was ich damit sagen will: Jede Gesellschaft muss für sich eine Balance finden zwischen Freiheit und Auflagen.
Ein sehr abstrakter Vergleich.
Natürlich gibt es in China nicht die gleichen Freiheiten wie in westlichen Gesellschaften. Aber sie müssen das in der Perspektive betrachten. In den vergangenen 150 Jahren sind die Chinesen durch die Hölle gegangen. Die Mehrheit hatte nichts zu essen. 80 Prozent lebten in bitterer Armut. Sie konnten nicht auswählen, wo sie leben, wo sie arbeiten, was sie studieren, nicht mal was sie anziehen. Alle trugen Mao-Anzüge. Heute ist China völlig anders.
Und alles ist toll: Kein Zwang, keine Unterdrückung, nur Freude?
Ich nenne ihnen eine andere Tatsache, die meinen Punkt verdeutlicht. Die Sowjetunion hatte ihren Bürger nicht erlaubt, ins Ausland zu reisen, weil sie alle abgehauen wären vor Angst, Armut und Unterdrückung. 2019 sind 139 Millionen Chinesen ins Ausland gereist. Das ist fast zweimal die gesamte Bundesrepublik. Und wissen Sie was? Alle sind zurück nach China gekommen. Wenn die chinesische Regierung die Menschen derart unterdrücken würde, wäre das wohl nicht passiert. Sie kommen zurück, weil sie ihr Leben und ihre Freiheiten in China genießen.
Die Sowjetunion stand auch im Konflikt mit den USA, nun ist Amerikas großer Rivale China. Sie sagen, im aktuellen Konflikt ist Amerika längst zur Sowjetunion geworden. Was meinen Sie damit?
Die USA sind inzwischen ideologisch, unflexibel und engstirnig – so wie es einst die Sowjetunion war. Und wie einst Moskau, ist es nun der Westen, vor allem die USA, die im Umgang mit China fundamentale Fehler machen.
Welche Fehler?
China ist den USA inzwischen voraus, weil sich Peking um seine Menschen kümmert. Amerikas Arbeiter sind längst zu einem Meer der Verzweifelten geworden. In der Politik hat man Donald Trump gewählt. Und noch schockierender: Donald Trump könnte bei den nächsten Wahlen wieder kommen. Was muss mit einer Gesellschaft passieren, dass man ernsthaft jemanden wie Donald Trump wählt? Aber Amerikas Selbstbewusstsein scheint das nicht zu beeinträchtigen, denn man denkt noch immer, man sei das Leuchtfeuer der Welt. Das Leuchtfeuer der Welt mit einem Präsidenten wie Donald Trump?
Umso mehr haben sich internationale Politiker darüber gefreut, dass Joe Biden die Wahl gegen Trump gewonnen hat. Aber ihr Urteil über Biden fällt nicht besser aus.
Joe Biden ist natürlich sehr viel besser als Donald Trump. Aber im Umgang mit China hat er rein gar nichts verändert. Im Wahlkampf hatte er Trumps Handelskrieg noch als schädlich für Amerikas Wirtschaft und Arbeiter gebrandmarkt, aber als Präsident hat auch Biden nichts geändert.
Die Volksrepublik ist aus Ihrer Sicht in einem besseren Zustand?
Ja, sie ist erfolgreich, rational, flexibel und zurückhaltend.
Zurückhaltend? Das werden viele Menschen anders sehen, beispielsweise in Hongkong.
Das ist ein kompliziertes Thema. Die Menschen dort haben natürlich das Recht, ihrem Unmut friedlich Ausdruck zu verleihen. Aber im vergangenen Jahr wurden die Proteste gewaltsam. Als die Legislative Assembly angegriffen wurde, jubelte man im Westen, das sei ein Ausdruck von Freiheit. Nur kurz ein Vergleich: Als im Januar 2021 der US-Kongress attackiert wurde, fiel das Urteil deutlich anders aus. In Amerika ist es Vandalismus, in Hongkong ein Akt der Freiheit? Ich bitte Sie, das ist doch Doppelmoral, die hier herrscht. Wenn Menschen das Gesetz brechen, müssen sie dafür bestraft werden. Überall auf der Welt.
Aber die Menschen in Hongkong wurden doch erst gewaltsam, weil sie nicht mehr demonstrieren durften. Es geht ihnen um ihre Rechte.
Nein, das ist Ihre westliche Sichtweise. Und entschuldigen Sie, aber die ist falsch. Es hat sicherlich mehrere Ursachen, aber der Hauptgrund ist die schlechte Lage der Wirtschaft und die angespannte Wohnungssituation. Hier hat Peking tatsächlich einen großen Fehler begangen und sich anfangs auf Hongkongs Immobilien-Tycoone verlassen. Aber sobald sich die soziale Lage in Hongkong wieder bessert, werden auch die Demonstrationen enden.
Noch ein Beispiel für Chinas Zurückhaltung war Pekings Reaktion auf den Friedensnobelpreis für Liu Xiaobo. Damals verhängte man Sanktionen gegen Norwegen – weil dort die Preisverleihung stattfand.
China hat damals nur so schroff reagiert, weil es seine nationalen Interessen attackiert sah.
Genau wie es auch die USA in der internationalen Politik tun. Also doch kein Unterschied?
Eine milde Großmacht gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Großmächte werden immer ihre eigenen Interessen verteidigen. Die Vorstellung, dass eine Großmacht ihre eigenen Interessen opfern werde, um anderen Ländern zu helfen, ist Unsinn. Wenn China also seine Interessen in Gefahr sieht, wird es sehr, sehr stark reagieren. Aber noch ein Gedanke zum Nobelpreis: Deng Xiaoping hat 500 Millionen Menschen aus der Armut gerettet, wohl einer der größten Beiträge zum Frieden und Wohlergehen der Menschen auf der gesamten Welt. Ein wahrer Fall für den Friedensnobelpreis. Aber wenn ihn tatsächlich mal ein Asiate erhält, dann ist es ein Dissident. Das verstehen wir Asiaten nicht. Aus meiner Sicht ist das auch so ein Fall von Doppelmoral.
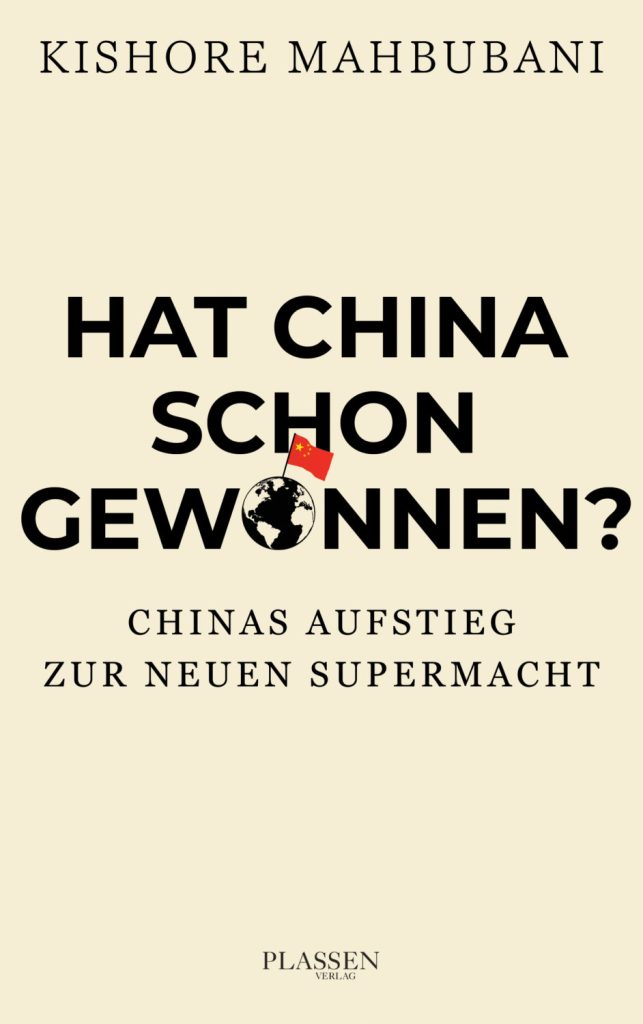
Trump und Biden machen aus Ihrer Sicht viele Fehler. Wie beurteilen Sie Xi Jinping? Einige fühlen sich angesichts seiner Machtfülle schon an Mao Zedong erinnert. Deng Xiaoping wollte so etwas verhindern. Aber die Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten hat Xi längst aufgehoben, übrigens eine Idee von Deng.
Deng hat sich in den 1990er-Jahren zurückgezogen, und das Land war auf einem guten Weg. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er sicherlich wieder eingegriffen. Als Xi Jinping an die Macht kam, standen das Land und die Kommunistische Partei wegen Korruption und innerer Streitigkeiten kurz vor ihrem Ende. Nun kommt auch noch der Konflikt mit den USA hinzu. Kein Land der Welt würde in solch einer Situation seinen Anführer wechseln. Und warum auch? Die Chinesen sind zufrieden mit Xi. Sie wollen einen derart starken Anführer.
Auch unter Joe Biden ist im Konflikt zwischen den USA und China keine Entspannung in Sicht. Steht uns ein neuer Kalter Krieg bevor?
Ich denke, das wäre die falsche Bezeichnung. Damals standen sich zwei isolierte Blöcke gegenüber; heute sind beide Staaten wirtschaftliche eng miteinander verflochten. Interessant ist aber wieder die Veränderung Amerikas: Damals war Washington für freien Handel, heute scheut man Freihandelsabkommen, erhebt Strafzölle und zieht sich aus der Trans-Pazifik-Partnerschaft zurück. Allesamt Fehler.
Also kein neuer Kalter Krieg. Was erleben wir dann?
Es ist ein massiver geopolitischer Wettstreit, aber in einer kleinen, interdependenten Welt, die sich zunehmend auch gemeinsamen, globalen Herausforderungen stellen muss wie der Corona-Pandemie oder dem Klimawandel. Wenn China und die USA das nicht verstehen, werden sie zu zwei Affenstämme, die sich gegenseitig bekämpfen und dabei nicht merken, wie der Wald um sie herum abbrennt. Das wäre katastrophal – für Amerika, für China und für die gesamte Welt.
Eine Welt unter US-Führung ist uns bekannt. Sollte China nun tatsächlich den Wettstreit gewinnen, wie würde die Welt von morgen aussehen?
China wird nicht in die Fußstapfen Amerikas treten, es will nicht die Welt verändern oder gar missionarisch verbessern. China wird sich nicht in unnötigen Kriegen wie im Irak oder Syrien verheddern. Denn China ist mit seinen 1,4 Milliarden Menschen genug beschäftigt. Sein Fokus liegt darauf, dass es seinen eigenen Leuten besser geht.
Was heißt das für den Westen?
Amerika und Europa sollten das aktuelle System stärken, ein System der Regeln. Und sind wir ehrlich: Es sind westliche Regeln. Aber egal. China wird sich an dieses System halten, denn es profitiert davon. China wird nicht das internationale System über den Haufen werfen und mit chinesischen Regeln neu aufbauen. Also nochmals mein klarer Rat: Europa und die USA sollten nicht selbst Axt an das internationale System legen, sich nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil das System mit seinen Regeln stärken. Dann wird auch China als Nummer Eins dieses System akzeptieren.
Ein letztes Wort zu Deutschland. Fast alle Parteien haben Angela Merkels Politik als zu china-freundlich kritisiert und eine härtere Gangart gegenüber Peking angekündigt. Eine gute Entscheidung?
Der größte Fehler in geopolitischen Fragen ist, wenn man emotional wird. Der Westen, wie auch Deutschland, scheint von einer Angst vor der Gelben Gefahr getrieben. Das kommt mir einer westlichen Psychose gleich. Deutschland sollte diesen Fehler nicht begehen. Das Herz neigt zu Amerika, aber die Fakten sagen etwas anders, was für Deutschland gut und wichtig ist. Chinas Markt ist in den vergangenen zehn Jahren um das Dreifache gewachsen. Sie sollten nicht vergessen, wo Sie ihre Autos verkaufen.
Kishore Mahbubani (73) stammt aus Singapur. Von 1971 bis 2004 stand er im diplomatischen Dienst des Stadtstaates und war unter anderem Präsident des Uno-Sicherheitsrates sowie Botschafter in den USA und Malaysia. Seit dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst macht er mit Büchern auf sich aufmerksam, die das Ende der Herrschaft des Westens zum Thema haben. Er hatte eine Professur in Politikwissenschaften an der National University of Singapore.
Die Sozialplattform LinkedIn schaltet ihre chinesischsprachige Seite ab, die seit 2014 als Parallelangebot unter dem Namen Lingying (领英) lief. Der Rückzug von LinkedIn ist der Schlusspunkt einer Entwicklung, die schon seit über einer Dekade andauert. Sie hat mit dem immer dichteren Netz der Zensur zu tun, mit dem die chinesische Regierung ihr Land gegen Informationen aus dem Westen abschottet.
Die großen amerikanischen Tech-Plattformen werden so gezwungen, sich aus China zurückzuziehen. Denn sie können eingeklemmt zwischen den Zensurbeschränkungen aus China und der politischen Kritik zu Hause kein stabiles Geschäftsmodell aufbauen. Denn wenn sie sich der chinesischen Zensur beugen, geraten sie in ihrer Heimat unter Druck. In Extremfällen werden sie auch kurzerhand von Peking geblockt wie Facebook und Twitter seit Juli 2009 im Zusammenhang mit Unruhen in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang. Instagram traf es dann im Jahr 2014.
Google hat 2010 aufgegeben – die Firmengründer waren nicht mehr bereit, bei der Zensur mitzumachen. Die Suchmaschine hat dennoch kürzlich ausgelotet, wie eine Rückkehr auf den Markt doch noch möglich sein könnte. Das Unternehmen hatte dazu das Selbstzensurprojekt Dragonfly ins Leben gerufen. Doch auch das wurde 2019 eingestellt. Er scheiterte an der Kritik innerhalb Googles und vonseiten der amerikanischen Politik. Zuvor hatten Google-Mitarbeiter die Existenz des Projekts durch Indiskretionen verraten.
Selbst die völlig unpolitische Handelsplattform Amazon hat mehr schlecht als recht nur bis 2019 durchgehalten. Die Einschränkungen waren zu stark, als dass man gegen Alibaba & Co wirtschaftlich hätte bestehen können.
Als letzte der großen Plattformen hat nun LinkedIn aufgegeben. Dem Rückzug ging ebenfalls ein Versuch der Selbstzensur voraus (China.Table berichtete). Auf Druck Pekings hat LinkedIn Accounts in China blockiert, auf denen amerikanische Journalisten Artikel posteten, die den Zensoren nicht gepasst haben. LinkedIn hat auch Konten von Akademikern und Menschenrechtsaktivisten für China gesperrt.
LinkedIn möchte sich allerdings noch nicht komplett aus China zurückziehen, sondern mit einer Job-Plattform in China bleiben: Sie soll InJobs heißen. Auf dieser Plattform soll es nicht möglich sein, seine Texte zu posten. Doch auch das kann im Alltag schwierig werden. Was passiert etwa, wenn ein Menschenrechtsaktivist seinen Lebenslauf online stellt, weil er einen Job in der Compliance-Abteilung einer großen internationalen Firma sucht?
Angesichts des Verstummens westlicher Internetplattformen in China mutet die Bewegung in umgekehrter Richtung skurril an: Während Peking die amerikanischen Social-Media-Seiten in China verbietet, haben Staatsmedien wie China Daily und der Staatssender CGTN über 100 Millionen Follower allein auf Facebook.
Eine große Rolle hat LinkedIn in China indessen nie spielen können, mit seinen rund 50 Millionen Usern in einem Land mit 1,41 Milliarden Menschen. In den USA mit rund 330 Millionen Einwohnern hat LinkedIn 180 Millionen User, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Interessant: Auch in Indien, wo LinkedIn nicht zensiert wird, hat das Netzwerk nur 78 Millionen User, was darauf schließen lässt, dass es auch interkulturelle Gründe gibt, statt LinkedIn eine lokale Plattform zu benutzten.
In China löst das Ende von Linkedin daher keinen Aufschrei der Empörung aus, weil die Chinesen sich offenbar längst mit der Entwicklung arrangiert haben. Innerhalb Chinas haben Tencents WeChat und Alibabas Dingtalk die Funktionen von LinkedIn übernommen. Wechat hat 1,2 Milliarden User. Dingtalk immerhin noch knapp die Hälfte. LinkedIn hat weltweit “nur” 750 Millionen User.
International ist es für chinesische Firmenmitarbeiter ohnehin kein Problem, über einen VPN-Kanal auf das Netzwerk zuzugreifen. Ein VPN ist eine Software, die verschleiert, auf welche Seiten ein User zugreift. Dadurch können die Zensur-Algorithmen nicht erkennen, um welche Seite es sich handelt und diese auch nicht blockieren. Die Benutzung eines VPN-Kanals ist zwar offiziell verboten. Dieses Verbot wird allerdings nur in sehr seltenen, aber durchaus auch willkürlichen Ausnahmefällen geahndet.
Im Alltag jedoch hängt jeder in China, der auf internationale Informationen angewiesen ist, über einen VPN an Google, Facebook & Co. Das gilt nicht nur für die Elite des Landes, sondern für die gesamte Mittelschicht. Kaum ein Forschungsprojekt, kaum ein Geschäft, ja selbst die Politik, kommt nicht ohne die ungefilterten Informationen aus amerikanischen sozialen Medien aus. Eine Untersuchung des GobalWebIndex kam 2019 zu dem Ergebnis, dass über 30 Prozent der chinesischen Internetnutzer regelmäßig ein VPN benutzen, um an Informationen zu kommen. Das wären rund 300 Millionen Menschen, also so gut wie die gesamte Mittelschicht. Diese hat in China einen Anteil von rund 25 Prozent der Bevölkerung.
Die Zahl ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass es selbst in Regionen ohne Medienzensur viele VPN-Nutzer gibt: In Nordamerika und Europa benutzen jeweils 17 Prozent der Internetnutzer regelmäßig so einen Dienst, weil sie nicht wollen, dass ihre Netzaktivitäten von Firmen, aber auch vom Staat zurückverfolgt werden können. Auch viele Firmen verlangen von ihren Mitarbeitern, gerade in Zeiten des Homeoffice, nur über firmeneigene VPN-Zugänge ins Internet zu gehen.
In Indien, ein Land ebenfalls ohne Medienzensur, sind es sogar 38 Prozent, also ein größerer Anteil als in China. Der VPN-Markt hatte 2020 ein Volumen von rund 30 Milliarden US-Dollar. Die Forscher von Grand View Research gehen in einer Studie davon aus, dass der Markt bereits 2027 über 90 Milliarden US-Dollar betragen wird.
Weil ein Alltag in China ohne internationale Vernetzung praktisch undenkbar ist, verfolgen die Behörden bisher vor allem Chinesen, die eigene VPNs herstellen und in China verbreiten. In den letzten Jahren sind fast ausschließlich Fälle bekannt geworden, in denen die Behörden gegen chinesische VPN Nutzer vorgehen, die VPNs genutzt haben, um Pornographie zu sammeln oder zu verbreiten. Das offizielle Strafmaß beträgt seit 2019 umgerechnet 145 US-Dollar. Apple musste 2017 alle VPN-Angebote aus seinem iOS App Store nehmen, allerdings kann man die VPNs problemlos bei den Anbietern direkt herunterladen.
Weil man davon ausgehen kann, dass fast alle chinesischen LinkedIn Benutzer über ein VPN verfügen, hat sich also durch den Rückzug von Linkedin für dessen Nutzer im Alltag wenig geändert. Sie müssen nun wie bei Google den VPN anschalten, wenn sie von Wechat auf einer der Internetplattformen wechseln. Und so bleibt der große Trend in China nach dem Rückzug von LinkedIn offensichtlich: Formell wird die Zensur strenger, informell bleibt der Spielraum nach wie vor groß.
Volkswagen hat in den ersten neun Monaten 47.200 E-Autos in China verkauft. Im dritten Quartal 2021 konnten die Verkäufe somit signifikant gesteigert werden, nachdem im ersten Halbjahr nur etwas mehr als 18.000 E-Autos verkauft wurden. Christian Dahlheim, Leiter des Konzernvertriebs: “Wir konnten den Markthochlauf in China im dritten Quartal deutlich beschleunigen und sind auf dem besten Weg, unser Jahresziel von 80.000 bis 100.000 ausgelieferten Fahrzeugen zu erreichen”, sagte Dahlheim. Im September lag VW mit den chinesischen Wettbewerbern Xpeng und Nio nahezu gleichauf. Alle diese Unternehmen konnten um die 10.000 E-Autos verkaufen.
Allerdings ist trotz der Elektro-Erfolge der Großteil der VW-Verkäufe weiterhin im Segment der Verbrenner zu finden. Zwei Volkswagen Joint-Ventures mussten deswegen am meisten “Emissionspunkte” für Autos zukaufen, wie Nikkei Asia berichtet. Autohersteller und -importeure müssen in China einen bestimmten Prozentsatz an Autos mit alternativen Antrieben herstellen oder verkaufen. Wenn sie die letztjährige Quote von zwölf Prozent übersteigen, erhalten sie “Emissionspunkte”. Erreichen sie die E-Auto-Quote nicht, müssen sie Emissionspunkte von anderen Anbietern zukaufen. VW musste dem Medienbericht am meisten Emissionspunkte zukaufen. Bei FAW-Volkswagen belaufen sich die Zukäufe demnach auf circa 400 Millionen Yuan, umgerechnet 53 Millionen Euro. SAIC Volkswagen Automotive muss nach FAW am zweitmeisten Emissionspunkte kaufen. Tesla konnte über das Emissionshandelssystem demnach über 330 Millionen Euro einnehmen. nib
Chinas Präsident Xi Jinping hat in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel auf Differenzen zwischen Brüssel und Peking verwiesen. Xi habe in dem Gespräch betont, dass sich die internationale Lage seit diesem Jahr verändert habe und die Beziehungen zwischen China und Europa vor “neuen Problemen” stehen, berichteten Staatsmedien. “China und Europa unterscheiden sich in ihrer Geschichte, Kultur, sozialen Systemen und Entwicklungsstadien”, so Xi. Es sei nicht verwunderlich, dass es “Konkurrenz und Differenzen” gebe. Xi plädierte für Dialog und Verhandlungen, um diese aufzulösen. Es gebe ein Interesse an engeren Verbindungen zwischen beiden Seiten. Das betreffe unter anderem die Bereiche Klima, Digitalisierung und Konnektivität. Jedoch sei die Souveränität Chinas dabei nicht verhandelbar.
Xi und er hätten sich auf einen EU-China-Gipfel verständigt, teilte Michel auf Twitter mit. Nähere Angaben zu einem Datum für das Treffen machte der EU-Ratspräsident nicht. Trotz Differenzen zwischen der EU und der Volksrepublik bleibe der Dialog von entscheidender Bedeutung, schrieb der Belgier. Neben weiteren internationalen Themen habe er mit Xi auch über die Situation in Afghanistan gesprochen.
Michel betonte gegenüber Xi den Berichten chinesischer Medien zufolge die Einhaltung der Ein-China-Politik der EU bezüglich Taiwan. Das Europaparlament wird in der am Montag beginnenden Plenarwoche über seinen Bericht zu den künftigen EU-Taiwan-Beziehungen abstimmen. Darin fordern die EU-Abgeordneten eine Hochstufung der Verbindungen zu Taipeh und ein Investitionsabkommen mit der Insel (China.Table berichtete).
Beobachter gehen davon aus, dass Peking seine EU-Strategie nach dem Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel neu austariert. Xi hatte in der vergangenen Woche ein “Abschiedsgespräch” mit der scheidenden Bundeskanzlerin geführt (China.Table berichtete). ari
Am Samstag hat ein Langzeitexperiment mit einer Taikonautin und zwei Taikonauten im All begonnen. Die Besatzung hat vom Weltraumhafen Jiuquan abgehoben und ist nur acht Stunden später an der chinesischen Raumstation Tiangong angekommen. Sie sollen für sechs Monate in der Schwerlosigkeit bleiben. Durch engmaschige Überwachung der biologischen Funktionen wollen chinesische Forscher Erkenntnisse über die Folgen langer Missionen sammeln. Die Taikonauten sollen zudem daran arbeiten, Routinen für langfristiges Leben und Arbeiten im All zu sammeln. Mit dabei ist auch Wang Yaping, eine Weltraum-Veteranin. Sie war vor acht Jahren erstmals im All. Sie war damals durch ihre per Video übertragenen Experimente für Kinder international bekannt geworden. fin
Einem Medienbericht zufolge hat Chinas Militär große Fortschritte bei der Entwicklung von Hyperschallraketen gemacht. Wie die Financial Times am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, testete die Armee bereits im August einen neuen Hochgeschwindigkeitsgleitkörper. Dem Bericht zufolge schoss China das atomwaffenfähige Geschoss mit einer Rakete des Typs “Langer Marsch” ins All. Dort umkreiste es die Erde auf einer niedrigen Umlaufbahn, bevor es Kurs auf sein Ziel nahm.
Zwar soll das Geschoss verschiedenen Quellen zufolge sein Ziel um rund 30 Kilometer verfehlt haben. US-Geheimdienste waren von den neuen militärischen Fähigkeiten China dennoch überrascht. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, wollte sich laut Nachrichtenagentur AFP zu den Einzelheiten des Berichts nicht äußern. Zugleich äußerte er seine Besorgnis “über die militärischen Fähigkeiten Chinas”. Dies sei einer der Gründe, “warum wir China als unsere größte Herausforderung betrachten”.
Wie ballistische Raketen können Hyperschallraketen Atomwaffen tragen, zugleich aber mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen. Neben China arbeiten auch die USA, Russland, Nordkorea und mindestens vier weitere Länder an der Hyperschalltechnologie. flee
Im Streit um eine Skulptur zum Gedenken an die Opfer auf dem Pekinger Tiananmen-Platz hat sich eine internationale Anwaltskanzlei von der Universität Hongkong (HKU) abgewandt. “Mayer Brown wird seinen langjährigen Mandanten in dieser Sache nicht mehr vertreten”, erklärte die Kanzlei laut Washington Post.
Die internationale Kanzlei aus Chicago hatte im Namen der Universität die kürzlich aufgelöste Hongkonger Allianz, die jahrelang die traditionellen Tiananmen-Mahnwachen in Hongkong organisiert hatte, zum Entfernen der Skulptur aufgefordert. Die Universitätsleitung setzte eine Frist bis vergangenen Mittwoch. Bislang steht die Skulptur aber noch.
Die etwa acht Meter hohe “Säule der Schande” erinnert an die die gewaltsame Niederschlagung der Demokratieproteste in Peking 1989. Die Skulptur des dänischen Künstlers Jens Galschiot zeigt 50 Menschen mit gequälten Gesichtern. Sie steht seit 1997 auf dem Campus der HKU.
US-Politiker übten scharfe Kritik an Mayer Brown. Senator Lindsey Graham von den Demokraten warf der Kanzlei vor, “auf Geheiß der Kommunistischen Partei die Erinnerung an die mutigen jungen chinesischen Studenten auslöschen, die auf dem Platz des Himmlischen Friedens ihr Leben für die Freiheit geopfert haben”. flee

In gewisser Weise waren es der Dalai Lama und der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy, die Professor Andreas Fuchs dazu brachten, sich mit China zu beschäftigen. Das Treffen des tibetischen Oberhauptes und des damaligen EU-Ratsvorsitzenden im Jahr 2008 sorgten für Dissonanzen zwischen der EU und China. “Die politischen Spannungen waren so präsent, dass Chinesen in meinem Bekanntenkreis in Paris Arbeitsangebote in Frankreich abgelehnt haben und in ihre Heimat zurückgekehrt sind”, sagt Andreas Fuchs rückblickend. “Das war einer der Momente, in dem mir bewusst wurde, dass wir mit China nicht nur eine aufstrebende Weltmacht haben, sondern dass hier politische Beziehungen und Wirtschaft besonders eng verzahnt sind.” Das Interesse war geweckt.
Fasziniert von dem Wechselspiel politischer Spannungen und wirtschaftlicher Auswirkungen hat sich Andreas Fuchs einige Jahre später in seiner Dissertation mit der wachsenden Entwicklungszusammenarbeit Chinas beschäftigt – heute ist der 39-Jährige ein gefragter Forscher auf diesem Gebiet.
Das zeigt sich auch an seiner Professur für Entwicklungsökonomik an der Universität Göttingen, die er seit 2019 innehat. In Göttingen leitet er auch das Centre for Modern East Asian Studies. Denn neben seiner persönlichen Motivation treibt ihn vor allem das fehlende Wissen über China in Deutschland und Europa an: “Die Forschung mit und über China muss unbedingt wachsen“, sagt er. “Wir haben einen Wissensrückstand, obwohl China weltweit und somit auch für Deutschland – politisch wie wirtschaftlich – immer wichtiger wird.”
Fuchs trägt nun dazu bei, diese Lücke zu schließen. Dazu baut er mit dem Institut für Weltwirtschaft die Kiel Institute China Initiative auf, ein Netzwerk aus Expertinnen und Experten, die sich in der Wissenschaft und Politikberatung mit Chinas Volkswirtschaft beschäftigen.
Fuchs schließt die Lücke dabei außerdem vor allem beim Verständnis von Chinas Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2010 erforscht der Volkswirt die grundlegenden Unterschiede zwischen westlicher und chinesischer Entwicklungszusammenarbeit und versucht die Motive der Führung in Peking zu verstehen, Entwicklungsprojekte zu etablieren – denn Chinas Einfluss wächst. Doch die Herangehensweise der Chinesen ist weniger humanitär und demokratisch als westliche Entwicklungszusammenarbeit.
Recht eindeutig zeigt sich in der Forschung: Vor allem wirtschaftliche und machtpolitische Interessen sind für China entscheidend. “In westlichen Kreisen wird dann schnell der Finger gehoben nach dem Motto: Haben wir’s doch geahnt”, sagt Fuchs. “Dabei sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass auch bei westlichen Entwicklungsprojekten Eigeninteressen einen großen Einfluss haben.”
Ein bedeutsamer Unterschied zur westlichen Hilfe? “China folgt in den meisten Projekten dem Prinzip der Nichteinmischung, gibt also nicht vor, wie etwa die Gelder von den Staaten genutzt werden”, sagt Fuchs. Das führe dazu, dass in Afrika etwa mehr Entwicklungsprojekte in bereits vergleichsweise wohlhabenden Gebieten entstehen, weil zum Beispiel viele Staatsoberhäupter das Geld in ihre Geburtsregionen lenken und nicht bedürfnisorientiert vorgehen. “Aus westlichen Sicht auf Entwicklungszusammenarbeit ist das problematisch.” So lasse sich die Schere zwischen Arm und Reich nicht schließen.
Dennoch zeigt sich, dass das Wirtschaftswachstum in den von China unterstützen Regionen ansteige. “In den kommenden Jahren wird es für Deutschland und Europa deshalb wichtig sein zu verstehen, ob und wie sich die Einstellung der Menschen in den unterstützen Ländern gegenüber China und Werten wie Demokratie und Marktwirtschaft verändern”, sagt Fuchs. “Unsere ersten Forschungen in Lateinamerika zeigen: China polarisiert.” Einige Menschen entwickeln eine sehr positive Einstellung, andere eine sehr negative gegenüber China.
Der Dalai Lama hat Fuchs übrigens nicht nur zum China-Interesse motiviert. Er hat es sogar in seine Forschung geschafft: 2013 zeigten Fuchs und sein Team, dass Länder, die den Dalai Lama empfangen, tatsächlich schlechtere wirtschaftliche Beziehungen zu China haben – der “Dalai-Lama-Effekt” war geboren. Leon Kirschgens
Zeng Yi wird zum Hauptgeschäftsführer der China Electronics Corporation (CEC), einem Staatsbetrieb mit enger Bindung ans Militär. Der 56-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in Chinas Rüstungsindustrie.
Amy Shang stößt zur Kundenbetreuung bei der Geldanlagefirma Grantham, Mayo, Van Otterloo (GMO) mit Zuständigkeit für den chinesischen Markt. Shang zieht dafür von Hongkong nach Singapur um.
Toby Chan wird in Hongkong Chefin der Abteilung für Kundenbeziehungen bei dem Vermögensverwalter Capital Group. Sie hat zuvor bei dem Bankhaus HSBC gearbeitet.
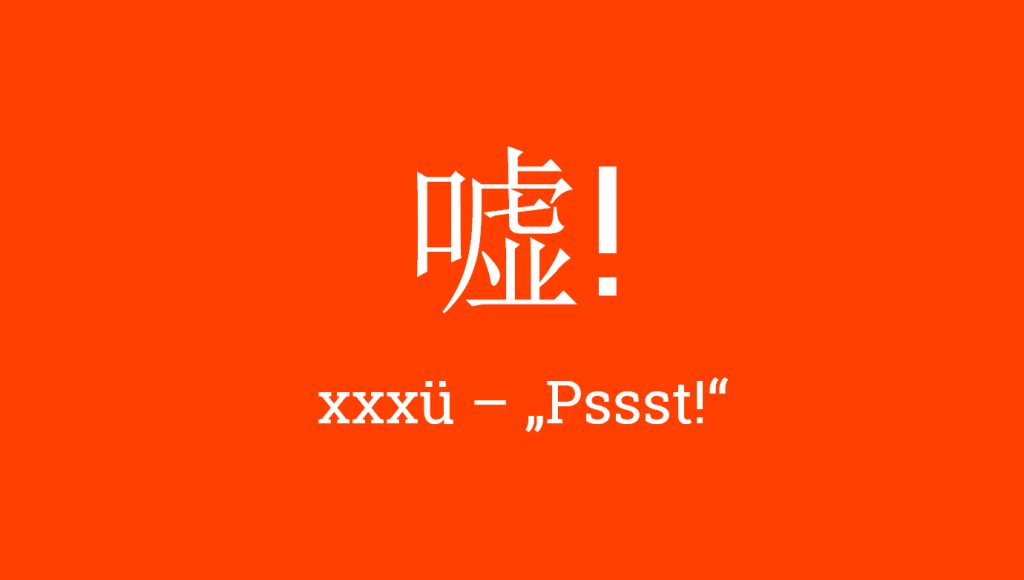
Pssst! Sagen Sie es bitte nicht weiter, aber im Chinesischen sagt man gar nicht “pst!”. Unliebsames Gemurmel im Kino, quatschende Kommilitonen auf der Hinterbank, quäkende Kulturbanausen in der Kunstausstellung – darauf folgt in China ein energisches “Xxxu!” – gesprochen mit kräftigem Reibelaut wie im deutschen “(i)ch” und mit ordentlicher Lippenrundung, so als wolle man ein “ü” sprechen. (Kurze Lesepause an dieser Stelle, Sie probieren sicher gerade aus.)
Für den chinesischen “Pst-Laut” gibt es mit 嘘 sogar ein eigenes Schriftzeichen! Und das ist nicht das einzige “Ausrufezeichen” im Chinesischen. So gut wie alle verbalisierten Gefühlsregungen (von Grammatikliebhabern gerne auch als Interjektionen bezeichnet), die man mit dem chinesischen Lautrepertoire so ausstoßen kann, lassen sich tatsächlich mit speziellen “Hanzi” abbilden. Meistens enthalten sie den Mundradikal 口 auf der linken Seite. Man trifft sie zwar selten in formellen schriftlichen Dokumenten, Sachbüchern oder Zeitungstexten, dafür aber umso häufiger in Filmuntertiteln, Songtexten, informeller Literatur und natürlich Textnachrichten, Onlineposts und Social-Media-Kommentaren.
Hier eine kleine “Ausrufezeichen”-Kunde für Einsteiger: Es gibt zum Beispiel ein eigenes Schriftzeichen für ein erstauntes, entzücktes oder erschrecktes “Ah!” (啊 ā, á, ǎ, à – je nach Situationsbedarf einfach in unterschiedlichen Tonlagen aussprechen!). Und ein Zeichen für ein locker zugerufenes “Hey!” (嘿 hei! – wie in “Hey, komm mal her!” 嘿,你过来一下!Hēi! Nǐ guòlái yīxià!). Man findet auch ein Hanzi für alle möglichen “Oh”-Varianten (哦 o! – vielfältig einsetzbar von freudiger Erregung, über Erstaunen und Zweifel bis hin zu resignierter Hinnahme – bitte auch hier den Ton entsprechend anpassen: ó, ò, o …), sowie ein eigenes Zeichen für freudiges (oder leicht hämisches?) Feierabendträllern (啦啦啦 lalala). Die Zeichenkombi für die schluchzenden (da Überstunden schiebenden) Kollegen kommt hier: 呜呼呼 wūhūhū. In China kennt man sogar eine Verschriftlichung für den entrüsteten Tzz!-Schnalzlaut, den man Dränglern, Anremplern und Fußtramplern in der überfüllten chinesischen Rushhour-U-Bahn gerne zuraunt (啧 – das Lautzeichen für ein Schnalzen).
Mit den chinesischen Interjektionszeichen für Lachlaute ließe sich gar ein interkultureller Lachleitfaden lancieren: Die Lachlatte reicht vom bekannten Basislaut 哈 hā (gerne auch in Mehrfachausführung: 哈哈哈,真可笑!Hāhāhā, zhēn kěxiào! – “Hahaha, wirklich lustig!”) über verschämtes (嘻嘻 xīxī “hihi”) oder verschwörerisches (嘿嘿 hēihēi “hehe”) Kichern bis hin zu leicht eingeschnapptem Feixen (呵呵 hēhē – “höhö, hähä”). Nicht zu vergessen als Lachgipfel natürlich das unverhohlene Allmachtsfantasie-Prusten (哇哈哈wāhāhā, oder wahlweise auch 呜哈哈 wūhāhā).
Für andere chinesische Interjektionen braucht man fast schon einen kleinen Kulturknigge, damit man sie zweifelsfrei zuordnen und richtig anwenden kann: Zum Beispiel für den chinesischen “Wow”-Laut – der lautet nämlich traditionell 哇 wā oder 哇塞 wāsài (哇!很漂亮! Wā! Hěn piàoliang! – “Wow! So hübsch!”). Besonders cool krakeelt man ihn heute neuerdings auch als Anglizismus: 哇喔 wā-ō! (genau: “Wow!”).
“Hä?” wie in “Hä? Wieso druckt das nicht?” heißt auf Chinesisch咦 yí (ein Laut zum Ausdruck von Überraschung). Nicht verwechseln bitte mit unserem “Iiii!” wie in “Igitt” (das heißt auf Chinesisch 额 é). Und wer in China vom Panda gekratzt wird, sagt authentischer Weise nicht “aua!” sondern 哎哟 “āiyō!”.
Zum Abschluss noch der Klassiker unter den Kulturschocklauten bei ersten Telefonkontakten nach China. Anrufe beantwortet man in China nämlich nicht mit “Hallo?”, sondern mit einem lässigen 喂 (wéi?). Wā-ō! Oder? Frohes Ausprobieren beim nächsten Telefonat!
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.
Microsoft schließt den chinesischen Ableger des Berufsnetzes LinkedIn. Eine Reaktion auf ein unerträgliches Maß an Zensur? Jein. Hauptgrund für die Schließung war mangelnder Erfolg des Netzwerks. Unser Autor Frank Sieren erläutert, warum sich damit weder für China noch für Microsoft viel ändert: Chinesische Nutzer verwenden am liebsten einheimische Plattformen. Expats und andere Ausländer wiederum verwenden meist die LinkedIn-Seiten ihrer Heimatländer. Frank Sieren ist selbst Power-User von LinkedIn – und auch er verwendet in China die internationale Version, nicht die chinesische.
Kishore Mahbubani ist einer der angesehensten Diplomaten Asiens. Er war für Singapur Botschafter in den USA und bei der Uno. Zwischenzeitlich ging er unter die Wissenschaftler und lehrte an der National Universiy of Singapore. In allen diesen Rollen pflegte er eine Asien-zentrische Sicht auf die Welt. Im Interview mit dem China.Table provoziert er nun mit der These, dass China genau die Freiheiten hat, die es haben möchte und braucht. Mahbubani vergleicht zudem die Erstürmung des Hongkonger Parlaments durch die dortigen Demokratie-Anhänger mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington durch Trump-Anhänger – beides seien Gesetzesverstöße, beides werde zu Recht bestraft. Auf abstrakter Ebene ist das völlig richtig, wird aber zu einigem Stirnrunzeln führen.
Weniger kontrovers ist dagegen Mahbubanis Diagnose: Die USA befinden sich in erbärmlichem Zustand, haben ihren globalen Führungsanspruch eigentlich schon verspielt – und ein deutlich rationaleres und besser organisiertes China steht bereit, in die Lücke vorzustoßen. Der Führungsstil wird jedoch ein anderer sein: “China will nicht die Welt verändern oder gar missionarisch verbessern. China wird sich nicht in unnötigen Kriegen wie im Irak oder Syrien verheddern.”
Einen produktiven Start in die Woche wünscht

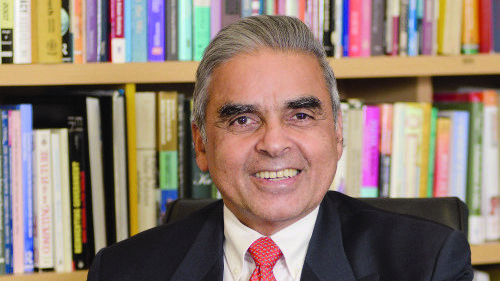
Herr Kishore Mahbubani, Ihr aktuelles Buch “Hat China schon gewonnen? – Chinas Aufstieg zur neuen Supermacht” ist gerade auf Deutsch erschienen. Ein sehr spannendes Buch, in dem Sie viele Annahmen des Westens herausfordern. Wir wollen mit Ihnen über den globalen Konflikt zwischen China und den USA reden. Hat China denn schon gewonnen?
Momentan werden viele Menschen denken: Ja. Doch soweit ist es nicht. Noch nicht. Aber sollten die Vereinigten Staaten so weitermachen wie bisher – ohne eine umfassende Strategie gegenüber China – dann werden sie tatsächlich verlieren.
Für viele ist das eine beängstige Vorhersage, denn im Westen hat man ein klares Bild der Auseinandersetzung: Hier die USA, eine Demokratie, ein Verbündeter, für manche sogar ein Freund. Dort China, böse, herausfordernd und gefährlich.
Ja, mag sein. Nur stimmt das so nicht. China ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt. Die meiste Zeit ihrer 4000 Jahre langen Geschichte war sie führend in der Welt. Nun hatten die Chinesen 200 schlechte Jahre – und der Westen war sehr erfolgreich. Aber nur wegen dieser kurzen Zeit denkt der Westen nun allen Ernstes, dass sich China nun wie der Westen entwickeln müsse? Eine Kopie des Westens werden – das ist ein Trugschluss. Die chinesische Zivilisation ist stärker und selbstbewusster als der Westen. Die Chinesen sehen gar keinen Grund, so zu werden wie der Westen. Das müssen Sie im Westen dringend verstehen.
China muss ja keine Kopie des Westens werden. Aber sollten universelle Rechte und Werte nicht überall auf der Welt gelten?
Ach ja, jetzt sprechen Sie wieder von Demokratie. Ja, Demokratie hat im Westen gut funktioniert. Aber in China weiß man aus der eigenen Geschichte, dass ohne eine starke Zentralregierung die Menschen unendlich leiden. Ohnehin, als China schwach war, hat der Westen kein Interesse gezeigt, dem Land Demokratie zu bringen. Im Gegenteil: Der Westen hat auf China herumgetrampelt und die Schwäche Chinas gnadenlos ausgenutzt. Und jetzt, da China zu alter Stärke zurückfindet, fällt dem Westen plötzlich ein: Ach, warum willst Du nicht so werden wie wir. Ist das ihr Ernst?
Das klingt sehr nach einer chinesischen Revanche.
Nein, überhaupt nicht. Die Chinesen haben kein Bedürfnis nach Revanche. Aber sie sind überrascht darüber, dass der Westen meint, besser zu wissen, was gut für Chinesen ist als die Chinesen selbst. Das ist sehr arrogant. Der Westen meint, alles was der Westen macht, sei richtig, und alles was China macht, sei falsch.
Was denken dann die Chinesen über ihre Situation?
Die Lebensumstände der Chinesen haben sich so stark verbessert wie in den ganzen 4000 Jahren zuvor nicht. Und genau in dem Moment, in dem die Chinesen wieder glücklich sind, kommt der Westen und sagt: So kann es nicht weitergehen.
Sie denken noch immer an den Punkt Demokratie und westliche Regierungssystem. Aber das meine ich nicht. Ich denke an Werte. Was wäre so falsch daran, den Chinesen universelle Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit zu ermöglichen?
Tja, die USA gelten ja als Ort der größten Meinungsfreiheit. Aber wenn ein Politiker aufsteht und sagt: Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass unser Land eventuell nicht länger die Nummer Eins in der Welt sein wird, dann ist er politisch tot – im Land der freien Rede. Was ich damit sagen will: Jede Gesellschaft muss für sich eine Balance finden zwischen Freiheit und Auflagen.
Ein sehr abstrakter Vergleich.
Natürlich gibt es in China nicht die gleichen Freiheiten wie in westlichen Gesellschaften. Aber sie müssen das in der Perspektive betrachten. In den vergangenen 150 Jahren sind die Chinesen durch die Hölle gegangen. Die Mehrheit hatte nichts zu essen. 80 Prozent lebten in bitterer Armut. Sie konnten nicht auswählen, wo sie leben, wo sie arbeiten, was sie studieren, nicht mal was sie anziehen. Alle trugen Mao-Anzüge. Heute ist China völlig anders.
Und alles ist toll: Kein Zwang, keine Unterdrückung, nur Freude?
Ich nenne ihnen eine andere Tatsache, die meinen Punkt verdeutlicht. Die Sowjetunion hatte ihren Bürger nicht erlaubt, ins Ausland zu reisen, weil sie alle abgehauen wären vor Angst, Armut und Unterdrückung. 2019 sind 139 Millionen Chinesen ins Ausland gereist. Das ist fast zweimal die gesamte Bundesrepublik. Und wissen Sie was? Alle sind zurück nach China gekommen. Wenn die chinesische Regierung die Menschen derart unterdrücken würde, wäre das wohl nicht passiert. Sie kommen zurück, weil sie ihr Leben und ihre Freiheiten in China genießen.
Die Sowjetunion stand auch im Konflikt mit den USA, nun ist Amerikas großer Rivale China. Sie sagen, im aktuellen Konflikt ist Amerika längst zur Sowjetunion geworden. Was meinen Sie damit?
Die USA sind inzwischen ideologisch, unflexibel und engstirnig – so wie es einst die Sowjetunion war. Und wie einst Moskau, ist es nun der Westen, vor allem die USA, die im Umgang mit China fundamentale Fehler machen.
Welche Fehler?
China ist den USA inzwischen voraus, weil sich Peking um seine Menschen kümmert. Amerikas Arbeiter sind längst zu einem Meer der Verzweifelten geworden. In der Politik hat man Donald Trump gewählt. Und noch schockierender: Donald Trump könnte bei den nächsten Wahlen wieder kommen. Was muss mit einer Gesellschaft passieren, dass man ernsthaft jemanden wie Donald Trump wählt? Aber Amerikas Selbstbewusstsein scheint das nicht zu beeinträchtigen, denn man denkt noch immer, man sei das Leuchtfeuer der Welt. Das Leuchtfeuer der Welt mit einem Präsidenten wie Donald Trump?
Umso mehr haben sich internationale Politiker darüber gefreut, dass Joe Biden die Wahl gegen Trump gewonnen hat. Aber ihr Urteil über Biden fällt nicht besser aus.
Joe Biden ist natürlich sehr viel besser als Donald Trump. Aber im Umgang mit China hat er rein gar nichts verändert. Im Wahlkampf hatte er Trumps Handelskrieg noch als schädlich für Amerikas Wirtschaft und Arbeiter gebrandmarkt, aber als Präsident hat auch Biden nichts geändert.
Die Volksrepublik ist aus Ihrer Sicht in einem besseren Zustand?
Ja, sie ist erfolgreich, rational, flexibel und zurückhaltend.
Zurückhaltend? Das werden viele Menschen anders sehen, beispielsweise in Hongkong.
Das ist ein kompliziertes Thema. Die Menschen dort haben natürlich das Recht, ihrem Unmut friedlich Ausdruck zu verleihen. Aber im vergangenen Jahr wurden die Proteste gewaltsam. Als die Legislative Assembly angegriffen wurde, jubelte man im Westen, das sei ein Ausdruck von Freiheit. Nur kurz ein Vergleich: Als im Januar 2021 der US-Kongress attackiert wurde, fiel das Urteil deutlich anders aus. In Amerika ist es Vandalismus, in Hongkong ein Akt der Freiheit? Ich bitte Sie, das ist doch Doppelmoral, die hier herrscht. Wenn Menschen das Gesetz brechen, müssen sie dafür bestraft werden. Überall auf der Welt.
Aber die Menschen in Hongkong wurden doch erst gewaltsam, weil sie nicht mehr demonstrieren durften. Es geht ihnen um ihre Rechte.
Nein, das ist Ihre westliche Sichtweise. Und entschuldigen Sie, aber die ist falsch. Es hat sicherlich mehrere Ursachen, aber der Hauptgrund ist die schlechte Lage der Wirtschaft und die angespannte Wohnungssituation. Hier hat Peking tatsächlich einen großen Fehler begangen und sich anfangs auf Hongkongs Immobilien-Tycoone verlassen. Aber sobald sich die soziale Lage in Hongkong wieder bessert, werden auch die Demonstrationen enden.
Noch ein Beispiel für Chinas Zurückhaltung war Pekings Reaktion auf den Friedensnobelpreis für Liu Xiaobo. Damals verhängte man Sanktionen gegen Norwegen – weil dort die Preisverleihung stattfand.
China hat damals nur so schroff reagiert, weil es seine nationalen Interessen attackiert sah.
Genau wie es auch die USA in der internationalen Politik tun. Also doch kein Unterschied?
Eine milde Großmacht gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Großmächte werden immer ihre eigenen Interessen verteidigen. Die Vorstellung, dass eine Großmacht ihre eigenen Interessen opfern werde, um anderen Ländern zu helfen, ist Unsinn. Wenn China also seine Interessen in Gefahr sieht, wird es sehr, sehr stark reagieren. Aber noch ein Gedanke zum Nobelpreis: Deng Xiaoping hat 500 Millionen Menschen aus der Armut gerettet, wohl einer der größten Beiträge zum Frieden und Wohlergehen der Menschen auf der gesamten Welt. Ein wahrer Fall für den Friedensnobelpreis. Aber wenn ihn tatsächlich mal ein Asiate erhält, dann ist es ein Dissident. Das verstehen wir Asiaten nicht. Aus meiner Sicht ist das auch so ein Fall von Doppelmoral.
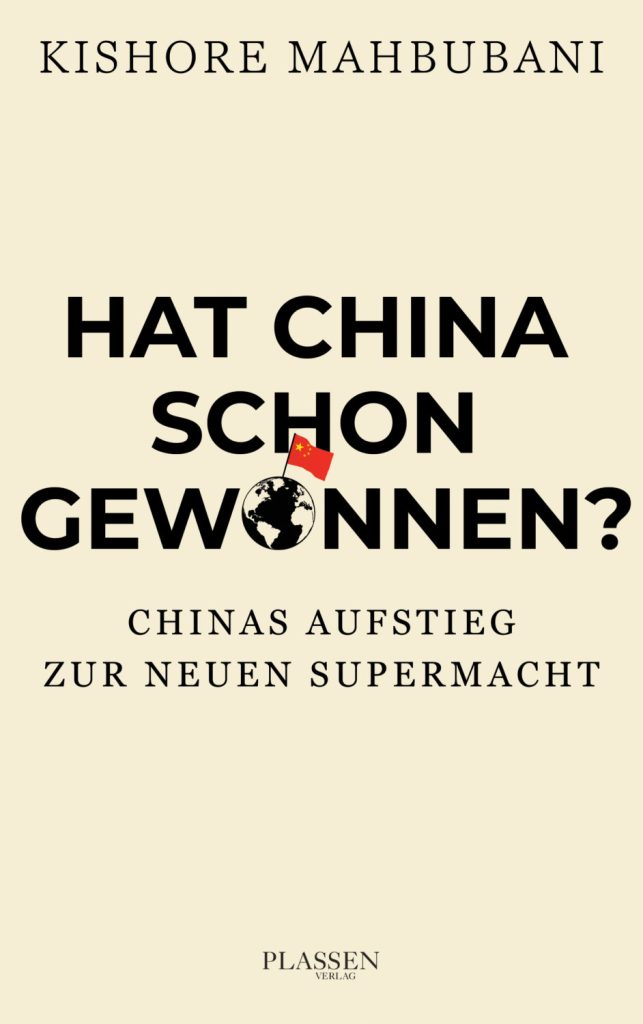
Trump und Biden machen aus Ihrer Sicht viele Fehler. Wie beurteilen Sie Xi Jinping? Einige fühlen sich angesichts seiner Machtfülle schon an Mao Zedong erinnert. Deng Xiaoping wollte so etwas verhindern. Aber die Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten hat Xi längst aufgehoben, übrigens eine Idee von Deng.
Deng hat sich in den 1990er-Jahren zurückgezogen, und das Land war auf einem guten Weg. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er sicherlich wieder eingegriffen. Als Xi Jinping an die Macht kam, standen das Land und die Kommunistische Partei wegen Korruption und innerer Streitigkeiten kurz vor ihrem Ende. Nun kommt auch noch der Konflikt mit den USA hinzu. Kein Land der Welt würde in solch einer Situation seinen Anführer wechseln. Und warum auch? Die Chinesen sind zufrieden mit Xi. Sie wollen einen derart starken Anführer.
Auch unter Joe Biden ist im Konflikt zwischen den USA und China keine Entspannung in Sicht. Steht uns ein neuer Kalter Krieg bevor?
Ich denke, das wäre die falsche Bezeichnung. Damals standen sich zwei isolierte Blöcke gegenüber; heute sind beide Staaten wirtschaftliche eng miteinander verflochten. Interessant ist aber wieder die Veränderung Amerikas: Damals war Washington für freien Handel, heute scheut man Freihandelsabkommen, erhebt Strafzölle und zieht sich aus der Trans-Pazifik-Partnerschaft zurück. Allesamt Fehler.
Also kein neuer Kalter Krieg. Was erleben wir dann?
Es ist ein massiver geopolitischer Wettstreit, aber in einer kleinen, interdependenten Welt, die sich zunehmend auch gemeinsamen, globalen Herausforderungen stellen muss wie der Corona-Pandemie oder dem Klimawandel. Wenn China und die USA das nicht verstehen, werden sie zu zwei Affenstämme, die sich gegenseitig bekämpfen und dabei nicht merken, wie der Wald um sie herum abbrennt. Das wäre katastrophal – für Amerika, für China und für die gesamte Welt.
Eine Welt unter US-Führung ist uns bekannt. Sollte China nun tatsächlich den Wettstreit gewinnen, wie würde die Welt von morgen aussehen?
China wird nicht in die Fußstapfen Amerikas treten, es will nicht die Welt verändern oder gar missionarisch verbessern. China wird sich nicht in unnötigen Kriegen wie im Irak oder Syrien verheddern. Denn China ist mit seinen 1,4 Milliarden Menschen genug beschäftigt. Sein Fokus liegt darauf, dass es seinen eigenen Leuten besser geht.
Was heißt das für den Westen?
Amerika und Europa sollten das aktuelle System stärken, ein System der Regeln. Und sind wir ehrlich: Es sind westliche Regeln. Aber egal. China wird sich an dieses System halten, denn es profitiert davon. China wird nicht das internationale System über den Haufen werfen und mit chinesischen Regeln neu aufbauen. Also nochmals mein klarer Rat: Europa und die USA sollten nicht selbst Axt an das internationale System legen, sich nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil das System mit seinen Regeln stärken. Dann wird auch China als Nummer Eins dieses System akzeptieren.
Ein letztes Wort zu Deutschland. Fast alle Parteien haben Angela Merkels Politik als zu china-freundlich kritisiert und eine härtere Gangart gegenüber Peking angekündigt. Eine gute Entscheidung?
Der größte Fehler in geopolitischen Fragen ist, wenn man emotional wird. Der Westen, wie auch Deutschland, scheint von einer Angst vor der Gelben Gefahr getrieben. Das kommt mir einer westlichen Psychose gleich. Deutschland sollte diesen Fehler nicht begehen. Das Herz neigt zu Amerika, aber die Fakten sagen etwas anders, was für Deutschland gut und wichtig ist. Chinas Markt ist in den vergangenen zehn Jahren um das Dreifache gewachsen. Sie sollten nicht vergessen, wo Sie ihre Autos verkaufen.
Kishore Mahbubani (73) stammt aus Singapur. Von 1971 bis 2004 stand er im diplomatischen Dienst des Stadtstaates und war unter anderem Präsident des Uno-Sicherheitsrates sowie Botschafter in den USA und Malaysia. Seit dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst macht er mit Büchern auf sich aufmerksam, die das Ende der Herrschaft des Westens zum Thema haben. Er hatte eine Professur in Politikwissenschaften an der National University of Singapore.
Die Sozialplattform LinkedIn schaltet ihre chinesischsprachige Seite ab, die seit 2014 als Parallelangebot unter dem Namen Lingying (领英) lief. Der Rückzug von LinkedIn ist der Schlusspunkt einer Entwicklung, die schon seit über einer Dekade andauert. Sie hat mit dem immer dichteren Netz der Zensur zu tun, mit dem die chinesische Regierung ihr Land gegen Informationen aus dem Westen abschottet.
Die großen amerikanischen Tech-Plattformen werden so gezwungen, sich aus China zurückzuziehen. Denn sie können eingeklemmt zwischen den Zensurbeschränkungen aus China und der politischen Kritik zu Hause kein stabiles Geschäftsmodell aufbauen. Denn wenn sie sich der chinesischen Zensur beugen, geraten sie in ihrer Heimat unter Druck. In Extremfällen werden sie auch kurzerhand von Peking geblockt wie Facebook und Twitter seit Juli 2009 im Zusammenhang mit Unruhen in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang. Instagram traf es dann im Jahr 2014.
Google hat 2010 aufgegeben – die Firmengründer waren nicht mehr bereit, bei der Zensur mitzumachen. Die Suchmaschine hat dennoch kürzlich ausgelotet, wie eine Rückkehr auf den Markt doch noch möglich sein könnte. Das Unternehmen hatte dazu das Selbstzensurprojekt Dragonfly ins Leben gerufen. Doch auch das wurde 2019 eingestellt. Er scheiterte an der Kritik innerhalb Googles und vonseiten der amerikanischen Politik. Zuvor hatten Google-Mitarbeiter die Existenz des Projekts durch Indiskretionen verraten.
Selbst die völlig unpolitische Handelsplattform Amazon hat mehr schlecht als recht nur bis 2019 durchgehalten. Die Einschränkungen waren zu stark, als dass man gegen Alibaba & Co wirtschaftlich hätte bestehen können.
Als letzte der großen Plattformen hat nun LinkedIn aufgegeben. Dem Rückzug ging ebenfalls ein Versuch der Selbstzensur voraus (China.Table berichtete). Auf Druck Pekings hat LinkedIn Accounts in China blockiert, auf denen amerikanische Journalisten Artikel posteten, die den Zensoren nicht gepasst haben. LinkedIn hat auch Konten von Akademikern und Menschenrechtsaktivisten für China gesperrt.
LinkedIn möchte sich allerdings noch nicht komplett aus China zurückziehen, sondern mit einer Job-Plattform in China bleiben: Sie soll InJobs heißen. Auf dieser Plattform soll es nicht möglich sein, seine Texte zu posten. Doch auch das kann im Alltag schwierig werden. Was passiert etwa, wenn ein Menschenrechtsaktivist seinen Lebenslauf online stellt, weil er einen Job in der Compliance-Abteilung einer großen internationalen Firma sucht?
Angesichts des Verstummens westlicher Internetplattformen in China mutet die Bewegung in umgekehrter Richtung skurril an: Während Peking die amerikanischen Social-Media-Seiten in China verbietet, haben Staatsmedien wie China Daily und der Staatssender CGTN über 100 Millionen Follower allein auf Facebook.
Eine große Rolle hat LinkedIn in China indessen nie spielen können, mit seinen rund 50 Millionen Usern in einem Land mit 1,41 Milliarden Menschen. In den USA mit rund 330 Millionen Einwohnern hat LinkedIn 180 Millionen User, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Interessant: Auch in Indien, wo LinkedIn nicht zensiert wird, hat das Netzwerk nur 78 Millionen User, was darauf schließen lässt, dass es auch interkulturelle Gründe gibt, statt LinkedIn eine lokale Plattform zu benutzten.
In China löst das Ende von Linkedin daher keinen Aufschrei der Empörung aus, weil die Chinesen sich offenbar längst mit der Entwicklung arrangiert haben. Innerhalb Chinas haben Tencents WeChat und Alibabas Dingtalk die Funktionen von LinkedIn übernommen. Wechat hat 1,2 Milliarden User. Dingtalk immerhin noch knapp die Hälfte. LinkedIn hat weltweit “nur” 750 Millionen User.
International ist es für chinesische Firmenmitarbeiter ohnehin kein Problem, über einen VPN-Kanal auf das Netzwerk zuzugreifen. Ein VPN ist eine Software, die verschleiert, auf welche Seiten ein User zugreift. Dadurch können die Zensur-Algorithmen nicht erkennen, um welche Seite es sich handelt und diese auch nicht blockieren. Die Benutzung eines VPN-Kanals ist zwar offiziell verboten. Dieses Verbot wird allerdings nur in sehr seltenen, aber durchaus auch willkürlichen Ausnahmefällen geahndet.
Im Alltag jedoch hängt jeder in China, der auf internationale Informationen angewiesen ist, über einen VPN an Google, Facebook & Co. Das gilt nicht nur für die Elite des Landes, sondern für die gesamte Mittelschicht. Kaum ein Forschungsprojekt, kaum ein Geschäft, ja selbst die Politik, kommt nicht ohne die ungefilterten Informationen aus amerikanischen sozialen Medien aus. Eine Untersuchung des GobalWebIndex kam 2019 zu dem Ergebnis, dass über 30 Prozent der chinesischen Internetnutzer regelmäßig ein VPN benutzen, um an Informationen zu kommen. Das wären rund 300 Millionen Menschen, also so gut wie die gesamte Mittelschicht. Diese hat in China einen Anteil von rund 25 Prozent der Bevölkerung.
Die Zahl ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass es selbst in Regionen ohne Medienzensur viele VPN-Nutzer gibt: In Nordamerika und Europa benutzen jeweils 17 Prozent der Internetnutzer regelmäßig so einen Dienst, weil sie nicht wollen, dass ihre Netzaktivitäten von Firmen, aber auch vom Staat zurückverfolgt werden können. Auch viele Firmen verlangen von ihren Mitarbeitern, gerade in Zeiten des Homeoffice, nur über firmeneigene VPN-Zugänge ins Internet zu gehen.
In Indien, ein Land ebenfalls ohne Medienzensur, sind es sogar 38 Prozent, also ein größerer Anteil als in China. Der VPN-Markt hatte 2020 ein Volumen von rund 30 Milliarden US-Dollar. Die Forscher von Grand View Research gehen in einer Studie davon aus, dass der Markt bereits 2027 über 90 Milliarden US-Dollar betragen wird.
Weil ein Alltag in China ohne internationale Vernetzung praktisch undenkbar ist, verfolgen die Behörden bisher vor allem Chinesen, die eigene VPNs herstellen und in China verbreiten. In den letzten Jahren sind fast ausschließlich Fälle bekannt geworden, in denen die Behörden gegen chinesische VPN Nutzer vorgehen, die VPNs genutzt haben, um Pornographie zu sammeln oder zu verbreiten. Das offizielle Strafmaß beträgt seit 2019 umgerechnet 145 US-Dollar. Apple musste 2017 alle VPN-Angebote aus seinem iOS App Store nehmen, allerdings kann man die VPNs problemlos bei den Anbietern direkt herunterladen.
Weil man davon ausgehen kann, dass fast alle chinesischen LinkedIn Benutzer über ein VPN verfügen, hat sich also durch den Rückzug von Linkedin für dessen Nutzer im Alltag wenig geändert. Sie müssen nun wie bei Google den VPN anschalten, wenn sie von Wechat auf einer der Internetplattformen wechseln. Und so bleibt der große Trend in China nach dem Rückzug von LinkedIn offensichtlich: Formell wird die Zensur strenger, informell bleibt der Spielraum nach wie vor groß.
Volkswagen hat in den ersten neun Monaten 47.200 E-Autos in China verkauft. Im dritten Quartal 2021 konnten die Verkäufe somit signifikant gesteigert werden, nachdem im ersten Halbjahr nur etwas mehr als 18.000 E-Autos verkauft wurden. Christian Dahlheim, Leiter des Konzernvertriebs: “Wir konnten den Markthochlauf in China im dritten Quartal deutlich beschleunigen und sind auf dem besten Weg, unser Jahresziel von 80.000 bis 100.000 ausgelieferten Fahrzeugen zu erreichen”, sagte Dahlheim. Im September lag VW mit den chinesischen Wettbewerbern Xpeng und Nio nahezu gleichauf. Alle diese Unternehmen konnten um die 10.000 E-Autos verkaufen.
Allerdings ist trotz der Elektro-Erfolge der Großteil der VW-Verkäufe weiterhin im Segment der Verbrenner zu finden. Zwei Volkswagen Joint-Ventures mussten deswegen am meisten “Emissionspunkte” für Autos zukaufen, wie Nikkei Asia berichtet. Autohersteller und -importeure müssen in China einen bestimmten Prozentsatz an Autos mit alternativen Antrieben herstellen oder verkaufen. Wenn sie die letztjährige Quote von zwölf Prozent übersteigen, erhalten sie “Emissionspunkte”. Erreichen sie die E-Auto-Quote nicht, müssen sie Emissionspunkte von anderen Anbietern zukaufen. VW musste dem Medienbericht am meisten Emissionspunkte zukaufen. Bei FAW-Volkswagen belaufen sich die Zukäufe demnach auf circa 400 Millionen Yuan, umgerechnet 53 Millionen Euro. SAIC Volkswagen Automotive muss nach FAW am zweitmeisten Emissionspunkte kaufen. Tesla konnte über das Emissionshandelssystem demnach über 330 Millionen Euro einnehmen. nib
Chinas Präsident Xi Jinping hat in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel auf Differenzen zwischen Brüssel und Peking verwiesen. Xi habe in dem Gespräch betont, dass sich die internationale Lage seit diesem Jahr verändert habe und die Beziehungen zwischen China und Europa vor “neuen Problemen” stehen, berichteten Staatsmedien. “China und Europa unterscheiden sich in ihrer Geschichte, Kultur, sozialen Systemen und Entwicklungsstadien”, so Xi. Es sei nicht verwunderlich, dass es “Konkurrenz und Differenzen” gebe. Xi plädierte für Dialog und Verhandlungen, um diese aufzulösen. Es gebe ein Interesse an engeren Verbindungen zwischen beiden Seiten. Das betreffe unter anderem die Bereiche Klima, Digitalisierung und Konnektivität. Jedoch sei die Souveränität Chinas dabei nicht verhandelbar.
Xi und er hätten sich auf einen EU-China-Gipfel verständigt, teilte Michel auf Twitter mit. Nähere Angaben zu einem Datum für das Treffen machte der EU-Ratspräsident nicht. Trotz Differenzen zwischen der EU und der Volksrepublik bleibe der Dialog von entscheidender Bedeutung, schrieb der Belgier. Neben weiteren internationalen Themen habe er mit Xi auch über die Situation in Afghanistan gesprochen.
Michel betonte gegenüber Xi den Berichten chinesischer Medien zufolge die Einhaltung der Ein-China-Politik der EU bezüglich Taiwan. Das Europaparlament wird in der am Montag beginnenden Plenarwoche über seinen Bericht zu den künftigen EU-Taiwan-Beziehungen abstimmen. Darin fordern die EU-Abgeordneten eine Hochstufung der Verbindungen zu Taipeh und ein Investitionsabkommen mit der Insel (China.Table berichtete).
Beobachter gehen davon aus, dass Peking seine EU-Strategie nach dem Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel neu austariert. Xi hatte in der vergangenen Woche ein “Abschiedsgespräch” mit der scheidenden Bundeskanzlerin geführt (China.Table berichtete). ari
Am Samstag hat ein Langzeitexperiment mit einer Taikonautin und zwei Taikonauten im All begonnen. Die Besatzung hat vom Weltraumhafen Jiuquan abgehoben und ist nur acht Stunden später an der chinesischen Raumstation Tiangong angekommen. Sie sollen für sechs Monate in der Schwerlosigkeit bleiben. Durch engmaschige Überwachung der biologischen Funktionen wollen chinesische Forscher Erkenntnisse über die Folgen langer Missionen sammeln. Die Taikonauten sollen zudem daran arbeiten, Routinen für langfristiges Leben und Arbeiten im All zu sammeln. Mit dabei ist auch Wang Yaping, eine Weltraum-Veteranin. Sie war vor acht Jahren erstmals im All. Sie war damals durch ihre per Video übertragenen Experimente für Kinder international bekannt geworden. fin
Einem Medienbericht zufolge hat Chinas Militär große Fortschritte bei der Entwicklung von Hyperschallraketen gemacht. Wie die Financial Times am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, testete die Armee bereits im August einen neuen Hochgeschwindigkeitsgleitkörper. Dem Bericht zufolge schoss China das atomwaffenfähige Geschoss mit einer Rakete des Typs “Langer Marsch” ins All. Dort umkreiste es die Erde auf einer niedrigen Umlaufbahn, bevor es Kurs auf sein Ziel nahm.
Zwar soll das Geschoss verschiedenen Quellen zufolge sein Ziel um rund 30 Kilometer verfehlt haben. US-Geheimdienste waren von den neuen militärischen Fähigkeiten China dennoch überrascht. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, wollte sich laut Nachrichtenagentur AFP zu den Einzelheiten des Berichts nicht äußern. Zugleich äußerte er seine Besorgnis “über die militärischen Fähigkeiten Chinas”. Dies sei einer der Gründe, “warum wir China als unsere größte Herausforderung betrachten”.
Wie ballistische Raketen können Hyperschallraketen Atomwaffen tragen, zugleich aber mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen. Neben China arbeiten auch die USA, Russland, Nordkorea und mindestens vier weitere Länder an der Hyperschalltechnologie. flee
Im Streit um eine Skulptur zum Gedenken an die Opfer auf dem Pekinger Tiananmen-Platz hat sich eine internationale Anwaltskanzlei von der Universität Hongkong (HKU) abgewandt. “Mayer Brown wird seinen langjährigen Mandanten in dieser Sache nicht mehr vertreten”, erklärte die Kanzlei laut Washington Post.
Die internationale Kanzlei aus Chicago hatte im Namen der Universität die kürzlich aufgelöste Hongkonger Allianz, die jahrelang die traditionellen Tiananmen-Mahnwachen in Hongkong organisiert hatte, zum Entfernen der Skulptur aufgefordert. Die Universitätsleitung setzte eine Frist bis vergangenen Mittwoch. Bislang steht die Skulptur aber noch.
Die etwa acht Meter hohe “Säule der Schande” erinnert an die die gewaltsame Niederschlagung der Demokratieproteste in Peking 1989. Die Skulptur des dänischen Künstlers Jens Galschiot zeigt 50 Menschen mit gequälten Gesichtern. Sie steht seit 1997 auf dem Campus der HKU.
US-Politiker übten scharfe Kritik an Mayer Brown. Senator Lindsey Graham von den Demokraten warf der Kanzlei vor, “auf Geheiß der Kommunistischen Partei die Erinnerung an die mutigen jungen chinesischen Studenten auslöschen, die auf dem Platz des Himmlischen Friedens ihr Leben für die Freiheit geopfert haben”. flee

In gewisser Weise waren es der Dalai Lama und der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy, die Professor Andreas Fuchs dazu brachten, sich mit China zu beschäftigen. Das Treffen des tibetischen Oberhauptes und des damaligen EU-Ratsvorsitzenden im Jahr 2008 sorgten für Dissonanzen zwischen der EU und China. “Die politischen Spannungen waren so präsent, dass Chinesen in meinem Bekanntenkreis in Paris Arbeitsangebote in Frankreich abgelehnt haben und in ihre Heimat zurückgekehrt sind”, sagt Andreas Fuchs rückblickend. “Das war einer der Momente, in dem mir bewusst wurde, dass wir mit China nicht nur eine aufstrebende Weltmacht haben, sondern dass hier politische Beziehungen und Wirtschaft besonders eng verzahnt sind.” Das Interesse war geweckt.
Fasziniert von dem Wechselspiel politischer Spannungen und wirtschaftlicher Auswirkungen hat sich Andreas Fuchs einige Jahre später in seiner Dissertation mit der wachsenden Entwicklungszusammenarbeit Chinas beschäftigt – heute ist der 39-Jährige ein gefragter Forscher auf diesem Gebiet.
Das zeigt sich auch an seiner Professur für Entwicklungsökonomik an der Universität Göttingen, die er seit 2019 innehat. In Göttingen leitet er auch das Centre for Modern East Asian Studies. Denn neben seiner persönlichen Motivation treibt ihn vor allem das fehlende Wissen über China in Deutschland und Europa an: “Die Forschung mit und über China muss unbedingt wachsen“, sagt er. “Wir haben einen Wissensrückstand, obwohl China weltweit und somit auch für Deutschland – politisch wie wirtschaftlich – immer wichtiger wird.”
Fuchs trägt nun dazu bei, diese Lücke zu schließen. Dazu baut er mit dem Institut für Weltwirtschaft die Kiel Institute China Initiative auf, ein Netzwerk aus Expertinnen und Experten, die sich in der Wissenschaft und Politikberatung mit Chinas Volkswirtschaft beschäftigen.
Fuchs schließt die Lücke dabei außerdem vor allem beim Verständnis von Chinas Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2010 erforscht der Volkswirt die grundlegenden Unterschiede zwischen westlicher und chinesischer Entwicklungszusammenarbeit und versucht die Motive der Führung in Peking zu verstehen, Entwicklungsprojekte zu etablieren – denn Chinas Einfluss wächst. Doch die Herangehensweise der Chinesen ist weniger humanitär und demokratisch als westliche Entwicklungszusammenarbeit.
Recht eindeutig zeigt sich in der Forschung: Vor allem wirtschaftliche und machtpolitische Interessen sind für China entscheidend. “In westlichen Kreisen wird dann schnell der Finger gehoben nach dem Motto: Haben wir’s doch geahnt”, sagt Fuchs. “Dabei sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass auch bei westlichen Entwicklungsprojekten Eigeninteressen einen großen Einfluss haben.”
Ein bedeutsamer Unterschied zur westlichen Hilfe? “China folgt in den meisten Projekten dem Prinzip der Nichteinmischung, gibt also nicht vor, wie etwa die Gelder von den Staaten genutzt werden”, sagt Fuchs. Das führe dazu, dass in Afrika etwa mehr Entwicklungsprojekte in bereits vergleichsweise wohlhabenden Gebieten entstehen, weil zum Beispiel viele Staatsoberhäupter das Geld in ihre Geburtsregionen lenken und nicht bedürfnisorientiert vorgehen. “Aus westlichen Sicht auf Entwicklungszusammenarbeit ist das problematisch.” So lasse sich die Schere zwischen Arm und Reich nicht schließen.
Dennoch zeigt sich, dass das Wirtschaftswachstum in den von China unterstützen Regionen ansteige. “In den kommenden Jahren wird es für Deutschland und Europa deshalb wichtig sein zu verstehen, ob und wie sich die Einstellung der Menschen in den unterstützen Ländern gegenüber China und Werten wie Demokratie und Marktwirtschaft verändern”, sagt Fuchs. “Unsere ersten Forschungen in Lateinamerika zeigen: China polarisiert.” Einige Menschen entwickeln eine sehr positive Einstellung, andere eine sehr negative gegenüber China.
Der Dalai Lama hat Fuchs übrigens nicht nur zum China-Interesse motiviert. Er hat es sogar in seine Forschung geschafft: 2013 zeigten Fuchs und sein Team, dass Länder, die den Dalai Lama empfangen, tatsächlich schlechtere wirtschaftliche Beziehungen zu China haben – der “Dalai-Lama-Effekt” war geboren. Leon Kirschgens
Zeng Yi wird zum Hauptgeschäftsführer der China Electronics Corporation (CEC), einem Staatsbetrieb mit enger Bindung ans Militär. Der 56-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in Chinas Rüstungsindustrie.
Amy Shang stößt zur Kundenbetreuung bei der Geldanlagefirma Grantham, Mayo, Van Otterloo (GMO) mit Zuständigkeit für den chinesischen Markt. Shang zieht dafür von Hongkong nach Singapur um.
Toby Chan wird in Hongkong Chefin der Abteilung für Kundenbeziehungen bei dem Vermögensverwalter Capital Group. Sie hat zuvor bei dem Bankhaus HSBC gearbeitet.
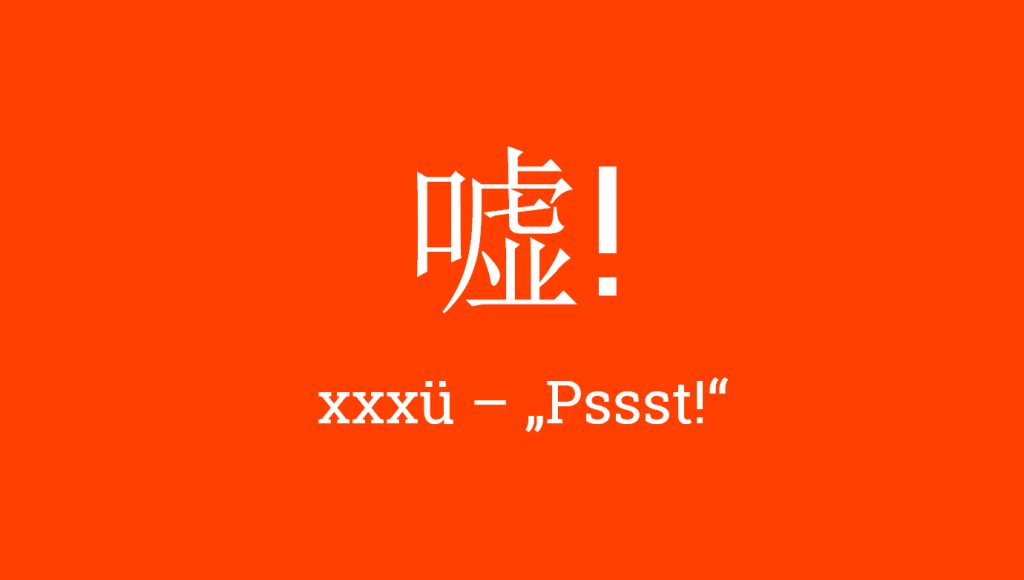
Pssst! Sagen Sie es bitte nicht weiter, aber im Chinesischen sagt man gar nicht “pst!”. Unliebsames Gemurmel im Kino, quatschende Kommilitonen auf der Hinterbank, quäkende Kulturbanausen in der Kunstausstellung – darauf folgt in China ein energisches “Xxxu!” – gesprochen mit kräftigem Reibelaut wie im deutschen “(i)ch” und mit ordentlicher Lippenrundung, so als wolle man ein “ü” sprechen. (Kurze Lesepause an dieser Stelle, Sie probieren sicher gerade aus.)
Für den chinesischen “Pst-Laut” gibt es mit 嘘 sogar ein eigenes Schriftzeichen! Und das ist nicht das einzige “Ausrufezeichen” im Chinesischen. So gut wie alle verbalisierten Gefühlsregungen (von Grammatikliebhabern gerne auch als Interjektionen bezeichnet), die man mit dem chinesischen Lautrepertoire so ausstoßen kann, lassen sich tatsächlich mit speziellen “Hanzi” abbilden. Meistens enthalten sie den Mundradikal 口 auf der linken Seite. Man trifft sie zwar selten in formellen schriftlichen Dokumenten, Sachbüchern oder Zeitungstexten, dafür aber umso häufiger in Filmuntertiteln, Songtexten, informeller Literatur und natürlich Textnachrichten, Onlineposts und Social-Media-Kommentaren.
Hier eine kleine “Ausrufezeichen”-Kunde für Einsteiger: Es gibt zum Beispiel ein eigenes Schriftzeichen für ein erstauntes, entzücktes oder erschrecktes “Ah!” (啊 ā, á, ǎ, à – je nach Situationsbedarf einfach in unterschiedlichen Tonlagen aussprechen!). Und ein Zeichen für ein locker zugerufenes “Hey!” (嘿 hei! – wie in “Hey, komm mal her!” 嘿,你过来一下!Hēi! Nǐ guòlái yīxià!). Man findet auch ein Hanzi für alle möglichen “Oh”-Varianten (哦 o! – vielfältig einsetzbar von freudiger Erregung, über Erstaunen und Zweifel bis hin zu resignierter Hinnahme – bitte auch hier den Ton entsprechend anpassen: ó, ò, o …), sowie ein eigenes Zeichen für freudiges (oder leicht hämisches?) Feierabendträllern (啦啦啦 lalala). Die Zeichenkombi für die schluchzenden (da Überstunden schiebenden) Kollegen kommt hier: 呜呼呼 wūhūhū. In China kennt man sogar eine Verschriftlichung für den entrüsteten Tzz!-Schnalzlaut, den man Dränglern, Anremplern und Fußtramplern in der überfüllten chinesischen Rushhour-U-Bahn gerne zuraunt (啧 – das Lautzeichen für ein Schnalzen).
Mit den chinesischen Interjektionszeichen für Lachlaute ließe sich gar ein interkultureller Lachleitfaden lancieren: Die Lachlatte reicht vom bekannten Basislaut 哈 hā (gerne auch in Mehrfachausführung: 哈哈哈,真可笑!Hāhāhā, zhēn kěxiào! – “Hahaha, wirklich lustig!”) über verschämtes (嘻嘻 xīxī “hihi”) oder verschwörerisches (嘿嘿 hēihēi “hehe”) Kichern bis hin zu leicht eingeschnapptem Feixen (呵呵 hēhē – “höhö, hähä”). Nicht zu vergessen als Lachgipfel natürlich das unverhohlene Allmachtsfantasie-Prusten (哇哈哈wāhāhā, oder wahlweise auch 呜哈哈 wūhāhā).
Für andere chinesische Interjektionen braucht man fast schon einen kleinen Kulturknigge, damit man sie zweifelsfrei zuordnen und richtig anwenden kann: Zum Beispiel für den chinesischen “Wow”-Laut – der lautet nämlich traditionell 哇 wā oder 哇塞 wāsài (哇!很漂亮! Wā! Hěn piàoliang! – “Wow! So hübsch!”). Besonders cool krakeelt man ihn heute neuerdings auch als Anglizismus: 哇喔 wā-ō! (genau: “Wow!”).
“Hä?” wie in “Hä? Wieso druckt das nicht?” heißt auf Chinesisch咦 yí (ein Laut zum Ausdruck von Überraschung). Nicht verwechseln bitte mit unserem “Iiii!” wie in “Igitt” (das heißt auf Chinesisch 额 é). Und wer in China vom Panda gekratzt wird, sagt authentischer Weise nicht “aua!” sondern 哎哟 “āiyō!”.
Zum Abschluss noch der Klassiker unter den Kulturschocklauten bei ersten Telefonkontakten nach China. Anrufe beantwortet man in China nämlich nicht mit “Hallo?”, sondern mit einem lässigen 喂 (wéi?). Wā-ō! Oder? Frohes Ausprobieren beim nächsten Telefonat!
Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.
