auch diesen Montag gehen wir mit einem CEO-Talk online, den Sie hier im China.Table als Interview lesen können. Diesmal hat Frank Sieren mit Christian Sommer gesprochen, dem Chef des German Centre in Shanghai. Sommer blickt mit den Augen des Mittelstands auf das Chinageschäft und die internationalen Beziehungen: Die German Centres sind Dreh- und Angelpunkt der deutschen Gemeinschaft vor Ort.
Sommer warnt vor einer zunehmenden politischen Aufladung der Wirtschaftsbeziehungen, die seiner Ansicht nach beiden Seiten nur schaden kann. Zugleich beobachtet er in Deutschland eine zu große Behäbigkeit zum Beispiel bei der Digitalisierung. China will heute das eigene Schicksal, aber auch das der Weltwirtschaft aktiver bestimmen. Schließlich ist es bereits die Nummer zwei im Ranking der Volkswirtschaften.
Im Medaillenspiegel ist China nach dem ersten Olympia-Wochenende sogar die Nummer eins. Sechsmal Gold in drei Tagen – das verheißt große Erfolge beim weltgrößten Sportfest. Unser Autor Michael Radunski hat sich angesehen, in welchen Disziplinen die Volksrepublik besonders üppig abräumen wird. Denn eins ist klar: Eine Schlappe wie in Rio will Präsident Xi nicht noch einmal sehen. Vor fünf Jahren war die sozialistische Sportnation auf Platz drei abgesackt. Das war immer noch ein gutes Ergebnis, möchte man meinen. Doch aus Gründen der Außendarstellung ist gerade in Japan – und ein halbes Jahr vor den Spielen im eigenen Land – ein anderer als der erste Platz geradezu undenkbar.
Einen guten Start in die Woche wünscht

Selbst nach seinem Erstkontakt mit China in den 1980er-Jahren war noch längst nicht abzusehen, dass er sein Leben im Reich der Mitte verbringen würde: Christian Sommer ist Sohn eines Elektromeisters aus Kiel und befand sich zunächst auf einem ganz biederen Karriereweg als Rechtsgehilfe. Heute ist er eine der am besten vernetzten Persönlichkeiten unter deutschen mittelständischen Unternehmen im Großraum Shanghai.
Sommer hatte Jura studiert, wurde Fachanwalt für Steuerrecht und kam Januar 1995 nach Shanghai, um für eine deutsche Kanzlei zu arbeiten. Die Tätigkeit wurde ihm jedoch schnell langweilig. Nach gut einem Jahr wechselte er als stellvertretender Leiter ins German Centre Shanghai. Danach hat er sechs Jahre lang das German Centre in Peking für die Landesbank Baden-Württemberg aufgebaut, nur um dann wieder nach Shanghai zurückzukehren – diesmal als Chef. Seit über 15 Jahren ist er dort nun der CEO.
Ein einzelner Standort in Shanghai reichte jedoch weder Sommer noch den Bedürfnissen der deutschen Wirtschaft vor Ort. Zwischendurch hat er daher neue Filialen in Taicang und in Qingdao eröffnet. Hunderte deutsche Firmen betreut er nun fast rund um die Uhr. Darüber hinaus veranstaltet Sommer deutsch-chinesische Tischtennis-Turniere. Mit schwarzer Sonnenbrille und Bass sieht man ihn auf Musik-Festivals. Seine Band heißt ShangHigh Voltage und klingt auch so: AC/DC aus Fernost plus eigene Songs. Tagsüber ist Christian Sommer aber ganz klar: Mr. German Centre.
In der Zeitspanne, in der Du in China lebst, also weit über 20 Jahre, waren die politischen Spannungen zwischen China und Europa nie so groß wie jetzt. Wie macht sich das bei den Unternehmen im German Centre bemerkbar?
In den Zentralen in Deutschland ist das Thema sicherlich präsenter als in China. Hier hingegen bereiten die Folgen der Corona-Pandemie viel größere Sorgen. Das Hauptproblem der Mittelständler ist schlicht und ergreifend, dass ihre Ingenieure aus Deutschland derzeit nicht hierherkommen können. Das bedeutet, die Maschinen sind geliefert und können nicht aufgebaut werden. Oder sie müssen gewartet werden und sind deshalb nur eingeschränkt in Betrieb. Denn all das wird noch immer von erfahrenen Spezialisten aus Deutschland gemacht. Die Chinesen sind zwar schon entsprechend ausgebildet, aber ihnen fehlt noch die zum Teil Jahrzehnte lange Erfahrung. Und auch umgekehrt: Chinesen, die in Deutschland geschult werden müssten, bekommen derzeit kein Visum. Das Geschäft stockt deshalb.
Aber sind die strengen Quarantäne-Regeln nicht sinnvoll?
Es liegt nicht nur an den strengen Quarantäne-Regeln. Man muss in China mindestens zwei Wochen in Hotelquarantäne. Das ist durchaus sinnvoll und würde von den Ingenieuren auch in Kauf genommen. Wir leben in China außerhalb öffentlicher Gebäude und Verkehrsmittel ja praktisch ohne Maske. Doch über den gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen hat sich nun noch der politische Clinch gelegt, nach dem Motto: Wie Du mir so ich Dir. Das finde ich nicht zielführend. Das habe ich so auch unter anderem dem deutschen Generalkonsulat in Shanghai gesagt. Es ist ja wahrscheinlich, dass sich die chinesischen Quarantänebeschränkungen noch bis weit ins nächste Jahr hinziehen. Da muss es möglich sein für die deutsche Wirtschaft eine bessere Lösung zu finden.
Ist das nicht auch der Versuch von China mal zu testen, inwieweit man auch ohne Ausländer zurechtkommt?
Ja, das wird hier und da gemunkelt. Das könnte ein Nebeneffekt sein. Aber ich glaube wirklich nicht, dass das der Hauptgrund ist. Denn China sucht ja internationale Qualität und Qualifikation. Das zeigt die normale Visapolitik deutlich.
Braucht China denn noch Ausländer?
Ja. Und glücklicherweise nicht nur die Vertreter der deutschen Industrie, sondern den weltweiten Austausch. Das ist ja eine Stärke der Globalisierung: Niemand kann alles. Auch die chinesische Politik ist realistisch genug, das nicht zu glauben. Der Austausch von Menschen ist in der Globalisierung notwendig. Fachkenntnisse sind weder nur deutsch, nur amerikanisch, französisch, nur japanisch noch nur chinesisch, obwohl China ein großes Land ist. Die internationalen Kenntnisse zu bündeln und daraus einen Mehrwert zu schaffen, ist ja eine Stärke der Globalisierung.
Gleichzeitig spricht man im Westen, aber auch in China, von gegenseitiger Entkopplung.
Auch dafür gibt es gute Gründe. Die Abhängigkeit, die durch immer engere Zusammenarbeit entsteht, fühlt sich in Krisenzeiten unangenehm an. In politisch schwierigen Zeiten versucht man, sich von der Umklammerung zu befreien. Die Unternehmen wollen ja Geschäfte machen und nicht Politik. Für diesen Wunsch habe ich Verständnis.
Wie die Realität aussieht, lässt sich bei den Halbleitern gut beobachten: Da gibt es eben nur eine paar Firmen, die die Mikrochips in großen Mengen herstellen können. Wenn die Politik sich dort einmischt, nach dem Motto, die Chinesen dürfen keine Chips kaufen, die mit dem Know-how amerikanischer Firmen gebaut werden, dann schadet das auch unserer Wirtschaft, weil fast alles in China produziert wird. Wir lernen gerade, dass eine Politik, die die Wirtschaft zwingen will, sich für China oder die USA zu entscheiden, wirtschaftlich keinen Sinn hat. Für Konzerne nicht und für den Mittelstand schon drei Mal nicht.
Der deutsche Mittelstand hat in China die Plattform der German Centres. Über so etwas verfügt kein anderes Land. Warum ist das so?
Es gibt eben kein Land, das einen so großen industriellen Mittelstand hat, die sogenannten Hidden Champions. Da lag es auf der Hand, die Kräfte in einem Zentrum zu bündeln, Synergien zu schaffen. Inzwischen sind wir sogar sozusagen German Centre International, denn auch nicht-deutsche Firmen schätzen unser Netzwerk. Wir haben in Shanghai aktuell knapp 130 Firmen, davon sind zwei Drittel deutschen Ursprungs. Das letzte Drittel ist über die Welt verteilt.
Diese Offenheit ist eine Stärke Deutschlands. Und inzwischen sind wir nicht nur ein Hub der deutschen Wirtschaft, ein Landeplatz also, sondern auch ein Startplatz für chinesische Unternehmen auf dem Weg nach Deutschland. Ein sehr positives Beispiel dafür, wie die Wirtschaft und der Staat sinnvoll zusammenarbeiten können. Denn die ursprüngliche Idee war, dass die Bundesländer, vor allem Bayern und Baden-Württemberg, gesagt haben, wir wollen unserer mittelständischen Industrie helfen, in die Welt zu gehen. Die Landesbanken haben dann den Aufbau übernommen und investiert. Die German Centre sind schon viele Jahre profitabel. Deshalb planen wir weitere neue Standorte. Denn China wird noch viel wichtiger für die deutsche Wirtschaft werden.
Wo drückt außer den Visa-Restriktionen der Schuh sonst noch für den deutschen Mittelstand?
Der Schuh drückt vor allem zu Hause, wenn es darum geht, gegenüber China wettbewerbsfähig zu bleiben. Was die Digitalisierung betrifft, sind wir einfach nicht mehr vorne. In Deutschland, in Europa wird viel darüber geredet, aber vergleichsweise wenig gemacht. Das finde ich aus chinesischer Perspektive schon erschreckend, wenn man sieht, wie schnell Innovationen in China ausgerollt werden. In Deutschland ist das Internet grottenschlecht. Und da reden wir noch nicht einmal über 5G.
Ist der deutsche Mittelstand also gezwungen, immer mehr Geschäft nach China zu verlagern?
Corona bremst die Entwicklung zwar derzeit. Aber ansonsten ist das so. Und dabei schaue ich nicht nur auf die Digitalisierung, sondern auf die Frage: Wo bekomme ich Fachkräfte her, in der richtigen Balance zwischen Ausbildung und Lohnkosten. Und ich schaue natürlich, wo sind meine Wachstumsmärkte. Da möchte ich vor Ort sein, um Veränderungen schnell und unmittelbar mitzubekommen.
Das hört sich fast so an, als ob die größte Klage beim Mittagessen in der Kantine des German Centres die Klage über Deutschland ist. Ist das realistisch?
Es geht gar nicht darum, Deutschland schlecht zu reden und China gut. Aber das sind tatsächlich die Gesprächsthemen. Unsere Unternehmen sind in Deutschland, in Europa stark geworden. Aber derzeit ist Deutschland für uns in der Entwicklungsgeschwindigkeit, was die Überregulierung betrifft, in der Verschuldung oder in der Ausbildungsqualität kein Vorteil. So empfinden das die Unternehmen.
Kürzlich gab es ein Treffen in Taicang bei Shanghai. Da saßen 400 deutsche Firmen. Der Tenor, und das sind nicht meine, sondern deren Worte: China hat einen Plan. Ich weiß, was ich machen kann. Ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Ich weiß, wie die nächsten Jahre ablaufen. In Europa vermissen wir das. Wir machen natürlich Umsatz in Europa. Aber was die Zukunftsfähigkeit anbelangt müssen wir aufpassen, dass wir in Europa nicht verlieren.
Aber es gibt auch in China viel politische Willkür und Unterdrückung in der heillosen Kombination mit einem schwachen Rechtsstaat.
Das ist zweifellos richtig. Man sollte jedoch differenzieren. Die politischen Probleme sind in der Zivilgesellschaft viel stärker spürbar als in der Wirtschaft. Und innerhalb der Wirtschaft stärker in Konzernen als beim Mittelstand. Beim Mittelstand steht – noch einmal – an erster Stelle die Feststellung, dass man hier sehr gute Geschäfte machen kann. Und das ist kein geschönter Eindruck. Es spiegelt sich auch in den anonymen Umfragen wider.
Viele Unternehmen haben mir zudem berichtet, dass das vergangene Corona Jahr das beste ihrer Geschichte war. Das bedeutet jedoch nicht, dass vieles in anderen Bereichen in China auch zu kritisieren ist beziehungsweise werden muss. Allerdings ist es wichtig zu sehen, dass im Alltag die größeren Sorgen in Richtung Deutschland gehen. Im Übrigen bedeutet die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ja durchaus, dass man auch seine Werte in der Welt selbstbewusster vertreten kann. Wenn wir wirtschaftlich bedeutungslos sind, hört uns niemand mehr zu. Die Chinesen schon gar nicht.
Was sind für Dich die größten zivilgesellschaftlichen Schwächen?
Neben dem noch schwach ausgeprägten Rechtssystem ist in den letzten Jahren viel Freiraum und Offenheit verloren gegangen. Das empfinden vor allem die chinesischen Manager – und viele deutsche Firmen haben ja inzwischen chinesische Generalmanager – als einen Rückschritt.
Woran liegt das?
An der Zentralregierung und der KP. Ich vermute, dass die Partei das Gefühl hat, durch das Wachstum der Wirtschaft haben die westlichen Werte ein zu großes Gewicht bekommen. Das möchte man nun bremsen. Die Partei sagt: Wir müssen die eigene Richtung, die eigene Entwicklung Chinas, den eigenen Weg deutlicher definieren. Dazu gehören auch eigene Wertvorstellungen. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sicherlich in stärkeren Maß als seine Vorgänger den unbedingten Willen, einen eigenen Weg auszuprobieren. Aber er lebt auch in günstigeren Zeiten dafür. Für die Nummer 2 der Weltwirtschaft ist das einfacher als für Nummer 7.
Müssen wir angesichts dieser Entwicklung nicht auch unsere Werte offensiver vertreten? Sind deshalb die Sanktionen nicht sinnvoll? Nach dem Motto: bis hierher und nicht weiter?
Ich wurde neulich von der Tochter des Inhabers eines deutschen Unternehmens angerufen, das in China produziert. Sie soll nun das Geschäft übernehmen und hat mich gefragt: Wie könne sie es moralisch rechtfertigen, in China Geschäfte zu machen. Ich habe geantwortet: Indem wir im Dialog die Dinge zum Besseren wenden. Sanktionen bringen nichts. Denn Sanktionen bedeuten vor allem eines: Ich will nicht mehr reden. Ich will etwas erzwingen. Dabei gibt es meist nur ein Ergebnis: Es zeigt sich, dass ich dazu die Macht nicht habe. Das ist kein Weg, um die Lage in China zu verbessern. Und darum geht es uns ja allen.
Ich habe dieser Frau folgendes gesagt: Unsere Präsenz hat Vorbildcharakter. Ich sehe, was die Präsenz der Ausländer in China allein in der Zeit, in der ich in China bin, bewirkt hat, bei Kinderarbeit, Arbeitszeiten, Bezahlung, Sicherheit am Arbeitsplatz, Hygienestandards und all den anderen sozialen Menschenrechten. Generell sind wir in der Art, wie wir Mitarbeiter behandeln, ein großes Vorbild. Wir sollten unseren Einfluss nicht unterschätzen, auch wenn sich nicht alles so schnell zum Besseren entwickelt, wie wir uns das wünschen.
Diesen Einfluss aufzugeben, weil es Bereiche gibt, die nicht nur rückständig, sondern unseren Werten sogar gegenläufig sind, halte ich für falsch. Wir werden uns im Übrigen daran gewöhnen müssen, dass wir unterschiedliche Systeme in der Welt haben, übrigens in China in einer viel größeren Übereinstimmung zwischen der Bevölkerung und ihrer Regierung, als wir gemeinhin annehmen. Auch, wenn wir aus guten Gründen und mit Selbstbewusstsein vertreten, dass unsere Werte die mit Abstand besten Werte der Welt sind.
Es ist ein Start nach Maß für China. Die erste Goldmedaille der Olympischen – Sommerspiele in Tokio holte Yang Qian 杨倩 im 10-Meter-Schießen mit der Luftpistole. Und damit nicht genug. Wenig später sicherten Hóu Zhìhuì 侯志慧 im Gewichtheben der Frauen (49kg) und Sūn Yīwén 孙一文 im Fechten für China die nächsten Goldmedaillen bei diesen Spielen. Damit steht die Volksrepublik bis Sonntagabend ganz oben im internationalen Medaillenspiegel – mit sechsmal Gold, einmal Silber und viermal Bronze.
In Tokio wird in 33 Sportarten um Medaillen gerungen, gerannt, geschwommen, gefahren, gesprungen oder geschossen. Genau 339 Mal wird dabei die höchste Auszeichnung vergeben: die olympische Gold-Medaille. Fans, Buchmacher und so mancher Staatspräsident blicken gespannt nach Tokio und fragen sich: Wer alles kann noch Gold gewinnen?
China scheint bei dieser Frage auf den ersten Blick einen recht simplen Ansatz zu verfolgen: viele Athlet:innen = viele Medaillen. 431 Sportler:innen sollen möglichst viele Auszeichnungen einheimsen. Nur 2008 bei dem eigenen Spielen in Peking schickte man noch mehr Aktive an den Start, nämlich 639. Und damals ging der Plan auf: 48-mal Gold für die Volksrepublik! Kein anderes Land gewann in Peking so viele Wettbewerbe wie China.
Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio erlebte man hingegen einen regelrechten Absturz. Mit “nur” 26-mal Gold landete die Volksrepublik auf Rang drei im Medaillenspiegel – noch hinter Großbritannien. Es bedarf keiner ausufernden Ausführungen, dass so etwas für Peking nicht akzeptabel war. Entsprechend wurde in den vergangenen Jahren viel Geld investiert in Übungsstätte, Trainingsprogramme und ausländische Trainer. Bleibt abzuwarten, ob sich das bei den Olympischen Spielen in Tokio auszahlen wird.
Dass sich Erfolg im Sport kaum vorausplanen lässt, ist weithin bekannt. Doch bei den aktuellen Wettbewerben kommen weitere Unwägbarkeiten hinzu: Zum einen werden die Spiele ohne Publikum in den Wettkampfstätten ausgetragen; zum anderen wurden sie wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben. So haben die meisten chinesischen Sportler:innen aufgrund der strikten Reiseeinschränkungen in der Volksrepublik knapp zwei Jahre lang kaum an internationalen Wettkämpfen teilnehmen können.
Dennoch wagen wir von China.Table einen Blick in die Glaskugel und stellen einige der chinesischen Medaillenhoffnungen vor:
Dass China nahezu alle Goldmedaillen im Tischtennis abräumt, war bislang so sicher wie das Gold in Fort Knox. Ob bei den Frauen oder den Männern – seit 1988 hat die Volksrepublik im Tischtennis 28 von 32 möglichen Goldmedaillen gewonnen.
Doch genau hier ist der erste Eklat der Tokioter Spiele ausgebrochen: Beim Tischtennis wischen die Spieler:innen immer wieder mit der feuchten Hand über die Platte oder pusten auf den Ball. Doch was manchem als Marotte erscheinen mag, hat große Auswirkungen auf das Spiel: Benetzen Mikrotropfen vom Schweiß der Spieler die technisch austarierten Bälle, entwickeln sie beim Anschneiden einen anderen Spin – was vor allem für das Spiel des chinesischen Topstars Mǎ Lóng 马龙 wichtig ist. Bei den Olympischen Spielen in Tokio allerdings wurden Abwischen und Pusten aus Hygiene-Gründen kurzfristig untersagt, was nun vor allem bei den Chinesen für großen Unmut sorgt. Noch vor dem ersten Aufschlag ist bereits die Rede von Manipulation und gezielter Benachteiligung.
Doch Regeländerung hin oder her, die besten Tischtennisspieler:innen stammen aus China. Bei den Männern sind das neben Mǎ auch Fán Zhèndōng 樊振东 im Einzel und Xǔ Xīn 许昕 im Team-Wettbewerb. Doch mit Tomokazu Harimoto 張本智和 hat zuletzt ausgerechnet ein Japaner die chinesische Phalanx in der aktuellen Weltrangliste durchbrochen und sich zwischen die Chinesen auf Platz 3 geschoben. Nun hoffen nicht nur die Japaner:innen, dass der 18 Jahre alte Harimoto in Tokio Chinas Seriensieger das Fürchten lehren möge. Aber: Auch der Tresor von Fort Knox konnte bislang von niemandem geknackt werden.
Bei den Frauen sind Chén Mèng 陈梦 und Sūn Yǐngshā 孙颖莎 Chinas Topspielerinnen. Doch auch hier hat sich die Japanerin Mima Ito 伊藤美誠 auf Platz 2 dazwischen geschoben. Dennoch wird eine Wette auf die beiden Chinesinnen bei ihrem lokalen Buchmacher bestimmt als sichere Bank angesehen.
War Tischtennis bislang für China eine weitgehend klare Sache, so ist es das Turmspringen umso mehr. Hier lautet Chinas Zielsetzung in Tokio: Alles gewinnen. Was für manchen arrogant klingen mag, spiegelt schlicht die Leistungsstärke der chinesischen Athlet:innen wider.
Bei den Frauen gilt die Aufmerksamkeit vor allem Shī Tíngmào 施廷懋 und Zhāng Jiāqí 张家齐. Shī hat schon bei den Spielen in Rio vom 3-Meter-Brett zwei Goldmedaillen gewonnen – und konnte ihre Serie in Tokio am Sonntag fortsetzen: einmal Gold. Die 17 Jahre alte Zhang ist derweil aktuelle Weltmeisterin vom 10 Meter-Brett, tritt bei Olympischen Spielen allerdings zum ersten Mal an. Im Synchronspringen sollte sie zusammen mit Chen Yuxi Gold gewinnen. Und China hat noch ein weiteres Ass im Ärmel bzw. auf dem 10-Meter-Turm: Quán Hóngchán 全红婵. Mit gerade mal 14 Jahren ist sie die jüngste chinesische Athletin in Tokio – und doch schon eine Siegerin: Denn mit 13 gewann sie bereits die nationalen Meisterschaften in China.
Bei den Männern sind Chinas sicherste Goldhoffnungen wohl Chén Àisēn 陈艾森 und Cáo Yuán 曹缘 im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm.
Der American-Football-Trainer Vince Lombardi soll einst gesagt haben: Gewinnen ist eine Gewohnheit. Im Badminton hatte viele Jahre Lín Dān 林丹 so eine Gewohnheit. Der Chinese aus Fujian gewann Spiel um Spiel, zweimal die Gold-Medaille, fünfmal die Weltmeisterschaft, sechsmal die All England – und mit 28 Jahren alle großen Turniere – als bislang einziger Spieler der Welt.
Doch für die Spiele in Tokio lautet die Hauptmeldung: Super Dān ist nicht dabei. Der vielleicht beste Spieler aller Zeiten ist der Verschiebung der Olympischen Spiele zum Opfer gefallen. Die Wettkämpfe in Tokio wären seine fünften Spiele gewesen und sollten den krönenden Abschluss seiner Karriere bilden. Doch während die Spiele verschoben wurden, hielt Super Dān an seinem Plan fest und beendete mit 37 Jahren im Sommer seine Karriere.
In Tokio dabei ist dafür Chén Lóng 谌龙. Der Olympia-Sieger von Rio hat zuletzt jedoch dramatisch an Form verloren. Sollten sie also darüber nachdenken, auf den Ausgang der Turniere zu wetten und scheuen das etwas das Risiko, wäre dieses Mal eventuell der Japaner Kento Momota 桃田賢斗 die bessere Wahl.
Bei den Frauen greift Chén Yǔfēi 陈雨菲 für China nach Gold. Doch hier wird es kompliziert – sportlich: weil Nozomi Okuhara 奥原希望 aus Japan ebenfalls stark ist; und politisch: weil auch Tai Tzu-Ying gute Chancen hat, die Goldmedaille zu gewinnen – und zwar für Taiwan, das unter dem Namen Chinesisch Taipeh an den Olympischen Spielen teilnimmt. Also doch für China, mag manch politischer Beobachter einwenden. Doch Sport kann eben herrlich kompliziert sein.
Hier führte lange Zeit kein Weg an Chinas Athlet:innen vorbei. Mittlerweile schon. Vor allem Indien, Italien und Deutschland drängeln sich hin und wieder an der Volksrepublik vorbei auf den obersten Podestplatz. Doch Yang Qian 杨倩 zeigte am Samstag im 10-Meter-Schießen der Frauen mit der Luftpistole, dass mit China weiter zu rechnen ist. Und ginge es nur nach der aktuellen Form, würde Xióng Yàxuān 熊亚瑄 eine weitere Gold-Mediale für China erschießen. Schließlich hat die 24 Jahre alte Schützin im März einen neuen Rekord im 25-Meter-Pistolenschießen aufgestellt.
Während sich China politisch und wirtschaftlich zu einem Schwergewicht entwickelt, liegen die Stärken beim Gewichtheben eher in den leichteren Klassen. Bei den Männern sind das vor allem Lǐ Fābīn 李发彬 (61kg), Chén Lìjūn 谌利军 (67kg), Shí Zhìyǒng 石智勇 (73kg) und Lǚ Xiǎojūn 吕小军 (81kg). Sie alle sind in ihren Klassen aktuell Weltmeister, wobei Li, Shi und Lu ganz nebenbei auch noch die aktuellen Weltrekorde innehaben. Chen und Li konnten am Sonntag auch schon ihre ersten Goldmedaillen gewinnen.
Auch Chinas Frauenteam ist im wahrsten Sinne des Wortes stark. Zwar fehlen mit Dèng Wēi 邓薇 (64kg) die Goldmedaillengewinnerin von Rio und mit Jiǎng Huìhuā 蒋惠花 (55kg) die aktuelle Weltrekordhalterin, doch Hóu Zhìhuì 侯志慧 (49kg) hat am Samstag gezeigt, wie kräftig Chinas Frauen sind. Ihr stehen Liào Qiūyún 廖秋云 (55kg), Wāng Zhōuyǔ 汪周雨 (87kg) und Lǐ Wénwén 李雯雯 (87kg) in kaum etwas nach, sodass mindestens eine weitere Goldmedaille für die Volksrepublik gehoben werden sollte.
Doch auch hier gibt es einen politischen Fallstrick; ihr Name ist Kuo Hsing-chun (59kg). Die 27-Jährige ist viermalige Weltmeisterin und hat sowohl die Universade wie auch die Asien-Spiele gewonnen. In Tokio soll Kuo nun Gold gewinnen – für Taiwan oder wie bereits erwähnt: für Chinesisch Taipeh. Doch auch Kuo hat ein Problem: “Die Verschiebung der Spiele um ein Jahr ist eine große Herausforderung, da ich nun schon fast 27 Jahre alt bin. Das Alter bereitet mir Sorgen“, sagte Kuo der South China Morning Post. Diese Sorgen möchte man haben.
Hier scheint es, als wären die guten alten Zeiten für China tatsächlich so langsam vorbei. 2008 in Peking konnte man noch 11 Goldmedaillen gewinnen – neun mehr als die USA und Russland zusammen. Doch schon in Rio 2016 sprangen für die Volksrepublik nur noch einmal Silber und viermal Bronze raus. Und für Tokio haben sich die Aussichten nicht sonderlich gebessert. Allerdings sollte man Chinas Turner:innen nicht voreilig abschreiben. Während der Corona-Pandemie haben sie an keiner Weltmeisterschaft teilgenommen, sondern fleißig in China trainiert. Und so sollte zumindest ein Tipp aufgehen: Gāo Lěi 高磊 ist und bleibt der König des Trampolins.
Fahnenträger im Team China sind die Volleyballerin Zhū Tíng 朱婷 und der Taekwondo-Kämpfer Zhào Shuài 赵帅. Beide haben durchaus Chancen, mit Gold aus Tokio heimzukehren. Chinas Volleyballerinnen haben schon in Rio Gold gewonnen. Doch dann fehlte Zhū Tíng 朱婷 – und mit ihr verließ auch das Spielglück das Team. Nun ist zumindest Zhū Tíng 朱婷 als Kapitänin zurück.
Auch Zhào Shuài 赵帅 konnte in Rio Gold gewinnen. Doch der Taekwondo-Kämpfer sieht sich in Tokio ebenfalls mit einer Herausforderung konfrontiert. In Rio konnte er mit 58kg alle Konkurrenten schlagen. Doch in den vergangenen fünf Jahren hat Zhào Shuài 赵帅 zugelegt und muss nun in der 68kg-Gewichtsklasse antreten, wo er in der Weltrangliste hinter dem Südkoreaner Lee Dae-hoon und dem Briten Bradly John Sinden lediglich auf Platz 3 rangiert.
Der Kampf um die Medaillen in Tokio wird also spannend. Doch wenn China auf den Medaillenspiegel von Tokio blickt, hat so mancher seine Gedanken schon in der nahen Zukunft. Durch die Verschiebung der Sommerspiele um ein Jahr beginnen nur wenige Monate später bereits die Winterspiele in Peking. “Weil die Winterspiele direkt vor der Tür stehen, will China mit guten Resultaten in Tokio eine Sport-Euphorie entfachen”, schreibt der chinesische Sportblogger Ma Bowen auf Weibo. “Wenn die Chinesen den Vibe in Tokio spüren, werden sie anschließend viel mehr Beachtung den Spielen in Peking schenken.”
US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman wollte mit ihrem Besuch eigentlich für Entspannung im schwierigen Verhältnis ihres Landes zu China sorgen. Doch kurz vor ihrer Ankunft in Tianjin am Sonntag hat Peking zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, was ihre Mission nun deutlich erschwert. Als Vergeltung für Strafmaßnahmen der USA gegen Repräsentanten des chinesischen Verbindungsbüros in Hongkong hat die chinesische Führung staatlichen Medienberichten zufolge Sanktionen gegen sieben Personen und Institutionen in den USA verhängt. Betroffen sind unter anderem der frühere US-Handelsminister Wilbur Ross sowie Carolyn Bartholomew, die Vorsitzende der Wirtschafts- und Sicherheitskommission für den Umgang mit China (USCC). Auch die Nichtregierungsorganisation Hongkong Democratic Council und Sophie Richardson von Human Rights Watch stehen auf der schwarzen Liste.
Als bisher ranghöchste Vertreterin der USA seit Joe Bidens Präsidentschaft ist Sherman am Sonntag für zwei Tage in die Volksrepublik gereist. Die USA wollten die Kommunikationskanäle offenhalten und weiter eine freimütige Diskussion pflegen, sagte ein US-Regierungsbeamter. “Besonders, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, ist es wichtig, das Potenzial von Missverständnissen zwischen unseren Ländern zu reduzieren.” Sherman wird am Montag unter anderem Chinas Außenminister Wang Yi und den für die USA zuständigen Vizeaußenminister Xie Feng treffen. Die Gespräche finden allerdings nicht in Peking statt, sondern in der 130 Kilometer entfernten Stadt Tianjin, angeblich aus Gründen des Infektionsschutzes.
Kurz vor ihrer Ankunft hat Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian die USA aufgefordert, sich nicht weiter in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen. Die USA versuchten, eine Konfrontation zu provozieren und China in seiner Entwicklung zu bremsen. Washington habe kein Recht China zu belehren und sollte aufhören Peking zu “verleumden”. Außenminister Wang warf den USA vor, “auf herablassende Weise Druck auf andere auszuüben”. Wang weiter: “Ich will den USA sagen, dass es kein Land gibt, das einem anderen übergeordnet ist, und es sollte auch keines geben.“
In der US-Hauptstadt haben unterdessen vier US-Abgeordneten das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgefordert, die Winterspiele in einem halben Jahr in Peking zu verschieben. Als Grund nennen sie den anhaltenden Völkermord an den Uiguren in Xinjiang und anderen muslimischen Minderheitengruppen in der Volksrepublik. “Wir haben keine Beweise dafür gesehen, dass das IOC irgendwelche Schritte unternommen hat, um die chinesische Regierung zu drängen, ihr Verhalten zu ändern“, erklärt die Gruppe in dem an IOC-Präsident Thomas Bach gerichteten Schreiben.
Auch in Europa wird der Unmut über Chinas Menschenrechtsverletzungen größer. Die niederländische Stadt Arnheim hat nach einer Entscheidung des Gemeinderates die seit mehr als 20 Jahren bestehende Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Wuhan aufgekündigt. flee
Die heftigen Regenfälle der vergangenen Woche haben die Menschen in der zentralchinesischen Provinz Henan noch nicht überwunden (China.Table berichtete), die Aufräumarbeiten sind noch mitten im Gange. Doch nun drohen bereits weitere Überschwemmungen. Staatlichen Medien zufolge könnte der Taifun “In-Fa” in den nächsten Tagen sogar für weitere heftige Regenfälle sorgen.
Der schwere Tropensturm hat am Sonntag die ostchinesische Küste im Ballungsraum um Shanghai erreicht. Mit heftigen Regenfällen traf er bei der Stadt Zhoushan an der ostchinesischen Küste auf Land, die Provinz Zhejiang rief die höchste Alarmstufe auf. Die Nationale Wetterbehörde warnte, dass mit bis zu 350 Liter Regen pro Quadratmetern zu rechnen sei.
Sämtliche Flüge der beiden internationalen Flufhäfen der Hafenmetropole wurden vorsorglich abgesagt, ebenso an den Flughäfen Hangzhou und Ningbo. Die Behörden strichen auch die Fahrten aller Hochgeschwindigkeitszüge von und nach Shanghai. Disneyland und andere Vergnügungsparks mussten ihre Pforten schließen, ebenso Märkte, Geschäfte und Schulen. Es ist der bereits sechste Taifun in diesem Jahr. Wegen der schweren Niederschläge befürchten auch die Provinzregierungen von Jiangsu, Anhui und Henan, dass Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Es kann also zu weiteren schweren Überflutungen kommen.
Heftige Regenfälle haben in der vergangenen Woche vor allem in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan, und umliegenden Regionen für die schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten gesorgt. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In einer überfluteten U-Bahn sowie einem vollgelaufenen Straßentunnel fanden die Behörden weitere Leichen, die Zahl der Toten ist offiziellen Angaben damit auf inzwischen 63 gestiegen.
Beim Treffen der G20-Umweltminister in Neapel am Wochenende haben sich die Fachminister indes auf keine ehrgeizigeren Klimaziele einigen können. In der gemeinsamen Abschlusserklärung fehlt nach Darstellung des italienischen Ministers Roberto Cingolani ein Bekenntnis, die Erderwärmung bis 2030 unter 1,5 Grad zu halten. Vor allem China, Indien und Russland haben Beobachtern zufolge blockiert: Sie wollen vorerst an der Nutzung fossiler Energie festhalten. UN-Klimachefin Patricia Espinosa mahnte dagegen die G20-Gruppe aus führenden Industrie- und Schwellenländern, sie sei allein für 80 Prozent aller globalen Emissionen verantwortlich. Ohne die G20 gebe es keinen Weg zu den 1,5 Grad. flee
Mehr als drei Jahrzehnte ist es her, seit ein chinesischer Staat- und Parteichef zuletzt in Tibet war. Präsident Jiang Zemin hatte 1990 die autonome Region besucht. Wie am Freitag bekannt wurde, hat der nun der amtierende Staats- und Parteichef Xi Jinping vergangenen Mittwoch Tibets Hauptstadt Lhasa besucht und war wohl auch kurz in der Stadt Nyingchi. Der staatliche Fernsehsender CCTV zeigte am Freitag, wie Xi beim Verlassen seines Flugzeugs am Flughafen von Nyingchi eine Menschenmenge mit chinesischen Flaggen und traditioneller tibetischer Kleidung begrüßte. Später sei Xi auch vor dem Potala-Palast aufgetreten. Der Palast ist der ehemalige Sitz des im Exil lebenden Dalai Lama.
Dem Staatssender zufolge forderte Xi die örtlichen Vertreter der Kommunistischen Partei dazu auf, das “Fundament der patriotischen und anti-separatistischen” Erziehung in Tibet zu festigen. Sie müssten die “Identifikation aller ethnischen Gruppen mit dem großen Mutterland erhöhen”, sagte der Staatschef demnach. Xi schaute sich mehrere Infrastrukturprojekte in der Region an, darunter einen umstrittenen Staudamm, der am Bramaputra gebaut werden soll.
Über die Gründe des unangekündigten Besuchs wird nun auch in Kreisen von Tibet-Unterstützer:innen spekuliert. Der Organisation International Campaign for Tibet (ICT) zufolge könnte der Besuch mit dem 70-jährigen Jahrestag des umstrittenen 17-Punkte-Abkommens zusammenhängen. Dessen Unterzeichnung im Jahre 1951 beendete die De-Facto-Unabhängigkeit Tibets. In den Jahren zuvor hatten Einheiten der Volksbefreiungsarmee Tibet besetzt.
Exil-Tibeter werfen der chinesischen Führung vor, ihre Kultur und Religion gewaltsam zu unterdrücken. Zuletzt hatte es 2008 in der Region schwere Unruhen gegeben. Xi war in seinem Leben zweimal in Tibet: Im Jahr 1998 als Parteichef der Provinz Fujian und 2011 als Vizepräsident. Als Staatsführer war ihm eine Reise offenbar bislang zu heikel.
Tibet-Aktivist:innen halten die Visite für hochgradig bedeutsam. “Nach unserer Auffassung verdeutlicht der Besuch von Präsident Xi Jinping, welche wichtige Rolle die autonome Region in den politischen Überlegungen der chinesischen Regierung spielt, vor allem wenn man berücksichtigt, dass der Besuch mit dem 70. Jahrestag der angeblich ‘friedlichen Befreiung’ Tibets verknüpft ist”, vermutet Kai Müller, Geschäftsführer von ICT in Deutschland. “Die Art und Weise, wie der Besuch organisiert wurde, ohne dass chinesische Staatsmedien darüber berichteten, zeigt, dass Tibet für die chinesische Führung weiterhin ein sensibles Thema ist und dass die chinesische Regierung nicht davon überzeugt ist, dass ihre Herrschaft in Tibet von den Tibetern als legitim angesehen wird.“ flee

Christian Straube arbeitet seit 2019 als Programm-Manager im China-Programm der Stiftung Asienhaus. Zusammen mit seiner Kollegin Joanna Klabisch bemüht sich Straube um den zivilgesellschaftlichen Dialog mit China. “Die chinesische Zivilgesellschaft steht teilweise vor genau den gleichen Herausforderungen wie Zivilgesellschaften in Deutschland und Europa”, sagt er, wenngleich sie anders strukturiert ist. Besonders bei klassischen Umweltthemen, urbaner Architektur und Gender gebe es Überschneidungen.
Das inzwischen eingestellte “EU-China NGO Twinning Program”, das er mitbetreute, hat ihm gezeigt, wie wertvoll es ist, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene zusammenzuarbeiten. Und das, obwohl die Rahmenbedingungen immer enger werden: “Es ist immer schwieriger bottom-up Dialog zu leisten“, stellt Straube fest. Die rechtlichen Vorgaben wurden seit dem Anfang 2017 in Kraft getretene Gesetz zum Management ausländischer Nichtregierungsorganisationen (ANRO-Gesetz) strenger. Themen mit gesellschaftlichem Konfliktpotenzial etwa Feminismus im Hinblick auf die Rolle von Frauen in der Gesellschaft würden strenger zensiert. “Sobald eine soziale Komponente reinkommt, muss man aufpassen, wie man das Dialogformat framen kann”, sagt Christian Straube.
Schwierigkeiten bereitet aber nicht nur der Staat China mit seinen strengen Vorgaben. Auf deutscher Seite beklagt Straube das oft fehlende Bewusstsein für die Vielfalt. Häufig begegnet ihm die Vorstellung, dass die chinesische Bevölkerung “zum Teil homogen gesteuert wird und keine zivilgesellschaftliche Aktivität stattfindet”. Ein Ziel des China-Programms der Stiftung Asienhaus ist es deshalb, die China-Kompetenz in Europa zu stärken. Und bei politischen Entscheidungsträgern ein Bewusstsein für die Gesellschaft in China zu schaffen. Durch Publikationen versuchen die Programm-Manager den Zugang zu den Informationen hierzulande zu erleichtern. Trotz allem sieht sich Straube nicht als China-Experte: “Ich finde, dass man von Aspekten von China eine Ahnung haben kann. Was mir oft fehlt, ist ein wenig mehr Bescheidenheit, was China anbelangt“.
Woher seine Leidenschaft für Asien kommt? Die wurde ihm “in die Wiege gelegt“, wie er sagt. Sein Vater studierte Asienwissenschaften an der Humboldt-Universität. Aber bereits seine beiden Großväter hatten berufliche Kontakte nach Asien. Besonders bemerkenswert, denn die Familie lebte in der DDR. Christian Straube zog es dann selbst früh nach Asien. Über den Austauschverein AFS machte er ein Auslandsschuljahr in Malaysia.
Dort war er regelmäßig mit Leuten aus der chinesischen Community unterwegs und lernte unter anderem das chinesische Neujahr kennen. Später studierte er Moderne Sinologie, Volkswirtschaftslehre und Politik Südasiens an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und schrieb seine Abschlussarbeit über die Auslandschinesen in Malaysia während der chinesischen Xinhai-Revolution. Alltagsgespräche im Chinesischen stellen für Straube kein Problem dar. Er sieht es aber als akute Herausforderung, die Sprache zu bewahren. Schließlich spricht er nicht nur Chinesisch, sondern auch Bemba. Für seine Doktorarbeit ging Christian Straube nämlich nach Sambia, wo er über chinesische Firmen im afrikanischen Kupfergürtel forschen wollte. Doch der Forschungszugang gestaltete sich so schwer, dass er den Forschungsschwerpunkt nochmal anpassen musste. “Die Industrie lässt sich nicht gerne in die Karten gucken“.
Seine Dissertation konnte er 2018 trotzdem fertigstellen. Das daraus entstandene Buch erzählt die Geschichte von materiellem und sozialem Zerfall sowie Erneuerung in einer ehemaligen Bergbau-Siedlung. Christian Straube ließ sich durch die Erfahrungen mit Chinas zunehmend zweifelhaftem Ruf in der Welt nicht demotivieren. Mit seiner Kollegin hat er in der Stiftung Asienhaus ein neues Projekt auf die Beine gestellt: Der zivilgesellschaftliche Dialog im Kontext der neuen Seidenstraße soll gestärkt werden. Organisationen aus den entsprechenden Ländern sollen hierfür vernetzt werden. Paula Faul
Vanessa Wang wird ab 1. September Head of Client Coverage bei dem deutschen Wertpapierhaus DWS am Standort Hongkong. Sie war bisher bei dem französischen Vermögendsverwalter Amundi beschäftigt. Sie berichtet bei DWS an Dirk Görgen, den Leiter Client Coverage Division in der Zentrale in Frankfurt.
Ben Meng wird neuer Chairman für Asien-Pazifik bei dem Investmenthaus Franklin Templeton. Zuvor hat er beim California Public Employees Retirement System gearbeitet. Meng soll mehr reiche Kunden für neue Anlageformen wie Private Equity oder Venture Capital gewinnen.
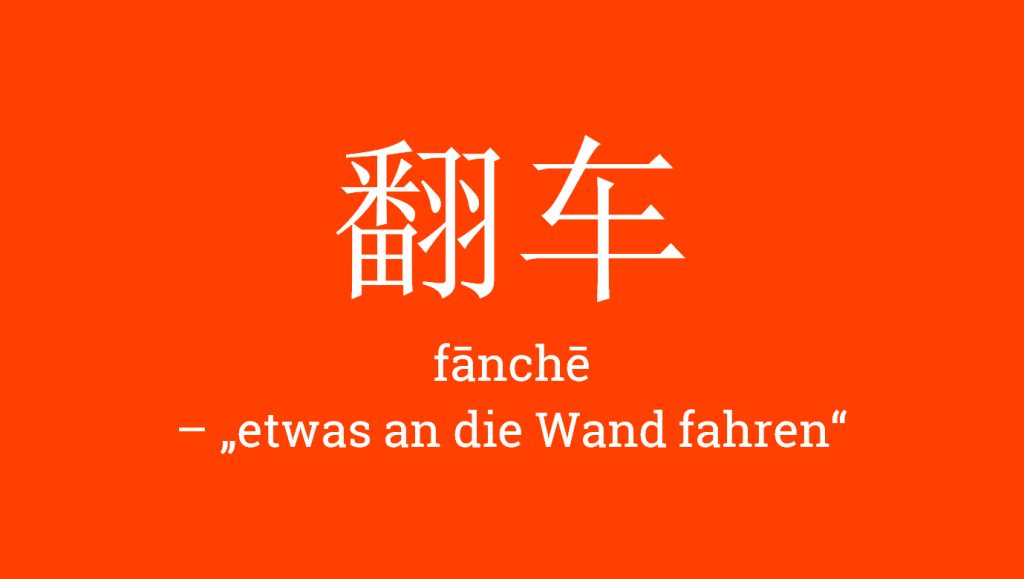
Mit viel PS und zu viel Bleifuß unterwegs auf der Überholspur? Vorsicht, Überschlagsgefahr! Im übertragenen Sinne gilt das auch für Chinas Datenautobahnen. Denn wer sich in den oberen Klickrängen der Internetstars und Influencer Fehltritte leistet, purzelt schnell tief.
翻车 fānchē – wörtlich “der Wagen überschlägt sich” – nennt man dieses Phänomen auf Chinesisch. Jüngstes Beispiel eines solchen “Crashs” ist der chinesische Celebrity Wu Yifan (吴亦凡 Wú Yìfán). Lange raste der Sänger, Tänzer und Schauspieler, der einst als Mitglied einer K-Pop-Boyband seinen Durchbruch feierte, großspurig und scheinbar ungebremst durch Chinas Promi-Olymp, hatte zahlreiche lukrative Werbedeals im “Handschuhfach”, unter anderem mit Louis Vuitton, Bulgari, Porsche und L’Oréal.
Seit einigen Tagen strauchelt der 30-jährige Beau jedoch inmitten eines heftigen MeToo-Sturms. Mehrere Frauen werfen dem Star sexuelle Übergriffe vor, einige davon sollen zum Zeitpunkt des Geschehens noch minderjährig gewesen sein. Sie bezichtigen Wu einer Ausbeutungsmasche in Weinstein-Manier. Wu bestreitet die Vorwürfe und die Gegenkampagne seines PR-Teams läuft auf Hochtouren. Doch die Karriere des chinesischen A-Promis scheint gründlich gegen die Wand gefahren. Alle großen Werbepartner haben ihre Zusammenarbeit bereits aufgekündigt. Es scheint ein Überschlagsszenario par excellence zu werden.
Das chinesische Schriftzeichen 翻 fān bedeutet wörtlich übrigens (unter anderem) “umkippen, wenden” oder “umblättern” (翻页 fānyè – eine Seite umblättern). Es taucht zum Beispiel auch im Wort “übersetzen” auf (翻译 fānyì). Der Trendbegriff 翻车 fānchē entstammt einer Wortwolke rund um das Autofahrmotiv, die sich in den letzten Jahren in der chinesischen Netz- und Jugendsprache ausgebreitet hat. Begonnen hat alles mit dem Schlagwort 老司机 lǎosījī “versierter Chauffeur” – ein Synonym für jemanden, der alle Ecken und Winkel seines Metiers wie die eigene Westentasche kennt und anderen eine “Mitfahrgelegenheit” durch das fremde Terrain bietet. Dank der “Streckenkenntnis” und Hilfe des “lǎosījī” gelangen andere so leichter ans Ziel.
Ursprünglich wurde “lǎosījī” vor allem in Foren und Chats zur Bezeichnung von versierten Surfern gebraucht, die Downloadlinks zu allen möglichen Ressourcen (资源 zīyuán), z.B. Spiele, Videos, Musik und E-Books, besaßen. Teilten diese “Chauffeure” ihre Quellen mit anderen Usern, hieß das “den Wagen fahren” (开车 kāichē). Wer das Ganze als Trittbrettfahrer herunterlud, “stieg in den Wagen ein” (上车 shàngchē). Und wer auf der Suche nach Downloadquellen war (求资源 qiú zīyuán), bat am besten einen erfahrenen Fahrer, ihn “mitzunehmen” (老司机带带我!Lǎosījī dàidai wǒ!).
Wurde das Material gelöscht, war im Internetjargon von 翻车 die Rede – die freie Fahrt auf der Datenautobahn hatte dann erst einmal ein Ende. Später stieg “fānchē” auch in der chinesischen Gamerszene zum Modewort auf. Wurde hier ein erfolgreicher Favorit überraschend vom Sockel gestoßen, sprach man auch hier vom “Autoüberschlag”.
Heute ist “fānchē” längst im chinesischen Alltagswortschatz angekommen, und zwar – je nach Kontext – als Synonym für “etwas vermasseln” oder “floppen”, sich mit etwas “auf die Schnauze legen”, als Gewinnertyp “einen Dämpfer kassieren” oder – um im Autobild zu bleiben – “etwas an die Wand fahren”. In diesem Sinne: Bleiben Sie auch weiterhin schön in der Spur!
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
auch diesen Montag gehen wir mit einem CEO-Talk online, den Sie hier im China.Table als Interview lesen können. Diesmal hat Frank Sieren mit Christian Sommer gesprochen, dem Chef des German Centre in Shanghai. Sommer blickt mit den Augen des Mittelstands auf das Chinageschäft und die internationalen Beziehungen: Die German Centres sind Dreh- und Angelpunkt der deutschen Gemeinschaft vor Ort.
Sommer warnt vor einer zunehmenden politischen Aufladung der Wirtschaftsbeziehungen, die seiner Ansicht nach beiden Seiten nur schaden kann. Zugleich beobachtet er in Deutschland eine zu große Behäbigkeit zum Beispiel bei der Digitalisierung. China will heute das eigene Schicksal, aber auch das der Weltwirtschaft aktiver bestimmen. Schließlich ist es bereits die Nummer zwei im Ranking der Volkswirtschaften.
Im Medaillenspiegel ist China nach dem ersten Olympia-Wochenende sogar die Nummer eins. Sechsmal Gold in drei Tagen – das verheißt große Erfolge beim weltgrößten Sportfest. Unser Autor Michael Radunski hat sich angesehen, in welchen Disziplinen die Volksrepublik besonders üppig abräumen wird. Denn eins ist klar: Eine Schlappe wie in Rio will Präsident Xi nicht noch einmal sehen. Vor fünf Jahren war die sozialistische Sportnation auf Platz drei abgesackt. Das war immer noch ein gutes Ergebnis, möchte man meinen. Doch aus Gründen der Außendarstellung ist gerade in Japan – und ein halbes Jahr vor den Spielen im eigenen Land – ein anderer als der erste Platz geradezu undenkbar.
Einen guten Start in die Woche wünscht

Selbst nach seinem Erstkontakt mit China in den 1980er-Jahren war noch längst nicht abzusehen, dass er sein Leben im Reich der Mitte verbringen würde: Christian Sommer ist Sohn eines Elektromeisters aus Kiel und befand sich zunächst auf einem ganz biederen Karriereweg als Rechtsgehilfe. Heute ist er eine der am besten vernetzten Persönlichkeiten unter deutschen mittelständischen Unternehmen im Großraum Shanghai.
Sommer hatte Jura studiert, wurde Fachanwalt für Steuerrecht und kam Januar 1995 nach Shanghai, um für eine deutsche Kanzlei zu arbeiten. Die Tätigkeit wurde ihm jedoch schnell langweilig. Nach gut einem Jahr wechselte er als stellvertretender Leiter ins German Centre Shanghai. Danach hat er sechs Jahre lang das German Centre in Peking für die Landesbank Baden-Württemberg aufgebaut, nur um dann wieder nach Shanghai zurückzukehren – diesmal als Chef. Seit über 15 Jahren ist er dort nun der CEO.
Ein einzelner Standort in Shanghai reichte jedoch weder Sommer noch den Bedürfnissen der deutschen Wirtschaft vor Ort. Zwischendurch hat er daher neue Filialen in Taicang und in Qingdao eröffnet. Hunderte deutsche Firmen betreut er nun fast rund um die Uhr. Darüber hinaus veranstaltet Sommer deutsch-chinesische Tischtennis-Turniere. Mit schwarzer Sonnenbrille und Bass sieht man ihn auf Musik-Festivals. Seine Band heißt ShangHigh Voltage und klingt auch so: AC/DC aus Fernost plus eigene Songs. Tagsüber ist Christian Sommer aber ganz klar: Mr. German Centre.
In der Zeitspanne, in der Du in China lebst, also weit über 20 Jahre, waren die politischen Spannungen zwischen China und Europa nie so groß wie jetzt. Wie macht sich das bei den Unternehmen im German Centre bemerkbar?
In den Zentralen in Deutschland ist das Thema sicherlich präsenter als in China. Hier hingegen bereiten die Folgen der Corona-Pandemie viel größere Sorgen. Das Hauptproblem der Mittelständler ist schlicht und ergreifend, dass ihre Ingenieure aus Deutschland derzeit nicht hierherkommen können. Das bedeutet, die Maschinen sind geliefert und können nicht aufgebaut werden. Oder sie müssen gewartet werden und sind deshalb nur eingeschränkt in Betrieb. Denn all das wird noch immer von erfahrenen Spezialisten aus Deutschland gemacht. Die Chinesen sind zwar schon entsprechend ausgebildet, aber ihnen fehlt noch die zum Teil Jahrzehnte lange Erfahrung. Und auch umgekehrt: Chinesen, die in Deutschland geschult werden müssten, bekommen derzeit kein Visum. Das Geschäft stockt deshalb.
Aber sind die strengen Quarantäne-Regeln nicht sinnvoll?
Es liegt nicht nur an den strengen Quarantäne-Regeln. Man muss in China mindestens zwei Wochen in Hotelquarantäne. Das ist durchaus sinnvoll und würde von den Ingenieuren auch in Kauf genommen. Wir leben in China außerhalb öffentlicher Gebäude und Verkehrsmittel ja praktisch ohne Maske. Doch über den gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen hat sich nun noch der politische Clinch gelegt, nach dem Motto: Wie Du mir so ich Dir. Das finde ich nicht zielführend. Das habe ich so auch unter anderem dem deutschen Generalkonsulat in Shanghai gesagt. Es ist ja wahrscheinlich, dass sich die chinesischen Quarantänebeschränkungen noch bis weit ins nächste Jahr hinziehen. Da muss es möglich sein für die deutsche Wirtschaft eine bessere Lösung zu finden.
Ist das nicht auch der Versuch von China mal zu testen, inwieweit man auch ohne Ausländer zurechtkommt?
Ja, das wird hier und da gemunkelt. Das könnte ein Nebeneffekt sein. Aber ich glaube wirklich nicht, dass das der Hauptgrund ist. Denn China sucht ja internationale Qualität und Qualifikation. Das zeigt die normale Visapolitik deutlich.
Braucht China denn noch Ausländer?
Ja. Und glücklicherweise nicht nur die Vertreter der deutschen Industrie, sondern den weltweiten Austausch. Das ist ja eine Stärke der Globalisierung: Niemand kann alles. Auch die chinesische Politik ist realistisch genug, das nicht zu glauben. Der Austausch von Menschen ist in der Globalisierung notwendig. Fachkenntnisse sind weder nur deutsch, nur amerikanisch, französisch, nur japanisch noch nur chinesisch, obwohl China ein großes Land ist. Die internationalen Kenntnisse zu bündeln und daraus einen Mehrwert zu schaffen, ist ja eine Stärke der Globalisierung.
Gleichzeitig spricht man im Westen, aber auch in China, von gegenseitiger Entkopplung.
Auch dafür gibt es gute Gründe. Die Abhängigkeit, die durch immer engere Zusammenarbeit entsteht, fühlt sich in Krisenzeiten unangenehm an. In politisch schwierigen Zeiten versucht man, sich von der Umklammerung zu befreien. Die Unternehmen wollen ja Geschäfte machen und nicht Politik. Für diesen Wunsch habe ich Verständnis.
Wie die Realität aussieht, lässt sich bei den Halbleitern gut beobachten: Da gibt es eben nur eine paar Firmen, die die Mikrochips in großen Mengen herstellen können. Wenn die Politik sich dort einmischt, nach dem Motto, die Chinesen dürfen keine Chips kaufen, die mit dem Know-how amerikanischer Firmen gebaut werden, dann schadet das auch unserer Wirtschaft, weil fast alles in China produziert wird. Wir lernen gerade, dass eine Politik, die die Wirtschaft zwingen will, sich für China oder die USA zu entscheiden, wirtschaftlich keinen Sinn hat. Für Konzerne nicht und für den Mittelstand schon drei Mal nicht.
Der deutsche Mittelstand hat in China die Plattform der German Centres. Über so etwas verfügt kein anderes Land. Warum ist das so?
Es gibt eben kein Land, das einen so großen industriellen Mittelstand hat, die sogenannten Hidden Champions. Da lag es auf der Hand, die Kräfte in einem Zentrum zu bündeln, Synergien zu schaffen. Inzwischen sind wir sogar sozusagen German Centre International, denn auch nicht-deutsche Firmen schätzen unser Netzwerk. Wir haben in Shanghai aktuell knapp 130 Firmen, davon sind zwei Drittel deutschen Ursprungs. Das letzte Drittel ist über die Welt verteilt.
Diese Offenheit ist eine Stärke Deutschlands. Und inzwischen sind wir nicht nur ein Hub der deutschen Wirtschaft, ein Landeplatz also, sondern auch ein Startplatz für chinesische Unternehmen auf dem Weg nach Deutschland. Ein sehr positives Beispiel dafür, wie die Wirtschaft und der Staat sinnvoll zusammenarbeiten können. Denn die ursprüngliche Idee war, dass die Bundesländer, vor allem Bayern und Baden-Württemberg, gesagt haben, wir wollen unserer mittelständischen Industrie helfen, in die Welt zu gehen. Die Landesbanken haben dann den Aufbau übernommen und investiert. Die German Centre sind schon viele Jahre profitabel. Deshalb planen wir weitere neue Standorte. Denn China wird noch viel wichtiger für die deutsche Wirtschaft werden.
Wo drückt außer den Visa-Restriktionen der Schuh sonst noch für den deutschen Mittelstand?
Der Schuh drückt vor allem zu Hause, wenn es darum geht, gegenüber China wettbewerbsfähig zu bleiben. Was die Digitalisierung betrifft, sind wir einfach nicht mehr vorne. In Deutschland, in Europa wird viel darüber geredet, aber vergleichsweise wenig gemacht. Das finde ich aus chinesischer Perspektive schon erschreckend, wenn man sieht, wie schnell Innovationen in China ausgerollt werden. In Deutschland ist das Internet grottenschlecht. Und da reden wir noch nicht einmal über 5G.
Ist der deutsche Mittelstand also gezwungen, immer mehr Geschäft nach China zu verlagern?
Corona bremst die Entwicklung zwar derzeit. Aber ansonsten ist das so. Und dabei schaue ich nicht nur auf die Digitalisierung, sondern auf die Frage: Wo bekomme ich Fachkräfte her, in der richtigen Balance zwischen Ausbildung und Lohnkosten. Und ich schaue natürlich, wo sind meine Wachstumsmärkte. Da möchte ich vor Ort sein, um Veränderungen schnell und unmittelbar mitzubekommen.
Das hört sich fast so an, als ob die größte Klage beim Mittagessen in der Kantine des German Centres die Klage über Deutschland ist. Ist das realistisch?
Es geht gar nicht darum, Deutschland schlecht zu reden und China gut. Aber das sind tatsächlich die Gesprächsthemen. Unsere Unternehmen sind in Deutschland, in Europa stark geworden. Aber derzeit ist Deutschland für uns in der Entwicklungsgeschwindigkeit, was die Überregulierung betrifft, in der Verschuldung oder in der Ausbildungsqualität kein Vorteil. So empfinden das die Unternehmen.
Kürzlich gab es ein Treffen in Taicang bei Shanghai. Da saßen 400 deutsche Firmen. Der Tenor, und das sind nicht meine, sondern deren Worte: China hat einen Plan. Ich weiß, was ich machen kann. Ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Ich weiß, wie die nächsten Jahre ablaufen. In Europa vermissen wir das. Wir machen natürlich Umsatz in Europa. Aber was die Zukunftsfähigkeit anbelangt müssen wir aufpassen, dass wir in Europa nicht verlieren.
Aber es gibt auch in China viel politische Willkür und Unterdrückung in der heillosen Kombination mit einem schwachen Rechtsstaat.
Das ist zweifellos richtig. Man sollte jedoch differenzieren. Die politischen Probleme sind in der Zivilgesellschaft viel stärker spürbar als in der Wirtschaft. Und innerhalb der Wirtschaft stärker in Konzernen als beim Mittelstand. Beim Mittelstand steht – noch einmal – an erster Stelle die Feststellung, dass man hier sehr gute Geschäfte machen kann. Und das ist kein geschönter Eindruck. Es spiegelt sich auch in den anonymen Umfragen wider.
Viele Unternehmen haben mir zudem berichtet, dass das vergangene Corona Jahr das beste ihrer Geschichte war. Das bedeutet jedoch nicht, dass vieles in anderen Bereichen in China auch zu kritisieren ist beziehungsweise werden muss. Allerdings ist es wichtig zu sehen, dass im Alltag die größeren Sorgen in Richtung Deutschland gehen. Im Übrigen bedeutet die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ja durchaus, dass man auch seine Werte in der Welt selbstbewusster vertreten kann. Wenn wir wirtschaftlich bedeutungslos sind, hört uns niemand mehr zu. Die Chinesen schon gar nicht.
Was sind für Dich die größten zivilgesellschaftlichen Schwächen?
Neben dem noch schwach ausgeprägten Rechtssystem ist in den letzten Jahren viel Freiraum und Offenheit verloren gegangen. Das empfinden vor allem die chinesischen Manager – und viele deutsche Firmen haben ja inzwischen chinesische Generalmanager – als einen Rückschritt.
Woran liegt das?
An der Zentralregierung und der KP. Ich vermute, dass die Partei das Gefühl hat, durch das Wachstum der Wirtschaft haben die westlichen Werte ein zu großes Gewicht bekommen. Das möchte man nun bremsen. Die Partei sagt: Wir müssen die eigene Richtung, die eigene Entwicklung Chinas, den eigenen Weg deutlicher definieren. Dazu gehören auch eigene Wertvorstellungen. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sicherlich in stärkeren Maß als seine Vorgänger den unbedingten Willen, einen eigenen Weg auszuprobieren. Aber er lebt auch in günstigeren Zeiten dafür. Für die Nummer 2 der Weltwirtschaft ist das einfacher als für Nummer 7.
Müssen wir angesichts dieser Entwicklung nicht auch unsere Werte offensiver vertreten? Sind deshalb die Sanktionen nicht sinnvoll? Nach dem Motto: bis hierher und nicht weiter?
Ich wurde neulich von der Tochter des Inhabers eines deutschen Unternehmens angerufen, das in China produziert. Sie soll nun das Geschäft übernehmen und hat mich gefragt: Wie könne sie es moralisch rechtfertigen, in China Geschäfte zu machen. Ich habe geantwortet: Indem wir im Dialog die Dinge zum Besseren wenden. Sanktionen bringen nichts. Denn Sanktionen bedeuten vor allem eines: Ich will nicht mehr reden. Ich will etwas erzwingen. Dabei gibt es meist nur ein Ergebnis: Es zeigt sich, dass ich dazu die Macht nicht habe. Das ist kein Weg, um die Lage in China zu verbessern. Und darum geht es uns ja allen.
Ich habe dieser Frau folgendes gesagt: Unsere Präsenz hat Vorbildcharakter. Ich sehe, was die Präsenz der Ausländer in China allein in der Zeit, in der ich in China bin, bewirkt hat, bei Kinderarbeit, Arbeitszeiten, Bezahlung, Sicherheit am Arbeitsplatz, Hygienestandards und all den anderen sozialen Menschenrechten. Generell sind wir in der Art, wie wir Mitarbeiter behandeln, ein großes Vorbild. Wir sollten unseren Einfluss nicht unterschätzen, auch wenn sich nicht alles so schnell zum Besseren entwickelt, wie wir uns das wünschen.
Diesen Einfluss aufzugeben, weil es Bereiche gibt, die nicht nur rückständig, sondern unseren Werten sogar gegenläufig sind, halte ich für falsch. Wir werden uns im Übrigen daran gewöhnen müssen, dass wir unterschiedliche Systeme in der Welt haben, übrigens in China in einer viel größeren Übereinstimmung zwischen der Bevölkerung und ihrer Regierung, als wir gemeinhin annehmen. Auch, wenn wir aus guten Gründen und mit Selbstbewusstsein vertreten, dass unsere Werte die mit Abstand besten Werte der Welt sind.
Es ist ein Start nach Maß für China. Die erste Goldmedaille der Olympischen – Sommerspiele in Tokio holte Yang Qian 杨倩 im 10-Meter-Schießen mit der Luftpistole. Und damit nicht genug. Wenig später sicherten Hóu Zhìhuì 侯志慧 im Gewichtheben der Frauen (49kg) und Sūn Yīwén 孙一文 im Fechten für China die nächsten Goldmedaillen bei diesen Spielen. Damit steht die Volksrepublik bis Sonntagabend ganz oben im internationalen Medaillenspiegel – mit sechsmal Gold, einmal Silber und viermal Bronze.
In Tokio wird in 33 Sportarten um Medaillen gerungen, gerannt, geschwommen, gefahren, gesprungen oder geschossen. Genau 339 Mal wird dabei die höchste Auszeichnung vergeben: die olympische Gold-Medaille. Fans, Buchmacher und so mancher Staatspräsident blicken gespannt nach Tokio und fragen sich: Wer alles kann noch Gold gewinnen?
China scheint bei dieser Frage auf den ersten Blick einen recht simplen Ansatz zu verfolgen: viele Athlet:innen = viele Medaillen. 431 Sportler:innen sollen möglichst viele Auszeichnungen einheimsen. Nur 2008 bei dem eigenen Spielen in Peking schickte man noch mehr Aktive an den Start, nämlich 639. Und damals ging der Plan auf: 48-mal Gold für die Volksrepublik! Kein anderes Land gewann in Peking so viele Wettbewerbe wie China.
Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio erlebte man hingegen einen regelrechten Absturz. Mit “nur” 26-mal Gold landete die Volksrepublik auf Rang drei im Medaillenspiegel – noch hinter Großbritannien. Es bedarf keiner ausufernden Ausführungen, dass so etwas für Peking nicht akzeptabel war. Entsprechend wurde in den vergangenen Jahren viel Geld investiert in Übungsstätte, Trainingsprogramme und ausländische Trainer. Bleibt abzuwarten, ob sich das bei den Olympischen Spielen in Tokio auszahlen wird.
Dass sich Erfolg im Sport kaum vorausplanen lässt, ist weithin bekannt. Doch bei den aktuellen Wettbewerben kommen weitere Unwägbarkeiten hinzu: Zum einen werden die Spiele ohne Publikum in den Wettkampfstätten ausgetragen; zum anderen wurden sie wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben. So haben die meisten chinesischen Sportler:innen aufgrund der strikten Reiseeinschränkungen in der Volksrepublik knapp zwei Jahre lang kaum an internationalen Wettkämpfen teilnehmen können.
Dennoch wagen wir von China.Table einen Blick in die Glaskugel und stellen einige der chinesischen Medaillenhoffnungen vor:
Dass China nahezu alle Goldmedaillen im Tischtennis abräumt, war bislang so sicher wie das Gold in Fort Knox. Ob bei den Frauen oder den Männern – seit 1988 hat die Volksrepublik im Tischtennis 28 von 32 möglichen Goldmedaillen gewonnen.
Doch genau hier ist der erste Eklat der Tokioter Spiele ausgebrochen: Beim Tischtennis wischen die Spieler:innen immer wieder mit der feuchten Hand über die Platte oder pusten auf den Ball. Doch was manchem als Marotte erscheinen mag, hat große Auswirkungen auf das Spiel: Benetzen Mikrotropfen vom Schweiß der Spieler die technisch austarierten Bälle, entwickeln sie beim Anschneiden einen anderen Spin – was vor allem für das Spiel des chinesischen Topstars Mǎ Lóng 马龙 wichtig ist. Bei den Olympischen Spielen in Tokio allerdings wurden Abwischen und Pusten aus Hygiene-Gründen kurzfristig untersagt, was nun vor allem bei den Chinesen für großen Unmut sorgt. Noch vor dem ersten Aufschlag ist bereits die Rede von Manipulation und gezielter Benachteiligung.
Doch Regeländerung hin oder her, die besten Tischtennisspieler:innen stammen aus China. Bei den Männern sind das neben Mǎ auch Fán Zhèndōng 樊振东 im Einzel und Xǔ Xīn 许昕 im Team-Wettbewerb. Doch mit Tomokazu Harimoto 張本智和 hat zuletzt ausgerechnet ein Japaner die chinesische Phalanx in der aktuellen Weltrangliste durchbrochen und sich zwischen die Chinesen auf Platz 3 geschoben. Nun hoffen nicht nur die Japaner:innen, dass der 18 Jahre alte Harimoto in Tokio Chinas Seriensieger das Fürchten lehren möge. Aber: Auch der Tresor von Fort Knox konnte bislang von niemandem geknackt werden.
Bei den Frauen sind Chén Mèng 陈梦 und Sūn Yǐngshā 孙颖莎 Chinas Topspielerinnen. Doch auch hier hat sich die Japanerin Mima Ito 伊藤美誠 auf Platz 2 dazwischen geschoben. Dennoch wird eine Wette auf die beiden Chinesinnen bei ihrem lokalen Buchmacher bestimmt als sichere Bank angesehen.
War Tischtennis bislang für China eine weitgehend klare Sache, so ist es das Turmspringen umso mehr. Hier lautet Chinas Zielsetzung in Tokio: Alles gewinnen. Was für manchen arrogant klingen mag, spiegelt schlicht die Leistungsstärke der chinesischen Athlet:innen wider.
Bei den Frauen gilt die Aufmerksamkeit vor allem Shī Tíngmào 施廷懋 und Zhāng Jiāqí 张家齐. Shī hat schon bei den Spielen in Rio vom 3-Meter-Brett zwei Goldmedaillen gewonnen – und konnte ihre Serie in Tokio am Sonntag fortsetzen: einmal Gold. Die 17 Jahre alte Zhang ist derweil aktuelle Weltmeisterin vom 10 Meter-Brett, tritt bei Olympischen Spielen allerdings zum ersten Mal an. Im Synchronspringen sollte sie zusammen mit Chen Yuxi Gold gewinnen. Und China hat noch ein weiteres Ass im Ärmel bzw. auf dem 10-Meter-Turm: Quán Hóngchán 全红婵. Mit gerade mal 14 Jahren ist sie die jüngste chinesische Athletin in Tokio – und doch schon eine Siegerin: Denn mit 13 gewann sie bereits die nationalen Meisterschaften in China.
Bei den Männern sind Chinas sicherste Goldhoffnungen wohl Chén Àisēn 陈艾森 und Cáo Yuán 曹缘 im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm.
Der American-Football-Trainer Vince Lombardi soll einst gesagt haben: Gewinnen ist eine Gewohnheit. Im Badminton hatte viele Jahre Lín Dān 林丹 so eine Gewohnheit. Der Chinese aus Fujian gewann Spiel um Spiel, zweimal die Gold-Medaille, fünfmal die Weltmeisterschaft, sechsmal die All England – und mit 28 Jahren alle großen Turniere – als bislang einziger Spieler der Welt.
Doch für die Spiele in Tokio lautet die Hauptmeldung: Super Dān ist nicht dabei. Der vielleicht beste Spieler aller Zeiten ist der Verschiebung der Olympischen Spiele zum Opfer gefallen. Die Wettkämpfe in Tokio wären seine fünften Spiele gewesen und sollten den krönenden Abschluss seiner Karriere bilden. Doch während die Spiele verschoben wurden, hielt Super Dān an seinem Plan fest und beendete mit 37 Jahren im Sommer seine Karriere.
In Tokio dabei ist dafür Chén Lóng 谌龙. Der Olympia-Sieger von Rio hat zuletzt jedoch dramatisch an Form verloren. Sollten sie also darüber nachdenken, auf den Ausgang der Turniere zu wetten und scheuen das etwas das Risiko, wäre dieses Mal eventuell der Japaner Kento Momota 桃田賢斗 die bessere Wahl.
Bei den Frauen greift Chén Yǔfēi 陈雨菲 für China nach Gold. Doch hier wird es kompliziert – sportlich: weil Nozomi Okuhara 奥原希望 aus Japan ebenfalls stark ist; und politisch: weil auch Tai Tzu-Ying gute Chancen hat, die Goldmedaille zu gewinnen – und zwar für Taiwan, das unter dem Namen Chinesisch Taipeh an den Olympischen Spielen teilnimmt. Also doch für China, mag manch politischer Beobachter einwenden. Doch Sport kann eben herrlich kompliziert sein.
Hier führte lange Zeit kein Weg an Chinas Athlet:innen vorbei. Mittlerweile schon. Vor allem Indien, Italien und Deutschland drängeln sich hin und wieder an der Volksrepublik vorbei auf den obersten Podestplatz. Doch Yang Qian 杨倩 zeigte am Samstag im 10-Meter-Schießen der Frauen mit der Luftpistole, dass mit China weiter zu rechnen ist. Und ginge es nur nach der aktuellen Form, würde Xióng Yàxuān 熊亚瑄 eine weitere Gold-Mediale für China erschießen. Schließlich hat die 24 Jahre alte Schützin im März einen neuen Rekord im 25-Meter-Pistolenschießen aufgestellt.
Während sich China politisch und wirtschaftlich zu einem Schwergewicht entwickelt, liegen die Stärken beim Gewichtheben eher in den leichteren Klassen. Bei den Männern sind das vor allem Lǐ Fābīn 李发彬 (61kg), Chén Lìjūn 谌利军 (67kg), Shí Zhìyǒng 石智勇 (73kg) und Lǚ Xiǎojūn 吕小军 (81kg). Sie alle sind in ihren Klassen aktuell Weltmeister, wobei Li, Shi und Lu ganz nebenbei auch noch die aktuellen Weltrekorde innehaben. Chen und Li konnten am Sonntag auch schon ihre ersten Goldmedaillen gewinnen.
Auch Chinas Frauenteam ist im wahrsten Sinne des Wortes stark. Zwar fehlen mit Dèng Wēi 邓薇 (64kg) die Goldmedaillengewinnerin von Rio und mit Jiǎng Huìhuā 蒋惠花 (55kg) die aktuelle Weltrekordhalterin, doch Hóu Zhìhuì 侯志慧 (49kg) hat am Samstag gezeigt, wie kräftig Chinas Frauen sind. Ihr stehen Liào Qiūyún 廖秋云 (55kg), Wāng Zhōuyǔ 汪周雨 (87kg) und Lǐ Wénwén 李雯雯 (87kg) in kaum etwas nach, sodass mindestens eine weitere Goldmedaille für die Volksrepublik gehoben werden sollte.
Doch auch hier gibt es einen politischen Fallstrick; ihr Name ist Kuo Hsing-chun (59kg). Die 27-Jährige ist viermalige Weltmeisterin und hat sowohl die Universade wie auch die Asien-Spiele gewonnen. In Tokio soll Kuo nun Gold gewinnen – für Taiwan oder wie bereits erwähnt: für Chinesisch Taipeh. Doch auch Kuo hat ein Problem: “Die Verschiebung der Spiele um ein Jahr ist eine große Herausforderung, da ich nun schon fast 27 Jahre alt bin. Das Alter bereitet mir Sorgen“, sagte Kuo der South China Morning Post. Diese Sorgen möchte man haben.
Hier scheint es, als wären die guten alten Zeiten für China tatsächlich so langsam vorbei. 2008 in Peking konnte man noch 11 Goldmedaillen gewinnen – neun mehr als die USA und Russland zusammen. Doch schon in Rio 2016 sprangen für die Volksrepublik nur noch einmal Silber und viermal Bronze raus. Und für Tokio haben sich die Aussichten nicht sonderlich gebessert. Allerdings sollte man Chinas Turner:innen nicht voreilig abschreiben. Während der Corona-Pandemie haben sie an keiner Weltmeisterschaft teilgenommen, sondern fleißig in China trainiert. Und so sollte zumindest ein Tipp aufgehen: Gāo Lěi 高磊 ist und bleibt der König des Trampolins.
Fahnenträger im Team China sind die Volleyballerin Zhū Tíng 朱婷 und der Taekwondo-Kämpfer Zhào Shuài 赵帅. Beide haben durchaus Chancen, mit Gold aus Tokio heimzukehren. Chinas Volleyballerinnen haben schon in Rio Gold gewonnen. Doch dann fehlte Zhū Tíng 朱婷 – und mit ihr verließ auch das Spielglück das Team. Nun ist zumindest Zhū Tíng 朱婷 als Kapitänin zurück.
Auch Zhào Shuài 赵帅 konnte in Rio Gold gewinnen. Doch der Taekwondo-Kämpfer sieht sich in Tokio ebenfalls mit einer Herausforderung konfrontiert. In Rio konnte er mit 58kg alle Konkurrenten schlagen. Doch in den vergangenen fünf Jahren hat Zhào Shuài 赵帅 zugelegt und muss nun in der 68kg-Gewichtsklasse antreten, wo er in der Weltrangliste hinter dem Südkoreaner Lee Dae-hoon und dem Briten Bradly John Sinden lediglich auf Platz 3 rangiert.
Der Kampf um die Medaillen in Tokio wird also spannend. Doch wenn China auf den Medaillenspiegel von Tokio blickt, hat so mancher seine Gedanken schon in der nahen Zukunft. Durch die Verschiebung der Sommerspiele um ein Jahr beginnen nur wenige Monate später bereits die Winterspiele in Peking. “Weil die Winterspiele direkt vor der Tür stehen, will China mit guten Resultaten in Tokio eine Sport-Euphorie entfachen”, schreibt der chinesische Sportblogger Ma Bowen auf Weibo. “Wenn die Chinesen den Vibe in Tokio spüren, werden sie anschließend viel mehr Beachtung den Spielen in Peking schenken.”
US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman wollte mit ihrem Besuch eigentlich für Entspannung im schwierigen Verhältnis ihres Landes zu China sorgen. Doch kurz vor ihrer Ankunft in Tianjin am Sonntag hat Peking zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, was ihre Mission nun deutlich erschwert. Als Vergeltung für Strafmaßnahmen der USA gegen Repräsentanten des chinesischen Verbindungsbüros in Hongkong hat die chinesische Führung staatlichen Medienberichten zufolge Sanktionen gegen sieben Personen und Institutionen in den USA verhängt. Betroffen sind unter anderem der frühere US-Handelsminister Wilbur Ross sowie Carolyn Bartholomew, die Vorsitzende der Wirtschafts- und Sicherheitskommission für den Umgang mit China (USCC). Auch die Nichtregierungsorganisation Hongkong Democratic Council und Sophie Richardson von Human Rights Watch stehen auf der schwarzen Liste.
Als bisher ranghöchste Vertreterin der USA seit Joe Bidens Präsidentschaft ist Sherman am Sonntag für zwei Tage in die Volksrepublik gereist. Die USA wollten die Kommunikationskanäle offenhalten und weiter eine freimütige Diskussion pflegen, sagte ein US-Regierungsbeamter. “Besonders, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, ist es wichtig, das Potenzial von Missverständnissen zwischen unseren Ländern zu reduzieren.” Sherman wird am Montag unter anderem Chinas Außenminister Wang Yi und den für die USA zuständigen Vizeaußenminister Xie Feng treffen. Die Gespräche finden allerdings nicht in Peking statt, sondern in der 130 Kilometer entfernten Stadt Tianjin, angeblich aus Gründen des Infektionsschutzes.
Kurz vor ihrer Ankunft hat Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian die USA aufgefordert, sich nicht weiter in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen. Die USA versuchten, eine Konfrontation zu provozieren und China in seiner Entwicklung zu bremsen. Washington habe kein Recht China zu belehren und sollte aufhören Peking zu “verleumden”. Außenminister Wang warf den USA vor, “auf herablassende Weise Druck auf andere auszuüben”. Wang weiter: “Ich will den USA sagen, dass es kein Land gibt, das einem anderen übergeordnet ist, und es sollte auch keines geben.“
In der US-Hauptstadt haben unterdessen vier US-Abgeordneten das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgefordert, die Winterspiele in einem halben Jahr in Peking zu verschieben. Als Grund nennen sie den anhaltenden Völkermord an den Uiguren in Xinjiang und anderen muslimischen Minderheitengruppen in der Volksrepublik. “Wir haben keine Beweise dafür gesehen, dass das IOC irgendwelche Schritte unternommen hat, um die chinesische Regierung zu drängen, ihr Verhalten zu ändern“, erklärt die Gruppe in dem an IOC-Präsident Thomas Bach gerichteten Schreiben.
Auch in Europa wird der Unmut über Chinas Menschenrechtsverletzungen größer. Die niederländische Stadt Arnheim hat nach einer Entscheidung des Gemeinderates die seit mehr als 20 Jahren bestehende Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Wuhan aufgekündigt. flee
Die heftigen Regenfälle der vergangenen Woche haben die Menschen in der zentralchinesischen Provinz Henan noch nicht überwunden (China.Table berichtete), die Aufräumarbeiten sind noch mitten im Gange. Doch nun drohen bereits weitere Überschwemmungen. Staatlichen Medien zufolge könnte der Taifun “In-Fa” in den nächsten Tagen sogar für weitere heftige Regenfälle sorgen.
Der schwere Tropensturm hat am Sonntag die ostchinesische Küste im Ballungsraum um Shanghai erreicht. Mit heftigen Regenfällen traf er bei der Stadt Zhoushan an der ostchinesischen Küste auf Land, die Provinz Zhejiang rief die höchste Alarmstufe auf. Die Nationale Wetterbehörde warnte, dass mit bis zu 350 Liter Regen pro Quadratmetern zu rechnen sei.
Sämtliche Flüge der beiden internationalen Flufhäfen der Hafenmetropole wurden vorsorglich abgesagt, ebenso an den Flughäfen Hangzhou und Ningbo. Die Behörden strichen auch die Fahrten aller Hochgeschwindigkeitszüge von und nach Shanghai. Disneyland und andere Vergnügungsparks mussten ihre Pforten schließen, ebenso Märkte, Geschäfte und Schulen. Es ist der bereits sechste Taifun in diesem Jahr. Wegen der schweren Niederschläge befürchten auch die Provinzregierungen von Jiangsu, Anhui und Henan, dass Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Es kann also zu weiteren schweren Überflutungen kommen.
Heftige Regenfälle haben in der vergangenen Woche vor allem in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan, und umliegenden Regionen für die schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten gesorgt. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In einer überfluteten U-Bahn sowie einem vollgelaufenen Straßentunnel fanden die Behörden weitere Leichen, die Zahl der Toten ist offiziellen Angaben damit auf inzwischen 63 gestiegen.
Beim Treffen der G20-Umweltminister in Neapel am Wochenende haben sich die Fachminister indes auf keine ehrgeizigeren Klimaziele einigen können. In der gemeinsamen Abschlusserklärung fehlt nach Darstellung des italienischen Ministers Roberto Cingolani ein Bekenntnis, die Erderwärmung bis 2030 unter 1,5 Grad zu halten. Vor allem China, Indien und Russland haben Beobachtern zufolge blockiert: Sie wollen vorerst an der Nutzung fossiler Energie festhalten. UN-Klimachefin Patricia Espinosa mahnte dagegen die G20-Gruppe aus führenden Industrie- und Schwellenländern, sie sei allein für 80 Prozent aller globalen Emissionen verantwortlich. Ohne die G20 gebe es keinen Weg zu den 1,5 Grad. flee
Mehr als drei Jahrzehnte ist es her, seit ein chinesischer Staat- und Parteichef zuletzt in Tibet war. Präsident Jiang Zemin hatte 1990 die autonome Region besucht. Wie am Freitag bekannt wurde, hat der nun der amtierende Staats- und Parteichef Xi Jinping vergangenen Mittwoch Tibets Hauptstadt Lhasa besucht und war wohl auch kurz in der Stadt Nyingchi. Der staatliche Fernsehsender CCTV zeigte am Freitag, wie Xi beim Verlassen seines Flugzeugs am Flughafen von Nyingchi eine Menschenmenge mit chinesischen Flaggen und traditioneller tibetischer Kleidung begrüßte. Später sei Xi auch vor dem Potala-Palast aufgetreten. Der Palast ist der ehemalige Sitz des im Exil lebenden Dalai Lama.
Dem Staatssender zufolge forderte Xi die örtlichen Vertreter der Kommunistischen Partei dazu auf, das “Fundament der patriotischen und anti-separatistischen” Erziehung in Tibet zu festigen. Sie müssten die “Identifikation aller ethnischen Gruppen mit dem großen Mutterland erhöhen”, sagte der Staatschef demnach. Xi schaute sich mehrere Infrastrukturprojekte in der Region an, darunter einen umstrittenen Staudamm, der am Bramaputra gebaut werden soll.
Über die Gründe des unangekündigten Besuchs wird nun auch in Kreisen von Tibet-Unterstützer:innen spekuliert. Der Organisation International Campaign for Tibet (ICT) zufolge könnte der Besuch mit dem 70-jährigen Jahrestag des umstrittenen 17-Punkte-Abkommens zusammenhängen. Dessen Unterzeichnung im Jahre 1951 beendete die De-Facto-Unabhängigkeit Tibets. In den Jahren zuvor hatten Einheiten der Volksbefreiungsarmee Tibet besetzt.
Exil-Tibeter werfen der chinesischen Führung vor, ihre Kultur und Religion gewaltsam zu unterdrücken. Zuletzt hatte es 2008 in der Region schwere Unruhen gegeben. Xi war in seinem Leben zweimal in Tibet: Im Jahr 1998 als Parteichef der Provinz Fujian und 2011 als Vizepräsident. Als Staatsführer war ihm eine Reise offenbar bislang zu heikel.
Tibet-Aktivist:innen halten die Visite für hochgradig bedeutsam. “Nach unserer Auffassung verdeutlicht der Besuch von Präsident Xi Jinping, welche wichtige Rolle die autonome Region in den politischen Überlegungen der chinesischen Regierung spielt, vor allem wenn man berücksichtigt, dass der Besuch mit dem 70. Jahrestag der angeblich ‘friedlichen Befreiung’ Tibets verknüpft ist”, vermutet Kai Müller, Geschäftsführer von ICT in Deutschland. “Die Art und Weise, wie der Besuch organisiert wurde, ohne dass chinesische Staatsmedien darüber berichteten, zeigt, dass Tibet für die chinesische Führung weiterhin ein sensibles Thema ist und dass die chinesische Regierung nicht davon überzeugt ist, dass ihre Herrschaft in Tibet von den Tibetern als legitim angesehen wird.“ flee

Christian Straube arbeitet seit 2019 als Programm-Manager im China-Programm der Stiftung Asienhaus. Zusammen mit seiner Kollegin Joanna Klabisch bemüht sich Straube um den zivilgesellschaftlichen Dialog mit China. “Die chinesische Zivilgesellschaft steht teilweise vor genau den gleichen Herausforderungen wie Zivilgesellschaften in Deutschland und Europa”, sagt er, wenngleich sie anders strukturiert ist. Besonders bei klassischen Umweltthemen, urbaner Architektur und Gender gebe es Überschneidungen.
Das inzwischen eingestellte “EU-China NGO Twinning Program”, das er mitbetreute, hat ihm gezeigt, wie wertvoll es ist, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene zusammenzuarbeiten. Und das, obwohl die Rahmenbedingungen immer enger werden: “Es ist immer schwieriger bottom-up Dialog zu leisten“, stellt Straube fest. Die rechtlichen Vorgaben wurden seit dem Anfang 2017 in Kraft getretene Gesetz zum Management ausländischer Nichtregierungsorganisationen (ANRO-Gesetz) strenger. Themen mit gesellschaftlichem Konfliktpotenzial etwa Feminismus im Hinblick auf die Rolle von Frauen in der Gesellschaft würden strenger zensiert. “Sobald eine soziale Komponente reinkommt, muss man aufpassen, wie man das Dialogformat framen kann”, sagt Christian Straube.
Schwierigkeiten bereitet aber nicht nur der Staat China mit seinen strengen Vorgaben. Auf deutscher Seite beklagt Straube das oft fehlende Bewusstsein für die Vielfalt. Häufig begegnet ihm die Vorstellung, dass die chinesische Bevölkerung “zum Teil homogen gesteuert wird und keine zivilgesellschaftliche Aktivität stattfindet”. Ein Ziel des China-Programms der Stiftung Asienhaus ist es deshalb, die China-Kompetenz in Europa zu stärken. Und bei politischen Entscheidungsträgern ein Bewusstsein für die Gesellschaft in China zu schaffen. Durch Publikationen versuchen die Programm-Manager den Zugang zu den Informationen hierzulande zu erleichtern. Trotz allem sieht sich Straube nicht als China-Experte: “Ich finde, dass man von Aspekten von China eine Ahnung haben kann. Was mir oft fehlt, ist ein wenig mehr Bescheidenheit, was China anbelangt“.
Woher seine Leidenschaft für Asien kommt? Die wurde ihm “in die Wiege gelegt“, wie er sagt. Sein Vater studierte Asienwissenschaften an der Humboldt-Universität. Aber bereits seine beiden Großväter hatten berufliche Kontakte nach Asien. Besonders bemerkenswert, denn die Familie lebte in der DDR. Christian Straube zog es dann selbst früh nach Asien. Über den Austauschverein AFS machte er ein Auslandsschuljahr in Malaysia.
Dort war er regelmäßig mit Leuten aus der chinesischen Community unterwegs und lernte unter anderem das chinesische Neujahr kennen. Später studierte er Moderne Sinologie, Volkswirtschaftslehre und Politik Südasiens an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und schrieb seine Abschlussarbeit über die Auslandschinesen in Malaysia während der chinesischen Xinhai-Revolution. Alltagsgespräche im Chinesischen stellen für Straube kein Problem dar. Er sieht es aber als akute Herausforderung, die Sprache zu bewahren. Schließlich spricht er nicht nur Chinesisch, sondern auch Bemba. Für seine Doktorarbeit ging Christian Straube nämlich nach Sambia, wo er über chinesische Firmen im afrikanischen Kupfergürtel forschen wollte. Doch der Forschungszugang gestaltete sich so schwer, dass er den Forschungsschwerpunkt nochmal anpassen musste. “Die Industrie lässt sich nicht gerne in die Karten gucken“.
Seine Dissertation konnte er 2018 trotzdem fertigstellen. Das daraus entstandene Buch erzählt die Geschichte von materiellem und sozialem Zerfall sowie Erneuerung in einer ehemaligen Bergbau-Siedlung. Christian Straube ließ sich durch die Erfahrungen mit Chinas zunehmend zweifelhaftem Ruf in der Welt nicht demotivieren. Mit seiner Kollegin hat er in der Stiftung Asienhaus ein neues Projekt auf die Beine gestellt: Der zivilgesellschaftliche Dialog im Kontext der neuen Seidenstraße soll gestärkt werden. Organisationen aus den entsprechenden Ländern sollen hierfür vernetzt werden. Paula Faul
Vanessa Wang wird ab 1. September Head of Client Coverage bei dem deutschen Wertpapierhaus DWS am Standort Hongkong. Sie war bisher bei dem französischen Vermögendsverwalter Amundi beschäftigt. Sie berichtet bei DWS an Dirk Görgen, den Leiter Client Coverage Division in der Zentrale in Frankfurt.
Ben Meng wird neuer Chairman für Asien-Pazifik bei dem Investmenthaus Franklin Templeton. Zuvor hat er beim California Public Employees Retirement System gearbeitet. Meng soll mehr reiche Kunden für neue Anlageformen wie Private Equity oder Venture Capital gewinnen.
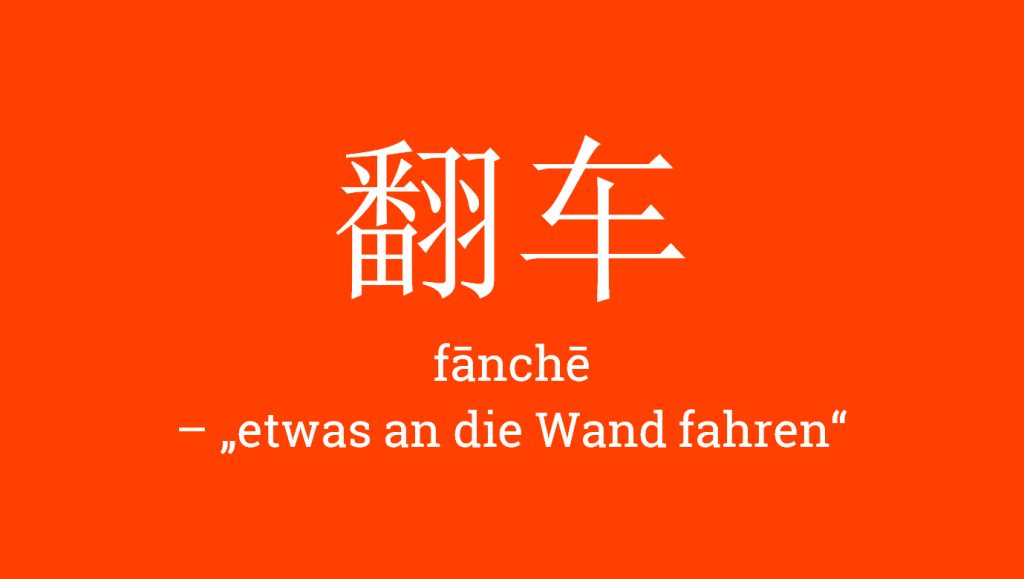
Mit viel PS und zu viel Bleifuß unterwegs auf der Überholspur? Vorsicht, Überschlagsgefahr! Im übertragenen Sinne gilt das auch für Chinas Datenautobahnen. Denn wer sich in den oberen Klickrängen der Internetstars und Influencer Fehltritte leistet, purzelt schnell tief.
翻车 fānchē – wörtlich “der Wagen überschlägt sich” – nennt man dieses Phänomen auf Chinesisch. Jüngstes Beispiel eines solchen “Crashs” ist der chinesische Celebrity Wu Yifan (吴亦凡 Wú Yìfán). Lange raste der Sänger, Tänzer und Schauspieler, der einst als Mitglied einer K-Pop-Boyband seinen Durchbruch feierte, großspurig und scheinbar ungebremst durch Chinas Promi-Olymp, hatte zahlreiche lukrative Werbedeals im “Handschuhfach”, unter anderem mit Louis Vuitton, Bulgari, Porsche und L’Oréal.
Seit einigen Tagen strauchelt der 30-jährige Beau jedoch inmitten eines heftigen MeToo-Sturms. Mehrere Frauen werfen dem Star sexuelle Übergriffe vor, einige davon sollen zum Zeitpunkt des Geschehens noch minderjährig gewesen sein. Sie bezichtigen Wu einer Ausbeutungsmasche in Weinstein-Manier. Wu bestreitet die Vorwürfe und die Gegenkampagne seines PR-Teams läuft auf Hochtouren. Doch die Karriere des chinesischen A-Promis scheint gründlich gegen die Wand gefahren. Alle großen Werbepartner haben ihre Zusammenarbeit bereits aufgekündigt. Es scheint ein Überschlagsszenario par excellence zu werden.
Das chinesische Schriftzeichen 翻 fān bedeutet wörtlich übrigens (unter anderem) “umkippen, wenden” oder “umblättern” (翻页 fānyè – eine Seite umblättern). Es taucht zum Beispiel auch im Wort “übersetzen” auf (翻译 fānyì). Der Trendbegriff 翻车 fānchē entstammt einer Wortwolke rund um das Autofahrmotiv, die sich in den letzten Jahren in der chinesischen Netz- und Jugendsprache ausgebreitet hat. Begonnen hat alles mit dem Schlagwort 老司机 lǎosījī “versierter Chauffeur” – ein Synonym für jemanden, der alle Ecken und Winkel seines Metiers wie die eigene Westentasche kennt und anderen eine “Mitfahrgelegenheit” durch das fremde Terrain bietet. Dank der “Streckenkenntnis” und Hilfe des “lǎosījī” gelangen andere so leichter ans Ziel.
Ursprünglich wurde “lǎosījī” vor allem in Foren und Chats zur Bezeichnung von versierten Surfern gebraucht, die Downloadlinks zu allen möglichen Ressourcen (资源 zīyuán), z.B. Spiele, Videos, Musik und E-Books, besaßen. Teilten diese “Chauffeure” ihre Quellen mit anderen Usern, hieß das “den Wagen fahren” (开车 kāichē). Wer das Ganze als Trittbrettfahrer herunterlud, “stieg in den Wagen ein” (上车 shàngchē). Und wer auf der Suche nach Downloadquellen war (求资源 qiú zīyuán), bat am besten einen erfahrenen Fahrer, ihn “mitzunehmen” (老司机带带我!Lǎosījī dàidai wǒ!).
Wurde das Material gelöscht, war im Internetjargon von 翻车 die Rede – die freie Fahrt auf der Datenautobahn hatte dann erst einmal ein Ende. Später stieg “fānchē” auch in der chinesischen Gamerszene zum Modewort auf. Wurde hier ein erfolgreicher Favorit überraschend vom Sockel gestoßen, sprach man auch hier vom “Autoüberschlag”.
Heute ist “fānchē” längst im chinesischen Alltagswortschatz angekommen, und zwar – je nach Kontext – als Synonym für “etwas vermasseln” oder “floppen”, sich mit etwas “auf die Schnauze legen”, als Gewinnertyp “einen Dämpfer kassieren” oder – um im Autobild zu bleiben – “etwas an die Wand fahren”. In diesem Sinne: Bleiben Sie auch weiterhin schön in der Spur!
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
