vor gut zwei Jahren war der Autozulieferer Webasto das erste Unternehmen in Deutschland, das von einem Corona-Fall getroffen wurde. Damals herrschte große Aufregung, doch im Gesamtbild der Pandemie erwies sich das Ereignis als bloße Episode, die heute schon fast wieder vergessen ist. Im Interview mit China.Table spricht nun der Vorstandsvorsitzende von Webasto, Holger Engelmann, nun über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.
Engelmann fürchtet aus mehreren Gründen für die Nach-Corona-Phase ein “wirtschaftliches Long Covid”. Mangel an Fachkräften, Rohstoffen oder Halbleitern werden die Unternehmen noch eine Weile bremsen, sagt er gegenüber Marcel Grzanna. Webasto habe daher seine Lieferbeziehungen möglichst robust aufgestellt. Doch Engelmann warnt: “Eine Lieferkette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied” – und am Ende kommen immer Teile aus anderen Weltgegenden.
Für China hegt Engelmann sogar Gedankenspiele für abgekoppelte Kreisläufe, da auch Peking seinen Lehren aus der Krise gezogen hat. Die Reaktion des Landes auf die beginnende Pandemie Ende 2019 bewertet Engelmann derweil als zu wenig transparent – die Welt habe damals wertvolle Zeit verloren.
Ab heute gilt das neue Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten – PIPL. Frank Sieren analysiert, wie sich Chinas Tech-Unternehmen seit der Ankündigung auf die Änderungen des Rechtsrahmens vorbereitet haben: Was blieb ihnen anderes übrig, als sich zu fügen und den Bürgern nun anständigen Datenschutz zu bieten? Der Staat nimm sich jedoch weiterhin von den Pflichten aus.
Wir haben ihnen im Juli das Buch “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt” vorgestellt. Eigentlich sollten die Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges vergangene Woche an zwei Konfuzius-Instituten aus ihrem Werk lesen. Dazu kam es nicht, denn die Institute sagten die Veranstaltung auf Druck aus Peking ab. Das hat nicht nur zum Imageverlust für die beteiligten deutschen Hochschulen geführt. Bildungsministerin Anja Karliczek feuert nun sogar einen Warnschuss für die Konfuzius-Institute und ihre Partner ab. Sie sollten sich mit der Einflussnahme Chinas “dezidiert auseinanderzusetzen”.
Einen guten Wochenbeginn wünscht


Herr Engelmann, Webasto war zu Beginn der Corona-Pandemie in den Schlagzeilen. Der erste Corona-Infizierte in Deutschland war einer Ihrer Mitarbeiter, der von einer Kollegin aus Wuhan angesteckt wurde. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die vergangenen anderthalb Jahre zurück?
Da springt bei mir sofort ein großes Kopfkino an. Als wir damals mit dem Virus konfrontiert wurden, hatte das nicht nur eine wirtschaftliche Dimension. Es ging auch um die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und unseres Umfeldes. Da mussten wir binnen weniger Stunden schnell handeln und harte Entscheidungen treffen wie die vorübergehende Schließung unserer Firmenzentrale in Stockdorf. Im Nachhinein sind wir stolz, wie gut wir das gemanagt haben.
Wie lautet ihr betriebswirtschaftliches Fazit dieser Zeit?
In der Summe hat uns die Corona-Pandemie als Autozulieferer schon sehr getroffen. Allerdings hätte alles schlimmer kommen können. Der chinesische Markt hat sich sehr schnell erholt, das hat uns geholfen. Dennoch haben wir 2020 nicht mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Das lag aber auch daran, dass wir trotz Krise weiter investiert haben, zum Beispiel in neue Standorte oder unsere Lösungen zum Thema E-Mobilität oder autonomes Fahren.
Ist die Krise jetzt überstanden?
Wir treten jetzt in die Nach-Corona-Phase ein, das wirtschaftliche Long Covid sozusagen. Wir spüren, dass die Welt aus dem Tritt gekommen ist. Das äußert sich bei den Halbleitern, bei der Verknappung von Rohstoffen oder der geringeren Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Das ist eine Entwicklung, die mich sehr beunruhigt. Wir haben über viele Jahre ein sehr komplexes System in der Welt aufgebaut, das sehr fragil ist, wie wir jetzt feststellen.
Dieses System ist jetzt aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn ich hier mit einer Metapher arbeiten darf: Es ist vergleichbar mit einem Stein, den man ins Wasser wirft. Man wird jetzt sehen, ob das nur eine Welle ist, die langsam abebbt, oder ob wir ein System losgetreten haben, das in eine Art Eigenfrequenz übertritt und nicht mehr zu schwingen aufhört.
Können Sie das konkretisieren?
Im Augenblick haben wir auf der ganzen Welt zu wenig Halbleiter. Ein Sturm in den USA, ein Feuer bei einem Chipproduzenten in Japan oder ein Corona-Ausbruch in Malaysia sind jetzt plötzlich auf der ganzen Welt spürbar. Es kommen weitere Themen hinzu: Die Rohstoffpreise steigen, in China gibt es eine Stromverknappung. Jedes Problem ist einzeln vielleicht lösbar, aber wenn dieser Zustand systemisch wird und an immer mehr Enden Baustellen entstehen, dann wird das natürlich schwierig.
Wagen Sie eine Prognose?
Beide Szenarien sind gleichermaßen wahrscheinlich. Wir wissen nicht, was 2022 oder 2023 wird. Haben wir das Problem der Halbleiter dann im Griff, oder wird alles noch schlimmer? Und kommt dann das nächste Problem auf uns zu und dann das nächste und wieder das nächste? Klar ist nur, dass sich einige grundsätzliche Dinge bei den Arbeitsabläufen dauerhaft verändert haben. Digitale Begegnungen werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil sein. Aber auch hier gilt es, ein vernünftiges Maß zu finden.
Wieso?
Wenn alles nur noch virtuell läuft, dann kommt das Zwischenmenschliche zu kurz, also die Möglichkeit, sich nach einem Meeting unter vier Augen auszutauschen, direkt die Stimmung meines Gegenübers zu erkennen, nochmal nachzuhaken oder auf etwas hinweisen zu können. Unsere Branche hat wenig Reserven in ihren Systemen. Das ist alles eng getaktet und auf kleine Margen ausgerichtet. Da kann die Kommunikation sehr entscheidend sein für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes. Wir akzeptieren den neuen Normalzustand, aber wir müssen ihn noch verbessern.
Was haben Sie über China gelernt in den vergangenen anderthalb Jahren?
Die Anfangsphase der Pandemie war geprägt von mangelnder Transparenz. Schon im Oktober 2019 haben wir in Wuhan mitbekommen, dass irgendetwas vor sich geht. Die ersten Gerüchte haben wir aber nicht wirklich ernst genommen.
Viele Unternehmen schweigen lieber, statt der chinesischen Regierung Fehler vorzuwerfen.
Ich denke, wir dürfen schon objektiv feststellen, dass die Informationspolitik transparenter hätte sein können. Ich muss aber auch sagen, dass unsere chinesische Mitarbeiterin, die damals das Virus in sich getragen hatte, nach ihrer Rückkehr nach China dem Robert Koch-Institut detailliert Auskunft gegeben und wichtige Erkenntnisse zu ihrem Krankheitsverlauf geliefert hat.
Wir hätten uns pandemisch hierzulande sicherlich besser vorbereiten können, wenn wir in Europa frühzeitig gewusst hätten, wie ernst die Situation in Wuhan war. Mit diesem Informationsvorsprung hätten wir eine größere Chance gehabt, das Virus einzudämmen. Zugegebenermaßen hätten Europäer oder Amerikaner bei ihrem folgenden Krisenmanagement deutlich besser sein können.
…während China schon frühzeitig seinen Sieg über das Virus feierte.
Mit ihrer Härte und extremer Effizienz hat die chinesische Regierung die Auswirkungen auf ihr eigenes Land extrem minimiert. Über die Vehemenz der Maßnahmen kann man sicherlich diskutieren, aber was die Eindämmung des Virus angeht, war das Land erfolgreich.
Die Pandemie hat die Schwachpunkte globaler Lieferketten offenbart. Wird Webasto weiter regionalisieren?
Unsere DNA ist es, dass wir in der Region für die Region produzieren und dort auch unsere Teile beziehen. Daher sind wir der Anfälligkeit der Lieferketten weniger unmittelbar ausgesetzt. Aber jede Komponente hat eine eigene Lieferkette, die ihrerseits betroffen sein kann. Insofern trifft es uns dort, wo unsere Zulieferer Komponenten benötigen.
Wir können diese ganzen Ebenen unmöglich selbst bis in die letzten Winkel selbst durchschreiten. Eine Lieferkette ist daher immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und selbst wenn wir Komponenten auf Vorrat lagern würden, kann es passieren, dass einem unserer Kunden eine andere Komponente fehlt. Auch dann wären wir betroffen. Die Komplexität der Wertschöpfung ist gewaltig.
China möchte diese Komplexität aus nationalen Interessen entflechten. Das bedeutet für Webasto und andere, künftig zwei Lieferketten aufbauen zu müssen. Eine für China und eine für den Rest der Welt.
Ich fürchte, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir einen solchen autarken Kreislauf in China in Zukunft ermöglichen müssen. Wir gehen davon aus, dass die chinesische Volkswirtschaft aus der Krise gelernt hat und ihre eigene Abhängigkeit vom Ausland verringern will. Heute ist es noch nicht so, aber es könnte darauf hinauslaufen, dass alle Komponenten in China irgendwann zur Verfügung stehen.
Bereitet Ihnen diese Entkopplung Unbehagen?
Wir haben uns in allen Regionen der Welt immer flexibel auf die jeweiligen Umstände einstellen können. Das wird uns auch in China gelingen. Es ist aber eine andere Frage, ob die Regionalisierung rein volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Sie lässt Effizienzpotenzial liegen, weil Einkaufsvolumen geringer werden und damit zu Preiserhöhungen für alle Beteiligten einschließlich der Konsumenten führen.
Zahlen wir auch einen politischen Preis in Form einer Entwurzelung unserer Unternehmen?
Schwierige Frage. Zumindest haben wir als Webasto in 20 Jahren, die wir jetzt in China tätig sind, keine Probleme gehabt. Wir konnten uns in den einzelnen Regionen nach Wunsch entwickeln. Wir können unsere Mitarbeiter frei nach unseren Werten führen, wie wir das auch in Deutschland machen. Und wir haben eine loyale chinesische Belegschaft.
Selbst wenn chinesische Konkurrenten in der Vergangenheit gegen unsere Patente verstoßen haben, konnten wir unsere Interessen rechtlich durchsetzen. Wir haben als Unternehmen also nichts Negatives in China erfahren und uns gut entwickeln können. Wir haben unsere Marktführerschaft bei Dächern bisher halten können. Wir merken natürlich, dass chinesische Konkurrenten hochkommen. Aber gegen die können wir uns nach den Regeln der Marktwirtschaft behaupten.
Mit der verschärften Datenschutz-Gesetzgebung erhalten chinesische Behörden jetzt aber die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, welche Daten ein Unternehmen aus dem Land transferieren darf. Bereitet Ihnen das keine Sorgen?
Von unserer Organisation vor Ort haben wir den Hinweis bekommen, dass wir keine Probleme haben werden. Wir mussten lediglich offenlegen, ob wir alle Regelungen einhalten. Das ist für uns erst einmal kein Nachteil. Eher sind wir davon überzeugt, dass sich der ein oder andere Mitbewerber an die Regelungen anpassen muss.
Sammeln Sie denn Daten in China, die nach Deutschland transferiert werden?
Nein, wir müssen in China keine Daten sammeln. Unsere gesamte chinesische Organisation arbeitet auf Systemen in Deutschland. Dort liegen also auch die Daten.
Das neue Antisanktions-Gesetz kann Unternehmen dazu zwingen, sich für oder gegen China zu entscheiden. Werden Webasto und andere zum Spielball auf der geopolitischen Bühne?
Das ist sicherlich Teil der Realität. Wenn sich die politische Gemengelage verhärtet und ein Decoupling droht, dann muss man als Firma so aufgestellt sein, dass man in jeder Region überlebensfähig ist, in der man operiert. Tatsache ist aber auch, dass wir in China gute Geschäfte machen und das Geld weiter in unsere Entwicklung oder innovative Technologien investieren können. Wir profitieren von dem Cashflow aus China, auch indem wir Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Aber wir sind natürlich so aufgestellt, dass wir in jeder Region profitabel arbeiten können.
Solange der Strom nicht abgeschaltet wird.
Webasto ist genauso wie viele unserer Kunden direkt von der Stromverknappung betroffen. Um die Situation abzufedern und die Produktion aufrechtzuerhalten, haben wir zwischenzeitlich zusätzliche Strom-Generatoren gemietet. Unser Eindruck ist, dass die Behörden sehr bemüht sind, die Situation zu stabilisieren. Der energieintensive Winter wird aber in jedem Fall eine weitere Herausforderung sein.
In ihrem neuen Batteriecenter in Jiaxing geht Webasto in China nun auch neue Wege, weg von Autodächern und Standheizungen. Steigen Sie mittelfristig in die Batterieproduktion ein?
Nein, wir werden keine Batteriezellen produzieren, sondern wollen eine Nische besetzen, in dem wir als Systemhersteller Batteriepacks entwickeln und verkaufen, die Hersteller in ihre Fahrzeuge integrieren können. So können sich Zelllieferanten und OEMs (Original Equipment Manufacturer, also Autohersteller) auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Das war eine mutige Entscheidung in 2016, in diesen neuen Bereich der Elektromobilität zu investieren. Unser Ziel ist es, mit unseren Systemlösungen für die Elektromobilität in einigen Jahren mehr als eine Milliarde Euro Umsatz zu generieren.
China ist der größte Einzelmarkt für Webasto, der dem Unternehmen fast 40 Prozent des Umsatzes einbringt. Sie haben dort zwölf Standorte. Bleibt das Zentrum der Forschung und Entwicklung dennoch in Deutschland?
Ja. Unsere Batterie-Technologie wurde komplett in Deutschland entwickelt. Wir haben jetzt aber gemeinsam mit chinesischen OEMs ein eigenes chinaspezifisches Batterieprodukt. Ich sehe hier ein wichtiges Prinzip für den freien Wettbewerb: Wir sollten nicht versuchen, andere Länder einzuschränken, sondern besser, schneller, innovativer zu sein.
Holger Engelmann ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender des Autozulieferers Webasto mit Sitz in Stockdorf bei München. Zuvor war der promovierte Volkswirt dort stellvertretender CEO und Finanzchef.
Webasto wurde 1901 gegründet und ist auch heute noch ein Familienunternehmen. Schwerpunkte liegen bei Dächern, Heizungen und Klimaanlagen, sowie bei Ladeeinrichtungen und kompletten Batteriesystemen für Elektroautos. Webasto produziert schon seit 2001 in Shanghai. China ist heute der wichtigste Einzelmarkt des Unternehmens. Im September 2019 besichtigte Kanzlerin Angela Merkel das Webasto-Werk in Wuhan. Im Januar 2020 steckten sich einige Firmenmitarbeiter in Deutschland mit Corona an. Das Unternehmen erhielt damals viel Lob für seine schnelle Reaktion zur Eindämmung der Infektionsketten.
Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zeigt sich besorgt über den zunehmenden Einfluss der Konfuzius-Institute auf das Geistesleben in Deutschland. In einem Brief an die deutschen Hochschulen schreibt sie von einer “inakzeptablen” Einflussnahme. Sie ruft dazu auf, “die Rolle der Konfuzius-Institute in der deutschen Hochschullandschaft neu zu bewerten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen”. Sie empfiehlt den Universitäten, “ihre Zusammenarbeit mit den Instituten prüfend zu hinterfragen” und sich mit der Einflussnahme Chinas “dezidiert auseinanderzusetzen”.
Der Anlass des Briefes ist eine Diskussion um eine Veranstaltung, die ursprünglich an zwei Konfuzius-Instituten angesetzt war. Stefan Aust und Adrian Geiges, die Autoren des Buches “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt”, wollten ihr Werk ursprünglich am 27. Oktober vorstellen und daraus lesen. Doch die Konfuzius-Institute an den Universitäten Hannover und Duisburg sagten die Veranstaltungen kurzfristig ab. In Duisburg wurde die Buchvorstellung dann von der Universität selbst organisiert.
Zur Begründung stellte das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover (LKIH) eine Stellungnahme online. Darin heißt es: “Nach der Ankündigung des Online-Gesprächs über die Biografie des chinesischen Staatspräsidenten mit Buchautor Adrian Geiges kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit den chinesischen Partnern, die ein Festhalten an dem Format und eine Mitwirkung des LKIH nicht mehr möglich machten.”
Dem Piper-Verlag zufolge soll die Shanghaier Tongji-Universität gegenüber dem Konfuzius-Institut in Hannover auf eine Absage der Veranstaltung bestanden haben. Das Konfuzius-Institut in Hannover wird gemeinsam von der Tongji-Universität und der Leibniz-Universität betrieben. In Duisburg intervenierte laut Pressemeldung Feng Haiyang, der Generalkonsul Chinas in Düsseldorf, persönlich, “um die Veranstaltung zu verhindern”.
Für Markus Taube, Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft / China an der Mercator School of Management und Kodirektor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr an der Universität Duisburg Essen, kam die Absage “aus heiterem Himmel“. “Bislang hat es trotz kritischer Veranstaltungen nie Einmischungen gegeben”, sagte Taube dem China.Table. Dieser Präzedenzfall ist für alle Beteiligten eine “Loose-Loose-Loose-Konstellation”, so Taube. Er meint damit nicht nur die jahrelangen Beziehungen, die die Universitäten mit ihren Partneruniversitäten in China pflegen, sondern auch, dass die Grundsatzfrage zur chinesischen Einmischung damit wieder auf dem Tisch ist.
Konfuzius-Institute wie das in Duisburg-Essen sind rechtlich gemeinnützige Vereine und unterstehen deutschem Recht. Sie sind nicht verpflichtet, den Hochschulen, denen sie angegliedert sind, ihre Finanzen offenzulegen, sondern müssen ihre Einnahmen nur gegenüber dem Finanzamt erklären. Auch die Nachprüfung der deutschen Steuerbehörde ist nicht öffentlich.
In Deutschland gibt es 19 Konfuzius-Institute. Sie sind meist Universitäten angegliedert. Ihr offiziellen Ziel ist die Vermittlung der chinesischen Sprache und Kultur zu fördern und eine Brücke für den kulturellen Austausch zu bilden.
Bereits 2014 sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping: “Wir sollten Chinas Soft Power stärken, ein gutes chinesisches Narrativ vermitteln und Chinas Botschaften besser in die Welt tragen”. Solche Äußerungen schüren jedoch auch Misstrauen. Konfuzius-Instituten wird nachgesagt, dass sie mit ihrem Programm der verlängerte Arm Pekings im Ausland seien.
Konfuzius-Institute sind staatliche chinesische Bildungsorganisationen. Sie sind dem Zentrum für Sprachbildung und Zusammenarbeit (Hanban) untergeordnet. Daher stehen sie unter dem Verdacht, eng mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um das Meinungsbild zu China im Ausland so zu beeinflussen, wie die Regierung in Peking es gern sehen würde.
Auch die Finanzierung einer Professur an der Freien Universität Berlin mit einer halben Million Euro aus Chinas Staatskasse sorgte für Aufsehen. Ganz unabhängig von finanziellen Zuwendungen wird diskutiert, wie die Universitäten den Konfuzius-Instituten durch die räumlichen Überschneidungen Legitimität verschaffen. Kritisiert wird auch, dass die Institute den Ruf der deutschen Hochschulen und die Freiheit der Forschung und Wissenschaft schädigen.
Zu den vehementesten Kritikern gehört Chinaexperte Andreas Fulda von der University of Nottingham. Fulda sagt, Konfuzius-Institute haben “nichts an Universitäten zu suchen”. “Das ist eine Art Ideen-Wäsche, wo politischer Propaganda der Stempel der Unbedenklichkeit gegeben wird“, sagte er dem Tagesspiegel.
Nach Absage der Buchvorstellung kritisierte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) laut NDR: “In Deutschland herrschen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit”. Auch Thümler nannte wie zuletzt Karliczek die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute “nicht akzeptabel”.
Laut dem Piper-Verlag, der das Xi-Buch verlegt, sollen die Konfuzius-Institute Druck “von ganz oben bekommen” haben. “Die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute ist ein beunruhigendes und verstörendes Signal“, sagt Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg.
Vertraute sagen hinter vorgehaltener Hand, dass die Glaubwürdigkeit der Konfuzius-Institute mit den Vorfällen massiv gelitten hat. Aber auch die Vertrauensbasis zwischen deutschen und chinesischen Wissenschaftlern der beteiligten Universitäten sei beschädigt worden.
Organisiert durch die Universität Duisburg fand die Online-Buchvorstellung letztlich doch noch statt. Allerdings ohne Beteiligung der Konfuzius-Institute. Stattdessen einigten sich alle Beteiligten darauf, dass das Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Duisburg-Essen, an der Taube derzeit Direktor ist, als alleiniger Veranstalter fungieren solle.
Stefan Aust, Co-Autor der Xi-Biografie, sieht die Grundthesen seines Buchs durch den Vorfall bestätigt: “Erstmals ist eine Diktatur dabei, den Westen wirtschaftlich zu überholen und versucht jetzt auch, ihre gegen unsere Freiheit gerichteten Werte international durchzusetzen.”
Adrian Geiges verweist darauf, dass das Buch China sehr differenziert darstellt, etwa auch die erfolgreiche Überwindung der Armut in den vergangenen Jahrzehnten. “Offenbar reichen Xi Jinping solche ausgewogenen Berichte nicht mehr aus – er will jetzt international einen Kult um seine Person, so wie in China selbst”, so zitiert eine Pressemeldung von Piper die beiden Autoren.
In der Pressemeldung zitiert der Piper-Verlag auch eine Mitarbeiterin der Konfuzius-Institute. Sie begründet die Absage der Buchvorstellung mit folgendem Satz: “Über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen reden, er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar.”
Geiges macht in einem Interview mit dem NDR klar, dass dieses Zitat nicht die eigene Meinung der Mitarbeiterin ist und nicht als Kritik am Vorgehen Pekings zu verstehen sei. Vielmehr gebe sie die Verbote wieder, die den Konfuzius-Instituten von chinesischer Seite mitgeteilt werden. “Dass es in China so ist, das ist nichts Neues, aber dass es jetzt auf Deutschland ausgedehnt werden soll, ist was Neues”, so Geiges.
Am 1. November ist Chinas neues Gesetz zum Schutz persönlicher Daten in Kraft getreten. Große Teile der Internetindustrie haben bereits eine stringente Umsetzung zugesichert. Schon mehr als 20 Firmen aus der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen haben angekündigt, ihre Datenschutzbestimmungen mit dem Datenschutzgesetz in Einklang zu bringen. Die Unternehmen verpflichteten sich auf die Einhaltung von zehn Initiativen der Regierung, die Unternehmen unter anderem dazu auffordern,
Man wolle “eine gesunde und nachhaltige Entwicklung” fördern, erklärten unisono Sprecher von Unternehmen wie Tencent und Huawei auf einer staatlich organisierten Internet-Konferenz in Shenzhen am vergangenen Freitag.
Das “Personal Information Protection Law” (PIPL) ist eine der weltweit strengsten Datenschutzbestimmungen. Es wurde bis ins Detail der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nachempfunden. Das Gesetz schreibt vor, dass personenbezogene Daten transparent gesammelt und verarbeitet werden müssen. Es gibt den chinesischen Bürgern also einen größeren Spielraum als zuvor, um sich gegen Datenlecks und den Missbrauch persönlicher Informationen zu schützen – zumindest, wenn es um Unternehmen geht. Das PIPL wurde am 20. August 2021 vom Nationalen Volkskongress Chinas verabschiedet. Es folgt auf das Cybersecurity Law von 2017 und das E-Commerce Law von 2019.
Mit dem Fortschritt bei Zukunftstechnologien wie Gesichtserkennung oder Künstlicher Intelligenz rücken in China auch verstärkt deren Risiken in den Fokus. 2019 hat eine Studie aufgezeigt, dass 30 Prozent der Befragten bereits Opfer von Datenmissbrauch geworden sind. Beispielsweise wurden ihre Telefonnummer, Adressen oder Bankverbindungen weitergegeben, ohne dass sie davon wussten.
Ebenso wie die DSGVO sieht das PIPL Strafen bei Verstößen vor. Diese beinhalten Geldbußen bis zu 50 Millionen Yuan (6,7 Millionen Euro) beziehungsweise fünf Prozent des vorausgegangenen Jahresumsatzes. Sogar die gesamte Stilllegung des Betriebs kann drohen (China.Table berichtete).
Datenschutz hat in China bislang vor allem wirtschaftliche Gründe: Die Regierung will den Konsum sicherer machen und gleichzeitig die Offenheit gegenüber neuen Technologien in der Bevölkerung stärken. Peking darf das Vertrauen der wachsenden Mittelschicht nicht verlieren – auf ihren Schultern soll Chinas Wirtschaft mehr und mehr auf den Binnenkonsum umgestellt werden. Schon jetzt entfallen rund 60 Prozent der Wirtschaftskraft und die Hälfte der staatlichen Arbeitsplätze auf den Dienstleistungssektor.
Das PIPL betrifft auch ausländische Unternehmen, die in China tätig sind. “In China aktive Unternehmen oder sonstige Unternehmen, die personenbezogene Daten chinesischer Bürger verarbeiten, sollten ihre Prozesse prüfen, gegebenenfalls anpassen und die Entwicklungen im Blick behalten”, empfiehlt die Wirtschaftskanzlei Noerr.
Das betrifft vor allem Auslandsdatentransfers und die sogenannte Datenlokalisierung. Konkret heißt das, dass die Daten chinesischer Bürger nicht ohne ihre Zustimmung ins Ausland übermittelt werden dürfen. Laut Artikel 39 des Gesetzes müssen die betroffenen Personen über die Übermittlung informiert werden. Auch müssen Daten, die ins Ausland übermittelt werden, eine behördliche Sicherheitsbewertung durchlaufen. Standardvertragsklauseln, die ähnlich wie im DSGVO Auslandsdatentransfers regeln, wurden durch die zuständige Cyberspace Administration of China noch nicht veröffentlicht.
Im chinesischen Gesetz gibt es noch einen entscheidenden Unterschied zum EU-Datenschutzgesetz: Peking behält sich vor, Daten zu erheben, die für die “Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit” wichtig erscheinen – der Staat ist von dem Gesetz nicht betroffen. Öffentliche Sicherheit ist in China bekanntlich ein potenziell weites Feld, das im Grunde alles umfassen kann.
Dennoch hält der in Peking geborene deutsche Rechtsanwalt Mathias Schroeder von der Pekinger Kanzlei Ding Schroeder & Partner dies für einen wichtigen Schritt. “Der neue Gedanke dabei, und der hat durchaus Sprengkraft: Die Menschen sollen grundsätzlich selbst bestimmen dürfen, wer, wie mit ihren Daten Geld verdient”, fasst Schroeder die Entwicklung zusammen. “Das bezieht sich erstmal auf den Konsum, aber der Geist ist aus der Flasche. Auch, wenn der Staat sagt, im Falle der nationalen Sicherheit darf er die Daten benutzen.”
US-Außenminister Antony Blinken hat mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi am Rande des G20-Gipfels in Rom über Taiwan gesprochen. Nach amerikanischer Darstellung des Treffens ging es darum, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Das Treffen habe eine Stunde gedauert und sei in offener und konstruktiver Atmosphäre verlaufen. Blinken habe seine Sorge darüber vorgetragen, dass China die Spannungen um Taiwan erhöhe. Er betonte zugleich, dass die USA an dem Ein-China-Prinzip festhalten wollen.
Ein konstruktives Treffen zwischen Blinken und Wang wäre ein Fortschritt gegenüber ihrem ersten Zusammentreffen im März. Damals hatten die beiden Außenpolitiker sich gegenseitig angegiftet und die Beziehungen zwischen ihren Ländern in schlechterem Zustand hinterlassen als vorher. Seitdem hat China mit Überflügen durch Luftwaffenjets und durch Aussagen der Führung ihren Anspruch auf eine Vereinigung mit Taiwan bekräftigt (China.Table berichtete). fin
Der chinesische Autokonzern Geely hat seine schwedische Tochter Volvo erfolgreich an die Börse gebracht. Die Aktie von Volvo Car AB stieg am ersten Handelstag um 23 Prozent auf 65,20 Kronen. Der erste Kurs lag bereits zehn Prozent über dem Ausgabepreis. Das Unternehmen hat damit am Freitag gut zwei Milliarden Euro eingenommen. Geely und Volvo wollen das Geld nutzen, um das Unternehmen zum reinen Elektroauto-Anbieter auszubauen. Damit kommen eine gut eingeführte schwedische Marke und besonders wettbewerbsfähige Batterietechnik aus China mit frischem Kapital zusammen. Die chinesische Muttergesellschaft hatte Volvo 2010 übernommen. fin
Die USA haben am Wochenende eine ergänzte Version ihres Geheimdienstberichts zur Herkunft von Sars-CoV-2 veröffentlicht. Die Autoren nennen darin die Möglichkeit eines Laborunfalls in der Stadt Wuhan als ein mögliches Szenario für die Freisetzung des Erregers. Zugleich schließen sie die Möglichkeit aus, dass das Virus dort absichtlich als Biowaffe entwickelt wurde. Als plausible Alternative nennen sie ein Überspringen von Tier auf Mensch in der Natur.
China wies den Bericht erneut zurück. “Egal, wie viele Versionen zusammengebastelt werden, es kann nichts daran ändern, dass es sich um einen rein politischen und falschen Bericht handelt”, sagte ein Sprecher. Auch Chinas Außenminister Wang Yi beschäftigte sich am Sonntag mit dem Thema. Auf dem G20-Treffen in Rom forderte er gegenüber Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Direktor der Weltgesundheitsorganisation, den Covid-Ursprung “objektiv und wissenschaftlich” untersuchen zu lassen. fin
Weil sie sich die Sichtweise Chinas zu sehr zu eigen mache, hat das ZDF eine Dokumentationsreihe wieder aus der Mediathek genommen. Auch eine Wiederholung von “China vs. USA – Clash der Supermächte” im Programm von ZDF Info sei gestrichen, berichtet die Webseite Übermedien. Die vierteilige Reihe war von Mediacorp produziert, der staatlichen Sendeanstalt von Singapur. Die Serie habe den Aufstieg Chinas als unausweichlich dargestellt und Menschenrechtsverletzungen wie Verhaftungen in Hongkong ignoriert, lautet Kritik an der Produktion. Die Regisseurin rechtfertigt sich: Sie habe sich um eine ausbalancierte Verteilung der Sendezeit über USA und China bemüht. Das ZDF habe die nötige Prüfung des Hintergrunds der Doku-Reihe versäumt, zitiert Übermedien den Leiter von ZDF Info, Robert Bachem. fin

Auf der jüngsten UN-Vollversammlung am 21. September kündigte Chinas Präsident Xi Jinping an, den Bau von neuen Kohleprojekten in Übersee einzustellen. “China will step up support for other developing countries in developing green and low-carbon energy, and will not build new coal-fired power projects abroad.” (englische und chinesische Version der Rede)
Ganz überraschend kam diese Ankündigung nicht. Doch noch am gleichen Tag ging der Sturm von Fragen los: Was genau hat der Präsident damit gemeint? Schließt das die Finanzierung und Versicherung mit ein? Und den Kohlebergbau? Welche Unternehmen und Banken sind davon betroffen?
Das offizielle China blieb zwar vorerst die Antworten schuldig. Die Ankündigung war jedoch durchaus intern und extern koordiniert. Hinter den Kulissen wurden bilaterale Gespräche geführt. Chinas Kohleindustrie und Kohlefinanzierer waren in den letzten zwei Jahren nicht nur durch die globale Klimaschutzbewegung unter Druck geraten. Das Leuchtturmprojekt BRI schien in ernsthafte Reputationsengpässe zu kommen. Gerade im Vorfeld des Weltklimagipfels musste nun auch offiziell reagiert werden.
Alok Sharma, der Präsident des 26. Weltklimagipfels, traf sich mit dem Chef einer der größten Banken Chinas, der Zentralbank (People’s Bank of China), sowie der nationalen Planungskommission und der nationalen Energiebehörde (NEA). Es ging um die Finanzierung von Kohle weltweit. Wenige Monate zuvor hatten Japan und Südkorea Pläne für den Ausstieg aus der öffentlichen Finanzierung von Kohleprojekten verkündet. Seit 2013 haben diese beiden Länder zusammen mit China 95 Prozent der öffentlichen Gelder für Kohleprojekte außerhalb ihrer eigenen Grenzen ausgegeben – China allerdings das meiste Geld, insgesamt 50 Milliarden USD und rund 56 GW der installierten Kapazität.
Was ändert sich jetzt, wo Präsident Xi Jinping medienwirksam den Kohleausstieg außerhalb Chinas verkündet hat?
In Planung befinden sich 60 Gigawatt Kohleverstromung in 20 Ländern, finanziert von öffentlichen chinesischen Banken. Es ist bis heute noch nicht klar, wie viele der geplanten neuen Kohlebergwerke (zum Beispiel in Russland und Pakistan) wirklich gestrichen werden.
Expansionisten – das sind die absoluten Klimakiller, aus Sicht von urgewald. Laut der gerade erst im Oktober 2021 von urgewald und NGO Partnern veröffentlichten Global Coal Exit Liste (GCEL) 2021 gehören chinesische Unternehmen derzeit nach wie vor zu den größten Expansionisten bei Kohlekraftwerken auf der ganzen Welt: Von den 503 Unternehmen mit Plänen für neue Anlagen sind 26 Prozent chinesische Unternehmen, im Vergleich zu elf Prozent aus Indien, dem zweitgrößten Expansionisten.
Dennoch-es gilt jetzt zu erfassen, wieviel der sich in Planung befindlichen Kohlekraft schon den Finanzabschluss erreicht hat (nicht als “neu” definiert, und damit wohl nicht adressiert werden), und was mit denen passiert, die sich in Vorbereitung zum Bau befinden (dies könnte zum Beispiel zwei der fünf sich im Bau befindlichen Kraftwerke in Kambodscha betreffen). Urgewald untersucht gemeinsam mit Kolleg*Innen weltweit, welche und wieviel Kohleinvestitionen im Ausland erfasst werden könnten.
Es ist recht klar: Die Ankündigung war auch ein Test. Sie hatte zwei Teile. Verbunden mit dem Angebot, in großem Stil Low-Carbon-Technologie in den Ländern der BRI zu fördern, werden nun bis zur COP 26 Wunschlisten eingeholt, wie die Kohlepläne “umgewandelt” werden können. Hier geht es auch um die Konkurrenz, wer am Ende in Südostasien, Lateinamerika und Afrika am meisten Gelder für Low-Carbon bereitstellen wird.
Was wir weltweit beobachten ist, dass der eine fossile Brennstoff durch einen anderen ersetzt wird. Etwa ein Drittel der zwischen 2011 und 2019 in den USA “stillgelegten” Kohlekraftwerke wurde tatsächlich auf Gas umgestellt. Und Länder wie Bangladesch, welches ein Drittel seiner geplanten Kohlekraftwerke gestrichen hat, oder die Philippinen, die mehr als die Hälfte der neuen Kohlekraftwerke in ihrer Projektpipeline gestrichen haben, steuern nun auf einen massiven Ausbau von Flüssigerdgas-Terminals (LNG) und gasbefeuerten Anlagen zu.
Diese Pläne müssen gestoppt werden, wenn wir das 1,5-Gradziel einhalten wollen. Gerade erst im Oktober 2021 einigten sich die OECD-Länder und damit u.a. Japan, Australien und die Türkei, auf die Einstellung von Exportkrediten für neue Kohlekraftwerke, die keine Carbon Capture, (Utilization) and Storage (CCUS/CCS) anwenden. Obwohl dies die erste international verbindliche Vereinbarung ist, die die Exportunterstützung für internationale Kohleprojekte bis Ende 2021 beendet, stützt sie sich auf falsche Lösungen. Es gibt keine “sauberen” Kohlekraftwerke. Auch wenn Emissionen “eingefangen/gespeichert” werden können, hängt an der Kohleindustrie die schmutzige Kohleproduktion, der Kohlebergbau. CCS legitimiert die Fortführung fossiler Industrien. Die Verfahren sind energieintensiv, kostspielig, und bergen neue Risiken.
Auch China wird aber genau diesen Weg gehen: Umstellung auf Gas und Flüssiggas (LNG), und CCS/CCUS. Atomenergie und Staudämme sind die anderen beiden “klimafreundlichen” Technologien, die auf der COP26 angepriesen werden. Gas kann keine Brückentechnologie sein, in die nun massiv investiert wird. Bei der Verbrennung entsteht zwar weniger CO2 pro kWh, dafür entweicht bei Förderung und Transport des fossilen Gases das noch viel klimaschädlichere Methan.
Wir wollen verhindern, dass diese Technologien Eingang in die europäische Taxonomie finden. Sie zählen zu den “falschen Lösungen”. Eine weitere Scheinlösung stellen ETM-Schemata (Energy Transition Mechanism) dar, im Rahmen derer den Kraftwerken Entschädigungssummen für das frühere Abschalten gezahlt werden. So soll es geschehen bei dem deutschen Braunkohleausstieg (dies wird seit 2021 allerdings noch in der EU-Kommission geprüft).
Auf der COP26 wird dieses Schema als goldener Weg von der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) angepriesen werden (3. November 2021). Ein Gutachten auf europäischer Ebene hat gezeigt, dass diese ETMs de facto eine Verlängerung der Laufzeit ermöglichen. Auch in China und Asien sind diese Lösungen Scheinlösungen. Die ADB, die dann Eigentümer von Kohlekraftwerken würde, trotz ihrer “Kohleausstiegsstrategie”, erklärt die “Verringerung der Laufzeit auf 15 Jahre”. Dies kann angesichts des neuen IPCC Berichts vom 9. August 2021 keine wirkliche Lösung sein. Außerdem sollen diese Buy-out-Pläne zusammen mit Investoren geschehen, die mit zu den größten Expansionisten gehören, wie Blackrock, HSBC und Citigroup Inc.
In einer großen Koalition von Gleichgesinnten setzen wir uns für die Abkehr von solchen Scheinlösungen ein. Aber abgesehen davon: China interne Kohleexpansionspläne allein, immerhin 250 Gigawatt neue Kohlekraftwerkskapazität, könnten jedoch das Pariser Klimaabkommen kippen. Der Bau des Riesenstaudammes in Tibet oder die Mega-Solarkraftwerke in der Wüste werden mit der neuen Kohlekraft um das Netz konkurrieren. Eine grundlegende Aussage zum Kohleausstieg innerhalb China ist dringender denn je.
Nora Sausmikat ist Leiterin des China Desk der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation urgewald e.V.
Hubertus Troska wird zur weiteren Vereinheitlichung der Vorstandsressorts der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG ebenfalls in den Vorstand der Mercedes-Benz AG berufen. Troska ist CEO und Chairman von Daimler Greater China und verantwortlich für alle strategischen und operativen Aktivitäten von Daimler in China.
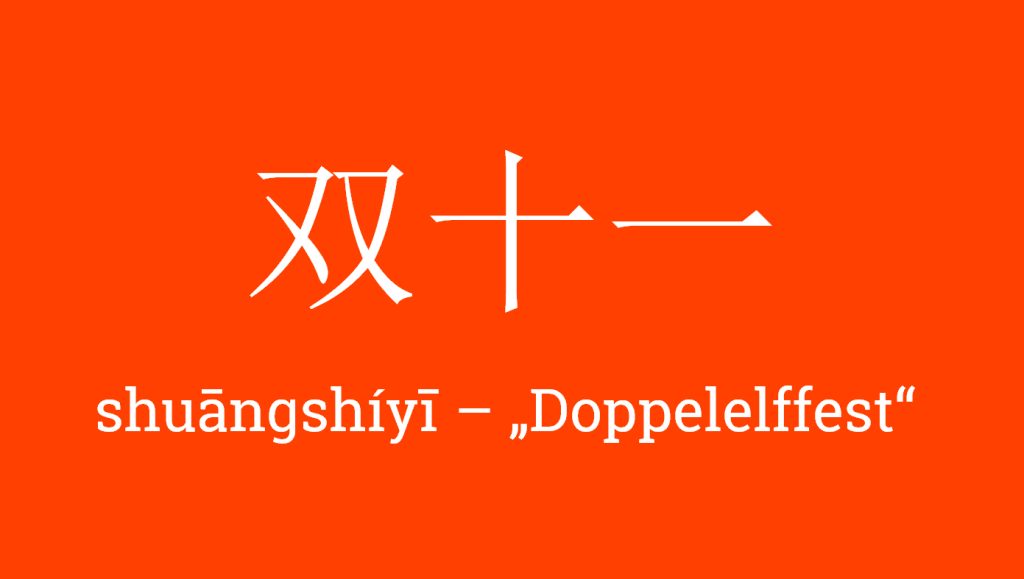
Verschwörungstheoretiker und Zahlenmystiker aufgepasst! Könnte die Zahlenreihe 1111, die uns in China momentan überall auf Internetseiten und Plakatwänden entgegenkreischt, vielleicht eine tiefere Bedeutung verschlüsseln? Tut sie tatsächlich. Die geheime Botschaft lautet: “kaufen, kaufen, kaufen” (买买买 mǎi mǎi mǎi)! Denn alljährlich am 11.11. – in wenigen Tagen ist es also wieder soweit – wird in China ein närrischer Shoppingkarneval zelebriert. Onlinehändler und Geschäfte liefern sich meist schon Wochen vorher eine wilde Preisschlacht und pflastern den öffentlichen und den virtuellen Raum mit entsprechenden Werbebotschaften zu. Berauschte Shoppingvictims sind dann beim Endspurt am 11. November manchmal schon fast zu erschöpft (oder finanziell ausgeblutet), um noch einmal den “Kaufbutton” zu klicken.
Erfunden hat’s Alibaba, besser gesagt das Portal Taobao Mall (heute Tmall 天猫 Tiānmāo) und zwar im Jahr 2010. Gut, ein bisschen abgekupfert wurde beim amerikanischen Vorbild des Black Friday, der ebenfalls traditionell im November stattfindet. In China war Taobao aber das erste E-Commerce-Portal, das eine spezielle November-Werbeaktion startete.
Die Datumswahl kam nicht von ungefähr: Für die junge, kauffreudige Zielgruppe war der 11.11. in China nämlich praktischerweise schon länger ein inoffizieller “Feiertag”, an dem viel konsumiert wurde. Weil sich an diesem Datum auf dem Kalenderblatt vier einsame Einsen zusammengesellen, wurde der Tag von Chinas Jugend zum “Tag der Singles” erklärt (光棍节 guānggùnjié “Singletag”, 光棍 guānggùn – wörtlich “kahler Stock” – ist die umgangssprachliche Bezeichnung für “Junggeselle, Junggesellin”). Viele Chinesen organisieren zu diesem Anlass Dinnerpartys, Datingtreffen und andere Get-togethers.
Im traditionellen Einzelhandel war das “Singlefest” lange jedoch eine Zeit gähnender Leere. Fällt der Tag doch genau in die Periode zwischen der Nationalfeiertagswoche um den 1. Oktober und dem Beginn des Weihnachts- und Frühlingsfestgeschäfts (ja, auch ersteres gibt es mittlerweile in China). Taobao wagte also ein Shopping-Experiment, der Rest ist Geschichte. Heute ist der Konsumfeiertag online wie offline ein Selbstläufer und hat unter dem Namen “Doppelelf(fest)” (双十一 shuāngshíyī – von双 shuāng “Paar, doppelt” und 十一 shíyī “elf”) längst Eingang ins Alltagsvokabular der Chinesen gefunden.
Hier noch einige weitere Zahlenfolgen, mit denen sie sich als Chinakenner profilieren können: 51 (五一 wǔ-yī: Tag der Arbeit am 1. Mai, oft auch als Bezeichnung für die nachfolgenden freien Tage gebraucht), 61 (六一 liù-yī: der internationale Kindertag am 1. Juni), 10-1 (十一 shíyī: Chinas Nationalfeiertag am 1. Oktober und die anschließende Feiertagswoche), 38 (三八 sānbā: internationaler Frauentag am 8. März – Achtung! Das Wort wird gemeinerweise auch als Schimpfwort mit der Bedeutung “blöde Kuh, dumme Schnepfe” verwendet).
Eine Zahl hat sogar den lexikalischen Sprung zum Adjektiv geschafft – nämlich die 2, chinesisch 二 èr! Wenn Ihnen in China jemand sagt, Sie seien sehr “zwei” (你很二! Nǐ hěn èr!), ist das allerdings alles andere als doppelter Grund zur Freude. In der Umgangs- und Internetsprache beschreibt “zwei” heute seltsame Verhaltensweisen oder eine schräge Optik. Jemand, der “zwei” ist, kommt also “schräg”, “seltsam”, “freaky”, “komisch” oder sogar ein bisschen “bekloppt” rüber.
Die neue Verwendungsweise geht teils auf Dialekteinflüsse zurück, da es in zahlreichen chinesischen Mundarten (方言 fāngyán) unterschiedliche abwertende Begriffe gibt, in denen das Zeichen 二 (èr) auftaucht. Verwandt ist sie aber auch mit einer anderen “geflügelten” Zahl, die Sie sich merken sollten, nämlich “zweihundertfünfzig” (二百五 èrbǎiwǔ) wie in “Er ist eine 250” (他是个二百五 Tā shì ge èrbǎiwǔ.). 250 ist in China ein Synonym für “Idiot, Depp, Trottel”. Wer hätte damit gerechnet.
vor gut zwei Jahren war der Autozulieferer Webasto das erste Unternehmen in Deutschland, das von einem Corona-Fall getroffen wurde. Damals herrschte große Aufregung, doch im Gesamtbild der Pandemie erwies sich das Ereignis als bloße Episode, die heute schon fast wieder vergessen ist. Im Interview mit China.Table spricht nun der Vorstandsvorsitzende von Webasto, Holger Engelmann, nun über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.
Engelmann fürchtet aus mehreren Gründen für die Nach-Corona-Phase ein “wirtschaftliches Long Covid”. Mangel an Fachkräften, Rohstoffen oder Halbleitern werden die Unternehmen noch eine Weile bremsen, sagt er gegenüber Marcel Grzanna. Webasto habe daher seine Lieferbeziehungen möglichst robust aufgestellt. Doch Engelmann warnt: “Eine Lieferkette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied” – und am Ende kommen immer Teile aus anderen Weltgegenden.
Für China hegt Engelmann sogar Gedankenspiele für abgekoppelte Kreisläufe, da auch Peking seinen Lehren aus der Krise gezogen hat. Die Reaktion des Landes auf die beginnende Pandemie Ende 2019 bewertet Engelmann derweil als zu wenig transparent – die Welt habe damals wertvolle Zeit verloren.
Ab heute gilt das neue Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten – PIPL. Frank Sieren analysiert, wie sich Chinas Tech-Unternehmen seit der Ankündigung auf die Änderungen des Rechtsrahmens vorbereitet haben: Was blieb ihnen anderes übrig, als sich zu fügen und den Bürgern nun anständigen Datenschutz zu bieten? Der Staat nimm sich jedoch weiterhin von den Pflichten aus.
Wir haben ihnen im Juli das Buch “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt” vorgestellt. Eigentlich sollten die Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges vergangene Woche an zwei Konfuzius-Instituten aus ihrem Werk lesen. Dazu kam es nicht, denn die Institute sagten die Veranstaltung auf Druck aus Peking ab. Das hat nicht nur zum Imageverlust für die beteiligten deutschen Hochschulen geführt. Bildungsministerin Anja Karliczek feuert nun sogar einen Warnschuss für die Konfuzius-Institute und ihre Partner ab. Sie sollten sich mit der Einflussnahme Chinas “dezidiert auseinanderzusetzen”.
Einen guten Wochenbeginn wünscht


Herr Engelmann, Webasto war zu Beginn der Corona-Pandemie in den Schlagzeilen. Der erste Corona-Infizierte in Deutschland war einer Ihrer Mitarbeiter, der von einer Kollegin aus Wuhan angesteckt wurde. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die vergangenen anderthalb Jahre zurück?
Da springt bei mir sofort ein großes Kopfkino an. Als wir damals mit dem Virus konfrontiert wurden, hatte das nicht nur eine wirtschaftliche Dimension. Es ging auch um die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und unseres Umfeldes. Da mussten wir binnen weniger Stunden schnell handeln und harte Entscheidungen treffen wie die vorübergehende Schließung unserer Firmenzentrale in Stockdorf. Im Nachhinein sind wir stolz, wie gut wir das gemanagt haben.
Wie lautet ihr betriebswirtschaftliches Fazit dieser Zeit?
In der Summe hat uns die Corona-Pandemie als Autozulieferer schon sehr getroffen. Allerdings hätte alles schlimmer kommen können. Der chinesische Markt hat sich sehr schnell erholt, das hat uns geholfen. Dennoch haben wir 2020 nicht mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Das lag aber auch daran, dass wir trotz Krise weiter investiert haben, zum Beispiel in neue Standorte oder unsere Lösungen zum Thema E-Mobilität oder autonomes Fahren.
Ist die Krise jetzt überstanden?
Wir treten jetzt in die Nach-Corona-Phase ein, das wirtschaftliche Long Covid sozusagen. Wir spüren, dass die Welt aus dem Tritt gekommen ist. Das äußert sich bei den Halbleitern, bei der Verknappung von Rohstoffen oder der geringeren Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Das ist eine Entwicklung, die mich sehr beunruhigt. Wir haben über viele Jahre ein sehr komplexes System in der Welt aufgebaut, das sehr fragil ist, wie wir jetzt feststellen.
Dieses System ist jetzt aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn ich hier mit einer Metapher arbeiten darf: Es ist vergleichbar mit einem Stein, den man ins Wasser wirft. Man wird jetzt sehen, ob das nur eine Welle ist, die langsam abebbt, oder ob wir ein System losgetreten haben, das in eine Art Eigenfrequenz übertritt und nicht mehr zu schwingen aufhört.
Können Sie das konkretisieren?
Im Augenblick haben wir auf der ganzen Welt zu wenig Halbleiter. Ein Sturm in den USA, ein Feuer bei einem Chipproduzenten in Japan oder ein Corona-Ausbruch in Malaysia sind jetzt plötzlich auf der ganzen Welt spürbar. Es kommen weitere Themen hinzu: Die Rohstoffpreise steigen, in China gibt es eine Stromverknappung. Jedes Problem ist einzeln vielleicht lösbar, aber wenn dieser Zustand systemisch wird und an immer mehr Enden Baustellen entstehen, dann wird das natürlich schwierig.
Wagen Sie eine Prognose?
Beide Szenarien sind gleichermaßen wahrscheinlich. Wir wissen nicht, was 2022 oder 2023 wird. Haben wir das Problem der Halbleiter dann im Griff, oder wird alles noch schlimmer? Und kommt dann das nächste Problem auf uns zu und dann das nächste und wieder das nächste? Klar ist nur, dass sich einige grundsätzliche Dinge bei den Arbeitsabläufen dauerhaft verändert haben. Digitale Begegnungen werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil sein. Aber auch hier gilt es, ein vernünftiges Maß zu finden.
Wieso?
Wenn alles nur noch virtuell läuft, dann kommt das Zwischenmenschliche zu kurz, also die Möglichkeit, sich nach einem Meeting unter vier Augen auszutauschen, direkt die Stimmung meines Gegenübers zu erkennen, nochmal nachzuhaken oder auf etwas hinweisen zu können. Unsere Branche hat wenig Reserven in ihren Systemen. Das ist alles eng getaktet und auf kleine Margen ausgerichtet. Da kann die Kommunikation sehr entscheidend sein für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes. Wir akzeptieren den neuen Normalzustand, aber wir müssen ihn noch verbessern.
Was haben Sie über China gelernt in den vergangenen anderthalb Jahren?
Die Anfangsphase der Pandemie war geprägt von mangelnder Transparenz. Schon im Oktober 2019 haben wir in Wuhan mitbekommen, dass irgendetwas vor sich geht. Die ersten Gerüchte haben wir aber nicht wirklich ernst genommen.
Viele Unternehmen schweigen lieber, statt der chinesischen Regierung Fehler vorzuwerfen.
Ich denke, wir dürfen schon objektiv feststellen, dass die Informationspolitik transparenter hätte sein können. Ich muss aber auch sagen, dass unsere chinesische Mitarbeiterin, die damals das Virus in sich getragen hatte, nach ihrer Rückkehr nach China dem Robert Koch-Institut detailliert Auskunft gegeben und wichtige Erkenntnisse zu ihrem Krankheitsverlauf geliefert hat.
Wir hätten uns pandemisch hierzulande sicherlich besser vorbereiten können, wenn wir in Europa frühzeitig gewusst hätten, wie ernst die Situation in Wuhan war. Mit diesem Informationsvorsprung hätten wir eine größere Chance gehabt, das Virus einzudämmen. Zugegebenermaßen hätten Europäer oder Amerikaner bei ihrem folgenden Krisenmanagement deutlich besser sein können.
…während China schon frühzeitig seinen Sieg über das Virus feierte.
Mit ihrer Härte und extremer Effizienz hat die chinesische Regierung die Auswirkungen auf ihr eigenes Land extrem minimiert. Über die Vehemenz der Maßnahmen kann man sicherlich diskutieren, aber was die Eindämmung des Virus angeht, war das Land erfolgreich.
Die Pandemie hat die Schwachpunkte globaler Lieferketten offenbart. Wird Webasto weiter regionalisieren?
Unsere DNA ist es, dass wir in der Region für die Region produzieren und dort auch unsere Teile beziehen. Daher sind wir der Anfälligkeit der Lieferketten weniger unmittelbar ausgesetzt. Aber jede Komponente hat eine eigene Lieferkette, die ihrerseits betroffen sein kann. Insofern trifft es uns dort, wo unsere Zulieferer Komponenten benötigen.
Wir können diese ganzen Ebenen unmöglich selbst bis in die letzten Winkel selbst durchschreiten. Eine Lieferkette ist daher immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und selbst wenn wir Komponenten auf Vorrat lagern würden, kann es passieren, dass einem unserer Kunden eine andere Komponente fehlt. Auch dann wären wir betroffen. Die Komplexität der Wertschöpfung ist gewaltig.
China möchte diese Komplexität aus nationalen Interessen entflechten. Das bedeutet für Webasto und andere, künftig zwei Lieferketten aufbauen zu müssen. Eine für China und eine für den Rest der Welt.
Ich fürchte, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir einen solchen autarken Kreislauf in China in Zukunft ermöglichen müssen. Wir gehen davon aus, dass die chinesische Volkswirtschaft aus der Krise gelernt hat und ihre eigene Abhängigkeit vom Ausland verringern will. Heute ist es noch nicht so, aber es könnte darauf hinauslaufen, dass alle Komponenten in China irgendwann zur Verfügung stehen.
Bereitet Ihnen diese Entkopplung Unbehagen?
Wir haben uns in allen Regionen der Welt immer flexibel auf die jeweiligen Umstände einstellen können. Das wird uns auch in China gelingen. Es ist aber eine andere Frage, ob die Regionalisierung rein volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Sie lässt Effizienzpotenzial liegen, weil Einkaufsvolumen geringer werden und damit zu Preiserhöhungen für alle Beteiligten einschließlich der Konsumenten führen.
Zahlen wir auch einen politischen Preis in Form einer Entwurzelung unserer Unternehmen?
Schwierige Frage. Zumindest haben wir als Webasto in 20 Jahren, die wir jetzt in China tätig sind, keine Probleme gehabt. Wir konnten uns in den einzelnen Regionen nach Wunsch entwickeln. Wir können unsere Mitarbeiter frei nach unseren Werten führen, wie wir das auch in Deutschland machen. Und wir haben eine loyale chinesische Belegschaft.
Selbst wenn chinesische Konkurrenten in der Vergangenheit gegen unsere Patente verstoßen haben, konnten wir unsere Interessen rechtlich durchsetzen. Wir haben als Unternehmen also nichts Negatives in China erfahren und uns gut entwickeln können. Wir haben unsere Marktführerschaft bei Dächern bisher halten können. Wir merken natürlich, dass chinesische Konkurrenten hochkommen. Aber gegen die können wir uns nach den Regeln der Marktwirtschaft behaupten.
Mit der verschärften Datenschutz-Gesetzgebung erhalten chinesische Behörden jetzt aber die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, welche Daten ein Unternehmen aus dem Land transferieren darf. Bereitet Ihnen das keine Sorgen?
Von unserer Organisation vor Ort haben wir den Hinweis bekommen, dass wir keine Probleme haben werden. Wir mussten lediglich offenlegen, ob wir alle Regelungen einhalten. Das ist für uns erst einmal kein Nachteil. Eher sind wir davon überzeugt, dass sich der ein oder andere Mitbewerber an die Regelungen anpassen muss.
Sammeln Sie denn Daten in China, die nach Deutschland transferiert werden?
Nein, wir müssen in China keine Daten sammeln. Unsere gesamte chinesische Organisation arbeitet auf Systemen in Deutschland. Dort liegen also auch die Daten.
Das neue Antisanktions-Gesetz kann Unternehmen dazu zwingen, sich für oder gegen China zu entscheiden. Werden Webasto und andere zum Spielball auf der geopolitischen Bühne?
Das ist sicherlich Teil der Realität. Wenn sich die politische Gemengelage verhärtet und ein Decoupling droht, dann muss man als Firma so aufgestellt sein, dass man in jeder Region überlebensfähig ist, in der man operiert. Tatsache ist aber auch, dass wir in China gute Geschäfte machen und das Geld weiter in unsere Entwicklung oder innovative Technologien investieren können. Wir profitieren von dem Cashflow aus China, auch indem wir Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Aber wir sind natürlich so aufgestellt, dass wir in jeder Region profitabel arbeiten können.
Solange der Strom nicht abgeschaltet wird.
Webasto ist genauso wie viele unserer Kunden direkt von der Stromverknappung betroffen. Um die Situation abzufedern und die Produktion aufrechtzuerhalten, haben wir zwischenzeitlich zusätzliche Strom-Generatoren gemietet. Unser Eindruck ist, dass die Behörden sehr bemüht sind, die Situation zu stabilisieren. Der energieintensive Winter wird aber in jedem Fall eine weitere Herausforderung sein.
In ihrem neuen Batteriecenter in Jiaxing geht Webasto in China nun auch neue Wege, weg von Autodächern und Standheizungen. Steigen Sie mittelfristig in die Batterieproduktion ein?
Nein, wir werden keine Batteriezellen produzieren, sondern wollen eine Nische besetzen, in dem wir als Systemhersteller Batteriepacks entwickeln und verkaufen, die Hersteller in ihre Fahrzeuge integrieren können. So können sich Zelllieferanten und OEMs (Original Equipment Manufacturer, also Autohersteller) auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Das war eine mutige Entscheidung in 2016, in diesen neuen Bereich der Elektromobilität zu investieren. Unser Ziel ist es, mit unseren Systemlösungen für die Elektromobilität in einigen Jahren mehr als eine Milliarde Euro Umsatz zu generieren.
China ist der größte Einzelmarkt für Webasto, der dem Unternehmen fast 40 Prozent des Umsatzes einbringt. Sie haben dort zwölf Standorte. Bleibt das Zentrum der Forschung und Entwicklung dennoch in Deutschland?
Ja. Unsere Batterie-Technologie wurde komplett in Deutschland entwickelt. Wir haben jetzt aber gemeinsam mit chinesischen OEMs ein eigenes chinaspezifisches Batterieprodukt. Ich sehe hier ein wichtiges Prinzip für den freien Wettbewerb: Wir sollten nicht versuchen, andere Länder einzuschränken, sondern besser, schneller, innovativer zu sein.
Holger Engelmann ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender des Autozulieferers Webasto mit Sitz in Stockdorf bei München. Zuvor war der promovierte Volkswirt dort stellvertretender CEO und Finanzchef.
Webasto wurde 1901 gegründet und ist auch heute noch ein Familienunternehmen. Schwerpunkte liegen bei Dächern, Heizungen und Klimaanlagen, sowie bei Ladeeinrichtungen und kompletten Batteriesystemen für Elektroautos. Webasto produziert schon seit 2001 in Shanghai. China ist heute der wichtigste Einzelmarkt des Unternehmens. Im September 2019 besichtigte Kanzlerin Angela Merkel das Webasto-Werk in Wuhan. Im Januar 2020 steckten sich einige Firmenmitarbeiter in Deutschland mit Corona an. Das Unternehmen erhielt damals viel Lob für seine schnelle Reaktion zur Eindämmung der Infektionsketten.
Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zeigt sich besorgt über den zunehmenden Einfluss der Konfuzius-Institute auf das Geistesleben in Deutschland. In einem Brief an die deutschen Hochschulen schreibt sie von einer “inakzeptablen” Einflussnahme. Sie ruft dazu auf, “die Rolle der Konfuzius-Institute in der deutschen Hochschullandschaft neu zu bewerten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen”. Sie empfiehlt den Universitäten, “ihre Zusammenarbeit mit den Instituten prüfend zu hinterfragen” und sich mit der Einflussnahme Chinas “dezidiert auseinanderzusetzen”.
Der Anlass des Briefes ist eine Diskussion um eine Veranstaltung, die ursprünglich an zwei Konfuzius-Instituten angesetzt war. Stefan Aust und Adrian Geiges, die Autoren des Buches “Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt”, wollten ihr Werk ursprünglich am 27. Oktober vorstellen und daraus lesen. Doch die Konfuzius-Institute an den Universitäten Hannover und Duisburg sagten die Veranstaltungen kurzfristig ab. In Duisburg wurde die Buchvorstellung dann von der Universität selbst organisiert.
Zur Begründung stellte das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover (LKIH) eine Stellungnahme online. Darin heißt es: “Nach der Ankündigung des Online-Gesprächs über die Biografie des chinesischen Staatspräsidenten mit Buchautor Adrian Geiges kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit den chinesischen Partnern, die ein Festhalten an dem Format und eine Mitwirkung des LKIH nicht mehr möglich machten.”
Dem Piper-Verlag zufolge soll die Shanghaier Tongji-Universität gegenüber dem Konfuzius-Institut in Hannover auf eine Absage der Veranstaltung bestanden haben. Das Konfuzius-Institut in Hannover wird gemeinsam von der Tongji-Universität und der Leibniz-Universität betrieben. In Duisburg intervenierte laut Pressemeldung Feng Haiyang, der Generalkonsul Chinas in Düsseldorf, persönlich, “um die Veranstaltung zu verhindern”.
Für Markus Taube, Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft / China an der Mercator School of Management und Kodirektor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr an der Universität Duisburg Essen, kam die Absage “aus heiterem Himmel“. “Bislang hat es trotz kritischer Veranstaltungen nie Einmischungen gegeben”, sagte Taube dem China.Table. Dieser Präzedenzfall ist für alle Beteiligten eine “Loose-Loose-Loose-Konstellation”, so Taube. Er meint damit nicht nur die jahrelangen Beziehungen, die die Universitäten mit ihren Partneruniversitäten in China pflegen, sondern auch, dass die Grundsatzfrage zur chinesischen Einmischung damit wieder auf dem Tisch ist.
Konfuzius-Institute wie das in Duisburg-Essen sind rechtlich gemeinnützige Vereine und unterstehen deutschem Recht. Sie sind nicht verpflichtet, den Hochschulen, denen sie angegliedert sind, ihre Finanzen offenzulegen, sondern müssen ihre Einnahmen nur gegenüber dem Finanzamt erklären. Auch die Nachprüfung der deutschen Steuerbehörde ist nicht öffentlich.
In Deutschland gibt es 19 Konfuzius-Institute. Sie sind meist Universitäten angegliedert. Ihr offiziellen Ziel ist die Vermittlung der chinesischen Sprache und Kultur zu fördern und eine Brücke für den kulturellen Austausch zu bilden.
Bereits 2014 sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping: “Wir sollten Chinas Soft Power stärken, ein gutes chinesisches Narrativ vermitteln und Chinas Botschaften besser in die Welt tragen”. Solche Äußerungen schüren jedoch auch Misstrauen. Konfuzius-Instituten wird nachgesagt, dass sie mit ihrem Programm der verlängerte Arm Pekings im Ausland seien.
Konfuzius-Institute sind staatliche chinesische Bildungsorganisationen. Sie sind dem Zentrum für Sprachbildung und Zusammenarbeit (Hanban) untergeordnet. Daher stehen sie unter dem Verdacht, eng mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um das Meinungsbild zu China im Ausland so zu beeinflussen, wie die Regierung in Peking es gern sehen würde.
Auch die Finanzierung einer Professur an der Freien Universität Berlin mit einer halben Million Euro aus Chinas Staatskasse sorgte für Aufsehen. Ganz unabhängig von finanziellen Zuwendungen wird diskutiert, wie die Universitäten den Konfuzius-Instituten durch die räumlichen Überschneidungen Legitimität verschaffen. Kritisiert wird auch, dass die Institute den Ruf der deutschen Hochschulen und die Freiheit der Forschung und Wissenschaft schädigen.
Zu den vehementesten Kritikern gehört Chinaexperte Andreas Fulda von der University of Nottingham. Fulda sagt, Konfuzius-Institute haben “nichts an Universitäten zu suchen”. “Das ist eine Art Ideen-Wäsche, wo politischer Propaganda der Stempel der Unbedenklichkeit gegeben wird“, sagte er dem Tagesspiegel.
Nach Absage der Buchvorstellung kritisierte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) laut NDR: “In Deutschland herrschen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit”. Auch Thümler nannte wie zuletzt Karliczek die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute “nicht akzeptabel”.
Laut dem Piper-Verlag, der das Xi-Buch verlegt, sollen die Konfuzius-Institute Druck “von ganz oben bekommen” haben. “Die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute ist ein beunruhigendes und verstörendes Signal“, sagt Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg.
Vertraute sagen hinter vorgehaltener Hand, dass die Glaubwürdigkeit der Konfuzius-Institute mit den Vorfällen massiv gelitten hat. Aber auch die Vertrauensbasis zwischen deutschen und chinesischen Wissenschaftlern der beteiligten Universitäten sei beschädigt worden.
Organisiert durch die Universität Duisburg fand die Online-Buchvorstellung letztlich doch noch statt. Allerdings ohne Beteiligung der Konfuzius-Institute. Stattdessen einigten sich alle Beteiligten darauf, dass das Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Duisburg-Essen, an der Taube derzeit Direktor ist, als alleiniger Veranstalter fungieren solle.
Stefan Aust, Co-Autor der Xi-Biografie, sieht die Grundthesen seines Buchs durch den Vorfall bestätigt: “Erstmals ist eine Diktatur dabei, den Westen wirtschaftlich zu überholen und versucht jetzt auch, ihre gegen unsere Freiheit gerichteten Werte international durchzusetzen.”
Adrian Geiges verweist darauf, dass das Buch China sehr differenziert darstellt, etwa auch die erfolgreiche Überwindung der Armut in den vergangenen Jahrzehnten. “Offenbar reichen Xi Jinping solche ausgewogenen Berichte nicht mehr aus – er will jetzt international einen Kult um seine Person, so wie in China selbst”, so zitiert eine Pressemeldung von Piper die beiden Autoren.
In der Pressemeldung zitiert der Piper-Verlag auch eine Mitarbeiterin der Konfuzius-Institute. Sie begründet die Absage der Buchvorstellung mit folgendem Satz: “Über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen reden, er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar.”
Geiges macht in einem Interview mit dem NDR klar, dass dieses Zitat nicht die eigene Meinung der Mitarbeiterin ist und nicht als Kritik am Vorgehen Pekings zu verstehen sei. Vielmehr gebe sie die Verbote wieder, die den Konfuzius-Instituten von chinesischer Seite mitgeteilt werden. “Dass es in China so ist, das ist nichts Neues, aber dass es jetzt auf Deutschland ausgedehnt werden soll, ist was Neues”, so Geiges.
Am 1. November ist Chinas neues Gesetz zum Schutz persönlicher Daten in Kraft getreten. Große Teile der Internetindustrie haben bereits eine stringente Umsetzung zugesichert. Schon mehr als 20 Firmen aus der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen haben angekündigt, ihre Datenschutzbestimmungen mit dem Datenschutzgesetz in Einklang zu bringen. Die Unternehmen verpflichteten sich auf die Einhaltung von zehn Initiativen der Regierung, die Unternehmen unter anderem dazu auffordern,
Man wolle “eine gesunde und nachhaltige Entwicklung” fördern, erklärten unisono Sprecher von Unternehmen wie Tencent und Huawei auf einer staatlich organisierten Internet-Konferenz in Shenzhen am vergangenen Freitag.
Das “Personal Information Protection Law” (PIPL) ist eine der weltweit strengsten Datenschutzbestimmungen. Es wurde bis ins Detail der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nachempfunden. Das Gesetz schreibt vor, dass personenbezogene Daten transparent gesammelt und verarbeitet werden müssen. Es gibt den chinesischen Bürgern also einen größeren Spielraum als zuvor, um sich gegen Datenlecks und den Missbrauch persönlicher Informationen zu schützen – zumindest, wenn es um Unternehmen geht. Das PIPL wurde am 20. August 2021 vom Nationalen Volkskongress Chinas verabschiedet. Es folgt auf das Cybersecurity Law von 2017 und das E-Commerce Law von 2019.
Mit dem Fortschritt bei Zukunftstechnologien wie Gesichtserkennung oder Künstlicher Intelligenz rücken in China auch verstärkt deren Risiken in den Fokus. 2019 hat eine Studie aufgezeigt, dass 30 Prozent der Befragten bereits Opfer von Datenmissbrauch geworden sind. Beispielsweise wurden ihre Telefonnummer, Adressen oder Bankverbindungen weitergegeben, ohne dass sie davon wussten.
Ebenso wie die DSGVO sieht das PIPL Strafen bei Verstößen vor. Diese beinhalten Geldbußen bis zu 50 Millionen Yuan (6,7 Millionen Euro) beziehungsweise fünf Prozent des vorausgegangenen Jahresumsatzes. Sogar die gesamte Stilllegung des Betriebs kann drohen (China.Table berichtete).
Datenschutz hat in China bislang vor allem wirtschaftliche Gründe: Die Regierung will den Konsum sicherer machen und gleichzeitig die Offenheit gegenüber neuen Technologien in der Bevölkerung stärken. Peking darf das Vertrauen der wachsenden Mittelschicht nicht verlieren – auf ihren Schultern soll Chinas Wirtschaft mehr und mehr auf den Binnenkonsum umgestellt werden. Schon jetzt entfallen rund 60 Prozent der Wirtschaftskraft und die Hälfte der staatlichen Arbeitsplätze auf den Dienstleistungssektor.
Das PIPL betrifft auch ausländische Unternehmen, die in China tätig sind. “In China aktive Unternehmen oder sonstige Unternehmen, die personenbezogene Daten chinesischer Bürger verarbeiten, sollten ihre Prozesse prüfen, gegebenenfalls anpassen und die Entwicklungen im Blick behalten”, empfiehlt die Wirtschaftskanzlei Noerr.
Das betrifft vor allem Auslandsdatentransfers und die sogenannte Datenlokalisierung. Konkret heißt das, dass die Daten chinesischer Bürger nicht ohne ihre Zustimmung ins Ausland übermittelt werden dürfen. Laut Artikel 39 des Gesetzes müssen die betroffenen Personen über die Übermittlung informiert werden. Auch müssen Daten, die ins Ausland übermittelt werden, eine behördliche Sicherheitsbewertung durchlaufen. Standardvertragsklauseln, die ähnlich wie im DSGVO Auslandsdatentransfers regeln, wurden durch die zuständige Cyberspace Administration of China noch nicht veröffentlicht.
Im chinesischen Gesetz gibt es noch einen entscheidenden Unterschied zum EU-Datenschutzgesetz: Peking behält sich vor, Daten zu erheben, die für die “Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit” wichtig erscheinen – der Staat ist von dem Gesetz nicht betroffen. Öffentliche Sicherheit ist in China bekanntlich ein potenziell weites Feld, das im Grunde alles umfassen kann.
Dennoch hält der in Peking geborene deutsche Rechtsanwalt Mathias Schroeder von der Pekinger Kanzlei Ding Schroeder & Partner dies für einen wichtigen Schritt. “Der neue Gedanke dabei, und der hat durchaus Sprengkraft: Die Menschen sollen grundsätzlich selbst bestimmen dürfen, wer, wie mit ihren Daten Geld verdient”, fasst Schroeder die Entwicklung zusammen. “Das bezieht sich erstmal auf den Konsum, aber der Geist ist aus der Flasche. Auch, wenn der Staat sagt, im Falle der nationalen Sicherheit darf er die Daten benutzen.”
US-Außenminister Antony Blinken hat mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi am Rande des G20-Gipfels in Rom über Taiwan gesprochen. Nach amerikanischer Darstellung des Treffens ging es darum, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Das Treffen habe eine Stunde gedauert und sei in offener und konstruktiver Atmosphäre verlaufen. Blinken habe seine Sorge darüber vorgetragen, dass China die Spannungen um Taiwan erhöhe. Er betonte zugleich, dass die USA an dem Ein-China-Prinzip festhalten wollen.
Ein konstruktives Treffen zwischen Blinken und Wang wäre ein Fortschritt gegenüber ihrem ersten Zusammentreffen im März. Damals hatten die beiden Außenpolitiker sich gegenseitig angegiftet und die Beziehungen zwischen ihren Ländern in schlechterem Zustand hinterlassen als vorher. Seitdem hat China mit Überflügen durch Luftwaffenjets und durch Aussagen der Führung ihren Anspruch auf eine Vereinigung mit Taiwan bekräftigt (China.Table berichtete). fin
Der chinesische Autokonzern Geely hat seine schwedische Tochter Volvo erfolgreich an die Börse gebracht. Die Aktie von Volvo Car AB stieg am ersten Handelstag um 23 Prozent auf 65,20 Kronen. Der erste Kurs lag bereits zehn Prozent über dem Ausgabepreis. Das Unternehmen hat damit am Freitag gut zwei Milliarden Euro eingenommen. Geely und Volvo wollen das Geld nutzen, um das Unternehmen zum reinen Elektroauto-Anbieter auszubauen. Damit kommen eine gut eingeführte schwedische Marke und besonders wettbewerbsfähige Batterietechnik aus China mit frischem Kapital zusammen. Die chinesische Muttergesellschaft hatte Volvo 2010 übernommen. fin
Die USA haben am Wochenende eine ergänzte Version ihres Geheimdienstberichts zur Herkunft von Sars-CoV-2 veröffentlicht. Die Autoren nennen darin die Möglichkeit eines Laborunfalls in der Stadt Wuhan als ein mögliches Szenario für die Freisetzung des Erregers. Zugleich schließen sie die Möglichkeit aus, dass das Virus dort absichtlich als Biowaffe entwickelt wurde. Als plausible Alternative nennen sie ein Überspringen von Tier auf Mensch in der Natur.
China wies den Bericht erneut zurück. “Egal, wie viele Versionen zusammengebastelt werden, es kann nichts daran ändern, dass es sich um einen rein politischen und falschen Bericht handelt”, sagte ein Sprecher. Auch Chinas Außenminister Wang Yi beschäftigte sich am Sonntag mit dem Thema. Auf dem G20-Treffen in Rom forderte er gegenüber Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Direktor der Weltgesundheitsorganisation, den Covid-Ursprung “objektiv und wissenschaftlich” untersuchen zu lassen. fin
Weil sie sich die Sichtweise Chinas zu sehr zu eigen mache, hat das ZDF eine Dokumentationsreihe wieder aus der Mediathek genommen. Auch eine Wiederholung von “China vs. USA – Clash der Supermächte” im Programm von ZDF Info sei gestrichen, berichtet die Webseite Übermedien. Die vierteilige Reihe war von Mediacorp produziert, der staatlichen Sendeanstalt von Singapur. Die Serie habe den Aufstieg Chinas als unausweichlich dargestellt und Menschenrechtsverletzungen wie Verhaftungen in Hongkong ignoriert, lautet Kritik an der Produktion. Die Regisseurin rechtfertigt sich: Sie habe sich um eine ausbalancierte Verteilung der Sendezeit über USA und China bemüht. Das ZDF habe die nötige Prüfung des Hintergrunds der Doku-Reihe versäumt, zitiert Übermedien den Leiter von ZDF Info, Robert Bachem. fin

Auf der jüngsten UN-Vollversammlung am 21. September kündigte Chinas Präsident Xi Jinping an, den Bau von neuen Kohleprojekten in Übersee einzustellen. “China will step up support for other developing countries in developing green and low-carbon energy, and will not build new coal-fired power projects abroad.” (englische und chinesische Version der Rede)
Ganz überraschend kam diese Ankündigung nicht. Doch noch am gleichen Tag ging der Sturm von Fragen los: Was genau hat der Präsident damit gemeint? Schließt das die Finanzierung und Versicherung mit ein? Und den Kohlebergbau? Welche Unternehmen und Banken sind davon betroffen?
Das offizielle China blieb zwar vorerst die Antworten schuldig. Die Ankündigung war jedoch durchaus intern und extern koordiniert. Hinter den Kulissen wurden bilaterale Gespräche geführt. Chinas Kohleindustrie und Kohlefinanzierer waren in den letzten zwei Jahren nicht nur durch die globale Klimaschutzbewegung unter Druck geraten. Das Leuchtturmprojekt BRI schien in ernsthafte Reputationsengpässe zu kommen. Gerade im Vorfeld des Weltklimagipfels musste nun auch offiziell reagiert werden.
Alok Sharma, der Präsident des 26. Weltklimagipfels, traf sich mit dem Chef einer der größten Banken Chinas, der Zentralbank (People’s Bank of China), sowie der nationalen Planungskommission und der nationalen Energiebehörde (NEA). Es ging um die Finanzierung von Kohle weltweit. Wenige Monate zuvor hatten Japan und Südkorea Pläne für den Ausstieg aus der öffentlichen Finanzierung von Kohleprojekten verkündet. Seit 2013 haben diese beiden Länder zusammen mit China 95 Prozent der öffentlichen Gelder für Kohleprojekte außerhalb ihrer eigenen Grenzen ausgegeben – China allerdings das meiste Geld, insgesamt 50 Milliarden USD und rund 56 GW der installierten Kapazität.
Was ändert sich jetzt, wo Präsident Xi Jinping medienwirksam den Kohleausstieg außerhalb Chinas verkündet hat?
In Planung befinden sich 60 Gigawatt Kohleverstromung in 20 Ländern, finanziert von öffentlichen chinesischen Banken. Es ist bis heute noch nicht klar, wie viele der geplanten neuen Kohlebergwerke (zum Beispiel in Russland und Pakistan) wirklich gestrichen werden.
Expansionisten – das sind die absoluten Klimakiller, aus Sicht von urgewald. Laut der gerade erst im Oktober 2021 von urgewald und NGO Partnern veröffentlichten Global Coal Exit Liste (GCEL) 2021 gehören chinesische Unternehmen derzeit nach wie vor zu den größten Expansionisten bei Kohlekraftwerken auf der ganzen Welt: Von den 503 Unternehmen mit Plänen für neue Anlagen sind 26 Prozent chinesische Unternehmen, im Vergleich zu elf Prozent aus Indien, dem zweitgrößten Expansionisten.
Dennoch-es gilt jetzt zu erfassen, wieviel der sich in Planung befindlichen Kohlekraft schon den Finanzabschluss erreicht hat (nicht als “neu” definiert, und damit wohl nicht adressiert werden), und was mit denen passiert, die sich in Vorbereitung zum Bau befinden (dies könnte zum Beispiel zwei der fünf sich im Bau befindlichen Kraftwerke in Kambodscha betreffen). Urgewald untersucht gemeinsam mit Kolleg*Innen weltweit, welche und wieviel Kohleinvestitionen im Ausland erfasst werden könnten.
Es ist recht klar: Die Ankündigung war auch ein Test. Sie hatte zwei Teile. Verbunden mit dem Angebot, in großem Stil Low-Carbon-Technologie in den Ländern der BRI zu fördern, werden nun bis zur COP 26 Wunschlisten eingeholt, wie die Kohlepläne “umgewandelt” werden können. Hier geht es auch um die Konkurrenz, wer am Ende in Südostasien, Lateinamerika und Afrika am meisten Gelder für Low-Carbon bereitstellen wird.
Was wir weltweit beobachten ist, dass der eine fossile Brennstoff durch einen anderen ersetzt wird. Etwa ein Drittel der zwischen 2011 und 2019 in den USA “stillgelegten” Kohlekraftwerke wurde tatsächlich auf Gas umgestellt. Und Länder wie Bangladesch, welches ein Drittel seiner geplanten Kohlekraftwerke gestrichen hat, oder die Philippinen, die mehr als die Hälfte der neuen Kohlekraftwerke in ihrer Projektpipeline gestrichen haben, steuern nun auf einen massiven Ausbau von Flüssigerdgas-Terminals (LNG) und gasbefeuerten Anlagen zu.
Diese Pläne müssen gestoppt werden, wenn wir das 1,5-Gradziel einhalten wollen. Gerade erst im Oktober 2021 einigten sich die OECD-Länder und damit u.a. Japan, Australien und die Türkei, auf die Einstellung von Exportkrediten für neue Kohlekraftwerke, die keine Carbon Capture, (Utilization) and Storage (CCUS/CCS) anwenden. Obwohl dies die erste international verbindliche Vereinbarung ist, die die Exportunterstützung für internationale Kohleprojekte bis Ende 2021 beendet, stützt sie sich auf falsche Lösungen. Es gibt keine “sauberen” Kohlekraftwerke. Auch wenn Emissionen “eingefangen/gespeichert” werden können, hängt an der Kohleindustrie die schmutzige Kohleproduktion, der Kohlebergbau. CCS legitimiert die Fortführung fossiler Industrien. Die Verfahren sind energieintensiv, kostspielig, und bergen neue Risiken.
Auch China wird aber genau diesen Weg gehen: Umstellung auf Gas und Flüssiggas (LNG), und CCS/CCUS. Atomenergie und Staudämme sind die anderen beiden “klimafreundlichen” Technologien, die auf der COP26 angepriesen werden. Gas kann keine Brückentechnologie sein, in die nun massiv investiert wird. Bei der Verbrennung entsteht zwar weniger CO2 pro kWh, dafür entweicht bei Förderung und Transport des fossilen Gases das noch viel klimaschädlichere Methan.
Wir wollen verhindern, dass diese Technologien Eingang in die europäische Taxonomie finden. Sie zählen zu den “falschen Lösungen”. Eine weitere Scheinlösung stellen ETM-Schemata (Energy Transition Mechanism) dar, im Rahmen derer den Kraftwerken Entschädigungssummen für das frühere Abschalten gezahlt werden. So soll es geschehen bei dem deutschen Braunkohleausstieg (dies wird seit 2021 allerdings noch in der EU-Kommission geprüft).
Auf der COP26 wird dieses Schema als goldener Weg von der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) angepriesen werden (3. November 2021). Ein Gutachten auf europäischer Ebene hat gezeigt, dass diese ETMs de facto eine Verlängerung der Laufzeit ermöglichen. Auch in China und Asien sind diese Lösungen Scheinlösungen. Die ADB, die dann Eigentümer von Kohlekraftwerken würde, trotz ihrer “Kohleausstiegsstrategie”, erklärt die “Verringerung der Laufzeit auf 15 Jahre”. Dies kann angesichts des neuen IPCC Berichts vom 9. August 2021 keine wirkliche Lösung sein. Außerdem sollen diese Buy-out-Pläne zusammen mit Investoren geschehen, die mit zu den größten Expansionisten gehören, wie Blackrock, HSBC und Citigroup Inc.
In einer großen Koalition von Gleichgesinnten setzen wir uns für die Abkehr von solchen Scheinlösungen ein. Aber abgesehen davon: China interne Kohleexpansionspläne allein, immerhin 250 Gigawatt neue Kohlekraftwerkskapazität, könnten jedoch das Pariser Klimaabkommen kippen. Der Bau des Riesenstaudammes in Tibet oder die Mega-Solarkraftwerke in der Wüste werden mit der neuen Kohlekraft um das Netz konkurrieren. Eine grundlegende Aussage zum Kohleausstieg innerhalb China ist dringender denn je.
Nora Sausmikat ist Leiterin des China Desk der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation urgewald e.V.
Hubertus Troska wird zur weiteren Vereinheitlichung der Vorstandsressorts der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG ebenfalls in den Vorstand der Mercedes-Benz AG berufen. Troska ist CEO und Chairman von Daimler Greater China und verantwortlich für alle strategischen und operativen Aktivitäten von Daimler in China.
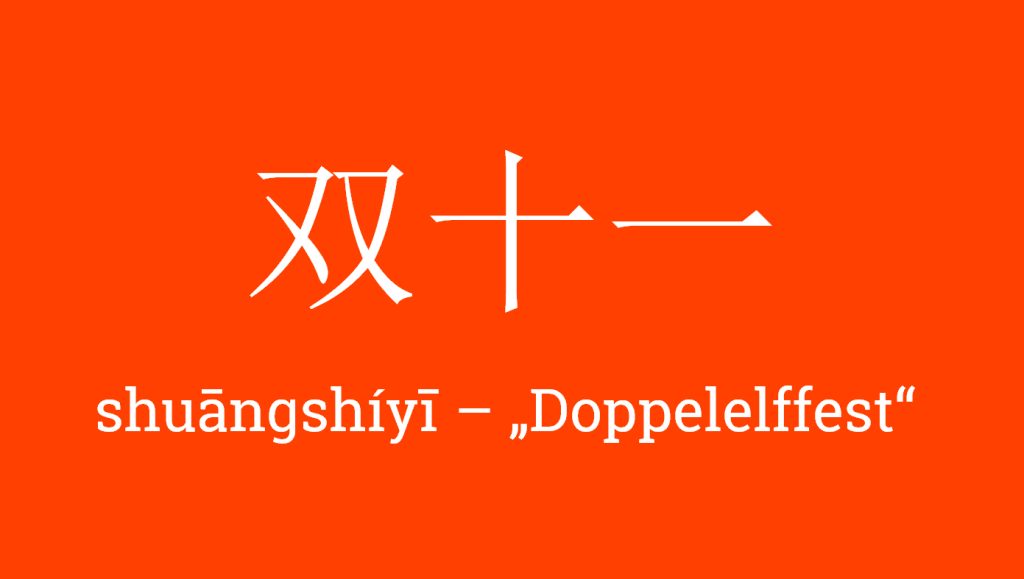
Verschwörungstheoretiker und Zahlenmystiker aufgepasst! Könnte die Zahlenreihe 1111, die uns in China momentan überall auf Internetseiten und Plakatwänden entgegenkreischt, vielleicht eine tiefere Bedeutung verschlüsseln? Tut sie tatsächlich. Die geheime Botschaft lautet: “kaufen, kaufen, kaufen” (买买买 mǎi mǎi mǎi)! Denn alljährlich am 11.11. – in wenigen Tagen ist es also wieder soweit – wird in China ein närrischer Shoppingkarneval zelebriert. Onlinehändler und Geschäfte liefern sich meist schon Wochen vorher eine wilde Preisschlacht und pflastern den öffentlichen und den virtuellen Raum mit entsprechenden Werbebotschaften zu. Berauschte Shoppingvictims sind dann beim Endspurt am 11. November manchmal schon fast zu erschöpft (oder finanziell ausgeblutet), um noch einmal den “Kaufbutton” zu klicken.
Erfunden hat’s Alibaba, besser gesagt das Portal Taobao Mall (heute Tmall 天猫 Tiānmāo) und zwar im Jahr 2010. Gut, ein bisschen abgekupfert wurde beim amerikanischen Vorbild des Black Friday, der ebenfalls traditionell im November stattfindet. In China war Taobao aber das erste E-Commerce-Portal, das eine spezielle November-Werbeaktion startete.
Die Datumswahl kam nicht von ungefähr: Für die junge, kauffreudige Zielgruppe war der 11.11. in China nämlich praktischerweise schon länger ein inoffizieller “Feiertag”, an dem viel konsumiert wurde. Weil sich an diesem Datum auf dem Kalenderblatt vier einsame Einsen zusammengesellen, wurde der Tag von Chinas Jugend zum “Tag der Singles” erklärt (光棍节 guānggùnjié “Singletag”, 光棍 guānggùn – wörtlich “kahler Stock” – ist die umgangssprachliche Bezeichnung für “Junggeselle, Junggesellin”). Viele Chinesen organisieren zu diesem Anlass Dinnerpartys, Datingtreffen und andere Get-togethers.
Im traditionellen Einzelhandel war das “Singlefest” lange jedoch eine Zeit gähnender Leere. Fällt der Tag doch genau in die Periode zwischen der Nationalfeiertagswoche um den 1. Oktober und dem Beginn des Weihnachts- und Frühlingsfestgeschäfts (ja, auch ersteres gibt es mittlerweile in China). Taobao wagte also ein Shopping-Experiment, der Rest ist Geschichte. Heute ist der Konsumfeiertag online wie offline ein Selbstläufer und hat unter dem Namen “Doppelelf(fest)” (双十一 shuāngshíyī – von双 shuāng “Paar, doppelt” und 十一 shíyī “elf”) längst Eingang ins Alltagsvokabular der Chinesen gefunden.
Hier noch einige weitere Zahlenfolgen, mit denen sie sich als Chinakenner profilieren können: 51 (五一 wǔ-yī: Tag der Arbeit am 1. Mai, oft auch als Bezeichnung für die nachfolgenden freien Tage gebraucht), 61 (六一 liù-yī: der internationale Kindertag am 1. Juni), 10-1 (十一 shíyī: Chinas Nationalfeiertag am 1. Oktober und die anschließende Feiertagswoche), 38 (三八 sānbā: internationaler Frauentag am 8. März – Achtung! Das Wort wird gemeinerweise auch als Schimpfwort mit der Bedeutung “blöde Kuh, dumme Schnepfe” verwendet).
Eine Zahl hat sogar den lexikalischen Sprung zum Adjektiv geschafft – nämlich die 2, chinesisch 二 èr! Wenn Ihnen in China jemand sagt, Sie seien sehr “zwei” (你很二! Nǐ hěn èr!), ist das allerdings alles andere als doppelter Grund zur Freude. In der Umgangs- und Internetsprache beschreibt “zwei” heute seltsame Verhaltensweisen oder eine schräge Optik. Jemand, der “zwei” ist, kommt also “schräg”, “seltsam”, “freaky”, “komisch” oder sogar ein bisschen “bekloppt” rüber.
Die neue Verwendungsweise geht teils auf Dialekteinflüsse zurück, da es in zahlreichen chinesischen Mundarten (方言 fāngyán) unterschiedliche abwertende Begriffe gibt, in denen das Zeichen 二 (èr) auftaucht. Verwandt ist sie aber auch mit einer anderen “geflügelten” Zahl, die Sie sich merken sollten, nämlich “zweihundertfünfzig” (二百五 èrbǎiwǔ) wie in “Er ist eine 250” (他是个二百五 Tā shì ge èrbǎiwǔ.). 250 ist in China ein Synonym für “Idiot, Depp, Trottel”. Wer hätte damit gerechnet.
