es ist ein Paukenschlag der am Mittwoch die Auto-Community aufmischte: Volkswagen hat sich in das chinesische Elektroauto-Startup Xpeng eingekauft. Beide Partner planen gemeinsam die Entwicklung neuer E-Modelle. Es ist bekannt, dass VW und die anderen deutschen Autobauer in Chinas Elektro-Segment hinterherhinken. Nun wollen die Wolfsburger diesen Rückstand offenbar mithilfe ihrer chinesischen Konkurrenten aufholen, wie Felix Lee analysiert. Auch Premium-Tochter Audi soll sich enger mit dem chinesischen Joint Venture-Partner SAIC zusammenschließen.
In unserem Interview geht es um intelligende Sprachmodelle: “In China gibt es bereits mehr als 80 Sprachmodelle von der Größe von ChatGPT”, sagt Hans Uszkoreit im Gespräch mit Frank Sieren. Der 73-Jährige ist einer der führenden europäischen KI-Forscher. Mit seinem Start-up Nyonic will er Deutschland in Sachen KI zur Weltklasse machen. Dabei arbeitet er eng mit einem Team aus Shanghai zusammen. Uszkoreit hat einen starken Bezug zu China: Er war Chief Scientist des Artificial Intelligence Technology Center (AITC) in Beijing. Seine Ehefrau Xu Feiyu ist ebenfalls profilierte KI-Forscherin und war zuletzt KI-Chefin von SAP. Uszkoreit erläutert Europas Chancen im Wettbewerb mit China – und wo die Schwächen und Gefahren von Anwendungen wie ChatGPT liegen.
Unterdessen herrscht im Zusammenhang mit der Ablösung von Außenminister Qin Gang in Peking weiterhin eisiges Schweigen, während Vorgänger-Nachfolger Wang Yi um die Welt reist. Am Mittwoch hatte er seine ersten Treffen in der alt-neuen Rolle als Außenminister in Ankara, mit seinem Amtskollegen sowie Präsident Erdogan. Und wir werden vielleicht nie erfahren, welcher Fehltritt Qin sein Amt gekostet hat.


Dass angesichts mieser Verkaufszahlen im Volkswagen-Konzern etwas im Schwange ist, haben die meisten Automarktexperten geahnt. Und doch dürfte diese Nachricht wie eine Bombe einschlagen. Europas größter Autobauer will mithilfe chinesischer Konkurrenten den Rückstand insbesondere in der Elektromobilität aufholen und auf diese Weise seinen Absturz auf dem weltgrößten PKW-Markt aufhalten.
Dazu arbeitet die Hauptmarke VW mit dem chinesischen E-Autobauer Xpeng ab sofort langfristig zusammen bei Elektromobilität, Software und selbstfahrenden Autos. Unterlegt werde die Allianz durch eine knapp fünfprozentige Beteiligung, für die Volkswagen 700 Millionen Dollar bezahle, teilte der Konzern am Mittwoch im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg mit.
Geplant sind zunächst die gemeinsame Entwicklung zweier Elektro-Modelle für das Mittelklasse-Segment von VW. Sie sollen in der noch relativ neuen Fabrik der Wolfsburger im ostchinesischen Hefei in der Provinz Anhui gebaut werden und 2026 auf den chinesischen Markt kommen. VW baut den Standort Hefei derzeit zu einem neuen Produktions- und Entwicklungszentrum aus.
Damit nicht genug: Zugleich teilte der Konzern mit, dass die Volkswagen-Tochter Audi ein strategisches Abkommen mit dem Joint Venture-Partner SAIC unterzeichnet habe. Kern dieser Zusammenarbeit wird zunächst die Übernahme der Elektroplattform von SAIC für die Audi-Modelle A3 und A4 sein. Bis 2027 wolle Audi mit SAIC eine gemeinsame E-Plattform entwickelt haben.
Das Problem, dass die Ingolstädter derzeit haben: Die E-Autos, die auf dem MEB-Baukasten von Audi aufbauen, sind aus Sicht der chinesischen Kunden zu schlecht vernetzt, sie laden zudem zu langsam und haben auch weniger Leistung als die chinesische Konkurrenz. SAIC soll also in den nächsten Jahren Schützenhilfe leisten, bevor sich Audi mit einer neuen Plattform auf den chinesischen Markt wagt.
Die SAIC-Plattform soll für die Mittelklasse-Modelle ausgelegt sein, während Audi mit dem zweiten Partner FAW Elektro-Fahrzeuge der Oberklasse bauen will. Es wird das erste Mal sein, dass der VW-Konzern das Herzstück eines Elektroautos von chinesischen Partnern bezieht.
Beide Beschlüsse zeigen, wie weit die chinesischen E-Autobauer der deutschen Konkurrenz bereits überlegen sind. Und was noch viel schwerer wiegt: Ohne Hilfe aus der Volksrepublik ist die chinesische Konkurrenz offenbar nicht mehr zu schlagen.
SAIC ist zwar seit Beginn des Volkswagen-Geschäfts in China einer von zwei großen Joint Venture-Partnern. Doch dabei hat der chinesische Autobauer fast vier Jahrzehnte lang zu den Deutschen aufgeschaut und wollte von ihnen lernen. Das Verhältnis hat sich nun erstaunlich schnell umgekehrt.
VW versucht noch, die eigene Schwäche herunterzuspielen. “Wir kaufen keine Technologie ein, sondern entwickeln gemeinsam Fahrzeuge”, beteuert Volkswagen-China-Chef Ralf Brandstätter bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zumindest bis 2027 ist aber genau das geplant: der Einkauf von Technologie. Und ob der Volkswagen-Konzern wirklich mit den chinesischen Partnern künftig Elektroplattformen entwickeln wird, ist noch gar nicht ausgemacht. Die Gespräche laufen noch.
Xpeng ist einer der vielen chinesischen Newcomer im E-Auto-Segment – und nicht einmal der Innovativste. Seit 2014 überhaupt erst auf dem Markt, gehört das private und von mehreren Internet-Konzern unterstützte Unternehmen mit Sitz in Guangzhou zu den eher kleineren Autobauern. Es rangierte laut dem Branchenverband CPCA bei E-Autos im ersten Quartal gerade mal auf Rang zwölf im Land. Das Unternehmen punktet eher durch clevere Marketing-Konzepte als durch Größe.
Mit Abstand an der Spitze steht seit kurzem BYD. Der einstige Batterie-Hersteller hat Volkswagen als Nummer eins am Gesamtmarkt verdrängt, also einschließlich der noch dominierenden Verbrennerautos. VWs starke Position zwei liegt allein an den Verbrennern. In der Elektromobilität fristen VW und Audi ein Nischendasein.
Bei den Batterie-Fahrzeugen gingen die Verkaufszahlen der Wolfsburger in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gar um 1,6 Prozent auf 62.400 Autos zurück. Angepeilt sind für das Gesamtjahr bisher rund 200.000. BYD verkauft zehnmal mehr E-Autos als VW. Und Audi hat in der Volksrepublik bei E-Autos komplett den Anschluss verloren, im ersten Quartal setzten die Ingolstädter gerade einmal gut 3.000 batteriegetriebene Fahrzeuge ab.
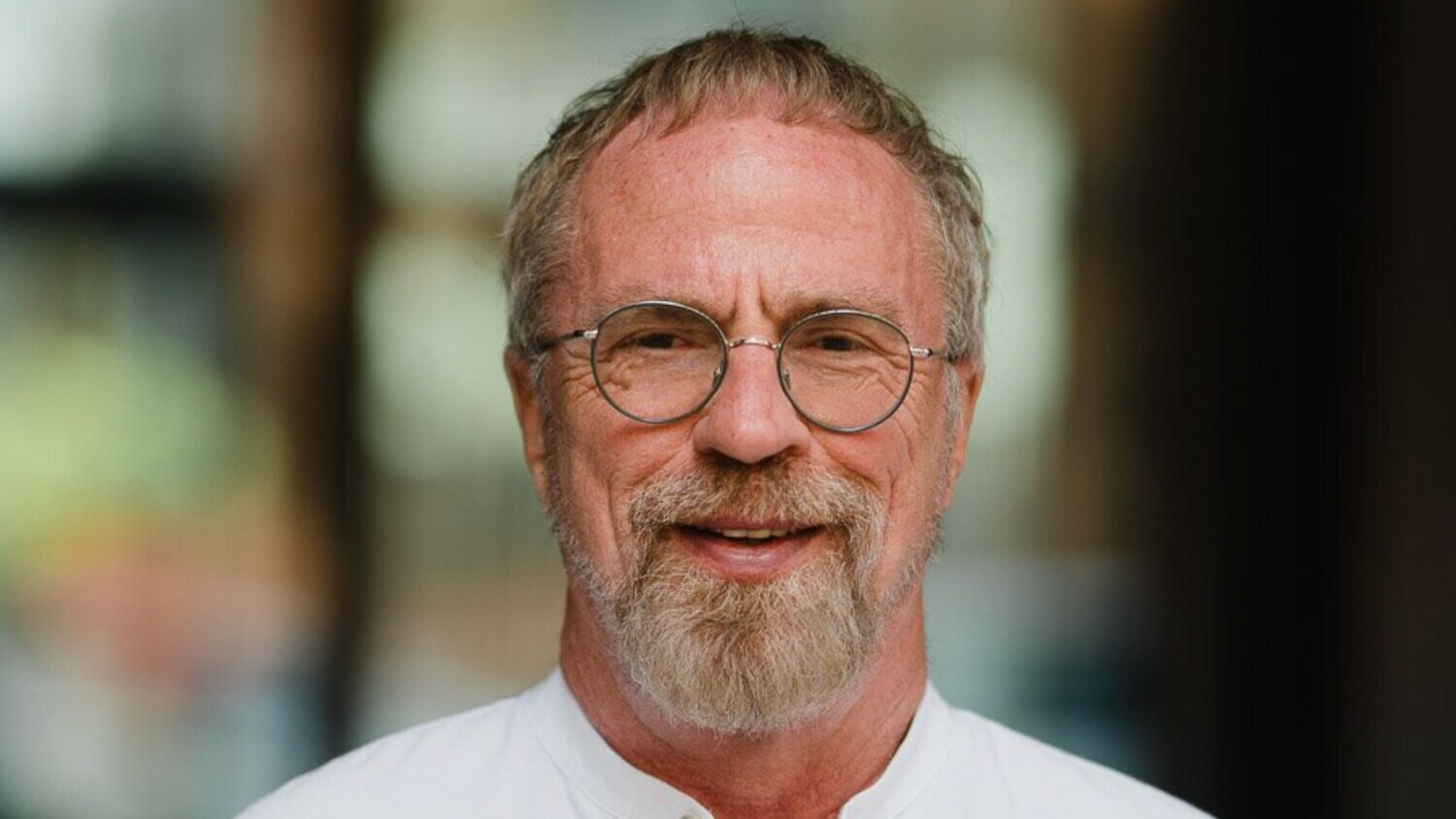
Sie haben gerade ein deutsches ChatGPT-Start-up gegründet, das auch einen Standort in China hat. Worum geht es dabei?
Wir haben das Start-up Nyonic in Berlin gegründet. In Shanghai haben wir ein Forschungsteam. Wir wollen zwei Schwächen von ChatGPT angehen. Die heutigen Sprachmodelle sind zu stark auf das Englische und vielleicht noch auf das Chinesische zentriert. Das wollen wir ändern. Und wir wollen ChatGPT für bestimmte Branchen zu einem verlässlichen Arbeitstool machen, was es heute noch nicht ist.
Was fehlt dazu?
ChatGTP muss mir so genaue und aktuelle Antworten geben, dass es zum Beispiel bei der Autoentwicklung und -herstellung helfen kann. Das gegenwärtige ChatGPT ist noch auf Highschool- oder Bachelor-Niveau. Wir müssen es auf das Niveau von Autoingenieuren bekommen. Die Maschine muss eine technische und geschäftliche Verlässlichkeit bekommen, sonst bleibt sie ein Spielzeug.
Aber warum die verschiedenen Sprachen? Englisch ist doch Weltsprache und Chinesisch auf dem Weg dorthin.
Weil viel europäisches Wissen noch gar nicht in Englisch vorliegt, sondern nur in den jeweiligen europäischen Sprachen. Zudem sollen die KI-Systeme für Anwender in aller Welt den gleichen Nutzen bringen. Die Sprachpluralität ist ein Riesenschritt für ChatGPT und wichtig für eine multipolare Welt. Die Mehrheit der Welt ist multilingual. Die USA können es sich leisten, anglozentrische Technologie zu haben. China kann es sich leisten, China-Technologie zu machen. Aber die Mehrheit der Welt, Südostasien, Afrika und eben Europa sind darauf angewiesen, dass viele Sprachen und Kulturen abgedeckt werden.
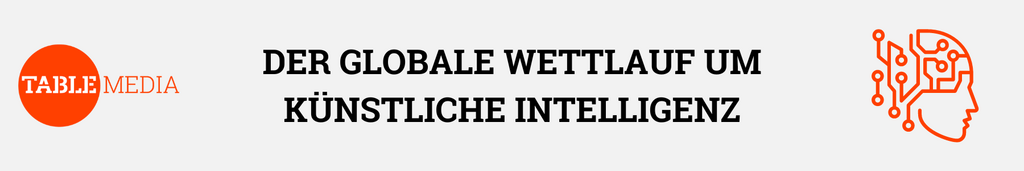
Warum machen Sie sich die Mühe? Sie sind ja mit 73 Jahren doch schon im Pensionsalter. Sie sind und bleiben ein Pionier der europäischen KI. Sie könnten die Füße hochlegen.
Alle in unserem Team, unabhängig vom Alter, wollen natürlich die größte Revolution in der KI zu unseren Lebzeiten mitgestalten. Hinzu kommt unser Wunsch, dass Europa sich diesmal nicht von den USA und China abhängen lässt. Wir haben sehr viele kluge Leute und viele Innovationen kamen aus Europa. Doch dann haben wir es immer wieder vermasselt. In China gibt es bereits mehr als 80 Sprachmodelle von der Größe von ChatGPT. In der EU gerade mal drei. In Deutschland gibt es erst eines, das bis jetzt auch noch nicht zu den besten zählt. Das wollen wir ändern.
Und die Chinesen, die daran mitarbeiten?
Die meisten sind, wie unser CEO Dong Han, zwei- oder mehrsprachig und haben deshalb schon aus biografischen Gründen ein Interesse an vielsprachiger KI. Fast alle chinesischen Modelle sind nur für den Einsatz in China konzipiert. Unsere Experten haben zum Teil in Deutschland oder anderen europäischen Ländern studiert und dort multilinguale Sprachtechnologie kennengelernt. Aber wir haben zum Beispiel auch Top-Ingenieure von Google abgeworben, weil sie unser Projekt mitgestalten wollen.
Das Thema künstliche Intelligenz ist ja nicht neu. Sie beschäftigen sich seit mehr als 30 Jahren damit. Was ist denn neu mit ChatGPT, dass es nun die große Aufregung gibt?
Das System hat nun etwas erreicht, was wir beim Menschen Verständnis nennen. Es ist zwar bei der Maschine anders definiert, denn die Maschine hat nicht unser holistisches Weltbild und passt auch ihr Wissen nicht an Aussagen der Benutzer an. Aber die Wirkung ist die gleiche: Die Maschine benimmt sich in ihren Antworten so, als würde sie die Eingaben tatsächlich verstehen.
Aber das war doch früher schon so.
Ja und nein. Es gab ein System, das konnte Schach spielen, ein anderes kann autonomes Fahren, noch ein anderes kann Bedarfsvorausplanung und Berechnung. Ein anderes kann übersetzen oder Musik schreiben und so weiter. Jedes System muss mit den Daten dieses Bereiches trainiert werden. Es lernt auch an hunderttausenden, manchmal Millionen Beispielen, wie es sich verhalten soll. Das funktioniert ein wenig wie bei einem Hund, dem ich etwas zu essen gebe. Bei dem, was er fressen soll, wird er belohnt. Bei dem, was er nicht fressen soll, gibt es einen Klaps auf die Pfoten. Der Hund hat das irgendwann gelernt, ohne zu wissen, was Fleisch, Kuchen oder Knochen sind …
… hat aber immer nur kleine triviale Aufgaben bewältigt.
Das ist beim bisherigen Machine Learning nicht viel anders. Für die Sprach-KI bedeutet das: Sie hat viele einzelne Fakten, Wörter und Begriffe gelernt. Nun, mit der Transformer-Technologie, auf der die neue KI basiert, ist sie besser in der Lage, Kontexte zu erfassen und aus denen wirkliche Bedeutung zu lernen. Das ist, als ob man in einer dunklen Hütte ohne Fenster aus Tausenden von Büchern und dem Internet lernt, was da draußen los ist. Am Anfang lernt man nur Begriffe wie Sonne, Baum, Blumen oder Auto. Mit der Zeit hat man so viele Informationen, dass man die Welt da draußen immer genauer nachzeichnen kann. Die Sonne geht auf und unter. Es können Wolken davor sein, und die werfen Schatten. Und manche Blumen richten sich nach der Sonne aus. Die Transformer-Technologie hat dann gelernt, sich nun in dieser Welt gewissermaßen zu bewegen, die immer mehr so aussieht wie unsere Welt, die aber nicht unsere Welt ist. Dadurch kann die Maschine inzwischen in dieser Welt Aufgaben lösen, für die sie nie trainiert wurde. Das ist der große Schritt der Transformer-Technologie, auf der ChatGPT basiert, wie der Name schon sagt: Generative Pretrained Transformer.
Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ich kann sagen: Fasse mir einen Text über die Funktionen des Autos so zusammen, dass es ein Zehnjähriger versteht. Die Maschine hat das noch nie gemacht. Aber sie weiß, was Texte zusammenfassen bedeutet und sie hat verstanden, dass Zehnjährige eine andere Sprache sprechen als 40-Jährige. Die Maschine hat schon viele Texte für 10-Jährige verfasst. Sie hat Schritt für Schritt gelernt, wie sie die Sätze bilden, welche Worte sie benutzen soll und welche zu schwierig sind. Also macht sie das so, durch Worte, die Zehnjährige benutzen, um zu beschreiben, wie ein Auto funktioniert.
Das fällt sogar dem Durchschnitts-Erwachsenen schwer.
Ja, obwohl er sofort versteht, was ein Auto ist und die Maschinen sich dem Bild des Autos in vielen kleinen Schritten nur angenähert haben. Das ist das Wunder: Die Maschine bekommt das hin, obwohl sie im Grunde nur stupide Texte gelernt hat. Sie hat Wörter gelernt, dann auch Wortgruppen und ganze Sätzen, dann ganze Textstücke, mit denen wir Menschen sie füttern. Und immer im Kontext, sodass sie nun aus den Wörtern und Wortgruppen völlig neue sinnvolle Texte, auch anspruchsvolle, entwerfen kann.
Das bedeutet, Fortschritte erzielt man inzwischen durch das Training der Sprachmodelle und nicht mehr durch Algorithmen.
Absolut. Die jüngsten Fortschritte kamen durch die Daten und das Training, nicht durch neue Algorithmen. Google und Baidu setzen zum Teil komplexere Algorithmen ein als OpenAI. Das versuche ich der Politik immer wieder zu erklären. Die ermahnen uns ja dauernd: Wir sollen die Algorithmen genauer programmieren, damit sich keine “falsche” Meinung mehr bildet. Das liegt jedoch nicht an den Algorithmen. Die Maschine muss mit der Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit dessen, was sie aus der Fülle der Textdaten gelernt hat, umgehen. Dabei kommt sie mitunter zu anderen Ergebnissen als sich manche wünschen. Und oft sind sie realitätsnäher als das, was sich mancher so wünscht und deswegen die Realität für falsch hält. Es geht nun um die Textmenge, das Mischungsverhältnis und die Art, wie ich das System trainiere, aber nicht mehr um die Algorithmen.
Wo liegen denn noch die Schwächen von ChatGPT?
ChatGPT ist zwar superschlau, hat aber auch erstaunliche Wissenslücken, die es manchmal durch Fantasie ausfüllt. Man kann sich noch nicht voll auf seine Kenntnisse und sein Urteil verlassen.
In der nächsten Version wird das doch sicher behoben?
Das wird Sie überraschen: Es gibt leider noch keine verlässliche Methode, nach der ich die Maschine ausbilden kann, um das zu bekommen, was ich möchte. Das ist alles noch Trial-and-Error. Mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Es gibt kein Curriculum, sondern ich füttere einfach Daten in Riesenschläuche ein und warte was passiert. Wir wissen nicht wirklich, was die Maschine dabei macht. Wenn das Ergebnis kommt, sagen wir: Schön gelernt, aber liebe Maschine, du sollst nicht alles glauben, was du gelesen hast. Und sag nicht alles, was du glaubst. Dann füttern wir gezielt Daten, um das Verhalten der Maschine zu korrigieren oder zu verbessern und schauen wieder, was herauskommt.
Geht das so einfach?
Die Maschine zu trainieren, mit Daten zu füttern, ist verdammt teuer. Das kostet jeweils viele Millionen. Deshalb können wir nicht einfach mal zehn Varianten ausprobieren. Das bedeutet, ich weiß gar nicht, wie gut meine Methode wirklich ist, weil ich nur relativ wenig Vergleiche habe.
Es kann also sein, dass wir die ganze Zeit einen verschlungenen Pfad bergauf gehen, weil wir die Seilbahn nicht finden.
Ja, und dieses Herumstochern ist für jemanden, der nach verlässlichen, immer besseren Methoden sucht, nicht so einfach zu akzeptieren. Das, was wir machen, ist teilweise noch Alchemie. Ich rühre den Zaubertrank zusammen. Der Zaubertrank wirkt. Ich kann dieses Wissen auch weitergeben. Ich weiß aber nicht warum, sondern nur wie er wirkt. Und die Nebenwirkungen kenne ich nur zum Teil. Gleichzeitig reden wir über Maschinen, die eine Anwaltsprüfung bestehen und als zugelassene Anwälte arbeiten könnten.
Was hat sie am meisten überrascht an der gegenwärtigen Entwicklung?
Viele meiner Kollegen und ich waren überzeugt, dass auch das Transformer-Modell schrittweise wie der Mensch lernen muss und sich langsam durch immer mehr und bessere Lerndaten verbessern würde. Wir waren schon verblüfft, als Forscher mit Brute Force mehr als 100 Milliarden Parameter angesetzt und die Maschine mit Hunderten von Milliarden Wörtern gefüttert haben. Das System ist nicht, wie wir befürchtet haben, einfach zusammengebrochen oder hat nur noch Unsinn produziert. Da waren wir alle Baff.
Die Maschine ist vielmehr schon so mächtig, dass sie auch sehr lange Texte in einem Schritt verarbeiten kann. Und auch muss. Das ist ganz anders als beim Menschen, der einen Text inkrementell Wort für Wort und Satz für Satz verarbeitet und in der Mitte eines Satzes bereits oft vorhersagen kann, wie es weitergeht.
Hans Uszkoreit, 73, hat in Deutschland, aber auch lange in den USA und in China gearbeitet – als Universitätsprofessor, Forschungsmanager, Industrieberater und Mitgründer mehrerer Startups. Er gilt als einer der führenden europäischen KI-Forscher. Uszkoreit ist wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Er hat deutsche und internationale Forschungsverbünde initiiert und koordiniert, leitete mehrere der bekanntesten europäischen Projekte. Uszkoreit ist Autor von über 250 internationalen Publikationen. Jüngst hat er das Berliner ChatGPT-ähnliche Startup “nyonic” gegründet – zusammen mit einem Forschungsteam in Shanghai.
Uszkoreit hat einen starken Bezug zu China: Er war Chief Scientist des Artificial Intelligence Technology Center (AITC) in Beijing. Seine Gattin, Xu Feiyu, ist ebenfalls profilierte KI-Forscherin und war zuletzt KI-Chefin von SAP.
Lesen Sie hier den zweiten Teil des Gesprächs. Es geht darin um die Frage, ob eine menschenfeindliche KI gefährlich werden könnte – oder ob die größte Gefahr nicht doch immer noch vom Menschen ausgeht.
Chinas alt-neuer Außenminister Wang Yi ist nur einen Tag nach seiner Wiederernennung bereits auf großer Reise. Nach dem Außenministertreffen der Brics-Staaten in Johannesburg ist er am Mittwoch in die Türkei weitergereist. In Johannesburg rief Wang am Dienstag zu gemeinsamen Anstrengungen zur Bewältigung globaler Sicherheitsherausforderungen. Am Mittwoch dann traf er, nun auch formal wieder in der Rolle des Außenministers, in Ankara mit Recep Tayyip Erdogan zusammen, sowie mit seinem Amtskollegen Hakan Fidan.
Die Türkei sei bereit, die Kommunikation und Koordination mit China in internationalen und regionalen Fragen wie der “Ukraine-Krise” aufrechtzuerhalten, berichtete der Staatssender CGTN nach Wangs Treffen mit Erdogan. Ankara lehne zudem Versuche der Nato ab, ihren Einfluss im Indo-Pazifik auszuweiten, hieß es. Auch sei die Türkei bereit “den hochrangigen Austausch mit China zu intensivieren, die Synergien zwischen der türkischen Mittlerer-Korridor-Initiative und Chinas Belt and Road-Initiative (BRI) zu verstärken und die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Tourismus zu vertiefen.”
Laut Reuters sprachen Wang und Fidan zuvor ebenfalls über die Lage in der Ukraine. In beiden Gesprächen dürfte das Getreideabkommen eine zentrale Rolle eingenommen haben; Ankara ist der zentrale Vermittler des von Russland gerade aufgekündigten Abkommens zum Export ukrainischen Getreides übers Schwarze Meer gewesen. Doch Details gab es dazu zunächst keine.
Unterdessen schweigt Peking weiter zu den Gründen für die Ablösung des bisherigen Außenministers Qin Gang. “Ich habe keine zusätzlichen Informationen”, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Mittwoch auf Nachfragen zu Qin. Man könne alles bei den Staatsmedien nachlesen. Auf der Website des Ministeriums sind bereits alle Hinweise auf die Existenz Qins gelöscht worden. Sein Name war allerdings laut AFP am Mittwoch noch auf anderen Regierungswebsites zu finden. ck

Taiwans Streitkräfte haben erstmals ein Manöver durchgeführt, um Luftangriffe auf den größten internationalen Flughafen des Landes abzuwehren. Die Übung vom Mittwoch ist Teil der jährlichen Han-Kuang-Manöver. Diese jährlichen Militärübungen standen nach einem Bericht der Financial Times zuletzt in der Kritik von Militäranalysten. Sie seien bloße Schau-Demonstrationen und sollen demnach zu authentischeren Tests echter Angriffsszenarien umgebaut werden. Die Übungen am Mittwoch seien ein Schritt zu dieser Transformation, schreibt das Blatt.
Die Übungen sollten sektorübergreifende Koordinations- und Notfallreaktionsfähigkeiten des Militärs unter dem Druck einer chinesischen Invasion testen, berichtete CNN unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Taipeh.
Während der Übung landete eine Formation von Black-Hawk-Hubschraubern auf dem Flughafen Taiwan Taoyuan, etwa 30 km westlich der Hauptstadt Taipeh. Jeder ließ sechs Soldaten mit Maschinengewehren herab, die eine chinesische Invasionstruppe simulierten. Die Black Hawks wurden von einer Gruppe Apache-Kampfhubschrauber eskortiert, die bodengestützte Verteidiger ins Visier nahmen. Nach einem halbstündigen Kampf gewann die Abwehr vor Ort die Oberhand und stellte die Kontrolle wieder her. Feuerwehrleute übten zudem das Löschen simulierter Brände.
In anderen Landesteilen sagte Taiwans Militär einige der mehrtägig angesetzten Han-Kuang-Übungen aufgrund des herannahenden Taifuns Doksuri ab. Erste Ausläufer erreichten Taiwan bereits am Mittwoch. ck
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will bei einer Reise in den Indo-Pazifik einen europäischen Fußabdruck hinterlassen, um chinesischem Einfluss entgegenzuwirken. So wird Macron Medienberichten zufolge am Donnerstag in Papua-Neuguinea erwartet, nach einem Zwischenstopp in der Inselrepublik Vanuatu. Papua-Neuguinea hatte im Mai einen Sicherheitspakt mit den USA unterzeichnet und verhandelt ein ähnliches Abkommen mit Australien. Nach Angaben aus dem Élysée wird Macron dem Land Infrastrukturprojekte anbieten sowie eine Partnerschaft, mit der man Wälder und Mangroven schützen und gleichzeitig Arbeitsplätze in Papua-Neuguinea sichern wolle. Auch wird der Präsident ein französisches Patrouillenschiff in der Gegend besuchen.
Der Élysée betonte zudem vorab, dass die Reise nicht speziell gegen China gerichtet sei. Stattdessen sollten die regionalen Mächte dazu ermutigt werden, ihre Partnerschaften über Peking und Washington hinaus zu diversifizieren. Macron habe die Reise für notwendig gehalten, da es “neue, intensivere Bedrohungen” für die Sicherheit, Institutionen und Umwelt in der Region gäbe, wird ein Mitarbeiter des Präsidenten zitiert.
Macron möchte in der Region generell mehr europäische Präsenz. Frankreich ist einer der wenigen EU-Staaten mit einer konkreten, eigenständigen Indo-Pazifik-Strategie – nicht zuletzt, weil sich mit Neukaledonien französisches Staatsgebiet mitten im Südpazifik befindet. Dorthin war Macron zu Beginn der Woche als erstes gereist. Die Themen dort waren allerdings mehr innenpolitischer Natur: Neukaledonien hat seit 2018 drei Unabhängigkeits-Referenden abgehalten. Die Ungleichheit zwischen den französischen Überseegebieten und dem europäischen Festland prägten daher den Besuch.
Auch die EU hat eine eigene Indo-Pazifik-Strategie vorgelegt. Bei einem Gipfeltreffen zwischen der EU und Außenministern aus der Region gab es zuletzt jedoch etwas Verdruss, da einige der europäischen Ministerien statt der Ressortchefs lieber Vertreter von niedrigerem Rang zu dem Treffen schickten. ari
Fidschis Premierminister Sitiveni Rabuka hat seinen geplanten Besuch in China aufgrund eines Unfalls abgesagt. Er sei beim Blick auf sein Smartphone gestolpert und eine Treppe hinuntergefallen, erklärte er in einem Video auf Twitter. Er veröffentliche das Video, da er erwarte, dass es nach der Bekanntgabe seines Unfalls “viele Spekulationen” geben werde, sagte Rabuka. “Ich bin sicher, dass es später eine weitere Einladung geben wird, und ich hoffe, dass ich dieser Einladung nachkommen kann.”
Es ist nicht das erste Mal, dass Rabuka Peking brüskiert. Im April besuchte Chinas Vize-Außenminister Ma Zhaoxu Fidschi zu Gesprächen mit der Regierung des Pazifikstaats. Rabuka schickte damals seinen Stellvertreter zu dem Treffen mit Ma; die Regierung in Suva teilte mit, Rabuka habe Urlaub, weil er um ein verstorbenes enges Familienmitglied trauere.
China und den USA haben zuletzt ihren Wettbewerb um die Gunst der Länder im strategisch wichtigen Südpazifik verschärft. Zeitweise sah es so aus, als würde der im Januar ernannte neue Premierminister von Fidschi sich dabei Peking annähern. Einen Monat später kündigte er jedoch eine Zusammenarbeit mit China bei der Polizei-Ausbildung wieder auf und begründete dies mit den Worten “Unser System der Demokratie und der Justiz ist anders”. rtr/fpe
Die chinesische Großstadt Chengdu wurde teilweise für Tesla-Fahrzeuge gesperrt, da sich die Stadt auf den Besuch von Präsident Xi Jinping zum Beginn der World University Games am Freitag vorbereitet. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Zudem kursierte laut Bloomberg ein Video in chinesischen sozialen Netzwerken, in dem einem Tesla-Fahrer der Zutritt zu einem Veranstaltungsort in der 21-Millionen-Einwohner-Stadt verweigert wird. In dem Clip, der nicht mehr verfügbar ist, erklärte ein Verkehrspolizist, dass er nur eine offizielle Anordnung für die Spiele befolge. Xi Jinping wird an der Eröffnungszeremonie teilnehmen und unter anderem den indonesischen Präsidenten Joko Widodo empfangen. Während des Events, das bis zum 8. August dauert, gelten in Chengdu noch weitere Verkehrsbeschränkungen, darunter die Sperrung einiger Straßen für zivile Autofahrer.
In den vergangenen Jahren wurden E-Autos der Marke Tesla immer wieder mal der Zutritt zu chinesischen Militärkomplexen und Wohnanlagen verwehrt. Im Sommer 2022 durften Teslas nicht in Beidaihe, einem Badeort östlich der Hauptstadt Peking, verkehren. Dort kommt die Führungselite der Kommunistischen Partei jedes Jahr zu einem Treffen hinter verschlossenen Türen zusammen. Die Verbote wurden damit begründet, dass die in den Fahrzeugen verbauten Kameras sensible Daten sammeln könnten. Tesla-Chef Elon Musk versicherte mehrmals, dass Teslas weder in China noch anderswo spionierten – und dass das Unternehmen geschlossen würde, wenn dies doch der Fall wäre. fpe

An der Hochschule Bremen ist Sandra Heep eine Besonderheit. Sie hat die einzige China-Professur an der Hochschule inne. Seit mehreren Jahren leitet sie den Studiengang “Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung” mit China-Schwerpunkt und zugleich das dortige China-Zentrum. Entsprechend breit ist das Gebiet, das sie abdeckt: Chinas Wirtschaftssystem, seine Rolle in der Weltwirtschaft, Chinas politisches System und seine Außenpolitik.
Unglücklich ist Heep darüber nicht. Denn die breite Aufstellung hilft ihr in der Rolle als Leiterin des China-Zentrums, wo sie Akteure aus Politik und Wirtschaft in China-spezifischen Fragen berät. “Mir kommt es sehr entgegen, auf diese Weise das große Ganze im Blick zu behalten, statt ausschließlich Spezialwissen zu vertiefen.”
Als Studiengangsleiterin steht Heep jedoch vor der großen Herausforderung, die Studierenden zu Experten für ein Land auszubilden, das im Inneren immer repressiver und nach außen immer aggressiver auftritt. “Es ist nicht leicht, junge Menschen trotz der politischen Entwicklungen für ein Studium mit China-Schwerpunkt zu begeistern.” Eine Lösung sieht sie vor allem in der Vermittlung von China-Kompetenz auch außerhalb der Sinologie, beispielsweise in Politik- und Wirtschaftswissenschaften, aber auch durch niedrigschwellige Angebote an Schulen. “In Deutschland gibt es bereits jetzt zu wenige China-Experten, und dieses Problem wird sich im Laufe der nächsten Jahre weiter verschärfen. Wir müssen dringend neue Wege finden, junge Menschen für die Auseinandersetzung mit China und das Erlernen der chinesischen Sprache zu begeistern.”
Den zögerlichen Umgang mit China kennt Heep aus ihrer eigenen Biografie. Die chinesische Sprache hatte sie schon immer fasziniert. Zu Beginn ihres Philosophie-Studiums an der Uni Bonn saß sie deshalb auch in Sinologie-Vorlesungen. Aber nach einigen Wochen ließ sie es bleiben und konzentrierte sich auf ihre Nebenfächer Politikwissenschaften und Psychologie. “Ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, für längere Zeit nach China zu gehen”, erinnert sie sich. Und warum eine Sprache lernen, die sie nicht anwenden würde?
Aber so ganz ging China ihr nicht aus dem Kopf. Mit einem Stipendium ging Heep nach ihrem Grundstudium für ein Jahr an die Universität Nanjing, lernte Chinesisch und bereiste das Land. Zurück in Deutschland schloss sie in Berlin ihr Philosophiestudium ab. In ihrer politikwissenschaftlichen Dissertation beschäftigte sie sich mit der Frage, ob Chinas staatlich gelenktes Finanzsystem mit der Ausübung von Macht im internationalen Finanzsystem vereinbar sei.
Es folgten Stationen als Gastwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin unter anderem am Institute of World Economics and Politics der Chinese Academy of Social Sciences in Peking und eine Position als Leiterin des Programms “Wirtschaftspolitik und Finanzsystem” am Merics-Institut. Vor ihrem Ruf nach Bremen 2018 beriet Heep zwei Jahre lang das Bundesministerium der Finanzen im G20-Projekt zur Kooperation mit China: “Rückblickend einer der wichtigsten Abschnitte in meiner Karriere, weil ich mich mit der Arbeitsweise der Bundesregierung vertraut machen und für die Politikberatung wertvolle Einblicke gewinnen konnte.”
Geprägt durch ihr Philosophiestudium ist Heep begriffliche Klarheit auch in ihrer Forschung zu China ein wichtiges Anliegen. So beschäftigt sie sich aktuell mit der zunehmenden Politisierung des chinesischen Wirtschaftssystems und der Frage, ob dieses System in Anbetracht der zunehmenden Fokussierung der Kommunistischen Partei auf nationale Sicherheit, politische Kontrolle und Ideologie noch als kapitalistisches System verstanden werden kann. Svenja Napp
Alexander Will kehrt nach Peking zurück, um bei VW China den Posten des Senior Director Product Management E-Mobility zu übernehmen. Will hat zehn Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie bei der Volkswagen-Gruppe in Deutschland und China. Zuletzt war er knapp drei Jahre in Wolfsburg als Senior Director Electric & Connected Modules tätig.
Zhou Jiangyon, der frühere Parteichef der Stadt Hangzhou, wurde wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilt. Offiziell erhielt er eine suspendierte Todesstrafe, die in der Regel nicht vollstreckt wird. Zhou soll umgerechnet rund 25 Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern einkassiert haben, unter anderem im Gegenzug für die Vergabe an Landnutzungsrechten und Projektverträge.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Unter strengster Bewachung wird Yuan Meng in einer Transportbox zu seinem Flugzeug eskortiert. Der erste in Frankreich geborene Panda verlässt Paris, wo er im Zoo von Beauval aufgezogen wurde, in Richtung China, der Heimat seiner Eltern. Hunderte Besucher und Zoo-Angestellte wünschten ihm am Charles-de-Gaulle-Flughafen “Bon Voyage” und viel Glück für seine nächste Mission: In Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan wird Yuan Meng nun in ein Fortpflanzungszentrum gebracht, wo er sich für die Erhaltung seiner Art einzusetzen hat.
es ist ein Paukenschlag der am Mittwoch die Auto-Community aufmischte: Volkswagen hat sich in das chinesische Elektroauto-Startup Xpeng eingekauft. Beide Partner planen gemeinsam die Entwicklung neuer E-Modelle. Es ist bekannt, dass VW und die anderen deutschen Autobauer in Chinas Elektro-Segment hinterherhinken. Nun wollen die Wolfsburger diesen Rückstand offenbar mithilfe ihrer chinesischen Konkurrenten aufholen, wie Felix Lee analysiert. Auch Premium-Tochter Audi soll sich enger mit dem chinesischen Joint Venture-Partner SAIC zusammenschließen.
In unserem Interview geht es um intelligende Sprachmodelle: “In China gibt es bereits mehr als 80 Sprachmodelle von der Größe von ChatGPT”, sagt Hans Uszkoreit im Gespräch mit Frank Sieren. Der 73-Jährige ist einer der führenden europäischen KI-Forscher. Mit seinem Start-up Nyonic will er Deutschland in Sachen KI zur Weltklasse machen. Dabei arbeitet er eng mit einem Team aus Shanghai zusammen. Uszkoreit hat einen starken Bezug zu China: Er war Chief Scientist des Artificial Intelligence Technology Center (AITC) in Beijing. Seine Ehefrau Xu Feiyu ist ebenfalls profilierte KI-Forscherin und war zuletzt KI-Chefin von SAP. Uszkoreit erläutert Europas Chancen im Wettbewerb mit China – und wo die Schwächen und Gefahren von Anwendungen wie ChatGPT liegen.
Unterdessen herrscht im Zusammenhang mit der Ablösung von Außenminister Qin Gang in Peking weiterhin eisiges Schweigen, während Vorgänger-Nachfolger Wang Yi um die Welt reist. Am Mittwoch hatte er seine ersten Treffen in der alt-neuen Rolle als Außenminister in Ankara, mit seinem Amtskollegen sowie Präsident Erdogan. Und wir werden vielleicht nie erfahren, welcher Fehltritt Qin sein Amt gekostet hat.


Dass angesichts mieser Verkaufszahlen im Volkswagen-Konzern etwas im Schwange ist, haben die meisten Automarktexperten geahnt. Und doch dürfte diese Nachricht wie eine Bombe einschlagen. Europas größter Autobauer will mithilfe chinesischer Konkurrenten den Rückstand insbesondere in der Elektromobilität aufholen und auf diese Weise seinen Absturz auf dem weltgrößten PKW-Markt aufhalten.
Dazu arbeitet die Hauptmarke VW mit dem chinesischen E-Autobauer Xpeng ab sofort langfristig zusammen bei Elektromobilität, Software und selbstfahrenden Autos. Unterlegt werde die Allianz durch eine knapp fünfprozentige Beteiligung, für die Volkswagen 700 Millionen Dollar bezahle, teilte der Konzern am Mittwoch im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg mit.
Geplant sind zunächst die gemeinsame Entwicklung zweier Elektro-Modelle für das Mittelklasse-Segment von VW. Sie sollen in der noch relativ neuen Fabrik der Wolfsburger im ostchinesischen Hefei in der Provinz Anhui gebaut werden und 2026 auf den chinesischen Markt kommen. VW baut den Standort Hefei derzeit zu einem neuen Produktions- und Entwicklungszentrum aus.
Damit nicht genug: Zugleich teilte der Konzern mit, dass die Volkswagen-Tochter Audi ein strategisches Abkommen mit dem Joint Venture-Partner SAIC unterzeichnet habe. Kern dieser Zusammenarbeit wird zunächst die Übernahme der Elektroplattform von SAIC für die Audi-Modelle A3 und A4 sein. Bis 2027 wolle Audi mit SAIC eine gemeinsame E-Plattform entwickelt haben.
Das Problem, dass die Ingolstädter derzeit haben: Die E-Autos, die auf dem MEB-Baukasten von Audi aufbauen, sind aus Sicht der chinesischen Kunden zu schlecht vernetzt, sie laden zudem zu langsam und haben auch weniger Leistung als die chinesische Konkurrenz. SAIC soll also in den nächsten Jahren Schützenhilfe leisten, bevor sich Audi mit einer neuen Plattform auf den chinesischen Markt wagt.
Die SAIC-Plattform soll für die Mittelklasse-Modelle ausgelegt sein, während Audi mit dem zweiten Partner FAW Elektro-Fahrzeuge der Oberklasse bauen will. Es wird das erste Mal sein, dass der VW-Konzern das Herzstück eines Elektroautos von chinesischen Partnern bezieht.
Beide Beschlüsse zeigen, wie weit die chinesischen E-Autobauer der deutschen Konkurrenz bereits überlegen sind. Und was noch viel schwerer wiegt: Ohne Hilfe aus der Volksrepublik ist die chinesische Konkurrenz offenbar nicht mehr zu schlagen.
SAIC ist zwar seit Beginn des Volkswagen-Geschäfts in China einer von zwei großen Joint Venture-Partnern. Doch dabei hat der chinesische Autobauer fast vier Jahrzehnte lang zu den Deutschen aufgeschaut und wollte von ihnen lernen. Das Verhältnis hat sich nun erstaunlich schnell umgekehrt.
VW versucht noch, die eigene Schwäche herunterzuspielen. “Wir kaufen keine Technologie ein, sondern entwickeln gemeinsam Fahrzeuge”, beteuert Volkswagen-China-Chef Ralf Brandstätter bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zumindest bis 2027 ist aber genau das geplant: der Einkauf von Technologie. Und ob der Volkswagen-Konzern wirklich mit den chinesischen Partnern künftig Elektroplattformen entwickeln wird, ist noch gar nicht ausgemacht. Die Gespräche laufen noch.
Xpeng ist einer der vielen chinesischen Newcomer im E-Auto-Segment – und nicht einmal der Innovativste. Seit 2014 überhaupt erst auf dem Markt, gehört das private und von mehreren Internet-Konzern unterstützte Unternehmen mit Sitz in Guangzhou zu den eher kleineren Autobauern. Es rangierte laut dem Branchenverband CPCA bei E-Autos im ersten Quartal gerade mal auf Rang zwölf im Land. Das Unternehmen punktet eher durch clevere Marketing-Konzepte als durch Größe.
Mit Abstand an der Spitze steht seit kurzem BYD. Der einstige Batterie-Hersteller hat Volkswagen als Nummer eins am Gesamtmarkt verdrängt, also einschließlich der noch dominierenden Verbrennerautos. VWs starke Position zwei liegt allein an den Verbrennern. In der Elektromobilität fristen VW und Audi ein Nischendasein.
Bei den Batterie-Fahrzeugen gingen die Verkaufszahlen der Wolfsburger in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gar um 1,6 Prozent auf 62.400 Autos zurück. Angepeilt sind für das Gesamtjahr bisher rund 200.000. BYD verkauft zehnmal mehr E-Autos als VW. Und Audi hat in der Volksrepublik bei E-Autos komplett den Anschluss verloren, im ersten Quartal setzten die Ingolstädter gerade einmal gut 3.000 batteriegetriebene Fahrzeuge ab.
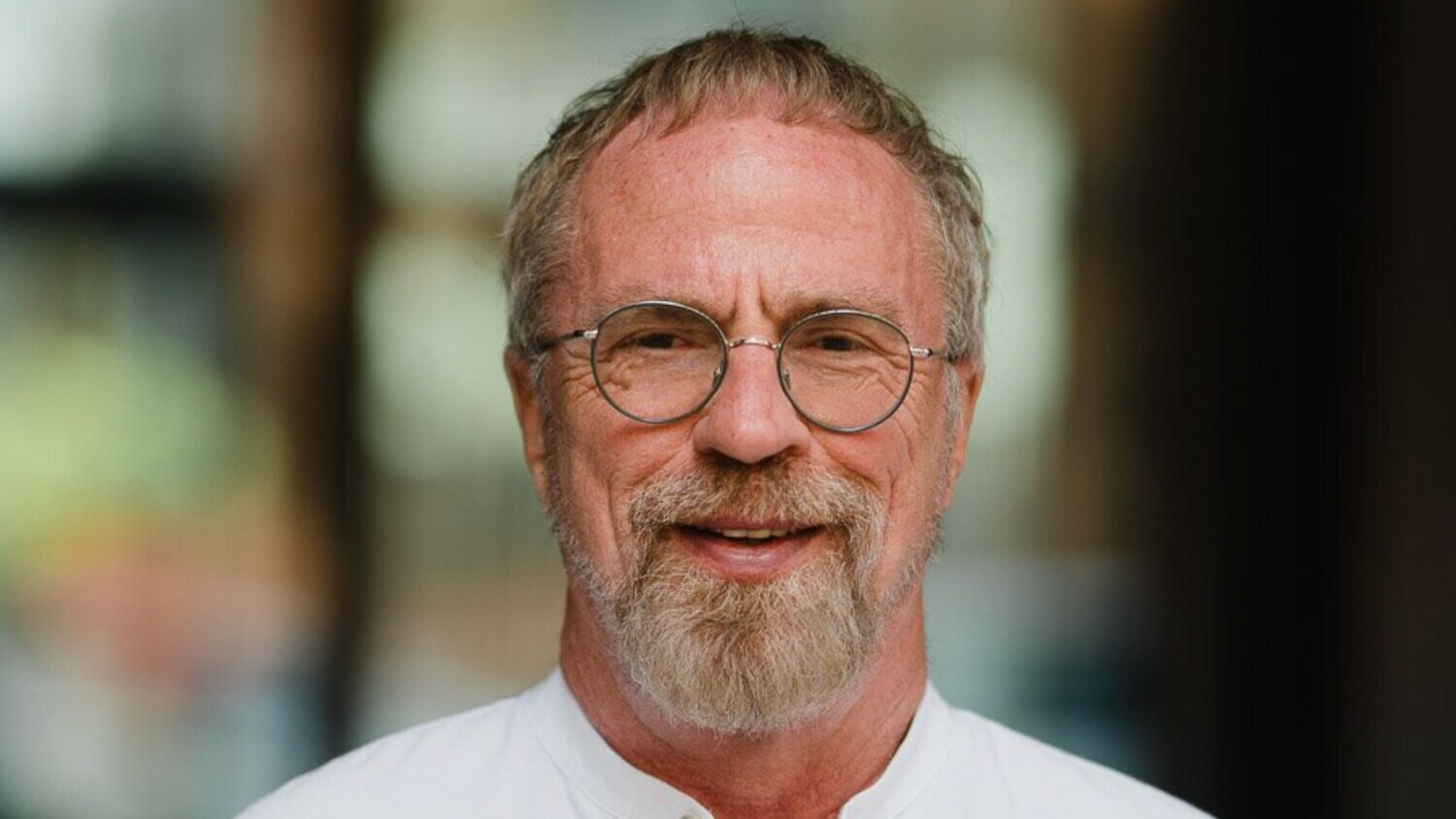
Sie haben gerade ein deutsches ChatGPT-Start-up gegründet, das auch einen Standort in China hat. Worum geht es dabei?
Wir haben das Start-up Nyonic in Berlin gegründet. In Shanghai haben wir ein Forschungsteam. Wir wollen zwei Schwächen von ChatGPT angehen. Die heutigen Sprachmodelle sind zu stark auf das Englische und vielleicht noch auf das Chinesische zentriert. Das wollen wir ändern. Und wir wollen ChatGPT für bestimmte Branchen zu einem verlässlichen Arbeitstool machen, was es heute noch nicht ist.
Was fehlt dazu?
ChatGTP muss mir so genaue und aktuelle Antworten geben, dass es zum Beispiel bei der Autoentwicklung und -herstellung helfen kann. Das gegenwärtige ChatGPT ist noch auf Highschool- oder Bachelor-Niveau. Wir müssen es auf das Niveau von Autoingenieuren bekommen. Die Maschine muss eine technische und geschäftliche Verlässlichkeit bekommen, sonst bleibt sie ein Spielzeug.
Aber warum die verschiedenen Sprachen? Englisch ist doch Weltsprache und Chinesisch auf dem Weg dorthin.
Weil viel europäisches Wissen noch gar nicht in Englisch vorliegt, sondern nur in den jeweiligen europäischen Sprachen. Zudem sollen die KI-Systeme für Anwender in aller Welt den gleichen Nutzen bringen. Die Sprachpluralität ist ein Riesenschritt für ChatGPT und wichtig für eine multipolare Welt. Die Mehrheit der Welt ist multilingual. Die USA können es sich leisten, anglozentrische Technologie zu haben. China kann es sich leisten, China-Technologie zu machen. Aber die Mehrheit der Welt, Südostasien, Afrika und eben Europa sind darauf angewiesen, dass viele Sprachen und Kulturen abgedeckt werden.
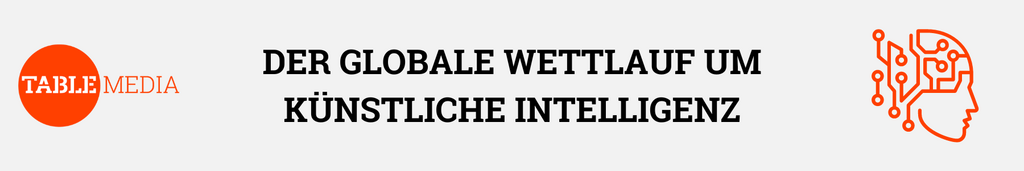
Warum machen Sie sich die Mühe? Sie sind ja mit 73 Jahren doch schon im Pensionsalter. Sie sind und bleiben ein Pionier der europäischen KI. Sie könnten die Füße hochlegen.
Alle in unserem Team, unabhängig vom Alter, wollen natürlich die größte Revolution in der KI zu unseren Lebzeiten mitgestalten. Hinzu kommt unser Wunsch, dass Europa sich diesmal nicht von den USA und China abhängen lässt. Wir haben sehr viele kluge Leute und viele Innovationen kamen aus Europa. Doch dann haben wir es immer wieder vermasselt. In China gibt es bereits mehr als 80 Sprachmodelle von der Größe von ChatGPT. In der EU gerade mal drei. In Deutschland gibt es erst eines, das bis jetzt auch noch nicht zu den besten zählt. Das wollen wir ändern.
Und die Chinesen, die daran mitarbeiten?
Die meisten sind, wie unser CEO Dong Han, zwei- oder mehrsprachig und haben deshalb schon aus biografischen Gründen ein Interesse an vielsprachiger KI. Fast alle chinesischen Modelle sind nur für den Einsatz in China konzipiert. Unsere Experten haben zum Teil in Deutschland oder anderen europäischen Ländern studiert und dort multilinguale Sprachtechnologie kennengelernt. Aber wir haben zum Beispiel auch Top-Ingenieure von Google abgeworben, weil sie unser Projekt mitgestalten wollen.
Das Thema künstliche Intelligenz ist ja nicht neu. Sie beschäftigen sich seit mehr als 30 Jahren damit. Was ist denn neu mit ChatGPT, dass es nun die große Aufregung gibt?
Das System hat nun etwas erreicht, was wir beim Menschen Verständnis nennen. Es ist zwar bei der Maschine anders definiert, denn die Maschine hat nicht unser holistisches Weltbild und passt auch ihr Wissen nicht an Aussagen der Benutzer an. Aber die Wirkung ist die gleiche: Die Maschine benimmt sich in ihren Antworten so, als würde sie die Eingaben tatsächlich verstehen.
Aber das war doch früher schon so.
Ja und nein. Es gab ein System, das konnte Schach spielen, ein anderes kann autonomes Fahren, noch ein anderes kann Bedarfsvorausplanung und Berechnung. Ein anderes kann übersetzen oder Musik schreiben und so weiter. Jedes System muss mit den Daten dieses Bereiches trainiert werden. Es lernt auch an hunderttausenden, manchmal Millionen Beispielen, wie es sich verhalten soll. Das funktioniert ein wenig wie bei einem Hund, dem ich etwas zu essen gebe. Bei dem, was er fressen soll, wird er belohnt. Bei dem, was er nicht fressen soll, gibt es einen Klaps auf die Pfoten. Der Hund hat das irgendwann gelernt, ohne zu wissen, was Fleisch, Kuchen oder Knochen sind …
… hat aber immer nur kleine triviale Aufgaben bewältigt.
Das ist beim bisherigen Machine Learning nicht viel anders. Für die Sprach-KI bedeutet das: Sie hat viele einzelne Fakten, Wörter und Begriffe gelernt. Nun, mit der Transformer-Technologie, auf der die neue KI basiert, ist sie besser in der Lage, Kontexte zu erfassen und aus denen wirkliche Bedeutung zu lernen. Das ist, als ob man in einer dunklen Hütte ohne Fenster aus Tausenden von Büchern und dem Internet lernt, was da draußen los ist. Am Anfang lernt man nur Begriffe wie Sonne, Baum, Blumen oder Auto. Mit der Zeit hat man so viele Informationen, dass man die Welt da draußen immer genauer nachzeichnen kann. Die Sonne geht auf und unter. Es können Wolken davor sein, und die werfen Schatten. Und manche Blumen richten sich nach der Sonne aus. Die Transformer-Technologie hat dann gelernt, sich nun in dieser Welt gewissermaßen zu bewegen, die immer mehr so aussieht wie unsere Welt, die aber nicht unsere Welt ist. Dadurch kann die Maschine inzwischen in dieser Welt Aufgaben lösen, für die sie nie trainiert wurde. Das ist der große Schritt der Transformer-Technologie, auf der ChatGPT basiert, wie der Name schon sagt: Generative Pretrained Transformer.
Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ich kann sagen: Fasse mir einen Text über die Funktionen des Autos so zusammen, dass es ein Zehnjähriger versteht. Die Maschine hat das noch nie gemacht. Aber sie weiß, was Texte zusammenfassen bedeutet und sie hat verstanden, dass Zehnjährige eine andere Sprache sprechen als 40-Jährige. Die Maschine hat schon viele Texte für 10-Jährige verfasst. Sie hat Schritt für Schritt gelernt, wie sie die Sätze bilden, welche Worte sie benutzen soll und welche zu schwierig sind. Also macht sie das so, durch Worte, die Zehnjährige benutzen, um zu beschreiben, wie ein Auto funktioniert.
Das fällt sogar dem Durchschnitts-Erwachsenen schwer.
Ja, obwohl er sofort versteht, was ein Auto ist und die Maschinen sich dem Bild des Autos in vielen kleinen Schritten nur angenähert haben. Das ist das Wunder: Die Maschine bekommt das hin, obwohl sie im Grunde nur stupide Texte gelernt hat. Sie hat Wörter gelernt, dann auch Wortgruppen und ganze Sätzen, dann ganze Textstücke, mit denen wir Menschen sie füttern. Und immer im Kontext, sodass sie nun aus den Wörtern und Wortgruppen völlig neue sinnvolle Texte, auch anspruchsvolle, entwerfen kann.
Das bedeutet, Fortschritte erzielt man inzwischen durch das Training der Sprachmodelle und nicht mehr durch Algorithmen.
Absolut. Die jüngsten Fortschritte kamen durch die Daten und das Training, nicht durch neue Algorithmen. Google und Baidu setzen zum Teil komplexere Algorithmen ein als OpenAI. Das versuche ich der Politik immer wieder zu erklären. Die ermahnen uns ja dauernd: Wir sollen die Algorithmen genauer programmieren, damit sich keine “falsche” Meinung mehr bildet. Das liegt jedoch nicht an den Algorithmen. Die Maschine muss mit der Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit dessen, was sie aus der Fülle der Textdaten gelernt hat, umgehen. Dabei kommt sie mitunter zu anderen Ergebnissen als sich manche wünschen. Und oft sind sie realitätsnäher als das, was sich mancher so wünscht und deswegen die Realität für falsch hält. Es geht nun um die Textmenge, das Mischungsverhältnis und die Art, wie ich das System trainiere, aber nicht mehr um die Algorithmen.
Wo liegen denn noch die Schwächen von ChatGPT?
ChatGPT ist zwar superschlau, hat aber auch erstaunliche Wissenslücken, die es manchmal durch Fantasie ausfüllt. Man kann sich noch nicht voll auf seine Kenntnisse und sein Urteil verlassen.
In der nächsten Version wird das doch sicher behoben?
Das wird Sie überraschen: Es gibt leider noch keine verlässliche Methode, nach der ich die Maschine ausbilden kann, um das zu bekommen, was ich möchte. Das ist alles noch Trial-and-Error. Mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Es gibt kein Curriculum, sondern ich füttere einfach Daten in Riesenschläuche ein und warte was passiert. Wir wissen nicht wirklich, was die Maschine dabei macht. Wenn das Ergebnis kommt, sagen wir: Schön gelernt, aber liebe Maschine, du sollst nicht alles glauben, was du gelesen hast. Und sag nicht alles, was du glaubst. Dann füttern wir gezielt Daten, um das Verhalten der Maschine zu korrigieren oder zu verbessern und schauen wieder, was herauskommt.
Geht das so einfach?
Die Maschine zu trainieren, mit Daten zu füttern, ist verdammt teuer. Das kostet jeweils viele Millionen. Deshalb können wir nicht einfach mal zehn Varianten ausprobieren. Das bedeutet, ich weiß gar nicht, wie gut meine Methode wirklich ist, weil ich nur relativ wenig Vergleiche habe.
Es kann also sein, dass wir die ganze Zeit einen verschlungenen Pfad bergauf gehen, weil wir die Seilbahn nicht finden.
Ja, und dieses Herumstochern ist für jemanden, der nach verlässlichen, immer besseren Methoden sucht, nicht so einfach zu akzeptieren. Das, was wir machen, ist teilweise noch Alchemie. Ich rühre den Zaubertrank zusammen. Der Zaubertrank wirkt. Ich kann dieses Wissen auch weitergeben. Ich weiß aber nicht warum, sondern nur wie er wirkt. Und die Nebenwirkungen kenne ich nur zum Teil. Gleichzeitig reden wir über Maschinen, die eine Anwaltsprüfung bestehen und als zugelassene Anwälte arbeiten könnten.
Was hat sie am meisten überrascht an der gegenwärtigen Entwicklung?
Viele meiner Kollegen und ich waren überzeugt, dass auch das Transformer-Modell schrittweise wie der Mensch lernen muss und sich langsam durch immer mehr und bessere Lerndaten verbessern würde. Wir waren schon verblüfft, als Forscher mit Brute Force mehr als 100 Milliarden Parameter angesetzt und die Maschine mit Hunderten von Milliarden Wörtern gefüttert haben. Das System ist nicht, wie wir befürchtet haben, einfach zusammengebrochen oder hat nur noch Unsinn produziert. Da waren wir alle Baff.
Die Maschine ist vielmehr schon so mächtig, dass sie auch sehr lange Texte in einem Schritt verarbeiten kann. Und auch muss. Das ist ganz anders als beim Menschen, der einen Text inkrementell Wort für Wort und Satz für Satz verarbeitet und in der Mitte eines Satzes bereits oft vorhersagen kann, wie es weitergeht.
Hans Uszkoreit, 73, hat in Deutschland, aber auch lange in den USA und in China gearbeitet – als Universitätsprofessor, Forschungsmanager, Industrieberater und Mitgründer mehrerer Startups. Er gilt als einer der führenden europäischen KI-Forscher. Uszkoreit ist wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Er hat deutsche und internationale Forschungsverbünde initiiert und koordiniert, leitete mehrere der bekanntesten europäischen Projekte. Uszkoreit ist Autor von über 250 internationalen Publikationen. Jüngst hat er das Berliner ChatGPT-ähnliche Startup “nyonic” gegründet – zusammen mit einem Forschungsteam in Shanghai.
Uszkoreit hat einen starken Bezug zu China: Er war Chief Scientist des Artificial Intelligence Technology Center (AITC) in Beijing. Seine Gattin, Xu Feiyu, ist ebenfalls profilierte KI-Forscherin und war zuletzt KI-Chefin von SAP.
Lesen Sie hier den zweiten Teil des Gesprächs. Es geht darin um die Frage, ob eine menschenfeindliche KI gefährlich werden könnte – oder ob die größte Gefahr nicht doch immer noch vom Menschen ausgeht.
Chinas alt-neuer Außenminister Wang Yi ist nur einen Tag nach seiner Wiederernennung bereits auf großer Reise. Nach dem Außenministertreffen der Brics-Staaten in Johannesburg ist er am Mittwoch in die Türkei weitergereist. In Johannesburg rief Wang am Dienstag zu gemeinsamen Anstrengungen zur Bewältigung globaler Sicherheitsherausforderungen. Am Mittwoch dann traf er, nun auch formal wieder in der Rolle des Außenministers, in Ankara mit Recep Tayyip Erdogan zusammen, sowie mit seinem Amtskollegen Hakan Fidan.
Die Türkei sei bereit, die Kommunikation und Koordination mit China in internationalen und regionalen Fragen wie der “Ukraine-Krise” aufrechtzuerhalten, berichtete der Staatssender CGTN nach Wangs Treffen mit Erdogan. Ankara lehne zudem Versuche der Nato ab, ihren Einfluss im Indo-Pazifik auszuweiten, hieß es. Auch sei die Türkei bereit “den hochrangigen Austausch mit China zu intensivieren, die Synergien zwischen der türkischen Mittlerer-Korridor-Initiative und Chinas Belt and Road-Initiative (BRI) zu verstärken und die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Tourismus zu vertiefen.”
Laut Reuters sprachen Wang und Fidan zuvor ebenfalls über die Lage in der Ukraine. In beiden Gesprächen dürfte das Getreideabkommen eine zentrale Rolle eingenommen haben; Ankara ist der zentrale Vermittler des von Russland gerade aufgekündigten Abkommens zum Export ukrainischen Getreides übers Schwarze Meer gewesen. Doch Details gab es dazu zunächst keine.
Unterdessen schweigt Peking weiter zu den Gründen für die Ablösung des bisherigen Außenministers Qin Gang. “Ich habe keine zusätzlichen Informationen”, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Mittwoch auf Nachfragen zu Qin. Man könne alles bei den Staatsmedien nachlesen. Auf der Website des Ministeriums sind bereits alle Hinweise auf die Existenz Qins gelöscht worden. Sein Name war allerdings laut AFP am Mittwoch noch auf anderen Regierungswebsites zu finden. ck

Taiwans Streitkräfte haben erstmals ein Manöver durchgeführt, um Luftangriffe auf den größten internationalen Flughafen des Landes abzuwehren. Die Übung vom Mittwoch ist Teil der jährlichen Han-Kuang-Manöver. Diese jährlichen Militärübungen standen nach einem Bericht der Financial Times zuletzt in der Kritik von Militäranalysten. Sie seien bloße Schau-Demonstrationen und sollen demnach zu authentischeren Tests echter Angriffsszenarien umgebaut werden. Die Übungen am Mittwoch seien ein Schritt zu dieser Transformation, schreibt das Blatt.
Die Übungen sollten sektorübergreifende Koordinations- und Notfallreaktionsfähigkeiten des Militärs unter dem Druck einer chinesischen Invasion testen, berichtete CNN unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Taipeh.
Während der Übung landete eine Formation von Black-Hawk-Hubschraubern auf dem Flughafen Taiwan Taoyuan, etwa 30 km westlich der Hauptstadt Taipeh. Jeder ließ sechs Soldaten mit Maschinengewehren herab, die eine chinesische Invasionstruppe simulierten. Die Black Hawks wurden von einer Gruppe Apache-Kampfhubschrauber eskortiert, die bodengestützte Verteidiger ins Visier nahmen. Nach einem halbstündigen Kampf gewann die Abwehr vor Ort die Oberhand und stellte die Kontrolle wieder her. Feuerwehrleute übten zudem das Löschen simulierter Brände.
In anderen Landesteilen sagte Taiwans Militär einige der mehrtägig angesetzten Han-Kuang-Übungen aufgrund des herannahenden Taifuns Doksuri ab. Erste Ausläufer erreichten Taiwan bereits am Mittwoch. ck
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will bei einer Reise in den Indo-Pazifik einen europäischen Fußabdruck hinterlassen, um chinesischem Einfluss entgegenzuwirken. So wird Macron Medienberichten zufolge am Donnerstag in Papua-Neuguinea erwartet, nach einem Zwischenstopp in der Inselrepublik Vanuatu. Papua-Neuguinea hatte im Mai einen Sicherheitspakt mit den USA unterzeichnet und verhandelt ein ähnliches Abkommen mit Australien. Nach Angaben aus dem Élysée wird Macron dem Land Infrastrukturprojekte anbieten sowie eine Partnerschaft, mit der man Wälder und Mangroven schützen und gleichzeitig Arbeitsplätze in Papua-Neuguinea sichern wolle. Auch wird der Präsident ein französisches Patrouillenschiff in der Gegend besuchen.
Der Élysée betonte zudem vorab, dass die Reise nicht speziell gegen China gerichtet sei. Stattdessen sollten die regionalen Mächte dazu ermutigt werden, ihre Partnerschaften über Peking und Washington hinaus zu diversifizieren. Macron habe die Reise für notwendig gehalten, da es “neue, intensivere Bedrohungen” für die Sicherheit, Institutionen und Umwelt in der Region gäbe, wird ein Mitarbeiter des Präsidenten zitiert.
Macron möchte in der Region generell mehr europäische Präsenz. Frankreich ist einer der wenigen EU-Staaten mit einer konkreten, eigenständigen Indo-Pazifik-Strategie – nicht zuletzt, weil sich mit Neukaledonien französisches Staatsgebiet mitten im Südpazifik befindet. Dorthin war Macron zu Beginn der Woche als erstes gereist. Die Themen dort waren allerdings mehr innenpolitischer Natur: Neukaledonien hat seit 2018 drei Unabhängigkeits-Referenden abgehalten. Die Ungleichheit zwischen den französischen Überseegebieten und dem europäischen Festland prägten daher den Besuch.
Auch die EU hat eine eigene Indo-Pazifik-Strategie vorgelegt. Bei einem Gipfeltreffen zwischen der EU und Außenministern aus der Region gab es zuletzt jedoch etwas Verdruss, da einige der europäischen Ministerien statt der Ressortchefs lieber Vertreter von niedrigerem Rang zu dem Treffen schickten. ari
Fidschis Premierminister Sitiveni Rabuka hat seinen geplanten Besuch in China aufgrund eines Unfalls abgesagt. Er sei beim Blick auf sein Smartphone gestolpert und eine Treppe hinuntergefallen, erklärte er in einem Video auf Twitter. Er veröffentliche das Video, da er erwarte, dass es nach der Bekanntgabe seines Unfalls “viele Spekulationen” geben werde, sagte Rabuka. “Ich bin sicher, dass es später eine weitere Einladung geben wird, und ich hoffe, dass ich dieser Einladung nachkommen kann.”
Es ist nicht das erste Mal, dass Rabuka Peking brüskiert. Im April besuchte Chinas Vize-Außenminister Ma Zhaoxu Fidschi zu Gesprächen mit der Regierung des Pazifikstaats. Rabuka schickte damals seinen Stellvertreter zu dem Treffen mit Ma; die Regierung in Suva teilte mit, Rabuka habe Urlaub, weil er um ein verstorbenes enges Familienmitglied trauere.
China und den USA haben zuletzt ihren Wettbewerb um die Gunst der Länder im strategisch wichtigen Südpazifik verschärft. Zeitweise sah es so aus, als würde der im Januar ernannte neue Premierminister von Fidschi sich dabei Peking annähern. Einen Monat später kündigte er jedoch eine Zusammenarbeit mit China bei der Polizei-Ausbildung wieder auf und begründete dies mit den Worten “Unser System der Demokratie und der Justiz ist anders”. rtr/fpe
Die chinesische Großstadt Chengdu wurde teilweise für Tesla-Fahrzeuge gesperrt, da sich die Stadt auf den Besuch von Präsident Xi Jinping zum Beginn der World University Games am Freitag vorbereitet. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Zudem kursierte laut Bloomberg ein Video in chinesischen sozialen Netzwerken, in dem einem Tesla-Fahrer der Zutritt zu einem Veranstaltungsort in der 21-Millionen-Einwohner-Stadt verweigert wird. In dem Clip, der nicht mehr verfügbar ist, erklärte ein Verkehrspolizist, dass er nur eine offizielle Anordnung für die Spiele befolge. Xi Jinping wird an der Eröffnungszeremonie teilnehmen und unter anderem den indonesischen Präsidenten Joko Widodo empfangen. Während des Events, das bis zum 8. August dauert, gelten in Chengdu noch weitere Verkehrsbeschränkungen, darunter die Sperrung einiger Straßen für zivile Autofahrer.
In den vergangenen Jahren wurden E-Autos der Marke Tesla immer wieder mal der Zutritt zu chinesischen Militärkomplexen und Wohnanlagen verwehrt. Im Sommer 2022 durften Teslas nicht in Beidaihe, einem Badeort östlich der Hauptstadt Peking, verkehren. Dort kommt die Führungselite der Kommunistischen Partei jedes Jahr zu einem Treffen hinter verschlossenen Türen zusammen. Die Verbote wurden damit begründet, dass die in den Fahrzeugen verbauten Kameras sensible Daten sammeln könnten. Tesla-Chef Elon Musk versicherte mehrmals, dass Teslas weder in China noch anderswo spionierten – und dass das Unternehmen geschlossen würde, wenn dies doch der Fall wäre. fpe

An der Hochschule Bremen ist Sandra Heep eine Besonderheit. Sie hat die einzige China-Professur an der Hochschule inne. Seit mehreren Jahren leitet sie den Studiengang “Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung” mit China-Schwerpunkt und zugleich das dortige China-Zentrum. Entsprechend breit ist das Gebiet, das sie abdeckt: Chinas Wirtschaftssystem, seine Rolle in der Weltwirtschaft, Chinas politisches System und seine Außenpolitik.
Unglücklich ist Heep darüber nicht. Denn die breite Aufstellung hilft ihr in der Rolle als Leiterin des China-Zentrums, wo sie Akteure aus Politik und Wirtschaft in China-spezifischen Fragen berät. “Mir kommt es sehr entgegen, auf diese Weise das große Ganze im Blick zu behalten, statt ausschließlich Spezialwissen zu vertiefen.”
Als Studiengangsleiterin steht Heep jedoch vor der großen Herausforderung, die Studierenden zu Experten für ein Land auszubilden, das im Inneren immer repressiver und nach außen immer aggressiver auftritt. “Es ist nicht leicht, junge Menschen trotz der politischen Entwicklungen für ein Studium mit China-Schwerpunkt zu begeistern.” Eine Lösung sieht sie vor allem in der Vermittlung von China-Kompetenz auch außerhalb der Sinologie, beispielsweise in Politik- und Wirtschaftswissenschaften, aber auch durch niedrigschwellige Angebote an Schulen. “In Deutschland gibt es bereits jetzt zu wenige China-Experten, und dieses Problem wird sich im Laufe der nächsten Jahre weiter verschärfen. Wir müssen dringend neue Wege finden, junge Menschen für die Auseinandersetzung mit China und das Erlernen der chinesischen Sprache zu begeistern.”
Den zögerlichen Umgang mit China kennt Heep aus ihrer eigenen Biografie. Die chinesische Sprache hatte sie schon immer fasziniert. Zu Beginn ihres Philosophie-Studiums an der Uni Bonn saß sie deshalb auch in Sinologie-Vorlesungen. Aber nach einigen Wochen ließ sie es bleiben und konzentrierte sich auf ihre Nebenfächer Politikwissenschaften und Psychologie. “Ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, für längere Zeit nach China zu gehen”, erinnert sie sich. Und warum eine Sprache lernen, die sie nicht anwenden würde?
Aber so ganz ging China ihr nicht aus dem Kopf. Mit einem Stipendium ging Heep nach ihrem Grundstudium für ein Jahr an die Universität Nanjing, lernte Chinesisch und bereiste das Land. Zurück in Deutschland schloss sie in Berlin ihr Philosophiestudium ab. In ihrer politikwissenschaftlichen Dissertation beschäftigte sie sich mit der Frage, ob Chinas staatlich gelenktes Finanzsystem mit der Ausübung von Macht im internationalen Finanzsystem vereinbar sei.
Es folgten Stationen als Gastwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin unter anderem am Institute of World Economics and Politics der Chinese Academy of Social Sciences in Peking und eine Position als Leiterin des Programms “Wirtschaftspolitik und Finanzsystem” am Merics-Institut. Vor ihrem Ruf nach Bremen 2018 beriet Heep zwei Jahre lang das Bundesministerium der Finanzen im G20-Projekt zur Kooperation mit China: “Rückblickend einer der wichtigsten Abschnitte in meiner Karriere, weil ich mich mit der Arbeitsweise der Bundesregierung vertraut machen und für die Politikberatung wertvolle Einblicke gewinnen konnte.”
Geprägt durch ihr Philosophiestudium ist Heep begriffliche Klarheit auch in ihrer Forschung zu China ein wichtiges Anliegen. So beschäftigt sie sich aktuell mit der zunehmenden Politisierung des chinesischen Wirtschaftssystems und der Frage, ob dieses System in Anbetracht der zunehmenden Fokussierung der Kommunistischen Partei auf nationale Sicherheit, politische Kontrolle und Ideologie noch als kapitalistisches System verstanden werden kann. Svenja Napp
Alexander Will kehrt nach Peking zurück, um bei VW China den Posten des Senior Director Product Management E-Mobility zu übernehmen. Will hat zehn Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie bei der Volkswagen-Gruppe in Deutschland und China. Zuletzt war er knapp drei Jahre in Wolfsburg als Senior Director Electric & Connected Modules tätig.
Zhou Jiangyon, der frühere Parteichef der Stadt Hangzhou, wurde wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilt. Offiziell erhielt er eine suspendierte Todesstrafe, die in der Regel nicht vollstreckt wird. Zhou soll umgerechnet rund 25 Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern einkassiert haben, unter anderem im Gegenzug für die Vergabe an Landnutzungsrechten und Projektverträge.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Unter strengster Bewachung wird Yuan Meng in einer Transportbox zu seinem Flugzeug eskortiert. Der erste in Frankreich geborene Panda verlässt Paris, wo er im Zoo von Beauval aufgezogen wurde, in Richtung China, der Heimat seiner Eltern. Hunderte Besucher und Zoo-Angestellte wünschten ihm am Charles-de-Gaulle-Flughafen “Bon Voyage” und viel Glück für seine nächste Mission: In Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan wird Yuan Meng nun in ein Fortpflanzungszentrum gebracht, wo er sich für die Erhaltung seiner Art einzusetzen hat.
