lange musste Siemens in China auf den ersten Chef aus der Volksrepublik warten. Mit Xiao Song übernimmt dort nun ein allseits gelobter Manager mit viel internationaler Erfahrung das Steuer. Es ist erfreulich und richtig, dass die Epoche ausländischer Chef:innen über Organisationen, die heute fast nur noch aus Chinesen bestehen, zu Ende geht. Doch in einer Zeit des ausufernden staatlichen Einflusses kann das für die betreffenden Manager auch zu Loyalitätskonflikten führen, schreibt Marcel Grzanna.
Was ist “nachhaltig”? Darüber sind sich China und Europa mitnichten einig. Die einen finden saubere Kohlekraftwerke bereits umweltfreundlich, für die anderen müsste es schon Windenergie sein. Dabei hat die Frage der offiziellen Definition von Nachhaltigkeit harte wirtschaftliche Auswirkungen. Denn nur Geldanlagen und Projekte mit dem passenden Gütesiegel erhalten Finanzierungen aus Töpfen für nachhaltige Investitionen. Den Streit um die Einordnung der Nachhaltigkeit beschreibt Nico Beckert.
Das Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung ist eine gute Woche alt. Unser Autor Frank Sieren schaut sich an, wie sich das Verhalten der Verbraucher und Restaurants seitdem bereits verändert hat. In China gilt dabei noch mehr als anderswo: Volle oder leere Teller sind eine brisante Frage. Wenn sich das Land zu große Verschwendung angewöhnt, muss es umso mehr importieren. Doch Xi Jinping gibt vor: China soll vom Ausland möglichst unabhängig sein. In Deutschland haben wir übrigens gut reden – die EU stellt weit mehr Lebensmittel her, als sie braucht.

Grüne Finanzinvestitionen sind eines der zentralen Zukunftsthemen. Für den Umbau der Wirtschaft weg von fossilen und hin zu klimaverträglichen Produktions- und Konsummustern sind Milliarden-Investitionen nötig. Auch Peking hat das erkannt: Um mehr Finanzmittel internationaler Investoren anzulocken, will die Zentralbank die Standards für grüne Geldanlagen und Projekte zwischen der EU und China angleichen. Sie hat wiederholt angekündigt, “gemeinsame Standards” einzuführen. Diese sollen definieren, was genau als grüne Investition gilt. Diese Standards werden in sogenannten Taxonomien festgehalten.
Seit Oktober 2020 tagt eine gemeinsame Taxonomie-Arbeitsgruppe, die bis zum Herbst 2021 “die Gemeinsamkeiten der schon bestehenden Taxonomien” herausarbeiten soll. Den Vorsitz haben die EU und China. Das Ergebnis soll eine Richtschnur für die Mitglieder der International Platform on Sustainable Finance (IPSF) werden. In der IPSF haben sich Behörden, die für die Entwicklung einer ökologisch nachhaltigen Finanzpolitik zuständig sind, aus 17 Ländern und Regionen zusammengeschlossen. Die EU ist als Staatenbund beteiligt. Weitere Mitglieder sind China, Japan, Indien, Großbritannien und Kanada. Die USA nehmen nicht teil.
Die IPSF ist ein Austauschforum und hat keine gesetzgeberischen Kompetenzen. Die Arbeit der Taxonomie-AG wird als Grundlage gesehen, auf der ein “gemeinsames Klassifizierungstool für den globalen grünen und nachhaltigen Finanzmarkt” aufgebaut werden könne, so der letzte Jahresbericht der IPSF. Peking hat das Ziel, schon Ende des Jahres gemeinsame Standards bekannt zu geben.
Die EU scheint noch etwas vorsichtiger zu sein. Ein Sprecher der EU-Kommission antwortete ausweichend auf eine Anfrage des China.Table, ob man nach gemeinsamen Standards mit China strebe. Er verwies auf die Taxonomie-Arbeitsgruppe, die Gemeinsamkeiten zwischen den bestehenden Taxonomien aufzeigen soll. Ob daran auch politische Verhandlungen um gemeinsame Standards anschließen, wollte man nicht mitteilen. Gleichwohl sagte der Sprecher, “internationale Kooperation ist ein Schlüssel zur Entwicklung gemeinsamer globaler Standards im Bereich nachhaltiger Finanzen. Die globalen Finanzmärkte fordern die Behörden bereits auf, gemeinsame Standards zu definieren, damit sich nachhaltige Finanzen weiter entwickeln können”.
Laut Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und Finanzexperte, mache es Sinn, sich bei Standards auszutauschen. Doch er widerspricht der EU-Kommission und sieht Kooperation nicht als zwingende Bedingung für die Angleichung von Standards für grüne Investitionen. Die EU-Kommission solle ihre Macht beim Setzen globaler Standards nicht unterschätzen, so Giegold. Wenn sich die EU-Staaten auf einen Standard für grüne Investitionen einigen, sind die Chancen gut, ihn weltweit durchzusetzen.
Die EU ist schließlich ein riesiger Binnenmarkt. Was hier geregelt ist, gilt schnell weltweit. Für andere Regionen hat es schlicht keinen Sinn, eigene Regeln zu setzen – sie müssen sich ja ohnehin schon an die der EU halten. Dann steigen die Kosten. Politische Verhandlungen über gemeinsame Standards mit anderen Staaten seien hingegen schwerfällig, so Giegold. Der Grünen-Politiker ist also eher dafür, dass die EU mit gutem Beispiel vorangeht, statt auf gemeinsame Prozesse zu warten.
Derzeit ist bei den Klassifizierungen, was als grüne Investition gilt, auf beiden Seiten noch einiges im Fluss. Die EU hat zwar eine “Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten” eingeführt, aber noch nicht abschließend entschieden, ob beispielsweise Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig gelten oder aus dem Green Finance Sektor ausgeschlossen werden. Eine Entscheidung darüber wurde jüngst auf Ende des Jahres vertagt, da sich die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten nicht auf einen Kompromiss einigen konnten.
Nach Pekinger Standards galten zumindest bei grünen Anleihen Investitionen in “saubere Kohle”, die “saubere Ölgewinnung” und auch Gaskraftwerke lange Zeit als grün (China.Table berichtete). Jüngst hat Peking die Standards für diese Instrumente verschärft und fossile Energieproduktion größtenteils rausgestrichen. Einzig die Gasinfrastruktur wie Pipelines und Flüssigerdgas-Terminals dürfen weiterhin mit grünen Anleihen finanziert werden (China.Table berichtete).
In den inhaltlichen Unterschieden lauern dann auch erste Fallstricke gemeinsamer Green Finance Standards zwischen der EU und China. Es könnte durchaus sein, dass die Standards in Zukunft weiter verschärft werden müssen, wenn sich herausstellt, dass sie nicht ausreichend streng sind und zu viele Investitionen in klimaschädliche Bereiche zulassen. Hat die EU dann jedoch schon gemeinsame Standards mit China beschlossen, müsste sie nicht nur einen Kompromiss unter den eigenen Mitgliedsstaaten finden, sondern auch mit Peking nachverhandeln.
Auch bezüglich der Erreichung der Pariser Klimaziele unterscheiden sich die Standards der EU und China. “Die EU-Taxonomie wurde im Einklang mit dem Ziel der EU-Klimapolitik entwickelt, die wirtschaftlichen Aktivitäten mit dem langfristigen Ziel des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen”, sagt Byford Tsang, Politikberater des Klima-Think-Tanks E3G gegenüber China.Table. “Investitionen, die die Standards der Taxonomie erfüllen, sollen eine bestimmte Reihe von Klimaschutz- und -anpassungszielen unterstützen.” Die jüngst erneuerten chinesischen Standards für grüne Anleihen berücksichtigen zwar Kennzahlen wie Kohlenstoffspitzenwerte und Ziele wie Kohlenstoffneutralität. Aber sie richten die Investitionen nicht wirklich an Klimaschutz-Zielen aus, so Tsang.
Gemeinsame Standards für grüne Investitionen könnten die grenzüberschreitenden Investitionen im Umweltsektor beschleunigen. Sie verringern die Transaktionskosten für Finanzakteure. Derzeit ist der chinesische Markt bei grünen Investitionen für europäische Finanzakteure noch recht unzugänglich, da sich die Standards trotz jüngster Reformen noch zu sehr unterscheiden.
Sven Giegold weist auch auf die Gefahr hin, dass Sozialstandards aufweichen, wenn die EU mit China verhandelt. Die EU-Taxonomie sieht derzeit vor, dass wirtschaftliche Aktivitäten nur als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, wenn sie beispielsweise den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen. Sie sollen auch mit den acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) im Einklang stehen. Darunter fallen auch ein Verbot von Zwangsarbeit und eine Garantie für Vereinigungsfreiheit. Es wird kaum möglich sein, in diesen Bereichen auf einen gemeinsamen Nenner mit China zu kommen. Außer eben, die Europäer senken ihre Ansprüche.
China hat vor gut einer Woche ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung verabschiedet, das Lieferdienste, Restaurants und Konsument:innen stärker in die Pflicht nehmen soll. In der Volksrepublik werden jedes Jahr rund 35 Milliarden Kilogramm Lebensmittel weggeworfen.
Laut Angaben des staatlichen Fernsehsenders CGTN landen allein in Chinas Catering-Industrie jährlich um die 18 Milliarden Kilogramm Lebensmittel in der Tonne. Durch das neue Gesetz sollen übermäßige Bestellungen sowie irreführende Angaben, die zu übermäßigen Bestellungen führen, mit einer Strafe von 10.000 Yuan (rund 1275 Euro) geahndet werden. Auch dürfen solche Dienste, ebenso wie Restaurants, nun eine Entsorgungsgebühr von Kund:innen verlangen, die große Mengen an Lebensmittelresten hinterlassen.
Online-Lieferdienste werden wiederum dazu angehalten, detailliertere Informationen zur Menge und Größe ihrer Portionen aufzulisten. Das 32 Klauseln umfassende Gesetz sieht zudem eine Strafe von 50.000 Yuan für Food-Service-Betreiber vor, die sehr große Mengen an Lebensmitteln verschwenden.
Zudem verbietet das Gesetz Video-Blogger:innen das Erstellen und Hochladen sogenannter Binge-Eating-Videos, in denen sich Menschen beim Verzehren großer Mengen von Lebensmitteln filmen. In den letzten zwei Jahren wurden diese in Südkorea unter dem Namen “Mukbang” populär gewordenen Videos auch in China immer beliebter.
Dass sich die Reform schnell durchsetzt, ist unwahrscheinlich. In China gebietet es die Gastfreundschaft (und oft auch die Geltungssucht), mehr Essen zu bestellen, als man verzehren kann. Bereits im vergangenen Sommer startete Peking eine Kampagne des “sauberen Tellers“. Mit ihr sollte einer potenziellen Lebensmittelknappheit zuvorgekommen werden, da die Schweinepest, die Corona-Pandemie und Überschwemmungen im Süden teilweise zu Lieferengpässen und Ernteausfällen geführt hatten. Lokalregierungen starteten daraufhin Programme zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen und priesen Sparsamkeit auf Bannern als ehrenwert.
Mit einer drohenden Nahrungsmittelknappheit habe das neue Gesetz jedoch nichts zu tun, versichern die Staatsmedien. Es sei vielmehr ein “weitsichtiger Schritt, um die Ernährungssicherheit zu garantieren”. Pekings Sorge ist derzeit vor allem die stark gestiegene Nachfrage nach Getreide für die Massentierhaltung. Chinas wachsende Mittelschicht konsumiert immer mehr Fleisch, Eier und Milch. Und damit steigt auch der Bedarf an energiereichem Tierfutter wie Sojabohnenmehl und Mais. Und die müssen zu großen Teilen importiert werden.
2020 importierte China einen Rekordwert von 11,3 Millionen Tonnen Mais, eine Steigerung von 135,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allein zwischen Januar und März dieses Jahres importierte die Volksrepublik 6,7 Millionen Tonnen Mais, das sind 438 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Bei Importen von Sojabohnen erreichte China 2020 sogar erstmals einen Rekordwert von 100 Millionen Tonnen, von denen 26 Prozent aus den USA stammten. Diese Abhängigkeit von Soja und anderem Getreide, die im Handelsstreit mit den USA eine enorme Rolle spielte, will Peking unbedingt reduzieren.
Schweinefleisch ist in China nach wie vor beliebt und für die immer wohlhabendere Bevölkerung auf dem Land und in kleineren Städten auch ein Statussymbol. Mehr als 95 Prozent der in China gehaltenen Schweine stammen aus drei im Ausland gezüchteten, schnell wachsenden Rassen, die in etwa sechs Monaten schlachtreif sind. Ihr schnelles Wachstum erfordert jedoch viel proteinreiche Futtermittel wie Mais und Sojabohnen.
Schweine-, aber auch Geflügelfarmen verwenden normalerweise 60 Prozent Mais und 18 Prozent Sojamehl als Futter. Die chinesischen Bauern werden von Chinas Landwirtschaftsministerium deshalb verstärkt dazu angehalten, auf einheimische Rassen zu setzen, die einen Fütterungszyklus von sieben bis zwölf Monaten haben und mit einer Vielzahl von Futtermitteln gefüttert werden können. Mehrere führende Tierfarmen Chinas haben bereits auf billigere Alternativen wie Maniok, Sorghum, Raps- und Sonnenblumenmehl umgestellt, um die Abhängigkeit von Mais und Sojamehl zu verringern.
Um die Selbstversorgung zu fördern und aus Tieren und Pflanzen mehr herauszuholen, hat China in den vergangenen Jahren außerdem stark in die Gentechnik investiert. Von 2008 bis 2020 beliefen sich die nationalen Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung in dem Bereich auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Auch propagiert die Regierung eine Reduzierung des Fleischkonsums um gut die Hälfte des jetzigen Verbrauchs. Produzenten von Fleischalternativen sehen in der Volksrepublik deshalb einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der Zukunft.
Die Europäische Union und Indien haben sich auf eine Wiederaufnahme der Gespräche über ein Freihandelsabkommen verständigt. Mit dem Abkommen solle auf die “aktuellen Herausforderungen” reagiert werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach dem EU-Indien-Gipfel im portugiesischen Porto. Zudem solle separat über ein Investitionsschutzabkommen und ein Abkommen zum Schutz von Herkunftsangaben gesprochen werden. Das sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den China-Verhandlungen:
Die EU und Indien schlossen zudem eine Partnerschaft mit dem Ziel größerer Vernetzung wie Brüssel sie bereits mit Japan unterhält. Diese sieht die Zusammenarbeit in verschiedenen Infrastruktur-Projekten vor, auch auf dem afrikanischen Kontinent.
Dass die Kooperation zwischen EU und Indien auch als Reaktion auf das erstarkende China vorangetrieben wird, ist ein offenes Geheimnis. Mit der Seidenstraßeninitiative BRI knüpft Peking ein Netz neuer Handelsbeziehungen. Auf dem Gipfel am Wochenende hat jedoch niemand diesen Zusammenhang offen ausgesprochen. Stattdessen gab es Andeutungen: “Wir waren uns einig, dass die EU und Indien als die beiden größten Demokratien der Welt ein gemeinsames Interesse daran haben, Sicherheit, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung in einer multipolaren Welt zu gewährleisten“, hieß es in dem gemeinsamen Statement.
Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte die Wichtigkeit der Kooperation zwischen Brüssel und asiatischen Staaten in der Indo-Pazifik-Region. “Es gibt konkurrierende Modelle für Entwicklung, Infrastruktur, Handel und Regierungsführung”, so Borrell nach dem Treffen. “Wir haben unser Engagement für den Schutz und die Förderung aller Menschenrechte bekräftigt”, teilten beide Seiten mit. Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den Wirtschaftsblöcken war 2013 eingestellt worden. Brüssel sucht derzeit nach Möglichkeiten, ein Gegengewicht zur chinesischen BRI zu bilden, neben der Kooperation mit Indien und anderen asiatischen Staaten gehört dazu unter anderem auch die Indo-Pazifik-Strategie. ari
Ein Abschnitt des Investitionsabkommens zwischen der EU und China (CAI) zum Umgang mit ausländischen Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen (NGO) hat erneut für Verunsicherung gesorgt. Der Abgeordnete des Europaparlaments und Vorsitzende der China-Delegation, Reinhard Bütikofer (Grüne) warnte, dass die in dem Absatz festgelegte Einsetzung chinesischer Führungspersonen bei in China tätigen ausländischen Stiftungen und NGOs “faktisch auf KP-Kontrolle” hinausliefe, wie die Zeitung Welt am Sonntag berichtete. Er fügte demnach hinzu: “Es ist mir schleierhaft, wie die Bundesregierung und die Europäische Kommission einem solchen Abkommen zustimmen wollen.”
Der umstrittene Absatz befindet sich jedoch in den bereits im März veröffentlichten Anhängen zum CAI und ist seitdem öffentlich zugänglich. Schon Ende März hatten deutsche Stiftungsvertreter:innen daher in China.Table vor einer massiven Verschlechterung ihrer Arbeitssituation in der Volksrepublik gewarnt (hier im China.Table), sollte der Absatz wie derzeit formuliert auch unterzeichnet werden. EU-Kreise erklärten damals gegenüber China.Table, dass der Passus zum Umgang mit NGOs einseitig von der chinesischen Seite eingebracht worden war. Der entsprechende Absatz in den CAI-Annexen sei während der Verhandlungen nicht zur Sprache gekommen. Der Bericht in der Welt am Sonntag von diesem Wochenende ist daher bereits veraltet.
Die Arbeit des Europaparlaments am CAI ist derzeit unterbrochen. EU-Abgeordnete fordern eine Rücknahme der Sanktionen aus Peking, die sich auch gegen Parlamentarier:innen richten. Bei der Plenumssitzung im Mai will das EU-Parlament voraussichtlich eine Resolution verabschieden, die die Weiterarbeit an dem Abkommen untersagt, solange die Strafmaßnahmen in Kraft sind. ari
China hat offenbar die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, nicht an einer von Deutschland, den USA und Großbritannien geplanten Veranstaltung zur Situation der Uiguren in Xinjiang teilzunehmen. Chinas UN-Botschaft wirft den Veranstaltern vor, “Menschenrechtsfragen als politisches Werkzeug zu benutzen, um sich in Chinas innere Angelegenheiten wie Xinjiang einzumischen”, berichtete Reuters. “Sie sind besessen davon, eine Konfrontation mit China zu provozieren”, hieß es demnach in dem Schreiben. Die Online-Veranstaltung könne “nur zu mehr Konfrontation führen”.
Die UN-Botschafter Deutschlands, der USA und Großbritanniens wollen am Mittwoch im Rahmen eines virtuellen Treffens mit dem Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Ken Roth, und der Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, sprechen. Die Teilnehmer wollen gemeinsam für die Menschenrechte der muslimischen Minderheiten in Xinjiang eintreten, hieß es in der Einladung laut Berichten. ari
Die Raketentrümmer der chinesischen Marsrakete sind harmlos in den Indischen Ozean gestürzt. Der größte Teil sei beim Wiedereintritt verglüht, teilte Chinas Raumfahrtorganisation am Sonntag mit. Zuvor hatte es Warnungen vor einem “unkontrollierten” Eintritt in die Erdatmosphäre gegeben. Die chinesische Raketentechnik steht in der Kritik, weil sich die Raketenstufen nicht gezielt auf einer vorgegebenen Umlaufbahn ablegen lassen. China bezeichnet das Vorgehen dagegen als branchenüblich. Jährlich fallen rund 100 Tonnen Weltraumschrott auf die Erde. fin
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dem Covid-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt. “Als neuer Impfstoff im Arsenal der Pandemiebekämpfung hat er das Potenzial, den Zugang zu Impfstoffen zu erhöhen”, sagte die WHO-Vizechefin Mariângela Simão. Die Organisation erwarte nun, dass der Hersteller einen Betrag zur gemeinsamen Impfkampagne Covax leiste. Inspektoren der WHO haben die Produktionsanlagen besucht und keine Defizite gefunden. Die Auswertung der Studien zur Erprobung des Wirkstoffs habe ergeben, dass er sicher und wirksam sei. Während das Produkt von Sinopharm eine gute Presse hat, ranken sich Zweifel um die Wirksamkeit des Konkurrenzprodukts von Sinovac (China.Table berichtete). Für diesen steht die WHO-Zulassung noch aus. fin
Präsident Xi Jinping hat sein politisches Programm bekräftigt, China eigenständiger zu machen. Die Welt sei in “Aufruhr” und China müsse daher größere Autarkie anstreben, sagte er in einer Rede, die nun in der Parteitschrift Qiushi erschienen ist. Solche Aussagen des Staats- und Parteichefs gelten in China als Handlungsanweisungen an Kader auf allen Ebenen. Weltweit finden “grundlegende und beispiellose Veränderungen” statt, so Xi. Es sehe so aus, “als ob diese Situation noch einige Zeit andauern wird”. Sein Land müsse eine neue Balance zwischen Öffnung gegenüber der Welt und größerer Unabhängigkeit erreichen. “Solange wir auf eigenen Füßen stehen und selbstständig sind, daheim einen lebendigen Strom von Waren und Dienstleistungen aufrechterhalten, werden wir unbesiegbar sein – egal wie die Stürme international wechseln”, gibt die Nachrichtenagentur dpa seine Worte wider. Die Globalisierung befinde sich auf dem Rückzug. fin
Das erste Quartal ist für deutsche Dax-Unternehmen in China überwiegend gut verlaufen – vor allem im Vergleich zu anderen Weltgegenden, die sich fest im Griff der dritten Covid-Welle befanden.
Adidas konnte in China seinen Umsatz um 156 Prozent steigern. Der mögliche Effekt eines Boykottaufrufs im April ist hier noch nicht enthalten; er fällt ins zweite Quartal. Berichten zufolge sollen die Onlinebestellungen kurzzeitig gesunken sein.
Die Marke Audi hat 45 Prozent seiner Autos (207.000 von weltweit 463.000 Stück) in China verkauft. Der hohe Absatz dort hob das Konzernergebnis nach einem schwachen Jahr 2020 wieder in die Gewinnzone.
Siemens hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres (ab Oktober) in China einen Auftragszuwachs von 29 Prozent verzeichnet. Auch der Umsatzerlös stieg dort im Vorjahresvergleich beachtlich um 865 Millionen Euro auf 3,8 Milliarden Euro. “Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und unserem Softwaregeschäft sowie, geografisch betrachtet, aus China”, teilte das Unternehmen mit. fin

Nach fast 150 Jahren im Land übernimmt erstmals ein chinesischer Manager die Verantwortung für das China-Geschäft des deutschen Industrie-Flaggschiffs Siemens: Xiao Song, 1965 geboren in Sichuan, Doktortitel in Ingenieurwissenschaften, errungen an der TU in Dortmund. Im Konzert der deutschen Großkonzerne ist diese Personalie ein Paukenschlag. Seit dem Desaster der Deutschen Bank, die noch 2019 für die korrupten Machenschaften ihres ehemaligen chinesischen Topmanagers im Land vor mehr als zehn Jahren zur Kasse gebeten wurde, haben nur wenige DAX-Unternehmen die Gesamtverantwortung ihres China-Geschäfts in die Hände von Führungspersonen aus der Volksrepublik gelegt. Fresenius Medical Care oder der Chemie-Konzern Covestro waren hier bisher eher die Ausnahmen.
Xiaos Berufung durch eine Ikone der europäischen Industrie zeigt die Professionalisierung der chinesischen Wirtschaft seit dem Beginn der Öffnungspolitik Ende der 70er-Jahre, einer Stunde Null für das Managementwissen im Land. Ist sie aber auch ein Zeichen dafür, dass sich der Bedarf an ausländischen Topmanagern im Land dem Ende entgegenneigt? Eine solche Entwicklung läge im Interesse der Regierung in Peking, die den Einfluss von außen verringern will. Ausländische Unternehmen, vor allem die großen, sollen weitgehend sinisiert werden: Made in Germany, gesteuert von Chinesen. Ganz ohne Risiko ist die Entscheidung von Siemens daher nicht. Kein Bürger der Volksrepublik ist seinem Staat gegenüber unabhängig.
Am 1. Mai löste Xiao seinen Vorgänger Lothar Herrmann an der Spitze von Siemens China ab. Xiao kennt das Haus bestens. Bis Ende 2015 war er schon einmal elf Jahre für das Unternehmen tätig, in verschiedenen Geschäftsfeldern: im später veräußerten Automobilsektor, im Bereich der Infrastruktur wie Transport, Logistik, Mobilität, Smart Grid oder Gebäudetechnik. “Natürlich bin ich weder in der Firma völlig neu, noch für viele unserer Kollegen, Kunden und Partner. Dennoch markiert dieser Tag für mich einen neuen Anfang“, schrieb er zum Dienstantritt in seinem LinkedIn-Profil. Er sei aufgeregt und demütig, zum Team zu stoßen. Und, so schreibt Xiao, er sei sich seiner “großen Verantwortung” bewusst.
Xiao trägt nun Verantwortung für das große China-Geschäft eines Unternehmens, das sein Image als Mischkonzern loswerden und nur noch als Technologie-Konzern wahrgenommen werden möchte. Das weltweit fast 300.000 Menschen beschäftigt und 2020 einen Jahresumsatz von 57,1 Milliarden Euro erzielte, davon zwölf Prozent in der Volksrepublik. Siemens ist seit 170 Jahren eines der bedeutendsten deutschen Unternehmen und hat vom Telegrafen bis zum MRT-Scanner wichtige Beiträge zur Technologiegeschichte geleistet.
In der Zentrale in München ist dem Vernehmen nach die Erwartung groß, dass Xiao sich der Bedeutung seiner Rolle bewusst ist, fast 150 Jahre nach den ersten Gehversuchen des Konzerns in der Volksrepublik. Der neue Unternehmenschef Roland Busch, der erst vor wenigen Wochen Joe Kaeser an der Spitze ablöste, richtete persönliche Grüße unter dem LinkedIn-Post an den neuen, alten Kollegen. “Lieber Song, willkommen zurück bei Siemens. Ich wünsche dir einen großartigen Start und viel Erfolg in deiner neuen Rolle. Ich freue mich darauf, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Bis bald, Roland”, schrieb Busch. Und Xiao verspricht: “Zusammen werden wir den Unterschied machen.“
Diesen Satz wiederholt Xiao etliche Male unter all den Glückwünschen und Willkommensgrüßen. Xiao stellt hier bewusst seine Qualitäten als langfristig verlässlicher Teamplayer heraus – eine Eigenschaft, die bei chinesischem Personal zuweilen vermisst wird. Er selbst eignete sich die deutsche Denkweise nicht nur während seines Studiums in Dortmund an, sondern auch in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten zunächst bei Siemens und zuletzt als Asien-Direktor des westfälischen Zulieferers Winkelmann Longchuan (SWL) Motorcomponents in Shanghai.
Xiao sei freundlich, verbindlich und kompetent, so spricht man in München über ihn. Siemens-Chef Busch ist überzeugt, den richtigen Mann erwählt zu haben. Seine Aufgabe wird es sein, die digitale Transformation der Kunden voranzutreiben, um deren Produktivität zu steigern und ihre Entwicklungszeiten zu verkürzen. Xiao wird auch daran gemessen werden, ob es ihm in stürmischen Zeiten globaler Handelsstreitigkeiten und Protektionismus gelingen wird, für Siemens die Lieferketten aufrechtzuerhalten, wenn es hart auf hart kommt. Xiao ist chinesischer Staatsbürger, seine Kontakte zu Staat und Politik sollen sich für Siemens in der Not auszahlen.
Der erste Versuch von Siemens, mit einem asiatischen Gesicht an der Spitze einem reibungslosen China-Geschäft den Weg zu ebnen, ging vor einigen Jahren noch schief. Cheng Mei-Wei wurde 2010 hier und da bereits als “erster Chinese” an der Spitze von Siemens im Land dargestellt. Doch Cheng stammt nicht aus der Volksrepublik, sondern aus Taiwan, und er hat die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das Experiment war relativ schnell wieder beendet, und Lothar Herrmann übernahm bis vorvergangene Woche die Geschäfte.
Die Deutsche Bank machte ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Topmanager Zhang Hongli, Rufname Lee, aus der Provinz Heilongjiang. Zhang war bestens verdrahtet, spielte Golf mit dem Sohn des früheren chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao. Seine Sporen in der Finanzindustrie hatte er sich bei der US-Investmentbank Goldman Sachs verdient. Ab 2003 übernahm er die China-Geschäfte der Deutschen Bank. Doch das Ganze endete in einem Skandal. Zhang zahlte offenbar Millionensummen an diverse Berater und Kontaktleute und brachte die Bank in Erklärungsnot. 2014 verklagte die Bank ihren ehemaligen Mitarbeiter. Im August 2019 zahlte das Unternehmen 16 Millionen US-Dollar Strafe an die US-Behörden.
Doch die Personalien Zhang und Xiao sind kaum zu vergleichen. Zhang übernahm damals die Geschäfte einer Bank, die ihren US-Mitbewerbern in China hoffnungslos hinterherlief, die sich etablieren wollte und bis auf ihren Ruf nichts zu verlieren hatte. Xiao dagegen übernimmt ein Unternehmen, das die Chinesen schon zu Zeiten des Kaiserreichs kannten, das an allen Stufen der technologischen Entwicklung des Landes beteiligt war, das Vertrauen chinesischer Kunden genießt, weil es deutsche Wertarbeit im Gepäck hat und schon lange in China profitabel wirtschaftet.
Das Magazin Cicero schrieb schon im Jahr 2010, als der Taiwaner Cheng das Ruder übernahm: “Doch gerade die enge Verflechtung mit Land und Leuten spricht bei vielen internationalen Unternehmen noch dringend gegen chinesische CEOs. Denn wo liegen ihre Interessen, und wem gehört ihre Loyalität?”
Die Frage wirkt heute angesichts vieler erfolgreicher chinesischer Führungskräfte in deutschen Diensten veraltet, ist aber zugleich aktueller denn je. Die Gesetzgebung in der Volksrepublik lässt Bürgern und Unternehmen immer weniger Spielraum, sich souverän gegenüber dem Staat zu behaupten. Aber solange die Zahlen in China stimmen, wird die Frage für Siemens kaum relevant sein. Und Probleme oder Skandale werden bei einer erprobten Personalie wie Xiao kaum zu erwarten sein. Marcel Grzanna
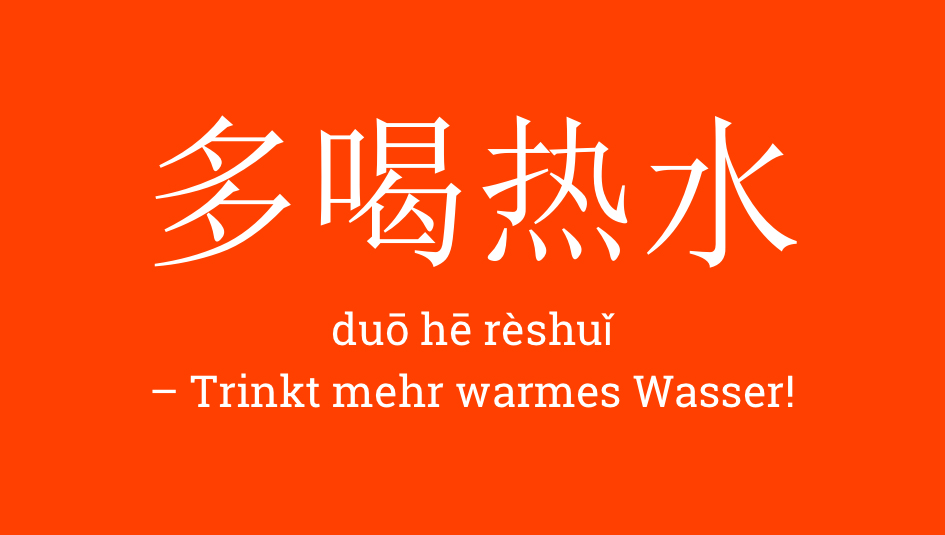
Erschöpft und ausgelaugt? Den Magen verdorben? Migräneanfall? Erkältung im Anflug? Homeoffice-Koller? Oder einfach alles zu viel? Trinken Sie mehr warmes Wasser! Das zumindest wird man Ihnen in China raten, wann immer die Sprache auf kleinere Wehwehchen und plötzliches körperliches Unbehagen kommt. Warmes beziehungsweise aufgekochtes Wasser – auf Chinesisch 热水 rèshuǐ oder 白开水 báikāishuǐ – gilt vielen Chinesen als wirksame Soforthilfe und beste Vorbeugung für verschiedenste Malaisen. Der gut gemeinte Ratschlag 多喝热水 duō hē rèshuǐ ist im Reich der Mitte deshalb zu einem geflügelten Wort geworden, ja hat sich gar zu einem Internet-Meme aufgeschwungen.
Digitale Sticker und Onlinebilder mit “Trinkt mehr warmes Wasser”-Slogan haben allerdings meist einen ironischen Beigeschmack. Denn schließlich ist der Warmwasser-Wink zwar sicher gut gemeint, entpuppt sich bei inflationärer Anwendung jedoch als floskelhaft “wässrig”. Insbesondere in Paarbeziehungen gilt er jungen Chinesen als echter Stimmungskiller. Spätestens seit eine Internetnutzerin sich in einem viel beachteten Onlinepost darüber echauffierte, ihr Freund ziehe sich ständig mit dem Warmwasser-Lösungsvorschlag aus der Affäre. Der Eintrag ging viral, schien er doch vielen Chinesinnen und Chinesen aus der Seele zu sprechen.
Auch im interkulturellen Austausch lauert das eine oder andere potenzielle “Watergate”. So reiben sich China-Neulinge beim Restaurantbesuch meist verdutzt die Augen, wenn sie auf die Bitte nach einem Glas Wasser (水 shuǐ) selbiges in heiß-dampfender Form gereicht bekommen. Wer in China auf eine erfrischende Abkühlung für die ausgedörrte Touristenkehle hofft, sollte stattdessen ein 冰水 bīngshuǐ (kaltes stilles Wasser) oder ein Sprudelwasser (苏打水 sūdǎshuǐ) bestellen. Auch der Hinweis 常温 chángwēn (normal- oder raumtemperiert) erweist sich als hilfreich. So ersparen sich Durstige unnötige Wartezeiten, bis sich das frisch aufgekochte Nass wieder auf gaumenfreundliche Temperaturen abgekühlt hat.
Chinesen auf der anderen Seite vermiest es nicht selten die Reiselaune, wenn sie in deutschen Hotelzimmern keinen Wasserkocher vorfinden. Denn der, so finden sie, gehört doch schließlich zur Grundausstattung! Heimische Hotels mit chinesischem Zulauf haben sich längst auf dieses Bedürfnis eingestellt und entsprechend nachgerüstet.
Die Vorliebe der Chinesen für aufgekochtes Wasser kommt übrigens nicht von ungefähr. Nach Auffassung der Traditionellen Chinesischen Medizin (中医 zhōngyī) liegen die Vorteile des natürlichen Heißgetränks auf der Hand: So soll der regelmäßige Verzehr von warmem Wasser nicht nur Magen und Darm gesund halten, die Durchblutung fördern, den Körper entgiften und das Hautbild verbessern, sondern auch Erkältungen vorbeugen. In diesem Sinne also: Duō hē rèshuǐ!
Verena Menzel 孟维娜 betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
lange musste Siemens in China auf den ersten Chef aus der Volksrepublik warten. Mit Xiao Song übernimmt dort nun ein allseits gelobter Manager mit viel internationaler Erfahrung das Steuer. Es ist erfreulich und richtig, dass die Epoche ausländischer Chef:innen über Organisationen, die heute fast nur noch aus Chinesen bestehen, zu Ende geht. Doch in einer Zeit des ausufernden staatlichen Einflusses kann das für die betreffenden Manager auch zu Loyalitätskonflikten führen, schreibt Marcel Grzanna.
Was ist “nachhaltig”? Darüber sind sich China und Europa mitnichten einig. Die einen finden saubere Kohlekraftwerke bereits umweltfreundlich, für die anderen müsste es schon Windenergie sein. Dabei hat die Frage der offiziellen Definition von Nachhaltigkeit harte wirtschaftliche Auswirkungen. Denn nur Geldanlagen und Projekte mit dem passenden Gütesiegel erhalten Finanzierungen aus Töpfen für nachhaltige Investitionen. Den Streit um die Einordnung der Nachhaltigkeit beschreibt Nico Beckert.
Das Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung ist eine gute Woche alt. Unser Autor Frank Sieren schaut sich an, wie sich das Verhalten der Verbraucher und Restaurants seitdem bereits verändert hat. In China gilt dabei noch mehr als anderswo: Volle oder leere Teller sind eine brisante Frage. Wenn sich das Land zu große Verschwendung angewöhnt, muss es umso mehr importieren. Doch Xi Jinping gibt vor: China soll vom Ausland möglichst unabhängig sein. In Deutschland haben wir übrigens gut reden – die EU stellt weit mehr Lebensmittel her, als sie braucht.

Grüne Finanzinvestitionen sind eines der zentralen Zukunftsthemen. Für den Umbau der Wirtschaft weg von fossilen und hin zu klimaverträglichen Produktions- und Konsummustern sind Milliarden-Investitionen nötig. Auch Peking hat das erkannt: Um mehr Finanzmittel internationaler Investoren anzulocken, will die Zentralbank die Standards für grüne Geldanlagen und Projekte zwischen der EU und China angleichen. Sie hat wiederholt angekündigt, “gemeinsame Standards” einzuführen. Diese sollen definieren, was genau als grüne Investition gilt. Diese Standards werden in sogenannten Taxonomien festgehalten.
Seit Oktober 2020 tagt eine gemeinsame Taxonomie-Arbeitsgruppe, die bis zum Herbst 2021 “die Gemeinsamkeiten der schon bestehenden Taxonomien” herausarbeiten soll. Den Vorsitz haben die EU und China. Das Ergebnis soll eine Richtschnur für die Mitglieder der International Platform on Sustainable Finance (IPSF) werden. In der IPSF haben sich Behörden, die für die Entwicklung einer ökologisch nachhaltigen Finanzpolitik zuständig sind, aus 17 Ländern und Regionen zusammengeschlossen. Die EU ist als Staatenbund beteiligt. Weitere Mitglieder sind China, Japan, Indien, Großbritannien und Kanada. Die USA nehmen nicht teil.
Die IPSF ist ein Austauschforum und hat keine gesetzgeberischen Kompetenzen. Die Arbeit der Taxonomie-AG wird als Grundlage gesehen, auf der ein “gemeinsames Klassifizierungstool für den globalen grünen und nachhaltigen Finanzmarkt” aufgebaut werden könne, so der letzte Jahresbericht der IPSF. Peking hat das Ziel, schon Ende des Jahres gemeinsame Standards bekannt zu geben.
Die EU scheint noch etwas vorsichtiger zu sein. Ein Sprecher der EU-Kommission antwortete ausweichend auf eine Anfrage des China.Table, ob man nach gemeinsamen Standards mit China strebe. Er verwies auf die Taxonomie-Arbeitsgruppe, die Gemeinsamkeiten zwischen den bestehenden Taxonomien aufzeigen soll. Ob daran auch politische Verhandlungen um gemeinsame Standards anschließen, wollte man nicht mitteilen. Gleichwohl sagte der Sprecher, “internationale Kooperation ist ein Schlüssel zur Entwicklung gemeinsamer globaler Standards im Bereich nachhaltiger Finanzen. Die globalen Finanzmärkte fordern die Behörden bereits auf, gemeinsame Standards zu definieren, damit sich nachhaltige Finanzen weiter entwickeln können”.
Laut Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und Finanzexperte, mache es Sinn, sich bei Standards auszutauschen. Doch er widerspricht der EU-Kommission und sieht Kooperation nicht als zwingende Bedingung für die Angleichung von Standards für grüne Investitionen. Die EU-Kommission solle ihre Macht beim Setzen globaler Standards nicht unterschätzen, so Giegold. Wenn sich die EU-Staaten auf einen Standard für grüne Investitionen einigen, sind die Chancen gut, ihn weltweit durchzusetzen.
Die EU ist schließlich ein riesiger Binnenmarkt. Was hier geregelt ist, gilt schnell weltweit. Für andere Regionen hat es schlicht keinen Sinn, eigene Regeln zu setzen – sie müssen sich ja ohnehin schon an die der EU halten. Dann steigen die Kosten. Politische Verhandlungen über gemeinsame Standards mit anderen Staaten seien hingegen schwerfällig, so Giegold. Der Grünen-Politiker ist also eher dafür, dass die EU mit gutem Beispiel vorangeht, statt auf gemeinsame Prozesse zu warten.
Derzeit ist bei den Klassifizierungen, was als grüne Investition gilt, auf beiden Seiten noch einiges im Fluss. Die EU hat zwar eine “Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten” eingeführt, aber noch nicht abschließend entschieden, ob beispielsweise Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig gelten oder aus dem Green Finance Sektor ausgeschlossen werden. Eine Entscheidung darüber wurde jüngst auf Ende des Jahres vertagt, da sich die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten nicht auf einen Kompromiss einigen konnten.
Nach Pekinger Standards galten zumindest bei grünen Anleihen Investitionen in “saubere Kohle”, die “saubere Ölgewinnung” und auch Gaskraftwerke lange Zeit als grün (China.Table berichtete). Jüngst hat Peking die Standards für diese Instrumente verschärft und fossile Energieproduktion größtenteils rausgestrichen. Einzig die Gasinfrastruktur wie Pipelines und Flüssigerdgas-Terminals dürfen weiterhin mit grünen Anleihen finanziert werden (China.Table berichtete).
In den inhaltlichen Unterschieden lauern dann auch erste Fallstricke gemeinsamer Green Finance Standards zwischen der EU und China. Es könnte durchaus sein, dass die Standards in Zukunft weiter verschärft werden müssen, wenn sich herausstellt, dass sie nicht ausreichend streng sind und zu viele Investitionen in klimaschädliche Bereiche zulassen. Hat die EU dann jedoch schon gemeinsame Standards mit China beschlossen, müsste sie nicht nur einen Kompromiss unter den eigenen Mitgliedsstaaten finden, sondern auch mit Peking nachverhandeln.
Auch bezüglich der Erreichung der Pariser Klimaziele unterscheiden sich die Standards der EU und China. “Die EU-Taxonomie wurde im Einklang mit dem Ziel der EU-Klimapolitik entwickelt, die wirtschaftlichen Aktivitäten mit dem langfristigen Ziel des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen”, sagt Byford Tsang, Politikberater des Klima-Think-Tanks E3G gegenüber China.Table. “Investitionen, die die Standards der Taxonomie erfüllen, sollen eine bestimmte Reihe von Klimaschutz- und -anpassungszielen unterstützen.” Die jüngst erneuerten chinesischen Standards für grüne Anleihen berücksichtigen zwar Kennzahlen wie Kohlenstoffspitzenwerte und Ziele wie Kohlenstoffneutralität. Aber sie richten die Investitionen nicht wirklich an Klimaschutz-Zielen aus, so Tsang.
Gemeinsame Standards für grüne Investitionen könnten die grenzüberschreitenden Investitionen im Umweltsektor beschleunigen. Sie verringern die Transaktionskosten für Finanzakteure. Derzeit ist der chinesische Markt bei grünen Investitionen für europäische Finanzakteure noch recht unzugänglich, da sich die Standards trotz jüngster Reformen noch zu sehr unterscheiden.
Sven Giegold weist auch auf die Gefahr hin, dass Sozialstandards aufweichen, wenn die EU mit China verhandelt. Die EU-Taxonomie sieht derzeit vor, dass wirtschaftliche Aktivitäten nur als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, wenn sie beispielsweise den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen. Sie sollen auch mit den acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) im Einklang stehen. Darunter fallen auch ein Verbot von Zwangsarbeit und eine Garantie für Vereinigungsfreiheit. Es wird kaum möglich sein, in diesen Bereichen auf einen gemeinsamen Nenner mit China zu kommen. Außer eben, die Europäer senken ihre Ansprüche.
China hat vor gut einer Woche ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung verabschiedet, das Lieferdienste, Restaurants und Konsument:innen stärker in die Pflicht nehmen soll. In der Volksrepublik werden jedes Jahr rund 35 Milliarden Kilogramm Lebensmittel weggeworfen.
Laut Angaben des staatlichen Fernsehsenders CGTN landen allein in Chinas Catering-Industrie jährlich um die 18 Milliarden Kilogramm Lebensmittel in der Tonne. Durch das neue Gesetz sollen übermäßige Bestellungen sowie irreführende Angaben, die zu übermäßigen Bestellungen führen, mit einer Strafe von 10.000 Yuan (rund 1275 Euro) geahndet werden. Auch dürfen solche Dienste, ebenso wie Restaurants, nun eine Entsorgungsgebühr von Kund:innen verlangen, die große Mengen an Lebensmittelresten hinterlassen.
Online-Lieferdienste werden wiederum dazu angehalten, detailliertere Informationen zur Menge und Größe ihrer Portionen aufzulisten. Das 32 Klauseln umfassende Gesetz sieht zudem eine Strafe von 50.000 Yuan für Food-Service-Betreiber vor, die sehr große Mengen an Lebensmitteln verschwenden.
Zudem verbietet das Gesetz Video-Blogger:innen das Erstellen und Hochladen sogenannter Binge-Eating-Videos, in denen sich Menschen beim Verzehren großer Mengen von Lebensmitteln filmen. In den letzten zwei Jahren wurden diese in Südkorea unter dem Namen “Mukbang” populär gewordenen Videos auch in China immer beliebter.
Dass sich die Reform schnell durchsetzt, ist unwahrscheinlich. In China gebietet es die Gastfreundschaft (und oft auch die Geltungssucht), mehr Essen zu bestellen, als man verzehren kann. Bereits im vergangenen Sommer startete Peking eine Kampagne des “sauberen Tellers“. Mit ihr sollte einer potenziellen Lebensmittelknappheit zuvorgekommen werden, da die Schweinepest, die Corona-Pandemie und Überschwemmungen im Süden teilweise zu Lieferengpässen und Ernteausfällen geführt hatten. Lokalregierungen starteten daraufhin Programme zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen und priesen Sparsamkeit auf Bannern als ehrenwert.
Mit einer drohenden Nahrungsmittelknappheit habe das neue Gesetz jedoch nichts zu tun, versichern die Staatsmedien. Es sei vielmehr ein “weitsichtiger Schritt, um die Ernährungssicherheit zu garantieren”. Pekings Sorge ist derzeit vor allem die stark gestiegene Nachfrage nach Getreide für die Massentierhaltung. Chinas wachsende Mittelschicht konsumiert immer mehr Fleisch, Eier und Milch. Und damit steigt auch der Bedarf an energiereichem Tierfutter wie Sojabohnenmehl und Mais. Und die müssen zu großen Teilen importiert werden.
2020 importierte China einen Rekordwert von 11,3 Millionen Tonnen Mais, eine Steigerung von 135,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allein zwischen Januar und März dieses Jahres importierte die Volksrepublik 6,7 Millionen Tonnen Mais, das sind 438 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Bei Importen von Sojabohnen erreichte China 2020 sogar erstmals einen Rekordwert von 100 Millionen Tonnen, von denen 26 Prozent aus den USA stammten. Diese Abhängigkeit von Soja und anderem Getreide, die im Handelsstreit mit den USA eine enorme Rolle spielte, will Peking unbedingt reduzieren.
Schweinefleisch ist in China nach wie vor beliebt und für die immer wohlhabendere Bevölkerung auf dem Land und in kleineren Städten auch ein Statussymbol. Mehr als 95 Prozent der in China gehaltenen Schweine stammen aus drei im Ausland gezüchteten, schnell wachsenden Rassen, die in etwa sechs Monaten schlachtreif sind. Ihr schnelles Wachstum erfordert jedoch viel proteinreiche Futtermittel wie Mais und Sojabohnen.
Schweine-, aber auch Geflügelfarmen verwenden normalerweise 60 Prozent Mais und 18 Prozent Sojamehl als Futter. Die chinesischen Bauern werden von Chinas Landwirtschaftsministerium deshalb verstärkt dazu angehalten, auf einheimische Rassen zu setzen, die einen Fütterungszyklus von sieben bis zwölf Monaten haben und mit einer Vielzahl von Futtermitteln gefüttert werden können. Mehrere führende Tierfarmen Chinas haben bereits auf billigere Alternativen wie Maniok, Sorghum, Raps- und Sonnenblumenmehl umgestellt, um die Abhängigkeit von Mais und Sojamehl zu verringern.
Um die Selbstversorgung zu fördern und aus Tieren und Pflanzen mehr herauszuholen, hat China in den vergangenen Jahren außerdem stark in die Gentechnik investiert. Von 2008 bis 2020 beliefen sich die nationalen Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung in dem Bereich auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Auch propagiert die Regierung eine Reduzierung des Fleischkonsums um gut die Hälfte des jetzigen Verbrauchs. Produzenten von Fleischalternativen sehen in der Volksrepublik deshalb einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der Zukunft.
Die Europäische Union und Indien haben sich auf eine Wiederaufnahme der Gespräche über ein Freihandelsabkommen verständigt. Mit dem Abkommen solle auf die “aktuellen Herausforderungen” reagiert werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach dem EU-Indien-Gipfel im portugiesischen Porto. Zudem solle separat über ein Investitionsschutzabkommen und ein Abkommen zum Schutz von Herkunftsangaben gesprochen werden. Das sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den China-Verhandlungen:
Die EU und Indien schlossen zudem eine Partnerschaft mit dem Ziel größerer Vernetzung wie Brüssel sie bereits mit Japan unterhält. Diese sieht die Zusammenarbeit in verschiedenen Infrastruktur-Projekten vor, auch auf dem afrikanischen Kontinent.
Dass die Kooperation zwischen EU und Indien auch als Reaktion auf das erstarkende China vorangetrieben wird, ist ein offenes Geheimnis. Mit der Seidenstraßeninitiative BRI knüpft Peking ein Netz neuer Handelsbeziehungen. Auf dem Gipfel am Wochenende hat jedoch niemand diesen Zusammenhang offen ausgesprochen. Stattdessen gab es Andeutungen: “Wir waren uns einig, dass die EU und Indien als die beiden größten Demokratien der Welt ein gemeinsames Interesse daran haben, Sicherheit, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung in einer multipolaren Welt zu gewährleisten“, hieß es in dem gemeinsamen Statement.
Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte die Wichtigkeit der Kooperation zwischen Brüssel und asiatischen Staaten in der Indo-Pazifik-Region. “Es gibt konkurrierende Modelle für Entwicklung, Infrastruktur, Handel und Regierungsführung”, so Borrell nach dem Treffen. “Wir haben unser Engagement für den Schutz und die Förderung aller Menschenrechte bekräftigt”, teilten beide Seiten mit. Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den Wirtschaftsblöcken war 2013 eingestellt worden. Brüssel sucht derzeit nach Möglichkeiten, ein Gegengewicht zur chinesischen BRI zu bilden, neben der Kooperation mit Indien und anderen asiatischen Staaten gehört dazu unter anderem auch die Indo-Pazifik-Strategie. ari
Ein Abschnitt des Investitionsabkommens zwischen der EU und China (CAI) zum Umgang mit ausländischen Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen (NGO) hat erneut für Verunsicherung gesorgt. Der Abgeordnete des Europaparlaments und Vorsitzende der China-Delegation, Reinhard Bütikofer (Grüne) warnte, dass die in dem Absatz festgelegte Einsetzung chinesischer Führungspersonen bei in China tätigen ausländischen Stiftungen und NGOs “faktisch auf KP-Kontrolle” hinausliefe, wie die Zeitung Welt am Sonntag berichtete. Er fügte demnach hinzu: “Es ist mir schleierhaft, wie die Bundesregierung und die Europäische Kommission einem solchen Abkommen zustimmen wollen.”
Der umstrittene Absatz befindet sich jedoch in den bereits im März veröffentlichten Anhängen zum CAI und ist seitdem öffentlich zugänglich. Schon Ende März hatten deutsche Stiftungsvertreter:innen daher in China.Table vor einer massiven Verschlechterung ihrer Arbeitssituation in der Volksrepublik gewarnt (hier im China.Table), sollte der Absatz wie derzeit formuliert auch unterzeichnet werden. EU-Kreise erklärten damals gegenüber China.Table, dass der Passus zum Umgang mit NGOs einseitig von der chinesischen Seite eingebracht worden war. Der entsprechende Absatz in den CAI-Annexen sei während der Verhandlungen nicht zur Sprache gekommen. Der Bericht in der Welt am Sonntag von diesem Wochenende ist daher bereits veraltet.
Die Arbeit des Europaparlaments am CAI ist derzeit unterbrochen. EU-Abgeordnete fordern eine Rücknahme der Sanktionen aus Peking, die sich auch gegen Parlamentarier:innen richten. Bei der Plenumssitzung im Mai will das EU-Parlament voraussichtlich eine Resolution verabschieden, die die Weiterarbeit an dem Abkommen untersagt, solange die Strafmaßnahmen in Kraft sind. ari
China hat offenbar die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, nicht an einer von Deutschland, den USA und Großbritannien geplanten Veranstaltung zur Situation der Uiguren in Xinjiang teilzunehmen. Chinas UN-Botschaft wirft den Veranstaltern vor, “Menschenrechtsfragen als politisches Werkzeug zu benutzen, um sich in Chinas innere Angelegenheiten wie Xinjiang einzumischen”, berichtete Reuters. “Sie sind besessen davon, eine Konfrontation mit China zu provozieren”, hieß es demnach in dem Schreiben. Die Online-Veranstaltung könne “nur zu mehr Konfrontation führen”.
Die UN-Botschafter Deutschlands, der USA und Großbritanniens wollen am Mittwoch im Rahmen eines virtuellen Treffens mit dem Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Ken Roth, und der Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, sprechen. Die Teilnehmer wollen gemeinsam für die Menschenrechte der muslimischen Minderheiten in Xinjiang eintreten, hieß es in der Einladung laut Berichten. ari
Die Raketentrümmer der chinesischen Marsrakete sind harmlos in den Indischen Ozean gestürzt. Der größte Teil sei beim Wiedereintritt verglüht, teilte Chinas Raumfahrtorganisation am Sonntag mit. Zuvor hatte es Warnungen vor einem “unkontrollierten” Eintritt in die Erdatmosphäre gegeben. Die chinesische Raketentechnik steht in der Kritik, weil sich die Raketenstufen nicht gezielt auf einer vorgegebenen Umlaufbahn ablegen lassen. China bezeichnet das Vorgehen dagegen als branchenüblich. Jährlich fallen rund 100 Tonnen Weltraumschrott auf die Erde. fin
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dem Covid-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt. “Als neuer Impfstoff im Arsenal der Pandemiebekämpfung hat er das Potenzial, den Zugang zu Impfstoffen zu erhöhen”, sagte die WHO-Vizechefin Mariângela Simão. Die Organisation erwarte nun, dass der Hersteller einen Betrag zur gemeinsamen Impfkampagne Covax leiste. Inspektoren der WHO haben die Produktionsanlagen besucht und keine Defizite gefunden. Die Auswertung der Studien zur Erprobung des Wirkstoffs habe ergeben, dass er sicher und wirksam sei. Während das Produkt von Sinopharm eine gute Presse hat, ranken sich Zweifel um die Wirksamkeit des Konkurrenzprodukts von Sinovac (China.Table berichtete). Für diesen steht die WHO-Zulassung noch aus. fin
Präsident Xi Jinping hat sein politisches Programm bekräftigt, China eigenständiger zu machen. Die Welt sei in “Aufruhr” und China müsse daher größere Autarkie anstreben, sagte er in einer Rede, die nun in der Parteitschrift Qiushi erschienen ist. Solche Aussagen des Staats- und Parteichefs gelten in China als Handlungsanweisungen an Kader auf allen Ebenen. Weltweit finden “grundlegende und beispiellose Veränderungen” statt, so Xi. Es sehe so aus, “als ob diese Situation noch einige Zeit andauern wird”. Sein Land müsse eine neue Balance zwischen Öffnung gegenüber der Welt und größerer Unabhängigkeit erreichen. “Solange wir auf eigenen Füßen stehen und selbstständig sind, daheim einen lebendigen Strom von Waren und Dienstleistungen aufrechterhalten, werden wir unbesiegbar sein – egal wie die Stürme international wechseln”, gibt die Nachrichtenagentur dpa seine Worte wider. Die Globalisierung befinde sich auf dem Rückzug. fin
Das erste Quartal ist für deutsche Dax-Unternehmen in China überwiegend gut verlaufen – vor allem im Vergleich zu anderen Weltgegenden, die sich fest im Griff der dritten Covid-Welle befanden.
Adidas konnte in China seinen Umsatz um 156 Prozent steigern. Der mögliche Effekt eines Boykottaufrufs im April ist hier noch nicht enthalten; er fällt ins zweite Quartal. Berichten zufolge sollen die Onlinebestellungen kurzzeitig gesunken sein.
Die Marke Audi hat 45 Prozent seiner Autos (207.000 von weltweit 463.000 Stück) in China verkauft. Der hohe Absatz dort hob das Konzernergebnis nach einem schwachen Jahr 2020 wieder in die Gewinnzone.
Siemens hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres (ab Oktober) in China einen Auftragszuwachs von 29 Prozent verzeichnet. Auch der Umsatzerlös stieg dort im Vorjahresvergleich beachtlich um 865 Millionen Euro auf 3,8 Milliarden Euro. “Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und unserem Softwaregeschäft sowie, geografisch betrachtet, aus China”, teilte das Unternehmen mit. fin

Nach fast 150 Jahren im Land übernimmt erstmals ein chinesischer Manager die Verantwortung für das China-Geschäft des deutschen Industrie-Flaggschiffs Siemens: Xiao Song, 1965 geboren in Sichuan, Doktortitel in Ingenieurwissenschaften, errungen an der TU in Dortmund. Im Konzert der deutschen Großkonzerne ist diese Personalie ein Paukenschlag. Seit dem Desaster der Deutschen Bank, die noch 2019 für die korrupten Machenschaften ihres ehemaligen chinesischen Topmanagers im Land vor mehr als zehn Jahren zur Kasse gebeten wurde, haben nur wenige DAX-Unternehmen die Gesamtverantwortung ihres China-Geschäfts in die Hände von Führungspersonen aus der Volksrepublik gelegt. Fresenius Medical Care oder der Chemie-Konzern Covestro waren hier bisher eher die Ausnahmen.
Xiaos Berufung durch eine Ikone der europäischen Industrie zeigt die Professionalisierung der chinesischen Wirtschaft seit dem Beginn der Öffnungspolitik Ende der 70er-Jahre, einer Stunde Null für das Managementwissen im Land. Ist sie aber auch ein Zeichen dafür, dass sich der Bedarf an ausländischen Topmanagern im Land dem Ende entgegenneigt? Eine solche Entwicklung läge im Interesse der Regierung in Peking, die den Einfluss von außen verringern will. Ausländische Unternehmen, vor allem die großen, sollen weitgehend sinisiert werden: Made in Germany, gesteuert von Chinesen. Ganz ohne Risiko ist die Entscheidung von Siemens daher nicht. Kein Bürger der Volksrepublik ist seinem Staat gegenüber unabhängig.
Am 1. Mai löste Xiao seinen Vorgänger Lothar Herrmann an der Spitze von Siemens China ab. Xiao kennt das Haus bestens. Bis Ende 2015 war er schon einmal elf Jahre für das Unternehmen tätig, in verschiedenen Geschäftsfeldern: im später veräußerten Automobilsektor, im Bereich der Infrastruktur wie Transport, Logistik, Mobilität, Smart Grid oder Gebäudetechnik. “Natürlich bin ich weder in der Firma völlig neu, noch für viele unserer Kollegen, Kunden und Partner. Dennoch markiert dieser Tag für mich einen neuen Anfang“, schrieb er zum Dienstantritt in seinem LinkedIn-Profil. Er sei aufgeregt und demütig, zum Team zu stoßen. Und, so schreibt Xiao, er sei sich seiner “großen Verantwortung” bewusst.
Xiao trägt nun Verantwortung für das große China-Geschäft eines Unternehmens, das sein Image als Mischkonzern loswerden und nur noch als Technologie-Konzern wahrgenommen werden möchte. Das weltweit fast 300.000 Menschen beschäftigt und 2020 einen Jahresumsatz von 57,1 Milliarden Euro erzielte, davon zwölf Prozent in der Volksrepublik. Siemens ist seit 170 Jahren eines der bedeutendsten deutschen Unternehmen und hat vom Telegrafen bis zum MRT-Scanner wichtige Beiträge zur Technologiegeschichte geleistet.
In der Zentrale in München ist dem Vernehmen nach die Erwartung groß, dass Xiao sich der Bedeutung seiner Rolle bewusst ist, fast 150 Jahre nach den ersten Gehversuchen des Konzerns in der Volksrepublik. Der neue Unternehmenschef Roland Busch, der erst vor wenigen Wochen Joe Kaeser an der Spitze ablöste, richtete persönliche Grüße unter dem LinkedIn-Post an den neuen, alten Kollegen. “Lieber Song, willkommen zurück bei Siemens. Ich wünsche dir einen großartigen Start und viel Erfolg in deiner neuen Rolle. Ich freue mich darauf, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Bis bald, Roland”, schrieb Busch. Und Xiao verspricht: “Zusammen werden wir den Unterschied machen.“
Diesen Satz wiederholt Xiao etliche Male unter all den Glückwünschen und Willkommensgrüßen. Xiao stellt hier bewusst seine Qualitäten als langfristig verlässlicher Teamplayer heraus – eine Eigenschaft, die bei chinesischem Personal zuweilen vermisst wird. Er selbst eignete sich die deutsche Denkweise nicht nur während seines Studiums in Dortmund an, sondern auch in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten zunächst bei Siemens und zuletzt als Asien-Direktor des westfälischen Zulieferers Winkelmann Longchuan (SWL) Motorcomponents in Shanghai.
Xiao sei freundlich, verbindlich und kompetent, so spricht man in München über ihn. Siemens-Chef Busch ist überzeugt, den richtigen Mann erwählt zu haben. Seine Aufgabe wird es sein, die digitale Transformation der Kunden voranzutreiben, um deren Produktivität zu steigern und ihre Entwicklungszeiten zu verkürzen. Xiao wird auch daran gemessen werden, ob es ihm in stürmischen Zeiten globaler Handelsstreitigkeiten und Protektionismus gelingen wird, für Siemens die Lieferketten aufrechtzuerhalten, wenn es hart auf hart kommt. Xiao ist chinesischer Staatsbürger, seine Kontakte zu Staat und Politik sollen sich für Siemens in der Not auszahlen.
Der erste Versuch von Siemens, mit einem asiatischen Gesicht an der Spitze einem reibungslosen China-Geschäft den Weg zu ebnen, ging vor einigen Jahren noch schief. Cheng Mei-Wei wurde 2010 hier und da bereits als “erster Chinese” an der Spitze von Siemens im Land dargestellt. Doch Cheng stammt nicht aus der Volksrepublik, sondern aus Taiwan, und er hat die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das Experiment war relativ schnell wieder beendet, und Lothar Herrmann übernahm bis vorvergangene Woche die Geschäfte.
Die Deutsche Bank machte ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Topmanager Zhang Hongli, Rufname Lee, aus der Provinz Heilongjiang. Zhang war bestens verdrahtet, spielte Golf mit dem Sohn des früheren chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao. Seine Sporen in der Finanzindustrie hatte er sich bei der US-Investmentbank Goldman Sachs verdient. Ab 2003 übernahm er die China-Geschäfte der Deutschen Bank. Doch das Ganze endete in einem Skandal. Zhang zahlte offenbar Millionensummen an diverse Berater und Kontaktleute und brachte die Bank in Erklärungsnot. 2014 verklagte die Bank ihren ehemaligen Mitarbeiter. Im August 2019 zahlte das Unternehmen 16 Millionen US-Dollar Strafe an die US-Behörden.
Doch die Personalien Zhang und Xiao sind kaum zu vergleichen. Zhang übernahm damals die Geschäfte einer Bank, die ihren US-Mitbewerbern in China hoffnungslos hinterherlief, die sich etablieren wollte und bis auf ihren Ruf nichts zu verlieren hatte. Xiao dagegen übernimmt ein Unternehmen, das die Chinesen schon zu Zeiten des Kaiserreichs kannten, das an allen Stufen der technologischen Entwicklung des Landes beteiligt war, das Vertrauen chinesischer Kunden genießt, weil es deutsche Wertarbeit im Gepäck hat und schon lange in China profitabel wirtschaftet.
Das Magazin Cicero schrieb schon im Jahr 2010, als der Taiwaner Cheng das Ruder übernahm: “Doch gerade die enge Verflechtung mit Land und Leuten spricht bei vielen internationalen Unternehmen noch dringend gegen chinesische CEOs. Denn wo liegen ihre Interessen, und wem gehört ihre Loyalität?”
Die Frage wirkt heute angesichts vieler erfolgreicher chinesischer Führungskräfte in deutschen Diensten veraltet, ist aber zugleich aktueller denn je. Die Gesetzgebung in der Volksrepublik lässt Bürgern und Unternehmen immer weniger Spielraum, sich souverän gegenüber dem Staat zu behaupten. Aber solange die Zahlen in China stimmen, wird die Frage für Siemens kaum relevant sein. Und Probleme oder Skandale werden bei einer erprobten Personalie wie Xiao kaum zu erwarten sein. Marcel Grzanna
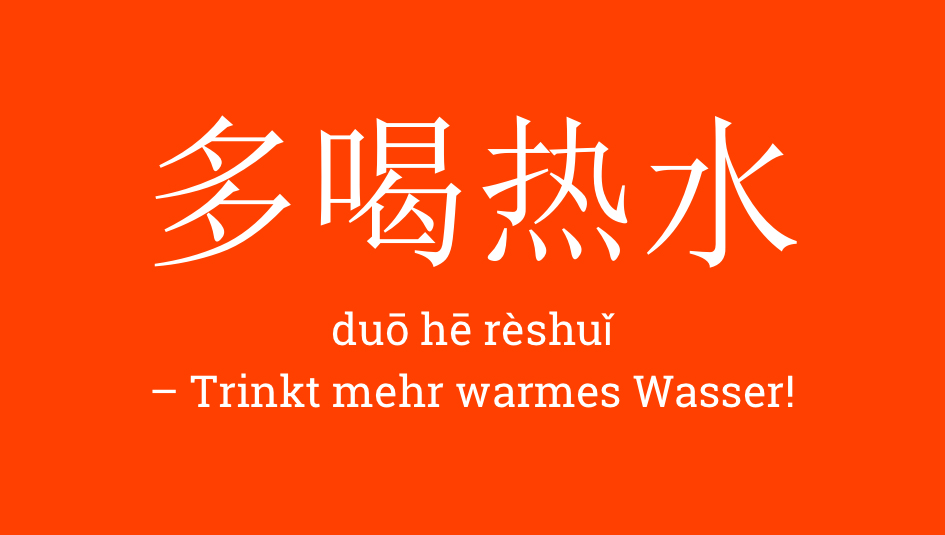
Erschöpft und ausgelaugt? Den Magen verdorben? Migräneanfall? Erkältung im Anflug? Homeoffice-Koller? Oder einfach alles zu viel? Trinken Sie mehr warmes Wasser! Das zumindest wird man Ihnen in China raten, wann immer die Sprache auf kleinere Wehwehchen und plötzliches körperliches Unbehagen kommt. Warmes beziehungsweise aufgekochtes Wasser – auf Chinesisch 热水 rèshuǐ oder 白开水 báikāishuǐ – gilt vielen Chinesen als wirksame Soforthilfe und beste Vorbeugung für verschiedenste Malaisen. Der gut gemeinte Ratschlag 多喝热水 duō hē rèshuǐ ist im Reich der Mitte deshalb zu einem geflügelten Wort geworden, ja hat sich gar zu einem Internet-Meme aufgeschwungen.
Digitale Sticker und Onlinebilder mit “Trinkt mehr warmes Wasser”-Slogan haben allerdings meist einen ironischen Beigeschmack. Denn schließlich ist der Warmwasser-Wink zwar sicher gut gemeint, entpuppt sich bei inflationärer Anwendung jedoch als floskelhaft “wässrig”. Insbesondere in Paarbeziehungen gilt er jungen Chinesen als echter Stimmungskiller. Spätestens seit eine Internetnutzerin sich in einem viel beachteten Onlinepost darüber echauffierte, ihr Freund ziehe sich ständig mit dem Warmwasser-Lösungsvorschlag aus der Affäre. Der Eintrag ging viral, schien er doch vielen Chinesinnen und Chinesen aus der Seele zu sprechen.
Auch im interkulturellen Austausch lauert das eine oder andere potenzielle “Watergate”. So reiben sich China-Neulinge beim Restaurantbesuch meist verdutzt die Augen, wenn sie auf die Bitte nach einem Glas Wasser (水 shuǐ) selbiges in heiß-dampfender Form gereicht bekommen. Wer in China auf eine erfrischende Abkühlung für die ausgedörrte Touristenkehle hofft, sollte stattdessen ein 冰水 bīngshuǐ (kaltes stilles Wasser) oder ein Sprudelwasser (苏打水 sūdǎshuǐ) bestellen. Auch der Hinweis 常温 chángwēn (normal- oder raumtemperiert) erweist sich als hilfreich. So ersparen sich Durstige unnötige Wartezeiten, bis sich das frisch aufgekochte Nass wieder auf gaumenfreundliche Temperaturen abgekühlt hat.
Chinesen auf der anderen Seite vermiest es nicht selten die Reiselaune, wenn sie in deutschen Hotelzimmern keinen Wasserkocher vorfinden. Denn der, so finden sie, gehört doch schließlich zur Grundausstattung! Heimische Hotels mit chinesischem Zulauf haben sich längst auf dieses Bedürfnis eingestellt und entsprechend nachgerüstet.
Die Vorliebe der Chinesen für aufgekochtes Wasser kommt übrigens nicht von ungefähr. Nach Auffassung der Traditionellen Chinesischen Medizin (中医 zhōngyī) liegen die Vorteile des natürlichen Heißgetränks auf der Hand: So soll der regelmäßige Verzehr von warmem Wasser nicht nur Magen und Darm gesund halten, die Durchblutung fördern, den Körper entgiften und das Hautbild verbessern, sondern auch Erkältungen vorbeugen. In diesem Sinne also: Duō hē rèshuǐ!
Verena Menzel 孟维娜 betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
