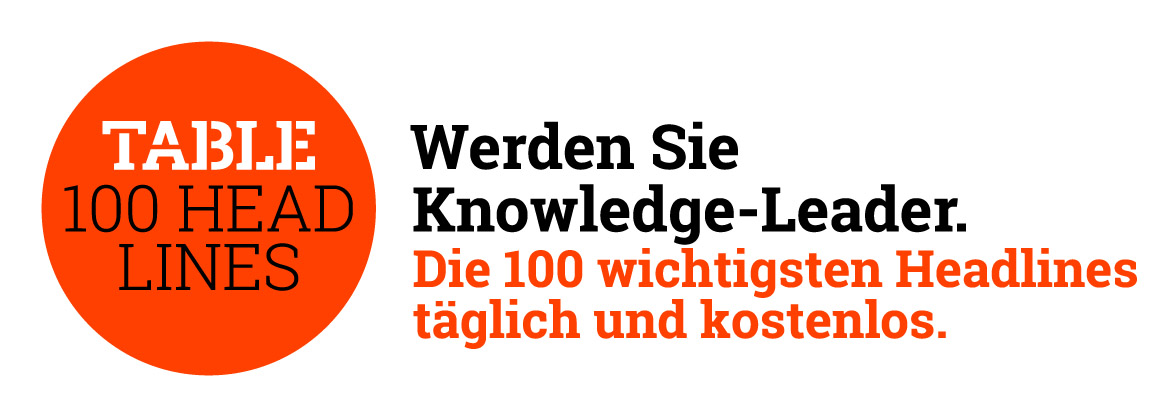es war eine Demonstration ökonomischer Stärke, die Chinas Premier Li Keqiang zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses am Freitag mit der Ankündigung verband, das Inlandsprodukt des Landes werden in diesem Jahr mindestens um sechs Prozent steigen. Am Sonntag folgte dann die Demonstration des geopolitischen Machtanspruchs durch den Außenminister. Mit deutlichen Worten verbat sich Wang Yi jede Form der Einmischung in “innere Angelegenheiten”, ob es um Hongkong oder Taiwan geht. Frank Sieren fasst die wesentlichen Details der jährlich stattfindenden Pressekonferenz zusammen.
Die angekündigten Wirtschaftswachstums- und Ausgabenpläne im Militärbereich kennen Sie als Leser von China.Table bereits seit Freitagfrüh. Felix Lee und Christiane Kühl analysieren nun die Hintergründe.
China ist mit Abstand der weltweit größte Kohlenstoffdioxyd-Emittent und es liegt nahe, dass die internationale Gemeinschaft mit größtem Interesse die ambitionierten Pläne Pekings zur Senkung der Emissionen verfolgt. Im 14. Fünfjahresplan, den der Nationale Volkskongress in dieser Woche debattiert, sucht man vergeblich nach konkreten Hinweisen dazu. Einzige Ausnahme: Die Vorhaben im Kernkraftbereich, wie Finn Mayer-Kuckuk schreibt. Zwanzig Gigawatt will China bis 2035 zubauen.
Einen erfolgreichen Wochenstart wünscht

Einmal im Jahr gibt der Außenminister Chinas zur Tagung des Nationalen Volkskongresses eine große Pressekonferenz, bei der westliche und chinesische Journalisten zugelassen sind. So auch gestern, anlässlich der vierten Tagung des 13. chinesischen Nationalen Volkskongresses (NVK). Gut 30 Fragen stellten die Medienvertreter – darunter umstrittene Themen: Die Provinz Xinjiang und der Vorwurf des Genozids an den Uiguren, Chinas Impfdiplomatie, das Sicherheitsgesetz in Hongkong, Taiwan, Indien, Myanmar, Klimawandel, Zwangsarbeit, die schwierigen Beziehungen zu den USA und die Grenzstreitigkeiten im südchinesischen Meer. Die Antworten des Außenministers fielen erwartungsgemäß routiniert aus. Wang macht gleich zu Beginn klar: Die “Partei ist der Anker der Diplomatie.”
Und im Rahmen dieser Diplomatie hatte Wang zunächst warme Worte für die EU übrig: Er lobte den Staatenbund dafür, dass er mit China zusammenarbeite und der Welt damit trotz der Corona-Pandemie “positive Signale” gebe. Er wies jedoch die Aussage der EU, China sei ein “systemischer Rivale”, zurück. Brüssel hadert bereits seit längerem mit seiner Position gegenüber Peking. Mit den Amtsantritt Joe Bidens als US-Präsident wurde von einer wieder aufflammenden transatlantischen Bindung ausgegangen – die EU will sich aber nicht als Juniorpartner der USA verstehen und betont ihre “strategische Autonomie”.
Es gebe kein Interesse Chinas daran, einen Keil zwischen Washington und Brüssel zu treiben, sagte Wang. “China ist bereitwillig, zu sehen, dass die EU ihre strategische Autonomie stärkt, den Multilateralismus aufrechterhält und sich der Koordinierung und Zusammenarbeit der Großmächte widmet”, sagte Wang.
Auch das Investitionsabkommen zwischen Brüssel und Peking wurde angesprochen. Wang reagiert auf Kritik, dass China sich bezüglich Zwangsarbeit und Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in dem bisher bekannten Abkommenstext lediglich “bemühen” muss, einen Fortschritt zumachen. Er könne klar sagen, dass China alle im Abkommen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen wird, einschließlich der Bemühungen, die einschlägigen ILO-Übereinkommen voranzutreiben, so Wang – konkrete Schritte und einen verbindlichen Zeitplan dafür, wie es unter anderem Mitglieder des Europaparlaments fordern, nannte er jedoch erneut nicht.
Der Außenminister verteidigte zudem die höchst umstrittenen Pläne für eine Wahlrechtsreform in Hongkong: “Loyalität zum Vaterland” sei eine Anforderung für Amtsträger in jeder Nation, so Wang. “Hongkong ist keine Ausnahme.” Das Vorhaben wird voraussichtlich zum Abschluss der Tagung am Donnerstag verabschiedet. Ein von Peking kontrolliertes Gremium könnte dann alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen, auf ihre politische Gesinnung prüfen, um sicherzustellen, dass es sich um “Patrioten” handelt. Der Außenminister gab keine weiteren Details bekannt. Er betonte jedoch, Hongkong behalte einen “hohen Grad an Autonomie.”
Auf die Frage eines Journalisten der staatlichen Global Times wies Wang den Vorwurf eines Völkermords an der muslimischen Minderheit der Uiguren im westchinesischen Xinjiang entschieden zurück. Es handele sich dabei um “Gerüchte“. Bei dem Thema Genozid denke man “an die amerikanischen Ureinwohner, afrikanische Sklaven, an die Juden in Europa und an die australischen Aborigines.” Damit hätten die Entwicklungen in Xinjiang nichts zu tun, so Wang. Die Bevölkerung und die Wirtschaftskraft der Region würden stetig wachsen.
Vielmehr würden “antichinesische Elemente Falschnachrichten fabrizieren” und “Lügen anhäufen”, sagte Wang. Diese würden dann von westlichen Politikern übernommen, die darauf abzielten, die Sicherheit und Stabilität in der Region zu untergraben und Chinas Entwicklung zu behindern. “Die Behauptung, dass es Völkermord in Xinjiang gibt, könnte nicht abwegiger sein”, fasste Wang seine Position zusammen.
Menschenrechtsgruppen schätzen, dass Hunderttausende Uiguren, Kasachen, Hui und andere Mitglieder muslimischer Minderheiten in Xinjiang in Umerziehungslager gebracht worden sind, Peking spricht dabei von sogenannten Fortbildungszentren. Der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo hatte einen Tag vor seinem Amtsabtritt den Vorwurf erhoben, Peking begehe in Xinjiang einen “Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.” Auch Pompeos Nachfolger Antony Blinken behielt diese Bezeichnung für die Vorgänge in Xinjiang bei. Das kanadische und das holländische Parlament werfen der chinesischen Regierung inzwischen vor, einen Völkermord begangen zu haben. Die Positionen sind für die Regierungen der beiden Länder nicht bindend. Beide Regierungschefs übernehmen die Formulierung “Völkermord” in Bezug auf Xinjiang bisher nicht.
Zu den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten machte der Außenminister eine direkte Ansage: Die Amerikaner sollten aufhören, sich in die “inneren Angelegenheiten Chinas” einzumischen. Die Chinesen wüssten selbst, was für sie gut sei, so Wang. Dennoch sei Peking daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den USA auf Basis einer Win-Win-Situation “zu vertiefen.”
Wang forderte die USA mit deutlichen Worten auf, ihre offiziellen Kontakte zu Taiwan einzustellen. Das “Ein-China-Prinzip” sei Grundlage der Beziehungen mit Washington und eine “rote Linie, die nicht überschritten werden sollte”, so der Außenminister. Er hoffe, dass sich die neue US-Regierung unter Präsident Biden klar von der Politik seines Vorgängers Donald Trump abwende. Taiwan sei ein untrennbarer Teil Chinas und müsse “wiedervereinigt” werden.
Eine Richtungsänderung Washingtons in Bezug auf Taiwan war bisher aber nicht zu erkennen – eher im Gegenteil: US-Präsident Biden hatte die Vertreterin Taipehs offiziell zu seiner Amtseinführung eingeladen. Das erste Mal in Jahrzehnten. Eine Videokonferenz zwischen der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, und Taiwans Präsidentin Tsai Yin-wen hatte in Peking zudem für Verstimmung gesorgt.
Auch zum Putsch in Myanmar äußerte sich der Außenminister auf der Pressekonferenz, die live im Internet übertragen wurde: “Es hat unmittelbaren Vorrang, weiteres Blutvergießen und Konfrontation zu vermeiden.” Er rief alle Beteiligten zum Dialog auf. China respektiere die Souveränität Myanmars und “den Willen des Volkes.” Zudem unterstütze Peking die Vermittlungsbemühungen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN nach dem Prinzip der Nicht-Einmischung.
Der Militärputsch hat Peking in ein Dilemma gebracht. Es verfolgt strategische und wirtschaftliche Interessen in dem Nachbarland. Peking hat sowohl der Militärjunta in Naypyidaw den Rücken gestärkt, als auch sich auffällig um die demokratisch gewählte faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi bemüht.
Bei der Pressekonferenz Wangs sind nicht nur die Fragen selbst interessant, sondern auch, wer sie in welcher Reihenfolge stellen darf. Die erste Frage eines Ausländers kam in diesem Jahr von einem russischen Medienvertreter. Man kämpfe Schulter an Schulter nicht nur gegen das Coronavirus, sondern auch gegen das “politische Virus”, betonte Wang in Richtung Russland. Anschließend wurden erst Fragen zur Kooperation mit Afrika, den USA und die Rolle der Vereinten Nationen gestellt – dann erst folgte Europa.
Chinas Militärbudget gilt als Barometer, wie entschlossen das Land sein Militär stärken will. Und das ist gerade in diesen Zeiten einer gewachsenen Ungewissheit bedeutsam: Die USA und Europa sehen China zunehmend als strategischen Rivalen und beobachten Pekings Aktivitäten etwa im Südchinesischen Meer – einer der meistbefahrenen internationalen Seewege – und an der Taiwanstraße mit Argusaugen. Zu Beginn des Nationalen Volkskongresses (NVK) teilte das chinesische Finanzministerium nun mit, dass der Militäretat in diesem Jahr um 6,8 Prozent auf rund 1,35 Billionen Yuan (umgerechnet 208 Milliarden Dollar beziehungsweise 175 Milliarden Euro) steigen wird.
Die geplante Erhöhung ist damit etwas mehr als das von Ministerpräsident Li Keqiang in seiner Rede ebenfalls am Freitag anvisierte Wirtschaftswachstum von “über sechs Prozent”. Im vergangenen Jahr hatte China die Verteidigungsausgaben trotz Corona-Pandemie um 6,6 Prozent angehoben, vor zwei Jahren um 7,5 Prozent. Die Zuwachsrate hat sich also nicht wesentlich verändert.
Experten im Westen gehen allerdings davon aus, dass das jährliche offizielle Budget nicht alle Verteidigungsausgaben enthält, weil manche Militär-Posten anderen Haushalten zugeordnet werden. Das sind zwar teilweise recht banale Posten – nach Recherchen des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) etwa Geld für die paramilitärische Bewaffnete Volkspolizei, sowie für militärnahe Forschung, Bauprojekte oder Pensionen. Anders als früher sind laut SIPRI Waffenkäufe im Ausland, etwa Russland, heute im offiziellen Budget enthalten.
Dennoch geht es durchaus um größere Summen, die nicht im Militärbudget auftauchen. Das angesehene Fachmagazin Janes schätzt, dass die tatsächlichen Ausgaben 2021 um rund 25 Prozent höher liegen werden als das offizielle Budget – und zwar bei umgerechnet etwa 262 Milliarden Dollar.
Unstrittig ist, dass China seit Jahren daran arbeitet, das Militär zu modernisieren. Die Zahl der aktiven Soldaten wurde in den letzten 40 Jahren von sechs auf zwei Millionen gesenkt. Parallel setzte Peking verstärkt auf Technologie und moderne Waffensysteme. So hat China in den letzten Jahren nach Berichten der South China Morning Post zum Beispiel die Entwicklung fortschrittlicher Kampfflugzeuge der sechsten Generation, sowie von Lasergewehren, Quantenradarsystemen, neuen Tarnkappen-Materialien, autonomen Kampfrobotern, Orbitalraumfahrzeugen und biologischen Technologien wie angetriebene Exoskelette, vorangetrieben. Chinas 2017 in Betrieb genommener Tarnkappenbomber J-20 wird mit dem US-Kampfjet F-22 der 5. Generation verglichen.
China besitzt inzwischen zwei Flugzeugträger; zwei weitere sind im Bau. Die Zahl der Atomsprengköpfe wird auf 200-300 geschätzt – etwa so viele wie Frankreich oder Großbritannien. 2017 gründete China zudem in Djibouti eine strategisch günstig am Horn von Afrika gelegene Militärbasis.
Ministerpräsident Li Keqiang kündigte in seiner Rede am Freitag an, China werde die militärische Ausbildung und die allgemeine Bereitschaft für den Ernstfall verbessern. “Wir werden die strategische Leistungsfähigkeit des Militärs verbessern, die Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen unseres Landes zu schützen“, sagte Li. China werde verteidigungsbezogene Wissenschaft, Technologie und Industrie sowie das System für die Mobilisierung im Verteidigungsfall verbessern.
Im 14. Fünfjahresplan (2021-2015) heißt es, China werde den Übergang von einer “Mechanisierung” hin zu “Informationisierung” und “Intelligentisierung” der Volksbefreiungsarmee (VBA) beschleunigen. “Dies weist auf eine Verlagerung von der Modernisierung militärischer Plattformen hin zur Einführung digitaler und vernetzter Systeme, sowie auf eine Integration ‘intelligenter’ Systeme unter Verwendung von Technologien wie künstlicher Intelligenz hin”, schreibt Janes.
Das alles passt zu Präsident Xi Jinpings Plan, die VBA bis 2027 – ihrem 100. Gründungsjahr – zu einer modernen Streitmacht umzubauen. Fernziel Chinas ist es, Streitkräfte auf Augenhöhe mit dem US-Militär zu kreieren. Dieser Aufbau militärischer Macht “ist nicht gegen andere Nationen gerichtet und stellt keine Bedrohung für sie dar”, sagte NVK-Sprecher Zheng Yesui am Freitag. China betont stets, dass sein Militär allein der Verteidigung diene. Im Verteidigungsweißbuch von 2019 heißt es, dass “China eher Partnerschaften als Allianzen befürwortet und sich keinem Militärblock anschließt”.
Dennoch steigen die Spannungen in der Region, denn manche Nachbarn sehen Chinas Verhalten als zunehmend aggressiv an. So gibt es Territorialkonflikte mit Vietnam oder den Philippinen im Südchinesischen Meer. China und Taiwan beanspruchen die von Japan kontrollierte, unbewohnte Senkaku-Inselgruppe. An Chinas Grenze zu Indien im Himalaya kam es seit Mai 2020 immer wieder zu Scharmützeln.
Parallel erhöht China den Druck auf das als abtrünnige Provinz angesehene Taiwan, etwa durch Manöver oder das Eindringen in den taiwanesischen Luftraum. Peking behält sich eine gewaltsame Eroberung Taiwans vor und hat ein gewaltiges Raketenarsenal an der Küste gegenüber der Insel stationiert. Doch bislang steht die Stärke der US-Präsenz in Ostasien derartigen Plänen entgegen. Auch 2021 betragen die US-Militärausgaben mit weit über 700 Milliarden Dollar ein Vielfaches jener Chinas.
“China wird auch auch in Zukunft in ausgefeiltere Technologien und Waffen investieren, um eine überlegene Gruppe von Gegnern – die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten – abzuschrecken und möglicherweise zu bekämpfen”, sagte Bates Gill, Professor für Asien. Pazifische Sicherheitsstudien an der australischen Macquarie University, der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Es geht aber nicht nur um Technologie. Es geht auch darum, militärische Theorien, Formationen, Personal und strategisches Management zu modernisieren, wie der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, Xu Qiliang, in einem offiziellen Handbuch zu den Militärplänen bis 2025 schrieb. Die VBA müsse “proaktiver gestalten, wie Krieg geführt wird”, anstatt nur auf Konflikte zu reagieren, so Xu.
Dass die Streitkräfte nun auch für den – wie Li Keqiang sagte – Schutz von “Entwicklungsinteressen” Chinas zuständig sind, ist neu und steht in der Anfang Januar in Kraft getretenen Novelle des Verteidigungsgesetzes. “Dies legt nahe, dass China nun alle seine Investitionen und wirtschaftlichen Aktivitäten im In- und Ausland als militärisch schutzwürdig erachtet”, schrieb Christian Le Miere, Gründer der Strategieberatung Arcipel, kürzlich in der South China Morning Post. So sei nun denkbar, dass chinesische Truppen etwa zum Schutz von “Belt and Road”-Projekten vor Angriffen lokaler Separatisten nach Pakistan entsandt werden oder chinesische Kriegsschiffe Frachter im Persischen Golf eskortieren.
Eigentlich waren die meisten Ökonomen davon ausgegangen, dass Chinas Führung auch in diesem Jahr kein Wachstumsziel ausgibt. So hatten es die Kader der KP Chinas im vergangenen Jahr gehandhabt mit der Begründung, im Pandemie-Jahres gebe es zu viele Unwägbarkeiten; die Erwartungen ließen sich kaum erfüllen. Mit rigorosen Maßnahmen gelang es China aber schon im vergangenen Sommer die Pandemie einzudämmen.
Nach einem heftigen Einbruch im ersten Quartal 2020 zog die chinesische Wirtschaft schon im Sommer wieder an. Am Ende des Jahres war China die einzige große Volkswirtschaft, die mit 2,3 Prozent nennenswertes Wachstum hatte. Während Europa und andere Regionen weiter mit der Pandemie ringen, kündigte Chinas Regierungschef Li Keqiang nun zur Überraschung der Experten beim Nationalen Volkskongress für dieses Jahr ein Wachstumsziel von “mehr als sechs Prozent” an.
Diese Zielvorgabe gilt noch als konservativ. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet gar mit 8,1 Prozent. Das ist zwar immer noch weit entfernt von den Nullerjahren mit über einige Jahre hinweg durchgehend zweistelligen Wachstumsraten. Es wäre aber das höchste Wachstum seit 2014. “Keine Frage”, sagte Markus Taube Professor für Ostasienwirtschaft an der Mercator School of Management in Duisburg, vergangene Woche in einem Vortrag zur Wirtschaftspolitik. “Die chinesische Volkswirtschaft ist wieder am boomen.”
Vor allem Chinas Exportwirtschaft hebt ab: Sie machte seit Jahresbeginn einen Sprung um Plus 60,6 Prozent im Vorjahresvergleich, teilte die Zollverwaltung am Sonntag in Peking mit. Dieser extrem hohe starke Zuwachs ist zwar auch auf den niedrigen Vergleichswert der beiden Vorjahresmonate zurückzuführen. China war Anfang 2020 als erstes Land vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Die Führung ließ daraufhin in weiten Teilen des Landes die Fabriken schließen und stellte auch den Reiseverkehr über Wochen fast komplett ein. Doch Chinas Ausfuhren waren auch schon im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,1 Prozent gestiegen. Der Exportboom ist also mehr als nur ein Ausgleich zum Einbruch im ersten Quartal 2020. “Alle Indikatoren, die wichtig sind, zeigen nach oben”, sagt China-Ökonom Tauber.
Der neue Fünfjahresplan, den die rund 3.000 Delegierten in den kommenden Tagen auf dem Nationalen Volkskongress verabschieden wollen, enthält zwar keine konkrete Wachstumszahl für den gesamten Zeitraum von 2021 bis 2025. Regierungschef Li Keqiang kündigte in seiner Rede lediglich an, dass das durchschnittliche Wachstum in einem “angemessenen” Rahmen gehalten werden solle. Es sei jedoch offensichtlich, dass das Wachstum über sechs Prozent liegen werde, sagte Regierungsberater Yao Jingyuan der Nachrichtenagentur Reuters. Der neue Fünfjahresplan sieht bis 2025 Investitionen in Technik und Infrastruktur zwischen 10 und 17,5 Billionen Yuan vor, das entspricht etwa 1,3 bis 2,3 Billionen Euro.
Im Umfeld der Regierung wird denn auch darauf verwiesen, dass die Führung den Ball absichtlich flach halte. Ihr gehe es um Stabilität und nicht darum, die Erwartungen eines ungestümen Aufschwungs zu fördern. Diese könnten schließlich zu höherer Verschuldung und Risikoneigung führen. “Die Absicht ist, den Menschen zu sagen, dass wir uns auf qualitativ höherwertiges Wachstum konzentrieren sollten”, sagte Regierungsberater Yao.
Doch obwohl Funktionäre wie Yao die Zahl von sechs Prozent herunterspielen, kann immer noch genau das passieren, was die Führung befürchtet: ein Überschießen des Wachstums. Die Gefahr einer Überhitzung der chinesischen Wirtschaft ist durchaus gegeben. Die chinesischen Aktienmärkte sind derzeit sehr hoch bewertet, die Immobilienpreise in vielen Großstädten ebenso. Die Wachstumsrate war von einst zweistelligen Prozentzahlen in den Nuller-Jahren stetig zurückgegangen und lag in den Jahren vor der Pandemie bei rund sechs Prozent. Westliche Medien hatten seinerzeit zwar herausgestellt, dass es sich um die niedrigsten Wachstumszahlen seit mehr als 30 Jahren handelte. Damit hatten sie zwar Recht. Doch sie vergessen dabei, dass ein Plus von sechs Prozent für eine große, hochentwickelte Volkswirtschaft einen viel größeren Zuwachs bedeutet, als zehn Prozent damals für das viel ärmere China das Jahres 2010.
Sollte Chinas Wirtschaft tatsächlich um über acht Prozent oder mehr wachsen dann droht regelrechte Überhitzung wie schon nach den gigantischen Konjunkturprogrammen der chinesischen Führung als Antwort auf die Weltfinanzkrise von 2009. Überkapazitäten insbesondere in Staatsunternehmen waren die Folge. Die Konsequenzen der Fehlentwicklungen sind zum Teil bis heute nicht überwunden.
Zehn Jahre nach Fukushima: Während sich Deutschland für seine Entscheidung beglückwünscht, aus der Kernkraft ausgestiegen zu sein, will China wieder so richtig loslegen. Im bisher veröffentlichten Zahlenwerk zum 14. Fünfjahresplan sind für den Reaktor-Ausbau vergleichsweise präzise Zahlen genannt, während andere Ziele noch eher vage formuliert sind.
Demnach sollen im Jahr 2035 landesweit Meiler mit einer Leistung von 70 Gigawatt stehen. Da der derzeitige Stand dem jüngsten Statistik-Bericht zufolge bei knapp 50 Gigawatt steht, ist für die kommenden anderthalb Jahrzehnte ein Ausbau in der Größenordnung von 20 Gigawatt geplant. Das Land will zudem international als Reaktorbauer auftreten – mit eigener Technik.
Der angepeilte Aufbau von 20 Gigawatt neuer Leistung entspricht ungefähr 20 neuen Reaktoren in der derzeit in China gebräuchlichen Größenklasse oder rund 15 Reaktoren vom Typ Biblis. Damit beschleunigt sich das größte Nuklearprogramm der Welt wieder. Während des abgelaufenen Fünfjahresplans wurden 16 Reaktoren fertiggestellt, zum neuen Fünfjahresplan legen die Planer mit rund 20 Einheiten also wieder eine kräftige Schippe drauf.
Die Katastrophe von Fukushima hatte auch den chinesischen Atomambitionen zeitweilig einen Dämpfer verpasst und hektische Sicherheitsüberprüfungen ausgelöst. Vor Fukushima war kurzzeitig bereits die Rede von 130 Gigawatt installierter Leistung bis 2030. Der aktuelle Plan ist also immer noch ambitioniert, liegt aber deutlich hinter den extremen Plänen der Vergangenheit. Das ist dem Politbüro enorm wichtig. Schließlich hatte die Katastrophe von Tschernobyl nach allgemeiner Einschätzung sehr zum Untergang der Sowjetunion beigetragen: Ein Nuklearunfall als KP-Killer? Die Ingenieure der staatlichen Atomkonglomerate konnten die Führung jedoch überzeugen, dass keine echte Gefahr für einen Unfall bestehe.
Die Kernkraft gilt den Technokraten an der Spitze nun wieder als Lösung für mehrere Probleme. Der Umstieg auf Elektromobilität und andere Energiesysteme ohne Ausstoß von Feinstaub und Kohlendioxid verstärkt die Stromnachfrage enorm. Der Umstieg auf die Wasserstoffwirtschaft wird den staatlichen Projektionen zufolge noch einmal enormen Druck auf die Versorgung ausüben. Der Wirkungsgrad der Wasserstoffherstellung ist schlecht. Am Anfang der Kette ist also ein hoher Einsatz von Rohenergie nötig. Auch wenn der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie enorm schnell vorankommt, können sie den Bedarf voraussichtlich nicht decken. Schließlich soll die Gesamtwirtschaft ungehindert weiterwachsen. China hat eigene Uranvorkommen, so dass die Kernkraft auch die Energiesicherheit stärkt.
Zur Verwirrung deutscher Beobachter zählt China die Kernkraft in der Statistik zu den alternativen, ökologischen Energiequellen – also in einer Kategorie mit Sonne, Wind und Wasser. Schließlich entsteht bei der eigentlichen Stromerzeugung kein Kohlendioxid. Dass – anders als bei Wind und Sonne – hinterher ein Entsorgungsproblem bleibt, scheint hier nicht im Vordergrund zu stehen.
Wie einst Deutschland und heute noch Japan strebt China grundsätzlich einen weitgehend geschlossenen Brennstoffkreislauf an. Die bereits laufenden Wiederaufbereitungseinrichtungen stehen vor allem in der bitterarmen, abgelegenen Provinz Gansu – hier sind gut bezahlte Industriearbeitsplätze hoch willkommen, während die Bevölkerungsdichte gering ist. Aus abgebrannten Brennstäben entstehen hier schmutzigere, aber brauchbare neue Brennstäbe. Weitere große Anlagen sollen während der Laufzeit des 14. Fünfjahresplans in schneller Folge öffnen. Wegen der kürzeren Transportwege sind sie nun auch an der Küste geplant. In der Provinz Jiangsu liegt ein Vorhaben allerdings nach Bürgerprotesten schon länger auf Eis. Fukushima ist bei der Bevölkerung eben doch noch in Erinnerung.
Zudem bleibt ein Anteil Müll trotz aller Aufbereitung übrig. Ein Teil davon lagert derzeit in einer Anlage 25 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Lanzhou, andere warten an Kraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen auf die Entsorgung. Selbst China hat bisher noch kein geologisch sicheres Tiefenlager identifiziert – obwohl das autoritäre Regime anders mit Vorbehalten der Bevölkerung umgehen kann, und trotz der sehr vielfältigen Geographie. Der aktuelle Plan sieht vor, den Müll in feste Behälter einzugießen und in 500 Metern Tiefe in Granitformationen zu lagern. Ein Standort in der Wüste Gobi gilt als heißer Kandidat. Baubeginn soll 2040 sein.
In den Dokumenten des Nationalen Volkskongresses (NVK) schreibt sich die Führung nun vor, “die Kernkraft in geordneter Weise und unter Einhaltung strenger Sicherheitsvoraussetzungen” voranzutreiben. Tatsächlich sind die neuen chinesischen Reaktoren mehrere Generationen moderner als die Meiler in Fukushima oder Biblis – und damit objektiv deutlich sicherer. Die weitere Planung setzt vor allem auf die Modelle Hualong-1 und CAP1400. Sie sind von westlicher Technik abgeleitet und werden jetzt international als chinesische Eigenentwicklungen vermarktet. Sie haben all das, was in Fukushima gefehlt hat: passive Kühlung, die nicht mehr auf Stromversorgung angewiesen ist; ein echtes Nebeneinander von System, die füreinander einspringen können; doppeltes Containment; und einen keramischen Core-Catcher, der selbst bei einer Kernschmelze das Schlimmste verhindern soll. Künstliche Intelligenz in den Prozessleitrechnern kann helfen, menschliche Fehler auszugleichen. Kritiker halten jedoch auch die ganze neue Technik nur für eine unzureichende Versicherung gegen Unfälle – schließlich kann auch ein Szenario eintreten, an das einfach bisher keiner gedacht hat.
China plant einem Bericht zufolge, bis Ende Juni 40 Prozent seiner rund 1,4 Milliarden Einwohner gegen das Coronavirus zu impfen. Um das Ziel von rund 560 Millionen Geimpften zu erreichen, müsste die Volksrepublik das Tempo seiner Impfkampagne jedoch erhöhen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Bisher seien lediglich 3,5 Prozent der Bevölkerung geimpft. Laut Zhong Nanshan, einem hochrangigen medizinischen Berater der chinesischen Regierung, wurden demnach bis Ende Februar 52,5 Millionen Dosen an Corona-Impfstoffen verabreicht.
Wegen der frühzeitigen Kontrolle von Virus-Ausbrüchen sei das Impftempo derzeit noch niedrig, zitiert der Bericht Regierungsberater und Direktor für Infektionskrankheiten am Shanghai-Huashan-Krankenhaus, Zhang Wenhong. “Die Impfstoffkapazität ist jedoch sehr hoch und wird voraussichtlich bis Ende 2021 auf 2,1 Milliarden Dosen steigen.” China verfügt derzeit über vier im Inland entwickelte und hergestellte Impfstoffe, die für die Verwendung zugelassen sind.
Berichten chinesischer Staatsmedien zufolge arbeitet China derzeit an einer einfacheren Lagerung von Impfstoff: Demnach kann ein sich in der Entwicklung befindliches Vakzin bei einer Temperatur zwischen zwei und acht Grad für ein halbes Jahr gelagert werden. ari
China war die einzige große Volkswirtschaft mit einem Anstieg der Treibhausgasemissionen im Jahr 2020, wie eine neue Analyse der Beratungsfirma Rhodium Group zeigt. Gleichzeitig war die Volksrepublik im letzten Jahr auch die einzige große Volkswirtschaft deren Wirtschaft gewachsen ist – Schätzungen zufolge um 2,1 Prozent.
Gut 71 Prozent der chinesischen Treibhausgasemissionen stammt demnach aus dem Energiesektor, vor allem aus CO2-Emissionen durch Kohlekraftwerke: Sie sind für 57 Prozent der Emissionen aus dem Energiesektor verantwortlich. Infolge der Corona-Pandemie konzentrierte sich Peking auf einfach zu erzielendes Wirtschaftswachstum in der Schwerindustrie und im Bausektor. Die Stahlproduktion stieg um sieben Prozent, die Zementproduktion um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beide Sektoren sind sehr CO2-intensiv und trieben den Anstieg der Treibhausgasemissionen in die Höhe.
Der 14. Fünfjahresplan Pekings enthält keine Obergrenze für die zukünftigen Kohlenstoffemissionen und bleibt somit hinter den Erwartungen von Klimaexperten zurück. Das im Fünfjahresplan enthaltene Ziel, die Kohlenstoffemissionen um 18 Prozent in Relation zum Wirtschaftswachstum zu senken, wird bei einem China-typischen Wirtschaftswachstum sogar zu einer absoluten Erhöhung der CO2-Emissionen führen. Ein Beispiel: Bei einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von moderaten fünf Prozent pro Jahr bis 2025 dürften die CO2-Emissionen von 14,4 Gigatonnen Ende 2020 auf fast 15,1 Gigatonnen Ende 2025 steigen – und dennoch würde das Ziel der Senkung um 18 Prozent in Relation zum BIP erreicht. nib
Die EU warnt vor der von Peking angekündigten Änderung des Wahlrechts in Hongkong. Im Falle eines Inkrafttretens hätte eine solche Reform “möglicherweise weitreichende negative Folgen für demokratische Grundsätze und demokratisch gewählte Vertreter in Hongkong“, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Die EU fordere die Behörden in Peking auf, die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Reform des Wahlsystems von Hongkong “sorgfältig zu prüfen”. Gebe es eine “weitere ernsthafte Verschlechterung der politischen Freiheiten und Menschenrechte”, sei die EU bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen. Wie diese aussehen könnten, sagte Borrell nicht.
Den Delegierten des chinesischen Parlaments soll in der kommenden Woche ein Entwurf zur “Verbesserung des Wahlsystems der Sonderverwaltungszone Hongkong” vorgelegt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Eine Entscheidung dazu wird Borrell zufolge am 11. März erwartet.
Bereits zuvor war spekuliert worden, dass Peking den seit Freitag laufenden Kongress nutzen wird, um die Kontrolle über die Finanzmetropole Hongkong auszuweiten. In den vergangenen Wochen veröffentlichten chinesische Staatsmedien mehrere Artikel, in denen suggeriert wurde, dass in Hongkong “Schlupflöcher” im Wahlsystem gestopft werden müssten. Zudem erwähnten hochrangige Beamte, dass nur “überzeugte Patrioten” an der Regierung Hongkongs beteiligt sein sollten. ari

Im Gespräch mit Sigrun Abels spürt man sofort ihre Faszination für die chinesische Sprache und Kultur. Schnell spricht sie über die Herausforderung, immer wieder eine Haltung zu China und seiner Politik zu entwickeln. “Ich bin sehr an einem ausgewogenen China-Bild interessiert”, sagt die Sinologin. Sie gehöre weder in die Gruppe der “China-Versteher”, noch wolle sie “China-Bashing” betreiben. Sie sieht sich in der Mitte. “Und das ist eine schwierige Aufgabe.”
Seit fünf Jahren leitet die 50-Jährige das China Center an der TU Berlin. Eine wesentliche Aufgabe des 16-köpfigen Teams und zahlreicher Lehrbeauftragter ist es, Chinakompetenz zu vermitteln. “Sinologie für Nicht-Sinologen” nennt Abels das Angebot, das von ganz unterschiedlichen Menschen genutzt werde – von der Chemikerin über den Kunsthistoriker bis hin zum Start-up-Unternehmer.
Zugleich ist die gebürtige Duisburgerin Leiterin der deutschen Geschäftsstelle des Chinesisch-Deutschen Hochschulkollegs (CDHK) der Tongji-Universität Shanghai. Das CDHK bildet deutsche und chinesische Studierende bilingual in Masterstudiengängen in Elektrotechnik, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Wirtschaftswissenschaften aus. Jedes Jahr bietet Abels eine Summer School am CDHK in Shanghai an – wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischenkommt.
Dass das Studium der Sinologie ihr solide berufliche Perspektiven bieten würde, hatte sie nicht erwartet, als sie sich 1989 in Bochum einschrieb. “Kein Mensch hat daran gedacht, dass man da später wirklich Geld mit verdienen könnte”, sagt sie. Abels verbrachte ein Studienjahr in Nanjing – bewusst nicht in Peking oder Shanghai, wo viele andere Austauschstudenten waren. Eine prägende Figur im Studium war Helmut Martin, ihr späterer Doktorvater. Der 1999 verstorbene Sinologe pflegte enge Beziehungen zu Anhängern der Demokratiebewegung im chinesischen Festland und auf Taiwan. “Wir waren permanent, als Studenten schon, mit chinesischen Dissidenten in Berührung”, sagt Abels.
Nach dem Studium arbeitete sie als Journalistin bei der Deutschen Welle. Als Medientrainerin der Deutschen Welle Akademie war sie ebenfalls in China unterwegs. Für die Promotion kehrte sie zurück an die Ruhr-Universität Bochum. Ihr Thema: Die Rolle der Medien in China seit 1979. Zum chinesischen Mediensystem forscht sie bis heute, hinzugekommen ist das chinesische Wissenschaftssystem als Forschungsschwerpunkt.
Beide Bereiche seien “brisante Themen”, sagt Abels. Wenn sie etwa einen Fachartikel über die Situation der Medien in China schreibe, sei es unmöglich auszublenden, dass China in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen einen der letzten Plätze belege. Abels war Teil der Arbeitsgruppe, die für die Hochschulrektorenkonferenz Leitfragen zur Hochschulkooperation mit der Volksrepublik entwickelt hat. “Haltung aneignen” nennt sie dieses Bemühen, einen ausgewogenen Umgang in der Zusammenarbeit mit China zu finden. Sarah Schaefer
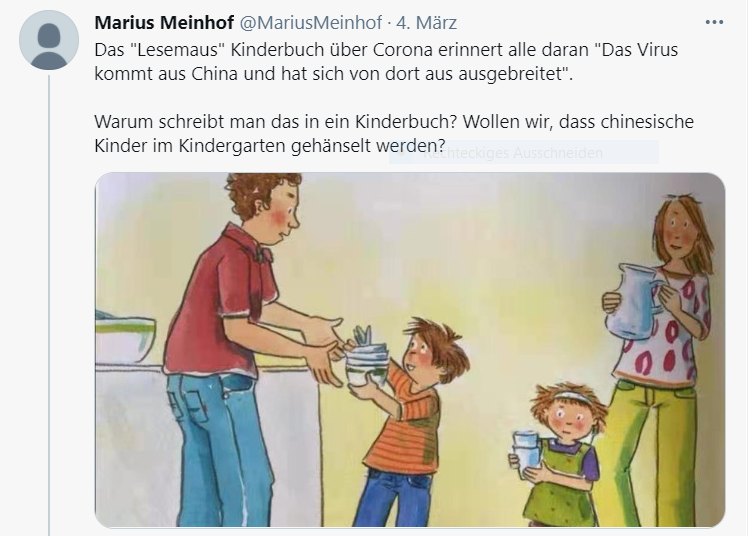
Der Carlsen-Verlag hat das Kinderbuch nach eigenen Angaben im Frühjahr 2020 konzipiert, um Eltern und Kindern Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags in Zeiten einer Pandemie zu geben. Der Verlag teilte am Freitag mit, dass er nach verschiedentlichen Hinweisen die Auslieferung des Buches gestoppt hat.
es war eine Demonstration ökonomischer Stärke, die Chinas Premier Li Keqiang zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses am Freitag mit der Ankündigung verband, das Inlandsprodukt des Landes werden in diesem Jahr mindestens um sechs Prozent steigen. Am Sonntag folgte dann die Demonstration des geopolitischen Machtanspruchs durch den Außenminister. Mit deutlichen Worten verbat sich Wang Yi jede Form der Einmischung in “innere Angelegenheiten”, ob es um Hongkong oder Taiwan geht. Frank Sieren fasst die wesentlichen Details der jährlich stattfindenden Pressekonferenz zusammen.
Die angekündigten Wirtschaftswachstums- und Ausgabenpläne im Militärbereich kennen Sie als Leser von China.Table bereits seit Freitagfrüh. Felix Lee und Christiane Kühl analysieren nun die Hintergründe.
China ist mit Abstand der weltweit größte Kohlenstoffdioxyd-Emittent und es liegt nahe, dass die internationale Gemeinschaft mit größtem Interesse die ambitionierten Pläne Pekings zur Senkung der Emissionen verfolgt. Im 14. Fünfjahresplan, den der Nationale Volkskongress in dieser Woche debattiert, sucht man vergeblich nach konkreten Hinweisen dazu. Einzige Ausnahme: Die Vorhaben im Kernkraftbereich, wie Finn Mayer-Kuckuk schreibt. Zwanzig Gigawatt will China bis 2035 zubauen.
Einen erfolgreichen Wochenstart wünscht

Einmal im Jahr gibt der Außenminister Chinas zur Tagung des Nationalen Volkskongresses eine große Pressekonferenz, bei der westliche und chinesische Journalisten zugelassen sind. So auch gestern, anlässlich der vierten Tagung des 13. chinesischen Nationalen Volkskongresses (NVK). Gut 30 Fragen stellten die Medienvertreter – darunter umstrittene Themen: Die Provinz Xinjiang und der Vorwurf des Genozids an den Uiguren, Chinas Impfdiplomatie, das Sicherheitsgesetz in Hongkong, Taiwan, Indien, Myanmar, Klimawandel, Zwangsarbeit, die schwierigen Beziehungen zu den USA und die Grenzstreitigkeiten im südchinesischen Meer. Die Antworten des Außenministers fielen erwartungsgemäß routiniert aus. Wang macht gleich zu Beginn klar: Die “Partei ist der Anker der Diplomatie.”
Und im Rahmen dieser Diplomatie hatte Wang zunächst warme Worte für die EU übrig: Er lobte den Staatenbund dafür, dass er mit China zusammenarbeite und der Welt damit trotz der Corona-Pandemie “positive Signale” gebe. Er wies jedoch die Aussage der EU, China sei ein “systemischer Rivale”, zurück. Brüssel hadert bereits seit längerem mit seiner Position gegenüber Peking. Mit den Amtsantritt Joe Bidens als US-Präsident wurde von einer wieder aufflammenden transatlantischen Bindung ausgegangen – die EU will sich aber nicht als Juniorpartner der USA verstehen und betont ihre “strategische Autonomie”.
Es gebe kein Interesse Chinas daran, einen Keil zwischen Washington und Brüssel zu treiben, sagte Wang. “China ist bereitwillig, zu sehen, dass die EU ihre strategische Autonomie stärkt, den Multilateralismus aufrechterhält und sich der Koordinierung und Zusammenarbeit der Großmächte widmet”, sagte Wang.
Auch das Investitionsabkommen zwischen Brüssel und Peking wurde angesprochen. Wang reagiert auf Kritik, dass China sich bezüglich Zwangsarbeit und Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in dem bisher bekannten Abkommenstext lediglich “bemühen” muss, einen Fortschritt zumachen. Er könne klar sagen, dass China alle im Abkommen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen wird, einschließlich der Bemühungen, die einschlägigen ILO-Übereinkommen voranzutreiben, so Wang – konkrete Schritte und einen verbindlichen Zeitplan dafür, wie es unter anderem Mitglieder des Europaparlaments fordern, nannte er jedoch erneut nicht.
Der Außenminister verteidigte zudem die höchst umstrittenen Pläne für eine Wahlrechtsreform in Hongkong: “Loyalität zum Vaterland” sei eine Anforderung für Amtsträger in jeder Nation, so Wang. “Hongkong ist keine Ausnahme.” Das Vorhaben wird voraussichtlich zum Abschluss der Tagung am Donnerstag verabschiedet. Ein von Peking kontrolliertes Gremium könnte dann alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen, auf ihre politische Gesinnung prüfen, um sicherzustellen, dass es sich um “Patrioten” handelt. Der Außenminister gab keine weiteren Details bekannt. Er betonte jedoch, Hongkong behalte einen “hohen Grad an Autonomie.”
Auf die Frage eines Journalisten der staatlichen Global Times wies Wang den Vorwurf eines Völkermords an der muslimischen Minderheit der Uiguren im westchinesischen Xinjiang entschieden zurück. Es handele sich dabei um “Gerüchte“. Bei dem Thema Genozid denke man “an die amerikanischen Ureinwohner, afrikanische Sklaven, an die Juden in Europa und an die australischen Aborigines.” Damit hätten die Entwicklungen in Xinjiang nichts zu tun, so Wang. Die Bevölkerung und die Wirtschaftskraft der Region würden stetig wachsen.
Vielmehr würden “antichinesische Elemente Falschnachrichten fabrizieren” und “Lügen anhäufen”, sagte Wang. Diese würden dann von westlichen Politikern übernommen, die darauf abzielten, die Sicherheit und Stabilität in der Region zu untergraben und Chinas Entwicklung zu behindern. “Die Behauptung, dass es Völkermord in Xinjiang gibt, könnte nicht abwegiger sein”, fasste Wang seine Position zusammen.
Menschenrechtsgruppen schätzen, dass Hunderttausende Uiguren, Kasachen, Hui und andere Mitglieder muslimischer Minderheiten in Xinjiang in Umerziehungslager gebracht worden sind, Peking spricht dabei von sogenannten Fortbildungszentren. Der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo hatte einen Tag vor seinem Amtsabtritt den Vorwurf erhoben, Peking begehe in Xinjiang einen “Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.” Auch Pompeos Nachfolger Antony Blinken behielt diese Bezeichnung für die Vorgänge in Xinjiang bei. Das kanadische und das holländische Parlament werfen der chinesischen Regierung inzwischen vor, einen Völkermord begangen zu haben. Die Positionen sind für die Regierungen der beiden Länder nicht bindend. Beide Regierungschefs übernehmen die Formulierung “Völkermord” in Bezug auf Xinjiang bisher nicht.
Zu den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten machte der Außenminister eine direkte Ansage: Die Amerikaner sollten aufhören, sich in die “inneren Angelegenheiten Chinas” einzumischen. Die Chinesen wüssten selbst, was für sie gut sei, so Wang. Dennoch sei Peking daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den USA auf Basis einer Win-Win-Situation “zu vertiefen.”
Wang forderte die USA mit deutlichen Worten auf, ihre offiziellen Kontakte zu Taiwan einzustellen. Das “Ein-China-Prinzip” sei Grundlage der Beziehungen mit Washington und eine “rote Linie, die nicht überschritten werden sollte”, so der Außenminister. Er hoffe, dass sich die neue US-Regierung unter Präsident Biden klar von der Politik seines Vorgängers Donald Trump abwende. Taiwan sei ein untrennbarer Teil Chinas und müsse “wiedervereinigt” werden.
Eine Richtungsänderung Washingtons in Bezug auf Taiwan war bisher aber nicht zu erkennen – eher im Gegenteil: US-Präsident Biden hatte die Vertreterin Taipehs offiziell zu seiner Amtseinführung eingeladen. Das erste Mal in Jahrzehnten. Eine Videokonferenz zwischen der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, und Taiwans Präsidentin Tsai Yin-wen hatte in Peking zudem für Verstimmung gesorgt.
Auch zum Putsch in Myanmar äußerte sich der Außenminister auf der Pressekonferenz, die live im Internet übertragen wurde: “Es hat unmittelbaren Vorrang, weiteres Blutvergießen und Konfrontation zu vermeiden.” Er rief alle Beteiligten zum Dialog auf. China respektiere die Souveränität Myanmars und “den Willen des Volkes.” Zudem unterstütze Peking die Vermittlungsbemühungen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN nach dem Prinzip der Nicht-Einmischung.
Der Militärputsch hat Peking in ein Dilemma gebracht. Es verfolgt strategische und wirtschaftliche Interessen in dem Nachbarland. Peking hat sowohl der Militärjunta in Naypyidaw den Rücken gestärkt, als auch sich auffällig um die demokratisch gewählte faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi bemüht.
Bei der Pressekonferenz Wangs sind nicht nur die Fragen selbst interessant, sondern auch, wer sie in welcher Reihenfolge stellen darf. Die erste Frage eines Ausländers kam in diesem Jahr von einem russischen Medienvertreter. Man kämpfe Schulter an Schulter nicht nur gegen das Coronavirus, sondern auch gegen das “politische Virus”, betonte Wang in Richtung Russland. Anschließend wurden erst Fragen zur Kooperation mit Afrika, den USA und die Rolle der Vereinten Nationen gestellt – dann erst folgte Europa.
Chinas Militärbudget gilt als Barometer, wie entschlossen das Land sein Militär stärken will. Und das ist gerade in diesen Zeiten einer gewachsenen Ungewissheit bedeutsam: Die USA und Europa sehen China zunehmend als strategischen Rivalen und beobachten Pekings Aktivitäten etwa im Südchinesischen Meer – einer der meistbefahrenen internationalen Seewege – und an der Taiwanstraße mit Argusaugen. Zu Beginn des Nationalen Volkskongresses (NVK) teilte das chinesische Finanzministerium nun mit, dass der Militäretat in diesem Jahr um 6,8 Prozent auf rund 1,35 Billionen Yuan (umgerechnet 208 Milliarden Dollar beziehungsweise 175 Milliarden Euro) steigen wird.
Die geplante Erhöhung ist damit etwas mehr als das von Ministerpräsident Li Keqiang in seiner Rede ebenfalls am Freitag anvisierte Wirtschaftswachstum von “über sechs Prozent”. Im vergangenen Jahr hatte China die Verteidigungsausgaben trotz Corona-Pandemie um 6,6 Prozent angehoben, vor zwei Jahren um 7,5 Prozent. Die Zuwachsrate hat sich also nicht wesentlich verändert.
Experten im Westen gehen allerdings davon aus, dass das jährliche offizielle Budget nicht alle Verteidigungsausgaben enthält, weil manche Militär-Posten anderen Haushalten zugeordnet werden. Das sind zwar teilweise recht banale Posten – nach Recherchen des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) etwa Geld für die paramilitärische Bewaffnete Volkspolizei, sowie für militärnahe Forschung, Bauprojekte oder Pensionen. Anders als früher sind laut SIPRI Waffenkäufe im Ausland, etwa Russland, heute im offiziellen Budget enthalten.
Dennoch geht es durchaus um größere Summen, die nicht im Militärbudget auftauchen. Das angesehene Fachmagazin Janes schätzt, dass die tatsächlichen Ausgaben 2021 um rund 25 Prozent höher liegen werden als das offizielle Budget – und zwar bei umgerechnet etwa 262 Milliarden Dollar.
Unstrittig ist, dass China seit Jahren daran arbeitet, das Militär zu modernisieren. Die Zahl der aktiven Soldaten wurde in den letzten 40 Jahren von sechs auf zwei Millionen gesenkt. Parallel setzte Peking verstärkt auf Technologie und moderne Waffensysteme. So hat China in den letzten Jahren nach Berichten der South China Morning Post zum Beispiel die Entwicklung fortschrittlicher Kampfflugzeuge der sechsten Generation, sowie von Lasergewehren, Quantenradarsystemen, neuen Tarnkappen-Materialien, autonomen Kampfrobotern, Orbitalraumfahrzeugen und biologischen Technologien wie angetriebene Exoskelette, vorangetrieben. Chinas 2017 in Betrieb genommener Tarnkappenbomber J-20 wird mit dem US-Kampfjet F-22 der 5. Generation verglichen.
China besitzt inzwischen zwei Flugzeugträger; zwei weitere sind im Bau. Die Zahl der Atomsprengköpfe wird auf 200-300 geschätzt – etwa so viele wie Frankreich oder Großbritannien. 2017 gründete China zudem in Djibouti eine strategisch günstig am Horn von Afrika gelegene Militärbasis.
Ministerpräsident Li Keqiang kündigte in seiner Rede am Freitag an, China werde die militärische Ausbildung und die allgemeine Bereitschaft für den Ernstfall verbessern. “Wir werden die strategische Leistungsfähigkeit des Militärs verbessern, die Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen unseres Landes zu schützen“, sagte Li. China werde verteidigungsbezogene Wissenschaft, Technologie und Industrie sowie das System für die Mobilisierung im Verteidigungsfall verbessern.
Im 14. Fünfjahresplan (2021-2015) heißt es, China werde den Übergang von einer “Mechanisierung” hin zu “Informationisierung” und “Intelligentisierung” der Volksbefreiungsarmee (VBA) beschleunigen. “Dies weist auf eine Verlagerung von der Modernisierung militärischer Plattformen hin zur Einführung digitaler und vernetzter Systeme, sowie auf eine Integration ‘intelligenter’ Systeme unter Verwendung von Technologien wie künstlicher Intelligenz hin”, schreibt Janes.
Das alles passt zu Präsident Xi Jinpings Plan, die VBA bis 2027 – ihrem 100. Gründungsjahr – zu einer modernen Streitmacht umzubauen. Fernziel Chinas ist es, Streitkräfte auf Augenhöhe mit dem US-Militär zu kreieren. Dieser Aufbau militärischer Macht “ist nicht gegen andere Nationen gerichtet und stellt keine Bedrohung für sie dar”, sagte NVK-Sprecher Zheng Yesui am Freitag. China betont stets, dass sein Militär allein der Verteidigung diene. Im Verteidigungsweißbuch von 2019 heißt es, dass “China eher Partnerschaften als Allianzen befürwortet und sich keinem Militärblock anschließt”.
Dennoch steigen die Spannungen in der Region, denn manche Nachbarn sehen Chinas Verhalten als zunehmend aggressiv an. So gibt es Territorialkonflikte mit Vietnam oder den Philippinen im Südchinesischen Meer. China und Taiwan beanspruchen die von Japan kontrollierte, unbewohnte Senkaku-Inselgruppe. An Chinas Grenze zu Indien im Himalaya kam es seit Mai 2020 immer wieder zu Scharmützeln.
Parallel erhöht China den Druck auf das als abtrünnige Provinz angesehene Taiwan, etwa durch Manöver oder das Eindringen in den taiwanesischen Luftraum. Peking behält sich eine gewaltsame Eroberung Taiwans vor und hat ein gewaltiges Raketenarsenal an der Küste gegenüber der Insel stationiert. Doch bislang steht die Stärke der US-Präsenz in Ostasien derartigen Plänen entgegen. Auch 2021 betragen die US-Militärausgaben mit weit über 700 Milliarden Dollar ein Vielfaches jener Chinas.
“China wird auch auch in Zukunft in ausgefeiltere Technologien und Waffen investieren, um eine überlegene Gruppe von Gegnern – die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten – abzuschrecken und möglicherweise zu bekämpfen”, sagte Bates Gill, Professor für Asien. Pazifische Sicherheitsstudien an der australischen Macquarie University, der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Es geht aber nicht nur um Technologie. Es geht auch darum, militärische Theorien, Formationen, Personal und strategisches Management zu modernisieren, wie der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, Xu Qiliang, in einem offiziellen Handbuch zu den Militärplänen bis 2025 schrieb. Die VBA müsse “proaktiver gestalten, wie Krieg geführt wird”, anstatt nur auf Konflikte zu reagieren, so Xu.
Dass die Streitkräfte nun auch für den – wie Li Keqiang sagte – Schutz von “Entwicklungsinteressen” Chinas zuständig sind, ist neu und steht in der Anfang Januar in Kraft getretenen Novelle des Verteidigungsgesetzes. “Dies legt nahe, dass China nun alle seine Investitionen und wirtschaftlichen Aktivitäten im In- und Ausland als militärisch schutzwürdig erachtet”, schrieb Christian Le Miere, Gründer der Strategieberatung Arcipel, kürzlich in der South China Morning Post. So sei nun denkbar, dass chinesische Truppen etwa zum Schutz von “Belt and Road”-Projekten vor Angriffen lokaler Separatisten nach Pakistan entsandt werden oder chinesische Kriegsschiffe Frachter im Persischen Golf eskortieren.
Eigentlich waren die meisten Ökonomen davon ausgegangen, dass Chinas Führung auch in diesem Jahr kein Wachstumsziel ausgibt. So hatten es die Kader der KP Chinas im vergangenen Jahr gehandhabt mit der Begründung, im Pandemie-Jahres gebe es zu viele Unwägbarkeiten; die Erwartungen ließen sich kaum erfüllen. Mit rigorosen Maßnahmen gelang es China aber schon im vergangenen Sommer die Pandemie einzudämmen.
Nach einem heftigen Einbruch im ersten Quartal 2020 zog die chinesische Wirtschaft schon im Sommer wieder an. Am Ende des Jahres war China die einzige große Volkswirtschaft, die mit 2,3 Prozent nennenswertes Wachstum hatte. Während Europa und andere Regionen weiter mit der Pandemie ringen, kündigte Chinas Regierungschef Li Keqiang nun zur Überraschung der Experten beim Nationalen Volkskongress für dieses Jahr ein Wachstumsziel von “mehr als sechs Prozent” an.
Diese Zielvorgabe gilt noch als konservativ. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet gar mit 8,1 Prozent. Das ist zwar immer noch weit entfernt von den Nullerjahren mit über einige Jahre hinweg durchgehend zweistelligen Wachstumsraten. Es wäre aber das höchste Wachstum seit 2014. “Keine Frage”, sagte Markus Taube Professor für Ostasienwirtschaft an der Mercator School of Management in Duisburg, vergangene Woche in einem Vortrag zur Wirtschaftspolitik. “Die chinesische Volkswirtschaft ist wieder am boomen.”
Vor allem Chinas Exportwirtschaft hebt ab: Sie machte seit Jahresbeginn einen Sprung um Plus 60,6 Prozent im Vorjahresvergleich, teilte die Zollverwaltung am Sonntag in Peking mit. Dieser extrem hohe starke Zuwachs ist zwar auch auf den niedrigen Vergleichswert der beiden Vorjahresmonate zurückzuführen. China war Anfang 2020 als erstes Land vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Die Führung ließ daraufhin in weiten Teilen des Landes die Fabriken schließen und stellte auch den Reiseverkehr über Wochen fast komplett ein. Doch Chinas Ausfuhren waren auch schon im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,1 Prozent gestiegen. Der Exportboom ist also mehr als nur ein Ausgleich zum Einbruch im ersten Quartal 2020. “Alle Indikatoren, die wichtig sind, zeigen nach oben”, sagt China-Ökonom Tauber.
Der neue Fünfjahresplan, den die rund 3.000 Delegierten in den kommenden Tagen auf dem Nationalen Volkskongress verabschieden wollen, enthält zwar keine konkrete Wachstumszahl für den gesamten Zeitraum von 2021 bis 2025. Regierungschef Li Keqiang kündigte in seiner Rede lediglich an, dass das durchschnittliche Wachstum in einem “angemessenen” Rahmen gehalten werden solle. Es sei jedoch offensichtlich, dass das Wachstum über sechs Prozent liegen werde, sagte Regierungsberater Yao Jingyuan der Nachrichtenagentur Reuters. Der neue Fünfjahresplan sieht bis 2025 Investitionen in Technik und Infrastruktur zwischen 10 und 17,5 Billionen Yuan vor, das entspricht etwa 1,3 bis 2,3 Billionen Euro.
Im Umfeld der Regierung wird denn auch darauf verwiesen, dass die Führung den Ball absichtlich flach halte. Ihr gehe es um Stabilität und nicht darum, die Erwartungen eines ungestümen Aufschwungs zu fördern. Diese könnten schließlich zu höherer Verschuldung und Risikoneigung führen. “Die Absicht ist, den Menschen zu sagen, dass wir uns auf qualitativ höherwertiges Wachstum konzentrieren sollten”, sagte Regierungsberater Yao.
Doch obwohl Funktionäre wie Yao die Zahl von sechs Prozent herunterspielen, kann immer noch genau das passieren, was die Führung befürchtet: ein Überschießen des Wachstums. Die Gefahr einer Überhitzung der chinesischen Wirtschaft ist durchaus gegeben. Die chinesischen Aktienmärkte sind derzeit sehr hoch bewertet, die Immobilienpreise in vielen Großstädten ebenso. Die Wachstumsrate war von einst zweistelligen Prozentzahlen in den Nuller-Jahren stetig zurückgegangen und lag in den Jahren vor der Pandemie bei rund sechs Prozent. Westliche Medien hatten seinerzeit zwar herausgestellt, dass es sich um die niedrigsten Wachstumszahlen seit mehr als 30 Jahren handelte. Damit hatten sie zwar Recht. Doch sie vergessen dabei, dass ein Plus von sechs Prozent für eine große, hochentwickelte Volkswirtschaft einen viel größeren Zuwachs bedeutet, als zehn Prozent damals für das viel ärmere China das Jahres 2010.
Sollte Chinas Wirtschaft tatsächlich um über acht Prozent oder mehr wachsen dann droht regelrechte Überhitzung wie schon nach den gigantischen Konjunkturprogrammen der chinesischen Führung als Antwort auf die Weltfinanzkrise von 2009. Überkapazitäten insbesondere in Staatsunternehmen waren die Folge. Die Konsequenzen der Fehlentwicklungen sind zum Teil bis heute nicht überwunden.
Zehn Jahre nach Fukushima: Während sich Deutschland für seine Entscheidung beglückwünscht, aus der Kernkraft ausgestiegen zu sein, will China wieder so richtig loslegen. Im bisher veröffentlichten Zahlenwerk zum 14. Fünfjahresplan sind für den Reaktor-Ausbau vergleichsweise präzise Zahlen genannt, während andere Ziele noch eher vage formuliert sind.
Demnach sollen im Jahr 2035 landesweit Meiler mit einer Leistung von 70 Gigawatt stehen. Da der derzeitige Stand dem jüngsten Statistik-Bericht zufolge bei knapp 50 Gigawatt steht, ist für die kommenden anderthalb Jahrzehnte ein Ausbau in der Größenordnung von 20 Gigawatt geplant. Das Land will zudem international als Reaktorbauer auftreten – mit eigener Technik.
Der angepeilte Aufbau von 20 Gigawatt neuer Leistung entspricht ungefähr 20 neuen Reaktoren in der derzeit in China gebräuchlichen Größenklasse oder rund 15 Reaktoren vom Typ Biblis. Damit beschleunigt sich das größte Nuklearprogramm der Welt wieder. Während des abgelaufenen Fünfjahresplans wurden 16 Reaktoren fertiggestellt, zum neuen Fünfjahresplan legen die Planer mit rund 20 Einheiten also wieder eine kräftige Schippe drauf.
Die Katastrophe von Fukushima hatte auch den chinesischen Atomambitionen zeitweilig einen Dämpfer verpasst und hektische Sicherheitsüberprüfungen ausgelöst. Vor Fukushima war kurzzeitig bereits die Rede von 130 Gigawatt installierter Leistung bis 2030. Der aktuelle Plan ist also immer noch ambitioniert, liegt aber deutlich hinter den extremen Plänen der Vergangenheit. Das ist dem Politbüro enorm wichtig. Schließlich hatte die Katastrophe von Tschernobyl nach allgemeiner Einschätzung sehr zum Untergang der Sowjetunion beigetragen: Ein Nuklearunfall als KP-Killer? Die Ingenieure der staatlichen Atomkonglomerate konnten die Führung jedoch überzeugen, dass keine echte Gefahr für einen Unfall bestehe.
Die Kernkraft gilt den Technokraten an der Spitze nun wieder als Lösung für mehrere Probleme. Der Umstieg auf Elektromobilität und andere Energiesysteme ohne Ausstoß von Feinstaub und Kohlendioxid verstärkt die Stromnachfrage enorm. Der Umstieg auf die Wasserstoffwirtschaft wird den staatlichen Projektionen zufolge noch einmal enormen Druck auf die Versorgung ausüben. Der Wirkungsgrad der Wasserstoffherstellung ist schlecht. Am Anfang der Kette ist also ein hoher Einsatz von Rohenergie nötig. Auch wenn der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie enorm schnell vorankommt, können sie den Bedarf voraussichtlich nicht decken. Schließlich soll die Gesamtwirtschaft ungehindert weiterwachsen. China hat eigene Uranvorkommen, so dass die Kernkraft auch die Energiesicherheit stärkt.
Zur Verwirrung deutscher Beobachter zählt China die Kernkraft in der Statistik zu den alternativen, ökologischen Energiequellen – also in einer Kategorie mit Sonne, Wind und Wasser. Schließlich entsteht bei der eigentlichen Stromerzeugung kein Kohlendioxid. Dass – anders als bei Wind und Sonne – hinterher ein Entsorgungsproblem bleibt, scheint hier nicht im Vordergrund zu stehen.
Wie einst Deutschland und heute noch Japan strebt China grundsätzlich einen weitgehend geschlossenen Brennstoffkreislauf an. Die bereits laufenden Wiederaufbereitungseinrichtungen stehen vor allem in der bitterarmen, abgelegenen Provinz Gansu – hier sind gut bezahlte Industriearbeitsplätze hoch willkommen, während die Bevölkerungsdichte gering ist. Aus abgebrannten Brennstäben entstehen hier schmutzigere, aber brauchbare neue Brennstäbe. Weitere große Anlagen sollen während der Laufzeit des 14. Fünfjahresplans in schneller Folge öffnen. Wegen der kürzeren Transportwege sind sie nun auch an der Küste geplant. In der Provinz Jiangsu liegt ein Vorhaben allerdings nach Bürgerprotesten schon länger auf Eis. Fukushima ist bei der Bevölkerung eben doch noch in Erinnerung.
Zudem bleibt ein Anteil Müll trotz aller Aufbereitung übrig. Ein Teil davon lagert derzeit in einer Anlage 25 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Lanzhou, andere warten an Kraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen auf die Entsorgung. Selbst China hat bisher noch kein geologisch sicheres Tiefenlager identifiziert – obwohl das autoritäre Regime anders mit Vorbehalten der Bevölkerung umgehen kann, und trotz der sehr vielfältigen Geographie. Der aktuelle Plan sieht vor, den Müll in feste Behälter einzugießen und in 500 Metern Tiefe in Granitformationen zu lagern. Ein Standort in der Wüste Gobi gilt als heißer Kandidat. Baubeginn soll 2040 sein.
In den Dokumenten des Nationalen Volkskongresses (NVK) schreibt sich die Führung nun vor, “die Kernkraft in geordneter Weise und unter Einhaltung strenger Sicherheitsvoraussetzungen” voranzutreiben. Tatsächlich sind die neuen chinesischen Reaktoren mehrere Generationen moderner als die Meiler in Fukushima oder Biblis – und damit objektiv deutlich sicherer. Die weitere Planung setzt vor allem auf die Modelle Hualong-1 und CAP1400. Sie sind von westlicher Technik abgeleitet und werden jetzt international als chinesische Eigenentwicklungen vermarktet. Sie haben all das, was in Fukushima gefehlt hat: passive Kühlung, die nicht mehr auf Stromversorgung angewiesen ist; ein echtes Nebeneinander von System, die füreinander einspringen können; doppeltes Containment; und einen keramischen Core-Catcher, der selbst bei einer Kernschmelze das Schlimmste verhindern soll. Künstliche Intelligenz in den Prozessleitrechnern kann helfen, menschliche Fehler auszugleichen. Kritiker halten jedoch auch die ganze neue Technik nur für eine unzureichende Versicherung gegen Unfälle – schließlich kann auch ein Szenario eintreten, an das einfach bisher keiner gedacht hat.
China plant einem Bericht zufolge, bis Ende Juni 40 Prozent seiner rund 1,4 Milliarden Einwohner gegen das Coronavirus zu impfen. Um das Ziel von rund 560 Millionen Geimpften zu erreichen, müsste die Volksrepublik das Tempo seiner Impfkampagne jedoch erhöhen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Bisher seien lediglich 3,5 Prozent der Bevölkerung geimpft. Laut Zhong Nanshan, einem hochrangigen medizinischen Berater der chinesischen Regierung, wurden demnach bis Ende Februar 52,5 Millionen Dosen an Corona-Impfstoffen verabreicht.
Wegen der frühzeitigen Kontrolle von Virus-Ausbrüchen sei das Impftempo derzeit noch niedrig, zitiert der Bericht Regierungsberater und Direktor für Infektionskrankheiten am Shanghai-Huashan-Krankenhaus, Zhang Wenhong. “Die Impfstoffkapazität ist jedoch sehr hoch und wird voraussichtlich bis Ende 2021 auf 2,1 Milliarden Dosen steigen.” China verfügt derzeit über vier im Inland entwickelte und hergestellte Impfstoffe, die für die Verwendung zugelassen sind.
Berichten chinesischer Staatsmedien zufolge arbeitet China derzeit an einer einfacheren Lagerung von Impfstoff: Demnach kann ein sich in der Entwicklung befindliches Vakzin bei einer Temperatur zwischen zwei und acht Grad für ein halbes Jahr gelagert werden. ari
China war die einzige große Volkswirtschaft mit einem Anstieg der Treibhausgasemissionen im Jahr 2020, wie eine neue Analyse der Beratungsfirma Rhodium Group zeigt. Gleichzeitig war die Volksrepublik im letzten Jahr auch die einzige große Volkswirtschaft deren Wirtschaft gewachsen ist – Schätzungen zufolge um 2,1 Prozent.
Gut 71 Prozent der chinesischen Treibhausgasemissionen stammt demnach aus dem Energiesektor, vor allem aus CO2-Emissionen durch Kohlekraftwerke: Sie sind für 57 Prozent der Emissionen aus dem Energiesektor verantwortlich. Infolge der Corona-Pandemie konzentrierte sich Peking auf einfach zu erzielendes Wirtschaftswachstum in der Schwerindustrie und im Bausektor. Die Stahlproduktion stieg um sieben Prozent, die Zementproduktion um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beide Sektoren sind sehr CO2-intensiv und trieben den Anstieg der Treibhausgasemissionen in die Höhe.
Der 14. Fünfjahresplan Pekings enthält keine Obergrenze für die zukünftigen Kohlenstoffemissionen und bleibt somit hinter den Erwartungen von Klimaexperten zurück. Das im Fünfjahresplan enthaltene Ziel, die Kohlenstoffemissionen um 18 Prozent in Relation zum Wirtschaftswachstum zu senken, wird bei einem China-typischen Wirtschaftswachstum sogar zu einer absoluten Erhöhung der CO2-Emissionen führen. Ein Beispiel: Bei einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von moderaten fünf Prozent pro Jahr bis 2025 dürften die CO2-Emissionen von 14,4 Gigatonnen Ende 2020 auf fast 15,1 Gigatonnen Ende 2025 steigen – und dennoch würde das Ziel der Senkung um 18 Prozent in Relation zum BIP erreicht. nib
Die EU warnt vor der von Peking angekündigten Änderung des Wahlrechts in Hongkong. Im Falle eines Inkrafttretens hätte eine solche Reform “möglicherweise weitreichende negative Folgen für demokratische Grundsätze und demokratisch gewählte Vertreter in Hongkong“, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Die EU fordere die Behörden in Peking auf, die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Reform des Wahlsystems von Hongkong “sorgfältig zu prüfen”. Gebe es eine “weitere ernsthafte Verschlechterung der politischen Freiheiten und Menschenrechte”, sei die EU bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen. Wie diese aussehen könnten, sagte Borrell nicht.
Den Delegierten des chinesischen Parlaments soll in der kommenden Woche ein Entwurf zur “Verbesserung des Wahlsystems der Sonderverwaltungszone Hongkong” vorgelegt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Eine Entscheidung dazu wird Borrell zufolge am 11. März erwartet.
Bereits zuvor war spekuliert worden, dass Peking den seit Freitag laufenden Kongress nutzen wird, um die Kontrolle über die Finanzmetropole Hongkong auszuweiten. In den vergangenen Wochen veröffentlichten chinesische Staatsmedien mehrere Artikel, in denen suggeriert wurde, dass in Hongkong “Schlupflöcher” im Wahlsystem gestopft werden müssten. Zudem erwähnten hochrangige Beamte, dass nur “überzeugte Patrioten” an der Regierung Hongkongs beteiligt sein sollten. ari

Im Gespräch mit Sigrun Abels spürt man sofort ihre Faszination für die chinesische Sprache und Kultur. Schnell spricht sie über die Herausforderung, immer wieder eine Haltung zu China und seiner Politik zu entwickeln. “Ich bin sehr an einem ausgewogenen China-Bild interessiert”, sagt die Sinologin. Sie gehöre weder in die Gruppe der “China-Versteher”, noch wolle sie “China-Bashing” betreiben. Sie sieht sich in der Mitte. “Und das ist eine schwierige Aufgabe.”
Seit fünf Jahren leitet die 50-Jährige das China Center an der TU Berlin. Eine wesentliche Aufgabe des 16-köpfigen Teams und zahlreicher Lehrbeauftragter ist es, Chinakompetenz zu vermitteln. “Sinologie für Nicht-Sinologen” nennt Abels das Angebot, das von ganz unterschiedlichen Menschen genutzt werde – von der Chemikerin über den Kunsthistoriker bis hin zum Start-up-Unternehmer.
Zugleich ist die gebürtige Duisburgerin Leiterin der deutschen Geschäftsstelle des Chinesisch-Deutschen Hochschulkollegs (CDHK) der Tongji-Universität Shanghai. Das CDHK bildet deutsche und chinesische Studierende bilingual in Masterstudiengängen in Elektrotechnik, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Wirtschaftswissenschaften aus. Jedes Jahr bietet Abels eine Summer School am CDHK in Shanghai an – wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischenkommt.
Dass das Studium der Sinologie ihr solide berufliche Perspektiven bieten würde, hatte sie nicht erwartet, als sie sich 1989 in Bochum einschrieb. “Kein Mensch hat daran gedacht, dass man da später wirklich Geld mit verdienen könnte”, sagt sie. Abels verbrachte ein Studienjahr in Nanjing – bewusst nicht in Peking oder Shanghai, wo viele andere Austauschstudenten waren. Eine prägende Figur im Studium war Helmut Martin, ihr späterer Doktorvater. Der 1999 verstorbene Sinologe pflegte enge Beziehungen zu Anhängern der Demokratiebewegung im chinesischen Festland und auf Taiwan. “Wir waren permanent, als Studenten schon, mit chinesischen Dissidenten in Berührung”, sagt Abels.
Nach dem Studium arbeitete sie als Journalistin bei der Deutschen Welle. Als Medientrainerin der Deutschen Welle Akademie war sie ebenfalls in China unterwegs. Für die Promotion kehrte sie zurück an die Ruhr-Universität Bochum. Ihr Thema: Die Rolle der Medien in China seit 1979. Zum chinesischen Mediensystem forscht sie bis heute, hinzugekommen ist das chinesische Wissenschaftssystem als Forschungsschwerpunkt.
Beide Bereiche seien “brisante Themen”, sagt Abels. Wenn sie etwa einen Fachartikel über die Situation der Medien in China schreibe, sei es unmöglich auszublenden, dass China in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen einen der letzten Plätze belege. Abels war Teil der Arbeitsgruppe, die für die Hochschulrektorenkonferenz Leitfragen zur Hochschulkooperation mit der Volksrepublik entwickelt hat. “Haltung aneignen” nennt sie dieses Bemühen, einen ausgewogenen Umgang in der Zusammenarbeit mit China zu finden. Sarah Schaefer
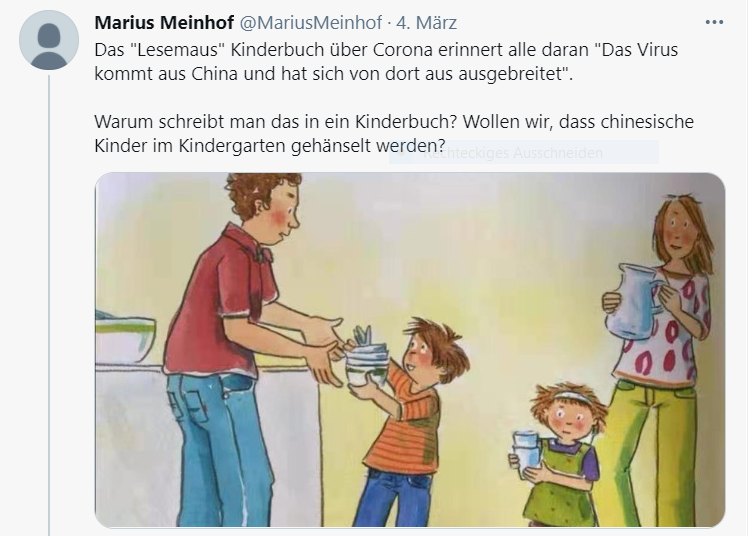
Der Carlsen-Verlag hat das Kinderbuch nach eigenen Angaben im Frühjahr 2020 konzipiert, um Eltern und Kindern Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags in Zeiten einer Pandemie zu geben. Der Verlag teilte am Freitag mit, dass er nach verschiedentlichen Hinweisen die Auslieferung des Buches gestoppt hat.