in China übertreffen sich die großen Unternehmen gerade mit hohen Spenden. Alibaba setzte mit umgerechnet 13 Milliarden Euro – zwei Drittel seines letzten Jahresgewinns – die Messlatte. Unser Team in Peking hat untersucht, ob die Gelder wirklich dem “allgemeinen Wohlstand” zugutekommen, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping in jüngster Zeit fordert. Vielleicht dienen die philanthropischen Großtaten auch als eine effektive Strategie, um den Zorn der Parteiführung auf Milliardäre und Großkonzerne zu dämpfen?
Michael Schaefer, ehemaliger Botschafter in China, blickt mit Sorge und Hoffnung auf die zivilgesellschaftlichen Beziehungen zu China. Sorge, weil die Gesprächskanäle sich sehr verengt haben, obwohl gerade jetzt der Dialog so wichtig wäre. Hoffnung, weil es immer noch Zugänge gibt. Wie sich diese aktivieren lassen, erklärt er im Montags-Interview mit dem China.Table. Schaefer warnt derweil vor der Vorstellung, dass China doch noch so zu einer Demokratie nach westlichem Vorbild wird. Er fordert dennoch einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe. Es gibt einfach keine Alternative.
Diese Woche startet die Messe IAA Mobility in München. Wir blicken daher noch einmal auf verschiedene Auto-Trends.
Einen guten Start in die Woche wünscht


Herr Botschafter, das Programm “Zukunftsbrücke” hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 240 junge Menschen mit Berufserfahrung aus China und Deutschland zusammengebracht. Können Sie noch einmal erzählen, wie es zu diesem Erfolg kam?
Die Idee zu diesem Projekt hatte ich schon 2008, ein Jahr nach meiner Ankunft als Botschafter in China. Schon damals fehlten informelle Kanäle, um strittige Themen zwischen Deutschland und China vertrauensvoll zu besprechen. Wir wollten daher einen Prozess aufbauen, der neue Wege nachhaltiger Verständigung eröffnet. Vorbild war die Atlantik-Brücke. Es sollte ein über einen längeren Zeitraum gehendes Programm sein, in dem künftige Führungspersönlichkeiten aus beiden Ländern zusammenkommen. Jedes Jahr 15 junge Führungskräfte aus jedem Land, nicht nur “Fachidioten”, sondern spannende Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft. Wir wollten dadurch möglichst viele verschiedene Perspektiven in den Austausch über gemeinsam interessierende Themen einbringen.
Das klingt ambitioniert.
Durchaus, aber es ist erstaunlich schnell zur Realisierung gekommen. Im Rahmen seines Chinabesuchs Ende 2008 nahm der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Idee sehr positiv auf. Gemeinsam konnten wir bei dieser Gelegenheit gleich auch Bernhard Lorentz, damals Chef der Stiftung Mercator, für die Durchführung des Projekts gewinnen. In der Erklärung der beiden Regierungschefs beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in China 2010 wurde die Zukunftsbrücke dann erstmals von beiden Regierungen begrüßt – neben der mutigen Ausstellung der drei staatlichen Museen Berlin, Dresden und München zur Kunst der Aufklärung. Bei den ersten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen 2011 in Berlin wurde die deutsch-chinesische Zukunftsbrücke dann offiziell aus der Taufe gehoben.
Die Unterstützung von ganz oben hat dann gewirkt?
Ja, das war sehr wichtig. Beide Regierungen haben damit die Schirmherrschaft übernommen. Schon 2012 hat das erste Camp der Zukunftsbrücke in Hangzhou stattgefunden, danach jährlich, rotierend einmal in China, einmal in Deutschland. Neben Peking und Berlin ging es auch immer an einen zweiten Ort in der Provinz im jeweiligen Land. Inhaltlich lag von Anfang an ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsthemen – mit unterschiedlichen Facetten. Neben Energie und Klima standen beispielsweise die soziale Dimension oder die Neuordnung internationaler Partnerschaften zur Diskussion. Selbst kontroverse Themen wie das jeweilige Menschenrechtsverständnis wurden intensiv und spannend diskutiert.
Inwiefern?
Beide Seiten entdeckten immer wieder falsche Vorstellungen von der eigenen Gesellschaft beim jeweils anderen. Umso wichtiger war es, aktiv zuzuhören und sich auf die jeweils andere Perspektive einzulassen. Im Mittelpunkt stand immer das persönliche Verstehen, das sogenannte Bonding. Regelmäßige Alumni-Treffen wie jetzt am Wochenende dienen dazu, diese Bande zu vertiefen. Es soll eben kein einmaliger thematischer Austausch sein, sondern die Schaffung eines nachhaltigen Netzwerks.
Das ist ein schönes Ziel – aber der Austausch mit China ist auch immer schwieriger geworden. Wie geht es dem Programm heute?
Wir haben bis 2019 jedes Jahr ein Camp veranstaltet, 2020 und 2021 ging das wegen Corona nicht mehr. In diesem Jahr ist der ursprünglich von beiden Regierungen avisierte Zehnjahreszeitraum abgelaufen. Ob der Prozess in eine zweite Phase gehen wird, ist derzeit noch offen, aber angesichts der vorherrschenden Spannungen zwischen beiden Seiten eher unwahrscheinlich…
…also aufgrund der Anfeindungen und Sanktionsrunden.
Wann sich die Lage wieder entspannt, muss man weitersehen. Ich bin überzeugt, dass beide Seiten den Wert eines solchen Austauschprozesses verstehen. Wir in Europa müssen besser verstehen, was China antreibt – umgekehrt müssen wir erklären, wie unsere Gesellschaften ticken und was unsere Visionen sind.
Auch in China gibt es Vorurteile?
Natürlich. Zum Beispiel wird überhaupt nicht verstanden, woher unser Interesse an den individuellen Menschenrechten kommt. Die Diskussion wird in China oft als Vorwand gesehen, das chinesische Gesellschaftsmodell an den Pranger zu stellen. Das ändert sich, wenn man den Chinesen erklärt, dass gerade die massiven Menschenrechtsverletzungen in und durch Deutschland im 20. Jahrhundert bei uns ein besonderes Bewusstsein für die Wichtigkeit individueller Rechte geschaffen haben. Wenn ich persönlich erzähle, wie mich meine Herkunft aus Deutschland geprägt hat, dann steigt die Bereitschaft, mir zuzuhören.
Dennoch wollen viele Deutsche ihre chinesischen Gesprächspartner vor allem belehren. Das ist vermutlich wenig hilfreich?
Das gilt auch für andere Länder des Westens. Wir machen uns vorschnell unser Bild von der anderen Seite. Den Vertretern des Westens mangelt es oft am Willen, gemeinsame Chancen und Interessen zu sehen. Die belehrende Sprache findet sich aber zunehmend auch auf chinesischer Seite.
Derzeit sind die Beziehungen ziemlich angeschlagen, die EU und China belegen sich mit Sanktionen, der Austausch ist auf einem Tiefpunkt. Wie brechen wir das jetzt wieder auf?
Wir müssen die Kanäle nutzen, die es noch gibt. Ein Beispiel sind Kooperationen der Umweltministerien. Klima und Biosphäre sind ein “global common good”, globales Gemeinschaftseigentum. Hier bestehen konkrete gemeinsame Interessen der Europäer und der Chinesen, aber auch der Amerikaner.
Institutionen mit Chinabezug klagen jedoch derzeit darüber, dass gar keine Veranstaltungen mehr stattfinden, auf denen sie Gesprächsbereitschaft signalisieren können.
Das stimmt, insbesondere der Spielraum für Zivilgesellschaft wird in China immer enger. Wir sollten von deutscher Seite immer wieder Dialogangebote machen. In der Vorbereitung können wir unseren chinesischen Gesprächspartnern ohne jede Form von Paternalismus sagen: Wir sind an wirklichem Austausch interessiert. Eine moralisierende Haltung schadet hier nur. Stattdessen sollten wir versuchen, zu verstehen, wo Chinas Interessen liegen und unsere eigenen Interessen erklären. Wir müssen mit kritisch-konstruktivem Blick an das Land herangehen, keinesfalls naiv-blauäugig, aber doch in dem Wissen, dass wir gerade mit einer so gewichtigen Gesellschaft auch künftig einen Austausch haben müssen, und überlegen müssen: Wie kriegt man das hin?
Und? Wie kriegt man das hin?
Uns muss immer bewusst sein, wie wichtig ehrlicher Dialog und gegenseitiges Vertrauen sind – gerade angesichts so großer Unterschiede. China ist Partner, Wettbewerber und strategischer Rivale in einem, wie die EU festgestellt hat. Wir müssen uns von dem Wunschdenken verabschieden, dass China unsere Interessen und Werte teilt. Ganz direkt: China war nie eine Demokratie, war nie ein Rechtsstaat, und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dahin entwickelt, ist gering. Wir waren schon immer systemische Rivalen; was sich geändert hat ist, dass China Großmacht geworden ist.
Also sollen wir alles abnicken, was China macht?
Natürlich nicht. Aber wir brauchen China und China braucht uns bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen. Kooperation bleibt unerlässlich. Aber China darf sich natürlich nicht außerhalb des Völkerrechts stellen. Das Folterverbot oder der Schutz von Menschenrechtsanwälten gilt für China genauso wie in europäischen Ländern. China muss sich auch in Hongkong an das Völkerrecht halten, also an den Übergabevertrag mit Großbritannien. An solchen Stellen muss Europa nicht nur bereit sein, eine klare rote Linie zu ziehen, sondern auch klar kommunizieren, was passiert, wenn China diese rote Linie überschreitet.
Wo verläuft die nächste rote Linie?
Eine gewaltsame Vereinigung Taiwans mit China markiert eine rote Linie. Europa sollte in diesem Falle bereit sein, Taiwan zu unterstützen. Und es sollte klarmachen, welche Handlungsmittel es einzusetzen bereit ist, um seine Ankündigungen umzusetzen. Europa muss auch hier glaubwürdig sein. Wir sollten mit Augenmaß, aber auch mit Selbstbewusstsein an die Rivalität mit China herangehen.
Umso wichtiger ist der zivilgesellschaftliche Austausch, bevor es überhaupt zu solchen Krisenszenarien kommt. Auf welcher Seite sehen Sie mehr guten Willen zum Dialog?
Auf Regierungsebene ist der gute Wille derzeit auf beiden Seiten nur sehr eingeschränkt vorhanden. Zivilgesellschaftlich ist er sehr viel größer. Die deutschen Stiftungen beispielsweise sind bereit, ihren Beitrag zu leisten und einen Austausch mitzutragen, in welcher Form auch immer. In China ist das schwieriger, weil die Zivilgesellschaft immer mehr in ihrer freien Entwicklung beschränkt ist. Das ist sehr bedauerlich, und ich glaube, dass sich die chinesische Regierung hiermit keinen Gefallen tut.
Gibt es in China überhaupt noch geeignete Ansprechpartner?
In China gibt immer noch zahlreiche Organisationen und Institutionen, die gesprächsbereit sind. Beispielsweise Thinktanks wie das Center for China and Globalization, oder die Universitäten. Wir sollten immer wieder versuchen, Dialogformate zu eröffnen, die von beiden Seiten getragen werden.
Sie meinen große Fachkonferenzen?
Nein, ich bin vielmehr für kleine Dialogformate. Große Konferenzen sind zu öffentlich, um frei reden zu können. Die Veranstaltungen sollten themenbezogen sein, aber einen vertraulichen Austausch zulassen. Mit der BMW Foundation haben wir in den letzten Jahren das Format “Global Table” entwickelt, in dem wir circa 30 kluge Köpfe aus unterschiedlichen Regionen der Welt zusammenbringen. Sowas kann man natürlich auch innerhalb einer Region oder bilateral machen.
Die Themensetzung spielt vermutlich ebenfalls eine Rolle?
Es geht darum, sich auf gemeinsame Interessen zu konzentrieren. Umwelt und Klima sind solche Themen. Jeder Einzelne sollte die Bereitschaft mitbringen, an notwendigen Veränderungsprozessen mitzuarbeiten. In jedem Falle ist es essenziell, dass ein respektvoller Dialog auf Augenhöhe stattfindet.
Michael Schaefer (72) ist als ehemaliger Diplomat und Stiftungs-Chef ein Vollprofi in der Sphäre des deutsch-chinesischen Austauschs. Von 2007 bis 2013 war er Botschafter in Peking, danach für acht Jahre Vorstandsvorsitzender der BMW Foundation. Er ist weiterhin Mitglied der Trilateralen Kommission, einer Denkfabrik für den Austausch zwischen Amerika, Europa und Asien.
Chinas Tech-Riesen haben es derzeit eilig, Spenden unters Volk zu bringen. Alibaba legte vergangene Woche die Messlatte auf eine ganz neue Höhe: Der Onlinehändler kündigte an, in den kommenden fünf Jahren 100 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 13 Milliarden Euro, für wohltätige Zwecke spenden zu wollen. Die Summe entspricht rund zwei Drittel des jüngsten Jahresgewinns von Alibaba.
Großzügig hatten sich in den Tagen zuvor bereits die Alibaba-Konkurrenten Tencent und Pinduoduo gezeigt, die jeweils erklärten, 50 Milliarden beziehungsweise zehn Milliarden Yuan bereitstellen zu wollen.
Chinas Tech-Giganten und andere private Konzerne scheinen zu dem Ergebnis gekommen zu sein, dass philanthropische Großtaten eine effektive Strategie sind, um sich der neuen Realität der Pekinger Wirtschaftspolitik zu stellen.
Wie die aussieht, wurde in den vergangenen Monaten durch die knallharten Eingriffe der Regulatoren deutlich. Plötzlich mischten sich die Behörden überall ein. Sie nahmen vor allem die Geschäftspraktiken der Tech-Riesen ins Visier. Doch auch der Immobilienmarkt, der Bildungssektor und die Unterhaltungsindustrie wurden mit strengeren Regeln und Verboten belegt.
Rund drei Billionen US-Dollar wurden durch die Eingriffe Pekings laut einer Schätzung der US-Bank Goldman Sachs an den Märkten ausgelöscht. Einige Beobachter sprechen bereits von einem Paradigmenwechsel. “Nach 40 Jahren, in denen der Markt eine wachsende Rolle bei der Förderung des Wohlstands spielen konnte, haben sich Chinas Führer an etwas Wichtiges erinnert – sie sind Kommunisten”, spitzte die Finanzagentur Bloomberg die Lage kürzlich in einem Kommentar zu.
China will den Kapitalismus freilich nicht abschaffen. Die Führung sieht aber die Notwendigkeit, gegen zunehmende Ungleichgewichte bei der Verteilung des Wohlstands vorzugehen. Auch soll die Macht großer Konzerne beschränkt und stattdessen kleine und mittelgroße Unternehmen gefördert werden. Als der Reformer Deng Xiaoping in den 80er-Jahren die wirtschaftliche Öffnung Chinas vorantrieb, lautete das Motto noch: “Lasst einige zuerst reich werden”. Das hat geklappt, schließlich gibt es heute in China so viele Milliardäre wie in keinem anderen Land.
Staats- und Parteichef Xi Jinping hat nun ein neues Mantra festgelegt. Gebetsmühlenartig wiederholten Staatsmedien zuletzt seinen Slogan vom “allgemeinen Wohlstand”. Den gab es zwar bereits zu Gründungszeiten der Kommunistischen Partei, lange wurde er aber nicht mehr so inbrünstig propagiert wie in diesen Tagen. Die Pekinger Führung hat genug von “irrationaler Kapitalexpansion” und “barbarischem Wachstum”. Das machte Xi in einer Rede Ende August deutlich (China.Table berichtete).
Unklar ist, wie weit es Peking mit der großen Umverteilung tatsächlich treiben will. So weisen Beobachter auf den anstehenden Parteikongress im kommenden Jahr hin, auf dem Xi sich seine dritte Amtszeit sichern wird. Vor solchen wichtigen Ereignissen kam es auch in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Peking die Schrauben anzog.
Viele der zuletzt verhängten Maßnahmen gegen die Konzerne werden vom Volk unterstützt. Alibaba darf Händler nun etwa nicht mehr dazu zwingen, seine Produkte exklusiv auf den eigenen Plattformen anzubieten. So soll mehr Wettbewerb ermöglicht werden. Dass Essenslieferanten den Mindestlohn verdienen und eine Krankenversicherung haben, sollte ebenfalls selbstverständlich sein. In sozialen Medien applaudierten zudem viele Nutzer der Entscheidung, gegen ausufernden Nachhilfeunterricht vorzugehen, mit dem einige wenige Anbieter viel Geld verdienten (China.Table berichtete).
Die großen Tech-Konzerne mögen sich zwar über die angezogenen Zügel ärgern, sie wissen aber auch, dass ihre Gewinne trotz schärferer Regulierung weiter sprudeln werden. Mit ihren großzügigen Spenden zeigen sie Peking, dass sie hinter der Führung stehen. Laut einer Auswertung von Bloomberg haben mindestens 73 börsennotierte Firmen in China in ihren letzten Quartalsberichten den Begriff “allgemeiner Wohlstand” verwendet.
Linientreue mag sich kurzfristig für die Unternehmen auszahlen. Doch gibt es auch warnende Stimmen vor Pekings neuer Marschrichtung. Reiche Menschen und Unternehmer ins Visier zu nehmen, schade der Schaffung von Jobs, schreibt der Pekinger Wirtschaftsprofessor Zhang Weiying. Es dämpfe den Konsum und führe die Nation letztendlich zurück in die Armut. Die marktorientierten Reformen seit den späten 1970er-Jahren haben China zu einer gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft gemacht, so Zhang. Eine freie Wirtschaft habe einfachen Leuten die Möglichkeit gegeben, aus der Armut herauszukommen und reich zu werden. Gehe das Vertrauen in den Markt verloren, werde China nicht “gemeinsamen Wohlstand”, sondern “gemeinsame Armut” erfahren.
Chinas Staatsmedien verbreiteten dagegen zuletzt lieber den radikalen Kommentar eines Internet-Bloggers, der in eine ganz andere Richtung geht. “Dies ist eine Transformation von kapitalzentriert zu menschenzentriert”, schrieb der Autor in seiner Lobeshymne zum derzeitigen Crackdown und fügte hinzu: “Der Kapitalmarkt wird kein Paradies mehr für Kapitalisten sein, um über Nacht reich zu werden.” Gregor Koppenburg/Joern Petring
Die deutsche Industrie will eine rote Linie für den Umgang mit China und seiner Wirtschaftspolitik. “Wer vom freien Zugang zu unserem Markt weiter profitieren will, muss sich an Grundregeln halten und auch seinen eigenen Markt öffnen”, sagte der Präsident des Branchenverbands BDI, Siegfried Russwurm, der Deutschen Presse-Agentur.
Er sieht eine gemeinsame Agenda mit anderen Staaten als notwendig: “Ich bin optimistisch, dass sich eine internationale Koalition für den richtigen Umgang mit Peking schmieden lässt”, sagte Russwurm. Innerhalb der EU sei der Konsens relativ breit, auch mit den USA sowie Ländern wie Australien, Neuseeland, Japan und Kanada gebe es große Übereinstimmung.
Da gerade China für viele deutsche Unternehmen einer der wichtigsten Märkte weltweit ist, ist auch der Wettbewerb groß. Zuletzt hatten Waren aus China der deutschen Exportwirtschaft zunehmend auch in der EU Konkurrenz gemacht. Von der Corona-Krise erholte sich die chinesische Wirtschaft schneller als die europäische. Während die EU chinesischen Unternehmen weitgehend freien Zugang zu ihrem Markt gewährt, schottet China seinen eigenen Markt stärker ab.
Weil China immer wieder gegen weltweit geltende Regeln – wie bei der Einhaltung der Menschenrechte – verstoße, sieht der BDI-Chef Risiken für die Unternehmen. “Für Politik wie für Unternehmen gilt, dass sie ihre roten Linien kennen müssen, hinter die man nicht zurückgeht”, unterstrich er. “Ein Unternehmen kann nicht das Risiko akzeptieren, dass in seiner Wertschöpfungskette Zwangsarbeit oder Kinderarbeit passieren. Da muss jedes Unternehmen für sich seine roten Linien finden”, sagte der BDI-Chef. niw
In China sind im August die Autoverkäufe signifikant gefallen. Laut Daten des Herstellerverbands CAAM ist die Zahl der verkauften Fahrzeuge im vergangenen Monat gegenüber dem Vormonat um 22 Prozent zurückgegangen. Die Meldung kommt nur wenige Tage, nachdem der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) verkündet hatte, dass im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 13 Prozent gefallen sei.
Beide Verbände berechnen ihre Daten anhand unterschiedlicher Kriterien. Während der Herstellerverband CAAM auch Nutzfahrzeuge und den Absatz der Produzenten an die Händler einbezieht, dient bei CPCA der Absatz von Pkw, SUV und Minivans an die Kunden als Berechnungsgrundlage. Extremwetter-Lagen mit Überschwemmungen und eine Zunahme von Coronavirus-Infektionen hatten Kunden zuletzt davon abgehalten, in die Verkaufsräume der Autohändler zu gehen.
Bei einem Branchentreffen warnte Vize-Industrieminister Xin Guobin allerdings, dass die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Chip-Knappheit die Autoproduktion in China weiterhin beeinträchtige. So erwartete die Autobranche zuletzt, dass der Chipmangel bereits Ende Juli nachlassen und so die Verkäufe im August stützen könnte. Aufgrund der Delta-Variante in Südostasien mussten jedoch mehrere Chipfabriken ihre Produktion einstellen, was zu einem erheblichen Mangel an Autochips führte. niw
Der chinesische Halbleiterhersteller Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) investiert rund siebeneinhalb Milliarden Euro in einen neuen Standort bei Shanghai. Das Unternehmen reagiert damit auf globale Lieferengpässe, die auch in der deutschen Industrie die Bänder stillstehen lassen. Projektpartner ist die Lingang Free Trade Zone (FTZ) in Pudong. SMIC wiederum finanziert die Expansion zum Teil aus einem staatlichen Förderfonds für die Halbleiterbranche.
SMIC will in Shanghai allerdings keine neue Technik an den Start bringen, sondern Chips ab 28 Nanometern Strukturbreite herstellen. Für Hightech-Anwendungen wie rasend schnelle Prozessoren werden derzeit Elemente mit sieben Nanometern Strukturbreite verwendet. Der Weltmarktführer TSMC aus Taiwan arbeitet derzeit sogar bereits an Drei-Nanometer-Chips. Die 28-Nanometer-Klasse, die jetzt in Shanghai entstehen soll, eignet sich eher für gröbere Anwendungen wie Wifi-Bauelemente. Doch auch Chips, wie sie in Autos verwendet werden, fallen in diese Kategorie. fin
Die Klimagespräche des US-amerikanischen Klimasonderbeauftragen John Kerry sind in China am Freitag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Chinesische Beamte hätten der US-Regierung klarmachen wollen, dass es “unmöglich ist, Chinas Zusammenarbeit beim Klimawandel zu gewinnen und gleichzeitig in wichtigen Fragen eine anti-chinesische Haltung einzunehmen”, sagte Shi Yinhong, Professor für internationale Beziehungen an der Pekinger Renmin-Universität, gegenüber der South China Morning Post.
Bereits vor den zweitägigen Gesprächen hatte China den USA Bedingungen für eine Kooperation im Klimaschutz gestellt. Washington könne nicht einerseits versuchen, die Entwicklung seines Landes einzudämmen – und andererseits auf eine Zusammenarbeit drängen, sagte Außenminister Wang Yi während eines Besuchs von Kerry am Donnerstag in Tianjin. Wang warf der Regierung von Präsident Joe Biden eine “große strategische Fehlkalkulation gegenüber China” vor (China.Table berichtete).
Wang hatte damit Kerrys Forderung zurückgewiesen, Klimaschutz isoliert zu behandeln. “Die amerikanische Seite will, dass Klimakooperation eine ‘Oase’ in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen ist, aber wenn diese ‘Oase’ von Wüste umgeben ist, wird sie früher oder später von der Wüste erfasst werden”, so Wang laut einer Mitteilung des Außenministeriums.
Dass Kerry dennoch neben Wang und dem Klimasondergesandten Xie Zhenhua mit dem stellvertretenden chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Han Zheng und dem hochrangigen Politiker und USA-Kenner Yang Jiechi zusammentraf, wird als Signal gesehen, dass Peking versucht, über die Klimagespräche hinaus Themen anzusprechen, die zu den andauernden Spannungen zwischen beiden Staaten führt.
Das Treffen kommt wenige Woche vor dem Klimagipfel in Glasgow im November. Experten weltweit sind sich einig, dass ohne eine Zusammenarbeit von China und den USA keine Fortschritte bei der Eindämmung des Klimawandels erreicht werden können. niw
Die EU braucht nach Ansicht ihres Außenbeauftragten Josep Borrell ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein für eine einheitliche Chinapolitik. Der Block müsse zudem Einheit und “einen pragmatischen, realistischen und kohärenten Ansatz mit China” haben, sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister am Freitag. “Außerdem müssen wir uns mit China in Bezug auf Afghanistan auseinandersetzen. Wettbewerb, aber auch Zusammenarbeit in Handels- und Wirtschaftsfragen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Beziehungen zu China”, so Borrell.
Der EU-Außenbeauftragte und die Minister sprachen bei ihrem Treffen in Slowenien zudem mit den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar über den Indopazifik-Raum. Brüssel will noch in diesem Monat seine Strategie für die Region vorstellen. Zudem wird erwartet, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen das Thema in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union (SOTEU) Mitte des Monats ansprechen wird.
Indien ersetze jedoch China nicht als genereller Gesprächspartner in Asien, betonte der slowenische Außenminister Anže Logar nach dem informellen Treffen. Sein Heimatland hält derzeit die EU-Ratspräsidentschaft. “Indien wird China nicht ersetzen, weil China und Indien unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und unterschiedlichen Handelsbeziehungen zu Europa sind, aber wir wollen unsere Beziehungen zu Indien stärken”, so Logar. So müsse beispielsweise weiter am Abschluss eines Handels- und Investitionsabkommens mit Indien gearbeitet und die Zusammenarbeit in Hinsicht auf die Sicherheit der Region gestärkt werden, sagte Logar. ari

Wer dem Niedergang der Rheinmetropole Duisburg als einstige Montanstadt nachspüren möchte, ist auf dem Gelände des ehemaligen Krupp-Hüttenwerks Rheinhausen am falschen Ort. Seit den späten 1990er-Jahren erzählt der Ort die Geschichte des schwierigen Strukturwandels von der Kohle- und Stahl-Metropole zum globalen Logistikzentrum. Die Probleme wie hohe Arbeitslosigkeit und Verschuldung sind allerdings noch längst nicht überwunden. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hat Rasmus C. Beck im Frühjahr dieses Jahres die geschäftsführende Leitung der Duisburger Wirtschaftsförderung, die inzwischen Duisburg Business Innovation heißt, übernommen.
Der Herausforderung ist sich Beck durchaus bewusst: “Marxloh kennt jeder, weil die Kanzlerin hier war.” 2015 wurde Angela Merkel bei ihrem Besuch vor Ort ausgebuht. Gleichzeitig findet Beck, dass die Potenziale der Stadt völlig unterbewertet sind: “Es gibt hier noch den letzten industriellen Kern im Ruhrgebiet und hier wird die Transformation der Stahlproduktion hin zur Klimaneutralität stattfinden.” Außerdem gibt es einen weiteren wichtigen Partner, der beim Wiederaufstieg der Stadt mithelfen soll: China.
Das Seidenstraßenprojekt bildet einen wichtigen Baustein im Konzept, mit dem Beck die Stadt voranbringen will: “Mir ist keine Erfolgsstory in der Wirtschaftsförderung bekannt, die nicht international eingebettet ist.” Die zwei weiteren Eckpfeiler sind eine gute Universität, die Knowhow entwickelt, sowie stadteigene Flächen, die der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden können. Dass der Endpunkt der neuen Seidenstraße am Duisburger Hafen liegt, sieht Beck als Geschenk. Zufall ist es allerdings nicht, meint Beck: “Es passt gut mit unseren Kompetenzen zusammen, die wir als Handelsstadt haben. Der Handel bestimmt die Stadt bereits seit ihrer Gründung.”
Angst vor einer Vereinnahmung durch chinesische Investoren hat der 41-Jährige nicht, dafür sei Duisburg zu breit aufgestellt. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit mit China und die Teilnahme an der neuen Seidenstraße auch ein kulturelles Projekt, findet Beck: “Ideen und Knowhow kommen nicht in Containern. Aber die Container sind eine gute Grundlage, dass wir auch einen kulturellen Austausch beginnen.” Die Arbeit des Konfuzius-Instituts an der Universität Duisburg-Essen begrüßt Beck genauso wie das Institut für Ostasienwissenschaften, außerdem verweist er darauf, dass Duisburg die erste deutsche Stadt war, die eine Städtepartnerschaft mit einer chinesischen Großstadt aufgenommen hat.
In China war Beck selbst das letzte Mal 2019 in Shenzhen. Bei seinen Besuchen in China beeindruckt ihn vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich das Land entwickelt. “Damit meine ich insbesondere auch das Tempo, mit dem sich der Lebensstandard für die ärmere Bevölkerung verbessert hat”, sagt Beck. Auch bei der Offenheit für digitale Lösungen im Alltag seien die Chinesen schon weiter – egal ob es das autonome Fahren oder 5G-Technologie ist.
Am Ende ist Beck überzeugt, dass die Unterschiede zwischen Deutschland und China tatsächlich nicht so groß sind, wie es häufig unterstellt werde. “Natürlich hat China ein anderes politisches System und ist ein riesengroßes Land mit anderen Entwicklungsnotwendigkeiten”, sagt Beck. Die autoritären Strukturen in China helfen zwar dabei, Prozesse zu beschleunigen, allerdings sei die Qualität, in der sich das Land mittlerweile entwickle, auf Augenhöhe mit dem Westen. Das sei beispielsweise in der Baubranche so. Bei Zukunftsthemen wie Smart Citys könne Deutschland mittlerweile von China lernen. “Ich finde, wir sollten die gegenseitige Bewunderung nutzen, um in den Austausch zu kommen. Auch über die kritischen Themen, vor allem aber über die gemeinsamen Chancen.” David Renke
Stephan Kneipp ist neuer COO bei Elaris. Elaris mit Sitz in Rheinland-Pfalz vertreibt die Modelle des chinesischen Herstellers Dorcen. Zuvor war Kneipp bei der Antriebsstrang-Sparte bei Powertrain Solutions von Bosch als Head of Digital Ventures and Data Driven Business tätig.
Dominik Lembke ist seit August Director Product Development bei Svolt. Lembke soll die Kunden in Europa und die Entwicklungsabteilungen des Batterie-Herstellers in Europa und China zusammenführen. Der 37-Jährige kommt von Porsche in Weissach, wo er zuletzt den Bereich BEV-Batteriesysteme geleitet hatte und technischer Projektleiter für den Bereich HV-Batterien war.
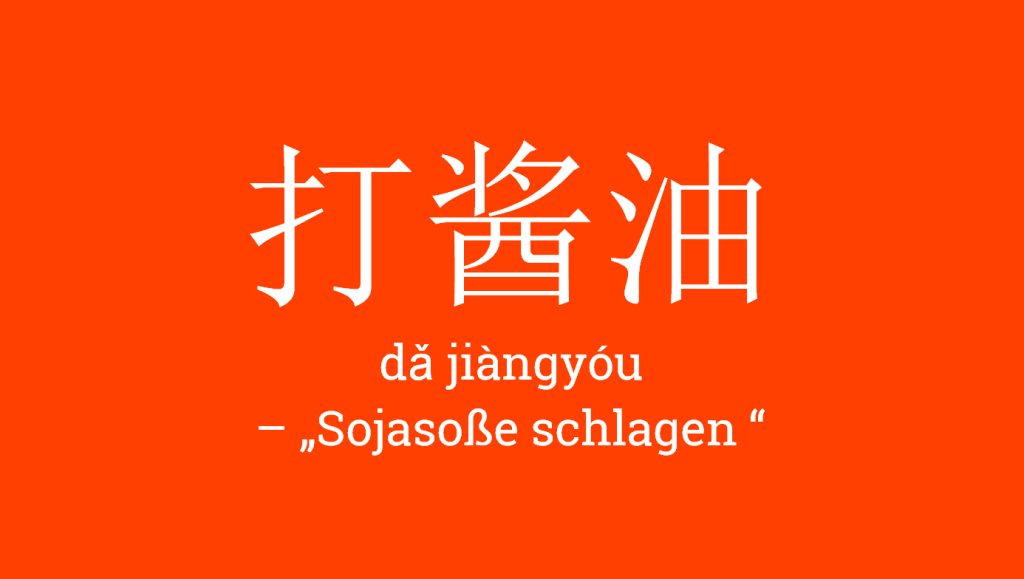
“Ich schlag’ hier nur die Sojasoße!” Das wäre doch mal ein origineller Konter, um sich bei unliebsamen Angelegenheiten souverän aus der Affäre zu ziehen. In China trended der Begriff “Sojasoße schlagen” (打酱油 dǎ jiàngyóu) mittlerweile als Synonym dafür, einer Sache nur als Unbeteiligter oder zufälliger Zuschauer beizuwohnen. Doch was zum Teufel hat das mit “geschlagener Würzsoße” zu tun?
Ursprünglich leitete sich diese Redensart aus einer alten Einkaufsgewohnheit aus dem Prä-Lieferservice- und Prä-Supermarkt-Zeitalter ab (ja, das gab es). Wie man bei uns einst die Milch holte, so ging man damals in China Sojasoße kaufen: nämlich mit einem selbst mitgebrachten Behälter (erlebt heute bei uns übrigens unter dem Label “Zero Waste” ein Revival). Mit Krug oder Flasche schlenderten die Chinesen damals zum Soßenhändler, der die Würzsoße je nach individuellem Bedarf in beliebiger Menge abfüllte.
Das Ganze nannte man 打酱油 dǎ jiàngyóu – “Sojasoße holen gehen”, wobei das Verb 打 dǎ (wörtlich “schlagen, hauen, klopfen”) hier in der Bedeutung “holen, besorgen” gebraucht wurde (ähnlich wie in 打水 dǎshuǐ “Wasser holen”). Heute gilt der Ausspruch in der Internetsprache gewissermaßen als Synonym für “Geht mich nichts an!”. Eigentlich sei man ja nur auf dem Weg, “Sojasoße zu holen” und nicht der richtige Ansprechpartner, sondern nur Sojasoßenträger… äh… Lückenbüßer für die eigentlich Zuständigen.
Sojasoße und Wasser sind übrigens bei Weitem nicht das Einzige, was man auf Chinesisch “schlagen” kann. Der Eintrag für das Schriftzeichen 打 dǎ füllt in Wörterbüchern etliche Seiten. Man kann sich als Sprachenlerner mit diesem Verb und seinen Kombinationen quasi durch den kompletten chinesischen Alltag “schlagen”. Das glauben Sie nicht? Dann passen Sie mal auf!
Das beginnt schon beim ersten Gähnen nach dem Aufwachen (打哈欠 dǎ hāqiàn “ein Gähnen schlagen”) und dem Zurechtmachen vor dem Spiegel (打扮 dǎbàn “schminken, zurechtmachen” – wörtlich “die Kostümierung schlagen”). Mancher wird sich für den Gang ins Büro noch rasch eine Krawatte “umprügeln” (打领带 dǎ lǐngdài “Krawatte anziehen”). Der Blick aus dem Fenster verrät derweil nichts Gutes: Es “schlägt Donner” (打雷 dǎléi “donnern”). Beim Tritt vor die Tür heißt es also den Schirm “aufschlagen” (打伞 dǎsǎn “Schirm aufspannen”). Sie sind vielleicht ohnehin spät dran? Warum sich also nicht gleich ins Taxi “hauen” (打车 dǎchē “ein Taxi nehmen”). An der Firmenpforte ist dann erst einmal “Kartenschlagen”, pardon, “Stechen” (打卡 dǎkǎ) angesagt. Angekommen im Büro hauen Sie nicht gleich auf den Putz, sondern erst einmal eine Begrüßung raus (打招呼 dǎ zhāohu “einen Gruß schlagen”).
Dann wird rangeklotzt: telefonieren (“ein Telefonat schlagen” 打电话 dǎ diànhuà), tippen (“Zeichen schlagen” 打字 dǎzì) und drucken (“den Druck schlagen” 打印 dǎyìn). Vor dem nächsten Meeting noch schnell einen Entwurf “prügeln” (打草稿 dǎ cǎogǎo “Entwurf erstellen”) und das Budget “raushauen” (打预算 dǎ yùsuàn “Budget aufstellen”). Wenn die To-do-Liste abgehakt ist (打勾 dǎgōu “abhaken”, wörtl. – “einen Haken schlagen”), ist es hoffentlich auch schon Zeit für die Mittagspause mit “eingeschlagenem” Lunch und Coffee “to go” (打包 dǎbāo “zum Mitnehmen”, wörtlich “eine Tasche schlagen”).
Ist alles im Magen, kommt das Mittagspausen-“Dǎ-dǎ”: sich für ein Nickerchen aufs Ohr hauen (打盹 dǎdǔn “ein Nickerchen “schlagen“) und nach Lust und Laune schnarchen (打呼噜 dǎ hūlu “Schnarchgeräusche schlagen”). Den Feierabend lässt man dann vielleicht gemütlich mit dem “Prügeln” von Karten, Mahjong-Steinen oder anderen Spielen ausklingen (打牌 dǎpái “Karten spielen”; 打麻将 dǎ májiàng “Mahjong spielen”, 打游戏 dǎ yóuxì “gamen, zocken”) oder “kloppt” zur Abwechslung ein paar Bälle (打球 dǎqiú “Ballsport betreiben“).
Geben wir uns angesichts der “Schlagkraft” des chinesischen Vokabulars also einfach geschlagen, denn diese Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Wenn Sie es nicht glauben, schlagen Sie es gerne nach.
Verena Menzel betreibt in Peking die Sprachschule New Chinese.
in China übertreffen sich die großen Unternehmen gerade mit hohen Spenden. Alibaba setzte mit umgerechnet 13 Milliarden Euro – zwei Drittel seines letzten Jahresgewinns – die Messlatte. Unser Team in Peking hat untersucht, ob die Gelder wirklich dem “allgemeinen Wohlstand” zugutekommen, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping in jüngster Zeit fordert. Vielleicht dienen die philanthropischen Großtaten auch als eine effektive Strategie, um den Zorn der Parteiführung auf Milliardäre und Großkonzerne zu dämpfen?
Michael Schaefer, ehemaliger Botschafter in China, blickt mit Sorge und Hoffnung auf die zivilgesellschaftlichen Beziehungen zu China. Sorge, weil die Gesprächskanäle sich sehr verengt haben, obwohl gerade jetzt der Dialog so wichtig wäre. Hoffnung, weil es immer noch Zugänge gibt. Wie sich diese aktivieren lassen, erklärt er im Montags-Interview mit dem China.Table. Schaefer warnt derweil vor der Vorstellung, dass China doch noch so zu einer Demokratie nach westlichem Vorbild wird. Er fordert dennoch einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe. Es gibt einfach keine Alternative.
Diese Woche startet die Messe IAA Mobility in München. Wir blicken daher noch einmal auf verschiedene Auto-Trends.
Einen guten Start in die Woche wünscht


Herr Botschafter, das Programm “Zukunftsbrücke” hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 240 junge Menschen mit Berufserfahrung aus China und Deutschland zusammengebracht. Können Sie noch einmal erzählen, wie es zu diesem Erfolg kam?
Die Idee zu diesem Projekt hatte ich schon 2008, ein Jahr nach meiner Ankunft als Botschafter in China. Schon damals fehlten informelle Kanäle, um strittige Themen zwischen Deutschland und China vertrauensvoll zu besprechen. Wir wollten daher einen Prozess aufbauen, der neue Wege nachhaltiger Verständigung eröffnet. Vorbild war die Atlantik-Brücke. Es sollte ein über einen längeren Zeitraum gehendes Programm sein, in dem künftige Führungspersönlichkeiten aus beiden Ländern zusammenkommen. Jedes Jahr 15 junge Führungskräfte aus jedem Land, nicht nur “Fachidioten”, sondern spannende Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft. Wir wollten dadurch möglichst viele verschiedene Perspektiven in den Austausch über gemeinsam interessierende Themen einbringen.
Das klingt ambitioniert.
Durchaus, aber es ist erstaunlich schnell zur Realisierung gekommen. Im Rahmen seines Chinabesuchs Ende 2008 nahm der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Idee sehr positiv auf. Gemeinsam konnten wir bei dieser Gelegenheit gleich auch Bernhard Lorentz, damals Chef der Stiftung Mercator, für die Durchführung des Projekts gewinnen. In der Erklärung der beiden Regierungschefs beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in China 2010 wurde die Zukunftsbrücke dann erstmals von beiden Regierungen begrüßt – neben der mutigen Ausstellung der drei staatlichen Museen Berlin, Dresden und München zur Kunst der Aufklärung. Bei den ersten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen 2011 in Berlin wurde die deutsch-chinesische Zukunftsbrücke dann offiziell aus der Taufe gehoben.
Die Unterstützung von ganz oben hat dann gewirkt?
Ja, das war sehr wichtig. Beide Regierungen haben damit die Schirmherrschaft übernommen. Schon 2012 hat das erste Camp der Zukunftsbrücke in Hangzhou stattgefunden, danach jährlich, rotierend einmal in China, einmal in Deutschland. Neben Peking und Berlin ging es auch immer an einen zweiten Ort in der Provinz im jeweiligen Land. Inhaltlich lag von Anfang an ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsthemen – mit unterschiedlichen Facetten. Neben Energie und Klima standen beispielsweise die soziale Dimension oder die Neuordnung internationaler Partnerschaften zur Diskussion. Selbst kontroverse Themen wie das jeweilige Menschenrechtsverständnis wurden intensiv und spannend diskutiert.
Inwiefern?
Beide Seiten entdeckten immer wieder falsche Vorstellungen von der eigenen Gesellschaft beim jeweils anderen. Umso wichtiger war es, aktiv zuzuhören und sich auf die jeweils andere Perspektive einzulassen. Im Mittelpunkt stand immer das persönliche Verstehen, das sogenannte Bonding. Regelmäßige Alumni-Treffen wie jetzt am Wochenende dienen dazu, diese Bande zu vertiefen. Es soll eben kein einmaliger thematischer Austausch sein, sondern die Schaffung eines nachhaltigen Netzwerks.
Das ist ein schönes Ziel – aber der Austausch mit China ist auch immer schwieriger geworden. Wie geht es dem Programm heute?
Wir haben bis 2019 jedes Jahr ein Camp veranstaltet, 2020 und 2021 ging das wegen Corona nicht mehr. In diesem Jahr ist der ursprünglich von beiden Regierungen avisierte Zehnjahreszeitraum abgelaufen. Ob der Prozess in eine zweite Phase gehen wird, ist derzeit noch offen, aber angesichts der vorherrschenden Spannungen zwischen beiden Seiten eher unwahrscheinlich…
…also aufgrund der Anfeindungen und Sanktionsrunden.
Wann sich die Lage wieder entspannt, muss man weitersehen. Ich bin überzeugt, dass beide Seiten den Wert eines solchen Austauschprozesses verstehen. Wir in Europa müssen besser verstehen, was China antreibt – umgekehrt müssen wir erklären, wie unsere Gesellschaften ticken und was unsere Visionen sind.
Auch in China gibt es Vorurteile?
Natürlich. Zum Beispiel wird überhaupt nicht verstanden, woher unser Interesse an den individuellen Menschenrechten kommt. Die Diskussion wird in China oft als Vorwand gesehen, das chinesische Gesellschaftsmodell an den Pranger zu stellen. Das ändert sich, wenn man den Chinesen erklärt, dass gerade die massiven Menschenrechtsverletzungen in und durch Deutschland im 20. Jahrhundert bei uns ein besonderes Bewusstsein für die Wichtigkeit individueller Rechte geschaffen haben. Wenn ich persönlich erzähle, wie mich meine Herkunft aus Deutschland geprägt hat, dann steigt die Bereitschaft, mir zuzuhören.
Dennoch wollen viele Deutsche ihre chinesischen Gesprächspartner vor allem belehren. Das ist vermutlich wenig hilfreich?
Das gilt auch für andere Länder des Westens. Wir machen uns vorschnell unser Bild von der anderen Seite. Den Vertretern des Westens mangelt es oft am Willen, gemeinsame Chancen und Interessen zu sehen. Die belehrende Sprache findet sich aber zunehmend auch auf chinesischer Seite.
Derzeit sind die Beziehungen ziemlich angeschlagen, die EU und China belegen sich mit Sanktionen, der Austausch ist auf einem Tiefpunkt. Wie brechen wir das jetzt wieder auf?
Wir müssen die Kanäle nutzen, die es noch gibt. Ein Beispiel sind Kooperationen der Umweltministerien. Klima und Biosphäre sind ein “global common good”, globales Gemeinschaftseigentum. Hier bestehen konkrete gemeinsame Interessen der Europäer und der Chinesen, aber auch der Amerikaner.
Institutionen mit Chinabezug klagen jedoch derzeit darüber, dass gar keine Veranstaltungen mehr stattfinden, auf denen sie Gesprächsbereitschaft signalisieren können.
Das stimmt, insbesondere der Spielraum für Zivilgesellschaft wird in China immer enger. Wir sollten von deutscher Seite immer wieder Dialogangebote machen. In der Vorbereitung können wir unseren chinesischen Gesprächspartnern ohne jede Form von Paternalismus sagen: Wir sind an wirklichem Austausch interessiert. Eine moralisierende Haltung schadet hier nur. Stattdessen sollten wir versuchen, zu verstehen, wo Chinas Interessen liegen und unsere eigenen Interessen erklären. Wir müssen mit kritisch-konstruktivem Blick an das Land herangehen, keinesfalls naiv-blauäugig, aber doch in dem Wissen, dass wir gerade mit einer so gewichtigen Gesellschaft auch künftig einen Austausch haben müssen, und überlegen müssen: Wie kriegt man das hin?
Und? Wie kriegt man das hin?
Uns muss immer bewusst sein, wie wichtig ehrlicher Dialog und gegenseitiges Vertrauen sind – gerade angesichts so großer Unterschiede. China ist Partner, Wettbewerber und strategischer Rivale in einem, wie die EU festgestellt hat. Wir müssen uns von dem Wunschdenken verabschieden, dass China unsere Interessen und Werte teilt. Ganz direkt: China war nie eine Demokratie, war nie ein Rechtsstaat, und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dahin entwickelt, ist gering. Wir waren schon immer systemische Rivalen; was sich geändert hat ist, dass China Großmacht geworden ist.
Also sollen wir alles abnicken, was China macht?
Natürlich nicht. Aber wir brauchen China und China braucht uns bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen. Kooperation bleibt unerlässlich. Aber China darf sich natürlich nicht außerhalb des Völkerrechts stellen. Das Folterverbot oder der Schutz von Menschenrechtsanwälten gilt für China genauso wie in europäischen Ländern. China muss sich auch in Hongkong an das Völkerrecht halten, also an den Übergabevertrag mit Großbritannien. An solchen Stellen muss Europa nicht nur bereit sein, eine klare rote Linie zu ziehen, sondern auch klar kommunizieren, was passiert, wenn China diese rote Linie überschreitet.
Wo verläuft die nächste rote Linie?
Eine gewaltsame Vereinigung Taiwans mit China markiert eine rote Linie. Europa sollte in diesem Falle bereit sein, Taiwan zu unterstützen. Und es sollte klarmachen, welche Handlungsmittel es einzusetzen bereit ist, um seine Ankündigungen umzusetzen. Europa muss auch hier glaubwürdig sein. Wir sollten mit Augenmaß, aber auch mit Selbstbewusstsein an die Rivalität mit China herangehen.
Umso wichtiger ist der zivilgesellschaftliche Austausch, bevor es überhaupt zu solchen Krisenszenarien kommt. Auf welcher Seite sehen Sie mehr guten Willen zum Dialog?
Auf Regierungsebene ist der gute Wille derzeit auf beiden Seiten nur sehr eingeschränkt vorhanden. Zivilgesellschaftlich ist er sehr viel größer. Die deutschen Stiftungen beispielsweise sind bereit, ihren Beitrag zu leisten und einen Austausch mitzutragen, in welcher Form auch immer. In China ist das schwieriger, weil die Zivilgesellschaft immer mehr in ihrer freien Entwicklung beschränkt ist. Das ist sehr bedauerlich, und ich glaube, dass sich die chinesische Regierung hiermit keinen Gefallen tut.
Gibt es in China überhaupt noch geeignete Ansprechpartner?
In China gibt immer noch zahlreiche Organisationen und Institutionen, die gesprächsbereit sind. Beispielsweise Thinktanks wie das Center for China and Globalization, oder die Universitäten. Wir sollten immer wieder versuchen, Dialogformate zu eröffnen, die von beiden Seiten getragen werden.
Sie meinen große Fachkonferenzen?
Nein, ich bin vielmehr für kleine Dialogformate. Große Konferenzen sind zu öffentlich, um frei reden zu können. Die Veranstaltungen sollten themenbezogen sein, aber einen vertraulichen Austausch zulassen. Mit der BMW Foundation haben wir in den letzten Jahren das Format “Global Table” entwickelt, in dem wir circa 30 kluge Köpfe aus unterschiedlichen Regionen der Welt zusammenbringen. Sowas kann man natürlich auch innerhalb einer Region oder bilateral machen.
Die Themensetzung spielt vermutlich ebenfalls eine Rolle?
Es geht darum, sich auf gemeinsame Interessen zu konzentrieren. Umwelt und Klima sind solche Themen. Jeder Einzelne sollte die Bereitschaft mitbringen, an notwendigen Veränderungsprozessen mitzuarbeiten. In jedem Falle ist es essenziell, dass ein respektvoller Dialog auf Augenhöhe stattfindet.
Michael Schaefer (72) ist als ehemaliger Diplomat und Stiftungs-Chef ein Vollprofi in der Sphäre des deutsch-chinesischen Austauschs. Von 2007 bis 2013 war er Botschafter in Peking, danach für acht Jahre Vorstandsvorsitzender der BMW Foundation. Er ist weiterhin Mitglied der Trilateralen Kommission, einer Denkfabrik für den Austausch zwischen Amerika, Europa und Asien.
Chinas Tech-Riesen haben es derzeit eilig, Spenden unters Volk zu bringen. Alibaba legte vergangene Woche die Messlatte auf eine ganz neue Höhe: Der Onlinehändler kündigte an, in den kommenden fünf Jahren 100 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 13 Milliarden Euro, für wohltätige Zwecke spenden zu wollen. Die Summe entspricht rund zwei Drittel des jüngsten Jahresgewinns von Alibaba.
Großzügig hatten sich in den Tagen zuvor bereits die Alibaba-Konkurrenten Tencent und Pinduoduo gezeigt, die jeweils erklärten, 50 Milliarden beziehungsweise zehn Milliarden Yuan bereitstellen zu wollen.
Chinas Tech-Giganten und andere private Konzerne scheinen zu dem Ergebnis gekommen zu sein, dass philanthropische Großtaten eine effektive Strategie sind, um sich der neuen Realität der Pekinger Wirtschaftspolitik zu stellen.
Wie die aussieht, wurde in den vergangenen Monaten durch die knallharten Eingriffe der Regulatoren deutlich. Plötzlich mischten sich die Behörden überall ein. Sie nahmen vor allem die Geschäftspraktiken der Tech-Riesen ins Visier. Doch auch der Immobilienmarkt, der Bildungssektor und die Unterhaltungsindustrie wurden mit strengeren Regeln und Verboten belegt.
Rund drei Billionen US-Dollar wurden durch die Eingriffe Pekings laut einer Schätzung der US-Bank Goldman Sachs an den Märkten ausgelöscht. Einige Beobachter sprechen bereits von einem Paradigmenwechsel. “Nach 40 Jahren, in denen der Markt eine wachsende Rolle bei der Förderung des Wohlstands spielen konnte, haben sich Chinas Führer an etwas Wichtiges erinnert – sie sind Kommunisten”, spitzte die Finanzagentur Bloomberg die Lage kürzlich in einem Kommentar zu.
China will den Kapitalismus freilich nicht abschaffen. Die Führung sieht aber die Notwendigkeit, gegen zunehmende Ungleichgewichte bei der Verteilung des Wohlstands vorzugehen. Auch soll die Macht großer Konzerne beschränkt und stattdessen kleine und mittelgroße Unternehmen gefördert werden. Als der Reformer Deng Xiaoping in den 80er-Jahren die wirtschaftliche Öffnung Chinas vorantrieb, lautete das Motto noch: “Lasst einige zuerst reich werden”. Das hat geklappt, schließlich gibt es heute in China so viele Milliardäre wie in keinem anderen Land.
Staats- und Parteichef Xi Jinping hat nun ein neues Mantra festgelegt. Gebetsmühlenartig wiederholten Staatsmedien zuletzt seinen Slogan vom “allgemeinen Wohlstand”. Den gab es zwar bereits zu Gründungszeiten der Kommunistischen Partei, lange wurde er aber nicht mehr so inbrünstig propagiert wie in diesen Tagen. Die Pekinger Führung hat genug von “irrationaler Kapitalexpansion” und “barbarischem Wachstum”. Das machte Xi in einer Rede Ende August deutlich (China.Table berichtete).
Unklar ist, wie weit es Peking mit der großen Umverteilung tatsächlich treiben will. So weisen Beobachter auf den anstehenden Parteikongress im kommenden Jahr hin, auf dem Xi sich seine dritte Amtszeit sichern wird. Vor solchen wichtigen Ereignissen kam es auch in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Peking die Schrauben anzog.
Viele der zuletzt verhängten Maßnahmen gegen die Konzerne werden vom Volk unterstützt. Alibaba darf Händler nun etwa nicht mehr dazu zwingen, seine Produkte exklusiv auf den eigenen Plattformen anzubieten. So soll mehr Wettbewerb ermöglicht werden. Dass Essenslieferanten den Mindestlohn verdienen und eine Krankenversicherung haben, sollte ebenfalls selbstverständlich sein. In sozialen Medien applaudierten zudem viele Nutzer der Entscheidung, gegen ausufernden Nachhilfeunterricht vorzugehen, mit dem einige wenige Anbieter viel Geld verdienten (China.Table berichtete).
Die großen Tech-Konzerne mögen sich zwar über die angezogenen Zügel ärgern, sie wissen aber auch, dass ihre Gewinne trotz schärferer Regulierung weiter sprudeln werden. Mit ihren großzügigen Spenden zeigen sie Peking, dass sie hinter der Führung stehen. Laut einer Auswertung von Bloomberg haben mindestens 73 börsennotierte Firmen in China in ihren letzten Quartalsberichten den Begriff “allgemeiner Wohlstand” verwendet.
Linientreue mag sich kurzfristig für die Unternehmen auszahlen. Doch gibt es auch warnende Stimmen vor Pekings neuer Marschrichtung. Reiche Menschen und Unternehmer ins Visier zu nehmen, schade der Schaffung von Jobs, schreibt der Pekinger Wirtschaftsprofessor Zhang Weiying. Es dämpfe den Konsum und führe die Nation letztendlich zurück in die Armut. Die marktorientierten Reformen seit den späten 1970er-Jahren haben China zu einer gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft gemacht, so Zhang. Eine freie Wirtschaft habe einfachen Leuten die Möglichkeit gegeben, aus der Armut herauszukommen und reich zu werden. Gehe das Vertrauen in den Markt verloren, werde China nicht “gemeinsamen Wohlstand”, sondern “gemeinsame Armut” erfahren.
Chinas Staatsmedien verbreiteten dagegen zuletzt lieber den radikalen Kommentar eines Internet-Bloggers, der in eine ganz andere Richtung geht. “Dies ist eine Transformation von kapitalzentriert zu menschenzentriert”, schrieb der Autor in seiner Lobeshymne zum derzeitigen Crackdown und fügte hinzu: “Der Kapitalmarkt wird kein Paradies mehr für Kapitalisten sein, um über Nacht reich zu werden.” Gregor Koppenburg/Joern Petring
Die deutsche Industrie will eine rote Linie für den Umgang mit China und seiner Wirtschaftspolitik. “Wer vom freien Zugang zu unserem Markt weiter profitieren will, muss sich an Grundregeln halten und auch seinen eigenen Markt öffnen”, sagte der Präsident des Branchenverbands BDI, Siegfried Russwurm, der Deutschen Presse-Agentur.
Er sieht eine gemeinsame Agenda mit anderen Staaten als notwendig: “Ich bin optimistisch, dass sich eine internationale Koalition für den richtigen Umgang mit Peking schmieden lässt”, sagte Russwurm. Innerhalb der EU sei der Konsens relativ breit, auch mit den USA sowie Ländern wie Australien, Neuseeland, Japan und Kanada gebe es große Übereinstimmung.
Da gerade China für viele deutsche Unternehmen einer der wichtigsten Märkte weltweit ist, ist auch der Wettbewerb groß. Zuletzt hatten Waren aus China der deutschen Exportwirtschaft zunehmend auch in der EU Konkurrenz gemacht. Von der Corona-Krise erholte sich die chinesische Wirtschaft schneller als die europäische. Während die EU chinesischen Unternehmen weitgehend freien Zugang zu ihrem Markt gewährt, schottet China seinen eigenen Markt stärker ab.
Weil China immer wieder gegen weltweit geltende Regeln – wie bei der Einhaltung der Menschenrechte – verstoße, sieht der BDI-Chef Risiken für die Unternehmen. “Für Politik wie für Unternehmen gilt, dass sie ihre roten Linien kennen müssen, hinter die man nicht zurückgeht”, unterstrich er. “Ein Unternehmen kann nicht das Risiko akzeptieren, dass in seiner Wertschöpfungskette Zwangsarbeit oder Kinderarbeit passieren. Da muss jedes Unternehmen für sich seine roten Linien finden”, sagte der BDI-Chef. niw
In China sind im August die Autoverkäufe signifikant gefallen. Laut Daten des Herstellerverbands CAAM ist die Zahl der verkauften Fahrzeuge im vergangenen Monat gegenüber dem Vormonat um 22 Prozent zurückgegangen. Die Meldung kommt nur wenige Tage, nachdem der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) verkündet hatte, dass im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 13 Prozent gefallen sei.
Beide Verbände berechnen ihre Daten anhand unterschiedlicher Kriterien. Während der Herstellerverband CAAM auch Nutzfahrzeuge und den Absatz der Produzenten an die Händler einbezieht, dient bei CPCA der Absatz von Pkw, SUV und Minivans an die Kunden als Berechnungsgrundlage. Extremwetter-Lagen mit Überschwemmungen und eine Zunahme von Coronavirus-Infektionen hatten Kunden zuletzt davon abgehalten, in die Verkaufsräume der Autohändler zu gehen.
Bei einem Branchentreffen warnte Vize-Industrieminister Xin Guobin allerdings, dass die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Chip-Knappheit die Autoproduktion in China weiterhin beeinträchtige. So erwartete die Autobranche zuletzt, dass der Chipmangel bereits Ende Juli nachlassen und so die Verkäufe im August stützen könnte. Aufgrund der Delta-Variante in Südostasien mussten jedoch mehrere Chipfabriken ihre Produktion einstellen, was zu einem erheblichen Mangel an Autochips führte. niw
Der chinesische Halbleiterhersteller Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) investiert rund siebeneinhalb Milliarden Euro in einen neuen Standort bei Shanghai. Das Unternehmen reagiert damit auf globale Lieferengpässe, die auch in der deutschen Industrie die Bänder stillstehen lassen. Projektpartner ist die Lingang Free Trade Zone (FTZ) in Pudong. SMIC wiederum finanziert die Expansion zum Teil aus einem staatlichen Förderfonds für die Halbleiterbranche.
SMIC will in Shanghai allerdings keine neue Technik an den Start bringen, sondern Chips ab 28 Nanometern Strukturbreite herstellen. Für Hightech-Anwendungen wie rasend schnelle Prozessoren werden derzeit Elemente mit sieben Nanometern Strukturbreite verwendet. Der Weltmarktführer TSMC aus Taiwan arbeitet derzeit sogar bereits an Drei-Nanometer-Chips. Die 28-Nanometer-Klasse, die jetzt in Shanghai entstehen soll, eignet sich eher für gröbere Anwendungen wie Wifi-Bauelemente. Doch auch Chips, wie sie in Autos verwendet werden, fallen in diese Kategorie. fin
Die Klimagespräche des US-amerikanischen Klimasonderbeauftragen John Kerry sind in China am Freitag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Chinesische Beamte hätten der US-Regierung klarmachen wollen, dass es “unmöglich ist, Chinas Zusammenarbeit beim Klimawandel zu gewinnen und gleichzeitig in wichtigen Fragen eine anti-chinesische Haltung einzunehmen”, sagte Shi Yinhong, Professor für internationale Beziehungen an der Pekinger Renmin-Universität, gegenüber der South China Morning Post.
Bereits vor den zweitägigen Gesprächen hatte China den USA Bedingungen für eine Kooperation im Klimaschutz gestellt. Washington könne nicht einerseits versuchen, die Entwicklung seines Landes einzudämmen – und andererseits auf eine Zusammenarbeit drängen, sagte Außenminister Wang Yi während eines Besuchs von Kerry am Donnerstag in Tianjin. Wang warf der Regierung von Präsident Joe Biden eine “große strategische Fehlkalkulation gegenüber China” vor (China.Table berichtete).
Wang hatte damit Kerrys Forderung zurückgewiesen, Klimaschutz isoliert zu behandeln. “Die amerikanische Seite will, dass Klimakooperation eine ‘Oase’ in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen ist, aber wenn diese ‘Oase’ von Wüste umgeben ist, wird sie früher oder später von der Wüste erfasst werden”, so Wang laut einer Mitteilung des Außenministeriums.
Dass Kerry dennoch neben Wang und dem Klimasondergesandten Xie Zhenhua mit dem stellvertretenden chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Han Zheng und dem hochrangigen Politiker und USA-Kenner Yang Jiechi zusammentraf, wird als Signal gesehen, dass Peking versucht, über die Klimagespräche hinaus Themen anzusprechen, die zu den andauernden Spannungen zwischen beiden Staaten führt.
Das Treffen kommt wenige Woche vor dem Klimagipfel in Glasgow im November. Experten weltweit sind sich einig, dass ohne eine Zusammenarbeit von China und den USA keine Fortschritte bei der Eindämmung des Klimawandels erreicht werden können. niw
Die EU braucht nach Ansicht ihres Außenbeauftragten Josep Borrell ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein für eine einheitliche Chinapolitik. Der Block müsse zudem Einheit und “einen pragmatischen, realistischen und kohärenten Ansatz mit China” haben, sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister am Freitag. “Außerdem müssen wir uns mit China in Bezug auf Afghanistan auseinandersetzen. Wettbewerb, aber auch Zusammenarbeit in Handels- und Wirtschaftsfragen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Beziehungen zu China”, so Borrell.
Der EU-Außenbeauftragte und die Minister sprachen bei ihrem Treffen in Slowenien zudem mit den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar über den Indopazifik-Raum. Brüssel will noch in diesem Monat seine Strategie für die Region vorstellen. Zudem wird erwartet, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen das Thema in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union (SOTEU) Mitte des Monats ansprechen wird.
Indien ersetze jedoch China nicht als genereller Gesprächspartner in Asien, betonte der slowenische Außenminister Anže Logar nach dem informellen Treffen. Sein Heimatland hält derzeit die EU-Ratspräsidentschaft. “Indien wird China nicht ersetzen, weil China und Indien unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und unterschiedlichen Handelsbeziehungen zu Europa sind, aber wir wollen unsere Beziehungen zu Indien stärken”, so Logar. So müsse beispielsweise weiter am Abschluss eines Handels- und Investitionsabkommens mit Indien gearbeitet und die Zusammenarbeit in Hinsicht auf die Sicherheit der Region gestärkt werden, sagte Logar. ari

Wer dem Niedergang der Rheinmetropole Duisburg als einstige Montanstadt nachspüren möchte, ist auf dem Gelände des ehemaligen Krupp-Hüttenwerks Rheinhausen am falschen Ort. Seit den späten 1990er-Jahren erzählt der Ort die Geschichte des schwierigen Strukturwandels von der Kohle- und Stahl-Metropole zum globalen Logistikzentrum. Die Probleme wie hohe Arbeitslosigkeit und Verschuldung sind allerdings noch längst nicht überwunden. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hat Rasmus C. Beck im Frühjahr dieses Jahres die geschäftsführende Leitung der Duisburger Wirtschaftsförderung, die inzwischen Duisburg Business Innovation heißt, übernommen.
Der Herausforderung ist sich Beck durchaus bewusst: “Marxloh kennt jeder, weil die Kanzlerin hier war.” 2015 wurde Angela Merkel bei ihrem Besuch vor Ort ausgebuht. Gleichzeitig findet Beck, dass die Potenziale der Stadt völlig unterbewertet sind: “Es gibt hier noch den letzten industriellen Kern im Ruhrgebiet und hier wird die Transformation der Stahlproduktion hin zur Klimaneutralität stattfinden.” Außerdem gibt es einen weiteren wichtigen Partner, der beim Wiederaufstieg der Stadt mithelfen soll: China.
Das Seidenstraßenprojekt bildet einen wichtigen Baustein im Konzept, mit dem Beck die Stadt voranbringen will: “Mir ist keine Erfolgsstory in der Wirtschaftsförderung bekannt, die nicht international eingebettet ist.” Die zwei weiteren Eckpfeiler sind eine gute Universität, die Knowhow entwickelt, sowie stadteigene Flächen, die der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden können. Dass der Endpunkt der neuen Seidenstraße am Duisburger Hafen liegt, sieht Beck als Geschenk. Zufall ist es allerdings nicht, meint Beck: “Es passt gut mit unseren Kompetenzen zusammen, die wir als Handelsstadt haben. Der Handel bestimmt die Stadt bereits seit ihrer Gründung.”
Angst vor einer Vereinnahmung durch chinesische Investoren hat der 41-Jährige nicht, dafür sei Duisburg zu breit aufgestellt. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit mit China und die Teilnahme an der neuen Seidenstraße auch ein kulturelles Projekt, findet Beck: “Ideen und Knowhow kommen nicht in Containern. Aber die Container sind eine gute Grundlage, dass wir auch einen kulturellen Austausch beginnen.” Die Arbeit des Konfuzius-Instituts an der Universität Duisburg-Essen begrüßt Beck genauso wie das Institut für Ostasienwissenschaften, außerdem verweist er darauf, dass Duisburg die erste deutsche Stadt war, die eine Städtepartnerschaft mit einer chinesischen Großstadt aufgenommen hat.
In China war Beck selbst das letzte Mal 2019 in Shenzhen. Bei seinen Besuchen in China beeindruckt ihn vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich das Land entwickelt. “Damit meine ich insbesondere auch das Tempo, mit dem sich der Lebensstandard für die ärmere Bevölkerung verbessert hat”, sagt Beck. Auch bei der Offenheit für digitale Lösungen im Alltag seien die Chinesen schon weiter – egal ob es das autonome Fahren oder 5G-Technologie ist.
Am Ende ist Beck überzeugt, dass die Unterschiede zwischen Deutschland und China tatsächlich nicht so groß sind, wie es häufig unterstellt werde. “Natürlich hat China ein anderes politisches System und ist ein riesengroßes Land mit anderen Entwicklungsnotwendigkeiten”, sagt Beck. Die autoritären Strukturen in China helfen zwar dabei, Prozesse zu beschleunigen, allerdings sei die Qualität, in der sich das Land mittlerweile entwickle, auf Augenhöhe mit dem Westen. Das sei beispielsweise in der Baubranche so. Bei Zukunftsthemen wie Smart Citys könne Deutschland mittlerweile von China lernen. “Ich finde, wir sollten die gegenseitige Bewunderung nutzen, um in den Austausch zu kommen. Auch über die kritischen Themen, vor allem aber über die gemeinsamen Chancen.” David Renke
Stephan Kneipp ist neuer COO bei Elaris. Elaris mit Sitz in Rheinland-Pfalz vertreibt die Modelle des chinesischen Herstellers Dorcen. Zuvor war Kneipp bei der Antriebsstrang-Sparte bei Powertrain Solutions von Bosch als Head of Digital Ventures and Data Driven Business tätig.
Dominik Lembke ist seit August Director Product Development bei Svolt. Lembke soll die Kunden in Europa und die Entwicklungsabteilungen des Batterie-Herstellers in Europa und China zusammenführen. Der 37-Jährige kommt von Porsche in Weissach, wo er zuletzt den Bereich BEV-Batteriesysteme geleitet hatte und technischer Projektleiter für den Bereich HV-Batterien war.
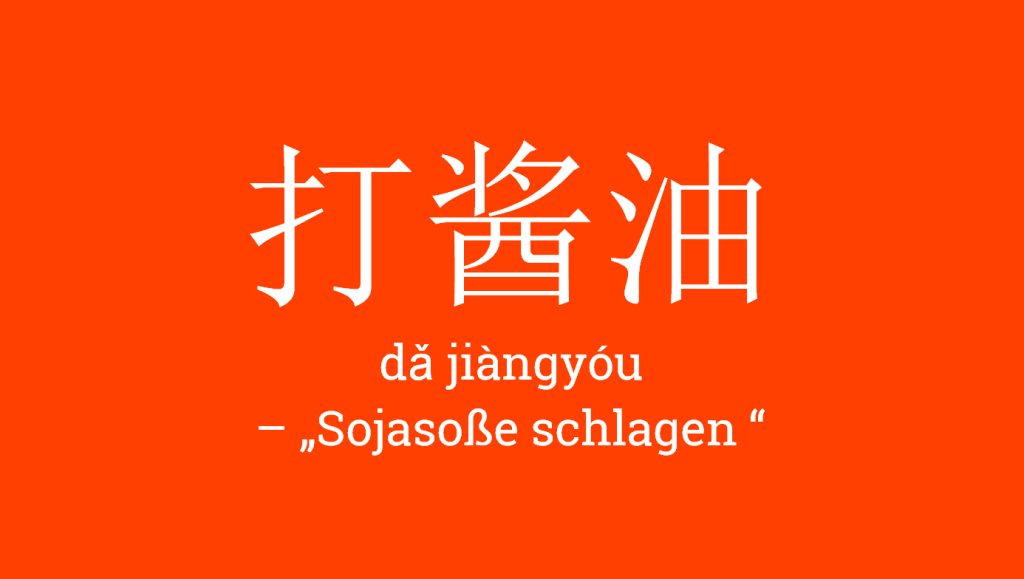
“Ich schlag’ hier nur die Sojasoße!” Das wäre doch mal ein origineller Konter, um sich bei unliebsamen Angelegenheiten souverän aus der Affäre zu ziehen. In China trended der Begriff “Sojasoße schlagen” (打酱油 dǎ jiàngyóu) mittlerweile als Synonym dafür, einer Sache nur als Unbeteiligter oder zufälliger Zuschauer beizuwohnen. Doch was zum Teufel hat das mit “geschlagener Würzsoße” zu tun?
Ursprünglich leitete sich diese Redensart aus einer alten Einkaufsgewohnheit aus dem Prä-Lieferservice- und Prä-Supermarkt-Zeitalter ab (ja, das gab es). Wie man bei uns einst die Milch holte, so ging man damals in China Sojasoße kaufen: nämlich mit einem selbst mitgebrachten Behälter (erlebt heute bei uns übrigens unter dem Label “Zero Waste” ein Revival). Mit Krug oder Flasche schlenderten die Chinesen damals zum Soßenhändler, der die Würzsoße je nach individuellem Bedarf in beliebiger Menge abfüllte.
Das Ganze nannte man 打酱油 dǎ jiàngyóu – “Sojasoße holen gehen”, wobei das Verb 打 dǎ (wörtlich “schlagen, hauen, klopfen”) hier in der Bedeutung “holen, besorgen” gebraucht wurde (ähnlich wie in 打水 dǎshuǐ “Wasser holen”). Heute gilt der Ausspruch in der Internetsprache gewissermaßen als Synonym für “Geht mich nichts an!”. Eigentlich sei man ja nur auf dem Weg, “Sojasoße zu holen” und nicht der richtige Ansprechpartner, sondern nur Sojasoßenträger… äh… Lückenbüßer für die eigentlich Zuständigen.
Sojasoße und Wasser sind übrigens bei Weitem nicht das Einzige, was man auf Chinesisch “schlagen” kann. Der Eintrag für das Schriftzeichen 打 dǎ füllt in Wörterbüchern etliche Seiten. Man kann sich als Sprachenlerner mit diesem Verb und seinen Kombinationen quasi durch den kompletten chinesischen Alltag “schlagen”. Das glauben Sie nicht? Dann passen Sie mal auf!
Das beginnt schon beim ersten Gähnen nach dem Aufwachen (打哈欠 dǎ hāqiàn “ein Gähnen schlagen”) und dem Zurechtmachen vor dem Spiegel (打扮 dǎbàn “schminken, zurechtmachen” – wörtlich “die Kostümierung schlagen”). Mancher wird sich für den Gang ins Büro noch rasch eine Krawatte “umprügeln” (打领带 dǎ lǐngdài “Krawatte anziehen”). Der Blick aus dem Fenster verrät derweil nichts Gutes: Es “schlägt Donner” (打雷 dǎléi “donnern”). Beim Tritt vor die Tür heißt es also den Schirm “aufschlagen” (打伞 dǎsǎn “Schirm aufspannen”). Sie sind vielleicht ohnehin spät dran? Warum sich also nicht gleich ins Taxi “hauen” (打车 dǎchē “ein Taxi nehmen”). An der Firmenpforte ist dann erst einmal “Kartenschlagen”, pardon, “Stechen” (打卡 dǎkǎ) angesagt. Angekommen im Büro hauen Sie nicht gleich auf den Putz, sondern erst einmal eine Begrüßung raus (打招呼 dǎ zhāohu “einen Gruß schlagen”).
Dann wird rangeklotzt: telefonieren (“ein Telefonat schlagen” 打电话 dǎ diànhuà), tippen (“Zeichen schlagen” 打字 dǎzì) und drucken (“den Druck schlagen” 打印 dǎyìn). Vor dem nächsten Meeting noch schnell einen Entwurf “prügeln” (打草稿 dǎ cǎogǎo “Entwurf erstellen”) und das Budget “raushauen” (打预算 dǎ yùsuàn “Budget aufstellen”). Wenn die To-do-Liste abgehakt ist (打勾 dǎgōu “abhaken”, wörtl. – “einen Haken schlagen”), ist es hoffentlich auch schon Zeit für die Mittagspause mit “eingeschlagenem” Lunch und Coffee “to go” (打包 dǎbāo “zum Mitnehmen”, wörtlich “eine Tasche schlagen”).
Ist alles im Magen, kommt das Mittagspausen-“Dǎ-dǎ”: sich für ein Nickerchen aufs Ohr hauen (打盹 dǎdǔn “ein Nickerchen “schlagen“) und nach Lust und Laune schnarchen (打呼噜 dǎ hūlu “Schnarchgeräusche schlagen”). Den Feierabend lässt man dann vielleicht gemütlich mit dem “Prügeln” von Karten, Mahjong-Steinen oder anderen Spielen ausklingen (打牌 dǎpái “Karten spielen”; 打麻将 dǎ májiàng “Mahjong spielen”, 打游戏 dǎ yóuxì “gamen, zocken”) oder “kloppt” zur Abwechslung ein paar Bälle (打球 dǎqiú “Ballsport betreiben“).
Geben wir uns angesichts der “Schlagkraft” des chinesischen Vokabulars also einfach geschlagen, denn diese Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Wenn Sie es nicht glauben, schlagen Sie es gerne nach.
Verena Menzel betreibt in Peking die Sprachschule New Chinese.
