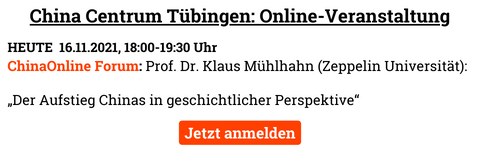ein EU-Abgeordneter erläutert uns die Hintergründe eines denkwürdigen Treffens. Charlie Weimers gehörte zu den Parlamentariern, die sich Ende Oktober mit Taiwans Außenminister Joseph Wu getroffen haben. Aus Pekinger Sicht ein Tabubruch – für Weimers jedoch erst der Anfang. Jetzt, wo China seine Drohungen gegenüber der Insel hochfährt, müsse Europa Farbe bekennen. Die EU müsse betonen, dass ein Vorgehen gegen Taiwan ernst Konsequenzen habe, sagte Weimers. Der Spielraum dafür sei größer denn je: Da das Vertrauen in China ohnehin erschüttert sei, gebe es weniger Bedenken, Peking zu verärgern.
Unsere EU-Korrespondentin Amelie Richter hatte derweil Einblick in den Entwurf des Richtungspapiers der Europäischen Union zu Verteidigung und Sicherheit. Tatsächlich zeichnet sich darin eine klarere Haltung des Bündnisses gegenüber Mächten mit deutlich abweichenden Interessen ab. Die Erkenntnis: Es reicht nicht mehr aus, nett und freundlich seine “Besorgnis” über das Weltgeschehen auszudrücken. Die EU müsse militärisch handlungsfähig werden, lautet einer der Eckpunkte. Leider wird es bis dahin noch sehr lange dauern. Dabei rennt den Politikern die Zeit davon.
Unter Zeitdruck steht auch der VW-Konzern. Er hat sich vorgenommen, in diesem Jahr eine Million elektrischer Autos zu verkaufen. Doch im größten Markt Chinas fand die Flaggschiff-Reihe mit dem ID.4 nur wenige Käufer. Der Vertrieb war einfach noch nicht gut organisiert. Jetzt bessert sich die Lage allerdings, analysiert Christian Domke Seidel. Die Verkaufszahlen steigen.


Kürzlich hat eine Delegation des Europaparlaments Taipeh besucht, der taiwanische Außenminister Joseph Wu war in Brüssel. Gibt es derzeit eine besondere Dynamik für die EU-Taiwan-Beziehungen?
Ja. Darüber hinaus wurde in der Woche vor dem Besuch von Minister Wu auch die Empfehlung des Europaparlaments zu den EU-Taiwan-Beziehungen herausgegeben. Es gibt also auf jeden Fall einen Impuls dafür.
Wie sehen Sie den Besuch der Abgeordneten des Sonderausschusses für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE) in Taipeh?
Das ist eine großartige Gelegenheit, mehr über bewährte Verfahren zur Bekämpfung chinesischer Desinformation zu erfahren. Die EU und Taiwan sollten viel stärker zusammenarbeiten, um die besten Ansätze zur Förderung der Medienfreiheit und des Journalismus zu finden, unsere Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit zu vertiefen und gemeinsam die Widerstandsfähigkeit Taiwans und der Mitgliedsstaaten der EU zu stärken.
Es war die allererste Delegation, die Taiwan besuchte. Warum wurde nicht schon früher eine Delegation geschickt?
Im Jahr 2016 rissen Trump und der Brexit ein riesiges Loch in die Erzählung vom “Ende der Geschichte” (“The End of History and the Last Men”). Im folgenden Jahr war Präsident Xi Jinping der Liebling von Davos, was einige dazu veranlasste, die Fantasie zu hegen, dass China eine von den USA geführte internationale Ordnung ersetzen würde. Viele übersahen die Zeichen der Zeit und dachten fälschlicherweise, dass ihre wirtschaftliche Zukunft in China liege.
In den letzten fünf Jahren ist es unvermeidbar geworden, Chinas Kampfbereitschaft gegenüber Nachbarn im nahen Ausland, die brutale interne Repression, Merkantilismus, den verleumdenden Einfluss in internationalen Institutionen und Drittstaaten, den Personenkult um Präsident Xi, zunehmende staatliche Kontrolle über Märkte, den demografischen Rückgang sowie Vertuschung, Desinformation und mangelnde Transparenz über die Ursprünge von Covid-19 zu sehen. Kurz gesagt, China ist kein zuverlässiger Partner mehr. Deshalb gibt es weniger Bedenken, China wegen Taiwan zu verärgern.
Glauben Sie, dass es Vergeltungsmaßnahmen aus Peking für den INGE-Besuch geben wird?
Als Reaktion auf EU-Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren hat China bereits Anfang des Jahres den Abgeordneten Raphaël Glucksmann (zusammen mit vier anderen EU-Abgeordneten) auf die schwarze Liste gesetzt. Im Oktober verweigerten sie einer US-Kongressdelegation Visa für China – es sei denn, sie stimmten zu, an einem bevorstehenden Besuch in Taiwan nicht teilzunehmen. Es ist durchaus möglich, dass sie auch die INGE-Abgeordneten sanktionieren.
Als Taiwans Außenminister Wu nach Brüssel reiste, gab es keine offiziellen Treffen mit Vertretern der EU-Kommission oder des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Hätten sich diese Ihrer Meinung nach mit Herrn Wu treffen sollen?
Ich denke, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hätte sich mit Minister Wu treffen sollen.
Sind Sie als EU-Parlamentarier mit der Leistung des EEAS in Bezug auf die Taiwan-Politik zufrieden?
Der EEAS hat damit begonnen, sich an das aktuelle Umfeld anzupassen.
Sie haben Herrn Wu in Brüssel getroffen – was hat er Ihnen gesagt und was war seine Botschaft an die EU?
Es war ein zukunftsweisendes Treffen, das sich auf die im Taiwan-Bericht des Europäischen Parlaments skizzierten Themen konzentrierte: Stärkung der Handelsbeziehungen, Taiwans Beteiligung an internationalen Organisationen, akademischer Austausch und Sicherheit in der Taiwanstraße. Außenminister Wu forderte eine Zusammenarbeit bei der weiteren Vertiefung der Beziehungen, einschließlich der Aufnahme von Verhandlungen über ein Investitionsabkommen.
Wie kann die EU Taiwan unterstützen?
Die Empfehlung des Europäischen Parlaments zu den politischen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan enthält viele Beispiele:
Die INGE-Delegation ist nach Taipeh gereist, um sich über Desinformation und Cyber-Angriffe zu informieren. Sind bereits konkrete Projekte zwischen der EU und Taiwan geplant?
Beide Seiten untersuchen Wege der Partnerschaft, einschließlich der möglichen Schaffung eines gemeinsamen Zentrums für Desinformation in Taipeh.
Die EU-Kommission hält sich in der offiziellen Kommunikation an die “Ein-China-Politik”. Glauben Sie, das muss sich ändern? Braucht die EU einen härteren Tonfall, wenn es um Taiwan geht?
Sowohl die Mitgliedstaaten als auch die EU-Institutionen haben damit begonnen, sich an die Entwicklungen im Indo-Pazifik anzupassen. Vorreiter sind Mitgliedstaaten wie Litauen und die Tschechische Republik.
Welche Reaktion haben Sie von der EU-Kommission auf Ihren Taiwan-Bericht erhalten?
Die Reaktion wurde während der Plenarsitzung im Oktober von EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager im Namen des EU-Außenbeauftragten Borrell mitgeteilt. Diese war sehr positiv. Beispielsweise sagte sie, dass die Europäische Union ein Interesse an der Verbesserung der Beziehungen und der Zusammenarbeit mit Taiwan hat. Außerdem sollen ihrer Antwort zufolge die Handels- und Investitionsbeziehungen mit “diesem wichtigen Partner und Technologieführer” vertieft verfolgt werden.
INGE-Delegationsführer Glucksmann sagte in Taipeh, dass hochrangige Treffen zwischen EU und Taiwan erforderlich sind – glauben Sie, dass es in naher Zukunft mehrere Treffen geben wird?
Angesichts gemeinsamer Interessen in wichtigen Bereichen, wie Halbleiter, Handel, Cybersicherheit, wäre es ratsam, das zu tun.
Was könnte die EU in Taiwan besonders interessieren?
Kooperationen im Bereich Cybersicherheit und Halbleiter sind interessant. Taiwan ist aber auch für die internationale Gemeinschaft wertvoll. Taiwan hatte als Erster die Weltgesundheitsorganisation über eine mögliche Mensch-zu-Mensch-Übertragung von Corona informiert, während die KP Chinas solche Behauptungen weitere drei Wochen lang zurückwies.
In Ihrem Bericht wird auch aufgefordert, den Namen des European Economic and Trade Office in Taiwan zu ändern – warum ist der Name in diesem Fall so wichtig?
Der Bericht fordert die EU-Kommission und den EEAS auf, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taiwan in “Büro der Europäischen Union in Taiwan” (“European Union Office in Taiwan”) zu ändern, um die große Bandbreite unserer Beziehungen mit der Insel besser widerzuspiegeln.
Charlie Weimers (39) ist konservativer Abgeordneter im Europaparlament. Der Schwede war zuletzt federführend für den ersten alleinstehenden Bericht des EU-Parlaments zu den Beziehungen zwischen Brüssel und Taipeh. In dem Papier fordern die EU-Abgeordneten eine engere Zusammenarbeit mit der Insel. Die Fragen beantwortete Reimers schriftlich.
Die EU will mehr Muskeln zeigen und bereitet sich mit einem neuen Strategiepapier auf ihre künftige Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor – China spielt dabei keine unerhebliche Rolle. Denn die Volksrepublik wird mehrfach namentlich in dem Entwurf erwähnt, der China.Table vorliegt. Am Montag wurde das Dokument bereits im Rat der EU-Außen- und Verteidigungsminister besprochen. Die Stoßrichtung ist klar gefasst: Die EU müsse künftig deutlich mehr als eine “Soft Power” sein, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kommentierte.
Um das zu erreichen, wiederholt die EU in ihrem Strategiepapier einerseits bereits bekannte Einschätzungen und betont ihren Ansatz der “strategischen Autonomie” zwischen Washington und Peking. Neu sind ein Ausbau der Abwehrinstrumente gegen Cyberattacken und Desinformations-Kampagnen. Außerdem soll eine schnelle EU-Einsatztruppe aufgebaut werden. Was Peking am meisten aufstoßen könnte: Brüssel will die koordinierte maritime Präsenz im Indo-Pazifik verstärken. Geplant ist, dass die Strategie beim Dezember-Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf die Tagesordnung kommt und dann im Frühjahr unter französischer EU-Präsidentschaft beschlossen wird.
Diese Punkte des Papiers sind wichtig für die EU-China-Politik:

Für VW nimmt China eine Schlüsselrolle ein, wenn es um die Zukunft der Mobilität und des Konzerns geht. Denn die Volksrepublik ist der weltgrößte Automarkt, die Kunden sind offen für Neuerungen und der Markt ist gleichzeitig sehr dynamisch und hart umkämpft. Besonders im Bereich der Elektromobilität. VW möchte noch im Jahr 2021 weltweit eine Million Elektro- und Plug-in-Hybride verkaufen. Weil der Konzern aber 40 Prozent seines Umsatzes in der Volksrepublik macht, muss diese Technologie dort ihre Abnehmer finden.
Genau das passierte aber erst einmal nicht, als VW Anfang des Jahres die Baureihe ID.4 präsentierte. Die Markteinführung floppte. Im Mai verkaufte das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht einmal 1.500 Stück, im Juni 3.400, im Juli 6.000 und im August 7.000 Stück. Die Maschinerie hatte Sand im Getriebe: Neben einem Halbleitermangel und dem Hochfahren der Produktion musste auch noch ein neuer Vertrieb geschultert werden.
Wer in China Elektroautos verkaufen will, der muss dorthin, wo die Kunden sind. Anders als in Deutschland fahren Chinesen nicht in irgendwelche Industriegebiete am Stadtrand, um sich ihren Wagen auszusuchen. Das hat auch Volkswagen erkannt. Die Einführung ihres Elektro-SUV ID.4 erfolgte jedoch so früh, dass das bestehende Vertriebsnetz die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte.
Erst im September knackte VW die Schwelle von 10.000 Fahrzeugen; im Oktober waren es dann immerhin 12.700. Hintergrund ist, dass gerade ein Netz an sogenannten ID.-City-Stores aufgebaut wird, das zum Marktstart noch löchrig war. Anfang November gab es davon aber immerhin 60 Stück. Sie liegen in zentraler Lage mit viel Laufkundschaft – beispielsweise in Shopping Malls. Bis Ende 2021 sollen es 170 Stück sein. Dazu kommen 1.500 ID-Händler mit 5.100 ID-Verkäufern in 230 Städten.
VW will mit den New Energy Vehicles (NEV) den gleichen Marktanteil erobern, den der Konzern schon mit den Verbrennern erreicht hat – rund 20 Prozent. Unter einem NEV versteht China ein Fahrzeug mit vollelektrischem (BEV), teilelektrischem (PHEV) oder Brennstoffzellenantrieb (FCEV) Antrieb. Zumindest bis ins Jahr 2025 sollen diese Modelle laut aktuellem Fünfjahresplan noch gefördert werden.
Entscheidend ist jedoch, dass diese NEV auch in China produziert werden müssen. VW hat dafür zwei Werke. Eines in Foshan und eines in Anting. Deren Gesamtkapazität liegt bei 600.000 Stück. Der deutsche Konzern ist gerade dabei, die produzierten Stückzahlen nach oben zu treiben. Im Jahr 2025 will und muss VW aber – um auf die gewünschten Marktanteile zu kommen – über eine Million E-Fahrzeuge in China produzieren, wie eine Konzernsprecherin gegenüber Table.Media erklärte. Ein entsprechender Ausbau der Kapazitäten muss also sein.
Doch gibt es auch Faktoren, auf die VW keinen Einfluss hat. Aktuell kämpft der Konzern – wie jeder Konkurrent auch – mit einer eklatanten Unterversorgung von Halbleitern. Etwa zehn Prozent fehlen dem Hersteller. Hintergrund war, dass Schneestürme samt Stromausfällen und Werksschließungen in Texas und ein Brand beim japanischen Zulieferer Renesas die ohnehin durch Corona angespannte Lage zusätzliche verschärft hatten.
Ein Problem, das aktuell nicht gelöst werden kann. VW rechnet damit, dass der Halbleitermangel noch weit über das Jahr 2021 ein Problem für die Marke sein wird. Nur ein bestimmter Teil des Bedarfs könne mit Brokerware gedeckt werden – also Halbleiter alternative Anbieter, deren Produkte dann aber noch eine Prüfung und Freigabe der technischen Entwicklung und Qualitätssicherung bedürfen. Halbleiter sind in der Automobilproduktion mittlerweile so wichtig wie im Elektroniksektor (China.Table berichtete).
Gerade in China, wo Kunden einen hohen Grad an Digitalisierung erwarten. Ein Bereich, in dem VW im Vergleich zu anderen Anbietern noch aufholen muss und das mit ID-Baureihe auch tut. Die Modelle sind allesamt sowohl mit Apple CarPlay als auch mit Baidu CarLife kompatibel (China.Table berichtete). Ein eigenes App-Angebot ermöglicht unter anderem die Steuerung des Smart Home oder eine Restaurant-Reservierung. Christian Domke Seidel
China will bis Jahresende alle Kinder zwischen drei und elf Jahren vollständig gegen Covid-19 impfen. Die Nationale Gesundheitskommission verkündete jüngst, dass bereits mehr als 84 Millionen Kinder im Alter zwischen drei und elf die erste Impfung bekommen haben.
“Die Impfung für Kinder ist freiwillig”, sagt Wang Dengfeng ein Beamter aus dem Bildungsministerium auf einer Pressekonferenz. Er lobte, dass von 160 Millionen Kinder in der Altersgruppe drei bis elf bereits die Hälfte eine Impfung erhalten habe.
Bereits im Juni hatte die chinesische Aufsichtsbehörde die Impfstoffe der Hersteller Sinovac und Sinopharm für die Altersgruppe zwischen drei und 17 Jahren zugelassen. Bisher wurden vor allem Impfungen von älteren Kindern priorisiert. So soll die Impfquote der 12 bis 17-Jährigen bei 90 Prozent liegen. Nachdem es jedoch zu Corona-Ausbrüchen an Grundschulen und in Kindergärten gekommen war (China.Table berichtete), scheint Peking sich nun dazu entschieden zu haben, auch die jüngeren Altersgruppen impfen zu wollen. In einer jüngsten Studie der Fachzeitschrift Lancet, wird der Impfstoff von Sinopharm für Kinder als sicher und gut verträglich bewertet.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien und Chile haben die beiden chinesischen Vakzine eine Notfallzulassung für Kinder ab drei Jahren erhalten. Auch Hongkong prüft seit Montag Sinovac für Kinder ab drei Jahren zuzulassen, so Bloomberg. Israel hat am Montag den Corona-Impfstoff von Biontech für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Auch die USA impfen Kinder ab fünf Jahren. Biontech hat auch in der EU eine Zulassung ihres Impfstoffes für 5- bis 11-Jährige beantragt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will voraussichtlich noch vor Weihnachten darüber entscheiden. niw
Seit ihren Vorwürfen gegen den hohen Kader Zhang Gaoli (China.Table berichtete) ist die bekannte Tennisspielerin Peng Shuai auf Social Media verstummt. Nach der Veröffentlichung ihres Berichts über sexuelle Übergriffe sind sämtliche ihrer Beiträge von der Plattform Weibo verschwunden. Der Verbleib der 35-Jährigen ist seit dem 2. November ungeklärt. Auf Weibo ist derzeit auch keine Suche nach dem Wort “Tennis” möglich. Die Women’s Tennis Association (WTA) fordert von China formale Ermittlungen gegen Zhang. “Peng Shuai, und alle Frauen, verdienen es, gehört statt zensiert zu werden”, so die WTA. Auf Twitter trendet das Hashtag #WhereIsPengShuai.
Zhang (74) ist einer der mächtigsten Männer Chinas. Unter anderem war er Vizepremier und Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros. Daher liegt die Annahme nahe, dass die Partei die Diskussion über den Fall unterdrückt. Der Zorn über die Übergriffe könnte zu Fragen nach der nicht eingehegten Machtfülle der Partei führen. Zhang soll seine Position ausgenutzt haben, um zunächst eine mehr oder weniger freiwillige Affäre mit Peng zu beginnen. Später soll er sie bei sich zu Hause auch zum Sex gezwungen haben. fin
Der Immobilienkonzern Dalian Wanda hat sich dem Gerücht entgegengestellt, dass Firmenchef Wang Jianlin verstorben sein soll. Er habe am Montag regulär einer Sitzung beigewohnt, teilte das Unternehmen mit. Ein Sprecher betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, der Firmenchef sei wohlauf. Online-Beiträge über den Tod Wangs seien falsch. Wanda habe Anzeige erstattet. fin
Der wachsende chinesische Kapitalmarkt, sowohl der Aktien- als auch der Anleihemarkt, wird von ausländischen Investoren oft vernachlässigt. Viele lokale chinesische (insbesondere technologieorientierte) Unternehmen wählen allerdings ein Initial Public Offering (IPO) als Finanzierungsform. Auch für chinesische Finanzinvestoren sind IPOs die bevorzugte Exit-Form. Anfang September kündigte Präsident Xi Jinping an, dass China eine neue Börse in Peking (Beijing Stock Exchange) einrichten und sie zu einer wichtigen Handelsplattform für innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausbauen wird. Die Pekinger Börse ist nun die dritte auf dem chinesischen Festland neben den seit den 90er-Jahren bestehenden Börsen in Shanghai und Shenzhen.
Bereits Ende 2021 könnte der Handel mit zunächst 70 Unternehmen aus der “ausgewählten Stufe” an der National Equities Exchange and Quotations Co., Ltd. (NEEQ, auch als “New Third Board” bekannt) aufgenommen werden. Diese wurde ursprünglich als Chinas Gegenstück zum NASDAQ im Rahmen des Aufbaus eines mehrstufigen Kapitalmarktsystems gegründet. Die Pekinger Börse soll so strukturiert werden, dass sie eine verbesserte Version des New Third Board darstellt und das Potenzial hat, sich als große dritte Säule auf dem Kapitalmarkt neben der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange zu etablieren.
Auf der offiziellen Website des National Enterprise Credit Information Publicity System wurde bekannt gegeben, dass die Unternehmensregistrierung für die Beijing Stock Exchange Co., Ltd., abgeschlossen und am 3. September 2021 gegründet sowie genehmigt wurde. Die neue Börse wird zu 100 Prozent im Besitz der NEEQ stehen, die alleinige Gesellschafterin ist. Das eingetragene Kapital beträgt eine Milliarde Yuan.
Die Ansiedlung der neuen Börse in der Hauptstadt kommt dabei nicht von ungefähr – sie hat sowohl praktische als auch politische Vorteile. Auf politischer Ebene könnte ein Faktor das Ungleichgewicht der Kapitalressourcen sein, da Chinas wichtigste Aktienmärkte derzeit in Ost- und Südchina positioniert sind. In praktischer Hinsicht hat Peking mit der NEEQ bereits den Grundstein für eine Börse gelegt, die auf KMU spezialisiert ist. Hauptziel der Gründung soll ein leichterer Zugang für KMU zum Kapitalmarkt sein, denn obwohl 99,8 Prozent der Unternehmen in China als KMU gelten und circa 50 Prozent der Steuereinnahmen Chinas stellen, hat ein Großteil der Unternehmen erhebliche Schwierigkeiten beim Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen.
Die Ankündigung und Gründung erfolgt in einer Zeit, in der die Besorgnis über eine mögliche Abkopplung der chinesischen Wirtschaft zunimmt und die US-Regierung Maßnahmen ergreift, chinesischen Unternehmen den Börsengang in den USA zu erschweren. So sind seit Ende 2020 chinesische Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind, verpflichtet, sich einer Prüfung durch eine US-Aufsichtsbehörde zu unterziehen. Viele chinesische Unternehmen sehen sich gezwungen, ihre Notierung aufzugeben, da es ihnen untersagt ist, ausländischen Aufsichtsbehörden ohne Genehmigung der chinesischen Regierung Zugang zu ihren Buchhaltungsunterlagen zu gewähren.
Zudem kündigte Anfang Juli 2021 die chinesische Cyberspace-Behörde an, dass Unternehmen mit mehr als eine Million Nutzern einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden müssen, bevor sie ihre Aktien im Ausland notieren dürfen. Da die Regulierungsbehörden befürchten, dass chinesische Unternehmen, die Daten ins Ausland übertragen, Risiken für die Cybersicherheit und die nationale Sicherheit verursachen könnten, ergreift China Maßnahmen, um Unternehmen zu ermutigen, ihren Börsengang im Inland zu forcieren. Die Gründung der Pekinger Börse könnte somit Teil dieser Bemühungen sein.
Die Pekinger Börse wird eine andere Rolle spielen als die bestehenden Börsen in Shanghai und Shenzhen, und gleichzeitig die Verbindung mit diesen Märkten aufrechterhalten. So dürfen beispielsweise Aktien an der Pekinger Börse unter bestimmten Bedingungen auf die Börsen in Shanghai und Shenzhen übertragen werden. Die Shanghaier Börse ist heute die größte Festlandchinas und eine wichtige Säule der Volkswirtschaft. Sie ist spezialisiert auf die Listung von Unternehmen grundlegender Industrien und Schlüsselbranchen.
Zusätzlich wurde im Sommer 2019 mit dem Science and Technology Board (STAR Market) ein auf Start-ups und Hightech-Unternehmen spezialisierter Handelsplatz etabliert. Vor allem Unternehmen aus der Hightech-Branche, aus strategischen neuen Industrien wie Informationstechnologie der neuen Generation, High-End-Ausrüstung, neue Materialien, alternative Energiegewinnung und -einsparung, Umweltschutz sowie Biomedizin und weitere, sind am STAR Market gelistet.
Die Börse Shenzhen listet verschiedene Marktindizes mit unterschiedlicher Marktpositionierung, z.B. Blue Chips mit hoher Marktkapitalisierung. Als zweiter Markt – ähnlich dem amerikanischen NASDAQ – wurde 2009 der ChiNext etabliert, der auf Privat- und Technologieunternehmen spezialisiert ist. Mit der Pekinger Börse soll nun für KMU ein spezialisierter Handelsplatz geschaffen werden. Zugleich wird NEEQ, wo bis Ende 2020 rund 6.000 KMU gelistet waren, aufgewertet.
Mitte September gab die Pekinger Börse Leitlinien heraus, in denen die Kriterien für qualifizierte Börsenteilnehmer beschrieben sind. Kleinanleger müssen danach über ein Wertpapiervermögen von mindestens RMB 500.000 (circa 67.000 €) verfügen und eine mehr als zweijährige Investitionshistorie haben, um an der Pekinger Börse notiert werden zu können. Es wurde keine Kapitalschwelle für institutionelle Anleger festgelegt. Anfang November wurden die Beijing Stock Exchange Trading Rules (Trial) und die Beijing Stock Exchange Member Management Rules (Trial) veröffentlicht, sowie grundlegende Geschäftsregeln und Leitlinien, die am 15. November 2021 in Kraft treten, der auch darauf hindeutet, dass dies der offizielle Start der Pekinger Börse geplant war.
Die NEEQ wurde vor allem für Kleinstunternehmen, KMU und Start-ups gegründet, die nicht in der Lage sind, die Notierungsstandards der Börsen in Shanghai und Shenzhen zu erfüllen. Derzeit nutzt die NEEQ ein Stufensystem für Anleger mit unterschiedlichen Schwellenwerten für die jeweilige Stufe. Nur wenn Unternehmen eine dieser Stufen erfüllen, sind sie zum Handel am New Third Board berechtigt.
Die Beijing Stock Exchange wird das dreistufige System zur Verwaltung der Anlegereignung übernehmen. Die drei Stufen sind:
Die Pekinger Börse wird nur Unternehmen der “ausgewählten Stufe” der NEEQ integrieren. Unternehmen der beiden anderen Stufen werden weiterhin im Freiverkehrsmarkt der NEEQ bleiben. Die Notierung an der Pekinger Börse wird für Unternehmen möglich, wenn sie zwölf Monate in Folge in der “ausgewählten Stufe” der NEEQ gelistet waren, den erwarteten Marktwert und bestimmte Finanzstandards erfüllen, bei der CSRC registriert sind und ein öffentliches Angebot an nicht-spezifische qualifizierte Investoren durchgeführt haben.
Für ausländische Anleger gibt es derzeit keine besonderen Regeln. Es wird erwartet, dass die Regeln für den Handel ausländischer Anleger mit den einschlägigen NEEQ-Regeln übereinstimmen werden.
Mit der Gründung der Pekinger Börse versucht die chinesische Regierung, wie schon durch die Gründung des STAR Markets, IPOs von chinesischen, technologie- und zukunftsorientierten Unternehmen im Land zu halten. Die Regulierung für heimische (Privat-) Unternehmen, die im Ausland oder in Hongkong (S.A.R.) einen Börsengang planen, wurden in den letzten Jahren verschärft. Prominentes Beispiel ist der Fahrdienstleister Didi, der sich kurz nach seinem Börsengang in den USA einer Cybersicherheitsprüfung in China unterziehen musste und mit einem Downloadverbot seiner App in China sanktioniert wurde.
Christina Gigler, LL.M., ist Rechtsanwältin (Senior Associate) und Leiterin der Rechtsabteilung bei Rödl & Partner in Peking. Sie begleitet und betreut Mandanten bei ihrem Markteintritt in China. Ihre Schwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, in der Restrukturierung von Unternehmen, im Arbeits- und im Vertragsrecht.
Falk Kretschmann ist als Senior Manager für den Bereich Elektronik und Assistenzsysteme bei BMW von München nach Shenyang gegangen.
Li Junfeng, bisher Direktor des National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation (NCSC), wechselt zu dem Investor Sequoia Capital.
Gan Lin ist bei der Marktaufsichtsbehörde zur Leiterin des Kartellamts ernannt worden. Gan war bisher stellvertretende Ministerin der Staatlichen Verwaltung für Marktregulierung (SAMR).

An einer Fachhochschule in Dalian dürfen 10.000 Studenten ihre Wohnheime nicht verlassen. Weil unter Studenten 60 Infektionen festgestellt wurde, bringen nun Helfer in Schutzanzügen Wasser und Essen. Der Unterricht findet bis auf Weiteres online statt. Die Küstenstadt im Nordosten des Landes hatte bei sechs Millionen Einwohnern mehr als 200 Infektionen gemeldet.
ein EU-Abgeordneter erläutert uns die Hintergründe eines denkwürdigen Treffens. Charlie Weimers gehörte zu den Parlamentariern, die sich Ende Oktober mit Taiwans Außenminister Joseph Wu getroffen haben. Aus Pekinger Sicht ein Tabubruch – für Weimers jedoch erst der Anfang. Jetzt, wo China seine Drohungen gegenüber der Insel hochfährt, müsse Europa Farbe bekennen. Die EU müsse betonen, dass ein Vorgehen gegen Taiwan ernst Konsequenzen habe, sagte Weimers. Der Spielraum dafür sei größer denn je: Da das Vertrauen in China ohnehin erschüttert sei, gebe es weniger Bedenken, Peking zu verärgern.
Unsere EU-Korrespondentin Amelie Richter hatte derweil Einblick in den Entwurf des Richtungspapiers der Europäischen Union zu Verteidigung und Sicherheit. Tatsächlich zeichnet sich darin eine klarere Haltung des Bündnisses gegenüber Mächten mit deutlich abweichenden Interessen ab. Die Erkenntnis: Es reicht nicht mehr aus, nett und freundlich seine “Besorgnis” über das Weltgeschehen auszudrücken. Die EU müsse militärisch handlungsfähig werden, lautet einer der Eckpunkte. Leider wird es bis dahin noch sehr lange dauern. Dabei rennt den Politikern die Zeit davon.
Unter Zeitdruck steht auch der VW-Konzern. Er hat sich vorgenommen, in diesem Jahr eine Million elektrischer Autos zu verkaufen. Doch im größten Markt Chinas fand die Flaggschiff-Reihe mit dem ID.4 nur wenige Käufer. Der Vertrieb war einfach noch nicht gut organisiert. Jetzt bessert sich die Lage allerdings, analysiert Christian Domke Seidel. Die Verkaufszahlen steigen.


Kürzlich hat eine Delegation des Europaparlaments Taipeh besucht, der taiwanische Außenminister Joseph Wu war in Brüssel. Gibt es derzeit eine besondere Dynamik für die EU-Taiwan-Beziehungen?
Ja. Darüber hinaus wurde in der Woche vor dem Besuch von Minister Wu auch die Empfehlung des Europaparlaments zu den EU-Taiwan-Beziehungen herausgegeben. Es gibt also auf jeden Fall einen Impuls dafür.
Wie sehen Sie den Besuch der Abgeordneten des Sonderausschusses für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE) in Taipeh?
Das ist eine großartige Gelegenheit, mehr über bewährte Verfahren zur Bekämpfung chinesischer Desinformation zu erfahren. Die EU und Taiwan sollten viel stärker zusammenarbeiten, um die besten Ansätze zur Förderung der Medienfreiheit und des Journalismus zu finden, unsere Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit zu vertiefen und gemeinsam die Widerstandsfähigkeit Taiwans und der Mitgliedsstaaten der EU zu stärken.
Es war die allererste Delegation, die Taiwan besuchte. Warum wurde nicht schon früher eine Delegation geschickt?
Im Jahr 2016 rissen Trump und der Brexit ein riesiges Loch in die Erzählung vom “Ende der Geschichte” (“The End of History and the Last Men”). Im folgenden Jahr war Präsident Xi Jinping der Liebling von Davos, was einige dazu veranlasste, die Fantasie zu hegen, dass China eine von den USA geführte internationale Ordnung ersetzen würde. Viele übersahen die Zeichen der Zeit und dachten fälschlicherweise, dass ihre wirtschaftliche Zukunft in China liege.
In den letzten fünf Jahren ist es unvermeidbar geworden, Chinas Kampfbereitschaft gegenüber Nachbarn im nahen Ausland, die brutale interne Repression, Merkantilismus, den verleumdenden Einfluss in internationalen Institutionen und Drittstaaten, den Personenkult um Präsident Xi, zunehmende staatliche Kontrolle über Märkte, den demografischen Rückgang sowie Vertuschung, Desinformation und mangelnde Transparenz über die Ursprünge von Covid-19 zu sehen. Kurz gesagt, China ist kein zuverlässiger Partner mehr. Deshalb gibt es weniger Bedenken, China wegen Taiwan zu verärgern.
Glauben Sie, dass es Vergeltungsmaßnahmen aus Peking für den INGE-Besuch geben wird?
Als Reaktion auf EU-Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren hat China bereits Anfang des Jahres den Abgeordneten Raphaël Glucksmann (zusammen mit vier anderen EU-Abgeordneten) auf die schwarze Liste gesetzt. Im Oktober verweigerten sie einer US-Kongressdelegation Visa für China – es sei denn, sie stimmten zu, an einem bevorstehenden Besuch in Taiwan nicht teilzunehmen. Es ist durchaus möglich, dass sie auch die INGE-Abgeordneten sanktionieren.
Als Taiwans Außenminister Wu nach Brüssel reiste, gab es keine offiziellen Treffen mit Vertretern der EU-Kommission oder des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Hätten sich diese Ihrer Meinung nach mit Herrn Wu treffen sollen?
Ich denke, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hätte sich mit Minister Wu treffen sollen.
Sind Sie als EU-Parlamentarier mit der Leistung des EEAS in Bezug auf die Taiwan-Politik zufrieden?
Der EEAS hat damit begonnen, sich an das aktuelle Umfeld anzupassen.
Sie haben Herrn Wu in Brüssel getroffen – was hat er Ihnen gesagt und was war seine Botschaft an die EU?
Es war ein zukunftsweisendes Treffen, das sich auf die im Taiwan-Bericht des Europäischen Parlaments skizzierten Themen konzentrierte: Stärkung der Handelsbeziehungen, Taiwans Beteiligung an internationalen Organisationen, akademischer Austausch und Sicherheit in der Taiwanstraße. Außenminister Wu forderte eine Zusammenarbeit bei der weiteren Vertiefung der Beziehungen, einschließlich der Aufnahme von Verhandlungen über ein Investitionsabkommen.
Wie kann die EU Taiwan unterstützen?
Die Empfehlung des Europäischen Parlaments zu den politischen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan enthält viele Beispiele:
Die INGE-Delegation ist nach Taipeh gereist, um sich über Desinformation und Cyber-Angriffe zu informieren. Sind bereits konkrete Projekte zwischen der EU und Taiwan geplant?
Beide Seiten untersuchen Wege der Partnerschaft, einschließlich der möglichen Schaffung eines gemeinsamen Zentrums für Desinformation in Taipeh.
Die EU-Kommission hält sich in der offiziellen Kommunikation an die “Ein-China-Politik”. Glauben Sie, das muss sich ändern? Braucht die EU einen härteren Tonfall, wenn es um Taiwan geht?
Sowohl die Mitgliedstaaten als auch die EU-Institutionen haben damit begonnen, sich an die Entwicklungen im Indo-Pazifik anzupassen. Vorreiter sind Mitgliedstaaten wie Litauen und die Tschechische Republik.
Welche Reaktion haben Sie von der EU-Kommission auf Ihren Taiwan-Bericht erhalten?
Die Reaktion wurde während der Plenarsitzung im Oktober von EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager im Namen des EU-Außenbeauftragten Borrell mitgeteilt. Diese war sehr positiv. Beispielsweise sagte sie, dass die Europäische Union ein Interesse an der Verbesserung der Beziehungen und der Zusammenarbeit mit Taiwan hat. Außerdem sollen ihrer Antwort zufolge die Handels- und Investitionsbeziehungen mit “diesem wichtigen Partner und Technologieführer” vertieft verfolgt werden.
INGE-Delegationsführer Glucksmann sagte in Taipeh, dass hochrangige Treffen zwischen EU und Taiwan erforderlich sind – glauben Sie, dass es in naher Zukunft mehrere Treffen geben wird?
Angesichts gemeinsamer Interessen in wichtigen Bereichen, wie Halbleiter, Handel, Cybersicherheit, wäre es ratsam, das zu tun.
Was könnte die EU in Taiwan besonders interessieren?
Kooperationen im Bereich Cybersicherheit und Halbleiter sind interessant. Taiwan ist aber auch für die internationale Gemeinschaft wertvoll. Taiwan hatte als Erster die Weltgesundheitsorganisation über eine mögliche Mensch-zu-Mensch-Übertragung von Corona informiert, während die KP Chinas solche Behauptungen weitere drei Wochen lang zurückwies.
In Ihrem Bericht wird auch aufgefordert, den Namen des European Economic and Trade Office in Taiwan zu ändern – warum ist der Name in diesem Fall so wichtig?
Der Bericht fordert die EU-Kommission und den EEAS auf, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taiwan in “Büro der Europäischen Union in Taiwan” (“European Union Office in Taiwan”) zu ändern, um die große Bandbreite unserer Beziehungen mit der Insel besser widerzuspiegeln.
Charlie Weimers (39) ist konservativer Abgeordneter im Europaparlament. Der Schwede war zuletzt federführend für den ersten alleinstehenden Bericht des EU-Parlaments zu den Beziehungen zwischen Brüssel und Taipeh. In dem Papier fordern die EU-Abgeordneten eine engere Zusammenarbeit mit der Insel. Die Fragen beantwortete Reimers schriftlich.
Die EU will mehr Muskeln zeigen und bereitet sich mit einem neuen Strategiepapier auf ihre künftige Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor – China spielt dabei keine unerhebliche Rolle. Denn die Volksrepublik wird mehrfach namentlich in dem Entwurf erwähnt, der China.Table vorliegt. Am Montag wurde das Dokument bereits im Rat der EU-Außen- und Verteidigungsminister besprochen. Die Stoßrichtung ist klar gefasst: Die EU müsse künftig deutlich mehr als eine “Soft Power” sein, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kommentierte.
Um das zu erreichen, wiederholt die EU in ihrem Strategiepapier einerseits bereits bekannte Einschätzungen und betont ihren Ansatz der “strategischen Autonomie” zwischen Washington und Peking. Neu sind ein Ausbau der Abwehrinstrumente gegen Cyberattacken und Desinformations-Kampagnen. Außerdem soll eine schnelle EU-Einsatztruppe aufgebaut werden. Was Peking am meisten aufstoßen könnte: Brüssel will die koordinierte maritime Präsenz im Indo-Pazifik verstärken. Geplant ist, dass die Strategie beim Dezember-Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf die Tagesordnung kommt und dann im Frühjahr unter französischer EU-Präsidentschaft beschlossen wird.
Diese Punkte des Papiers sind wichtig für die EU-China-Politik:

Für VW nimmt China eine Schlüsselrolle ein, wenn es um die Zukunft der Mobilität und des Konzerns geht. Denn die Volksrepublik ist der weltgrößte Automarkt, die Kunden sind offen für Neuerungen und der Markt ist gleichzeitig sehr dynamisch und hart umkämpft. Besonders im Bereich der Elektromobilität. VW möchte noch im Jahr 2021 weltweit eine Million Elektro- und Plug-in-Hybride verkaufen. Weil der Konzern aber 40 Prozent seines Umsatzes in der Volksrepublik macht, muss diese Technologie dort ihre Abnehmer finden.
Genau das passierte aber erst einmal nicht, als VW Anfang des Jahres die Baureihe ID.4 präsentierte. Die Markteinführung floppte. Im Mai verkaufte das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht einmal 1.500 Stück, im Juni 3.400, im Juli 6.000 und im August 7.000 Stück. Die Maschinerie hatte Sand im Getriebe: Neben einem Halbleitermangel und dem Hochfahren der Produktion musste auch noch ein neuer Vertrieb geschultert werden.
Wer in China Elektroautos verkaufen will, der muss dorthin, wo die Kunden sind. Anders als in Deutschland fahren Chinesen nicht in irgendwelche Industriegebiete am Stadtrand, um sich ihren Wagen auszusuchen. Das hat auch Volkswagen erkannt. Die Einführung ihres Elektro-SUV ID.4 erfolgte jedoch so früh, dass das bestehende Vertriebsnetz die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte.
Erst im September knackte VW die Schwelle von 10.000 Fahrzeugen; im Oktober waren es dann immerhin 12.700. Hintergrund ist, dass gerade ein Netz an sogenannten ID.-City-Stores aufgebaut wird, das zum Marktstart noch löchrig war. Anfang November gab es davon aber immerhin 60 Stück. Sie liegen in zentraler Lage mit viel Laufkundschaft – beispielsweise in Shopping Malls. Bis Ende 2021 sollen es 170 Stück sein. Dazu kommen 1.500 ID-Händler mit 5.100 ID-Verkäufern in 230 Städten.
VW will mit den New Energy Vehicles (NEV) den gleichen Marktanteil erobern, den der Konzern schon mit den Verbrennern erreicht hat – rund 20 Prozent. Unter einem NEV versteht China ein Fahrzeug mit vollelektrischem (BEV), teilelektrischem (PHEV) oder Brennstoffzellenantrieb (FCEV) Antrieb. Zumindest bis ins Jahr 2025 sollen diese Modelle laut aktuellem Fünfjahresplan noch gefördert werden.
Entscheidend ist jedoch, dass diese NEV auch in China produziert werden müssen. VW hat dafür zwei Werke. Eines in Foshan und eines in Anting. Deren Gesamtkapazität liegt bei 600.000 Stück. Der deutsche Konzern ist gerade dabei, die produzierten Stückzahlen nach oben zu treiben. Im Jahr 2025 will und muss VW aber – um auf die gewünschten Marktanteile zu kommen – über eine Million E-Fahrzeuge in China produzieren, wie eine Konzernsprecherin gegenüber Table.Media erklärte. Ein entsprechender Ausbau der Kapazitäten muss also sein.
Doch gibt es auch Faktoren, auf die VW keinen Einfluss hat. Aktuell kämpft der Konzern – wie jeder Konkurrent auch – mit einer eklatanten Unterversorgung von Halbleitern. Etwa zehn Prozent fehlen dem Hersteller. Hintergrund war, dass Schneestürme samt Stromausfällen und Werksschließungen in Texas und ein Brand beim japanischen Zulieferer Renesas die ohnehin durch Corona angespannte Lage zusätzliche verschärft hatten.
Ein Problem, das aktuell nicht gelöst werden kann. VW rechnet damit, dass der Halbleitermangel noch weit über das Jahr 2021 ein Problem für die Marke sein wird. Nur ein bestimmter Teil des Bedarfs könne mit Brokerware gedeckt werden – also Halbleiter alternative Anbieter, deren Produkte dann aber noch eine Prüfung und Freigabe der technischen Entwicklung und Qualitätssicherung bedürfen. Halbleiter sind in der Automobilproduktion mittlerweile so wichtig wie im Elektroniksektor (China.Table berichtete).
Gerade in China, wo Kunden einen hohen Grad an Digitalisierung erwarten. Ein Bereich, in dem VW im Vergleich zu anderen Anbietern noch aufholen muss und das mit ID-Baureihe auch tut. Die Modelle sind allesamt sowohl mit Apple CarPlay als auch mit Baidu CarLife kompatibel (China.Table berichtete). Ein eigenes App-Angebot ermöglicht unter anderem die Steuerung des Smart Home oder eine Restaurant-Reservierung. Christian Domke Seidel
China will bis Jahresende alle Kinder zwischen drei und elf Jahren vollständig gegen Covid-19 impfen. Die Nationale Gesundheitskommission verkündete jüngst, dass bereits mehr als 84 Millionen Kinder im Alter zwischen drei und elf die erste Impfung bekommen haben.
“Die Impfung für Kinder ist freiwillig”, sagt Wang Dengfeng ein Beamter aus dem Bildungsministerium auf einer Pressekonferenz. Er lobte, dass von 160 Millionen Kinder in der Altersgruppe drei bis elf bereits die Hälfte eine Impfung erhalten habe.
Bereits im Juni hatte die chinesische Aufsichtsbehörde die Impfstoffe der Hersteller Sinovac und Sinopharm für die Altersgruppe zwischen drei und 17 Jahren zugelassen. Bisher wurden vor allem Impfungen von älteren Kindern priorisiert. So soll die Impfquote der 12 bis 17-Jährigen bei 90 Prozent liegen. Nachdem es jedoch zu Corona-Ausbrüchen an Grundschulen und in Kindergärten gekommen war (China.Table berichtete), scheint Peking sich nun dazu entschieden zu haben, auch die jüngeren Altersgruppen impfen zu wollen. In einer jüngsten Studie der Fachzeitschrift Lancet, wird der Impfstoff von Sinopharm für Kinder als sicher und gut verträglich bewertet.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien und Chile haben die beiden chinesischen Vakzine eine Notfallzulassung für Kinder ab drei Jahren erhalten. Auch Hongkong prüft seit Montag Sinovac für Kinder ab drei Jahren zuzulassen, so Bloomberg. Israel hat am Montag den Corona-Impfstoff von Biontech für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Auch die USA impfen Kinder ab fünf Jahren. Biontech hat auch in der EU eine Zulassung ihres Impfstoffes für 5- bis 11-Jährige beantragt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will voraussichtlich noch vor Weihnachten darüber entscheiden. niw
Seit ihren Vorwürfen gegen den hohen Kader Zhang Gaoli (China.Table berichtete) ist die bekannte Tennisspielerin Peng Shuai auf Social Media verstummt. Nach der Veröffentlichung ihres Berichts über sexuelle Übergriffe sind sämtliche ihrer Beiträge von der Plattform Weibo verschwunden. Der Verbleib der 35-Jährigen ist seit dem 2. November ungeklärt. Auf Weibo ist derzeit auch keine Suche nach dem Wort “Tennis” möglich. Die Women’s Tennis Association (WTA) fordert von China formale Ermittlungen gegen Zhang. “Peng Shuai, und alle Frauen, verdienen es, gehört statt zensiert zu werden”, so die WTA. Auf Twitter trendet das Hashtag #WhereIsPengShuai.
Zhang (74) ist einer der mächtigsten Männer Chinas. Unter anderem war er Vizepremier und Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros. Daher liegt die Annahme nahe, dass die Partei die Diskussion über den Fall unterdrückt. Der Zorn über die Übergriffe könnte zu Fragen nach der nicht eingehegten Machtfülle der Partei führen. Zhang soll seine Position ausgenutzt haben, um zunächst eine mehr oder weniger freiwillige Affäre mit Peng zu beginnen. Später soll er sie bei sich zu Hause auch zum Sex gezwungen haben. fin
Der Immobilienkonzern Dalian Wanda hat sich dem Gerücht entgegengestellt, dass Firmenchef Wang Jianlin verstorben sein soll. Er habe am Montag regulär einer Sitzung beigewohnt, teilte das Unternehmen mit. Ein Sprecher betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, der Firmenchef sei wohlauf. Online-Beiträge über den Tod Wangs seien falsch. Wanda habe Anzeige erstattet. fin
Der wachsende chinesische Kapitalmarkt, sowohl der Aktien- als auch der Anleihemarkt, wird von ausländischen Investoren oft vernachlässigt. Viele lokale chinesische (insbesondere technologieorientierte) Unternehmen wählen allerdings ein Initial Public Offering (IPO) als Finanzierungsform. Auch für chinesische Finanzinvestoren sind IPOs die bevorzugte Exit-Form. Anfang September kündigte Präsident Xi Jinping an, dass China eine neue Börse in Peking (Beijing Stock Exchange) einrichten und sie zu einer wichtigen Handelsplattform für innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausbauen wird. Die Pekinger Börse ist nun die dritte auf dem chinesischen Festland neben den seit den 90er-Jahren bestehenden Börsen in Shanghai und Shenzhen.
Bereits Ende 2021 könnte der Handel mit zunächst 70 Unternehmen aus der “ausgewählten Stufe” an der National Equities Exchange and Quotations Co., Ltd. (NEEQ, auch als “New Third Board” bekannt) aufgenommen werden. Diese wurde ursprünglich als Chinas Gegenstück zum NASDAQ im Rahmen des Aufbaus eines mehrstufigen Kapitalmarktsystems gegründet. Die Pekinger Börse soll so strukturiert werden, dass sie eine verbesserte Version des New Third Board darstellt und das Potenzial hat, sich als große dritte Säule auf dem Kapitalmarkt neben der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange zu etablieren.
Auf der offiziellen Website des National Enterprise Credit Information Publicity System wurde bekannt gegeben, dass die Unternehmensregistrierung für die Beijing Stock Exchange Co., Ltd., abgeschlossen und am 3. September 2021 gegründet sowie genehmigt wurde. Die neue Börse wird zu 100 Prozent im Besitz der NEEQ stehen, die alleinige Gesellschafterin ist. Das eingetragene Kapital beträgt eine Milliarde Yuan.
Die Ansiedlung der neuen Börse in der Hauptstadt kommt dabei nicht von ungefähr – sie hat sowohl praktische als auch politische Vorteile. Auf politischer Ebene könnte ein Faktor das Ungleichgewicht der Kapitalressourcen sein, da Chinas wichtigste Aktienmärkte derzeit in Ost- und Südchina positioniert sind. In praktischer Hinsicht hat Peking mit der NEEQ bereits den Grundstein für eine Börse gelegt, die auf KMU spezialisiert ist. Hauptziel der Gründung soll ein leichterer Zugang für KMU zum Kapitalmarkt sein, denn obwohl 99,8 Prozent der Unternehmen in China als KMU gelten und circa 50 Prozent der Steuereinnahmen Chinas stellen, hat ein Großteil der Unternehmen erhebliche Schwierigkeiten beim Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen.
Die Ankündigung und Gründung erfolgt in einer Zeit, in der die Besorgnis über eine mögliche Abkopplung der chinesischen Wirtschaft zunimmt und die US-Regierung Maßnahmen ergreift, chinesischen Unternehmen den Börsengang in den USA zu erschweren. So sind seit Ende 2020 chinesische Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind, verpflichtet, sich einer Prüfung durch eine US-Aufsichtsbehörde zu unterziehen. Viele chinesische Unternehmen sehen sich gezwungen, ihre Notierung aufzugeben, da es ihnen untersagt ist, ausländischen Aufsichtsbehörden ohne Genehmigung der chinesischen Regierung Zugang zu ihren Buchhaltungsunterlagen zu gewähren.
Zudem kündigte Anfang Juli 2021 die chinesische Cyberspace-Behörde an, dass Unternehmen mit mehr als eine Million Nutzern einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden müssen, bevor sie ihre Aktien im Ausland notieren dürfen. Da die Regulierungsbehörden befürchten, dass chinesische Unternehmen, die Daten ins Ausland übertragen, Risiken für die Cybersicherheit und die nationale Sicherheit verursachen könnten, ergreift China Maßnahmen, um Unternehmen zu ermutigen, ihren Börsengang im Inland zu forcieren. Die Gründung der Pekinger Börse könnte somit Teil dieser Bemühungen sein.
Die Pekinger Börse wird eine andere Rolle spielen als die bestehenden Börsen in Shanghai und Shenzhen, und gleichzeitig die Verbindung mit diesen Märkten aufrechterhalten. So dürfen beispielsweise Aktien an der Pekinger Börse unter bestimmten Bedingungen auf die Börsen in Shanghai und Shenzhen übertragen werden. Die Shanghaier Börse ist heute die größte Festlandchinas und eine wichtige Säule der Volkswirtschaft. Sie ist spezialisiert auf die Listung von Unternehmen grundlegender Industrien und Schlüsselbranchen.
Zusätzlich wurde im Sommer 2019 mit dem Science and Technology Board (STAR Market) ein auf Start-ups und Hightech-Unternehmen spezialisierter Handelsplatz etabliert. Vor allem Unternehmen aus der Hightech-Branche, aus strategischen neuen Industrien wie Informationstechnologie der neuen Generation, High-End-Ausrüstung, neue Materialien, alternative Energiegewinnung und -einsparung, Umweltschutz sowie Biomedizin und weitere, sind am STAR Market gelistet.
Die Börse Shenzhen listet verschiedene Marktindizes mit unterschiedlicher Marktpositionierung, z.B. Blue Chips mit hoher Marktkapitalisierung. Als zweiter Markt – ähnlich dem amerikanischen NASDAQ – wurde 2009 der ChiNext etabliert, der auf Privat- und Technologieunternehmen spezialisiert ist. Mit der Pekinger Börse soll nun für KMU ein spezialisierter Handelsplatz geschaffen werden. Zugleich wird NEEQ, wo bis Ende 2020 rund 6.000 KMU gelistet waren, aufgewertet.
Mitte September gab die Pekinger Börse Leitlinien heraus, in denen die Kriterien für qualifizierte Börsenteilnehmer beschrieben sind. Kleinanleger müssen danach über ein Wertpapiervermögen von mindestens RMB 500.000 (circa 67.000 €) verfügen und eine mehr als zweijährige Investitionshistorie haben, um an der Pekinger Börse notiert werden zu können. Es wurde keine Kapitalschwelle für institutionelle Anleger festgelegt. Anfang November wurden die Beijing Stock Exchange Trading Rules (Trial) und die Beijing Stock Exchange Member Management Rules (Trial) veröffentlicht, sowie grundlegende Geschäftsregeln und Leitlinien, die am 15. November 2021 in Kraft treten, der auch darauf hindeutet, dass dies der offizielle Start der Pekinger Börse geplant war.
Die NEEQ wurde vor allem für Kleinstunternehmen, KMU und Start-ups gegründet, die nicht in der Lage sind, die Notierungsstandards der Börsen in Shanghai und Shenzhen zu erfüllen. Derzeit nutzt die NEEQ ein Stufensystem für Anleger mit unterschiedlichen Schwellenwerten für die jeweilige Stufe. Nur wenn Unternehmen eine dieser Stufen erfüllen, sind sie zum Handel am New Third Board berechtigt.
Die Beijing Stock Exchange wird das dreistufige System zur Verwaltung der Anlegereignung übernehmen. Die drei Stufen sind:
Die Pekinger Börse wird nur Unternehmen der “ausgewählten Stufe” der NEEQ integrieren. Unternehmen der beiden anderen Stufen werden weiterhin im Freiverkehrsmarkt der NEEQ bleiben. Die Notierung an der Pekinger Börse wird für Unternehmen möglich, wenn sie zwölf Monate in Folge in der “ausgewählten Stufe” der NEEQ gelistet waren, den erwarteten Marktwert und bestimmte Finanzstandards erfüllen, bei der CSRC registriert sind und ein öffentliches Angebot an nicht-spezifische qualifizierte Investoren durchgeführt haben.
Für ausländische Anleger gibt es derzeit keine besonderen Regeln. Es wird erwartet, dass die Regeln für den Handel ausländischer Anleger mit den einschlägigen NEEQ-Regeln übereinstimmen werden.
Mit der Gründung der Pekinger Börse versucht die chinesische Regierung, wie schon durch die Gründung des STAR Markets, IPOs von chinesischen, technologie- und zukunftsorientierten Unternehmen im Land zu halten. Die Regulierung für heimische (Privat-) Unternehmen, die im Ausland oder in Hongkong (S.A.R.) einen Börsengang planen, wurden in den letzten Jahren verschärft. Prominentes Beispiel ist der Fahrdienstleister Didi, der sich kurz nach seinem Börsengang in den USA einer Cybersicherheitsprüfung in China unterziehen musste und mit einem Downloadverbot seiner App in China sanktioniert wurde.
Christina Gigler, LL.M., ist Rechtsanwältin (Senior Associate) und Leiterin der Rechtsabteilung bei Rödl & Partner in Peking. Sie begleitet und betreut Mandanten bei ihrem Markteintritt in China. Ihre Schwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, in der Restrukturierung von Unternehmen, im Arbeits- und im Vertragsrecht.
Falk Kretschmann ist als Senior Manager für den Bereich Elektronik und Assistenzsysteme bei BMW von München nach Shenyang gegangen.
Li Junfeng, bisher Direktor des National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation (NCSC), wechselt zu dem Investor Sequoia Capital.
Gan Lin ist bei der Marktaufsichtsbehörde zur Leiterin des Kartellamts ernannt worden. Gan war bisher stellvertretende Ministerin der Staatlichen Verwaltung für Marktregulierung (SAMR).

An einer Fachhochschule in Dalian dürfen 10.000 Studenten ihre Wohnheime nicht verlassen. Weil unter Studenten 60 Infektionen festgestellt wurde, bringen nun Helfer in Schutzanzügen Wasser und Essen. Der Unterricht findet bis auf Weiteres online statt. Die Küstenstadt im Nordosten des Landes hatte bei sechs Millionen Einwohnern mehr als 200 Infektionen gemeldet.