der Erfolgsautor und Sinologe Stephan Thome lebt seit 12 Jahren in Taiwan. Er schreibt Romane mit einer lokalen Perspektive, und hat zuletzt mit “Pflaumenregen” ein Buch vorgelegt, das in der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft über die Insel spielt. Im Interview mit Fabian Peltsch erzählt Thome, wie er die gegenwärtige Bedrohungslage auf der Insel erlebt, was er sich für Taiwan wünscht und wie er zu dem gelegentlichen Vorwurf kultureller Aneignung steht.
Es gibt Umfragen, nach denen die meisten Menschen kaum etwas so lästig finden wie ihre Nachbarn. China und Indien mag es ähnlich gehen; seit Jahrzehnten beharken sich beide über ihren Grenzverlauf. So ist es kein Wunder, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern längst nicht so gut laufen, wie es sein könnte. Nun straft Indien China für sein aggressives Verhalten entlang der Grenze ab. Wie unser Redaktionsteam in Peking analysiert, geht Neu-Delhi derzeit rabiat gegen chinesische IT-Firmen vor, die in Indien eigentlich Fuß fassen wollen.
Unterdessen ist die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Asien aufgebrochen. Ob sie dabei, wie unter anderem von der Financial Times spekuliert, auch Taiwan besuchen wird, war am Sonntag weiter unklar. Manche Analysten erwarten im Falle eines Taipeh-Abstechers Pelosis eine politische Krise im Dreieck USA-China-Taiwan. Wir behalten die Lage im Blick.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche!


Mit Ihrem ersten Roman “Grenzgang” gelang Ihnen 2009 ein Überraschungserfolg. Geschrieben haben Sie ihn in Ihrer Zeit als Forschungsassistent an der Academia Sinica in Taiwan. Hatten Sie dort den nötigen Abstand, um ein Sittenbild der deutschen Provinz zu entwerfen?
Das Vorbild für den Ort, in dem “Grenzgang” spielt, ist mein Heimatort in Oberhessen. Die Gegend kenne ich so gut, darüber hätte ich überall schreiben können. Tatsächlich sind fast alle meine Romane in Taiwan entstanden. Damals hatte ich die Idee einfach im Gepäck.
Mittlerweile leben Sie seit 12 Jahren in Taiwan. Ihr jüngster Roman “Pflaumenregen” spielt zu der Zeit, als die Insel unter japanischer Kolonialherrschaft stand. Zeitgleich haben Sie eine “Gebrauchsanweisung für Taiwan” in Buchform veröffentlicht. Wie kommt es, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen über Taiwan erst jetzt literarisch verarbeiten?
Bei Lesereisen kam immer wieder die Frage auf: Wenn Sie schon dort leben, wieso schreiben Sie nicht darüber? Man muss aber erstmal dahin kommen, auf eine Art über Asien schreiben zu können, dass die Schauplätze nicht zu einer exotischen Fototapete voller westlicher Helden werden. Will man substantiell etwas über diese Länder mitteilen, muss man sich etwas besser auskennen. Zwei Jahre Aufenthalt und ein paar Sprachkenntnisse reichen nicht aus, um eine derart reichhaltige Kultur und Geschichte zu verstehen.
Sie schreiben als Deutscher aus der Sicht von Chinesen. Man könnte das als Vermessenheit oder sogar als kulturelle Aneignung betrachten.
Einige englischsprachige Verlage, denen wir die Bücher angeboten haben, merkten tatsächlich an, dass dies ein Fall von “Cultural Appropriation” sei. Allerdings kam der Vorwurf bereits, bevor jemand den Text gelesen hatte. Das hat mich etwas konsterniert. Bei “Pflaumenregen” hatte ich das Gefühl, dass ich über Menschen schreibe, die ich gut kenne. Im Vorgänger “Gott der Barbaren” tritt ein Konfuzianer des 19. Jahrhunderts auf. Wie dieser sich fühlt, kann sich ein Chinese heute genauso wenig vorstellen wie ich zu Beginn meiner Recherche.
Ich bin beim besten Willen kein Gegner der sozialen Bewegungen, die heute für mehr Diversität und Gerechtigkeit eintreten. Bei der Literatur habe ich jedoch Bedenken, dass eine Verengung stattfindet hinsichtlich der Frage, was einen Text authentisch macht. Eingehende Recherche, Fantasie, Einfühlungsvermögen, technisches Handwerk und solche Dinge sind auch wichtig, wenn man einen Text authentisch und glaubwürdig machen will. Übrigens profitiert die gesamte Gesellschaft davon, wenn wir es schaffen – als Schreibende, Lesende, Bürgerinnen und Bürger -, uns besser in andere Menschen hineinzuversetzen
Sie sind mit einer Taiwanerin verheiratet und leben in Taipeh. Betrachten Sie Taiwan mittlerweile als ihre Heimat?
Ich nenne es meine zweite Heimat. Es gibt keinen Grund, Heimat nur im Singular zu gebrauchen. In Deutschland hat mein Heimatgefühl etwas Selbstverständliches. Selbstverständlichkeit kann aber auch bedeuten, dass vieles unverstanden bleibt, weil man es nie hinterfragt hat. In Taiwan musste ich mir das Gefühl von Heimat erst erarbeiten, indem ich mich bemüht habe, das Land explizit und umfassend zu verstehen. Vermutlich habe ich über taiwanische Geschichte intensiver nachgedacht als über die europäische, auch aufgrund der dortigen Lebensumstände. Das Damoklesschwert der chinesischen Bedrohung schwebt täglich über uns – gut möglich, dass meine Frau und ich eines Tages gezwungen sein werden, Taiwan zu verlassen.
Gehen Sie mit der chinesischen Bedrohung anders um als ihre taiwanische Familie?
Was ich wahrnehme, ist, dass manche Menschen in Taiwan dazu neigen, die Bedrohung nicht direkt zu thematisieren. Vielleicht weil das Maß an Bedrohlichkeit für sie ungleich höher ist als für mich, der ich in Deutschland eine weitere Heimat habe. Deshalb bin ich derjenige, der das Thema am ehesten anspricht. Ich ermutige meine Frau dazu, Deutsch zu lernen, sozusagen als Vorbereitung für den Ernstfall. Niemand weiß, was geschehen wird; man kann sich nur innerlich wappnen. Zwar besteht die Bedrohung schon seit 70 Jahren, aber ich glaube, dass viele Leute unterschätzen, dass Xi Jinping ein Game Changer ist. Der Druck auf Taiwan steigt, China zeigt heute eine größere Bereitschaft, es mit der westlichen Welt aufzunehmen und dafür auch einen Preis zu zahlen.
Wie stehen Sie heute zu China?
Es ist heute ein anderes Land als vor zehn, zwölf Jahren. Ich habe mich in China nie so wohl gefühlt wie in Taiwan, aber ich war fasziniert von dem Land, habe es gerne bereist und habe auch noch einige wenige Freunde dort. Seit dem Nationalen Sicherheitsgesetz (für Hongkong, d. Red.) ist aber eigentlich klar, dass ich nicht mehr dorthin reisen kann. Man würde mir wohl kein Visum ausstellen. Schon die letzten Male musste ich alle meine Buchtitel angeben, und jetzt stehen da eben auch Titel wie “Gebrauchsanweisung für Taiwan”. Hinzu kommen einige Presseartikel, die deutlich China-kritisch waren.
Ist das ein schwerer Verlust für Sie?
Ja, ich bedauere das sehr. Auch weil es irgendwann schwierig wird, sich noch als Experte für das Land zu bezeichnen. Wenn man keine persönlichen Eindrücke mehr vor Ort sammeln kann, verengt und verzerrt sich die Wahrnehmung. Man darf ja nicht vergessen, wie viele freundliche weltoffene Menschen es in China gibt, die an einem ehrlichen Austausch mit dem Westen interessiert sind. Nicht alle sind patriotische Eiferer. Das verliert man leicht aus dem Blick, wenn man nur die tagesaktuelle Berichterstattung verfolgt. Wir brauchen mehr China-Kompetenz, aber es wird immer schwerer, sie zu bekommen.
Als fantasiebegabter Schriftsteller: Was wäre Ihrer Meinung nach das Best-Case-Szenario für Taiwan?
Wäre es ein Wunschkonzert, würde ich mir wünschen, dass auf dem Festland peu à peu ein Wandel einsetzt, hin zu der Haltung: Wir brauchen die Insel nicht, wir könnten in Taiwan einfach einen guten Nachbarn haben, mit dem wir Handel treiben. Ich weiß aber, dass das völlig unrealistisch ist. Das realistische Best-Case-Szenario ist, dass die USA und Europa genug Druck auf China ausüben, um dort die Einsicht zu fördern, dass der Preis einer Invasion politisch, ökonomisch und militärisch zu hoch wäre, um sie zu vollziehen. Schwer genug, aber darauf sollte man politisch hinarbeiten. In Europa scheint sich der Wind gerade zu drehen. Wir wissen, dass wir im Umgang mit Russland Fehler gemacht haben – und wir wissen, dass wir auch im Umgang mit China Fehler machen, Stichwort Abhängigkeit: dort von Öl und Gas, hier vom chinesischen Absatzmarkt.
Ist es umgekehrt denkbar, dass die Taiwaner sich irgendwann einen Anschluss an Großchina wünschen?
Das ist sehr schwer vorstellbar, die ganze soziale Entwicklung geht in die andere Richtung. Die Menschen betonen immer mehr die eigene taiwanische Identität, für die meisten jungen Leute ist das heute einfach selbstverständlich. In Taiwan gibt es jetzt eine ganze Generation, die in demokratischen Verhältnissen aufgewachsen ist; für diese wird China trotz seines Reichtums immer unattraktiver. Die Volksrepublik müsste gewaltige Anstrengungen unternehmen, um dagegen zu arbeiten, aber oft gießen solche Kampagnen vom Festland eher Wasser auf die Mühlen der Taiwaner. Wenn das Regime Drohungen ausstößt, schnellen die Umfragewerte von Tsai Ing-wen sofort in die Höhe.
Welche Bücher außer Ihren eigenen muss man lesen, um Taiwan besser zu verstehen?
Der Roman “The Stolen Bicycle” von Wu Ming-yi ist das Beste, was ich an taiwanischer Literatur in letzter Zeit gelesen habe. Es gibt aber auch tolle akademische Arbeiten, etwa “Why Taiwan” von Alan Wachman über das geostrategische Interesse Chinas an Taiwan. Eine wunderbare Sozialgeschichte hat Andrew D. Morris mit “Colonial Project, National Game” vorgelegt. Hier kann man sehen, dass sich die taiwanische Geschichte des 20. Jahrhunderts tatsächlich anhand der Entwicklung des Baseballs im Land erzählen lässt. Außerdem gibt es sehr gute Filme, etwa “Warriors Of The Rainbow” über den Kampf der Ureinwohner Taiwans gegen die japanischen Kolonialherren. Oder “Kanō”, ein Baseballfilm, der ein anderes, viel positiveres Bild der Kolonialzeit zeichnet. Oder “The Silent Forest”, ein sehr intensiver Film über sexuellen Missbrauch an einer Schule für gehörlose Jugendliche. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen.
Wird ihr nächstes Buch wieder in Taiwan spielen?
Darüber spreche ich noch ungern. Was ich mir für die Zukunft aber vorstellen kann, ist ein Sachbuch über den chinesisch-taiwanischen Konflikt, sozusagen als Handreichung für interessierte deutsche Leser ohne chinaspezifische Vorkenntnisse: Woher kommt der Konflikt, was treibt ihn gegenwärtig an, worum geht es ideologisch, geostrategisch und ökonomisch? Bei meinen Lesungen mit “Pflaumenregen” habe ich festgestellt, dass sehr viele Leute an der Thematik interessiert sind, aber die tagesaktuelle Presse kann den ganzen historischen Hintergrund natürlich nicht liefern.
Was würden Sie sich von der deutschen Berichterstattung über Taiwan wünschen?
Vor allem wünsche ich mir mehr davon! Es gibt keine deutsche Tageszeitung mit einem ständigen Korrespondenten in Taiwan. Der britische Guardian hat jemanden, dadurch wird die Berichterstattung gleich vielfältiger – auch kleinere Ereignisse und die Normalität des Alltags kommen vor. Taiwan ist weit mehr als eine potentielle Krisenregion: Ein faszinierendes, kulturell und landschaftlich vielfältiges Land mit einer unschlagbaren Küche.
Stephan Thome wurde 1972 in Biedenkopf/ Hessen geboren. Er studierte Philosophie und Sinologie und lebt seit über 12 Jahren in Ostasien. Seine letzten Bücher “Gott der Barbaren”, “Gebrauchsanweisung für Taiwan” und “Pflaumenregen” setzen sich intensiv mit chinesischer Geschichte auseinander.

Für chinesische Technologie-Konzerne läuft die Expansion ins Ausland schleppend. Zuerst waren es westliche Staaten, allen voran die USA, die den Firmen aus Angst vor Spionage und vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen mehr und mehr die Türen verschlossen haben. Nun nimmt der Druck auch im Nachbarland Indien massiv zu.
BBK Electronics etwa bekam das in den vergangenen Tagen gleich doppelt zu spüren. Dem Konzern aus der Südprovinz Guangdong gehören mit Oppo und Vivo zwei der größten Smartphone-Marken Chinas. Zusammengerechnet sind sie sowohl auf ihrem Heimatmarkt als auch in Indien Marktführer. Doch in Indien ermitteln jetzt die Steuerbehörden. Zuerst beschuldigten sie Vivo vergangene Woche, durch illegale Transferzahlungen Gewinne verschleiert zu haben – und froren umgerechnet rund 60 Millionen Euro an Firmengeldern vorübergehend ein.
Nur drei Tage später verkündeten die indischen Behörden, dass auch Oppo Steuern hinterzogen habe. Demnach soll das Unternehmen umgerechnet rund 550 Millionen Euro an Einfuhrzöllen nicht gezahlt haben. Bereits vor zwei Monaten erging es dem chinesischen Smartphone-Giganten Xiaomi ähnlich. Von diesem beschlagnahmten die indischen Behörden rund 700 Millionen Euro Bankguthaben. Dann nahm allerdings ein Gericht die Entscheidung zurück.
Gerade erst auf dem per Videoschalte abgehaltenen BRICS-Gipfel vor drei Wochen hatte sich China vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts bemüht, Geschlossenheit mit den Partnerländern Brasilien, Russland, Südafrika und eben Indien zu demonstrieren (China.Table berichtete). Die Realität sieht jedoch anders aus. Zwar ist auch Indien gegen die westlichen Russland-Sanktionen. Eine ähnliche Haltung in diesem einen Punkt macht Neu-Delhi und Peking aber längst nicht zu Freunden.
Die Beziehungen der beiden bevölkerungsreichsten Staaten bleiben angespannt, seit es vor zwei Jahren zu einem tödlichen Zusammenstoß von Soldaten beider Länder an der gemeinsamen Grenze in der Himalaya-Region gekommen war. Derzeit halten indische und chinesische Militärs bereits die 16. Gesprächsrunde zur Beilegung des Konfliktes ab. Bislang jedoch ohne Ergebnis. Zwar betont die indische Führung, dass die Maßnahmen gegen chinesische Firmen nicht politisch motiviert seien. Dennoch begann der große Crackdown nachweislich direkt nach den Grenzkämpfen.
Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hat seitdem mehr als 200 Apps von chinesischen Anbietern in Indien verboten. Auch die chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE gerieten ins Visier. Beide sind vom Ausbau des 5G-Netzes praktisch ausgeschlossen. Mittlerweile haben die Steuerbehörden Untersuchungen bei mehr als 500 chinesischen Unternehmen eingeleitet, wie Insider dem Finanzdienst Bloomberg berichteten. Neben ZTE, Vivo, Xiaomi, Huawei und Oppo sollen auch mehrere Tochterfirmen von Alibaba betroffen sein.
Indien, so analysieren Beobachter, geht es bei den Maßnahmen wohl nicht ausschließlich um eine Reaktion auf den Grenzkonflikt. Vielmehr sei die Regierung vor dem Hintergrund der aggressiven Expansion chinesischer Firmen besorgt, dass lokale Unternehmen ins Hintertreffen geraten. So machten chinesische Hersteller zuletzt etwa 60 Prozent des indischen Smartphone-Marktes aus. Auch die Handelsbilanz beider Staaten spricht für sich. Indien importierte in den ersten drei Monaten des Jahres Waren im Wert von 27,7 Milliarden Dollar aus China, exportierte aber nur Waren im Wert von 4,9 Milliarden Dollar in die Volksrepublik.
Nun sollen heimische Unternehmen mit Regierungshilfe Marktanteile zurückgewinnen. “In vielerlei Hinsicht folgt Indien dem chinesischen Vorbild”, sagte Professor Jabin T. Jacob, China-Fachmann der Universität Shiv Nadar in Neu-Delhi, der Financial Times. Genau wie China in der Vergangenheit ganz gezielt eigene Tech-Giganten gefördert hat, um US-Konzerne wie Google, Amazon und Facebook vom Heimatmarkt fernzuhalten, wolle auch Indien lieber auf eigene Unternehmen setzen. So soll letztendlich auch die Abhängigkeit von chinesischen Importen gemindert werden. Jörn Petring/Gregor Koppenburg
Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft verschlechtert sich wieder. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des produzierenden Gewerbes ist im Juli nach Angaben des Nationalen Statistikamtes (NBS) vom Sonntag überraschend wieder eingebrochen – und zwar deutlich. Er sank laut Bloomberg von 50,2 auf nur noch 49,0. Damit deutet der Indikatior nun erneut auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hin: Denn er liegt wieder unterhalb der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte über 5 signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivitäten, Werte darunter eine Kontraktion. Bis Juni hatte der Index monatelang in negativem Terrain gelegen – wohl unter dem Eindruck der vielen Lockdowns im Land. Der erneute Einbruch dämpft nun die Hoffnung auf eine rasche Trendwende.
“Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Stimmung in China etwas eingetrübt”, räumte Zhao Qinghe, leitender Statistiker beim NBS, ein. Der offizielle PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe – also etwa für den Bau- oder Dienstleistungssektor – ging ebenfalls auf 53,8 gegenüber 54,7 im Juni zurück. Er blieb damit aber immer noch deutlich im Bereich der Expansion. Zhao wertete dies daher auch als Anzeichen für die weitere Erholung dieser Branchen. Die Teilindizes für den Luftverkehr und das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe lagen laut Xinhua über 60 und damit “auf einem relativ hohen Niveau”.
Es mehren sich derweil die Anzeichen, dass die politische Führung still und leise Abstand von ihrem im März proklamierten Wachstumsziel von “etwa 5,5 Prozent” nimmt. Das 25-köpfige Politbüro der Kommunistischen Partei betonte auf einem Treffen Ende vergangene Woche die Fortführung der “Null-Covid-Politik. Der Sitzungsbericht erwähnte aber nicht das Wachstumsziel, sondern rief laut der Analysefirma Trivium China zu Bemühungen auf, “die wirtschaftlichen Operationen in einem vernünftigen Rahmen zu halten und die besten Ergebnisse zu erzielen”. Trivium sieht das in einer Notiz als Abkehr von einer fixen Zielgröße: “Den Beamten zu sagen, sie sollen ihr Bestes geben, ist etwas ganz anderes, als ihnen zu sagen, sie müssten ein bestimmtes Ziel erreichen.”
Westliche Analysten stuften die Wachstumserwartungen bereits herunter (China.Table berichtete). Der Internationale Währungsfonds etwa erwartet nur 3,3 Prozent. Chinas Wachstum lag im zweiten Quartal bei nur noch 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 4,8 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. ck
Die Vorsitzendende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist zu ihrer mit Spannung erwarteten Asienreise aufgebrochen. Ob sie einen Zwischenstopp in Taiwan einlegt, war zu Redaktionsschluss weiter unklar. Am Sonntag kündigte das Büro der Politikerin Stopps in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan an. Zu Taiwan kein Wort. “Unsere Delegation wird hochrangige Gespräche führen, um zu erörtern, wie wir unsere gemeinsamen Interessen und Werte weiter vorantreiben können”, erklärte Pelosi laut AFP in der Mitteilung. Im Fokus liegen demnach Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Klimaschutz und Menschenrechte.
China reagierte trotzdem, wohl als Warnung an Washington: Am Samstag ließ das Militär im nördlichen Teil der Taiwanstraße Manöver mit scharfer Munition abhalten. Dazu wurden laut dpa Teile der Gewässer vor der Taiwan gegenüberliegenden Küstenprovinz Fujian gesperrt. China hat den USA in den vergangenen Tagen mit harten Konsequenzen gedroht, sollte Pelosi wirklich nach Taiwan reisen. Das US-Militär geht laut Berichten daher davon aus, Pelosis Flugzeug im Zweifelsfall absichern zu müssen – und soll wenig begeistert von der Reise-Idee sein.
Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan ist derzeit im Südchinesischen Meer unterwegs; Beobachter gehen von einem Kurs Richtung Taiwanstraße aus. Das US-Militär sprach indes laut dpa von einer länger geplanten Fahrt und “Routine-Patrouille”. Das Außenministerium Singapurs bestätigte unterdessen laut AFP, dass Pelosis Delegation den Stadtstaat ab dem heutigen Montag besuchen und dabei Präsidentin Halimah Yacob und Premierminister Lee Hsien Loong treffen werde. ck
China hat mit dem Bau seines ersten Großprojekts zur Wärmeerzeugung durch Atomkraft begonnen. Am Atomkraftwerk von Haiyang in Yantai, Provinz Shandong, sollen ab dem Jahr 2023 rund 900 Megawatt Wärmeenergie erzeugt werden. Die durch den Reaktor entstehende Wärme will man nutzen, um Dampf zu erzeugen, der dann durch eine Pipeline an die Haushalte geschickt wird. Auch die nahen Metropolen Weihai und Qingdao sollen auf diese Weise mit Wärme beliefert werden. Insgesamt wollen die Betreiber circa eine Million Menschen mit Heizwärme versorgen können. Schon heute werden die zwei Westinghouse-Druckwasserreaktoren des Kernkraftwerks für die Kraft-Wärme-Kopplung – also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme – genutzt.
Laut der Analysefirma Trivium China “scheint das neue Projekt das weltweit größte Einzelprojekt zur Dampferzeugung mithilfe von Atomenergie zu sein”. Es ersetzt jährlich 900.000 Tonnen Kohle für Heizzwecke und wird das administrativ zu Yantai gehörende Haiyang zu Chinas erster Stadt mit kohlenstofffreier Wärmeversorgung für Heizzwecke machen.
Im Streben nach Klimaneutralität setzt China neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch auf die Kernkraft. In den nächsten 15 Jahren will es etwa 150 Reaktoren bauen – und damit die aktuelle Zahl vervierfachen. In den letzten Jahren kam es dabei jedoch zu Verzögerungen (China.Table berichtete). Beim Ausbau der Kernkraft setzt das Land auch auf die Weiterentwicklung bestehender Reaktoren. Am Kraftwerk in Yantai werden beispielsweise zwei weitere Reaktoren aus chinesischer Bauart errichtet. Sie sollen im Jahr 2027 ans Netz gehen und für 60 Jahre Strom erzeugen. nib
Stromerzeugung und Produktion in Chinas Fotovoltaiksektor haben im ersten Halbjahr 2022 stark zugelegt. Zwischen Januar und Juni wurden mit knapp 31 Gigawatt (GW) um 137,4 Prozent mehr Fotovoltaik-Kapazität für die Stromerzeugung installiert als im Vorjahreszeitraum. Das berichtet Xinhua unter Berufung auf den Verband der Fotovoltaikindustrie. Auch die Produktion in der gesamten Fotovoltaik-Lieferkette sei nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie mit einem durchschnittlichen Plus von mehr als 45 Prozent stark gestiegen, hieß es. Besonders stark legten mit 54,1 Prozent kristalline Siliziummodule zu.
Erfreulich entwickelten sich nach dem Bericht trotz moderat steigender Preise auch die Exporte von Fotovoltaikprodukten. Sie beliefen sich auf rund 26 Milliarden US-Dollar und lagen damit um gut 113 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Ausfuhr von Fotovoltaik-Modulen lag mit 79 GW Leistung so hoch wie noch nie und 74 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2021. Die großen Stromerzeugungsunternehmen investierten zudem laut Xinhua in der ersten Jahreshälfte 63 Milliarden Yuan in die Solar-Stromerzeugung, 284 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. ck
Trümmer einer am 24. Juli gestarteten Trägerrakete vom Typ “Langer Marsch 5B” sind am frühen Sonntagmorgen nahe Südoastasien abgestürzt. Die chinesische Weltraumbehörde meldete laut AFP am Sonntag Koordinaten für das Einschlagsgebiet in der Sulu-See, knapp 60 Kilometer vor der Ostküste der philippinischen Insel Palawan. “Die meisten Bauteile wurden beim Wiedereintritt abgetragen und zerstört”, hieß es. Die malaysische Raumfahrtbehörde teilte Beobachtungen mit, wonach Raketentrümmer beim Wiedereintritt in die Atmosphäre in Brand geraten seien und dann in die Sulu-See stürzten. Die Rakete hatte das zweite von drei geplanten Modulen für die chinesische Raumstation “Tiangong” ins All gebracht.
Nasa-Chef Bill Nelson hatte Peking am Samstag auf Twitter vorgeworfen, vorab keine Informationen über die Flugbahn der Rakete veröffentlicht zu haben. Alle Raumfahrt-Nationen sollten “diese Art von Informationen im Voraus austauschen, um verlässliche Vorhersagen über das potenzielle Risiko eines Trümmeraufpralls zu ermöglichen”,mahnte er. Das sei insbesondere bei Schwerlasttransportern wie “Langer Marsch 5B” wichtig. Deren Teile stellten “ein erhebliches Risiko für den Verlust von Menschenleben und Eigentum darstellen. ck

Wird es im November 2022 einen Machtwechsel in der Führungsspitze Chinas geben? Mit Fragen wie dieser befasst sich Viktoria Laura Herczegh als Analystin bei Geopolitical Futures, der 2015 von George Friedman gegründeten Publikation für geopolitische Prognosen. Nebenbei schreibt sie an ihrer Doktorarbeit in Internationalen Beziehungen und Politikwissenschaft an der Corvinus-Universität in Budapest.
Ihre Einschätzung: “Ich glaube nicht, dass Xi nicht wiedergewählt wird.” Aber: “Die Verschiebungen, die jetzt innerhalb des engsten Führungszirkels stattfinden, deuten darauf hin, dass Xi Jinpings Macht nicht annähernd so stark ist, wie sie einmal war.” Allein der Umstand, dass Politiker aus seinem innersten Kreis Bedenken zu wichtigen Punkten des aktuellen Fünfjahresplans (2021-2025) äußerten, stelle seinen Machtanspruch infrage – und sei ein Novum. Als Leitfigur des oppositionellen Lagers sieht Herczegh Chinas Vizepremier Han Zheng. Sollte er wider Erwarten im November gewählt werden, ginge dies mit einer Öffnung gegenüber der westlichen Welt einher, so Herczegh.
Chinas politische Strukturen spielen auch in Herczeghs Dissertation über die Doppelmoral von Großmächten (“Double standard projection of great powers through specific cases”) eine große Rolle. Darin untersucht sie unter anderem die politische Interaktion Chinas mit den USA – und kommt zu interessanten Ergebnissen: “Meine Erkenntnisse zeigen, dass es, wenn es eine Doppelmoral gibt, auch eine umgekehrte Doppelmoral gibt.” Keine der Großmächte habe also das Recht, andere der Doppelmoral zu bezichtigen. “Sie neigen selbst dazu, mit zweierlei Maß zu messen.”
Schon als Kind war Herczegh ein Sprachtalent und absorbierte neue Wörter und Strukturen mit Freude und Leichtigkeit. 2012 kam sie dann während ihres Bachelorstudiums mit dem Chinesischen in Kontakt: “Bei Chinesisch war es wirklich das erste Mal, dass ich für eine Sprache lernen musste”, erzählt sie. Es hilft eben nicht, sich einfach die Schriftzeichen anzusehen und einzuprägen. “Man muss erstens die Töne üben und zweitens, was noch wichtiger ist, das Schreiben der Schriftzeichen üben.” Heute spricht die Ungarin neben ihrer Muttersprache auch Mandarin, Englisch, Spanisch, Italienisch und etwas Koreanisch.
Nach dem Abschluss des Bachelors in chinesischer und spanischer Sprache und Kultur an der Eötvös Loránd University ging sie ein Semester nach Shanghai, um dort ihre Chinesischkenntnisse zu vertiefen. Zurück in Ungarn studierte sie 2015-2018 den brandneuen Masterstudiengang East Asian Studies – eine Kooperation zwischen der Corvinus Universität Budapest und der Pázmány Péter Catholic University. “Ich habe mich schon immer für Politik und die modernen Aspekte Chinas und Ostasiens interessiert – vor allem wegen des chinesischen Wirtschaftswunders, das wir in den Jahren meines Studiums erlebt haben.”
An China fasziniert sie, wie das Land Tradition und Modernität miteinander vereinbart. Das betreffe nicht nur die Architektur, sondern auch die Denkstrukturen der Menschen. So würden auch heute noch junge Leute ganz selbstverständlich alte chinesische Sprichwörter in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch nutzen. Und ihr Interesse an Südostasien ist noch lange nicht erschöpft. Selbst für die Flitterwochen hat sie Japan und Südkorea ins Auge gefasst. Juliane Scholübbers
Leon Bechler stößt zum China-Desk der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Scholz aus Stuttgart. Bechler hat in Furtwangen Wirtschaft und an der Northwest University Chinesisch studiert.
Marco Braun übernimmt eine Führungsposition im Bereich Forschung und Entwicklung bei BMW in Shanghai. Er ist 2019 zu BMW gestoßen, nachdem er an der Tongji einen Abschluss gemacht hat.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
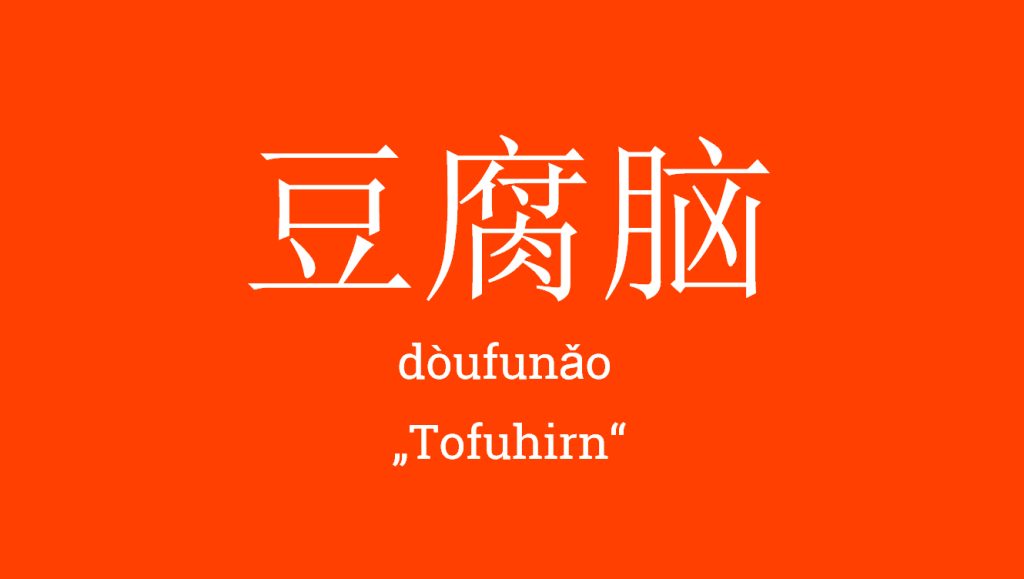
Sie haben schon viele Horrorgeschichten über die kulinarischen Vorlieben der Chinesen gehört und jetzt auch noch das: Ihr chinesischer Begleiter ordert für Sie im Restaurant lässig eine Schüssel “Tofuhirn” (豆腐脑 dòufunǎo). Doch keine Panik, bitte. Fluchtreflexe gleich wieder ausknipsen. Denn die Gourmet-Gruselstory, die vielleicht gerade in ihrem Kopfkino Premiere feiert, ist falsch aufgelegt. Serviert wird nämlich keine weichgekochte Denkmasse, sondern ein schmackhafter und eiweißreicher Tofupudding, wahlweise in süßer (Südchina) oder deftiger (Nordchina) Ausführung, hergestellt aus frischen und gesunden Zutaten – allen voran jede Menge Sojaprotein.
Wir Westler sind ja oft etwas aufgescheucht, wenn es um Essensexperimente im Reich der Mitte geht. Tatsächlich geht es im kulinarischen Alltag in China aber definitiv wesentlich weniger wild zu, als es manch falsches Vorurteil nahelegen mag. Doch die Schreckenslegenden halten sich hartnäckig, so dass man als Chinesischlerner auf China-Restaurant-Safari aus Angst vor unerwarteten Überfällen auf die Geschmacksknospen die Flinte vielleicht auf Daueranschlag hat. Leider trägt es auch nicht gerade zur Entschärfung des inneren Notfallmodus bei, wenn man chinesische Speisekarten und Supermarktlabels allzu wörtlich nimmt. Denn viele Speisen – besser gesagt ihre chinesischen Bezeichnungen – werden nicht so heiß gegessen, wie sie das Wörterbuch vorkocht. Sprich: manches zunächst unappetitlich klingende Wortungetüm entpuppt sich bei näherem Hinsehen als harmloses Häppchen.
Das gilt zum Beispiel auch für ein weiteres Tofu-Gericht – nämlich “Tofu nach Art der pockennarbigen Alten” (麻婆豆腐 mápó dòufǔ), ein landesweit beliebter Klassiker der Sichuanküche. Sein Geschmacksgeheimnis besteht natürlich nicht in einer Zubereitung durch Hausdamen mit Hautproblemen, sondern vielmehr aus zartweich auf der Zunge zerschmelzendem milden Tofuquark, der mit feuriger Sichuan-Schärfe angemacht und zum Abschluss mit gebratenem Schweinehack garniert wird. Bonne Appetite!
Komisch kribbeln mag es in der Magengegend, wenn man auf dem Menü “Ameisen, die auf einen Baum krabbeln” entdeckt (蚂蚁上树 mǎyǐ shàng shù). Sie werden schon ahnen, dass die Chinesen auch hier wieder tief in die Metapher-Trickkiste gegriffen haben. Es handelt sich schlichtweg um gebratene Glasnudeln mit würzigem Schweinehack. Das körnige Hackfleisch, das an den geschmeidigen Glasnudeln haften bleibt, hat wohl den einen oder anderen im Hunger-Delirium an Krabbelgetier erinnert, das Zweige und Äste erklimmt. Daher der etwas abenteuerliche Name.
Das nächste Gericht ist nichts für schwache Gaumen, aber immerhin längst nicht so blutrünstig, wie der Name nahelegen mag. Die Rede ist von “Lungenstücken vom Ehepaar” (夫妻肺片 fūqī fèipiàn). Für die beliebte Sichuaner Kaltspeise hat zum Glück niemand seine Nachbarn kaltgemacht, dafür aber so einiges anderes Getier. Hauptzutat des scharfen Appetizers ist nämlich alles, was das Rind so hergibt – neben Rindfleisch auch Rinderkopfhaut, Rinderherz, Rinderzunge und Rinderkutteln. Das alles wird in Salzlake eingelegt, später in Scheiben angerichtet und mit Chili-Öl, Frühlingszwiebeln und anderen Zutaten serviert. Den Namen “Ehegattenlunge” hat das Gericht seinen Erfindern zu verdanken – einem Ehepaar aus Chengdu, das in den 1930er Jahren einst kalte Rinderlungenstücke als Arme-Leute-Essen verkauft haben soll. Mit wachsendem Wohlstand wurde der Snack dann mit der Zeit durch hochwertigere Innereien aufgemotzt.
In chinesischen Werkskantinen erwarten Sie außerdem noch:
Auch beim Obsthändler werden Essenshypochonder übrigens über Verdächtiges stolpern, zum Beispiel über “Drachenaugen” (龙眼 lóngyǎn) – gemeint sind die ockerfarbenen Longanfrüchte, die von der Form her entfernt an Litschis erinnern – oder “Makakenpfirsiche” (猕猴桃 míhóutáo) – das ist tatsächlich die offizielle chinesische Bezeichnung für Kiwis (mit etwas Fantasie erinnert die Schale ja auch irgendwie an ruppiges Affenfell).
Wer sich jetzt bei so viel Worttohuwabohu lieber wieder in heimische Hausmannskostgefilde verkriechen will, den muss ich (sprachlich) leider enttäuschen. Denn auch Haribo und Co. haben in China einen etwas abenteuerlichen Namen, nämlich “Radiergummizucker” (橡皮糖 xiàngpítáng) – die chinesische Bezeichnung für Fruchtgummi. Und auf dem Grill kringeln sich “Duftdärme” (香肠 xiāngcháng) – Chinesisch für “Würste”. Wer sprachlich auf Nummer sicher gehen will, bleibt in diesem Sommer also am besten einfach bei der “Hundert-Düfte-Frucht” 百香果 bǎixiāngguǒ – der Maracuja. Da kann man assoziationsmäßig absolut nichts falsch machen und das kulinarische Kopfkino bleibt garantiert aus.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
der Erfolgsautor und Sinologe Stephan Thome lebt seit 12 Jahren in Taiwan. Er schreibt Romane mit einer lokalen Perspektive, und hat zuletzt mit “Pflaumenregen” ein Buch vorgelegt, das in der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft über die Insel spielt. Im Interview mit Fabian Peltsch erzählt Thome, wie er die gegenwärtige Bedrohungslage auf der Insel erlebt, was er sich für Taiwan wünscht und wie er zu dem gelegentlichen Vorwurf kultureller Aneignung steht.
Es gibt Umfragen, nach denen die meisten Menschen kaum etwas so lästig finden wie ihre Nachbarn. China und Indien mag es ähnlich gehen; seit Jahrzehnten beharken sich beide über ihren Grenzverlauf. So ist es kein Wunder, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern längst nicht so gut laufen, wie es sein könnte. Nun straft Indien China für sein aggressives Verhalten entlang der Grenze ab. Wie unser Redaktionsteam in Peking analysiert, geht Neu-Delhi derzeit rabiat gegen chinesische IT-Firmen vor, die in Indien eigentlich Fuß fassen wollen.
Unterdessen ist die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Asien aufgebrochen. Ob sie dabei, wie unter anderem von der Financial Times spekuliert, auch Taiwan besuchen wird, war am Sonntag weiter unklar. Manche Analysten erwarten im Falle eines Taipeh-Abstechers Pelosis eine politische Krise im Dreieck USA-China-Taiwan. Wir behalten die Lage im Blick.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche!


Mit Ihrem ersten Roman “Grenzgang” gelang Ihnen 2009 ein Überraschungserfolg. Geschrieben haben Sie ihn in Ihrer Zeit als Forschungsassistent an der Academia Sinica in Taiwan. Hatten Sie dort den nötigen Abstand, um ein Sittenbild der deutschen Provinz zu entwerfen?
Das Vorbild für den Ort, in dem “Grenzgang” spielt, ist mein Heimatort in Oberhessen. Die Gegend kenne ich so gut, darüber hätte ich überall schreiben können. Tatsächlich sind fast alle meine Romane in Taiwan entstanden. Damals hatte ich die Idee einfach im Gepäck.
Mittlerweile leben Sie seit 12 Jahren in Taiwan. Ihr jüngster Roman “Pflaumenregen” spielt zu der Zeit, als die Insel unter japanischer Kolonialherrschaft stand. Zeitgleich haben Sie eine “Gebrauchsanweisung für Taiwan” in Buchform veröffentlicht. Wie kommt es, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen über Taiwan erst jetzt literarisch verarbeiten?
Bei Lesereisen kam immer wieder die Frage auf: Wenn Sie schon dort leben, wieso schreiben Sie nicht darüber? Man muss aber erstmal dahin kommen, auf eine Art über Asien schreiben zu können, dass die Schauplätze nicht zu einer exotischen Fototapete voller westlicher Helden werden. Will man substantiell etwas über diese Länder mitteilen, muss man sich etwas besser auskennen. Zwei Jahre Aufenthalt und ein paar Sprachkenntnisse reichen nicht aus, um eine derart reichhaltige Kultur und Geschichte zu verstehen.
Sie schreiben als Deutscher aus der Sicht von Chinesen. Man könnte das als Vermessenheit oder sogar als kulturelle Aneignung betrachten.
Einige englischsprachige Verlage, denen wir die Bücher angeboten haben, merkten tatsächlich an, dass dies ein Fall von “Cultural Appropriation” sei. Allerdings kam der Vorwurf bereits, bevor jemand den Text gelesen hatte. Das hat mich etwas konsterniert. Bei “Pflaumenregen” hatte ich das Gefühl, dass ich über Menschen schreibe, die ich gut kenne. Im Vorgänger “Gott der Barbaren” tritt ein Konfuzianer des 19. Jahrhunderts auf. Wie dieser sich fühlt, kann sich ein Chinese heute genauso wenig vorstellen wie ich zu Beginn meiner Recherche.
Ich bin beim besten Willen kein Gegner der sozialen Bewegungen, die heute für mehr Diversität und Gerechtigkeit eintreten. Bei der Literatur habe ich jedoch Bedenken, dass eine Verengung stattfindet hinsichtlich der Frage, was einen Text authentisch macht. Eingehende Recherche, Fantasie, Einfühlungsvermögen, technisches Handwerk und solche Dinge sind auch wichtig, wenn man einen Text authentisch und glaubwürdig machen will. Übrigens profitiert die gesamte Gesellschaft davon, wenn wir es schaffen – als Schreibende, Lesende, Bürgerinnen und Bürger -, uns besser in andere Menschen hineinzuversetzen
Sie sind mit einer Taiwanerin verheiratet und leben in Taipeh. Betrachten Sie Taiwan mittlerweile als ihre Heimat?
Ich nenne es meine zweite Heimat. Es gibt keinen Grund, Heimat nur im Singular zu gebrauchen. In Deutschland hat mein Heimatgefühl etwas Selbstverständliches. Selbstverständlichkeit kann aber auch bedeuten, dass vieles unverstanden bleibt, weil man es nie hinterfragt hat. In Taiwan musste ich mir das Gefühl von Heimat erst erarbeiten, indem ich mich bemüht habe, das Land explizit und umfassend zu verstehen. Vermutlich habe ich über taiwanische Geschichte intensiver nachgedacht als über die europäische, auch aufgrund der dortigen Lebensumstände. Das Damoklesschwert der chinesischen Bedrohung schwebt täglich über uns – gut möglich, dass meine Frau und ich eines Tages gezwungen sein werden, Taiwan zu verlassen.
Gehen Sie mit der chinesischen Bedrohung anders um als ihre taiwanische Familie?
Was ich wahrnehme, ist, dass manche Menschen in Taiwan dazu neigen, die Bedrohung nicht direkt zu thematisieren. Vielleicht weil das Maß an Bedrohlichkeit für sie ungleich höher ist als für mich, der ich in Deutschland eine weitere Heimat habe. Deshalb bin ich derjenige, der das Thema am ehesten anspricht. Ich ermutige meine Frau dazu, Deutsch zu lernen, sozusagen als Vorbereitung für den Ernstfall. Niemand weiß, was geschehen wird; man kann sich nur innerlich wappnen. Zwar besteht die Bedrohung schon seit 70 Jahren, aber ich glaube, dass viele Leute unterschätzen, dass Xi Jinping ein Game Changer ist. Der Druck auf Taiwan steigt, China zeigt heute eine größere Bereitschaft, es mit der westlichen Welt aufzunehmen und dafür auch einen Preis zu zahlen.
Wie stehen Sie heute zu China?
Es ist heute ein anderes Land als vor zehn, zwölf Jahren. Ich habe mich in China nie so wohl gefühlt wie in Taiwan, aber ich war fasziniert von dem Land, habe es gerne bereist und habe auch noch einige wenige Freunde dort. Seit dem Nationalen Sicherheitsgesetz (für Hongkong, d. Red.) ist aber eigentlich klar, dass ich nicht mehr dorthin reisen kann. Man würde mir wohl kein Visum ausstellen. Schon die letzten Male musste ich alle meine Buchtitel angeben, und jetzt stehen da eben auch Titel wie “Gebrauchsanweisung für Taiwan”. Hinzu kommen einige Presseartikel, die deutlich China-kritisch waren.
Ist das ein schwerer Verlust für Sie?
Ja, ich bedauere das sehr. Auch weil es irgendwann schwierig wird, sich noch als Experte für das Land zu bezeichnen. Wenn man keine persönlichen Eindrücke mehr vor Ort sammeln kann, verengt und verzerrt sich die Wahrnehmung. Man darf ja nicht vergessen, wie viele freundliche weltoffene Menschen es in China gibt, die an einem ehrlichen Austausch mit dem Westen interessiert sind. Nicht alle sind patriotische Eiferer. Das verliert man leicht aus dem Blick, wenn man nur die tagesaktuelle Berichterstattung verfolgt. Wir brauchen mehr China-Kompetenz, aber es wird immer schwerer, sie zu bekommen.
Als fantasiebegabter Schriftsteller: Was wäre Ihrer Meinung nach das Best-Case-Szenario für Taiwan?
Wäre es ein Wunschkonzert, würde ich mir wünschen, dass auf dem Festland peu à peu ein Wandel einsetzt, hin zu der Haltung: Wir brauchen die Insel nicht, wir könnten in Taiwan einfach einen guten Nachbarn haben, mit dem wir Handel treiben. Ich weiß aber, dass das völlig unrealistisch ist. Das realistische Best-Case-Szenario ist, dass die USA und Europa genug Druck auf China ausüben, um dort die Einsicht zu fördern, dass der Preis einer Invasion politisch, ökonomisch und militärisch zu hoch wäre, um sie zu vollziehen. Schwer genug, aber darauf sollte man politisch hinarbeiten. In Europa scheint sich der Wind gerade zu drehen. Wir wissen, dass wir im Umgang mit Russland Fehler gemacht haben – und wir wissen, dass wir auch im Umgang mit China Fehler machen, Stichwort Abhängigkeit: dort von Öl und Gas, hier vom chinesischen Absatzmarkt.
Ist es umgekehrt denkbar, dass die Taiwaner sich irgendwann einen Anschluss an Großchina wünschen?
Das ist sehr schwer vorstellbar, die ganze soziale Entwicklung geht in die andere Richtung. Die Menschen betonen immer mehr die eigene taiwanische Identität, für die meisten jungen Leute ist das heute einfach selbstverständlich. In Taiwan gibt es jetzt eine ganze Generation, die in demokratischen Verhältnissen aufgewachsen ist; für diese wird China trotz seines Reichtums immer unattraktiver. Die Volksrepublik müsste gewaltige Anstrengungen unternehmen, um dagegen zu arbeiten, aber oft gießen solche Kampagnen vom Festland eher Wasser auf die Mühlen der Taiwaner. Wenn das Regime Drohungen ausstößt, schnellen die Umfragewerte von Tsai Ing-wen sofort in die Höhe.
Welche Bücher außer Ihren eigenen muss man lesen, um Taiwan besser zu verstehen?
Der Roman “The Stolen Bicycle” von Wu Ming-yi ist das Beste, was ich an taiwanischer Literatur in letzter Zeit gelesen habe. Es gibt aber auch tolle akademische Arbeiten, etwa “Why Taiwan” von Alan Wachman über das geostrategische Interesse Chinas an Taiwan. Eine wunderbare Sozialgeschichte hat Andrew D. Morris mit “Colonial Project, National Game” vorgelegt. Hier kann man sehen, dass sich die taiwanische Geschichte des 20. Jahrhunderts tatsächlich anhand der Entwicklung des Baseballs im Land erzählen lässt. Außerdem gibt es sehr gute Filme, etwa “Warriors Of The Rainbow” über den Kampf der Ureinwohner Taiwans gegen die japanischen Kolonialherren. Oder “Kanō”, ein Baseballfilm, der ein anderes, viel positiveres Bild der Kolonialzeit zeichnet. Oder “The Silent Forest”, ein sehr intensiver Film über sexuellen Missbrauch an einer Schule für gehörlose Jugendliche. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen.
Wird ihr nächstes Buch wieder in Taiwan spielen?
Darüber spreche ich noch ungern. Was ich mir für die Zukunft aber vorstellen kann, ist ein Sachbuch über den chinesisch-taiwanischen Konflikt, sozusagen als Handreichung für interessierte deutsche Leser ohne chinaspezifische Vorkenntnisse: Woher kommt der Konflikt, was treibt ihn gegenwärtig an, worum geht es ideologisch, geostrategisch und ökonomisch? Bei meinen Lesungen mit “Pflaumenregen” habe ich festgestellt, dass sehr viele Leute an der Thematik interessiert sind, aber die tagesaktuelle Presse kann den ganzen historischen Hintergrund natürlich nicht liefern.
Was würden Sie sich von der deutschen Berichterstattung über Taiwan wünschen?
Vor allem wünsche ich mir mehr davon! Es gibt keine deutsche Tageszeitung mit einem ständigen Korrespondenten in Taiwan. Der britische Guardian hat jemanden, dadurch wird die Berichterstattung gleich vielfältiger – auch kleinere Ereignisse und die Normalität des Alltags kommen vor. Taiwan ist weit mehr als eine potentielle Krisenregion: Ein faszinierendes, kulturell und landschaftlich vielfältiges Land mit einer unschlagbaren Küche.
Stephan Thome wurde 1972 in Biedenkopf/ Hessen geboren. Er studierte Philosophie und Sinologie und lebt seit über 12 Jahren in Ostasien. Seine letzten Bücher “Gott der Barbaren”, “Gebrauchsanweisung für Taiwan” und “Pflaumenregen” setzen sich intensiv mit chinesischer Geschichte auseinander.

Für chinesische Technologie-Konzerne läuft die Expansion ins Ausland schleppend. Zuerst waren es westliche Staaten, allen voran die USA, die den Firmen aus Angst vor Spionage und vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen mehr und mehr die Türen verschlossen haben. Nun nimmt der Druck auch im Nachbarland Indien massiv zu.
BBK Electronics etwa bekam das in den vergangenen Tagen gleich doppelt zu spüren. Dem Konzern aus der Südprovinz Guangdong gehören mit Oppo und Vivo zwei der größten Smartphone-Marken Chinas. Zusammengerechnet sind sie sowohl auf ihrem Heimatmarkt als auch in Indien Marktführer. Doch in Indien ermitteln jetzt die Steuerbehörden. Zuerst beschuldigten sie Vivo vergangene Woche, durch illegale Transferzahlungen Gewinne verschleiert zu haben – und froren umgerechnet rund 60 Millionen Euro an Firmengeldern vorübergehend ein.
Nur drei Tage später verkündeten die indischen Behörden, dass auch Oppo Steuern hinterzogen habe. Demnach soll das Unternehmen umgerechnet rund 550 Millionen Euro an Einfuhrzöllen nicht gezahlt haben. Bereits vor zwei Monaten erging es dem chinesischen Smartphone-Giganten Xiaomi ähnlich. Von diesem beschlagnahmten die indischen Behörden rund 700 Millionen Euro Bankguthaben. Dann nahm allerdings ein Gericht die Entscheidung zurück.
Gerade erst auf dem per Videoschalte abgehaltenen BRICS-Gipfel vor drei Wochen hatte sich China vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts bemüht, Geschlossenheit mit den Partnerländern Brasilien, Russland, Südafrika und eben Indien zu demonstrieren (China.Table berichtete). Die Realität sieht jedoch anders aus. Zwar ist auch Indien gegen die westlichen Russland-Sanktionen. Eine ähnliche Haltung in diesem einen Punkt macht Neu-Delhi und Peking aber längst nicht zu Freunden.
Die Beziehungen der beiden bevölkerungsreichsten Staaten bleiben angespannt, seit es vor zwei Jahren zu einem tödlichen Zusammenstoß von Soldaten beider Länder an der gemeinsamen Grenze in der Himalaya-Region gekommen war. Derzeit halten indische und chinesische Militärs bereits die 16. Gesprächsrunde zur Beilegung des Konfliktes ab. Bislang jedoch ohne Ergebnis. Zwar betont die indische Führung, dass die Maßnahmen gegen chinesische Firmen nicht politisch motiviert seien. Dennoch begann der große Crackdown nachweislich direkt nach den Grenzkämpfen.
Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hat seitdem mehr als 200 Apps von chinesischen Anbietern in Indien verboten. Auch die chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE gerieten ins Visier. Beide sind vom Ausbau des 5G-Netzes praktisch ausgeschlossen. Mittlerweile haben die Steuerbehörden Untersuchungen bei mehr als 500 chinesischen Unternehmen eingeleitet, wie Insider dem Finanzdienst Bloomberg berichteten. Neben ZTE, Vivo, Xiaomi, Huawei und Oppo sollen auch mehrere Tochterfirmen von Alibaba betroffen sein.
Indien, so analysieren Beobachter, geht es bei den Maßnahmen wohl nicht ausschließlich um eine Reaktion auf den Grenzkonflikt. Vielmehr sei die Regierung vor dem Hintergrund der aggressiven Expansion chinesischer Firmen besorgt, dass lokale Unternehmen ins Hintertreffen geraten. So machten chinesische Hersteller zuletzt etwa 60 Prozent des indischen Smartphone-Marktes aus. Auch die Handelsbilanz beider Staaten spricht für sich. Indien importierte in den ersten drei Monaten des Jahres Waren im Wert von 27,7 Milliarden Dollar aus China, exportierte aber nur Waren im Wert von 4,9 Milliarden Dollar in die Volksrepublik.
Nun sollen heimische Unternehmen mit Regierungshilfe Marktanteile zurückgewinnen. “In vielerlei Hinsicht folgt Indien dem chinesischen Vorbild”, sagte Professor Jabin T. Jacob, China-Fachmann der Universität Shiv Nadar in Neu-Delhi, der Financial Times. Genau wie China in der Vergangenheit ganz gezielt eigene Tech-Giganten gefördert hat, um US-Konzerne wie Google, Amazon und Facebook vom Heimatmarkt fernzuhalten, wolle auch Indien lieber auf eigene Unternehmen setzen. So soll letztendlich auch die Abhängigkeit von chinesischen Importen gemindert werden. Jörn Petring/Gregor Koppenburg
Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft verschlechtert sich wieder. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des produzierenden Gewerbes ist im Juli nach Angaben des Nationalen Statistikamtes (NBS) vom Sonntag überraschend wieder eingebrochen – und zwar deutlich. Er sank laut Bloomberg von 50,2 auf nur noch 49,0. Damit deutet der Indikatior nun erneut auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hin: Denn er liegt wieder unterhalb der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte über 5 signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivitäten, Werte darunter eine Kontraktion. Bis Juni hatte der Index monatelang in negativem Terrain gelegen – wohl unter dem Eindruck der vielen Lockdowns im Land. Der erneute Einbruch dämpft nun die Hoffnung auf eine rasche Trendwende.
“Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Stimmung in China etwas eingetrübt”, räumte Zhao Qinghe, leitender Statistiker beim NBS, ein. Der offizielle PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe – also etwa für den Bau- oder Dienstleistungssektor – ging ebenfalls auf 53,8 gegenüber 54,7 im Juni zurück. Er blieb damit aber immer noch deutlich im Bereich der Expansion. Zhao wertete dies daher auch als Anzeichen für die weitere Erholung dieser Branchen. Die Teilindizes für den Luftverkehr und das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe lagen laut Xinhua über 60 und damit “auf einem relativ hohen Niveau”.
Es mehren sich derweil die Anzeichen, dass die politische Führung still und leise Abstand von ihrem im März proklamierten Wachstumsziel von “etwa 5,5 Prozent” nimmt. Das 25-köpfige Politbüro der Kommunistischen Partei betonte auf einem Treffen Ende vergangene Woche die Fortführung der “Null-Covid-Politik. Der Sitzungsbericht erwähnte aber nicht das Wachstumsziel, sondern rief laut der Analysefirma Trivium China zu Bemühungen auf, “die wirtschaftlichen Operationen in einem vernünftigen Rahmen zu halten und die besten Ergebnisse zu erzielen”. Trivium sieht das in einer Notiz als Abkehr von einer fixen Zielgröße: “Den Beamten zu sagen, sie sollen ihr Bestes geben, ist etwas ganz anderes, als ihnen zu sagen, sie müssten ein bestimmtes Ziel erreichen.”
Westliche Analysten stuften die Wachstumserwartungen bereits herunter (China.Table berichtete). Der Internationale Währungsfonds etwa erwartet nur 3,3 Prozent. Chinas Wachstum lag im zweiten Quartal bei nur noch 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 4,8 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. ck
Die Vorsitzendende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist zu ihrer mit Spannung erwarteten Asienreise aufgebrochen. Ob sie einen Zwischenstopp in Taiwan einlegt, war zu Redaktionsschluss weiter unklar. Am Sonntag kündigte das Büro der Politikerin Stopps in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan an. Zu Taiwan kein Wort. “Unsere Delegation wird hochrangige Gespräche führen, um zu erörtern, wie wir unsere gemeinsamen Interessen und Werte weiter vorantreiben können”, erklärte Pelosi laut AFP in der Mitteilung. Im Fokus liegen demnach Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Klimaschutz und Menschenrechte.
China reagierte trotzdem, wohl als Warnung an Washington: Am Samstag ließ das Militär im nördlichen Teil der Taiwanstraße Manöver mit scharfer Munition abhalten. Dazu wurden laut dpa Teile der Gewässer vor der Taiwan gegenüberliegenden Küstenprovinz Fujian gesperrt. China hat den USA in den vergangenen Tagen mit harten Konsequenzen gedroht, sollte Pelosi wirklich nach Taiwan reisen. Das US-Militär geht laut Berichten daher davon aus, Pelosis Flugzeug im Zweifelsfall absichern zu müssen – und soll wenig begeistert von der Reise-Idee sein.
Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan ist derzeit im Südchinesischen Meer unterwegs; Beobachter gehen von einem Kurs Richtung Taiwanstraße aus. Das US-Militär sprach indes laut dpa von einer länger geplanten Fahrt und “Routine-Patrouille”. Das Außenministerium Singapurs bestätigte unterdessen laut AFP, dass Pelosis Delegation den Stadtstaat ab dem heutigen Montag besuchen und dabei Präsidentin Halimah Yacob und Premierminister Lee Hsien Loong treffen werde. ck
China hat mit dem Bau seines ersten Großprojekts zur Wärmeerzeugung durch Atomkraft begonnen. Am Atomkraftwerk von Haiyang in Yantai, Provinz Shandong, sollen ab dem Jahr 2023 rund 900 Megawatt Wärmeenergie erzeugt werden. Die durch den Reaktor entstehende Wärme will man nutzen, um Dampf zu erzeugen, der dann durch eine Pipeline an die Haushalte geschickt wird. Auch die nahen Metropolen Weihai und Qingdao sollen auf diese Weise mit Wärme beliefert werden. Insgesamt wollen die Betreiber circa eine Million Menschen mit Heizwärme versorgen können. Schon heute werden die zwei Westinghouse-Druckwasserreaktoren des Kernkraftwerks für die Kraft-Wärme-Kopplung – also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme – genutzt.
Laut der Analysefirma Trivium China “scheint das neue Projekt das weltweit größte Einzelprojekt zur Dampferzeugung mithilfe von Atomenergie zu sein”. Es ersetzt jährlich 900.000 Tonnen Kohle für Heizzwecke und wird das administrativ zu Yantai gehörende Haiyang zu Chinas erster Stadt mit kohlenstofffreier Wärmeversorgung für Heizzwecke machen.
Im Streben nach Klimaneutralität setzt China neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch auf die Kernkraft. In den nächsten 15 Jahren will es etwa 150 Reaktoren bauen – und damit die aktuelle Zahl vervierfachen. In den letzten Jahren kam es dabei jedoch zu Verzögerungen (China.Table berichtete). Beim Ausbau der Kernkraft setzt das Land auch auf die Weiterentwicklung bestehender Reaktoren. Am Kraftwerk in Yantai werden beispielsweise zwei weitere Reaktoren aus chinesischer Bauart errichtet. Sie sollen im Jahr 2027 ans Netz gehen und für 60 Jahre Strom erzeugen. nib
Stromerzeugung und Produktion in Chinas Fotovoltaiksektor haben im ersten Halbjahr 2022 stark zugelegt. Zwischen Januar und Juni wurden mit knapp 31 Gigawatt (GW) um 137,4 Prozent mehr Fotovoltaik-Kapazität für die Stromerzeugung installiert als im Vorjahreszeitraum. Das berichtet Xinhua unter Berufung auf den Verband der Fotovoltaikindustrie. Auch die Produktion in der gesamten Fotovoltaik-Lieferkette sei nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie mit einem durchschnittlichen Plus von mehr als 45 Prozent stark gestiegen, hieß es. Besonders stark legten mit 54,1 Prozent kristalline Siliziummodule zu.
Erfreulich entwickelten sich nach dem Bericht trotz moderat steigender Preise auch die Exporte von Fotovoltaikprodukten. Sie beliefen sich auf rund 26 Milliarden US-Dollar und lagen damit um gut 113 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Ausfuhr von Fotovoltaik-Modulen lag mit 79 GW Leistung so hoch wie noch nie und 74 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2021. Die großen Stromerzeugungsunternehmen investierten zudem laut Xinhua in der ersten Jahreshälfte 63 Milliarden Yuan in die Solar-Stromerzeugung, 284 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. ck
Trümmer einer am 24. Juli gestarteten Trägerrakete vom Typ “Langer Marsch 5B” sind am frühen Sonntagmorgen nahe Südoastasien abgestürzt. Die chinesische Weltraumbehörde meldete laut AFP am Sonntag Koordinaten für das Einschlagsgebiet in der Sulu-See, knapp 60 Kilometer vor der Ostküste der philippinischen Insel Palawan. “Die meisten Bauteile wurden beim Wiedereintritt abgetragen und zerstört”, hieß es. Die malaysische Raumfahrtbehörde teilte Beobachtungen mit, wonach Raketentrümmer beim Wiedereintritt in die Atmosphäre in Brand geraten seien und dann in die Sulu-See stürzten. Die Rakete hatte das zweite von drei geplanten Modulen für die chinesische Raumstation “Tiangong” ins All gebracht.
Nasa-Chef Bill Nelson hatte Peking am Samstag auf Twitter vorgeworfen, vorab keine Informationen über die Flugbahn der Rakete veröffentlicht zu haben. Alle Raumfahrt-Nationen sollten “diese Art von Informationen im Voraus austauschen, um verlässliche Vorhersagen über das potenzielle Risiko eines Trümmeraufpralls zu ermöglichen”,mahnte er. Das sei insbesondere bei Schwerlasttransportern wie “Langer Marsch 5B” wichtig. Deren Teile stellten “ein erhebliches Risiko für den Verlust von Menschenleben und Eigentum darstellen. ck

Wird es im November 2022 einen Machtwechsel in der Führungsspitze Chinas geben? Mit Fragen wie dieser befasst sich Viktoria Laura Herczegh als Analystin bei Geopolitical Futures, der 2015 von George Friedman gegründeten Publikation für geopolitische Prognosen. Nebenbei schreibt sie an ihrer Doktorarbeit in Internationalen Beziehungen und Politikwissenschaft an der Corvinus-Universität in Budapest.
Ihre Einschätzung: “Ich glaube nicht, dass Xi nicht wiedergewählt wird.” Aber: “Die Verschiebungen, die jetzt innerhalb des engsten Führungszirkels stattfinden, deuten darauf hin, dass Xi Jinpings Macht nicht annähernd so stark ist, wie sie einmal war.” Allein der Umstand, dass Politiker aus seinem innersten Kreis Bedenken zu wichtigen Punkten des aktuellen Fünfjahresplans (2021-2025) äußerten, stelle seinen Machtanspruch infrage – und sei ein Novum. Als Leitfigur des oppositionellen Lagers sieht Herczegh Chinas Vizepremier Han Zheng. Sollte er wider Erwarten im November gewählt werden, ginge dies mit einer Öffnung gegenüber der westlichen Welt einher, so Herczegh.
Chinas politische Strukturen spielen auch in Herczeghs Dissertation über die Doppelmoral von Großmächten (“Double standard projection of great powers through specific cases”) eine große Rolle. Darin untersucht sie unter anderem die politische Interaktion Chinas mit den USA – und kommt zu interessanten Ergebnissen: “Meine Erkenntnisse zeigen, dass es, wenn es eine Doppelmoral gibt, auch eine umgekehrte Doppelmoral gibt.” Keine der Großmächte habe also das Recht, andere der Doppelmoral zu bezichtigen. “Sie neigen selbst dazu, mit zweierlei Maß zu messen.”
Schon als Kind war Herczegh ein Sprachtalent und absorbierte neue Wörter und Strukturen mit Freude und Leichtigkeit. 2012 kam sie dann während ihres Bachelorstudiums mit dem Chinesischen in Kontakt: “Bei Chinesisch war es wirklich das erste Mal, dass ich für eine Sprache lernen musste”, erzählt sie. Es hilft eben nicht, sich einfach die Schriftzeichen anzusehen und einzuprägen. “Man muss erstens die Töne üben und zweitens, was noch wichtiger ist, das Schreiben der Schriftzeichen üben.” Heute spricht die Ungarin neben ihrer Muttersprache auch Mandarin, Englisch, Spanisch, Italienisch und etwas Koreanisch.
Nach dem Abschluss des Bachelors in chinesischer und spanischer Sprache und Kultur an der Eötvös Loránd University ging sie ein Semester nach Shanghai, um dort ihre Chinesischkenntnisse zu vertiefen. Zurück in Ungarn studierte sie 2015-2018 den brandneuen Masterstudiengang East Asian Studies – eine Kooperation zwischen der Corvinus Universität Budapest und der Pázmány Péter Catholic University. “Ich habe mich schon immer für Politik und die modernen Aspekte Chinas und Ostasiens interessiert – vor allem wegen des chinesischen Wirtschaftswunders, das wir in den Jahren meines Studiums erlebt haben.”
An China fasziniert sie, wie das Land Tradition und Modernität miteinander vereinbart. Das betreffe nicht nur die Architektur, sondern auch die Denkstrukturen der Menschen. So würden auch heute noch junge Leute ganz selbstverständlich alte chinesische Sprichwörter in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch nutzen. Und ihr Interesse an Südostasien ist noch lange nicht erschöpft. Selbst für die Flitterwochen hat sie Japan und Südkorea ins Auge gefasst. Juliane Scholübbers
Leon Bechler stößt zum China-Desk der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Scholz aus Stuttgart. Bechler hat in Furtwangen Wirtschaft und an der Northwest University Chinesisch studiert.
Marco Braun übernimmt eine Führungsposition im Bereich Forschung und Entwicklung bei BMW in Shanghai. Er ist 2019 zu BMW gestoßen, nachdem er an der Tongji einen Abschluss gemacht hat.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
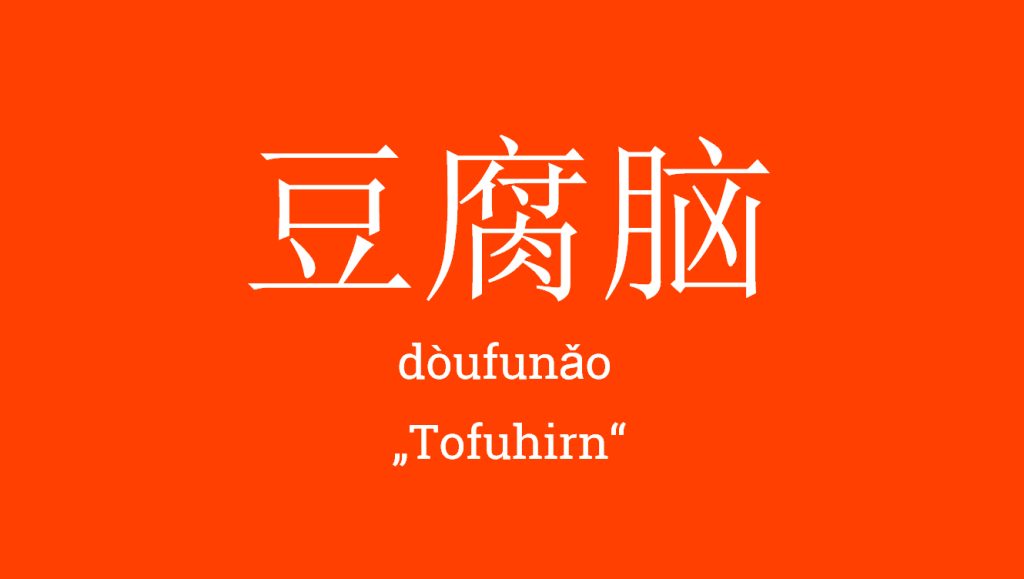
Sie haben schon viele Horrorgeschichten über die kulinarischen Vorlieben der Chinesen gehört und jetzt auch noch das: Ihr chinesischer Begleiter ordert für Sie im Restaurant lässig eine Schüssel “Tofuhirn” (豆腐脑 dòufunǎo). Doch keine Panik, bitte. Fluchtreflexe gleich wieder ausknipsen. Denn die Gourmet-Gruselstory, die vielleicht gerade in ihrem Kopfkino Premiere feiert, ist falsch aufgelegt. Serviert wird nämlich keine weichgekochte Denkmasse, sondern ein schmackhafter und eiweißreicher Tofupudding, wahlweise in süßer (Südchina) oder deftiger (Nordchina) Ausführung, hergestellt aus frischen und gesunden Zutaten – allen voran jede Menge Sojaprotein.
Wir Westler sind ja oft etwas aufgescheucht, wenn es um Essensexperimente im Reich der Mitte geht. Tatsächlich geht es im kulinarischen Alltag in China aber definitiv wesentlich weniger wild zu, als es manch falsches Vorurteil nahelegen mag. Doch die Schreckenslegenden halten sich hartnäckig, so dass man als Chinesischlerner auf China-Restaurant-Safari aus Angst vor unerwarteten Überfällen auf die Geschmacksknospen die Flinte vielleicht auf Daueranschlag hat. Leider trägt es auch nicht gerade zur Entschärfung des inneren Notfallmodus bei, wenn man chinesische Speisekarten und Supermarktlabels allzu wörtlich nimmt. Denn viele Speisen – besser gesagt ihre chinesischen Bezeichnungen – werden nicht so heiß gegessen, wie sie das Wörterbuch vorkocht. Sprich: manches zunächst unappetitlich klingende Wortungetüm entpuppt sich bei näherem Hinsehen als harmloses Häppchen.
Das gilt zum Beispiel auch für ein weiteres Tofu-Gericht – nämlich “Tofu nach Art der pockennarbigen Alten” (麻婆豆腐 mápó dòufǔ), ein landesweit beliebter Klassiker der Sichuanküche. Sein Geschmacksgeheimnis besteht natürlich nicht in einer Zubereitung durch Hausdamen mit Hautproblemen, sondern vielmehr aus zartweich auf der Zunge zerschmelzendem milden Tofuquark, der mit feuriger Sichuan-Schärfe angemacht und zum Abschluss mit gebratenem Schweinehack garniert wird. Bonne Appetite!
Komisch kribbeln mag es in der Magengegend, wenn man auf dem Menü “Ameisen, die auf einen Baum krabbeln” entdeckt (蚂蚁上树 mǎyǐ shàng shù). Sie werden schon ahnen, dass die Chinesen auch hier wieder tief in die Metapher-Trickkiste gegriffen haben. Es handelt sich schlichtweg um gebratene Glasnudeln mit würzigem Schweinehack. Das körnige Hackfleisch, das an den geschmeidigen Glasnudeln haften bleibt, hat wohl den einen oder anderen im Hunger-Delirium an Krabbelgetier erinnert, das Zweige und Äste erklimmt. Daher der etwas abenteuerliche Name.
Das nächste Gericht ist nichts für schwache Gaumen, aber immerhin längst nicht so blutrünstig, wie der Name nahelegen mag. Die Rede ist von “Lungenstücken vom Ehepaar” (夫妻肺片 fūqī fèipiàn). Für die beliebte Sichuaner Kaltspeise hat zum Glück niemand seine Nachbarn kaltgemacht, dafür aber so einiges anderes Getier. Hauptzutat des scharfen Appetizers ist nämlich alles, was das Rind so hergibt – neben Rindfleisch auch Rinderkopfhaut, Rinderherz, Rinderzunge und Rinderkutteln. Das alles wird in Salzlake eingelegt, später in Scheiben angerichtet und mit Chili-Öl, Frühlingszwiebeln und anderen Zutaten serviert. Den Namen “Ehegattenlunge” hat das Gericht seinen Erfindern zu verdanken – einem Ehepaar aus Chengdu, das in den 1930er Jahren einst kalte Rinderlungenstücke als Arme-Leute-Essen verkauft haben soll. Mit wachsendem Wohlstand wurde der Snack dann mit der Zeit durch hochwertigere Innereien aufgemotzt.
In chinesischen Werkskantinen erwarten Sie außerdem noch:
Auch beim Obsthändler werden Essenshypochonder übrigens über Verdächtiges stolpern, zum Beispiel über “Drachenaugen” (龙眼 lóngyǎn) – gemeint sind die ockerfarbenen Longanfrüchte, die von der Form her entfernt an Litschis erinnern – oder “Makakenpfirsiche” (猕猴桃 míhóutáo) – das ist tatsächlich die offizielle chinesische Bezeichnung für Kiwis (mit etwas Fantasie erinnert die Schale ja auch irgendwie an ruppiges Affenfell).
Wer sich jetzt bei so viel Worttohuwabohu lieber wieder in heimische Hausmannskostgefilde verkriechen will, den muss ich (sprachlich) leider enttäuschen. Denn auch Haribo und Co. haben in China einen etwas abenteuerlichen Namen, nämlich “Radiergummizucker” (橡皮糖 xiàngpítáng) – die chinesische Bezeichnung für Fruchtgummi. Und auf dem Grill kringeln sich “Duftdärme” (香肠 xiāngcháng) – Chinesisch für “Würste”. Wer sprachlich auf Nummer sicher gehen will, bleibt in diesem Sommer also am besten einfach bei der “Hundert-Düfte-Frucht” 百香果 bǎixiāngguǒ – der Maracuja. Da kann man assoziationsmäßig absolut nichts falsch machen und das kulinarische Kopfkino bleibt garantiert aus.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
