auch im Chinageschäft gibt es eine Verklärung der guten alten Zeit. Doch wann waren sie, die guten Zeiten, in denen sich die Türen zum Markt ohne Zutun öffneten, als Reibereien mit Behörden und der Öffentlichkeit unbekannt waren und westliche Unternehmen sich auf einen Rechtsstaat berufen konnten? Hartmut Heine, unser CEO-Talk-Interviewpartner, erzählt uns, welche Manipulationen und Verrenkungen nötig waren, um die eine kurze Transrapid-Strecke in Shanghai Realität werden zu lassen. Es war damals nervenaufreibend, in China Geschäfte zu machen. Doch jede Technologie hat ihre Zeit. Heine will heute den Hyperloop verkaufen, eine moderne Form der Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre. Er erklärt, warum sie – etwas paradoxerweise – bessere Chancen hat als die simplere Technik ohne Röhre.
Das Beispiel zeigt: Seit der ersten Transrapid-Strecke hat sich dann doch etwas ganz Entscheidendes verschoben. “Damals hatten die Chinesen den großen Markt und wir die Technologie”, sagt Heine. Heute ist China technisch gleichauf und will seinen Markt am liebsten selbst bedienen. “Wir müssen akzeptieren, dass die Chinesen eigene Vorstellungen haben und die auch umsetzen wollen.”
Die Technologiewende schafft auch bei der individuellen Mobilität neue Schwierigkeiten. Akkus für E-Autos sind bis oben hin voll mit aggressiven Chemikalien. China nimmt nun bei ihrem Recycling zwangsläufig eine Vorreiterrolle ein: Viel E-Mobilität bringt auch viele Altbatterien. Nico Beckert vergleicht für uns den chinesischen Ansatz mit dem der EU.
Wer derzeit von Europa nach China will, ist mit allerlei Corona-Komplikationen konfrontiert. Viele Expats haben sich daher vorläufig in ihre Heimat zurückgezogen. In unserer neuen Rubrik “Tools” erklären Expert:innen, wie sich die Arbeitserlaubnis aus der Ferne verlängern lässt und welche Fallstricke hier bei der Aufenthaltsgenehmigung lauern. Unter “Tools” klären wir demnächst im China.Table regelmäßig Fragen zu Recht, Regulierung und Marktzugang.
Einen produktiven Start in die Woche wünscht

Das ist sehr realistisch. Der Klimawandel zwingt die Welt, neu darüber nachzudenken. Denn Flugzeuge verbrauchen zu viel CO2 und die Welt wächst immer enger zusammen. Gleichzeitig gilt: Je weniger Luft im Tunnel ist, desto weniger Widerstand, desto geringer der Energieverbrauch. Dass diese Technologie wieder an Relevanz gewinnt, sieht man daran, dass sowohl in den USA, aber auch in Europa, bei Hardt Hyperloop und gleichzeitig unabhängig davon in China daran geforscht und entwickelt wird. Inzwischen haben wir einige technologische Probleme gelöst, die es beim Transrapid noch gab: Die Weichen sind zum Beispiel nun elektronisch und nicht mehr mechanisch. Sie müssen also nicht mehr aufwendig gewartet werden. Sie fahren sich nicht fest. Das senkt die Betriebskosten.
Das kann man nicht so einfach sagen. Klar ist jedoch: die Chinesen haben den größten Handlungsdruck.
Die Politik hat den Hyperloop schon fest eingeplant. 30.000 Kilometer bis 2060. Die Frage ist, wie schnell ist es technologisch möglich? Es ist ein Blick in die Kristallkugel. Aber ich denke in zehn Jahren fahren die Züge in China. Diesen Plan kann man einhalten.
In jedem Fall. Die Chinesen werden nun jedoch keinen Prototyp mehr kaufen, sondern sie werden die Technologie gemeinsam mit europäischen Firmen zur Serienreife bringen. Eine solch komplexe Technologie entwickelt heute kein Land mehr alleine. Dafür ist der Zeitdruck des Klimawandels zu groß. Aber inzwischen ist China innovativ genug, um auf Augenhöhe mitzuspielen.
Neben der neuen Innovationskraft ist es die chinesische Politik. Sie hat die Macht und das Geschick solche Projekte – wenn es sein muss sehr zügig – umzusetzen. Mir fällt derzeit kein Land ein, wo das schneller gehen würde. Deswegen bin ich immer noch hier. Die Art wie hier in die Zukunft gedacht und gehandelt wird, ist sehr beeindruckend. Peking legt ein konkretes aber ehrgeiziges Ziel fest: In dreieinhalb Stunden von Peking ganz in den Süden nach Shenzhen mit 800 Kilometern pro Stunde. Und dann geht es an die Umsetzung. Das Geld ist da. Der Handlungsdruck auch. Die vielen Menschen müssen irgendwie umweltfreundlich von A nach B kommen.
Weil wir und andere europäische Firmen Know-how haben, das die Chinesen brauchen. Mit uns fährt der Zug früher. Chinas Firmen erfüllen damit die Erwartungen der chinesischen Regierung schneller. Und wir kommen schneller zu einem Referenzprojekt. Eine Win-Win-Konstellation also. Die ersten Strecken werden eine Länge von 300 bis 400 Kilometer haben, also eine halbe Stunde Fahrzeit.
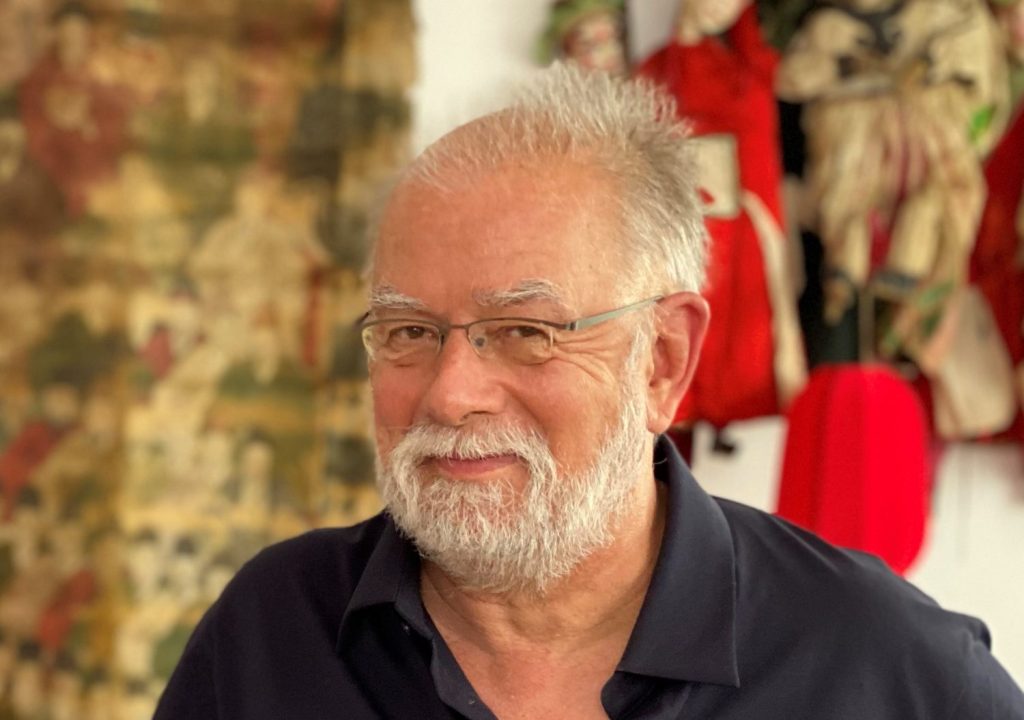
Nichts ist ohne Risiko, aber die Chancen sind höher als die Risiken. Und, wo sonst sollen wir eine Anlage bauen, wenn nicht in China. Noch einmal: Nirgends weltweit ist die Konstellation günstiger.
Das Problem in den USA sind die Grundstücke. Ich habe ja selbst ein Transrapidprojekt in den USA verhandelt. Die Strecke Los Angeles-Las Vegas. Die ist an den Grundstückspreisen und der potenziellen Verhandlungsdauer beim Kauf der Grundstücke gescheitert. Das lässt sich dann irgendwann nicht mehr rentabel rechnen.
In Deutschland waren es vor allem politische Widerstände. Die Grünen in der rot-grünen Regierung wollten das nicht. Doch der Klimawandel zwingt auch sie zum Umdenken. Insofern sind die Zeichen in Europa nun viel günstiger. Der erste wichtige Schritt wird sein, zu sehen wie sich die deutsche Politik dazu verhält, dem Wunsch der Chinesen nachzukommen, die alte Transrapid-Teststrecke in Lathen als Hyperloop-Teststrecke auszubauen, statt eine neue zu bauen. Damit würden wir, die Europäer und die Chinesen, viel Zeit sparen. Die Chinesen wollten in Shanghai auf der Transrapidstrecke außerhalb der Betriebszeiten testen. Das wurde ihnen jedoch nicht erlaubt. Doch gleichzeitig ist der politische Druck, die neue Technologie im Alltagsbetrieb zu testen sehr groß.
Ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Jetzt sind erst mal Wahlen in Deutschland. Und dann muss man weitersehen. Gut wäre es, wenn man sich auf EU-Ebene zusammentäte. Auch das halte ich nicht mehr für Wunschdenken. Wir Europäer haben was zu bieten. Die Chinesen auch. Es macht also Sinn, sich zusammenzutun.
Genau hinschauen hilft: Deutschland wurde von den Chinesen in dieser Frage nicht öffentlich angegriffen und Bundeskanzlerin Merkel schon gar nicht. Da sehe ich Verhandlungsspielraum. Hinzu kommt der Druck aus der Wirtschaft Chinas und der EU. Die Unternehmen wollen die Sanktionen nicht. Die Einsicht auf beiden Seiten wächst, dass die Sanktionen eine Sackgasse sind. Und, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Peking lässt sich heute viel weniger bieten als noch vor 20 Jahren, hat seine eigenen Vorstellungen und äußert die auch klar und deutlich. Und plötzlich ist sie da, die Systemkonkurrenz zwischen dem Westen und China. Die Fronten verhärten sich. Wir müssen uns eben erst noch daran gewöhnen, dass die Chinesen nicht mehr das machen, was wir für richtig halten. Deshalb war es auch vernünftig mit den Chinesen ein Investitionsabkommen zu unterschreiben. Da werden die unterschiedlichen Vorstellungen ja konstruktiv diskutiert und austariert.
Das glaube ich nicht. Der Trend geht ja aller politischen Querelen zum Trotz in Richtung mehr Zusammenarbeit und nicht in Richtung weniger Kooperation.
Es ist anders. Es war nie einfach in China Geschäfte zu machen. Das verklären wir heute gern. Damals hatten die Chinesen den großen Markt und wir die Technologie. Das Problem war der Technologieklau. Heute haben sie selbst Technologie und deswegen ist Technologie generell besser geschützt, aber sie haben auch einen viel größeren Erwartungsdruck der Menschen. Das bedeutet: Der Zeitdruck, fortschrittlich zu sein, ist größer. Wenn die europäischen Firmen sich darauf einstellen, können sie sehr gute Geschäfte hier machen. Der Hyperloop wird das zeigen.
Wir müssen akzeptieren, dass die Chinesen eigene Vorstellungen haben und die auch umsetzen wollen. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber am Ende ist es wie überall im Geschäftsleben. Ich habe mit Chinesen zusammengearbeitet, die waren und sind loyal und haben sehr hart gearbeitet. Aber es gibt auch andere. Die einen von den anderen zu unterscheiden, darum geht es im Arbeitsalltag. Dazu braucht man kulturelle Kompetenz.
Das habe ich jedenfalls anders erlebt. Am Anfang wollte niemand den Transrapid. Thyssen-Krupp und Siemens hatten den Zug zwar entwickelt. Doch die Geschäftsinteressen hatten sich mit den Jahren gewandelt. Siemens wollte lieber seine Rad-Schiene-Züge in China verkaufen und für Thyssen war das kein Kerngeschäft mehr. Deswegen hatten sie die Vermarktungsrechte für Asien bereits an ein japanisches Konsortium verkauft. Die haben aber in China nichts gemacht. Als die Rechte wieder frei waren, hat mein von mir sehr geschätzter Vorstand, Eckhard Rohkamm, mir gesagt: Ja, Sie können das probieren, es gibt aber kein Budget dafür. Eigentlich ein Zeichen, dass man die Finger davonlassen soll. Zumal die Chinesen ebenfalls skeptisch waren, weil die Deutschen keine Referenzstrecke im Alltagsbetrieb hatten. Da ging es erst einmal nicht um kulturelle Unterschiede.
Ich habe einen chinesischen Partner in der Politik gesucht, der von dem Thema begeistert ist. Und den habe ich dann gefunden: Das war Zhu Rongji, damals noch Vizepremier. Als gelernter Elektroingenieur und ehemaliger Oberbürgermeister von Shanghai konnte er sich eine Strecke vom Flughafen zur Innenstadt dort gut vorstellen. Es gab immer wieder Gespräche, aber es wurde einfach nicht konkret. Erst, nachdem Zhu 1998 Premier wurde, kam Fahrt in die Verhandlungen. Und ich wusste, ich habe auf den richtigen Mann gesetzt. Dann gab es plötzlich einen Termin beim Premierminister für Vorstand Rohkamm. Wir waren immer noch skeptisch. Würde der Termin klappen? Und wenn er klappt, würde etwas Konkretes besprochen? Dann dauerte der 20-Minuten-Termin zweieinhalb Stunden und der Premier kam nicht alleine, sondern hat gleich seine zuständigen Minister mitgebracht. Da wusste ich: Jetzt wird es ernst.
Der war immer noch skeptisch und stellte sich nun durchaus nicht zu Unrecht die Frage, ob wir überhaupt ein marktfähiges Produkt liefern können. Da habe ich dann ein wenig nachgeholfen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Presse von dem Treffen erfährt. Die Thyssen-Aktien sind daraufhin um 15 Prozent gestiegen. Dann war klar bei uns, das müssen wir nun machen.
Auch dort musste Premier Zhu Widerstände der Rad-Schiene-Fraktion im Ministerium niederkämpfen. Er ist dann bei einem Besuch in Deutschland nach Lathen gefahren. Das war das einzige Mal, dass ein IC dorthin fuhr. Er hat den Shanghaier Bürgermeister mitgenommen und ihn dann nach der Testfahrt öffentlich gefragt: Und willst Du den Zug kaufen? Der hat dann ja gesagt – was sollte er auch anders tun – und damit war der Damm gebrochen.
Ja. Premier Zhu wollte, dass wir die Anlage fertigstellen, solange er noch Premierminister war. Das waren jedoch nur zwei Jahre. Eigentlich war das aus deutscher Sicht unmöglich. Doch wir haben das dann doch irgendwie hinbekommen. Mit großen Anstrengungen und enormer Risikobereitschaft. Denn wir hatten ein Produkt verkauft, für das wir im Grunde keine Alltagserfahrung hatten. Wir mussten uns also darauf verlassen, dass der chinesische Kunde hie und da schon mal ein Auge zudrückt. Das hat er auch dann getan, auch wenn es immer wieder heftig gekracht hat. Am 31. Dezember 2002 haben der damalige Kanzler Gerhard Schröder und Premier Zhu den Transrapid dann offiziell eingeweiht. Auf dem Tisch stand eine Vase und die hat sich bei über 400 Kilometer pro Stunde nicht bewegt. Das war der Beweis: Der Transrapid hält, was er verspricht.
Das hat aber nicht mit unserer Technologie zu tun, sondern liegt daran, dass der Fahrweg zu schnell gebaut wurde. Er hat sich in dem sumpfigen Gelände mit der Zeit abgesenkt.
Dann muss man sich allerdings auch die Frage stellen, warum haben sie Probleme. Sind sie vielleicht selbst nicht flexibel genug? Sind sie nicht mehr wettbewerbsfähig? Können sie sich nicht anpassen? Es liegt nicht immer daran, dass die Chinesen selbstbewusster geworden sind oder uns sogar austricksen. Es ist immer einfach zu sagen ‘Die anderen sind schuld’, statt sich an die eigene Nase zu fassen. Grundsätzlich glaube ich: Auch heute ist ein solches Teamwork noch denkbar.
Sicherlich muss man sich mehr mit der Frage beschäftigen, welche Vorstellungen die Chinesen haben. Als wir in den 80er-Jahren anfingen, Autos in China zu bauen oder Stahlwerke, da konnten wir bestimmen, wie das geht. Da hatten die Chinesen noch keine Ahnung. Doch es war auch nicht einfach, ihnen das beizubringen. Heute sind sie gut ausgebildet, haben eigene Erfahrungen, eigene Vorstellungen. Das ist anders, aber nicht unbedingt schwieriger oder einfacher. Spannend ist es in jedem Fall. Deshalb freue ich mich unglaublich auf die nächste große Herausforderung, den Hyperloop. Das will ich unbedingt noch hinkriegen. Und dann schalte ich einen Gang zurück. Erstmal jedenfalls.
Hartmut Heine, 67, hat als Chef von ThyssenKrupp in China von 1989 bis 2004 die chinesische Politik und die deutsche Industrie an einen Tisch gebracht und war für die deutsche Seite federführend beim Bau des Transrapid in Shanghai. Er lebt und arbeitet seit mehr als 40 Jahren in China und stand unter anderem bei Salzgitter Stahl, Georgsmarienhütte und Siemens unter Vertrag. Im Jahr 1984 gründete er die Deutsche Handelskammer mit und war über ein Jahrzehnt im Vorstand der Deutschen Schule. Heute ist er der China-Chef des europäischen Hyperloop-Herstellers Hardt aus Holland.
Der Boom der E-Mobilität der letzten Jahre wird bald zu Millionen gebrauchten E-Auto-Akkus führen. Die Lebensdauer der Batterien wird in Branchenkreisen auf acht bis zehn Jahre angegeben. Danach ist die Kapazität der Speichermodule und somit die Reichweite der Fahrzeuge so weit gesunken, dass die Akkus ausgetauscht werden.
Was geschieht mit den Millionen gebrauchten E-Auto-Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer? Bisher ist das Recycling in China noch sehr lückenhaft. Dabei müssten die wertvollen Rohstoffe dringend wiederverwertet werden. Die Nachfrage nach Batterie-Rohstoffen wird mit dem weiteren E-Auto-Boom stark steigen.
In China sind die Recycling-Herausforderungen akut. Schon 2025 müssen zwölfmal mehr gebrauchte E-Auto-Batterien recycelt oder anderer Nutzung zugeführt werden als noch 2020, so der chinesische Verband der Automobilhersteller. Das sind siebenmal mehr gebrauchte E-Auto-Batterien, als zum gleichen Zeitpunkt in der EU anfallen werden.
Derzeit gelangen in China viele E-Auto-Batterien noch immer nicht zu den offiziellen Recycling-Unternehmen. Stattdessen landen sie auf der Müllhalde oder bei illegalen Unternehmen. Dort werden die Akkus mit veralteter Technologie und niedrigen Umweltstandards recycelt, wie chinesische Medien berichten. “Das Recyclingsystem für E-Auto-Batterien muss schneller entwickelt werden”, betonte Chinas Premier Li Keqiang dann auch im Regierungsbericht für den letzten Volkskongress im März.
Auf dem Papier sehen die chinesischen Regulierungen zum Recycling fortschrittlich aus. Die Regierung in Peking hat 2018 und 2019 Bestimmungen und Richtlinien erlassen, um das Recycling zu verbessern. Zunächst wurde die Auto- und Batterieindustrie aufgefordert, gemeinsam Recycling-Pilotprojekte in 17 Städten und Regionen zu starten und “Dienstleistungsnetzwerke zum Recycling” aufzubauen. Schon 2018 wurde die Verantwortung für die Sammlung, Behandlung und das Recycling der Batterien an die Autohersteller übertragen.
Ende 2019 bekräftigte die Regierung diese Verantwortung von E-Autoherstellern und forderte sie zum Aufbau von “Servicestellen zum Recycling” für E-Auto-Batterien auf – diese Aufgabe darf jedoch auch an externe Dienstleister ausgelagert werden. Die Servicestellen sind verantwortlich, die Batterien zu sammeln, zu lagern, zu verpacken und zu verschicken. Sie dürfen die Batterien aber nicht selbst zerlegen. Dafür sind nur 22 zugelassene Recycling-Unternehmen verantwortlich.
Die Batteriehersteller wiederum müssen Informationen zur ordnungsgemäßen Lagerung und Entsorgung der Akkus bereitstellen. Ebenso sollen sie sich zum Batterie-Design koordinieren, um das Recycling zu vereinheitlichen. Um ausrangierte Batterien zu identifizieren, soll ein System zur Rückverfolgbarkeit etabliert werden.
Es gibt jedoch eine “Schieflage zwischen politischen Regeln und der Praxis” des Recyclings, sagt der Nachhaltigkeitsexperte Richard Brubaker aus Shanghai im Gespräch mit China.Table. Es gäbe noch immer “eine Reihe von Engpässen bei der Sammlung und Verarbeitung ausgedienter E-Auto-Batterien“, so der Gründer und Geschäftsführer der auf Nachhaltigkeit fokussierten Beratungsagentur Collective Responsibility.
Hinzu kommt: In den Gesetzen und Vorschriften zum Batterie-Recycling gibt es zwar Sammelquoten. “Die Sammel-Praxis entspricht jedoch nicht diesen Quoten“, so Brubaker. Auch enthalten die Richtlinien keine Vorschriften, wie viel der wertvollen Rohstoffe beim Recycling zurückgewonnen werden muss. Es gebe jedoch Arbeitsgruppen, die sich mit der Einführung solcher Rückgewinnungsquoten beschäftigten, sagt Brubaker.
Bei der Zweitnutzung ausgedienter E-Auto-Batterien als Energiespeicher und der Sammlung der Batterien zu diesem Zweck beobachtet Brubaker “spannende Entwicklungen”. Jedoch gibt es auch hier Probleme: Aus Sicherheitsgründen hat Chinas Nationale Energiebehörde (National Energy Administration) ein Verbot der Nutzung von ausgedienten E-Auto-Batterien als Energiespeicher vorgeschlagen, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet. Im April war es zu einer Explosion in einer Energiespeicher-Einrichtung gekommen, bei der zwei Feuerwehrleute starben.
Die Zweitnutzung der ausgedienten Akkus in kleineren Anwendungen – beispielsweise im Bereich der Telekommunikation – wäre von diesem Verbot nicht betroffen. Doch es fehlt an Informationen über den Zustand ausgedienter E-Auto-Akkus. “Unvollständige Betriebsdaten machen es schwer, ihre Sicherheit, Lebensdauer und Anpassungsfähigkeit zu beurteilen”, gibt Caixin einen Branchenvertreter wieder. Richard Brubaker bestätigt diese Einschätzung. Solche Informationen sind jedoch für den Geschäftserfolg von Unternehmen wichtig, die Batterien für ein Second-Life in Speicherapplikationen aufarbeiten.
Generell ist sich die KP Chinas des Problems bewusst. Anfang Juli verabschiedete die Entwicklungs- und Reformkommission den “14. Fünfjahresplan zur Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft”. Allgemein ist dort festgehalten: “Es besteht ein dringender Bedarf, die Kapazitäten des hochwertigen Recyclings” in China zu verbessern. Der Aufbau von “Servicestellen zum Recycling” durch die Autohersteller soll vorangetrieben werden. Um zu verhindern, dass E-Auto-Batterien illegal recycelt werden, sollen sie über die gesamte Lebensdauer besser nachverfolgbar werden. Gegen illegale Recycler wollen die Behörden nach eigenen Angaben hart durchgreifen. Vieles aus dem Plan ist eine Wiederholung vorheriger Regulierungen. Konkrete Recyclingziele nennt der Plan nicht.
Die EU ist schon etwas weiter. Die EU-Kommission hat im Dezember 2020 einen umfassenden Regulierungsvorschlag zum Recycling von (E-Auto-)Batterien und ihrer Zweitnutzung vorgelegt. Der Vorschlag löst eine veraltete EU-Richtlinie von 2006 ab, als Lithium-Akkus noch keine große Rolle spielten. Bisher gibt es für solche Akkus noch keine Sammel- oder Recyclingziele. Durch den Kommissionsvorschlag sollen Batterien in Zukunft “zu einer wahren Quelle für die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe werden”.
Gerade bei Lithiumbatterien wie sie in Elektroautos verbaut werden, sieht die EU “noch viel zu tun”. Bisher werden Schätzungen zufolge nur zehn Prozent des in Batterien enthaltenen Lithiums recycelt. Diese Quote soll erhöht werden:
Geplant ist auch, dass E-Auto-Batterien ab dem Jahr 2030 gewisse Anteile recycelter Materialien enthalten – beispielsweise vier Prozent recyceltes Lithium und Nickel und zwölf Prozent recyceltes Kobalt. Bis 2035 werden die Quoten weiter angehoben. Um E-Auto-Batterien als Energiespeicher weiter nutzbar zu machen, will die EU einen Markt für Second-Life-Batterien aufbauen.
Kerstin Meyer von Agora Verkehrswende sagt, der Vorschlag der EU-Kommission sei “grundsätzlich zu begrüßen.” Wiederverwertungsziele gesetzlich zu verankern sei “ein wichtiger Schritt, um mehr Rohstoffe im Kreislauf zu halten”. Auch der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft findet lobende Worte für die Vorschläge. Die Mindesteinsatzquote von recycelten Rohstoffe für neue Batterien schaffe “Planungs- und Investitionssicherheit für den Aufbau der Recyclinginfrastruktur”, so ein Sprecher zu China.Table. Jedoch müsse die Kommission bei der Berechnungsgrundlage für Recycling- und Verwertungsquoten aufs Tempo drücken. Nur wenn frühzeitig feststehe, wie die vorgeschlagenen Quoten erreicht werden sollen, könne die Recyclinginfrastrukur rechtzeitig aufgebaut werden, so der Verband.
Der VDMA befürwortet “im Grundsatz die von der EU verfolgten Regulierungsziele für nachhaltige Batterien”. Doch der Verband warnt auch vor der “Gefahr eines erheblichen bürokratischen Mehraufwands” für seine Mitgliedsunternehmen. Den Unternehmen drohten “enorme Wettbewerbsnachteile zur außer-europäischen Konkurrenz“. Kerstin Meyer will diese Kritik nicht gelten lassen. “Die EU sollte hohe Standards setzen. Der internationale Wettbewerb darf bei Recyclingstandards nicht zu einem Race to the Bottom führen”, sagt die Projektleiterin im Bereiche Fahrzeuge und Antriebe.
Das Europaparlament arbeitet an einem Vorschlag zur Neuausrichtung der China-Politik der EU. In einem Bericht, den nun der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des EU-Parlaments verabschiedet hat, schlagen die Abgeordneten eine Strategie mit insgesamt sechs Säulen vor, darunter ein offener Dialog über globale Herausforderungen, das Engagement für Menschenrechte durch wirtschaftspolitische Maßnahmen und die Stärkung der geopolitischen Bedeutung der EU.
Die EU-Abgeordneten betonen darin erneut, dass der Ratifizierungsprozess des Investitionsabkommens (CAI) nicht beginnen kann, bis China die Sanktionen gegen Abgeordnete und EU-Institutionen aufhebt. Die EU-Kommission wird aufgefordert, den Investitionsschutz wieder in das CAI einzuführen – bei diesem Thema konnte bei den CAI-Verhandlungen keine Lösung gefunden werden. Außerdem drängt das Europaparlament auf Fortschritte beim Investitionsabkommen mit Taiwan. Derzeit gibt es dazu jedoch keine Signale für die offizielle Aufnahme entsprechender Gespräche.
Insgesamt folgen die Vorschläge den bereits bekannten Ansätzen des Europaparlaments. Die Abstimmung über den Bericht soll im September im Plenum erfolgen. Was die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten dann damit machen, ist offen. Im Oktober soll bei einem EU-internen Sondergipfel über das Verhältnis zu China gesprochen werden. Die letzte offizielle EU-China-Strategie stammt aus dem Jahr 2019.
In dem Strategie-Vorschlag des EU-Parlaments wird ein regelmäßiger Menschenrechtsdialog zwischen Brüssel und Peking sowie die Einführung nachprüfbarer Maßstäbe für die Fortschritte Chinas in Sachen Menschenrechten gefordert. Der Bericht drängt zudem darauf, dass der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) ein Mandat und die erforderlichen Ressourcen erhält, um chinesische Desinformationskampagnen mit einer speziellen StratCom-Task-Force für den Fernen Osten anzugehen (China.Table berichtete). ari
Ein Flugverbot Chinas gegenüber der Lufthansa löst eine deutsche Gegenreaktion aus. Das Auswärtige Amt äußerte “Bedenken” in Hinblick auf die Maßnahme und kündigte an, jetzt Flüge chinesischer Gesellschaften blockieren zu wollen. China begründet die Streichung von Flugverbindungen mit Corona. Derzeit gilt: Bringt eine Fluggesellschaft positiv auf Covid-19 getestete Passagiere ins Land, wird sie bestraft. Chinesische Behörden können den Airlines verbieten, die Strecke für eine bestimmte Zeit anzubieten. Davon waren seit Februar auch schon die deutschen Fluggesellschaften Condor und Lufthansa betroffen.
Das Außenministerium vermutet einem Medienbericht zufolge dabei nun Wettbewerbsverzerrung und leitet Gegenschritte ein. “Nach vorliegenden Informationen gibt es keine Verstöße deutscher Fluggesellschaften gegen die Infektionsschutz-Vorgaben der chinesischen Behörden, die die Aussetzung von Flügen begründen könnten”, zitiert die Branchenplattform Aerotelegraph das Außenministerium. Um dem zu begegnen, suspendiere Deutschland nun reziprok Flüge chinesischer Fluggesellschaften auf derselben Strecke, auf der es für deutsche Unternehmen zu Einschränkungen kommt. Welche Fluggesellschaften und Strecken davon betroffen sind, blieb zunächst offen. ari
Am Freitag hat der chinesische Emissionshandel gestartet (China.Table berichtete). Nach über einem Jahrzehnt der Vorbereitung wurden die ersten Emissionsrechte ge- und verkauft. Der Preis lag zum Handelsschluss bei umgerechnet 6,90 Euro pro Tonne CO2. Im europäischen Emissionshandel kostet eine Tonne CO2 mittlerweile mehr als 50 Euro.
Insgesamt nehmen 2.162 Unternehmen aus dem Energie- und Wärmesektor an der ersten Phase des chinesischen Emissionshandels teil, wie der chinesische Umweltminister Huang Runqiu zum Handelsstart verkündete. Sie verursachen demzufolge 4,5 Gigatonnen CO2 pro Jahr, was gut 40 Prozent der chinesischen Gesamtemissionen ausmacht. Der für Klima zuständige EU-Kommissar Frans Timmermanns gratulierte China auf Twitter zum Handelsstart.
Ursprünglich hatte Peking sehr ambitionierte Ziele für den Emissionshandel. Sie wurden jedoch aufgeweicht. Industriesektoren oder der Flugverkehr müssen sich vorerst nicht am Handel beteiligen. Auch gibt es keine feste oder gar abnehmende Obergrenze an CO2-Zertifikaten, wie es beim europäischen Emissionshandel der Fall ist. Experten bezweifeln, ob der Handel in seiner derzeitigen Form überhaupt nennenswert zur Verringerung der immensen Emissionen beitragen kann. Gleichzeitig gibt es weiterhin Pläne zur Ausweitung des Emissionshandels auf andere Sektoren. nib
Auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue ständige Arbeitsgruppe angekündigt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte am Freitag in Genf, dass neben der Untersuchung von Wildtieren und Tiermärkten im chinesischen Wuhan auch die dortigen Labore inspiziert werden müssten. Das WHO-Team, das nach monatelangem Gezerre erst im Januar nach China reisen durfte, berichtete Ende März, es sei “wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich”, dass das Virus von einem Tier über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergesprungen sei. Dass das Virus aus Versehen aus einem Viren-Labor entwich und sich verbreitete, gelte als “extrem unwahrscheinlicher Weg” (China.Table berichtete).
Die USA halten aber an der These eines Laborunfalls fest. Das werde zumindest in Teilen des US-Geheimdienstapparates für möglich gehalten, sagte US-Präsident Joe Biden Ende Mai und ordnete weitere Prüfungen an. Ende August soll der Geheimdienst berichten. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt weitere Untersuchungen zur Herkunft des Virus gefordert. ari
Der taiwanesische Chip-Weltmarktführer TSMC konkretisiert seine Expansionspläne. Bis 2023 sollen in der chinesischen Fabrik in Nanjing 40.000 Wafer pro Monat hergestellt werden. Das entspricht einer Kapazitätserweiterung um 60 Prozent. Dafür will der Halbleiterhersteller 2,8 Milliarden US-Dollar investieren, wie das Unternehmen schon vor einiger Zeit mitteilte. In Nanjing sollen technologisch weniger anspruchsvolle 28-Nanometer-Chips hergestellt werden, die jedoch für die Autoindustrie von großer Relevanz sind. TSMC habe erklärt, dass die weltweite Knappheit an Automobilchips ab diesem Quartal “signifikant reduziert” werde, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet.
Medienberichten zufolge könnte TSMC auch eine Milliarden-Investition in Dresden planen. Demnach laufen Gesprächen über den Bau einer Chipfabrik in der Nähe der sächsischen Landeshauptstadt. Weder Dresden noch das taiwanesische Unternehmen bestätigten die Pläne bisher jedoch. Weiter ist das Unternehmen schon in den USA: Die in Arizona geplante Fabrik soll im ersten Quartal 2024 die Massenproduktion starten. TSMC will dort insgesamt zwölf Milliarden US-Dollar investieren. Das Unternehmen verfolgt auch Pläne zum Bau einer ersten Chipfabrik in Japan. nib
Aufgrund der Corona-Pandemie und den davon ausgelösten Reiseverboten wurde vielen Expats, die in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren, die Wiedereinreise nach China untersagt. Die Erneuerung ihrer chinesischen Arbeitserlaubnis ist für diese “Gestrandeten” kompliziert geworden.
Zwar hat die chinesische Regierung eine vorübergehende Regelung erlassen, die es Ausländer:innen erlaubt, ihre Arbeitserlaubnis aus der Ferne zu verlängern. Schwierigkeiten kann es allerdings bei der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung geben. Und läuft diese in der Zwischenzeit aus, kann das wiederum ein Hindernis für die erneute Verlängerung der Arbeitserlaubnis darstellen.
Außerdem scheinen einige lokale Regierungen im Juli die Regeln für die Beantragung der Arbeitserlaubnis verschärft zu haben, um Personen davon abzuhalten, Scheinfirmen nur für Visazwecke zu gründen.
Um Expats, die außerhalb Chinas gestrandet sind, die Erneuerung ihrer chinesischen Arbeitserlaubnis zu erleichtern, haben viele örtliche Auslandsämter befristete Maßnahmen erlassen. Zum Beispiel hat die Shanghai Administration of Foreign Experts Affairs am 1. Februar bekannt gemacht, eine “No-Visit”-Prüfung und -Genehmigung für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Arbeitserlaubnis für Ausländer in Shanghai einzuführen.
Gemäß dieser Richtlinie müssen Antragsteller für die Verlängerung der Arbeitserlaubnis keine Originale der Antragsunterlagen zum örtlichen Büro für Ausländerangelegenheiten in China mitbringen. Stattdessen können Antragsteller ihre Arbeitserlaubnis aus der Ferne verlängern, indem sie eine Echtheitserklärung (“Commitment”) für die Dokumente abgeben.
Die oben genannte Richtlinie hat den Prozess zur Verlängerung der Arbeitserlaubnis von Ausländer:innen stark vereinfacht; einige Probleme wurden jedoch noch nicht vollständig gelöst.
Da es parallel keine Vereinfachung der Richtlinie zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis gab, müssen Ausländer:innen immer noch in China anwesend sein und ihre Einreiseunterlagen vorlegen, um ihre Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. In der Tat haben viele Ausländer und Ausländerinnen ihre Arbeitserlaubnis verlängert bekommen, mussten aber ihre Aufenthaltsgenehmigung ablaufen lassen.
Schwieriger wird es nach zwölf Monaten, wenn die Arbeitserlaubnis dann erneuert werden muss. Da sich die Regeln für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis immer noch nicht geändert haben, kann es sein, dass diejenigen, die ihre Aufenthaltserlaubnis im letzten Jahr nicht verlängern konnten, auch in diesem Jahr nicht in der Lage sind, die Verlängerung zu beantragen.
Da jedoch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung eine der Hauptvoraussetzungen für die Verlängerung einer Arbeitserlaubnis ist, kann es sein, dass Expats, die außerhalb Chinas gestrandet sind, ohne eine gültige Aufenthaltsgenehmigung ihre Arbeitserlaubnis nicht mehr verlängern können.
Nach Auskunft des Shenzhen Foreign Affair Office gegenüber Dezan Shira gibt es mehrere Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen:
Wenn es dann an der Zeit ist, nach China zurückzukehren, können sie die Arbeitserlaubnis erneut beantragen, als ob sie diese zum ersten Mal beantragt hätten.
In diesem Fall empfehlen wir, dass sie die folgenden Vorbereitungen im Voraus treffen:
Zusätzlich zu anderen besorgniserregenden Nachrichten hat die Ausländerbehörde der Provinz Guangdong im Juli die Regeln für die Beantragung der Arbeitserlaubnis sogar verschärft. Dies kann eine große Hürde für Start-up-Unternehmen sein, da der Erhalt einer Arbeitserlaubnis oft der erste Schritt ist, um Mitarbeiter:innen nach China zu schicken.
Von einigen Antragstellern, die zum ersten Mal eine Arbeitserlaubnis beantragen, werden nun zusätzliche Unterlagen verlangt, die vorher nicht verlangt wurden, darunter (ganz allgemein):
Unserer Meinung nach wollen die Behörden mit der Verschärfung der Regeln für die Arbeitserlaubnis sicherstellen, dass eine echte Notwendigkeit der Antragsteller besteht, in China zu arbeiten, und nicht aus anderen Gründen ins Land zu kommen. Denn während der Pandemie haben einige Ausländer Firmen in China gegründet, um ein Arbeitsvisum zu erhalten.
Nach unseren jüngsten Erfahrungen scheint es so, als ob der gesetzliche Vertreter oder die Vertreterin eines Unternehmens im Vergleich zu den anderen Führungspositionen weniger Unterlagen benötigt, um die Genehmigungen zu erhalten.
Der Grund dafür ist, dass der gesetzliche Vertreter eines chinesischen Unternehmens bei einigen unternehmensbezogenen Vorgängen physisch anwesend sein muss, zum Beispiel bei der Bank, um ein Bankkonto einzurichten, beim Finanzamt, um ein Steuerkonto für das Unternehmen einzurichten oder um einen Identitätsnachweis zu erbringen.
Allerdings muss der gesetzliche Vertreter heute einen Arbeitsvertrag unterzeichnen, anstatt einfach einen Gewerbeschein hochzuladen. Außerdem muss der gesetzliche Vertreter einen Jobtitel in der Firma tragen.
Für diejenigen, die nicht der gesetzliche Vertreter des chinesischen Unternehmens sind, sollten weitere Dokumente im Voraus vorbereitet werden, um den Antrag zu unterstützen.
Unternehmen, die Ausländer:innen einstellen, müssen eine schriftliche Verpflichtung zur Einstellung chinesischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgegeben haben bzw. wird erwartet, dass sie diese abgeben, da sonst die Arbeitserlaubnis der ausländischen Mitarbeiter:innen nicht verlängert oder die Anträge nicht bearbeitet werden können. Das berichtet uns die State Administration of Foreign Experts Affairs (Safea) in Guangzhou.
Dies ist auch ein Weg, um sicherzustellen, dass das Unternehmen wirklich Geschäftstätigkeit betreibt (und nicht eine Scheinfirma, die für Visazwecke eingerichtet wurde). Wenn eine Firma, die sich verpflichtet hat, chinesische Mitarbeiter:innen einzustellen, dies nach Ablauf einer Frist noch nicht getan hat, könnte die Verlängerung der Arbeitserlaubnis ebenfalls abgelehnt werden.
Die Safea in Shenzhen scheint diesem Beispiel zu folgen und die Unternehmen zu drängen, chinesische Mitarbeiter einzustellen. Für Ein-Personen-Firmen, die nur zum Zweck des Visums gegründet wurden, könnte der Verlängerungsantrag unter den derzeitigen Umständen eine echte Herausforderung sein.
Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam. Bitte nehmen Sie Kontakt auf über info@dezanshira.com oder die Website www.dezanshira.com.
Shang Yanchun und Lu Man haben Chinas Staatsfonds China Investment Corporation verlassen. Shang Yanchun leitete eines der beiden Investmentteams im Bereich Technologie, Medien und Kommunikation. Lu Man war hochrangiger Manager im Bereich Direktinvestitionen. Laut Bloomberg sieht sich der Fonds mit einem “Exodus leitender Angestellter” konfrontiert. In den vergangenen fünf Jahren verließen 20 Teamleiter und Geschäftsführer den Staatsfonds.

Wobei lassen Sie sich nur ungern stören? Beim “Ess-ing” (吃饭ing – chīfàn-ing), “Les-ing” (看书ing – kànshū-ing) oder vielleicht während des “Ausruh-ing” (休息ing – xiūxi-ing)? Wenn sich jedenfalls Chinas “Generation Online” ganz in den Moment vertieft, werden auch schon mal Sprach- und Grammatikgrenzen nebensächlich. Zwar hat auch das Chinesische seine eigene Verlaufsform (吃饭 chīfàn = “essen”, 正在吃饭 zhèngzài chīfàn = “gerade essen”/”beim Essen sein”). Doch in der chinesischen Internetsprache hat sich die englische ing-Form seit einiger Zeit einen gewissen Coolness-Faktor erarbeitet. Chinas junge Netzgemeinde – die das englische Suffix noch zur Genüge vom Grammatikbüffeln im Schulunterricht kennt – spielt heute kreativ mit dem Wortanhängsel, fügt es nicht nur an chinesische Verben, sondern zum Beispiel auch an Substantive an, und schafft damit jede Menge neue Wortkreationen.
Diese reichen vom “Vergnüging” (娱乐ing – yúlè-ing) über “Bewerbing” (招聘ing – zhāopìn-ing) und “Spieling” (游戏ing – yóuxì-ing) bis hin zum “Fernsehing” (看电视ing – kàn diànshì-ing). Gemein ist allen Formen, dass sie den Verlaufscharakter der Handlung unterstreichen – beim “ING”-ing ist man geistig und emotional ganz bei der Sache und genießt den Augenblick.
Wer im Übrigen glaubt, eine Ton- und Zeichensprache wie das Chinesische eigne sich nicht für Anglizismen, wird im Gespräch mit heutigen Chinesen schnell eines Besseren belehrt. Beeinflusst durch Internet, internationales Arbeitsumfeld und die immense Unterhaltungsindustrie, die auch ausländische Trends in sich aufsaugt, streuen Chines:innen im Gespräch auch gerne mal ohne jede Vorwarnung englische Begriffe ein.
Vorgemacht haben es einst Chinas aufstrebende Büroangestellte (白领 báilǐng), die angesichts globaler Unternehmensstrukturen und Kommunikationswege so manches chinesische Wort im “Bürosprech” durch englische Platzhalter austauschten (我把link和proposal的PPT发到你的email,ok吗?). Heute finden Anglizismen nicht selten über eine Vielzahl landesweit erfolgreicher Entertainmentshows ihren Weg in den chinesischen Alltagssprachgebrauch. So machten etwa Hip-Hop- und Streetdance-Formate Begriffe wie “battle”, “diss”, “pick” und “freestyle” zu festen Vokabelgrößen im Alltag – auch über das Publikum der Sendungen hinaus. Die chinesische Sprache bleibt also weiter in Bewegung. Da heißt es weiter ins “Lern-ing” vertiefen – fleißig xuéxí-ing also.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Spracheschule New Chinese.
auch im Chinageschäft gibt es eine Verklärung der guten alten Zeit. Doch wann waren sie, die guten Zeiten, in denen sich die Türen zum Markt ohne Zutun öffneten, als Reibereien mit Behörden und der Öffentlichkeit unbekannt waren und westliche Unternehmen sich auf einen Rechtsstaat berufen konnten? Hartmut Heine, unser CEO-Talk-Interviewpartner, erzählt uns, welche Manipulationen und Verrenkungen nötig waren, um die eine kurze Transrapid-Strecke in Shanghai Realität werden zu lassen. Es war damals nervenaufreibend, in China Geschäfte zu machen. Doch jede Technologie hat ihre Zeit. Heine will heute den Hyperloop verkaufen, eine moderne Form der Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre. Er erklärt, warum sie – etwas paradoxerweise – bessere Chancen hat als die simplere Technik ohne Röhre.
Das Beispiel zeigt: Seit der ersten Transrapid-Strecke hat sich dann doch etwas ganz Entscheidendes verschoben. “Damals hatten die Chinesen den großen Markt und wir die Technologie”, sagt Heine. Heute ist China technisch gleichauf und will seinen Markt am liebsten selbst bedienen. “Wir müssen akzeptieren, dass die Chinesen eigene Vorstellungen haben und die auch umsetzen wollen.”
Die Technologiewende schafft auch bei der individuellen Mobilität neue Schwierigkeiten. Akkus für E-Autos sind bis oben hin voll mit aggressiven Chemikalien. China nimmt nun bei ihrem Recycling zwangsläufig eine Vorreiterrolle ein: Viel E-Mobilität bringt auch viele Altbatterien. Nico Beckert vergleicht für uns den chinesischen Ansatz mit dem der EU.
Wer derzeit von Europa nach China will, ist mit allerlei Corona-Komplikationen konfrontiert. Viele Expats haben sich daher vorläufig in ihre Heimat zurückgezogen. In unserer neuen Rubrik “Tools” erklären Expert:innen, wie sich die Arbeitserlaubnis aus der Ferne verlängern lässt und welche Fallstricke hier bei der Aufenthaltsgenehmigung lauern. Unter “Tools” klären wir demnächst im China.Table regelmäßig Fragen zu Recht, Regulierung und Marktzugang.
Einen produktiven Start in die Woche wünscht

Das ist sehr realistisch. Der Klimawandel zwingt die Welt, neu darüber nachzudenken. Denn Flugzeuge verbrauchen zu viel CO2 und die Welt wächst immer enger zusammen. Gleichzeitig gilt: Je weniger Luft im Tunnel ist, desto weniger Widerstand, desto geringer der Energieverbrauch. Dass diese Technologie wieder an Relevanz gewinnt, sieht man daran, dass sowohl in den USA, aber auch in Europa, bei Hardt Hyperloop und gleichzeitig unabhängig davon in China daran geforscht und entwickelt wird. Inzwischen haben wir einige technologische Probleme gelöst, die es beim Transrapid noch gab: Die Weichen sind zum Beispiel nun elektronisch und nicht mehr mechanisch. Sie müssen also nicht mehr aufwendig gewartet werden. Sie fahren sich nicht fest. Das senkt die Betriebskosten.
Das kann man nicht so einfach sagen. Klar ist jedoch: die Chinesen haben den größten Handlungsdruck.
Die Politik hat den Hyperloop schon fest eingeplant. 30.000 Kilometer bis 2060. Die Frage ist, wie schnell ist es technologisch möglich? Es ist ein Blick in die Kristallkugel. Aber ich denke in zehn Jahren fahren die Züge in China. Diesen Plan kann man einhalten.
In jedem Fall. Die Chinesen werden nun jedoch keinen Prototyp mehr kaufen, sondern sie werden die Technologie gemeinsam mit europäischen Firmen zur Serienreife bringen. Eine solch komplexe Technologie entwickelt heute kein Land mehr alleine. Dafür ist der Zeitdruck des Klimawandels zu groß. Aber inzwischen ist China innovativ genug, um auf Augenhöhe mitzuspielen.
Neben der neuen Innovationskraft ist es die chinesische Politik. Sie hat die Macht und das Geschick solche Projekte – wenn es sein muss sehr zügig – umzusetzen. Mir fällt derzeit kein Land ein, wo das schneller gehen würde. Deswegen bin ich immer noch hier. Die Art wie hier in die Zukunft gedacht und gehandelt wird, ist sehr beeindruckend. Peking legt ein konkretes aber ehrgeiziges Ziel fest: In dreieinhalb Stunden von Peking ganz in den Süden nach Shenzhen mit 800 Kilometern pro Stunde. Und dann geht es an die Umsetzung. Das Geld ist da. Der Handlungsdruck auch. Die vielen Menschen müssen irgendwie umweltfreundlich von A nach B kommen.
Weil wir und andere europäische Firmen Know-how haben, das die Chinesen brauchen. Mit uns fährt der Zug früher. Chinas Firmen erfüllen damit die Erwartungen der chinesischen Regierung schneller. Und wir kommen schneller zu einem Referenzprojekt. Eine Win-Win-Konstellation also. Die ersten Strecken werden eine Länge von 300 bis 400 Kilometer haben, also eine halbe Stunde Fahrzeit.
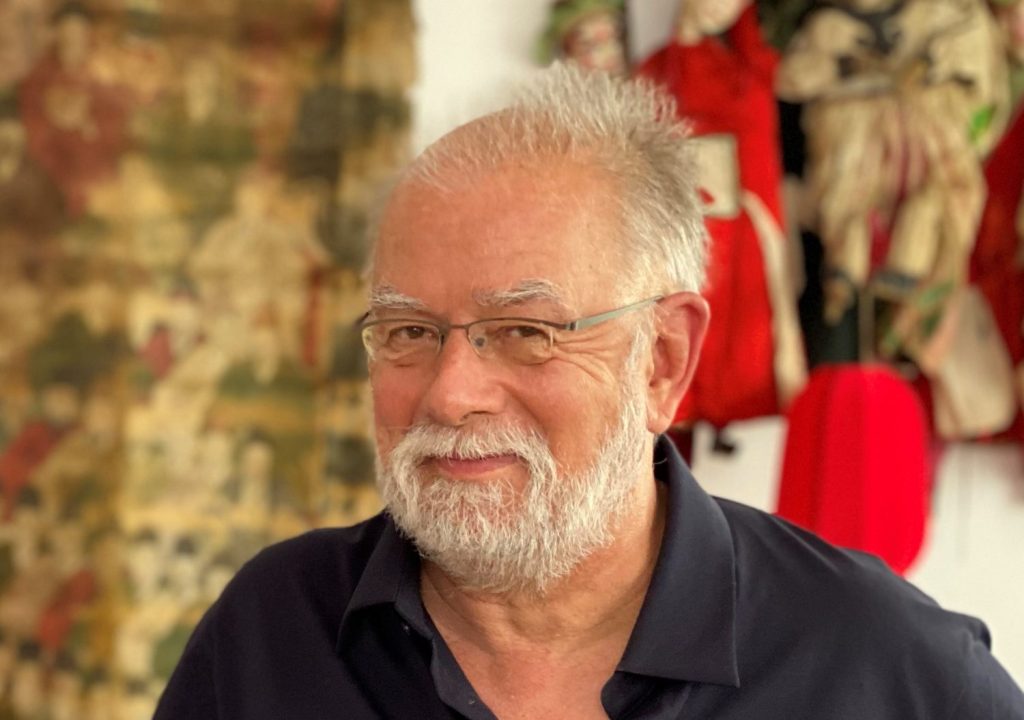
Nichts ist ohne Risiko, aber die Chancen sind höher als die Risiken. Und, wo sonst sollen wir eine Anlage bauen, wenn nicht in China. Noch einmal: Nirgends weltweit ist die Konstellation günstiger.
Das Problem in den USA sind die Grundstücke. Ich habe ja selbst ein Transrapidprojekt in den USA verhandelt. Die Strecke Los Angeles-Las Vegas. Die ist an den Grundstückspreisen und der potenziellen Verhandlungsdauer beim Kauf der Grundstücke gescheitert. Das lässt sich dann irgendwann nicht mehr rentabel rechnen.
In Deutschland waren es vor allem politische Widerstände. Die Grünen in der rot-grünen Regierung wollten das nicht. Doch der Klimawandel zwingt auch sie zum Umdenken. Insofern sind die Zeichen in Europa nun viel günstiger. Der erste wichtige Schritt wird sein, zu sehen wie sich die deutsche Politik dazu verhält, dem Wunsch der Chinesen nachzukommen, die alte Transrapid-Teststrecke in Lathen als Hyperloop-Teststrecke auszubauen, statt eine neue zu bauen. Damit würden wir, die Europäer und die Chinesen, viel Zeit sparen. Die Chinesen wollten in Shanghai auf der Transrapidstrecke außerhalb der Betriebszeiten testen. Das wurde ihnen jedoch nicht erlaubt. Doch gleichzeitig ist der politische Druck, die neue Technologie im Alltagsbetrieb zu testen sehr groß.
Ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Jetzt sind erst mal Wahlen in Deutschland. Und dann muss man weitersehen. Gut wäre es, wenn man sich auf EU-Ebene zusammentäte. Auch das halte ich nicht mehr für Wunschdenken. Wir Europäer haben was zu bieten. Die Chinesen auch. Es macht also Sinn, sich zusammenzutun.
Genau hinschauen hilft: Deutschland wurde von den Chinesen in dieser Frage nicht öffentlich angegriffen und Bundeskanzlerin Merkel schon gar nicht. Da sehe ich Verhandlungsspielraum. Hinzu kommt der Druck aus der Wirtschaft Chinas und der EU. Die Unternehmen wollen die Sanktionen nicht. Die Einsicht auf beiden Seiten wächst, dass die Sanktionen eine Sackgasse sind. Und, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Peking lässt sich heute viel weniger bieten als noch vor 20 Jahren, hat seine eigenen Vorstellungen und äußert die auch klar und deutlich. Und plötzlich ist sie da, die Systemkonkurrenz zwischen dem Westen und China. Die Fronten verhärten sich. Wir müssen uns eben erst noch daran gewöhnen, dass die Chinesen nicht mehr das machen, was wir für richtig halten. Deshalb war es auch vernünftig mit den Chinesen ein Investitionsabkommen zu unterschreiben. Da werden die unterschiedlichen Vorstellungen ja konstruktiv diskutiert und austariert.
Das glaube ich nicht. Der Trend geht ja aller politischen Querelen zum Trotz in Richtung mehr Zusammenarbeit und nicht in Richtung weniger Kooperation.
Es ist anders. Es war nie einfach in China Geschäfte zu machen. Das verklären wir heute gern. Damals hatten die Chinesen den großen Markt und wir die Technologie. Das Problem war der Technologieklau. Heute haben sie selbst Technologie und deswegen ist Technologie generell besser geschützt, aber sie haben auch einen viel größeren Erwartungsdruck der Menschen. Das bedeutet: Der Zeitdruck, fortschrittlich zu sein, ist größer. Wenn die europäischen Firmen sich darauf einstellen, können sie sehr gute Geschäfte hier machen. Der Hyperloop wird das zeigen.
Wir müssen akzeptieren, dass die Chinesen eigene Vorstellungen haben und die auch umsetzen wollen. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber am Ende ist es wie überall im Geschäftsleben. Ich habe mit Chinesen zusammengearbeitet, die waren und sind loyal und haben sehr hart gearbeitet. Aber es gibt auch andere. Die einen von den anderen zu unterscheiden, darum geht es im Arbeitsalltag. Dazu braucht man kulturelle Kompetenz.
Das habe ich jedenfalls anders erlebt. Am Anfang wollte niemand den Transrapid. Thyssen-Krupp und Siemens hatten den Zug zwar entwickelt. Doch die Geschäftsinteressen hatten sich mit den Jahren gewandelt. Siemens wollte lieber seine Rad-Schiene-Züge in China verkaufen und für Thyssen war das kein Kerngeschäft mehr. Deswegen hatten sie die Vermarktungsrechte für Asien bereits an ein japanisches Konsortium verkauft. Die haben aber in China nichts gemacht. Als die Rechte wieder frei waren, hat mein von mir sehr geschätzter Vorstand, Eckhard Rohkamm, mir gesagt: Ja, Sie können das probieren, es gibt aber kein Budget dafür. Eigentlich ein Zeichen, dass man die Finger davonlassen soll. Zumal die Chinesen ebenfalls skeptisch waren, weil die Deutschen keine Referenzstrecke im Alltagsbetrieb hatten. Da ging es erst einmal nicht um kulturelle Unterschiede.
Ich habe einen chinesischen Partner in der Politik gesucht, der von dem Thema begeistert ist. Und den habe ich dann gefunden: Das war Zhu Rongji, damals noch Vizepremier. Als gelernter Elektroingenieur und ehemaliger Oberbürgermeister von Shanghai konnte er sich eine Strecke vom Flughafen zur Innenstadt dort gut vorstellen. Es gab immer wieder Gespräche, aber es wurde einfach nicht konkret. Erst, nachdem Zhu 1998 Premier wurde, kam Fahrt in die Verhandlungen. Und ich wusste, ich habe auf den richtigen Mann gesetzt. Dann gab es plötzlich einen Termin beim Premierminister für Vorstand Rohkamm. Wir waren immer noch skeptisch. Würde der Termin klappen? Und wenn er klappt, würde etwas Konkretes besprochen? Dann dauerte der 20-Minuten-Termin zweieinhalb Stunden und der Premier kam nicht alleine, sondern hat gleich seine zuständigen Minister mitgebracht. Da wusste ich: Jetzt wird es ernst.
Der war immer noch skeptisch und stellte sich nun durchaus nicht zu Unrecht die Frage, ob wir überhaupt ein marktfähiges Produkt liefern können. Da habe ich dann ein wenig nachgeholfen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Presse von dem Treffen erfährt. Die Thyssen-Aktien sind daraufhin um 15 Prozent gestiegen. Dann war klar bei uns, das müssen wir nun machen.
Auch dort musste Premier Zhu Widerstände der Rad-Schiene-Fraktion im Ministerium niederkämpfen. Er ist dann bei einem Besuch in Deutschland nach Lathen gefahren. Das war das einzige Mal, dass ein IC dorthin fuhr. Er hat den Shanghaier Bürgermeister mitgenommen und ihn dann nach der Testfahrt öffentlich gefragt: Und willst Du den Zug kaufen? Der hat dann ja gesagt – was sollte er auch anders tun – und damit war der Damm gebrochen.
Ja. Premier Zhu wollte, dass wir die Anlage fertigstellen, solange er noch Premierminister war. Das waren jedoch nur zwei Jahre. Eigentlich war das aus deutscher Sicht unmöglich. Doch wir haben das dann doch irgendwie hinbekommen. Mit großen Anstrengungen und enormer Risikobereitschaft. Denn wir hatten ein Produkt verkauft, für das wir im Grunde keine Alltagserfahrung hatten. Wir mussten uns also darauf verlassen, dass der chinesische Kunde hie und da schon mal ein Auge zudrückt. Das hat er auch dann getan, auch wenn es immer wieder heftig gekracht hat. Am 31. Dezember 2002 haben der damalige Kanzler Gerhard Schröder und Premier Zhu den Transrapid dann offiziell eingeweiht. Auf dem Tisch stand eine Vase und die hat sich bei über 400 Kilometer pro Stunde nicht bewegt. Das war der Beweis: Der Transrapid hält, was er verspricht.
Das hat aber nicht mit unserer Technologie zu tun, sondern liegt daran, dass der Fahrweg zu schnell gebaut wurde. Er hat sich in dem sumpfigen Gelände mit der Zeit abgesenkt.
Dann muss man sich allerdings auch die Frage stellen, warum haben sie Probleme. Sind sie vielleicht selbst nicht flexibel genug? Sind sie nicht mehr wettbewerbsfähig? Können sie sich nicht anpassen? Es liegt nicht immer daran, dass die Chinesen selbstbewusster geworden sind oder uns sogar austricksen. Es ist immer einfach zu sagen ‘Die anderen sind schuld’, statt sich an die eigene Nase zu fassen. Grundsätzlich glaube ich: Auch heute ist ein solches Teamwork noch denkbar.
Sicherlich muss man sich mehr mit der Frage beschäftigen, welche Vorstellungen die Chinesen haben. Als wir in den 80er-Jahren anfingen, Autos in China zu bauen oder Stahlwerke, da konnten wir bestimmen, wie das geht. Da hatten die Chinesen noch keine Ahnung. Doch es war auch nicht einfach, ihnen das beizubringen. Heute sind sie gut ausgebildet, haben eigene Erfahrungen, eigene Vorstellungen. Das ist anders, aber nicht unbedingt schwieriger oder einfacher. Spannend ist es in jedem Fall. Deshalb freue ich mich unglaublich auf die nächste große Herausforderung, den Hyperloop. Das will ich unbedingt noch hinkriegen. Und dann schalte ich einen Gang zurück. Erstmal jedenfalls.
Hartmut Heine, 67, hat als Chef von ThyssenKrupp in China von 1989 bis 2004 die chinesische Politik und die deutsche Industrie an einen Tisch gebracht und war für die deutsche Seite federführend beim Bau des Transrapid in Shanghai. Er lebt und arbeitet seit mehr als 40 Jahren in China und stand unter anderem bei Salzgitter Stahl, Georgsmarienhütte und Siemens unter Vertrag. Im Jahr 1984 gründete er die Deutsche Handelskammer mit und war über ein Jahrzehnt im Vorstand der Deutschen Schule. Heute ist er der China-Chef des europäischen Hyperloop-Herstellers Hardt aus Holland.
Der Boom der E-Mobilität der letzten Jahre wird bald zu Millionen gebrauchten E-Auto-Akkus führen. Die Lebensdauer der Batterien wird in Branchenkreisen auf acht bis zehn Jahre angegeben. Danach ist die Kapazität der Speichermodule und somit die Reichweite der Fahrzeuge so weit gesunken, dass die Akkus ausgetauscht werden.
Was geschieht mit den Millionen gebrauchten E-Auto-Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer? Bisher ist das Recycling in China noch sehr lückenhaft. Dabei müssten die wertvollen Rohstoffe dringend wiederverwertet werden. Die Nachfrage nach Batterie-Rohstoffen wird mit dem weiteren E-Auto-Boom stark steigen.
In China sind die Recycling-Herausforderungen akut. Schon 2025 müssen zwölfmal mehr gebrauchte E-Auto-Batterien recycelt oder anderer Nutzung zugeführt werden als noch 2020, so der chinesische Verband der Automobilhersteller. Das sind siebenmal mehr gebrauchte E-Auto-Batterien, als zum gleichen Zeitpunkt in der EU anfallen werden.
Derzeit gelangen in China viele E-Auto-Batterien noch immer nicht zu den offiziellen Recycling-Unternehmen. Stattdessen landen sie auf der Müllhalde oder bei illegalen Unternehmen. Dort werden die Akkus mit veralteter Technologie und niedrigen Umweltstandards recycelt, wie chinesische Medien berichten. “Das Recyclingsystem für E-Auto-Batterien muss schneller entwickelt werden”, betonte Chinas Premier Li Keqiang dann auch im Regierungsbericht für den letzten Volkskongress im März.
Auf dem Papier sehen die chinesischen Regulierungen zum Recycling fortschrittlich aus. Die Regierung in Peking hat 2018 und 2019 Bestimmungen und Richtlinien erlassen, um das Recycling zu verbessern. Zunächst wurde die Auto- und Batterieindustrie aufgefordert, gemeinsam Recycling-Pilotprojekte in 17 Städten und Regionen zu starten und “Dienstleistungsnetzwerke zum Recycling” aufzubauen. Schon 2018 wurde die Verantwortung für die Sammlung, Behandlung und das Recycling der Batterien an die Autohersteller übertragen.
Ende 2019 bekräftigte die Regierung diese Verantwortung von E-Autoherstellern und forderte sie zum Aufbau von “Servicestellen zum Recycling” für E-Auto-Batterien auf – diese Aufgabe darf jedoch auch an externe Dienstleister ausgelagert werden. Die Servicestellen sind verantwortlich, die Batterien zu sammeln, zu lagern, zu verpacken und zu verschicken. Sie dürfen die Batterien aber nicht selbst zerlegen. Dafür sind nur 22 zugelassene Recycling-Unternehmen verantwortlich.
Die Batteriehersteller wiederum müssen Informationen zur ordnungsgemäßen Lagerung und Entsorgung der Akkus bereitstellen. Ebenso sollen sie sich zum Batterie-Design koordinieren, um das Recycling zu vereinheitlichen. Um ausrangierte Batterien zu identifizieren, soll ein System zur Rückverfolgbarkeit etabliert werden.
Es gibt jedoch eine “Schieflage zwischen politischen Regeln und der Praxis” des Recyclings, sagt der Nachhaltigkeitsexperte Richard Brubaker aus Shanghai im Gespräch mit China.Table. Es gäbe noch immer “eine Reihe von Engpässen bei der Sammlung und Verarbeitung ausgedienter E-Auto-Batterien“, so der Gründer und Geschäftsführer der auf Nachhaltigkeit fokussierten Beratungsagentur Collective Responsibility.
Hinzu kommt: In den Gesetzen und Vorschriften zum Batterie-Recycling gibt es zwar Sammelquoten. “Die Sammel-Praxis entspricht jedoch nicht diesen Quoten“, so Brubaker. Auch enthalten die Richtlinien keine Vorschriften, wie viel der wertvollen Rohstoffe beim Recycling zurückgewonnen werden muss. Es gebe jedoch Arbeitsgruppen, die sich mit der Einführung solcher Rückgewinnungsquoten beschäftigten, sagt Brubaker.
Bei der Zweitnutzung ausgedienter E-Auto-Batterien als Energiespeicher und der Sammlung der Batterien zu diesem Zweck beobachtet Brubaker “spannende Entwicklungen”. Jedoch gibt es auch hier Probleme: Aus Sicherheitsgründen hat Chinas Nationale Energiebehörde (National Energy Administration) ein Verbot der Nutzung von ausgedienten E-Auto-Batterien als Energiespeicher vorgeschlagen, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet. Im April war es zu einer Explosion in einer Energiespeicher-Einrichtung gekommen, bei der zwei Feuerwehrleute starben.
Die Zweitnutzung der ausgedienten Akkus in kleineren Anwendungen – beispielsweise im Bereich der Telekommunikation – wäre von diesem Verbot nicht betroffen. Doch es fehlt an Informationen über den Zustand ausgedienter E-Auto-Akkus. “Unvollständige Betriebsdaten machen es schwer, ihre Sicherheit, Lebensdauer und Anpassungsfähigkeit zu beurteilen”, gibt Caixin einen Branchenvertreter wieder. Richard Brubaker bestätigt diese Einschätzung. Solche Informationen sind jedoch für den Geschäftserfolg von Unternehmen wichtig, die Batterien für ein Second-Life in Speicherapplikationen aufarbeiten.
Generell ist sich die KP Chinas des Problems bewusst. Anfang Juli verabschiedete die Entwicklungs- und Reformkommission den “14. Fünfjahresplan zur Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft”. Allgemein ist dort festgehalten: “Es besteht ein dringender Bedarf, die Kapazitäten des hochwertigen Recyclings” in China zu verbessern. Der Aufbau von “Servicestellen zum Recycling” durch die Autohersteller soll vorangetrieben werden. Um zu verhindern, dass E-Auto-Batterien illegal recycelt werden, sollen sie über die gesamte Lebensdauer besser nachverfolgbar werden. Gegen illegale Recycler wollen die Behörden nach eigenen Angaben hart durchgreifen. Vieles aus dem Plan ist eine Wiederholung vorheriger Regulierungen. Konkrete Recyclingziele nennt der Plan nicht.
Die EU ist schon etwas weiter. Die EU-Kommission hat im Dezember 2020 einen umfassenden Regulierungsvorschlag zum Recycling von (E-Auto-)Batterien und ihrer Zweitnutzung vorgelegt. Der Vorschlag löst eine veraltete EU-Richtlinie von 2006 ab, als Lithium-Akkus noch keine große Rolle spielten. Bisher gibt es für solche Akkus noch keine Sammel- oder Recyclingziele. Durch den Kommissionsvorschlag sollen Batterien in Zukunft “zu einer wahren Quelle für die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe werden”.
Gerade bei Lithiumbatterien wie sie in Elektroautos verbaut werden, sieht die EU “noch viel zu tun”. Bisher werden Schätzungen zufolge nur zehn Prozent des in Batterien enthaltenen Lithiums recycelt. Diese Quote soll erhöht werden:
Geplant ist auch, dass E-Auto-Batterien ab dem Jahr 2030 gewisse Anteile recycelter Materialien enthalten – beispielsweise vier Prozent recyceltes Lithium und Nickel und zwölf Prozent recyceltes Kobalt. Bis 2035 werden die Quoten weiter angehoben. Um E-Auto-Batterien als Energiespeicher weiter nutzbar zu machen, will die EU einen Markt für Second-Life-Batterien aufbauen.
Kerstin Meyer von Agora Verkehrswende sagt, der Vorschlag der EU-Kommission sei “grundsätzlich zu begrüßen.” Wiederverwertungsziele gesetzlich zu verankern sei “ein wichtiger Schritt, um mehr Rohstoffe im Kreislauf zu halten”. Auch der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft findet lobende Worte für die Vorschläge. Die Mindesteinsatzquote von recycelten Rohstoffe für neue Batterien schaffe “Planungs- und Investitionssicherheit für den Aufbau der Recyclinginfrastruktur”, so ein Sprecher zu China.Table. Jedoch müsse die Kommission bei der Berechnungsgrundlage für Recycling- und Verwertungsquoten aufs Tempo drücken. Nur wenn frühzeitig feststehe, wie die vorgeschlagenen Quoten erreicht werden sollen, könne die Recyclinginfrastrukur rechtzeitig aufgebaut werden, so der Verband.
Der VDMA befürwortet “im Grundsatz die von der EU verfolgten Regulierungsziele für nachhaltige Batterien”. Doch der Verband warnt auch vor der “Gefahr eines erheblichen bürokratischen Mehraufwands” für seine Mitgliedsunternehmen. Den Unternehmen drohten “enorme Wettbewerbsnachteile zur außer-europäischen Konkurrenz“. Kerstin Meyer will diese Kritik nicht gelten lassen. “Die EU sollte hohe Standards setzen. Der internationale Wettbewerb darf bei Recyclingstandards nicht zu einem Race to the Bottom führen”, sagt die Projektleiterin im Bereiche Fahrzeuge und Antriebe.
Das Europaparlament arbeitet an einem Vorschlag zur Neuausrichtung der China-Politik der EU. In einem Bericht, den nun der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des EU-Parlaments verabschiedet hat, schlagen die Abgeordneten eine Strategie mit insgesamt sechs Säulen vor, darunter ein offener Dialog über globale Herausforderungen, das Engagement für Menschenrechte durch wirtschaftspolitische Maßnahmen und die Stärkung der geopolitischen Bedeutung der EU.
Die EU-Abgeordneten betonen darin erneut, dass der Ratifizierungsprozess des Investitionsabkommens (CAI) nicht beginnen kann, bis China die Sanktionen gegen Abgeordnete und EU-Institutionen aufhebt. Die EU-Kommission wird aufgefordert, den Investitionsschutz wieder in das CAI einzuführen – bei diesem Thema konnte bei den CAI-Verhandlungen keine Lösung gefunden werden. Außerdem drängt das Europaparlament auf Fortschritte beim Investitionsabkommen mit Taiwan. Derzeit gibt es dazu jedoch keine Signale für die offizielle Aufnahme entsprechender Gespräche.
Insgesamt folgen die Vorschläge den bereits bekannten Ansätzen des Europaparlaments. Die Abstimmung über den Bericht soll im September im Plenum erfolgen. Was die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten dann damit machen, ist offen. Im Oktober soll bei einem EU-internen Sondergipfel über das Verhältnis zu China gesprochen werden. Die letzte offizielle EU-China-Strategie stammt aus dem Jahr 2019.
In dem Strategie-Vorschlag des EU-Parlaments wird ein regelmäßiger Menschenrechtsdialog zwischen Brüssel und Peking sowie die Einführung nachprüfbarer Maßstäbe für die Fortschritte Chinas in Sachen Menschenrechten gefordert. Der Bericht drängt zudem darauf, dass der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) ein Mandat und die erforderlichen Ressourcen erhält, um chinesische Desinformationskampagnen mit einer speziellen StratCom-Task-Force für den Fernen Osten anzugehen (China.Table berichtete). ari
Ein Flugverbot Chinas gegenüber der Lufthansa löst eine deutsche Gegenreaktion aus. Das Auswärtige Amt äußerte “Bedenken” in Hinblick auf die Maßnahme und kündigte an, jetzt Flüge chinesischer Gesellschaften blockieren zu wollen. China begründet die Streichung von Flugverbindungen mit Corona. Derzeit gilt: Bringt eine Fluggesellschaft positiv auf Covid-19 getestete Passagiere ins Land, wird sie bestraft. Chinesische Behörden können den Airlines verbieten, die Strecke für eine bestimmte Zeit anzubieten. Davon waren seit Februar auch schon die deutschen Fluggesellschaften Condor und Lufthansa betroffen.
Das Außenministerium vermutet einem Medienbericht zufolge dabei nun Wettbewerbsverzerrung und leitet Gegenschritte ein. “Nach vorliegenden Informationen gibt es keine Verstöße deutscher Fluggesellschaften gegen die Infektionsschutz-Vorgaben der chinesischen Behörden, die die Aussetzung von Flügen begründen könnten”, zitiert die Branchenplattform Aerotelegraph das Außenministerium. Um dem zu begegnen, suspendiere Deutschland nun reziprok Flüge chinesischer Fluggesellschaften auf derselben Strecke, auf der es für deutsche Unternehmen zu Einschränkungen kommt. Welche Fluggesellschaften und Strecken davon betroffen sind, blieb zunächst offen. ari
Am Freitag hat der chinesische Emissionshandel gestartet (China.Table berichtete). Nach über einem Jahrzehnt der Vorbereitung wurden die ersten Emissionsrechte ge- und verkauft. Der Preis lag zum Handelsschluss bei umgerechnet 6,90 Euro pro Tonne CO2. Im europäischen Emissionshandel kostet eine Tonne CO2 mittlerweile mehr als 50 Euro.
Insgesamt nehmen 2.162 Unternehmen aus dem Energie- und Wärmesektor an der ersten Phase des chinesischen Emissionshandels teil, wie der chinesische Umweltminister Huang Runqiu zum Handelsstart verkündete. Sie verursachen demzufolge 4,5 Gigatonnen CO2 pro Jahr, was gut 40 Prozent der chinesischen Gesamtemissionen ausmacht. Der für Klima zuständige EU-Kommissar Frans Timmermanns gratulierte China auf Twitter zum Handelsstart.
Ursprünglich hatte Peking sehr ambitionierte Ziele für den Emissionshandel. Sie wurden jedoch aufgeweicht. Industriesektoren oder der Flugverkehr müssen sich vorerst nicht am Handel beteiligen. Auch gibt es keine feste oder gar abnehmende Obergrenze an CO2-Zertifikaten, wie es beim europäischen Emissionshandel der Fall ist. Experten bezweifeln, ob der Handel in seiner derzeitigen Form überhaupt nennenswert zur Verringerung der immensen Emissionen beitragen kann. Gleichzeitig gibt es weiterhin Pläne zur Ausweitung des Emissionshandels auf andere Sektoren. nib
Auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue ständige Arbeitsgruppe angekündigt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte am Freitag in Genf, dass neben der Untersuchung von Wildtieren und Tiermärkten im chinesischen Wuhan auch die dortigen Labore inspiziert werden müssten. Das WHO-Team, das nach monatelangem Gezerre erst im Januar nach China reisen durfte, berichtete Ende März, es sei “wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich”, dass das Virus von einem Tier über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergesprungen sei. Dass das Virus aus Versehen aus einem Viren-Labor entwich und sich verbreitete, gelte als “extrem unwahrscheinlicher Weg” (China.Table berichtete).
Die USA halten aber an der These eines Laborunfalls fest. Das werde zumindest in Teilen des US-Geheimdienstapparates für möglich gehalten, sagte US-Präsident Joe Biden Ende Mai und ordnete weitere Prüfungen an. Ende August soll der Geheimdienst berichten. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt weitere Untersuchungen zur Herkunft des Virus gefordert. ari
Der taiwanesische Chip-Weltmarktführer TSMC konkretisiert seine Expansionspläne. Bis 2023 sollen in der chinesischen Fabrik in Nanjing 40.000 Wafer pro Monat hergestellt werden. Das entspricht einer Kapazitätserweiterung um 60 Prozent. Dafür will der Halbleiterhersteller 2,8 Milliarden US-Dollar investieren, wie das Unternehmen schon vor einiger Zeit mitteilte. In Nanjing sollen technologisch weniger anspruchsvolle 28-Nanometer-Chips hergestellt werden, die jedoch für die Autoindustrie von großer Relevanz sind. TSMC habe erklärt, dass die weltweite Knappheit an Automobilchips ab diesem Quartal “signifikant reduziert” werde, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet.
Medienberichten zufolge könnte TSMC auch eine Milliarden-Investition in Dresden planen. Demnach laufen Gesprächen über den Bau einer Chipfabrik in der Nähe der sächsischen Landeshauptstadt. Weder Dresden noch das taiwanesische Unternehmen bestätigten die Pläne bisher jedoch. Weiter ist das Unternehmen schon in den USA: Die in Arizona geplante Fabrik soll im ersten Quartal 2024 die Massenproduktion starten. TSMC will dort insgesamt zwölf Milliarden US-Dollar investieren. Das Unternehmen verfolgt auch Pläne zum Bau einer ersten Chipfabrik in Japan. nib
Aufgrund der Corona-Pandemie und den davon ausgelösten Reiseverboten wurde vielen Expats, die in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren, die Wiedereinreise nach China untersagt. Die Erneuerung ihrer chinesischen Arbeitserlaubnis ist für diese “Gestrandeten” kompliziert geworden.
Zwar hat die chinesische Regierung eine vorübergehende Regelung erlassen, die es Ausländer:innen erlaubt, ihre Arbeitserlaubnis aus der Ferne zu verlängern. Schwierigkeiten kann es allerdings bei der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung geben. Und läuft diese in der Zwischenzeit aus, kann das wiederum ein Hindernis für die erneute Verlängerung der Arbeitserlaubnis darstellen.
Außerdem scheinen einige lokale Regierungen im Juli die Regeln für die Beantragung der Arbeitserlaubnis verschärft zu haben, um Personen davon abzuhalten, Scheinfirmen nur für Visazwecke zu gründen.
Um Expats, die außerhalb Chinas gestrandet sind, die Erneuerung ihrer chinesischen Arbeitserlaubnis zu erleichtern, haben viele örtliche Auslandsämter befristete Maßnahmen erlassen. Zum Beispiel hat die Shanghai Administration of Foreign Experts Affairs am 1. Februar bekannt gemacht, eine “No-Visit”-Prüfung und -Genehmigung für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Arbeitserlaubnis für Ausländer in Shanghai einzuführen.
Gemäß dieser Richtlinie müssen Antragsteller für die Verlängerung der Arbeitserlaubnis keine Originale der Antragsunterlagen zum örtlichen Büro für Ausländerangelegenheiten in China mitbringen. Stattdessen können Antragsteller ihre Arbeitserlaubnis aus der Ferne verlängern, indem sie eine Echtheitserklärung (“Commitment”) für die Dokumente abgeben.
Die oben genannte Richtlinie hat den Prozess zur Verlängerung der Arbeitserlaubnis von Ausländer:innen stark vereinfacht; einige Probleme wurden jedoch noch nicht vollständig gelöst.
Da es parallel keine Vereinfachung der Richtlinie zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis gab, müssen Ausländer:innen immer noch in China anwesend sein und ihre Einreiseunterlagen vorlegen, um ihre Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. In der Tat haben viele Ausländer und Ausländerinnen ihre Arbeitserlaubnis verlängert bekommen, mussten aber ihre Aufenthaltsgenehmigung ablaufen lassen.
Schwieriger wird es nach zwölf Monaten, wenn die Arbeitserlaubnis dann erneuert werden muss. Da sich die Regeln für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis immer noch nicht geändert haben, kann es sein, dass diejenigen, die ihre Aufenthaltserlaubnis im letzten Jahr nicht verlängern konnten, auch in diesem Jahr nicht in der Lage sind, die Verlängerung zu beantragen.
Da jedoch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung eine der Hauptvoraussetzungen für die Verlängerung einer Arbeitserlaubnis ist, kann es sein, dass Expats, die außerhalb Chinas gestrandet sind, ohne eine gültige Aufenthaltsgenehmigung ihre Arbeitserlaubnis nicht mehr verlängern können.
Nach Auskunft des Shenzhen Foreign Affair Office gegenüber Dezan Shira gibt es mehrere Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen:
Wenn es dann an der Zeit ist, nach China zurückzukehren, können sie die Arbeitserlaubnis erneut beantragen, als ob sie diese zum ersten Mal beantragt hätten.
In diesem Fall empfehlen wir, dass sie die folgenden Vorbereitungen im Voraus treffen:
Zusätzlich zu anderen besorgniserregenden Nachrichten hat die Ausländerbehörde der Provinz Guangdong im Juli die Regeln für die Beantragung der Arbeitserlaubnis sogar verschärft. Dies kann eine große Hürde für Start-up-Unternehmen sein, da der Erhalt einer Arbeitserlaubnis oft der erste Schritt ist, um Mitarbeiter:innen nach China zu schicken.
Von einigen Antragstellern, die zum ersten Mal eine Arbeitserlaubnis beantragen, werden nun zusätzliche Unterlagen verlangt, die vorher nicht verlangt wurden, darunter (ganz allgemein):
Unserer Meinung nach wollen die Behörden mit der Verschärfung der Regeln für die Arbeitserlaubnis sicherstellen, dass eine echte Notwendigkeit der Antragsteller besteht, in China zu arbeiten, und nicht aus anderen Gründen ins Land zu kommen. Denn während der Pandemie haben einige Ausländer Firmen in China gegründet, um ein Arbeitsvisum zu erhalten.
Nach unseren jüngsten Erfahrungen scheint es so, als ob der gesetzliche Vertreter oder die Vertreterin eines Unternehmens im Vergleich zu den anderen Führungspositionen weniger Unterlagen benötigt, um die Genehmigungen zu erhalten.
Der Grund dafür ist, dass der gesetzliche Vertreter eines chinesischen Unternehmens bei einigen unternehmensbezogenen Vorgängen physisch anwesend sein muss, zum Beispiel bei der Bank, um ein Bankkonto einzurichten, beim Finanzamt, um ein Steuerkonto für das Unternehmen einzurichten oder um einen Identitätsnachweis zu erbringen.
Allerdings muss der gesetzliche Vertreter heute einen Arbeitsvertrag unterzeichnen, anstatt einfach einen Gewerbeschein hochzuladen. Außerdem muss der gesetzliche Vertreter einen Jobtitel in der Firma tragen.
Für diejenigen, die nicht der gesetzliche Vertreter des chinesischen Unternehmens sind, sollten weitere Dokumente im Voraus vorbereitet werden, um den Antrag zu unterstützen.
Unternehmen, die Ausländer:innen einstellen, müssen eine schriftliche Verpflichtung zur Einstellung chinesischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgegeben haben bzw. wird erwartet, dass sie diese abgeben, da sonst die Arbeitserlaubnis der ausländischen Mitarbeiter:innen nicht verlängert oder die Anträge nicht bearbeitet werden können. Das berichtet uns die State Administration of Foreign Experts Affairs (Safea) in Guangzhou.
Dies ist auch ein Weg, um sicherzustellen, dass das Unternehmen wirklich Geschäftstätigkeit betreibt (und nicht eine Scheinfirma, die für Visazwecke eingerichtet wurde). Wenn eine Firma, die sich verpflichtet hat, chinesische Mitarbeiter:innen einzustellen, dies nach Ablauf einer Frist noch nicht getan hat, könnte die Verlängerung der Arbeitserlaubnis ebenfalls abgelehnt werden.
Die Safea in Shenzhen scheint diesem Beispiel zu folgen und die Unternehmen zu drängen, chinesische Mitarbeiter einzustellen. Für Ein-Personen-Firmen, die nur zum Zweck des Visums gegründet wurden, könnte der Verlängerungsantrag unter den derzeitigen Umständen eine echte Herausforderung sein.
Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam. Bitte nehmen Sie Kontakt auf über info@dezanshira.com oder die Website www.dezanshira.com.
Shang Yanchun und Lu Man haben Chinas Staatsfonds China Investment Corporation verlassen. Shang Yanchun leitete eines der beiden Investmentteams im Bereich Technologie, Medien und Kommunikation. Lu Man war hochrangiger Manager im Bereich Direktinvestitionen. Laut Bloomberg sieht sich der Fonds mit einem “Exodus leitender Angestellter” konfrontiert. In den vergangenen fünf Jahren verließen 20 Teamleiter und Geschäftsführer den Staatsfonds.

Wobei lassen Sie sich nur ungern stören? Beim “Ess-ing” (吃饭ing – chīfàn-ing), “Les-ing” (看书ing – kànshū-ing) oder vielleicht während des “Ausruh-ing” (休息ing – xiūxi-ing)? Wenn sich jedenfalls Chinas “Generation Online” ganz in den Moment vertieft, werden auch schon mal Sprach- und Grammatikgrenzen nebensächlich. Zwar hat auch das Chinesische seine eigene Verlaufsform (吃饭 chīfàn = “essen”, 正在吃饭 zhèngzài chīfàn = “gerade essen”/”beim Essen sein”). Doch in der chinesischen Internetsprache hat sich die englische ing-Form seit einiger Zeit einen gewissen Coolness-Faktor erarbeitet. Chinas junge Netzgemeinde – die das englische Suffix noch zur Genüge vom Grammatikbüffeln im Schulunterricht kennt – spielt heute kreativ mit dem Wortanhängsel, fügt es nicht nur an chinesische Verben, sondern zum Beispiel auch an Substantive an, und schafft damit jede Menge neue Wortkreationen.
Diese reichen vom “Vergnüging” (娱乐ing – yúlè-ing) über “Bewerbing” (招聘ing – zhāopìn-ing) und “Spieling” (游戏ing – yóuxì-ing) bis hin zum “Fernsehing” (看电视ing – kàn diànshì-ing). Gemein ist allen Formen, dass sie den Verlaufscharakter der Handlung unterstreichen – beim “ING”-ing ist man geistig und emotional ganz bei der Sache und genießt den Augenblick.
Wer im Übrigen glaubt, eine Ton- und Zeichensprache wie das Chinesische eigne sich nicht für Anglizismen, wird im Gespräch mit heutigen Chinesen schnell eines Besseren belehrt. Beeinflusst durch Internet, internationales Arbeitsumfeld und die immense Unterhaltungsindustrie, die auch ausländische Trends in sich aufsaugt, streuen Chines:innen im Gespräch auch gerne mal ohne jede Vorwarnung englische Begriffe ein.
Vorgemacht haben es einst Chinas aufstrebende Büroangestellte (白领 báilǐng), die angesichts globaler Unternehmensstrukturen und Kommunikationswege so manches chinesische Wort im “Bürosprech” durch englische Platzhalter austauschten (我把link和proposal的PPT发到你的email,ok吗?). Heute finden Anglizismen nicht selten über eine Vielzahl landesweit erfolgreicher Entertainmentshows ihren Weg in den chinesischen Alltagssprachgebrauch. So machten etwa Hip-Hop- und Streetdance-Formate Begriffe wie “battle”, “diss”, “pick” und “freestyle” zu festen Vokabelgrößen im Alltag – auch über das Publikum der Sendungen hinaus. Die chinesische Sprache bleibt also weiter in Bewegung. Da heißt es weiter ins “Lern-ing” vertiefen – fleißig xuéxí-ing also.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Spracheschule New Chinese.
