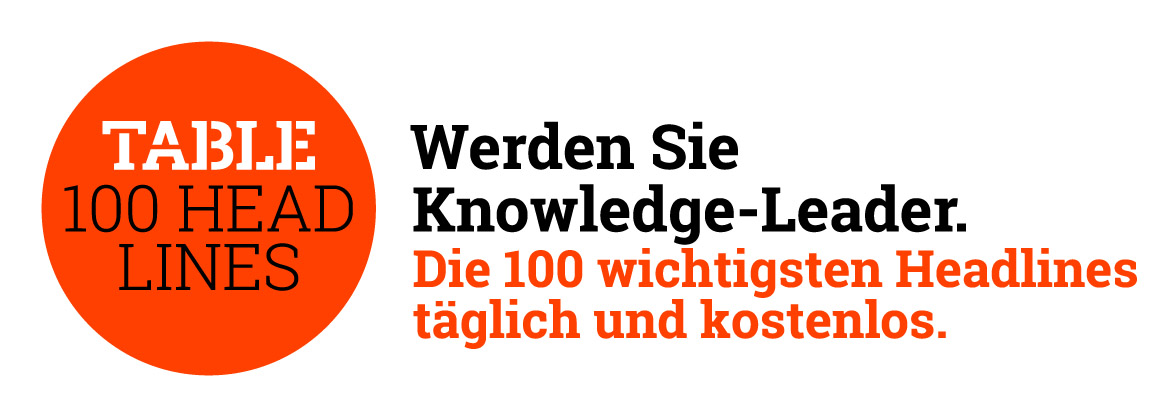begleitet von einem bedrohlichen Polizeiaufgebot fand am Montag in Hongkong die Anhörung von 47 Oppositionellen statt. Die Botschaft aus Peking ist klar: Jeder Versuch einer Demokratisierung soll im Keim erstickt werden. Um das Sicherheitsgesetz durchzusetzen, stehen der Stadt für die nächsten zwei Jahre zusätzlich 850 Millionen Euro zur Verfügung, schreibt Marcel Grzanna. Woher das Geld stammt, darüber schweigen Honkongs Stadtobere.
Eines der großen Themen der kommenden Wochen wird zweifellos sein, welche konkreten wirtschaftspolitischen Entscheidungen die chinesische Regierung mit dem Ziel der “Dual Circulation” verbindet – und mit welchen Konsequenzen Investoren und Exporteure in Europa zu rechnen haben. Frank Sieren analysiert dieses und weitere wirtschaftspolitische Inhalte des 14. Fünfjahresplans vor dem Nationalen Volkskongress.
In Brüssel, schreibt Amelie Richter, erwarten die Experten erst einmal nichts Gutes von Pekings Plänen. Nach dem Volkskongress wird sich Europa der Aufgabe einer gemeinsamen China-Strategie stellen müssen – und darin auch über Strukturen einer punktuellen Zusammenarbeit, etwa im Klimabereich, nachdenken müssen.
Zu den Zielen chinesischer Politik gehört auch die Vergrößerung der Unabhängigkeit in wichtigen technologischen Bereichen. Da lassen Gerüchte über eine Fusion der staatseigenen China Electronics Technology Group (CETC) mit China Putian Information Industry Group (Potevio) aufhorchen. Finn Mayer-Kuckuk nimmt den entstehenden Elektronik-Giganten unter die Lupe.

Anfang März wird China beim Nationalen Volkskongress seinen 14. Fünfjahresplan verabschieden und damit die Weichen für die Jahre zwischen 2021 bis 2025 stellen.
Schon Ende Oktober 2020 hatte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei den Plan ausgearbeitet – und vor allem ein Stichwort fällt auf: “Dualer Kreislauf”.
Man kann diese “Dual Circulation”-Strategie als Antwort auf die von den USA vorgenommene technologische Entkoppelung von China verstehen. Auch unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden gilt es als wahrscheinlich, dass die Sanktionslisten bestehen bleiben werden.
Deshalb hält China es für sinnvoll, sich wirtschaftlich, technologisch und finanziell autarker zu machen.
Das bedeutet: Mehr eigene Technologie, mehr eigene Energieversorgung (Wind, Solar, Wasser) und vor allem mehr Binnenkonsum und weniger Handel, vor allem Exporte.
Zuerst zur Binnenwirtschaft. Das Ziel: Die eigene Wirtschaft noch effizienter machen. Die Staatsunternehmen sollen weiter saniert und unnachgiebig reformiert werden. Gleichzeitig soll aber auch der private Sektor ausgebaut werden, um den nationalen Wettbewerb zu erhöhen. Im vergangenen Herbst ließ die Regierung etwa eine Reihe von Staatsunternehmen gegen die Wand fahren, nachdem diese ihre Schuldenprobleme nicht mehr in den Griff bekamen.
Zudem sollen die Grundeigentumspolitik und das Hukou System liberalisiert werden. In diesem System wird der Wohnsitz geregelt, daran hängen verschiedene Rechte. Insgesamt soll das Sozialsystem weiter ausgebaut werden, damit die Menschen wirtschaftlich risikobereiter werden.
Kurz: Es sollen weitere Hürden aus dem Weg geräumt, die verhindern, dass die Menschen wirtschaftlich noch produktiver sind.
Gleichzeitig jedoch soll die Verschuldungsquote wieder runtergefahren werden. Darauf gab das Politbüro auf seiner Sitzung vom 26. Februar bereits einen entsprechenden Hinweis. Das Finanzministerium solle “proaktiv” eine “nachhaltigere Finanzpolitik” machen.
Vermutlich wird das Defizit am BIP wieder auf drei Prozent beschränkt, nachdem es im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie auf 3,7 Prozent gestiegen war.
Zudem wird erwartet, dass Peking die Emission von Spezialanleihen zur Finanzierung zurückfährt. Die Zentralregierung führte 2015 Spezialanleihen ein, die den Kommunalverwaltungen eine Finanzierungsquelle außerhalb des normalen Budgets eröffnete.
Eine derart nachhaltigere Infrastruktur hat wiederum auch Einfluss auf die Infrastrukturinvestitionen. Sie waren im vergangenen Jahr auf 3,7 Prozent des Sozialproduktes hochgefahren worden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nun werden sie voraussichtlich auf zwei Prozent reduziert. Ein Hinweis darauf, wohin die Reise mit dem neuen Fünfjahresplan gehen soll: keine maßlose Verschuldung.
Innerhalb der geringeren Investitionen wird es zudem eine deutliche Verschiebung in Richtung neuer Infrastruktur geben, also in Erneuerbare Energien, 5G-Netz und andere digitale Infrastrukturen. Die fünf größten genehmigten Projekte belaufen sich insgesamt auf 131,7 Milliarden US-Dollar. Der größte Anteil entfällt auf neue Zugstrecken, etwa zur stärkeren Vernetzung der Bay-Area-Metropolregion im Perlflussdelta. Es sind Investitionen, die kein Selbstzweck sind, sondern zum langfristigen Wirtschaftswachstum beitragen sollen. Ähnliches gilt für den Ausbau der Telekommunikationsnetze oder Erneuerbaren Energiequellen, etwa dem gigantischen Wasserkraftvorhaben am Fluss Yarlung Tsangpo in Tibet, wo Turbinen mit einer Rekordleistung von 60 Gigawatt installiert werden.
In den Bereichen des Handels, der sich nicht vollständig vermeiden lässt, geht es Peking darum, durch Diversifizierung eine zu große Abhängigkeit vom Westen zu verhindern.
Die Balance der Handelsströme soll aus dem Westen in Richtung Asien in die neue Freihandelszone RCEP verschoben werden. Dazu gehört, dass einfache Industrien mit geringer Wertschöpfung – zum Beispiel die Textilindustrie – in diese Regionen ausgelagert werden sollen. So schafft man einerseits zu Hause Raum für hochwertigere Produktion. Andererseits lässt man die einfachen Waren billiger in den Anrainerstaaten produzieren und transportiert sie dann zollfrei zurück in den eigenen Binnenmarkt. Bestenfalls ist die Produktion dann billiger als in China und schafft dennoch Gewinne und Arbeitsplätze für Schwellenländer wie Indonesien, Malaysia, Thailand, Philippinen und Vietnam.
Ausländische Firmen einzuladen mehr in China zu produzieren ist eine weitere Strategie. Damit wird die Wertschöpfung nach China verlagert.
Dies sind alles im Grunde keine neuen Entwicklungen. Sie haben jedoch angesichts des wachsenden Drucks aus den USA eine neue Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig wird die Verschiebung von Peking als Hebel benutzt, um Druck aufzubauen, eigene Reformen zügiger voranzutreiben.
Für deutsche Firmen wird es in kommenden fünf Jahren zwar noch lukrativer, in China zu investieren. Einfacher wird es jedoch nicht. Lukrativer, weil es nun einen großen Binnenmarkt gibt, den man mitversorgen kann. Nicht einfacher, weil die chinesischen Firmen immer mehr zum technologischen Wettbewerber werden und Marktanteile abgreifen.
Auch ein anderer Trend wird sich in diesem Zusammenhang fortsetzen: China wird weiterhin weniger im Westen investieren und gleichzeitig seine wirtschaftlichen Interessen offensiver vertreten.
Ein Instrument bei Meinungsverschiedenheiten könnten zum einen Klagen vor der WTO sein. Zum anderen ist es wahrscheinlich, dass China die eigene Marktmacht weiter ausnutzt, um seine Forderungen durchzudrücken. Denkbar wäre etwa, dass China den Export von Seltenen Erden noch strenger reglementiert, wenn China weiter von amerikanischen Chips oder anderen essentiellen Kern-Technologien abgeschnitten wird.
Innerhalb des chinesischen Binnenmarktes wird vor allem der E-Commerce-Sektor weiter ausgebaut, der durch die Corona-Epidemie ohnehin einen Schub bekommen hat. Peking ist bewusst, dass Chinas Wachstum in Zukunft mehr von Innovation und digitalem Produktivitätswachstum geprägt sein muss.
Dabei ist die Volksrepublik schon jetzt weit fortgeschritten. Die Marktforscher von eMarketer prognostizieren, dass China dieses Jahr 52,1 Prozent des Einzelhandelsumsatzes aus E-Commerce-Transaktionen erwirtschaften wird. Im Vorjahr waren es noch 44,8 Prozent. Damit wäre China das erste Land, das mehr Waren online als offline verkauft. Die USA kommen nur auf 15 Prozent, Südkorea auf 28,9 Prozent.
Peking wird mit seinem Fünfjahresplan eine deutliche Botschaft an die Europäische Union senden, was die internationalen Beziehungen angeht: Einmischung in innere Angelegenheiten nicht erwünscht. Beobachter in Brüssel erwarten denn auch scharfe Ansagen bezüglich Taiwan und Hongkong. Sie finden aber auch Bereiche, in welchen zusammengearbeitet werden kann.
Normalerweise wird in Chinas Fünfjahresplänen außenpolitischen Angelegenheiten nur wenig Platz eingeräumt. Dieses Mal aber wird neben der Bestätigung des Wirtschaftsmodells aber auch eine andere Sache weit oben auf der Agenda stehen, meint Alicia García-Herrero, Chefökonomin für den asiatisch-pazifischen Raum bei der französischen Investmentbank Natixis und Analystin des in Brüssel ansässigen Thinktank Bruegel: Ausländische Einflussnahme und wie damit umgegangen wird. “Ich erwarte einen sehr protektionistischen Fünfjahresplan“, sagt García-Herrero China.Table. Hinsichtlich Themen wie Taiwan und Hongkong werde es deutliche Ansagen in Richtung Brüssel geben.
Im Vorschlag des Zentralkomitees für den Fünfjahresplan finden sich derartige Ankündigungen bereits an mehreren Stellen: Die Volksrepublik “wird in höchster Alarmbereitschaft sein und die separatistischen Aktivitäten der ‘Unabhängigkeit Taiwans’ entschlossen eindämmen”, heißt es darin. Zudem werde “entschlossen gegen Eingriffe externer Kräfte in Hongkong und Macau” vorgegangen und diese unterdrückt werden. Dieses Narrativ werde auch beim am Freitag beginnenden Volkskongress weiter betont werden, so García-Herrero, die in Hongkong arbeitet.
Sie hoffe, dass die EU ohne Naivität auf die Ansagen aus Peking blicken werde: “Ich hoffe, wir betrachten diesen Fünfjahresplan und sehen wirklich, wohin die Ausrichtung zeigt, und das ist in Richtung vollständiger Eigenständigkeit.” Ankündigungen für eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes für ausländische Unternehmen und Investitionen erwartet die Analystin nicht. Da man sich bereits auf das Investitionsabkommen zwischen China und der EU geeinigt habe, gebe es derzeit für Peking keine Gründe weitere Öffnungen “anzubieten”, sagt García-Herrero.
Gerade die deutsche Industrie sollte angesichts der wirtschaftlichen Leitlinien des 14. Fünfjahresplans sehr hellhörig werden, warnt die Analystin. Die Ankündigungen bezüglich der Dual-Circulation-Strategie, der Ziele bei der Innovationsfähigkeit und der Technologie-Unabhängigkeit bedeuten nichts Gutes für die Deutschen: Dass deutsche Unternehmen in den im Plan skizzierten Markt exportieren und Geld verdienen werden, sei eine “riesige Illusion”, so García-Herrero.
Die Europäische Kommission hat ihre gemeinsame China-Politik zuletzt im März 2019 neu definiert. Die Brüsseler Behörde bezeichnete damals China erstmals als “systematischen Rivalen”. Für das EU-Ratstreffen Ende dieses Monats wird Brüsseler Quellen zufolge ein Fortschrittsbericht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über die Beziehungen zu China erwartet. Zuletzt war aus Brüssel vermehrt Kritik am Vorgehen Pekings in Hongkong zu hören. Das Europaparlament hat in mehreren Resolutionen direkte Sanktionen für Verantwortliche gefordert. Neben Hongkong verschärfte sich zudem der Ton auch in Bezug auf Berichte über Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang.
“Wir werden die Banner des Friedens, der Entwicklung, der Zusammenarbeit und der Win-Win-Situation hochhalten,” heißt es hingegen im Vorschlags-Papier des Zentralkomitees. Es solle an “einer unabhängigen Außenpolitik des Friedens” festgehalten und an der Zusammenarbeit mit anderen Großmächten (大 国) gearbeitet werden. Auch dem Multilateralismus und der Einhaltung des Völkerrechts wird zugesprochen.
Trotz aller Differenzen ergeben sich aber auch Bereiche einer möglichen Zusammenarbeit angesichts der vorgeschlagenen Ziele des neuen Fünfjahresplans und der strategischen Aussichten der EU: Einer der wichtigsten Punkte sei die Klimapolitik, sagt Dharmendra Kanani, Direktor der Brüsseler Denkfabrik Friends of Europe. Die EU wie auch China planten, Milliarden in grüne Technologien, grüne Finanzen und in neue Lösungen zur Förderung der Nachhaltigkeit zu investieren, betont Kanani. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich könnte Innovationen fördern, von denen beide Partner und auch Drittländer profitierten. Sowohl die EU als auch China haben sich verpflichtet, bis 2050 beziehungsweise 2060 klimaneutral zu werden.
Ein weiteres Feld der Kooperation ist Kanani zufolge angesichts der Corona-Pandemie auch die gemeinsame Entwicklung neuer Impftechnologien. Kanani betont, dass der Fünfjahresplan nicht nur als Kampfansagen verstanden werden dürfe. Er spricht sich zudem für eine engere Zusammenarbeit im Innovationssektor aus.
Neben dem Klimawandel stehen noch weitere geteilte Probleme auf den jeweiligen Agenda der Volksrepublik und der Europäischen Union: Sowohl China als auch die meisten EU-Länder müssen die Alterung der Bevölkerung und die nachhaltige Entwicklung ländlicher Gebiete im Auge behalten.
Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften hat am Montag die Anhörung von 47 pro-demokratischen Politikern und Aktivisten vor einem Gericht in Hongkong begleitet. Vor dem Gebäude in West-Kowloon auf dem Festland hatten sich am Vormittag Hunderte Menschen versammelt, die ihre Solidarität mit den Angeklagten durch Sprechchöre und Banner bekundeten und auf Zugang zu der Anhörung hofften.
Zahlreiche Menschen waren in schwarzer Kleidung vor dem Gericht erschienen und symbolisierten damit ihre Unterstützung für Hongkongs Protestbewegung, die im Sommer 2019 begonnen hatte und von den Behörden zum Teil mit großer Brutalität niedergeschlagen worden war. Viele Demonstranten streckten sechs Finger in die Luft als Zeichen für den zentralen Slogan der Proteste, “Fünf Forderungen – nicht eine weniger”.
Die Polizei warnte die Unterstützer vor möglichen Verstößen gegen das neue Sicherheitsgesetz, das eine Strafverfolgung von oppositionellen Versammlungen in der Stadt seit Mitte vergangenen Jahres maßgeblich erleichtert. Verhaftungen vor Ort blieben bis zum Abend jedoch aus, obwohl die Polizei von einer “gesetzeswidrigen Versammlung” sprach. Deren Teilnehmer fügten sich jedoch den Anordnungen und vermieden eine Eskalation.
Mehrere ausländische Diplomaten, darunter auch deutsche Vertreter, waren ebenfalls zum Gericht gekommen, um ein Signal zu senden, dass die juristische Auslegung des Sicherheitsgesetzes in Europa und Nordamerika sehr genau beobachtet wird. Im Gegensatz zu einigen Vertretern der Protestbewegung war jedoch kein Diplomat im Gerichtssaal anwesend. “In Hongkong ist es nicht üblich, die Teilnahme an Gerichtsverfahren formal anzukündigen. Wegen des großen Andrangs und begrenzter Raumkapazitäten haben die anwesenden diplomatischen Vertreter den Unterstützern der Protestbewegung den Vortritt gelassen“, teilte das Auswärtige Amt in Berlin dem China.Table mit.
Die EU-Vertretung vor Ort brachte in einer Stellungnahme “große Sorge” über die Anklage zum Ausdruck. “Das Wesen dieser Anklage verdeutlicht, dass legitimer politischer Pluralismus in Hongkong nicht länger toleriert wird”, heißt es dort. Die EU erinnerte die Behörden an ihre Zusage, die Prinzipien von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu befolgen, die in Hongkongs Basic Law, einer Art Verfassung der Stadt, festgeschrieben sind, und forderte die sofortige Freilassung der 47 Inhaftierten.
US-Außenminister Anthony Blinken schrieb auf Twitter: “Die umfangreichen Verhaftungen pro-demokratischer Demonstranten sind ein Angriff auf diejenigen, die sich mutig für universelle Rechte einsetzen. Die Biden-Harris-Regierung wird an der Seite der Menschen in Hongkong und gegen Pekings Maßregelung der Demokratie stehen“, Sein britischer Amtskollege Dominic Raab bewertete die Anklage als “zutiefst verstörend”. Sie zeige, dass das Sicherheitsgesetz vornehmlich dazu benutzt würde, politischen Dissens zu eliminieren, statt die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen, wie es sowohl von Seiten der Hongkonger Regierung als auch aus Peking formuliert wird. Das Sicherheitsgesetz wurde im Juli 2020 durch den Ständigen Ausschuss des National Volkskongresses implementiert.
Die Ereignisse im und vor dem Gerichtssaal versinnbildlichten auf zweierlei Weise die politische Richtung, in die sich die Stadt bewegt. Drinnen mussten sich Dutzende Lokalpolitiker gegen den Vorwurf verteidigen, die Staatsgewalt untergraben zu haben, obwohl sie lediglich ihre einst zugesicherten demokratischen Rechte ausübten. Draußen machten die Behörden derweil deutlich, dass sie jeden Widerstand im Keim ersticken wollen. Zumal die Sicherheitskräfte künftig deutlich mehr Geld zur Verfügung haben, um die Vorgaben durchzusetzen.
In der vergangenen Woche hatte die Regierung ihren Haushaltsplan
vorgestellt, inklusive einer erheblichen finanziellen Aufstockung der Ausgaben für die innere Sicherheit. Für das Geschäftsjahr 2021/22 werden acht Milliarden Hongkong Dollar, umgerechnet rund 850 Millionen Euro, als “einmalige Mittelzuweisung an einen Spezialfonds zur Deckung der Ausgaben für die Wahrung der nationalen Sicherheit” veranschlagt. Finanziert werden sollen damit unter anderem eine neue Sicherheitseinheit innerhalb der Polizeikräfte, ein Sicherheitsbüro, das nicht der örtlichen Rechtssprechung unterliegt, sowie eine Abteilung im Justizministerium, die sich auf Anklagen bei Verstößen gegen das Sicherheitsgesetz konzentrieren soll.
Trotz der bemerkenswert hohen Summe für den Fond, die zu den üblichen Kosten für innere Sicherheit in Hongkong noch hinzu addiert wird, gab Hongkongs Finanzchef Paul Chan der Öffentlichkeit nicht preis, woher das Geld stammt, das nun verwendet werden soll. Chan hatte bei der öffentlichen Vorstellung des Haushaltsberichts den neuen Posten im Haushaltsplan, der nur im Anhang explizit aufgelistet wird, anfangs gar nicht erwähnt, sondern bezog erst auf Nachfrage Stellung dazu. Kritiker der Hongkonger Regierung erkennen darin ihren Versuch, nicht mehr Aufmerksamkeit als unbedingt nötig für die Bereitstellung des Geldes zu provozieren und vermuten, dass es direkt aus Peking stammt.
Die Vermutung liegt deshalb nah, weil auch die Auslegung des Sicherheitsgesetzes vor Hongkonger Gerichten mit deutlichen Forderungen aus Peking begleitet wird. Beispielsweise hatte der für Hongkong und Macau zuständige Pekinger Funktionär Xia Baolong Ende Februar gesagt, dass Angeklagte wie der Verleger Jimmy Lai, der Aktivist Joshua Wong und der Organisator der inoffiziellen Vorwahlen zum
Legislativrat, Benny Tai, unter Anwendung des neuen Gesetzes “streng
bestraft” werden müssten, ohne den Verlauf weiterer Gerichtsprozesse abzuwarten. Chinesische Medien formulieren derweil schon seit Monaten scharf die Erwartungshaltung der Volksrepublik an die örtlichen Richter.
Während Jimmy Lai und Joshua Wong bereits inhaftiert waren, musste sich Benny Tai wie die meisten der 46 anderen am vergangenen Sonntag bei der Polizei melden, um sich in Haft zu begeben, ehe sie am Montag vor das Gericht traten. Tai gehört zu einer Gruppe von insgesamt über 50 Politikern und Aktivisten, die im vergangenen Sommer die Vorwahlen organisiert und durchgeführt hatten. Ziel war es, jene Kandidaten herauszufiltern, denen die besten Chancen eingeräumt wurden, einen Sitz in dem 70-köpfigen Gremium zu gewinnen. Die Opposition erhoffte sich dadurch die Chance auf eine Mehrheit im Legislativrat.
Das Basic Law sieht vor, dass der Rat den Haushaltsplan der Hongkonger Regierung ablehnen kann. Sollte es soweit kommen, könnte Regierungschefin Carrie Lam das Gremium auflösen. Sollte auch ein neu gewählter Legislativrat den Haushalt ablehnen, müsste Lam zurücktreten. Dieses Szenario galt als eines der letzten Werkzeuge der demokratischen Parlamentarier der Stadt, um auf die politischen Rahmenbedingungen in der Stadt prägnant Einfluss zu nehmen. Die Wahlen waren allerdings in den Herbst dieses Jahres verlegt worden. Offiziell geschah das wegen der Corona-Pandemie. Oppositionspolitiker glauben jedoch, dass die Hongkonger Regierung sich Zeit verschaffen wollte, um bis zur Neuansetzung der Wahl die Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten zu modellieren. Die Anklage am Montag und mögliche Verurteilungen zu Haftstrafen würde die verbliebene Opposition in der Stadt noch weiter schwächen.
Die Fusion der China Electronics Technology Group (CETC) mit China Putian Information Industry Group (Potevio) ist zwar noch nicht offiziell besiegelt, doch chinesische Medien stellen die Zusammenlegung nach den ersten Ankündigungen bereits als Fakt dar. Der Schritt würde auf jeden Fall in die derzeitige Regierungsstrategie passen. Die Schaffung eines Technik-Giganten mit eigener Chipherstellung und einem Fokus auf Militär– und Überwachungstechnik würde diese Branchen vom Ausland unabhängiger machen. Es entstünde die drittgrößte chinesische Technikfirma hinter Lenovo und Huawei.
Beide Fusionspartner gehören zur chinesischen “Nationalmannschaft” aus Staatsbetrieben unter Kontrolle der Zentralregierung. Sie kommen zusammen auf knapp 50 Milliarden Euro Umsatz und spielen somit in einer Liga mit beispielsweise Bayer. Ein vom Profil her ähnliches Unternehmen gibt es in Deutschland nicht. So beliefern beispielsweise Jenoptik oder Diehl auch Rüstungshersteller mit optischen und elektronischen Bauteilen, aber natürlich in viel kleinerem Maßstab. Von Größe und Produktpalette her zum Teil vergleichbar wären eher Lockheed Martin, General Dynamics oder Raytheon aus den USA.
In Chinas Industriekreisen heißt das neue Konglomerat bereits scherzhaft der “Big Mac” oder der “Gigant”, weil die Wirtschaftsplaner hier zwei ohnehin große Unternehmen zu einem neuen Marktführer zusammenschrauben. Die Idee dazu dürfte während des Handelskriegs mit den USA gereift sein. Ein Tochterunternehmen von CETC war bereits direkt von Sanktionen der Trump-Regierung betroffen: Hikvision stellt Überwachungskameras her, die auch in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang zum Einsatz kommen, um Uiguren zu überwachen. Tatsächlich ist Hikvision auch eng mit der Volksbefreiungsarmee verbandelt und liefert wohl Optiken und Kameras für eine ganze Reihe von Anwendungen.
Potevio ist ein Dachunternehmen für die ehemaligen Ausrüstungssparten verschiedener regionaler Telefongesellschaften, die unter dem Ministerium für Post und Fernmeldewesen angesiedelt waren. In den Achtzigerjahren haben seine Vorgängerunternehmen also Telefone, Kabel, Relais und dergleichen hergestellt. Noch heute heißen die Tochterfirmen der Holding beispielsweise Shanghai Putian oder Chengdu Putian. Der Schwerpunkt liegt weiter bei Netzausrüstung. Als kleinerer Partner wird Potevio in CETC aufgehen.
CETC ist im Gesamtbild in erster Linie ein Militärzulieferer. Die Gruppe stellt beispielsweise Radar- und Zielerfassungssysteme her. Das Unternehmen ist auch ein weltweiter Vorreiter beim Bau vollständig autonomer Drohnen, denen die Operateure nur das Einsatzziel vorgeben müssen. Die Drohnen suchen sich als Schwarm ihren Weg und zerstören das Ziel selbständig. Militärexperten sehen im massenhaften Einsatz von billig produzierten, intelligenten Killer-Robotern in der Luft, am Boden und im Wasser die Zukunft der Kriegsführung.
Diese für die Zukunft der Menschheit wenig erbauliche Aussicht zieht erhebliche industriepolitische Schlussfolgerungen nach sich. Völlige Unabhängigkeit in der Lieferkette bis hinunter zur kleinsten Komponente ist damit eine Frage nationaler Sicherheit, für die kein Preis zu hoch ist. Das betrifft in erster Linie die Chips. Die Fusion hat daher den Nebeneffekt, mehr Versorgungssicherheit bei Halbleitern herzustellen. Chips gehören bei beiden Partnern zum Produktangebot. Von den gesicherten Abnahmemengen des chinesischen Regierungskonzerns kann Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei seinem Vorhaben, mehr Elektroindustrie nach Deutschland zurückzuholen, nur träumen.
Neben dem Big-Mac-Vergleich kursiert noch ein zweites Schlagwort für die Mega-Fusion: es entstehe Chinas “IT-Flugzeugträger”. China baut gerade eine Flotte von Flugzeugträgern auf und hat bereits zwei der strategisch wichtigen Schiffe. Auch sie symbolisieren den Aufstieg Chinas an die Weltspitze der Militärtechnik, so wie die Drohnenschwärme von CETC. Das Konglomerat soll nun möglichst unbesiegbar werden – auch im Fall eines Handelskriegs um Steuerchips.
Die Fusion passt auch zu Chinas Strategie der “Dual Circulation”. Diese sieht unter anderem vor, dass mehr wichtige Zulieferwaren im Inland hergestellt werden. Der kommende 14. Fünfjahresplan wird zahlreiche Vorgaben enthalten, die auf größere IT-Unabhängigkeit abzielen.
Chinas Elektronikeinzelhändler Suning.com hat den Verkauf von Aktien im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar angekündigt. Damit würde fast ein Viertel des Unternehmens an staatliche Unternehmen übergehen. Um Sunings Schuldendruck zu verringern, planten die staatlichen Unternehmen Shenzhen International Holdings Ltd. und Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co. 8 Prozent bzw. 15 Prozent der Suning-Aktien zu kaufen, teilte der Gerätehändler am Sonntag mit.
Suning.com verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns um 93 Prozent, nachdem man in den ersten sechs Monaten ohnehin herbe Verluste hinnehmen musste aufgrund der schwachen Nachfrage und der vorübergehenden Schließung von Geschäften während der Pandemie, berichtete Caixin.
Das Schuldenrisiko von Suning Appliance, dem Mutterkonzern von Suning.com, war in den Fokus gerückt, nachdem man der China Evergrande Group geholfen hatte, eine Liquiditätskrise zu vermeiden. So hatte Suning Appliance offenbar auf eine Rückzahlung von 20 Milliarden Yuan des Immobilienentwicklers Evergrande Group verzichtet, da Suning auch ein Evergrande-Zulieferer ist und befürchtet wird, dass ein Zusammenbruch von Evergrande auch Auswirkungen auf das eigene Geschäft haben könnte.
Am Sonntag wurde ebenfalls bekannt, dass Suning.com auch seine Aktivitäten beim chinesischen Fußballklub Jiangsu FC gänzlich einstellt. Der Verein konnte in der abgelaufenen Saison den Meistertiel der Chinese Super League gewinnen. Sunings Rückzug bei Jiangsu FC sorgt auch für Unsicherheit beim italienischen Fußballklub Inter Mailand. Im Jahr 2016 hatte Suning 70 Prozent des italienischen Traditionsvereins für 270 Millionen Euro (damals 306 Millionen US-Dollar). Seitdem hatte das Unternehmen sein Fußballimperium stetig erweitert, einschließlich eines 650-Millionen-Dollar-Deals für einen dreijährigen Fernsehvertrag mit der englischen Premier League mit dem digitalen Sender PPTV – einer Einheit von Suning Holdings Co. niw
Polen zieht den Kauf von in China produziertem Corona-Impfstoff in Betracht. Das Thema sei auf Ersuchen des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in einem Telefonat zwischen Polens Präsidenten Andrzej Duda und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping behandelt worden, hieß es in einer Mitteilung des polnischen Präsidialamtes. Demnach verständigten sich beide Staaten auf eine weitere Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie, bei der auch der Einsatz chinesischer Impfstoffe in Polen nicht ausgeschlossen wird.
Peking zeigte sich laut der Mitteilung offen dafür, Impfstoffe an Polen zu liefern. Um welchen Impfstoff es sich dabei potentiell handeln könnte, wurde nicht genannt. Die internationale Zusammenarbeit und Solidarität nähmen “eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen zur Überwindung” der Corona-Pandemie ein, betonte Polen nach dem Telefonat. Xi lud Duda während des Gesprächs der Mitteilung zufolge zudem zu einem Staatsbesuch in China ein.
Polen ist der zweite EU-Staat, der Interesse an dem Impfstoff aus China zeigt. In Ungarn ist das Vakzin von Sinopharm seit vergangener Woche im Einsatz. Auch der ungarische Premier Viktor Orbán erhielt nach eigenen Angaben am Sonntag den chinesischen Sinopharm-Impfstoff. Orbán veröffentlichte ein Foto von sich auf Facebook (siehe China.Table #29), das ihn bei der Impfung zeigt. Die ungarische Regulierungsbehörde hatte Ende Januar als erstes Land der Europäischen Union die Notfallgenehmigung zur Verwendung des chinesischen Covid-19-Impfstoffes erteilt. ari
China und die USA werden gemeinsam die G20 Sustainable Finance Study Group leiten. Die Gruppe wurde auf dem ersten Treffen der G20-Finanzminister und -Zentralbankgouverneure unter der italienischen G20-Präsidentschaft nach zwei Jahren Pause wieder ins Leben gerufen. Sie wird Maßnahmen und Pläne analysieren, um die Risiken des Klimawandels für das Finanzsystem zu minimieren. Das Gremium soll zudem die Offenlegung von klimabezogenen Unternehmensinformationen stärken.
Dazu gehören beispielsweise Informationen, wie sehr börsennotierte Unternehmen vom Klimawandel betroffen sind und, je nach Umfang der Offenlegungspflichten, auch die Frage, wie stark sich ihr Handeln auf den Klimawandel auswirkt. Auch soll die “grüne Transformation” des Wirtschafts- und Finanzsystems unterstützt werden. Li Shuo von Greenpeace Ostasien lobt die Zusammenarbeit zwischen den USA und China auf Twitter als “sinnvolle Strategie”.
Der Vorsitz der Gruppe wird unter Leitung der Zentralbank Chinas und des US-Finanzministeriums stehen. Ursprünglich war die Gruppe unter dem Namen Green Finance Study Group unter der chinesischen G20-Präsidentschaft im Dezember 2015 ins Leben gerufen worden. nib
Ausländische Journalisten beklagen in China einen “raschen Verfall der Pressefreiheit“. Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie, Einschränkungen bei den Einreisen und Einschüchterungen seien im vergangenen Jahr gezielt eingesetzt worden, um die Berichterstattung ausländischer Medien zu beschränken. Das teilte der Club der Auslandskorrespondenten in der Volksrepublik auf Basis von 150 Antworten einer Befragung an China-Korrespondenten am Montag in Peking mit. “Alle Gliederungen der Staatsmacht, inbegriffen jene zur Eindämmung des Coronavirus geschaffenen Überwachungssysteme, wurden genutzt, um Journalisten, ihre chinesischen Kollegen und ihre Interviewpartner zu drangsalieren und einzuschüchtern”, heißt es in der Stellungnahme.
“Vertreibungen sind der größte konkrete operative Erfolg”, sagte Jonathan Cheng, Chef des chinesischen Büros für das Wall Street Journal, zu den Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen Journalisten aus dem Ausland. “Ich habe diesen Job mit fünfzehn Reportern begonnen und wollte unser Büro erweitern. Jetzt sind wir nur noch vier vor Ort auf dem chinesischen Festland”, fügte Cheng hinzu.
Das dritte Jahr in Folge habe keiner der Korrespondenten oder Büroleiter erklärt, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessert hätten. Journalisten, die in der Provinz Xinjiang gearbeitet hätten, seien besonderen Schikanen ausgesetzt gewesen. Menschenrechtsgruppen werfen der chinesischen Regierung vor, beim Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren die Menschenrechte zu verletzen. rtr

Vertrauen, so Sabrina Weithmann, sei die Grundlage für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Weil es genau daran in deutsch-chinesischen Geschäftsbeziehungen noch hapert, hat sie Weithmann Consulting gegründet, ein unabhängiges Netzwerk interdisziplinärer China-Expertinnen und -Experten, die deutsche Unternehmen auf den chinesischen Markt vorbereiten wollen. “Misstrauen hat mit fehlender interkultureller Kompetenz zu tun”, so Weithmann, “man versteht die andere Kultur nicht, möchte sie vielleicht sogar nicht verstehen”. Die Folge seien negative Stereotype über “die Chinesen” und Konflikte. Mit Beratungen sowie Seminaren und Workshops möchte die 33-jährige das ändern. Denn China sei nicht nur Risiko, sondern wegen des riesigen Marktes und der Chancen internationaler Kooperationen auch Chance für deutsche Unternehmen.
Ihr Interesse für China entdeckte Sabrina Weithmann mit 15 Jahren während eines Austauschs in Australien. Unter chinesischen Eltern sei Australien ein beliebtes Land, um dort die Kinder zur Schule zu schicken. So kam es, dass Weithmann sich als einziges nicht-chinesischen Gastkind in einer australischen Familie wiederfand. “Bei uns wurde nicht Englisch, sondern Chinesisch gesprochen”, erzählt sie. Der anfängliche Kulturschock wich der Faszination und so war klar, “wenn ich die Sprache und das Land kennenlernen möchte, muss ich es studieren”. Gesagt getan: im Bachelor studierte sie Modern China, nach dem Master in Umweltwissenschaften in Hagen und International Management in Barcelona, folgte der PhD in China Business and Economics in Würzburg.
“Man ist sehr diplomatisch und oft in der Mediation, um beide Seiten zusammen zu bringen”, so Weithmann über ihre Arbeit bei Weithmann Consulting. Auch in der Zusammenarbeit mit Medien, die zu China publizieren, müsse man eine gewisse Vorsicht walten lassen. “Die Regierung versucht oft Einfluss zu nehmen“. Bei ihren Studierenden an der University for Applied Sciences in Aschaffenburg, wo sie als Professorin tätig ist, stellte sie immer wieder fest, dass Quellen genutzt würden, die von chinesischen Staatsmedien beeinflusst worden seien oder nicht richtig sind. “Es fehlt das Wissen, um die Inhalte kritisch hinterfragen zu können“.
Bereits in der Schule, so Weithmanns Kritik, würde viel zu wenig zu China unterrichtet. “China muss mehr Aufmerksamkeit bekommen”. Um Menschen, die sich für das Land interessieren, den Zugang zu Informationen zu erleichtern gründete sie 2018 die Plattform Chinalogue. In Blogposts, in einem Newsletter und in Podcasts kommt Weithmann dabei mit verschiedenen Menschen, die zu China arbeiten ins Gespräch. Mal geht es um Lobbying, mal um Journalismus, Rechtstaatlichkeit oder auch um chinesische Märchen. “In Medien wird oft vermittelt, China überrolle uns, wolle nur Böses”, sagt Weithmann. “Auch wenn Xi Jinping sicher nicht dazu beiträgt, dass wir uns mit China wohlfühlen, liegt der Fokus zu sehr auf dem Negativen”. Lisa Winter

Für ihren Film Nomadland hat die Regisseurin Chloé Zhao in der Nacht zum Montag den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das gab die Hollywood Foreign Press Association bekannt, die die Filmpreise vergibt. Zhao gewann den Golden Globe für die Beste Regie und die beste Produktion. Erst einmal (1984, Barbra Streisand) hat eine Frau den Preis in der Kategorie “Beste Regie” erhalten. Zhao wurde 1982 als 赵婷 Zhào Tíng in Peking geboren, sie arbeitet als Filmemacherin vor allem in den USA.
begleitet von einem bedrohlichen Polizeiaufgebot fand am Montag in Hongkong die Anhörung von 47 Oppositionellen statt. Die Botschaft aus Peking ist klar: Jeder Versuch einer Demokratisierung soll im Keim erstickt werden. Um das Sicherheitsgesetz durchzusetzen, stehen der Stadt für die nächsten zwei Jahre zusätzlich 850 Millionen Euro zur Verfügung, schreibt Marcel Grzanna. Woher das Geld stammt, darüber schweigen Honkongs Stadtobere.
Eines der großen Themen der kommenden Wochen wird zweifellos sein, welche konkreten wirtschaftspolitischen Entscheidungen die chinesische Regierung mit dem Ziel der “Dual Circulation” verbindet – und mit welchen Konsequenzen Investoren und Exporteure in Europa zu rechnen haben. Frank Sieren analysiert dieses und weitere wirtschaftspolitische Inhalte des 14. Fünfjahresplans vor dem Nationalen Volkskongress.
In Brüssel, schreibt Amelie Richter, erwarten die Experten erst einmal nichts Gutes von Pekings Plänen. Nach dem Volkskongress wird sich Europa der Aufgabe einer gemeinsamen China-Strategie stellen müssen – und darin auch über Strukturen einer punktuellen Zusammenarbeit, etwa im Klimabereich, nachdenken müssen.
Zu den Zielen chinesischer Politik gehört auch die Vergrößerung der Unabhängigkeit in wichtigen technologischen Bereichen. Da lassen Gerüchte über eine Fusion der staatseigenen China Electronics Technology Group (CETC) mit China Putian Information Industry Group (Potevio) aufhorchen. Finn Mayer-Kuckuk nimmt den entstehenden Elektronik-Giganten unter die Lupe.

Anfang März wird China beim Nationalen Volkskongress seinen 14. Fünfjahresplan verabschieden und damit die Weichen für die Jahre zwischen 2021 bis 2025 stellen.
Schon Ende Oktober 2020 hatte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei den Plan ausgearbeitet – und vor allem ein Stichwort fällt auf: “Dualer Kreislauf”.
Man kann diese “Dual Circulation”-Strategie als Antwort auf die von den USA vorgenommene technologische Entkoppelung von China verstehen. Auch unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden gilt es als wahrscheinlich, dass die Sanktionslisten bestehen bleiben werden.
Deshalb hält China es für sinnvoll, sich wirtschaftlich, technologisch und finanziell autarker zu machen.
Das bedeutet: Mehr eigene Technologie, mehr eigene Energieversorgung (Wind, Solar, Wasser) und vor allem mehr Binnenkonsum und weniger Handel, vor allem Exporte.
Zuerst zur Binnenwirtschaft. Das Ziel: Die eigene Wirtschaft noch effizienter machen. Die Staatsunternehmen sollen weiter saniert und unnachgiebig reformiert werden. Gleichzeitig soll aber auch der private Sektor ausgebaut werden, um den nationalen Wettbewerb zu erhöhen. Im vergangenen Herbst ließ die Regierung etwa eine Reihe von Staatsunternehmen gegen die Wand fahren, nachdem diese ihre Schuldenprobleme nicht mehr in den Griff bekamen.
Zudem sollen die Grundeigentumspolitik und das Hukou System liberalisiert werden. In diesem System wird der Wohnsitz geregelt, daran hängen verschiedene Rechte. Insgesamt soll das Sozialsystem weiter ausgebaut werden, damit die Menschen wirtschaftlich risikobereiter werden.
Kurz: Es sollen weitere Hürden aus dem Weg geräumt, die verhindern, dass die Menschen wirtschaftlich noch produktiver sind.
Gleichzeitig jedoch soll die Verschuldungsquote wieder runtergefahren werden. Darauf gab das Politbüro auf seiner Sitzung vom 26. Februar bereits einen entsprechenden Hinweis. Das Finanzministerium solle “proaktiv” eine “nachhaltigere Finanzpolitik” machen.
Vermutlich wird das Defizit am BIP wieder auf drei Prozent beschränkt, nachdem es im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie auf 3,7 Prozent gestiegen war.
Zudem wird erwartet, dass Peking die Emission von Spezialanleihen zur Finanzierung zurückfährt. Die Zentralregierung führte 2015 Spezialanleihen ein, die den Kommunalverwaltungen eine Finanzierungsquelle außerhalb des normalen Budgets eröffnete.
Eine derart nachhaltigere Infrastruktur hat wiederum auch Einfluss auf die Infrastrukturinvestitionen. Sie waren im vergangenen Jahr auf 3,7 Prozent des Sozialproduktes hochgefahren worden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nun werden sie voraussichtlich auf zwei Prozent reduziert. Ein Hinweis darauf, wohin die Reise mit dem neuen Fünfjahresplan gehen soll: keine maßlose Verschuldung.
Innerhalb der geringeren Investitionen wird es zudem eine deutliche Verschiebung in Richtung neuer Infrastruktur geben, also in Erneuerbare Energien, 5G-Netz und andere digitale Infrastrukturen. Die fünf größten genehmigten Projekte belaufen sich insgesamt auf 131,7 Milliarden US-Dollar. Der größte Anteil entfällt auf neue Zugstrecken, etwa zur stärkeren Vernetzung der Bay-Area-Metropolregion im Perlflussdelta. Es sind Investitionen, die kein Selbstzweck sind, sondern zum langfristigen Wirtschaftswachstum beitragen sollen. Ähnliches gilt für den Ausbau der Telekommunikationsnetze oder Erneuerbaren Energiequellen, etwa dem gigantischen Wasserkraftvorhaben am Fluss Yarlung Tsangpo in Tibet, wo Turbinen mit einer Rekordleistung von 60 Gigawatt installiert werden.
In den Bereichen des Handels, der sich nicht vollständig vermeiden lässt, geht es Peking darum, durch Diversifizierung eine zu große Abhängigkeit vom Westen zu verhindern.
Die Balance der Handelsströme soll aus dem Westen in Richtung Asien in die neue Freihandelszone RCEP verschoben werden. Dazu gehört, dass einfache Industrien mit geringer Wertschöpfung – zum Beispiel die Textilindustrie – in diese Regionen ausgelagert werden sollen. So schafft man einerseits zu Hause Raum für hochwertigere Produktion. Andererseits lässt man die einfachen Waren billiger in den Anrainerstaaten produzieren und transportiert sie dann zollfrei zurück in den eigenen Binnenmarkt. Bestenfalls ist die Produktion dann billiger als in China und schafft dennoch Gewinne und Arbeitsplätze für Schwellenländer wie Indonesien, Malaysia, Thailand, Philippinen und Vietnam.
Ausländische Firmen einzuladen mehr in China zu produzieren ist eine weitere Strategie. Damit wird die Wertschöpfung nach China verlagert.
Dies sind alles im Grunde keine neuen Entwicklungen. Sie haben jedoch angesichts des wachsenden Drucks aus den USA eine neue Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig wird die Verschiebung von Peking als Hebel benutzt, um Druck aufzubauen, eigene Reformen zügiger voranzutreiben.
Für deutsche Firmen wird es in kommenden fünf Jahren zwar noch lukrativer, in China zu investieren. Einfacher wird es jedoch nicht. Lukrativer, weil es nun einen großen Binnenmarkt gibt, den man mitversorgen kann. Nicht einfacher, weil die chinesischen Firmen immer mehr zum technologischen Wettbewerber werden und Marktanteile abgreifen.
Auch ein anderer Trend wird sich in diesem Zusammenhang fortsetzen: China wird weiterhin weniger im Westen investieren und gleichzeitig seine wirtschaftlichen Interessen offensiver vertreten.
Ein Instrument bei Meinungsverschiedenheiten könnten zum einen Klagen vor der WTO sein. Zum anderen ist es wahrscheinlich, dass China die eigene Marktmacht weiter ausnutzt, um seine Forderungen durchzudrücken. Denkbar wäre etwa, dass China den Export von Seltenen Erden noch strenger reglementiert, wenn China weiter von amerikanischen Chips oder anderen essentiellen Kern-Technologien abgeschnitten wird.
Innerhalb des chinesischen Binnenmarktes wird vor allem der E-Commerce-Sektor weiter ausgebaut, der durch die Corona-Epidemie ohnehin einen Schub bekommen hat. Peking ist bewusst, dass Chinas Wachstum in Zukunft mehr von Innovation und digitalem Produktivitätswachstum geprägt sein muss.
Dabei ist die Volksrepublik schon jetzt weit fortgeschritten. Die Marktforscher von eMarketer prognostizieren, dass China dieses Jahr 52,1 Prozent des Einzelhandelsumsatzes aus E-Commerce-Transaktionen erwirtschaften wird. Im Vorjahr waren es noch 44,8 Prozent. Damit wäre China das erste Land, das mehr Waren online als offline verkauft. Die USA kommen nur auf 15 Prozent, Südkorea auf 28,9 Prozent.
Peking wird mit seinem Fünfjahresplan eine deutliche Botschaft an die Europäische Union senden, was die internationalen Beziehungen angeht: Einmischung in innere Angelegenheiten nicht erwünscht. Beobachter in Brüssel erwarten denn auch scharfe Ansagen bezüglich Taiwan und Hongkong. Sie finden aber auch Bereiche, in welchen zusammengearbeitet werden kann.
Normalerweise wird in Chinas Fünfjahresplänen außenpolitischen Angelegenheiten nur wenig Platz eingeräumt. Dieses Mal aber wird neben der Bestätigung des Wirtschaftsmodells aber auch eine andere Sache weit oben auf der Agenda stehen, meint Alicia García-Herrero, Chefökonomin für den asiatisch-pazifischen Raum bei der französischen Investmentbank Natixis und Analystin des in Brüssel ansässigen Thinktank Bruegel: Ausländische Einflussnahme und wie damit umgegangen wird. “Ich erwarte einen sehr protektionistischen Fünfjahresplan“, sagt García-Herrero China.Table. Hinsichtlich Themen wie Taiwan und Hongkong werde es deutliche Ansagen in Richtung Brüssel geben.
Im Vorschlag des Zentralkomitees für den Fünfjahresplan finden sich derartige Ankündigungen bereits an mehreren Stellen: Die Volksrepublik “wird in höchster Alarmbereitschaft sein und die separatistischen Aktivitäten der ‘Unabhängigkeit Taiwans’ entschlossen eindämmen”, heißt es darin. Zudem werde “entschlossen gegen Eingriffe externer Kräfte in Hongkong und Macau” vorgegangen und diese unterdrückt werden. Dieses Narrativ werde auch beim am Freitag beginnenden Volkskongress weiter betont werden, so García-Herrero, die in Hongkong arbeitet.
Sie hoffe, dass die EU ohne Naivität auf die Ansagen aus Peking blicken werde: “Ich hoffe, wir betrachten diesen Fünfjahresplan und sehen wirklich, wohin die Ausrichtung zeigt, und das ist in Richtung vollständiger Eigenständigkeit.” Ankündigungen für eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes für ausländische Unternehmen und Investitionen erwartet die Analystin nicht. Da man sich bereits auf das Investitionsabkommen zwischen China und der EU geeinigt habe, gebe es derzeit für Peking keine Gründe weitere Öffnungen “anzubieten”, sagt García-Herrero.
Gerade die deutsche Industrie sollte angesichts der wirtschaftlichen Leitlinien des 14. Fünfjahresplans sehr hellhörig werden, warnt die Analystin. Die Ankündigungen bezüglich der Dual-Circulation-Strategie, der Ziele bei der Innovationsfähigkeit und der Technologie-Unabhängigkeit bedeuten nichts Gutes für die Deutschen: Dass deutsche Unternehmen in den im Plan skizzierten Markt exportieren und Geld verdienen werden, sei eine “riesige Illusion”, so García-Herrero.
Die Europäische Kommission hat ihre gemeinsame China-Politik zuletzt im März 2019 neu definiert. Die Brüsseler Behörde bezeichnete damals China erstmals als “systematischen Rivalen”. Für das EU-Ratstreffen Ende dieses Monats wird Brüsseler Quellen zufolge ein Fortschrittsbericht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über die Beziehungen zu China erwartet. Zuletzt war aus Brüssel vermehrt Kritik am Vorgehen Pekings in Hongkong zu hören. Das Europaparlament hat in mehreren Resolutionen direkte Sanktionen für Verantwortliche gefordert. Neben Hongkong verschärfte sich zudem der Ton auch in Bezug auf Berichte über Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang.
“Wir werden die Banner des Friedens, der Entwicklung, der Zusammenarbeit und der Win-Win-Situation hochhalten,” heißt es hingegen im Vorschlags-Papier des Zentralkomitees. Es solle an “einer unabhängigen Außenpolitik des Friedens” festgehalten und an der Zusammenarbeit mit anderen Großmächten (大 国) gearbeitet werden. Auch dem Multilateralismus und der Einhaltung des Völkerrechts wird zugesprochen.
Trotz aller Differenzen ergeben sich aber auch Bereiche einer möglichen Zusammenarbeit angesichts der vorgeschlagenen Ziele des neuen Fünfjahresplans und der strategischen Aussichten der EU: Einer der wichtigsten Punkte sei die Klimapolitik, sagt Dharmendra Kanani, Direktor der Brüsseler Denkfabrik Friends of Europe. Die EU wie auch China planten, Milliarden in grüne Technologien, grüne Finanzen und in neue Lösungen zur Förderung der Nachhaltigkeit zu investieren, betont Kanani. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich könnte Innovationen fördern, von denen beide Partner und auch Drittländer profitierten. Sowohl die EU als auch China haben sich verpflichtet, bis 2050 beziehungsweise 2060 klimaneutral zu werden.
Ein weiteres Feld der Kooperation ist Kanani zufolge angesichts der Corona-Pandemie auch die gemeinsame Entwicklung neuer Impftechnologien. Kanani betont, dass der Fünfjahresplan nicht nur als Kampfansagen verstanden werden dürfe. Er spricht sich zudem für eine engere Zusammenarbeit im Innovationssektor aus.
Neben dem Klimawandel stehen noch weitere geteilte Probleme auf den jeweiligen Agenda der Volksrepublik und der Europäischen Union: Sowohl China als auch die meisten EU-Länder müssen die Alterung der Bevölkerung und die nachhaltige Entwicklung ländlicher Gebiete im Auge behalten.
Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften hat am Montag die Anhörung von 47 pro-demokratischen Politikern und Aktivisten vor einem Gericht in Hongkong begleitet. Vor dem Gebäude in West-Kowloon auf dem Festland hatten sich am Vormittag Hunderte Menschen versammelt, die ihre Solidarität mit den Angeklagten durch Sprechchöre und Banner bekundeten und auf Zugang zu der Anhörung hofften.
Zahlreiche Menschen waren in schwarzer Kleidung vor dem Gericht erschienen und symbolisierten damit ihre Unterstützung für Hongkongs Protestbewegung, die im Sommer 2019 begonnen hatte und von den Behörden zum Teil mit großer Brutalität niedergeschlagen worden war. Viele Demonstranten streckten sechs Finger in die Luft als Zeichen für den zentralen Slogan der Proteste, “Fünf Forderungen – nicht eine weniger”.
Die Polizei warnte die Unterstützer vor möglichen Verstößen gegen das neue Sicherheitsgesetz, das eine Strafverfolgung von oppositionellen Versammlungen in der Stadt seit Mitte vergangenen Jahres maßgeblich erleichtert. Verhaftungen vor Ort blieben bis zum Abend jedoch aus, obwohl die Polizei von einer “gesetzeswidrigen Versammlung” sprach. Deren Teilnehmer fügten sich jedoch den Anordnungen und vermieden eine Eskalation.
Mehrere ausländische Diplomaten, darunter auch deutsche Vertreter, waren ebenfalls zum Gericht gekommen, um ein Signal zu senden, dass die juristische Auslegung des Sicherheitsgesetzes in Europa und Nordamerika sehr genau beobachtet wird. Im Gegensatz zu einigen Vertretern der Protestbewegung war jedoch kein Diplomat im Gerichtssaal anwesend. “In Hongkong ist es nicht üblich, die Teilnahme an Gerichtsverfahren formal anzukündigen. Wegen des großen Andrangs und begrenzter Raumkapazitäten haben die anwesenden diplomatischen Vertreter den Unterstützern der Protestbewegung den Vortritt gelassen“, teilte das Auswärtige Amt in Berlin dem China.Table mit.
Die EU-Vertretung vor Ort brachte in einer Stellungnahme “große Sorge” über die Anklage zum Ausdruck. “Das Wesen dieser Anklage verdeutlicht, dass legitimer politischer Pluralismus in Hongkong nicht länger toleriert wird”, heißt es dort. Die EU erinnerte die Behörden an ihre Zusage, die Prinzipien von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu befolgen, die in Hongkongs Basic Law, einer Art Verfassung der Stadt, festgeschrieben sind, und forderte die sofortige Freilassung der 47 Inhaftierten.
US-Außenminister Anthony Blinken schrieb auf Twitter: “Die umfangreichen Verhaftungen pro-demokratischer Demonstranten sind ein Angriff auf diejenigen, die sich mutig für universelle Rechte einsetzen. Die Biden-Harris-Regierung wird an der Seite der Menschen in Hongkong und gegen Pekings Maßregelung der Demokratie stehen“, Sein britischer Amtskollege Dominic Raab bewertete die Anklage als “zutiefst verstörend”. Sie zeige, dass das Sicherheitsgesetz vornehmlich dazu benutzt würde, politischen Dissens zu eliminieren, statt die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen, wie es sowohl von Seiten der Hongkonger Regierung als auch aus Peking formuliert wird. Das Sicherheitsgesetz wurde im Juli 2020 durch den Ständigen Ausschuss des National Volkskongresses implementiert.
Die Ereignisse im und vor dem Gerichtssaal versinnbildlichten auf zweierlei Weise die politische Richtung, in die sich die Stadt bewegt. Drinnen mussten sich Dutzende Lokalpolitiker gegen den Vorwurf verteidigen, die Staatsgewalt untergraben zu haben, obwohl sie lediglich ihre einst zugesicherten demokratischen Rechte ausübten. Draußen machten die Behörden derweil deutlich, dass sie jeden Widerstand im Keim ersticken wollen. Zumal die Sicherheitskräfte künftig deutlich mehr Geld zur Verfügung haben, um die Vorgaben durchzusetzen.
In der vergangenen Woche hatte die Regierung ihren Haushaltsplan
vorgestellt, inklusive einer erheblichen finanziellen Aufstockung der Ausgaben für die innere Sicherheit. Für das Geschäftsjahr 2021/22 werden acht Milliarden Hongkong Dollar, umgerechnet rund 850 Millionen Euro, als “einmalige Mittelzuweisung an einen Spezialfonds zur Deckung der Ausgaben für die Wahrung der nationalen Sicherheit” veranschlagt. Finanziert werden sollen damit unter anderem eine neue Sicherheitseinheit innerhalb der Polizeikräfte, ein Sicherheitsbüro, das nicht der örtlichen Rechtssprechung unterliegt, sowie eine Abteilung im Justizministerium, die sich auf Anklagen bei Verstößen gegen das Sicherheitsgesetz konzentrieren soll.
Trotz der bemerkenswert hohen Summe für den Fond, die zu den üblichen Kosten für innere Sicherheit in Hongkong noch hinzu addiert wird, gab Hongkongs Finanzchef Paul Chan der Öffentlichkeit nicht preis, woher das Geld stammt, das nun verwendet werden soll. Chan hatte bei der öffentlichen Vorstellung des Haushaltsberichts den neuen Posten im Haushaltsplan, der nur im Anhang explizit aufgelistet wird, anfangs gar nicht erwähnt, sondern bezog erst auf Nachfrage Stellung dazu. Kritiker der Hongkonger Regierung erkennen darin ihren Versuch, nicht mehr Aufmerksamkeit als unbedingt nötig für die Bereitstellung des Geldes zu provozieren und vermuten, dass es direkt aus Peking stammt.
Die Vermutung liegt deshalb nah, weil auch die Auslegung des Sicherheitsgesetzes vor Hongkonger Gerichten mit deutlichen Forderungen aus Peking begleitet wird. Beispielsweise hatte der für Hongkong und Macau zuständige Pekinger Funktionär Xia Baolong Ende Februar gesagt, dass Angeklagte wie der Verleger Jimmy Lai, der Aktivist Joshua Wong und der Organisator der inoffiziellen Vorwahlen zum
Legislativrat, Benny Tai, unter Anwendung des neuen Gesetzes “streng
bestraft” werden müssten, ohne den Verlauf weiterer Gerichtsprozesse abzuwarten. Chinesische Medien formulieren derweil schon seit Monaten scharf die Erwartungshaltung der Volksrepublik an die örtlichen Richter.
Während Jimmy Lai und Joshua Wong bereits inhaftiert waren, musste sich Benny Tai wie die meisten der 46 anderen am vergangenen Sonntag bei der Polizei melden, um sich in Haft zu begeben, ehe sie am Montag vor das Gericht traten. Tai gehört zu einer Gruppe von insgesamt über 50 Politikern und Aktivisten, die im vergangenen Sommer die Vorwahlen organisiert und durchgeführt hatten. Ziel war es, jene Kandidaten herauszufiltern, denen die besten Chancen eingeräumt wurden, einen Sitz in dem 70-köpfigen Gremium zu gewinnen. Die Opposition erhoffte sich dadurch die Chance auf eine Mehrheit im Legislativrat.
Das Basic Law sieht vor, dass der Rat den Haushaltsplan der Hongkonger Regierung ablehnen kann. Sollte es soweit kommen, könnte Regierungschefin Carrie Lam das Gremium auflösen. Sollte auch ein neu gewählter Legislativrat den Haushalt ablehnen, müsste Lam zurücktreten. Dieses Szenario galt als eines der letzten Werkzeuge der demokratischen Parlamentarier der Stadt, um auf die politischen Rahmenbedingungen in der Stadt prägnant Einfluss zu nehmen. Die Wahlen waren allerdings in den Herbst dieses Jahres verlegt worden. Offiziell geschah das wegen der Corona-Pandemie. Oppositionspolitiker glauben jedoch, dass die Hongkonger Regierung sich Zeit verschaffen wollte, um bis zur Neuansetzung der Wahl die Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten zu modellieren. Die Anklage am Montag und mögliche Verurteilungen zu Haftstrafen würde die verbliebene Opposition in der Stadt noch weiter schwächen.
Die Fusion der China Electronics Technology Group (CETC) mit China Putian Information Industry Group (Potevio) ist zwar noch nicht offiziell besiegelt, doch chinesische Medien stellen die Zusammenlegung nach den ersten Ankündigungen bereits als Fakt dar. Der Schritt würde auf jeden Fall in die derzeitige Regierungsstrategie passen. Die Schaffung eines Technik-Giganten mit eigener Chipherstellung und einem Fokus auf Militär– und Überwachungstechnik würde diese Branchen vom Ausland unabhängiger machen. Es entstünde die drittgrößte chinesische Technikfirma hinter Lenovo und Huawei.
Beide Fusionspartner gehören zur chinesischen “Nationalmannschaft” aus Staatsbetrieben unter Kontrolle der Zentralregierung. Sie kommen zusammen auf knapp 50 Milliarden Euro Umsatz und spielen somit in einer Liga mit beispielsweise Bayer. Ein vom Profil her ähnliches Unternehmen gibt es in Deutschland nicht. So beliefern beispielsweise Jenoptik oder Diehl auch Rüstungshersteller mit optischen und elektronischen Bauteilen, aber natürlich in viel kleinerem Maßstab. Von Größe und Produktpalette her zum Teil vergleichbar wären eher Lockheed Martin, General Dynamics oder Raytheon aus den USA.
In Chinas Industriekreisen heißt das neue Konglomerat bereits scherzhaft der “Big Mac” oder der “Gigant”, weil die Wirtschaftsplaner hier zwei ohnehin große Unternehmen zu einem neuen Marktführer zusammenschrauben. Die Idee dazu dürfte während des Handelskriegs mit den USA gereift sein. Ein Tochterunternehmen von CETC war bereits direkt von Sanktionen der Trump-Regierung betroffen: Hikvision stellt Überwachungskameras her, die auch in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang zum Einsatz kommen, um Uiguren zu überwachen. Tatsächlich ist Hikvision auch eng mit der Volksbefreiungsarmee verbandelt und liefert wohl Optiken und Kameras für eine ganze Reihe von Anwendungen.
Potevio ist ein Dachunternehmen für die ehemaligen Ausrüstungssparten verschiedener regionaler Telefongesellschaften, die unter dem Ministerium für Post und Fernmeldewesen angesiedelt waren. In den Achtzigerjahren haben seine Vorgängerunternehmen also Telefone, Kabel, Relais und dergleichen hergestellt. Noch heute heißen die Tochterfirmen der Holding beispielsweise Shanghai Putian oder Chengdu Putian. Der Schwerpunkt liegt weiter bei Netzausrüstung. Als kleinerer Partner wird Potevio in CETC aufgehen.
CETC ist im Gesamtbild in erster Linie ein Militärzulieferer. Die Gruppe stellt beispielsweise Radar- und Zielerfassungssysteme her. Das Unternehmen ist auch ein weltweiter Vorreiter beim Bau vollständig autonomer Drohnen, denen die Operateure nur das Einsatzziel vorgeben müssen. Die Drohnen suchen sich als Schwarm ihren Weg und zerstören das Ziel selbständig. Militärexperten sehen im massenhaften Einsatz von billig produzierten, intelligenten Killer-Robotern in der Luft, am Boden und im Wasser die Zukunft der Kriegsführung.
Diese für die Zukunft der Menschheit wenig erbauliche Aussicht zieht erhebliche industriepolitische Schlussfolgerungen nach sich. Völlige Unabhängigkeit in der Lieferkette bis hinunter zur kleinsten Komponente ist damit eine Frage nationaler Sicherheit, für die kein Preis zu hoch ist. Das betrifft in erster Linie die Chips. Die Fusion hat daher den Nebeneffekt, mehr Versorgungssicherheit bei Halbleitern herzustellen. Chips gehören bei beiden Partnern zum Produktangebot. Von den gesicherten Abnahmemengen des chinesischen Regierungskonzerns kann Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei seinem Vorhaben, mehr Elektroindustrie nach Deutschland zurückzuholen, nur träumen.
Neben dem Big-Mac-Vergleich kursiert noch ein zweites Schlagwort für die Mega-Fusion: es entstehe Chinas “IT-Flugzeugträger”. China baut gerade eine Flotte von Flugzeugträgern auf und hat bereits zwei der strategisch wichtigen Schiffe. Auch sie symbolisieren den Aufstieg Chinas an die Weltspitze der Militärtechnik, so wie die Drohnenschwärme von CETC. Das Konglomerat soll nun möglichst unbesiegbar werden – auch im Fall eines Handelskriegs um Steuerchips.
Die Fusion passt auch zu Chinas Strategie der “Dual Circulation”. Diese sieht unter anderem vor, dass mehr wichtige Zulieferwaren im Inland hergestellt werden. Der kommende 14. Fünfjahresplan wird zahlreiche Vorgaben enthalten, die auf größere IT-Unabhängigkeit abzielen.
Chinas Elektronikeinzelhändler Suning.com hat den Verkauf von Aktien im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar angekündigt. Damit würde fast ein Viertel des Unternehmens an staatliche Unternehmen übergehen. Um Sunings Schuldendruck zu verringern, planten die staatlichen Unternehmen Shenzhen International Holdings Ltd. und Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co. 8 Prozent bzw. 15 Prozent der Suning-Aktien zu kaufen, teilte der Gerätehändler am Sonntag mit.
Suning.com verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns um 93 Prozent, nachdem man in den ersten sechs Monaten ohnehin herbe Verluste hinnehmen musste aufgrund der schwachen Nachfrage und der vorübergehenden Schließung von Geschäften während der Pandemie, berichtete Caixin.
Das Schuldenrisiko von Suning Appliance, dem Mutterkonzern von Suning.com, war in den Fokus gerückt, nachdem man der China Evergrande Group geholfen hatte, eine Liquiditätskrise zu vermeiden. So hatte Suning Appliance offenbar auf eine Rückzahlung von 20 Milliarden Yuan des Immobilienentwicklers Evergrande Group verzichtet, da Suning auch ein Evergrande-Zulieferer ist und befürchtet wird, dass ein Zusammenbruch von Evergrande auch Auswirkungen auf das eigene Geschäft haben könnte.
Am Sonntag wurde ebenfalls bekannt, dass Suning.com auch seine Aktivitäten beim chinesischen Fußballklub Jiangsu FC gänzlich einstellt. Der Verein konnte in der abgelaufenen Saison den Meistertiel der Chinese Super League gewinnen. Sunings Rückzug bei Jiangsu FC sorgt auch für Unsicherheit beim italienischen Fußballklub Inter Mailand. Im Jahr 2016 hatte Suning 70 Prozent des italienischen Traditionsvereins für 270 Millionen Euro (damals 306 Millionen US-Dollar). Seitdem hatte das Unternehmen sein Fußballimperium stetig erweitert, einschließlich eines 650-Millionen-Dollar-Deals für einen dreijährigen Fernsehvertrag mit der englischen Premier League mit dem digitalen Sender PPTV – einer Einheit von Suning Holdings Co. niw
Polen zieht den Kauf von in China produziertem Corona-Impfstoff in Betracht. Das Thema sei auf Ersuchen des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in einem Telefonat zwischen Polens Präsidenten Andrzej Duda und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping behandelt worden, hieß es in einer Mitteilung des polnischen Präsidialamtes. Demnach verständigten sich beide Staaten auf eine weitere Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie, bei der auch der Einsatz chinesischer Impfstoffe in Polen nicht ausgeschlossen wird.
Peking zeigte sich laut der Mitteilung offen dafür, Impfstoffe an Polen zu liefern. Um welchen Impfstoff es sich dabei potentiell handeln könnte, wurde nicht genannt. Die internationale Zusammenarbeit und Solidarität nähmen “eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen zur Überwindung” der Corona-Pandemie ein, betonte Polen nach dem Telefonat. Xi lud Duda während des Gesprächs der Mitteilung zufolge zudem zu einem Staatsbesuch in China ein.
Polen ist der zweite EU-Staat, der Interesse an dem Impfstoff aus China zeigt. In Ungarn ist das Vakzin von Sinopharm seit vergangener Woche im Einsatz. Auch der ungarische Premier Viktor Orbán erhielt nach eigenen Angaben am Sonntag den chinesischen Sinopharm-Impfstoff. Orbán veröffentlichte ein Foto von sich auf Facebook (siehe China.Table #29), das ihn bei der Impfung zeigt. Die ungarische Regulierungsbehörde hatte Ende Januar als erstes Land der Europäischen Union die Notfallgenehmigung zur Verwendung des chinesischen Covid-19-Impfstoffes erteilt. ari
China und die USA werden gemeinsam die G20 Sustainable Finance Study Group leiten. Die Gruppe wurde auf dem ersten Treffen der G20-Finanzminister und -Zentralbankgouverneure unter der italienischen G20-Präsidentschaft nach zwei Jahren Pause wieder ins Leben gerufen. Sie wird Maßnahmen und Pläne analysieren, um die Risiken des Klimawandels für das Finanzsystem zu minimieren. Das Gremium soll zudem die Offenlegung von klimabezogenen Unternehmensinformationen stärken.
Dazu gehören beispielsweise Informationen, wie sehr börsennotierte Unternehmen vom Klimawandel betroffen sind und, je nach Umfang der Offenlegungspflichten, auch die Frage, wie stark sich ihr Handeln auf den Klimawandel auswirkt. Auch soll die “grüne Transformation” des Wirtschafts- und Finanzsystems unterstützt werden. Li Shuo von Greenpeace Ostasien lobt die Zusammenarbeit zwischen den USA und China auf Twitter als “sinnvolle Strategie”.
Der Vorsitz der Gruppe wird unter Leitung der Zentralbank Chinas und des US-Finanzministeriums stehen. Ursprünglich war die Gruppe unter dem Namen Green Finance Study Group unter der chinesischen G20-Präsidentschaft im Dezember 2015 ins Leben gerufen worden. nib
Ausländische Journalisten beklagen in China einen “raschen Verfall der Pressefreiheit“. Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie, Einschränkungen bei den Einreisen und Einschüchterungen seien im vergangenen Jahr gezielt eingesetzt worden, um die Berichterstattung ausländischer Medien zu beschränken. Das teilte der Club der Auslandskorrespondenten in der Volksrepublik auf Basis von 150 Antworten einer Befragung an China-Korrespondenten am Montag in Peking mit. “Alle Gliederungen der Staatsmacht, inbegriffen jene zur Eindämmung des Coronavirus geschaffenen Überwachungssysteme, wurden genutzt, um Journalisten, ihre chinesischen Kollegen und ihre Interviewpartner zu drangsalieren und einzuschüchtern”, heißt es in der Stellungnahme.
“Vertreibungen sind der größte konkrete operative Erfolg”, sagte Jonathan Cheng, Chef des chinesischen Büros für das Wall Street Journal, zu den Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen Journalisten aus dem Ausland. “Ich habe diesen Job mit fünfzehn Reportern begonnen und wollte unser Büro erweitern. Jetzt sind wir nur noch vier vor Ort auf dem chinesischen Festland”, fügte Cheng hinzu.
Das dritte Jahr in Folge habe keiner der Korrespondenten oder Büroleiter erklärt, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessert hätten. Journalisten, die in der Provinz Xinjiang gearbeitet hätten, seien besonderen Schikanen ausgesetzt gewesen. Menschenrechtsgruppen werfen der chinesischen Regierung vor, beim Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren die Menschenrechte zu verletzen. rtr

Vertrauen, so Sabrina Weithmann, sei die Grundlage für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Weil es genau daran in deutsch-chinesischen Geschäftsbeziehungen noch hapert, hat sie Weithmann Consulting gegründet, ein unabhängiges Netzwerk interdisziplinärer China-Expertinnen und -Experten, die deutsche Unternehmen auf den chinesischen Markt vorbereiten wollen. “Misstrauen hat mit fehlender interkultureller Kompetenz zu tun”, so Weithmann, “man versteht die andere Kultur nicht, möchte sie vielleicht sogar nicht verstehen”. Die Folge seien negative Stereotype über “die Chinesen” und Konflikte. Mit Beratungen sowie Seminaren und Workshops möchte die 33-jährige das ändern. Denn China sei nicht nur Risiko, sondern wegen des riesigen Marktes und der Chancen internationaler Kooperationen auch Chance für deutsche Unternehmen.
Ihr Interesse für China entdeckte Sabrina Weithmann mit 15 Jahren während eines Austauschs in Australien. Unter chinesischen Eltern sei Australien ein beliebtes Land, um dort die Kinder zur Schule zu schicken. So kam es, dass Weithmann sich als einziges nicht-chinesischen Gastkind in einer australischen Familie wiederfand. “Bei uns wurde nicht Englisch, sondern Chinesisch gesprochen”, erzählt sie. Der anfängliche Kulturschock wich der Faszination und so war klar, “wenn ich die Sprache und das Land kennenlernen möchte, muss ich es studieren”. Gesagt getan: im Bachelor studierte sie Modern China, nach dem Master in Umweltwissenschaften in Hagen und International Management in Barcelona, folgte der PhD in China Business and Economics in Würzburg.
“Man ist sehr diplomatisch und oft in der Mediation, um beide Seiten zusammen zu bringen”, so Weithmann über ihre Arbeit bei Weithmann Consulting. Auch in der Zusammenarbeit mit Medien, die zu China publizieren, müsse man eine gewisse Vorsicht walten lassen. “Die Regierung versucht oft Einfluss zu nehmen“. Bei ihren Studierenden an der University for Applied Sciences in Aschaffenburg, wo sie als Professorin tätig ist, stellte sie immer wieder fest, dass Quellen genutzt würden, die von chinesischen Staatsmedien beeinflusst worden seien oder nicht richtig sind. “Es fehlt das Wissen, um die Inhalte kritisch hinterfragen zu können“.
Bereits in der Schule, so Weithmanns Kritik, würde viel zu wenig zu China unterrichtet. “China muss mehr Aufmerksamkeit bekommen”. Um Menschen, die sich für das Land interessieren, den Zugang zu Informationen zu erleichtern gründete sie 2018 die Plattform Chinalogue. In Blogposts, in einem Newsletter und in Podcasts kommt Weithmann dabei mit verschiedenen Menschen, die zu China arbeiten ins Gespräch. Mal geht es um Lobbying, mal um Journalismus, Rechtstaatlichkeit oder auch um chinesische Märchen. “In Medien wird oft vermittelt, China überrolle uns, wolle nur Böses”, sagt Weithmann. “Auch wenn Xi Jinping sicher nicht dazu beiträgt, dass wir uns mit China wohlfühlen, liegt der Fokus zu sehr auf dem Negativen”. Lisa Winter

Für ihren Film Nomadland hat die Regisseurin Chloé Zhao in der Nacht zum Montag den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das gab die Hollywood Foreign Press Association bekannt, die die Filmpreise vergibt. Zhao gewann den Golden Globe für die Beste Regie und die beste Produktion. Erst einmal (1984, Barbra Streisand) hat eine Frau den Preis in der Kategorie “Beste Regie” erhalten. Zhao wurde 1982 als 赵婷 Zhào Tíng in Peking geboren, sie arbeitet als Filmemacherin vor allem in den USA.