noch nie wurden Frauenrechte in China so öffentlich diskutiert wie heute. Fernsehsendungen und Popsongs setzen sich mit Gleichstellungsfragen und häuslicher Gewalt auseinander. In sozialen Netzwerken kochen regelmäßig die Emotionen hoch, wenn Frauen im noch immer patriarchalisch geprägten Land zum Kinderkriegen gedrängt werden – und sich ansonsten ruhig verhalten sollen. Der Staat hat noch keine klare Linie gefunden, wie er mit dem Unmut der zumeist jungen Frauen umgehen soll. Entgegenkommen und Repressalien halten sich noch die Waage. Wir blicken anlässlich von Fällen wie Peng Shuai und einer angeketteten Frau heute näher auf das Thema.
Zwischen Russland und China beobachten wir derzeit eine Annäherung – und das nicht nur auf der Erde, etwa beim olympischen Händeschütteln zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin. Die Partnerschaft erstreckt sich bis ins All. Noch in diesem Jahrzehnt wollen die beiden Länder mit dem Bau einer gemeinsamen Raumstation auf dem Mond beginnen. Für Moskau und Peking geht es dabei vor allem ums Prestige. Man will die Amerikaner, die ebenfalls neue Mondmissionen planen, so schnell wie möglich abhängen. Ein neues Wettrennen im Weltraum hat begonnen. Der Erdtrabant ist dabei nur der erste Stopp.

Im Januar 2021 wurde die chinesische Stand-Up-Komikerin Yang Li schlagartig für ihren Ausspruch berühmt, Männer seien “普確信” Pǔ quèxìn: “mittelmäßig, aber selbstbewusst”. Auf Chinas Social-Media-Plattformen wurde der Satz innerhalb weniger Stunden zur feministischen Parole. Gleichzeitig brach ein Shitstorm über Li herein, der sie auch einige Werbeverträge kostete. Der Tenor: Li würde mit ihrer Comedy “Männerhass” schüren. Auch sonst kochen beim Thema Gleichberechtigung in China die Gemüter schnell hoch. Zuletzt sorgte der Fall einer von ihrem Ehemann angeketteten, psychisch kranken Frau in der Stadt Xuzhou für landesweite Empörung. Frauen würden oft nicht einmal als menschliche Wesen behandelt, las man in Kommentarspalten von chinesischen Social-Media-Kanälen wie Weibo.
Noch nie wurden Geschlechterdebatten und Gleichstellungsfragen in China so öffentlich verhandelt wie in den vergangenen drei Jahren. Wie in westlichen Ländern werden Gewissheiten in Zweifel gezogen. Feministisch angehauchte Fernsehshows wie “Hear Her” 听见她说” kritisieren ungesunde Schönheitsideale und verzerrte Selbstwahrnehmungen junger Frauen. Die Popsängerin Tan Weiwei adressierte in ihrem Lied “Xiǎo juān 小娟” reale Fälle häuslicher Gewalt, während sich die Rapperin Yamy auf ihrem Weibo-Kanal offen über sexuelle Belästigung im chinesischen Showbusiness echauffierte.
Feminismus ist heute zu einem gewissen Grad Teil der chinesischen Popkultur. Die Künstlerinnen bewegen sich jedoch auf einem schmalen Grat. Die chinesische Regierung bewertet eine feministische Massenbewegung als Gefahr für die soziale Stabilität. Insbesondere die unter dem Hashtag “MeToo” um die Welt gegangene Solidaritätswelle mit Opfern von Missbrauch und Übergriffen bezeichnet Peking als “Werkzeug ausländischer Kräfte”, mit dem das chinesische System unterwandert werden soll.
Als die Bewegung in China Anfang 2018 an Fahrt aufnahm, nachdem eine ehemalige Studentin der Shanghai University of Finance and Economics einen Professor beschuldigt hatte, sie sexuell belästigt zu haben, löschten die Zensoren binnen weniger Wochen reihenweise Social-Media-Accounts bekannter Feministinnen und feministische Diskussionsgruppen. Der bekannteste “MeToo”-Fall um die Tennisspielerin Peng Shuai hat Chinas Mächtigen dann noch einmal klargemacht, wie schnell Anschuldigungen der sexuellen Belästigung zur Staatsaffäre ausarten können.
Um die Gemüter abzukühlen und das Gleichstellungs-Narrativ nicht dem Volk zu überlassen, hat Chinas Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses Ende Dezember eine Überarbeitung des chinesischen Frauenrechtsgesetzes vorgelegt. Der Entwurf, der auf dem 1992 verabschiedeten und 2005 zum letzten Mal überarbeiteten Gesetz zum Schutz der Rechte und Interessen der Frau (LPWRI) basiert, sieht unter anderem vor, dass Arbeitgeber weibliche Bewerber in Einstellungsgesprächen nicht mehr nach ihrem Heiratsstatus oder Kinderwunsch fragen dürfen – eine in China nach wie vor gängige Praxis.
Auch wird erstmals in einem chinesischen Gesetz versucht, eine klare Definition für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorzulegen. Diese beinhaltet nicht nur körperliche Übergriffe, sondern auch verbale und nonverbale Anzüglichkeiten sowie das Verbreiten privater Bilder und Dateien. Unternehmen und Bildungseinrichtungen werden angehalten, Verantwortliche auszubilden, die die Regelungen durchsetzen und Workshops zum Thema anbieten. Dazu sollen Hotlines und Postfächer eingerichtet werden, um Fälle sexueller Belästigung zu melden.
Insgesamt enthält der Entwurf Überarbeitungen von 48 Paragrafen und 24 neue Ergänzungen. Bis zur endgültigen Verabschiedung im nächsten Jahr muss er noch zwei weitere Prüfungen durchlaufen. Ein Beitrag des staatlichen Fernsehsenders CCTV feiert das Update schon jetzt als großen Meilenstein für Chinas Frauen. In chinesischen Online-Foren löste die Ankündigung dagegen einen regelrechten Geschlechterkampf aus. Zahlreiche User:innen erklärten, das geplante Gesetz benachteilige Männer. Andere schrieben, das Gesetz rühre nicht an die Wurzel des Problems: Die tief verankerten patriarchalen Strukturen in China.
Zu den Kritikerinnen des Gesetzes gehört Eloise Fan. Die 29-jährige Feministin arbeitet seit acht Jahren in der Werbeindustrie in Shanghai und betreibt nebenher das Musiklabel Scandal, das feministischen Künstlerinnen eine Plattform bieten will. “Es braucht noch viel mehr Schritte, um das toxische Umfeld, in dem Chinas Frauen sich bewegen, von Grund auf zu verändern”, sagt sie gegenüber China.Table. Trotz ihrer Stellung als Creative Director erlebe sie am Arbeitsplatz immer wieder Sexismus, vor allem durch direkte Vorgesetzte, die anzügliche oder frauenverachtende Kommentare von sich geben oder weibliche Angestellte von wichtigen Entscheidungsprozessen ausschließen. Ihre eigenen Ideen würden oft als “zu feministisch” abgelehnt, sagt Fan. “Meine langjährigen Erfahrungen in der Industrie haben mir gezeigt, dass auch ein Jobwechsel daran nichts ändern wird.”
China hat grundsätzlich eine gute Ausgangsposition für Gleichstellung im Wirtschaftsleben: Der Anteil der weiblichen Erwerbstätigen lag in China laut Zahlen der Weltbank im Jahr 2019 bei 43,7 Prozent – so hoch wie in keinem anderen Land des Asien-Pazifik-Raums. Doch der nähere Blick auf die Zahlen offenbart dann doch erhebliche Geschlechterunterschiede. Zwar gibt es nirgends auf der Welt so viele Milliardärinnen wie in China, für die gleiche Arbeit bei vergleichbarer Qualifikation und Erfahrung verdienen Frauen aber immer noch durchschnittlich 36 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
Zwischen 2008 und 2021 ist die Volksrepublik im Ranking des WTO Global Gender Gap Reports von Platz 57 auf Platz 107 abgerutscht. Sprich: Vom chinesischen Wirtschaftsboom der vergangenen Jahre profitierten vor allem Männer. In Chinas patriarchaler Gesellschaft gelten sie noch immer als durchsetzungsfähiger und geeigneter für Führungspositionen. Das spiegelt sich auch in der Politik wider: Im zweitmächtigsten Gremium, dem 25-köpfigen Politbüro, saßen in den vergangenen 50 Jahren gerade einmal sechs Frauen.
Weil die chinesische Gesellschaft rapide altert, werden Frauen im heutigen China zudem wieder verstärkt zur Mutterschaft gedrängt. Bereits 2016 hat Peking die Ein-Kind-Politik abgeschafft. Seit dem Mai 2021 dürfen Chinas Frauen sogar drei Kinder bekommen. Nur die wenigsten wagen das jedoch angesichts des hohen finanziellen und gesellschaftlichen Drucks, den Kindern die beste und oftmals teuerste Ausbildung zu bieten.
Gleichzeitig ist die Scheidungsrate in der Volksrepublik in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich angestiegen. Während sich im Jahr 2003, dem Jahr, als China den Scheidungsprozess gesetzlich erleichterte, rund 1,3 Millionen Paare scheiden ließen, waren es 2018 schon 4,5 Millionen. Auch hier versucht die Regierung, mit der klassische Familienstrukturen zu propagieren, um dem Trend zur Scheidung entgegenzuwirken. Seit Anfang 2021 müssen Paare, die sich scheiden lassen wollen, erst durch eine “Abkühlungsphase” gehen: Wenn sie im Zeitraum von 30 und 60 Tagen nicht gemeinsam zu zwei Amtsterminen erscheinen, wird dem Scheidungsantrag nicht stattgegeben. “Immer mehr Frauen wollen gar nicht erst heiraten”, erläutert Fan. “Viele haben erkannt, dass eine Heirat ihnen nur Energie und Eigentum raubt, und das bis zum Lebensende.”
Nach 1990 geborene Chinesinnen wie Fan sind selbstbewusster, selbstständiger und besser ausgebildet als die Generationen vor ihnen. Sie wollen nicht als Menschen zweiter Klasse oder gar als Gebärmaschinen gesehen werden. Von Männern, die sie für intellektuell nicht ebenbürtig halten, schon gar nicht. “Mehr und mehr Frauen realisieren, dass das Patriarchat wirklich existiert und sie benachteiligt”, sagt sie.
In die chinesische Justiz setzt die junge Feministin keine großen Hoffnungen. Laut einer Analyse des Beijing Yuanzhong Gender Development Centre wird eine Mehrheit der Klägerinnen, die wegen sexueller Belästigung vor Gericht gehen, am Ende ihrerseits wegen Verleumdung bestraft. “Wenige Frauen ziehen den juristischen Weg in Betracht, weil sie Angst haben, dass sie ihren Job verlieren oder ihre Karriere vorbei sein wird”, sagt Fan. “Wenn du so einen Prozess wirklich gewinnen willst, musst du tough sein und viele handfeste Beweise vorlegen.” Die Öffentlichmachung sexueller Belästigung auf Social-Media-Kanälen verspreche mehr Erfolg, gehört zu werden. Auch wenn der Prozess “schwierig und schmerzhaft” werden könne, so Fan.
Der Staat pendelt zwischen Entgegenkommen und Repression, um dem Unmut junger Frauenrechtlerinnen wie Fan zu begegnen. Man werde sich jedoch niemals “radikalen feministischen Kampagnen” beugen, schreibt die staatliche Zeitung Global Times in einem Artikel zum neuen Gesetzesentwurf. Trotz solcher politischer Hürden glaubt Fan, dass die “MeToo”-Bewegung in China gerade erst angefangen hat. “Es ist ein Trial-and-Error-Prozess: Was wir bislang erreicht haben, kann uns jederzeit wieder weggenommen werden.”
Am 4. März werden Astronomie-Fans ihren Blick auf den Mond richten. Denn dann soll dort eine chinesische Rakete einschlagen, die einen ansehnlichen Krater hinterlassen dürfte. Bisher wurde angenommen, dass das Objekt von einer Rakete des Unternehmers Elon Musk stammt. Doch der Weltraumexperte Bill Gray, der den Einschlag auf dem Mond vorhergesagt hatte, korrigierte in dieser Woche seine These. Laut Gray handelt es sich bei dem Flugkörper höchstwahrscheinlich um den Träger der chinesischen Mondsonde Chang’e 5-T1. Diese startete 2014 ins All und umflog den Mond. Die Trägerrakete verblieb im Orbit – und könnte nun auf den Erdtrabanten abstürzen.
Das Spektakel um den Mondabsturz mag in sozialen Medien für große Aufmerksamkeit sorgen. Die Mitarbeiter des chinesischen Weltraumprogramms werden jedoch kaum Interesse an ihrer alten Rakete haben. Sie haben alle Hände damit zu tun, die ambitionierten Weltraum-Pläne der Pekinger Führung umzusetzen. Allein in diesem Jahr sind wieder mehr als 50 Raketenstarts geplant. Fast jede Woche will China eine neue Rakete ins All schicken. Höchste Priorität hat die pünktliche Fertigstellung der Raumstation Tiangong (Himmelspalast). Das Kernmodul Tianhe (Himmlische Harmonie) war im vergangenen April ins All gebracht worden. Derzeit lebt und arbeitet in ihm bereits die zweite dreiköpfige Astronauten-Crew. Zwei weitere Module der Station muss China noch ins All bringen. Auch weitere Frachtmissionen und bemannte Flüge sind geplant.
Das bisherige Highlight des nationalen Raumfahrtprogramms bildete 2019 die Landung eines Rovers auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Keinem anderen Land war dieses Manöver zuvor gelungen. 2021 brachten die Chinesen zudem ihren ersten Rover auf den Mars. Mittelfristig sind weitere Missionen zum Erdtrabanten und zum Roten Planeten geplant.
Vor allem um den Mond zeichnet sich ein neues heißes Weltraumrennen ab. China und Russland wollen gemeinsam noch in diesem Jahrzehnt mit dem Bau einer permanenten Raumstation auf dem Erdtrabanten beginnen. Dabei hatten sich die Russen ursprünglich dafür interessiert, beim neuen Mond-Programm der Amerikaner mitzumachen. Doch es ist wohl auch den derzeitigen geopolitischen Verwerfungen geschuldet, dass es dazu nicht mehr kommen wird. Die Entscheidung Russlands ist daher auch ein Spiegel der Weltpolitik. Mit wachsenden Spannungen der USA sowohl mit Russland als auch mit China werden Zusammenarbeiten der Raumfahrtprogramme immer komplizierter.
Stattdessen sind die USA nun bei ihren ebenfalls ambitionierten Plänen auf sich allein gestellt. Das Artemis-Programm der US-Weltraumbehörde NASA sah eigentlich vor, bis 2024 die erste Frau auf dem Mond landen zu lassen und dann nach und nach eine permanente Raumstation namens Gateway zu errichten, die in der Umlaufbahn des Mondes kreisen und Landungskapseln für Oberflächenmissionen zur Verfügung haben soll. Doch längst wird mit erheblichen Verspätungen gerechnet: Die NASA kündigte im November an, dass das vom früheren US-Präsidenten Donald Trump gesetzte Ziel, bis 2024 wieder US-Astronauten auf den Mond zu bringen, um mindestens ein Jahr nach hinten verschoben wird.
China und Russland machen dagegen Tempo. Nachdem zunächst davon die Rede war, eine Station auf dem Mond bis 2035 in Betrieb zu nehmen, berichtete die South China Morning Post zuletzt, dass die Pläne um bis zu acht Jahre auf 2027 vorgezogen werden könnten. So jedenfalls deutete die Zeitung Aussagen von Zhang Chongfeng, dem stellvertretenden Chefingenieur des bemannten Raumfahrtprogramms der Chinesen. Anders als die USA, die ihre Station in einer Mondumlaufbahn platzieren und nur für Missionen mit Shuttles aufsetzen wollen, planen die Chinesen laut Zhang eine Basis direkt auf der Oberfläche. Dort sollen sich chinesische Astronauten für längere Zeit aufhalten können. Zusätzlich ist eine mobile Mondbasis geplant, die automatisiert auch ohne Besatzung in der Lage wäre, die Oberfläche zu erkunden.
Laut Zhang interessiere sich China vor allem für die Erforschung von Mond-Höhlen, die einen natürlichen Schutz für den Bau dauerhafter Siedlungen bieten könnten. Noch mehr dürfte es jedoch um nationales Prestige gehen, woraus Zhang ebenfalls kein Geheimnis macht. Bis 2050, so der hochrangige Mitarbeiter des Raumfahrtprogramms, soll China eine Führungsposition auf dem Mond einnehmen. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Am Dienstag gab es wieder zwei Medaillen für China im Freestyle. Allerdings stahl ein junger Snowboarder dem Ski-Freestyle-Superstar Eileen Gu die Show. Denn nicht sie holte das Gold, sondern er. Eine Niederlage besiegelte derweil das Aus für das Herren-Eishockey-Team der Gastgeber. China lag am Ende des Tages auf Rang sechs des Medaillenspiegels (Deutschland: Rang zwei).


Wasserstoff könnte für Chinas Energiezukunft eine größere Rolle spielen als bisher angenommen. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Reports des Ölkonzerns Shell. Chinas Medien haben die Studie anlässlich von Wasserstoffanwendungen bei den Olympischen Spielen groß aufgegriffen. Wasserstoff spielt den Experten zufolge vor allem da eine Rolle, wo sich Elektrizität nicht direkt einsetzen lässt. Dazu gehören der Transport mit schweren Lkw, die Schiff- und Luftfahrt oder die Stahlproduktion. Das energiereiche Gas könnte bis 2060 demnach 16 Prozent des Energieumsatzes ausmachen. Daraus ergäbe sich ein gewaltiges Wachstum des Marktes mit Herstellung, Handhabung und Nutzung von Wasserstoff. Der Anteil ist bisher vernachlässigbar klein.
Damit die Wasserstoffnutzung für den Klimaschutz Sinn hat, komme nur sogenannter grüner Wasserstoff in Frage, der durch die Aufspaltung von Wasser mit klimaneutral hergestelltem Strom entsteht. Dieser Teil sollte 85 Prozent des Verbrauchs ausmachen, so die Shell-Experten. Zu den klimafreundlichen Energiequellen zählt in China auch die Kernkraft. Shell geht auch davon aus, dass die Stromerzeugung sich insgesamt verdreifachen muss, um genug Strom für direkte Anwendungen und für die Elektrolyse von Wasserstoff bereitzustellen. Der Anteil von Wind und Solar wird demnach auf 80 Prozent steigen. Zwar erfordert die Umstellung zunächst erhebliche Investitionen, doch dann sinken die Kosten erheblich.
Viel Aufmerksamkeit gilt derweil den Wasserstofffahrzeugen, die bei den Olympischen Spielen bereits im realen Einsatz sind. Bloomberg stellt einen Vergleich mit 2008 an. Damals hatte Peking das Elektroauto als Zukunftstechnik vorgestellt, heute ist es ein Alltagsgegenstand. Genauso könne es nun mit Brennstoffzellenantrieben laufen. Die rund 1000 Wasserstoffbusse und -autos im Umfeld der Spiele beweisen den Berichten zufolge die Nützlichkeit der Technik bei tiefen Minustemperaturen. Wo Batterien schwächeln, laufen Wasserstoffantriebe weiter einwandfrei. Das Tanken dauert zudem wie beim Benziner nur wenige Minuten – ein Vorteil, wenn die Heizung lange läuft und die Energiereserven sich daher schneller aufzehren.
Die Fahrzeuge stammen von Beiqi Foton, Geely, Yutong und Toyota. Der Wasserstoff für den Einsatz im Olympiagebiet Zhangjiakou stammt aus einer kräftigen 20-Megawatt-Anlage von Shell. Der Strom dafür kommt aus den umliegenden konventionellen Kraftwerken, es handelt sich also noch nicht um grünen, sondern bisher um schwarzen Wasserstoff aus Kohleverbrennung. fin
Der Autobauer Audi kann die Produktion von Elektroautos in China in den kommenden Jahren kräftig ausweiten. Die Behörden erteilten der VW-Tochter und ihrem staatlichen chinesischen Partner FAW die Genehmigung für eine rund drei Milliarden Dollar teure Fabrik in Changchun im Nordosten des Landes. Die Arbeiten an den Anlagen dort sollen im April beginnen, das Werk mit einer Jahreskapazität von mehr als 150.000 Fahrzeugen soll Ende 2024 die Produktion aufnehmen. Audi wolle dort drei vollelektrische Modelle montieren, darunter einen SUV. “Das Projekt Audi FAW NEV ist ein wichtiger Eckpfeiler der Elektrifizierungsstrategie von Audi in China”, sagte ein Volkswagen-Sprecher. Unter der Abkürzung NEV werden in China Fahrzeuge mit klimaschonenden Antrieben zusammengefasst.
Audi und FAW hatten im Oktober 2020 eine Absichtserklärung zur Produktion von Premium-Elektrofahrzeugen unterzeichnet. Im November 2021 teilte Audi mit, dass das Werk wegen Verzögerungen bei der Genehmigung hinter dem Zeitplan zurückliege. Audi baut seit vielen Jahren zusammen mit FAW in Changchun und im südlich gelegenen Foshan Autos mit Verbrennungsmotor. An beiden Standorten läuft bereits je ein E-Modell vom Band: In Changchun der Audi e-tron und in Foshan die Langversion des Q2 e-tron. Die Ingolstädter wollen auch mit dem in Shanghai ansässigen chinesischen Partner SAIC Elektroautos bauen. Bis 2025 sollen elektrifizierte Autos ein Drittel des Absatzes von Audi auf dem weltgrößten Pkw-Markt ausmachen. rtr
Indien hat 54 Apps aus China auf eine schwarze Liste gesetzt. Die Plattformen, die teilweise großen chinesischen Tech-Konzernen wie Tencent, Alibaba and NetEase angehören, können nun nicht mehr innerhalb der indischen Landesgrenzen genutzt werden. Einige der verbotenen Apps sind offenbar Plagiate von Plattformen, die bereits im Sommer 2020 in Indien erboten wurden. Damals hatte Indiens Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie 59 chinesische Apps vom indischen Markt ausgeschlossen, weil sie verdächtigt wurden, unerlaubt Daten nach China abzuführen. Die Apps seien “der Souveränität und Integrität Indiens, der Verteidigung Indiens und der Sicherheit des Staates sowie der öffentlichen Ordnung abträglich”, so das Ministerium in einer Mitteilung.
Das Verbot von 2020 kam zwei Wochen, nachdem indische und chinesische Soldaten an einer unmarkierten Grenzlinie im Himalaya aneinandergeraten waren. 20 indische Soldaten waren dabei ums Leben gekommen. Auch unter den chinesischen Grenztruppen soll es Tote gegeben haben. Es war der blutigste Zwischenfall zwischen den beiden Atommächten seit dem indisch-chinesischen Grenzkrieg 1962.
Das Verbot chinesischer Apps hat jedoch auch eine wirtschaftliche Komponente. Chinesische Tech-Exporte spielen auf dem indischen Markt eine immer größere Rolle, wobei heimische Unternehmen zusehends von den Chinesen verdrängt werden. So kamen laut neuen Daten von Counterpoint im Jahr 2021 vier der fünf meistverkauften Smartphone-Marken in Indien aus China. fpe
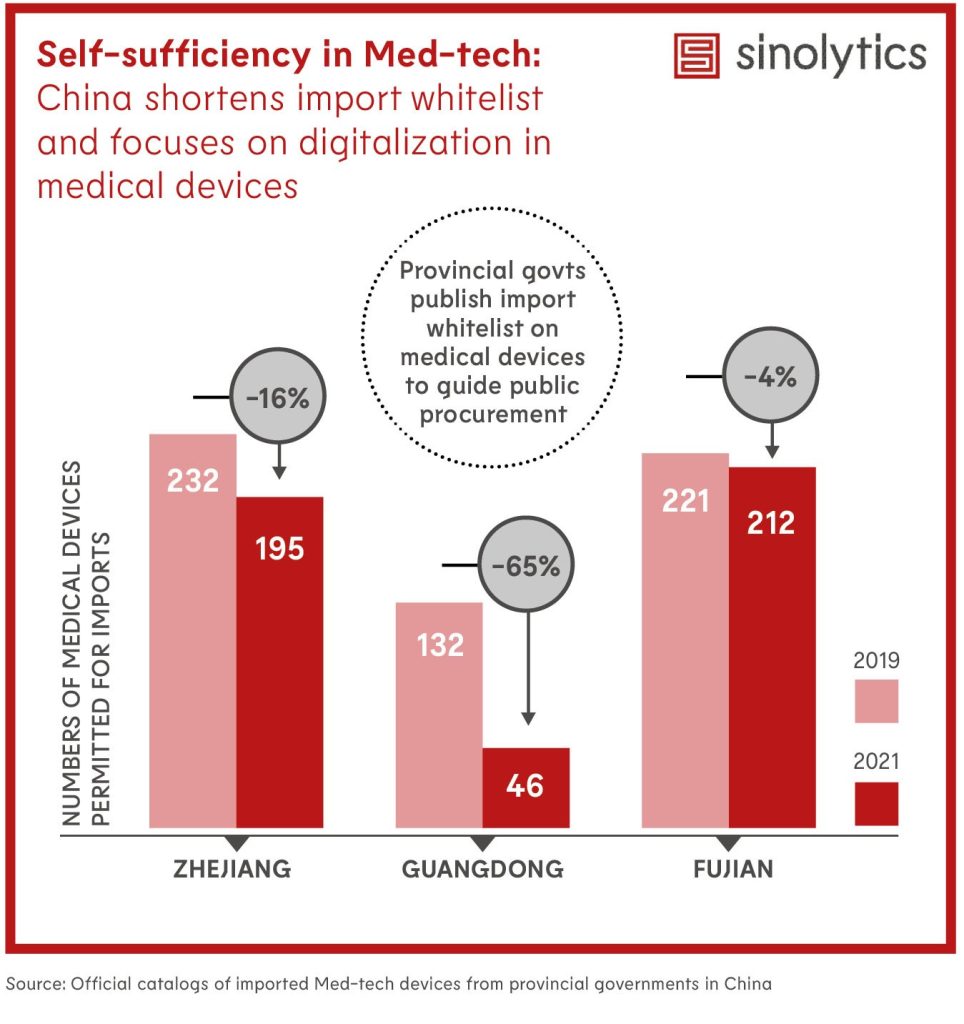
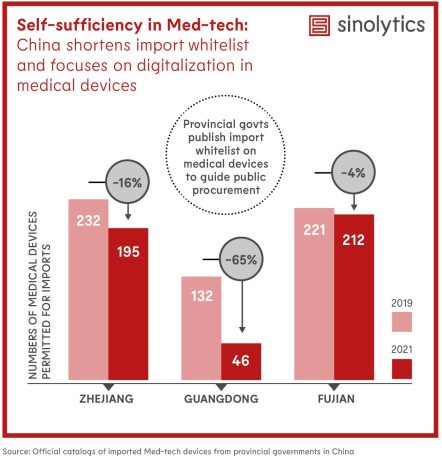
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Mirjam Meissner hatte sich auf den üblichen Auslandsaufenthalt eingestellt, wie ihn viele Sinolog:innen gegen Ende ihres Studiums einlegen. Nach Wuhan wollte sie, um so richtig Mandarin zu lernen und in die chinesische Kultur einzutauchen. Doch sie wollte auch Oboe üben. Und das macht Lärm. Sie entschloss sich daher, zum Üben vom Studentenwohnheim in das Musikinstitut Wuhan auszuweichen.
Dort blieb die Musikerin jedoch nicht lange allein: Der erste Oboist des Wuhan Symphony Orchestra entdeckte sie, kurz darauf saß sie in Konzerten neben ihm. Trotz aller Widrigkeiten, die so ein Doppelleben im Orchester und der Universität mit sich bringt, blickt sie hochzufrieden auf ihre Zeit dort zurück: “So konnte ich damals nicht nur in die Wissenschaft, sondern auch in das Leben der Stadt tief einsteigen.” Es sei nur nebenbei erwähnt, dass das Spielen der Oboe eine präzise Atemtechnik erfordert und als eines der schwierigsten Musikinstrumente gilt.
Präzisionsarbeit leistet Meissner immer noch, nur widmet sie sich heutzutage der Politikanalyse und Strategieberatung. Sie ist Gründungsmitglied und Managing Partner bei Sinolytics, einem Beratungsunternehmen, das auch die Radar-Rubrik im China.Table erstellt. In ihrer langjährigen Tätigkeit in der unabhängigen Politikforschung beim Mercator Institute for China Studies und dem Global Public Policy Institute fiel ihr auf, dass maßgeschneiderte Analysen zum wirtschaftlichen und technologischen Geschehen in China für Unternehmen besonders nützlich sind.
Den Erfolg von Sinolytics führt Meissner unter anderem auf die rasante Entwicklung der chinesischen Marktregulierung zurück, die sich tagtäglich verändert: “Es ist mittlerweile unmöglich, das gewohnte Compliance Management aus anderen Ländern nach China zu übertragen.” Anpassungen sind aber nicht nur wegen des international viel beachteten Corporate Social Credit Systems nötig, denn auch andere Regulierungsinstrumente bergen Chancen und Risiken für internationale Unternehmen. Beachtung schenken müsse man auch den Blacklistings, die bei besonders harten Vergehen verhängt werden und dem frisch eingeführten Risk Score.
Zu gerne würde sie diese Prozesse auch in China begleiten, was ihr aufgrund der strikten Einreisebedingungen der vergangenen zwei Jahre nicht möglich war. Am meisten fehlt ihr, im normalen Leben und Alltag mitzuschwimmen. Dafür fand Sinolytics Gelegenheit, den Standort China weiter auszubauen, um den steigenden Bedarf an Informationen aus China zu decken. Den Überblick verliert sie also trotz der Flut an Reformen nicht – dafür findet sie die Geschehnisse persönlich auch einfach zu spannend. Julius Schwarzwälder
Mirjam Meissner ist Sprecherin auf der China.Table-Veranstaltung China-Strategie 2022 am kommenden Dienstag. Sie informiert dort über die Auswirkungen der gegenseitigen wirtschaftlichen Abkopplung.

Mit den vier rasch aufeinander folgenden Novellen der Außenwirtschaftsverordnung zwischen 2020 und 2021 wurde die staatliche Investitionsprüfung in der Bundesrepublik Deutschland stark ausgeweitet. Die Prüfung des Erwerbs inländischer Unternehmen durch ausländische Käufer durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) soll der Vermeidung von Sicherheitsgefahren dienen. Diese Reformen hängen nicht zuletzt mit dem als bedrohlich empfundenen Anstieg chinesischer Investitionen in deutsche Firmen zusammen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Investitionsprüfungen auf Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen sind noch nicht untersucht, aber nicht zu unterschätzen. Zudem besteht die Gefahr von Investitionshindernissen für deutsche Unternehmen im Ausland.
Weltweit sind ausländische Direktinvestitionen über die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich und stark gewachsen. Wurde in den vergangenen Jahrzehnten hauptsächlich über attraktive Bedingungen für Investoren diskutiert, so werden ausländische Investitionen in den letzten Jahren vermehrt aus dem Blickwinkel der öffentlichen Ordnung und nationalen Sicherheit betrachtet. Investitionen führen zu einer Veränderung der Besitzverhältnisse von inländischen Unternehmen und erlauben Investoren potenziellen Zugang zu sensiblen oder sicherheitsrelevanten Informationen und Technologien. Wie seit Jahrzehnten bekannt, birgt das finanzielle Engagement aus dem Ausland neben vielen wirtschaftlichen Vorteilen auch Risiken. Allerdings haben sich die Risiken von ausländischen Investitionen in der Wahrnehmung zahlreicher Staaten verändert. Diese neue Einschätzung der Gefahrenlage hängt unter anderem mit der Digitalisierung zusammen, welche den Zugriff und Transfer von sensiblen Informationen und Technologie vereinfacht.
Zudem haben einige Übernahmen von deutschen Unternehmen durch chinesische Investoren zu Diskussionen über die einseitigen Investitionsmöglichkeiten und dem non-reziproken Wissenstransfer zwischen China und Europa geführt. Diese Diskussionen dürften neben den tatsächlichen Sicherheitsbedenken und strategischen Überlegungen die Popularität von Investitionsprüfungen erhöht haben. Die Investitionen aus China in europäische Firmen sind von 2010 bis 2017 stark gewachsen, allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau. Eigene Berechnungen beruhend auf Daten des Bureau van Dijk zeigen, dass chinesische Investoren nur an 1,6 Prozent aller internationalen Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen (M&A) beteiligt waren, die in Europa zwischen 2007 und 2021 abgeschlossen wurden. Zudem waren Chinas Investitionen in Europa ab 2017 auch aufgrund innenpolitischer Faktoren bereits rückläufig.
Die OECD schätzt, dass bis zu 60 Prozent der weltweiten Direktinvestitionen einer Investitionsprüfung unterliegen. Dennoch wurden die Effekte der neuen Investitionsprüfungen auf die Anzahl von Firmenübernahmen oder die Übernahmepreise in Europa noch nicht systematisch untersucht. Die Investitionsprüfungen sollen zwar Zusammenschlüsse und Übernahmen von Firmen ohne Sicherheitsrisiken nicht behindern. Dennoch lässt die ökonomische Theorie erwarten, dass einige ausländische Investoren durch die Kosten für die Bereitstellung aller geforderten Unterlagen für die Behörden, die Zeitverzögerung aufgrund des Prüfprozesses sowie die Unsicherheit über das Resultat des Prozesses, die insbesondere in den ersten Jahren der Umsetzung und nach Reformen hoch sein dürfte, abgeschreckt werden. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 160 Übernahmen geprüft, wobei Sicherheitsrisiken in nahezu allen Fällen durch vertragliche Vereinbarungen reduziert werden konnten. Nur ein Projekt wurde verboten. Allerdings können Milliarden-Deals auch ohne Verbot an den langwierigen Prüfverfahren mit internationalen Dimensionen scheitern. Dies zeigt das aktuelle Beispiel der geplanten Übernahme des deutschen Chip-Herstellers Siltronic durch den taiwanischen Chip-Zulieferer GlobalWafers. Auch Start-ups können von Investitionsprüfungen betroffen sein.
Mit der 2021 in Kraft getretenen 17. Novelle der Außenwirtschaftsverordnung sind jetzt auch Unternehmen aus Zukunftsindustrien oder dem Gesundheitssektor ab einer Beteiligung von 20% meldepflichtig . Dabei begrüßt der Bund der Deutschen Industrie (BDI), dass die Bundesregierung die meldepflichtigen Teilbranchen künftig zyklisch überprüfen wird. Zudem sei zu bedenken, dass deutsche Unternehmen auf Investitionsmöglichkeiten im Ausland angewiesen sind und dass ausufernder Investitionsprotektionismus im Inland zu Investitionshemmnissen im Ausland führen kann.
Bei sektorübergreifendem Unternehmenserwerb gemäß der Paragrafen 55-59 der Außenwirtschaftsverordnung sind Mitgliedsstaaten der EU und des EFTA-Raums von der Meldepflicht ausgenommen . Diese Ausnahme gilt allerdings nicht für Investitionen in den zahlreichen sicherheitsrelevanten Sektoren. Es ist möglich, dass in den kommenden Jahren bi- und multilaterale Abkommen ausgehandelt werden, in denen Staaten mit vergleichbaren Werte- und Wirtschaftssystemen gegenseitig auf die Kontrolle von privaten Investitionen (in gewissen Sektoren) verzichten. Damit könnten in Zukunft Investitionen zwischen diesen Staaten wieder vereinfacht werden.
Die Bundesregierung sollte die Umsetzung der Investitionsprüfung und der Sektoren kontinuierlich auf ihre Verhältnismäßigkeit evaluieren. Zudem sollten Meldeprozesse vereinfacht und über Ausnahmen für gewisse Länder nachgedacht werden, damit es zu keiner Spirale des Protektionismus kommt.
Dr. Vera Eichenauer ist Ökonomin der ETH Zürich und forscht aktuell unter anderem zu Europas Umgang mit Chinas wirtschaftlicher Präsenz und Einfluss durch wirtschaftspolitische Maßnahmen. Sie moderiert die nächste Ausgabe des Onlineformates Global China Conversations (Online, Do., 17.2.22, 11-12h) des Kiel Instituts für Weltwirtschaft und seiner Partner zum Thema: Wie wirken sich Investitionsprüfungen auf (chinesische) Direktinvestitionen aus? China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.
Michael Kirsch wird neuer Präsident und CEO der Porsche Motors Ltd. in China. Er wird das Amt im Juni in Shanghai antreten. Kirsch, der seit 2019 als CEO für Porsche Japan zuständig war, löst Jens Puttfarcken ab. Puttfarcken wechselt ab dem 1. Juni ins Mutterhaus und übernimmt dort die Funktion Leiter Vertrieb Europa.
Luanne Lim wird CEO von HSBC Hongkong. Lim verfügt über mehr als 25 Jahre Bankerfahrung. Zuvor arbeitete sie unter anderem bei der Bank of Singapore in verschiedenen Führungspositionen mit Schwerpunkt Asien. Zuletzt war Lim als Chief Operating Officer (COO) von HSBC in Hongkong tätig.

Bei den Olympischen Spielen in China ist normales Laufpublikum wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Stimmung verbreiten sollen ausgewählte, durchgetestete Zuschauergruppen sowie angereiste Sportler, was bei den bisherigen Wettkämpfen mal mehr und mal weniger gut funktionierte. Mit gutem Beispiel voran gingen diese Fans, die das deutsche Eiskunstlauf-Team im Pekinger Hauptstadt-Hallenstadion mit einer aufblasbaren Brezel anfeuerten.
noch nie wurden Frauenrechte in China so öffentlich diskutiert wie heute. Fernsehsendungen und Popsongs setzen sich mit Gleichstellungsfragen und häuslicher Gewalt auseinander. In sozialen Netzwerken kochen regelmäßig die Emotionen hoch, wenn Frauen im noch immer patriarchalisch geprägten Land zum Kinderkriegen gedrängt werden – und sich ansonsten ruhig verhalten sollen. Der Staat hat noch keine klare Linie gefunden, wie er mit dem Unmut der zumeist jungen Frauen umgehen soll. Entgegenkommen und Repressalien halten sich noch die Waage. Wir blicken anlässlich von Fällen wie Peng Shuai und einer angeketteten Frau heute näher auf das Thema.
Zwischen Russland und China beobachten wir derzeit eine Annäherung – und das nicht nur auf der Erde, etwa beim olympischen Händeschütteln zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin. Die Partnerschaft erstreckt sich bis ins All. Noch in diesem Jahrzehnt wollen die beiden Länder mit dem Bau einer gemeinsamen Raumstation auf dem Mond beginnen. Für Moskau und Peking geht es dabei vor allem ums Prestige. Man will die Amerikaner, die ebenfalls neue Mondmissionen planen, so schnell wie möglich abhängen. Ein neues Wettrennen im Weltraum hat begonnen. Der Erdtrabant ist dabei nur der erste Stopp.

Im Januar 2021 wurde die chinesische Stand-Up-Komikerin Yang Li schlagartig für ihren Ausspruch berühmt, Männer seien “普確信” Pǔ quèxìn: “mittelmäßig, aber selbstbewusst”. Auf Chinas Social-Media-Plattformen wurde der Satz innerhalb weniger Stunden zur feministischen Parole. Gleichzeitig brach ein Shitstorm über Li herein, der sie auch einige Werbeverträge kostete. Der Tenor: Li würde mit ihrer Comedy “Männerhass” schüren. Auch sonst kochen beim Thema Gleichberechtigung in China die Gemüter schnell hoch. Zuletzt sorgte der Fall einer von ihrem Ehemann angeketteten, psychisch kranken Frau in der Stadt Xuzhou für landesweite Empörung. Frauen würden oft nicht einmal als menschliche Wesen behandelt, las man in Kommentarspalten von chinesischen Social-Media-Kanälen wie Weibo.
Noch nie wurden Geschlechterdebatten und Gleichstellungsfragen in China so öffentlich verhandelt wie in den vergangenen drei Jahren. Wie in westlichen Ländern werden Gewissheiten in Zweifel gezogen. Feministisch angehauchte Fernsehshows wie “Hear Her” 听见她说” kritisieren ungesunde Schönheitsideale und verzerrte Selbstwahrnehmungen junger Frauen. Die Popsängerin Tan Weiwei adressierte in ihrem Lied “Xiǎo juān 小娟” reale Fälle häuslicher Gewalt, während sich die Rapperin Yamy auf ihrem Weibo-Kanal offen über sexuelle Belästigung im chinesischen Showbusiness echauffierte.
Feminismus ist heute zu einem gewissen Grad Teil der chinesischen Popkultur. Die Künstlerinnen bewegen sich jedoch auf einem schmalen Grat. Die chinesische Regierung bewertet eine feministische Massenbewegung als Gefahr für die soziale Stabilität. Insbesondere die unter dem Hashtag “MeToo” um die Welt gegangene Solidaritätswelle mit Opfern von Missbrauch und Übergriffen bezeichnet Peking als “Werkzeug ausländischer Kräfte”, mit dem das chinesische System unterwandert werden soll.
Als die Bewegung in China Anfang 2018 an Fahrt aufnahm, nachdem eine ehemalige Studentin der Shanghai University of Finance and Economics einen Professor beschuldigt hatte, sie sexuell belästigt zu haben, löschten die Zensoren binnen weniger Wochen reihenweise Social-Media-Accounts bekannter Feministinnen und feministische Diskussionsgruppen. Der bekannteste “MeToo”-Fall um die Tennisspielerin Peng Shuai hat Chinas Mächtigen dann noch einmal klargemacht, wie schnell Anschuldigungen der sexuellen Belästigung zur Staatsaffäre ausarten können.
Um die Gemüter abzukühlen und das Gleichstellungs-Narrativ nicht dem Volk zu überlassen, hat Chinas Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses Ende Dezember eine Überarbeitung des chinesischen Frauenrechtsgesetzes vorgelegt. Der Entwurf, der auf dem 1992 verabschiedeten und 2005 zum letzten Mal überarbeiteten Gesetz zum Schutz der Rechte und Interessen der Frau (LPWRI) basiert, sieht unter anderem vor, dass Arbeitgeber weibliche Bewerber in Einstellungsgesprächen nicht mehr nach ihrem Heiratsstatus oder Kinderwunsch fragen dürfen – eine in China nach wie vor gängige Praxis.
Auch wird erstmals in einem chinesischen Gesetz versucht, eine klare Definition für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorzulegen. Diese beinhaltet nicht nur körperliche Übergriffe, sondern auch verbale und nonverbale Anzüglichkeiten sowie das Verbreiten privater Bilder und Dateien. Unternehmen und Bildungseinrichtungen werden angehalten, Verantwortliche auszubilden, die die Regelungen durchsetzen und Workshops zum Thema anbieten. Dazu sollen Hotlines und Postfächer eingerichtet werden, um Fälle sexueller Belästigung zu melden.
Insgesamt enthält der Entwurf Überarbeitungen von 48 Paragrafen und 24 neue Ergänzungen. Bis zur endgültigen Verabschiedung im nächsten Jahr muss er noch zwei weitere Prüfungen durchlaufen. Ein Beitrag des staatlichen Fernsehsenders CCTV feiert das Update schon jetzt als großen Meilenstein für Chinas Frauen. In chinesischen Online-Foren löste die Ankündigung dagegen einen regelrechten Geschlechterkampf aus. Zahlreiche User:innen erklärten, das geplante Gesetz benachteilige Männer. Andere schrieben, das Gesetz rühre nicht an die Wurzel des Problems: Die tief verankerten patriarchalen Strukturen in China.
Zu den Kritikerinnen des Gesetzes gehört Eloise Fan. Die 29-jährige Feministin arbeitet seit acht Jahren in der Werbeindustrie in Shanghai und betreibt nebenher das Musiklabel Scandal, das feministischen Künstlerinnen eine Plattform bieten will. “Es braucht noch viel mehr Schritte, um das toxische Umfeld, in dem Chinas Frauen sich bewegen, von Grund auf zu verändern”, sagt sie gegenüber China.Table. Trotz ihrer Stellung als Creative Director erlebe sie am Arbeitsplatz immer wieder Sexismus, vor allem durch direkte Vorgesetzte, die anzügliche oder frauenverachtende Kommentare von sich geben oder weibliche Angestellte von wichtigen Entscheidungsprozessen ausschließen. Ihre eigenen Ideen würden oft als “zu feministisch” abgelehnt, sagt Fan. “Meine langjährigen Erfahrungen in der Industrie haben mir gezeigt, dass auch ein Jobwechsel daran nichts ändern wird.”
China hat grundsätzlich eine gute Ausgangsposition für Gleichstellung im Wirtschaftsleben: Der Anteil der weiblichen Erwerbstätigen lag in China laut Zahlen der Weltbank im Jahr 2019 bei 43,7 Prozent – so hoch wie in keinem anderen Land des Asien-Pazifik-Raums. Doch der nähere Blick auf die Zahlen offenbart dann doch erhebliche Geschlechterunterschiede. Zwar gibt es nirgends auf der Welt so viele Milliardärinnen wie in China, für die gleiche Arbeit bei vergleichbarer Qualifikation und Erfahrung verdienen Frauen aber immer noch durchschnittlich 36 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
Zwischen 2008 und 2021 ist die Volksrepublik im Ranking des WTO Global Gender Gap Reports von Platz 57 auf Platz 107 abgerutscht. Sprich: Vom chinesischen Wirtschaftsboom der vergangenen Jahre profitierten vor allem Männer. In Chinas patriarchaler Gesellschaft gelten sie noch immer als durchsetzungsfähiger und geeigneter für Führungspositionen. Das spiegelt sich auch in der Politik wider: Im zweitmächtigsten Gremium, dem 25-köpfigen Politbüro, saßen in den vergangenen 50 Jahren gerade einmal sechs Frauen.
Weil die chinesische Gesellschaft rapide altert, werden Frauen im heutigen China zudem wieder verstärkt zur Mutterschaft gedrängt. Bereits 2016 hat Peking die Ein-Kind-Politik abgeschafft. Seit dem Mai 2021 dürfen Chinas Frauen sogar drei Kinder bekommen. Nur die wenigsten wagen das jedoch angesichts des hohen finanziellen und gesellschaftlichen Drucks, den Kindern die beste und oftmals teuerste Ausbildung zu bieten.
Gleichzeitig ist die Scheidungsrate in der Volksrepublik in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich angestiegen. Während sich im Jahr 2003, dem Jahr, als China den Scheidungsprozess gesetzlich erleichterte, rund 1,3 Millionen Paare scheiden ließen, waren es 2018 schon 4,5 Millionen. Auch hier versucht die Regierung, mit der klassische Familienstrukturen zu propagieren, um dem Trend zur Scheidung entgegenzuwirken. Seit Anfang 2021 müssen Paare, die sich scheiden lassen wollen, erst durch eine “Abkühlungsphase” gehen: Wenn sie im Zeitraum von 30 und 60 Tagen nicht gemeinsam zu zwei Amtsterminen erscheinen, wird dem Scheidungsantrag nicht stattgegeben. “Immer mehr Frauen wollen gar nicht erst heiraten”, erläutert Fan. “Viele haben erkannt, dass eine Heirat ihnen nur Energie und Eigentum raubt, und das bis zum Lebensende.”
Nach 1990 geborene Chinesinnen wie Fan sind selbstbewusster, selbstständiger und besser ausgebildet als die Generationen vor ihnen. Sie wollen nicht als Menschen zweiter Klasse oder gar als Gebärmaschinen gesehen werden. Von Männern, die sie für intellektuell nicht ebenbürtig halten, schon gar nicht. “Mehr und mehr Frauen realisieren, dass das Patriarchat wirklich existiert und sie benachteiligt”, sagt sie.
In die chinesische Justiz setzt die junge Feministin keine großen Hoffnungen. Laut einer Analyse des Beijing Yuanzhong Gender Development Centre wird eine Mehrheit der Klägerinnen, die wegen sexueller Belästigung vor Gericht gehen, am Ende ihrerseits wegen Verleumdung bestraft. “Wenige Frauen ziehen den juristischen Weg in Betracht, weil sie Angst haben, dass sie ihren Job verlieren oder ihre Karriere vorbei sein wird”, sagt Fan. “Wenn du so einen Prozess wirklich gewinnen willst, musst du tough sein und viele handfeste Beweise vorlegen.” Die Öffentlichmachung sexueller Belästigung auf Social-Media-Kanälen verspreche mehr Erfolg, gehört zu werden. Auch wenn der Prozess “schwierig und schmerzhaft” werden könne, so Fan.
Der Staat pendelt zwischen Entgegenkommen und Repression, um dem Unmut junger Frauenrechtlerinnen wie Fan zu begegnen. Man werde sich jedoch niemals “radikalen feministischen Kampagnen” beugen, schreibt die staatliche Zeitung Global Times in einem Artikel zum neuen Gesetzesentwurf. Trotz solcher politischer Hürden glaubt Fan, dass die “MeToo”-Bewegung in China gerade erst angefangen hat. “Es ist ein Trial-and-Error-Prozess: Was wir bislang erreicht haben, kann uns jederzeit wieder weggenommen werden.”
Am 4. März werden Astronomie-Fans ihren Blick auf den Mond richten. Denn dann soll dort eine chinesische Rakete einschlagen, die einen ansehnlichen Krater hinterlassen dürfte. Bisher wurde angenommen, dass das Objekt von einer Rakete des Unternehmers Elon Musk stammt. Doch der Weltraumexperte Bill Gray, der den Einschlag auf dem Mond vorhergesagt hatte, korrigierte in dieser Woche seine These. Laut Gray handelt es sich bei dem Flugkörper höchstwahrscheinlich um den Träger der chinesischen Mondsonde Chang’e 5-T1. Diese startete 2014 ins All und umflog den Mond. Die Trägerrakete verblieb im Orbit – und könnte nun auf den Erdtrabanten abstürzen.
Das Spektakel um den Mondabsturz mag in sozialen Medien für große Aufmerksamkeit sorgen. Die Mitarbeiter des chinesischen Weltraumprogramms werden jedoch kaum Interesse an ihrer alten Rakete haben. Sie haben alle Hände damit zu tun, die ambitionierten Weltraum-Pläne der Pekinger Führung umzusetzen. Allein in diesem Jahr sind wieder mehr als 50 Raketenstarts geplant. Fast jede Woche will China eine neue Rakete ins All schicken. Höchste Priorität hat die pünktliche Fertigstellung der Raumstation Tiangong (Himmelspalast). Das Kernmodul Tianhe (Himmlische Harmonie) war im vergangenen April ins All gebracht worden. Derzeit lebt und arbeitet in ihm bereits die zweite dreiköpfige Astronauten-Crew. Zwei weitere Module der Station muss China noch ins All bringen. Auch weitere Frachtmissionen und bemannte Flüge sind geplant.
Das bisherige Highlight des nationalen Raumfahrtprogramms bildete 2019 die Landung eines Rovers auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Keinem anderen Land war dieses Manöver zuvor gelungen. 2021 brachten die Chinesen zudem ihren ersten Rover auf den Mars. Mittelfristig sind weitere Missionen zum Erdtrabanten und zum Roten Planeten geplant.
Vor allem um den Mond zeichnet sich ein neues heißes Weltraumrennen ab. China und Russland wollen gemeinsam noch in diesem Jahrzehnt mit dem Bau einer permanenten Raumstation auf dem Erdtrabanten beginnen. Dabei hatten sich die Russen ursprünglich dafür interessiert, beim neuen Mond-Programm der Amerikaner mitzumachen. Doch es ist wohl auch den derzeitigen geopolitischen Verwerfungen geschuldet, dass es dazu nicht mehr kommen wird. Die Entscheidung Russlands ist daher auch ein Spiegel der Weltpolitik. Mit wachsenden Spannungen der USA sowohl mit Russland als auch mit China werden Zusammenarbeiten der Raumfahrtprogramme immer komplizierter.
Stattdessen sind die USA nun bei ihren ebenfalls ambitionierten Plänen auf sich allein gestellt. Das Artemis-Programm der US-Weltraumbehörde NASA sah eigentlich vor, bis 2024 die erste Frau auf dem Mond landen zu lassen und dann nach und nach eine permanente Raumstation namens Gateway zu errichten, die in der Umlaufbahn des Mondes kreisen und Landungskapseln für Oberflächenmissionen zur Verfügung haben soll. Doch längst wird mit erheblichen Verspätungen gerechnet: Die NASA kündigte im November an, dass das vom früheren US-Präsidenten Donald Trump gesetzte Ziel, bis 2024 wieder US-Astronauten auf den Mond zu bringen, um mindestens ein Jahr nach hinten verschoben wird.
China und Russland machen dagegen Tempo. Nachdem zunächst davon die Rede war, eine Station auf dem Mond bis 2035 in Betrieb zu nehmen, berichtete die South China Morning Post zuletzt, dass die Pläne um bis zu acht Jahre auf 2027 vorgezogen werden könnten. So jedenfalls deutete die Zeitung Aussagen von Zhang Chongfeng, dem stellvertretenden Chefingenieur des bemannten Raumfahrtprogramms der Chinesen. Anders als die USA, die ihre Station in einer Mondumlaufbahn platzieren und nur für Missionen mit Shuttles aufsetzen wollen, planen die Chinesen laut Zhang eine Basis direkt auf der Oberfläche. Dort sollen sich chinesische Astronauten für längere Zeit aufhalten können. Zusätzlich ist eine mobile Mondbasis geplant, die automatisiert auch ohne Besatzung in der Lage wäre, die Oberfläche zu erkunden.
Laut Zhang interessiere sich China vor allem für die Erforschung von Mond-Höhlen, die einen natürlichen Schutz für den Bau dauerhafter Siedlungen bieten könnten. Noch mehr dürfte es jedoch um nationales Prestige gehen, woraus Zhang ebenfalls kein Geheimnis macht. Bis 2050, so der hochrangige Mitarbeiter des Raumfahrtprogramms, soll China eine Führungsposition auf dem Mond einnehmen. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Am Dienstag gab es wieder zwei Medaillen für China im Freestyle. Allerdings stahl ein junger Snowboarder dem Ski-Freestyle-Superstar Eileen Gu die Show. Denn nicht sie holte das Gold, sondern er. Eine Niederlage besiegelte derweil das Aus für das Herren-Eishockey-Team der Gastgeber. China lag am Ende des Tages auf Rang sechs des Medaillenspiegels (Deutschland: Rang zwei).


Wasserstoff könnte für Chinas Energiezukunft eine größere Rolle spielen als bisher angenommen. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Reports des Ölkonzerns Shell. Chinas Medien haben die Studie anlässlich von Wasserstoffanwendungen bei den Olympischen Spielen groß aufgegriffen. Wasserstoff spielt den Experten zufolge vor allem da eine Rolle, wo sich Elektrizität nicht direkt einsetzen lässt. Dazu gehören der Transport mit schweren Lkw, die Schiff- und Luftfahrt oder die Stahlproduktion. Das energiereiche Gas könnte bis 2060 demnach 16 Prozent des Energieumsatzes ausmachen. Daraus ergäbe sich ein gewaltiges Wachstum des Marktes mit Herstellung, Handhabung und Nutzung von Wasserstoff. Der Anteil ist bisher vernachlässigbar klein.
Damit die Wasserstoffnutzung für den Klimaschutz Sinn hat, komme nur sogenannter grüner Wasserstoff in Frage, der durch die Aufspaltung von Wasser mit klimaneutral hergestelltem Strom entsteht. Dieser Teil sollte 85 Prozent des Verbrauchs ausmachen, so die Shell-Experten. Zu den klimafreundlichen Energiequellen zählt in China auch die Kernkraft. Shell geht auch davon aus, dass die Stromerzeugung sich insgesamt verdreifachen muss, um genug Strom für direkte Anwendungen und für die Elektrolyse von Wasserstoff bereitzustellen. Der Anteil von Wind und Solar wird demnach auf 80 Prozent steigen. Zwar erfordert die Umstellung zunächst erhebliche Investitionen, doch dann sinken die Kosten erheblich.
Viel Aufmerksamkeit gilt derweil den Wasserstofffahrzeugen, die bei den Olympischen Spielen bereits im realen Einsatz sind. Bloomberg stellt einen Vergleich mit 2008 an. Damals hatte Peking das Elektroauto als Zukunftstechnik vorgestellt, heute ist es ein Alltagsgegenstand. Genauso könne es nun mit Brennstoffzellenantrieben laufen. Die rund 1000 Wasserstoffbusse und -autos im Umfeld der Spiele beweisen den Berichten zufolge die Nützlichkeit der Technik bei tiefen Minustemperaturen. Wo Batterien schwächeln, laufen Wasserstoffantriebe weiter einwandfrei. Das Tanken dauert zudem wie beim Benziner nur wenige Minuten – ein Vorteil, wenn die Heizung lange läuft und die Energiereserven sich daher schneller aufzehren.
Die Fahrzeuge stammen von Beiqi Foton, Geely, Yutong und Toyota. Der Wasserstoff für den Einsatz im Olympiagebiet Zhangjiakou stammt aus einer kräftigen 20-Megawatt-Anlage von Shell. Der Strom dafür kommt aus den umliegenden konventionellen Kraftwerken, es handelt sich also noch nicht um grünen, sondern bisher um schwarzen Wasserstoff aus Kohleverbrennung. fin
Der Autobauer Audi kann die Produktion von Elektroautos in China in den kommenden Jahren kräftig ausweiten. Die Behörden erteilten der VW-Tochter und ihrem staatlichen chinesischen Partner FAW die Genehmigung für eine rund drei Milliarden Dollar teure Fabrik in Changchun im Nordosten des Landes. Die Arbeiten an den Anlagen dort sollen im April beginnen, das Werk mit einer Jahreskapazität von mehr als 150.000 Fahrzeugen soll Ende 2024 die Produktion aufnehmen. Audi wolle dort drei vollelektrische Modelle montieren, darunter einen SUV. “Das Projekt Audi FAW NEV ist ein wichtiger Eckpfeiler der Elektrifizierungsstrategie von Audi in China”, sagte ein Volkswagen-Sprecher. Unter der Abkürzung NEV werden in China Fahrzeuge mit klimaschonenden Antrieben zusammengefasst.
Audi und FAW hatten im Oktober 2020 eine Absichtserklärung zur Produktion von Premium-Elektrofahrzeugen unterzeichnet. Im November 2021 teilte Audi mit, dass das Werk wegen Verzögerungen bei der Genehmigung hinter dem Zeitplan zurückliege. Audi baut seit vielen Jahren zusammen mit FAW in Changchun und im südlich gelegenen Foshan Autos mit Verbrennungsmotor. An beiden Standorten läuft bereits je ein E-Modell vom Band: In Changchun der Audi e-tron und in Foshan die Langversion des Q2 e-tron. Die Ingolstädter wollen auch mit dem in Shanghai ansässigen chinesischen Partner SAIC Elektroautos bauen. Bis 2025 sollen elektrifizierte Autos ein Drittel des Absatzes von Audi auf dem weltgrößten Pkw-Markt ausmachen. rtr
Indien hat 54 Apps aus China auf eine schwarze Liste gesetzt. Die Plattformen, die teilweise großen chinesischen Tech-Konzernen wie Tencent, Alibaba and NetEase angehören, können nun nicht mehr innerhalb der indischen Landesgrenzen genutzt werden. Einige der verbotenen Apps sind offenbar Plagiate von Plattformen, die bereits im Sommer 2020 in Indien erboten wurden. Damals hatte Indiens Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie 59 chinesische Apps vom indischen Markt ausgeschlossen, weil sie verdächtigt wurden, unerlaubt Daten nach China abzuführen. Die Apps seien “der Souveränität und Integrität Indiens, der Verteidigung Indiens und der Sicherheit des Staates sowie der öffentlichen Ordnung abträglich”, so das Ministerium in einer Mitteilung.
Das Verbot von 2020 kam zwei Wochen, nachdem indische und chinesische Soldaten an einer unmarkierten Grenzlinie im Himalaya aneinandergeraten waren. 20 indische Soldaten waren dabei ums Leben gekommen. Auch unter den chinesischen Grenztruppen soll es Tote gegeben haben. Es war der blutigste Zwischenfall zwischen den beiden Atommächten seit dem indisch-chinesischen Grenzkrieg 1962.
Das Verbot chinesischer Apps hat jedoch auch eine wirtschaftliche Komponente. Chinesische Tech-Exporte spielen auf dem indischen Markt eine immer größere Rolle, wobei heimische Unternehmen zusehends von den Chinesen verdrängt werden. So kamen laut neuen Daten von Counterpoint im Jahr 2021 vier der fünf meistverkauften Smartphone-Marken in Indien aus China. fpe
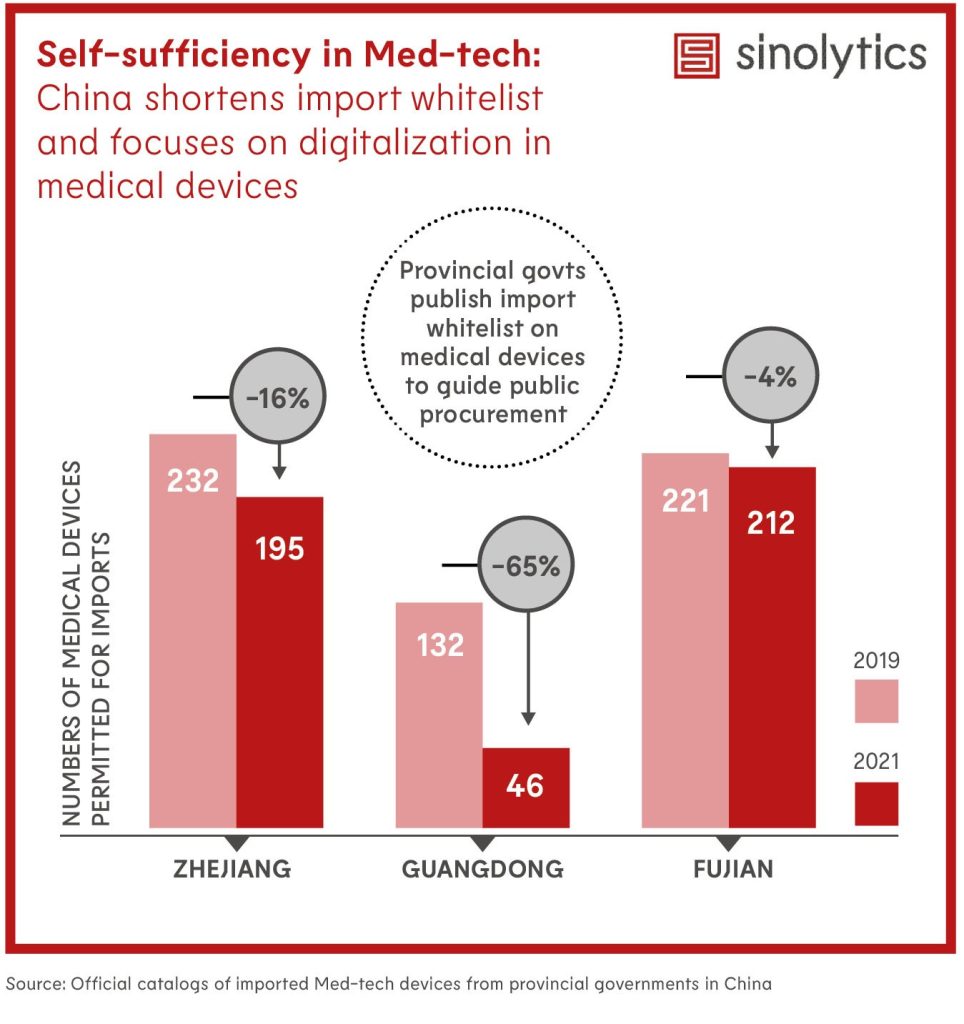
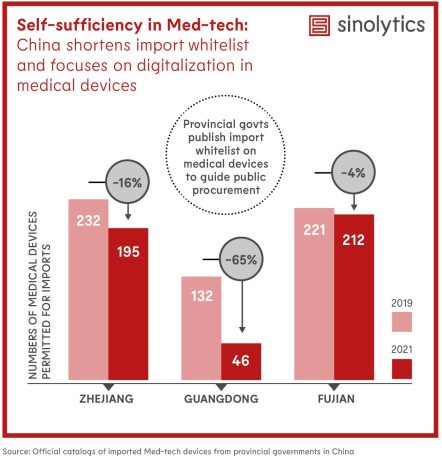
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Mirjam Meissner hatte sich auf den üblichen Auslandsaufenthalt eingestellt, wie ihn viele Sinolog:innen gegen Ende ihres Studiums einlegen. Nach Wuhan wollte sie, um so richtig Mandarin zu lernen und in die chinesische Kultur einzutauchen. Doch sie wollte auch Oboe üben. Und das macht Lärm. Sie entschloss sich daher, zum Üben vom Studentenwohnheim in das Musikinstitut Wuhan auszuweichen.
Dort blieb die Musikerin jedoch nicht lange allein: Der erste Oboist des Wuhan Symphony Orchestra entdeckte sie, kurz darauf saß sie in Konzerten neben ihm. Trotz aller Widrigkeiten, die so ein Doppelleben im Orchester und der Universität mit sich bringt, blickt sie hochzufrieden auf ihre Zeit dort zurück: “So konnte ich damals nicht nur in die Wissenschaft, sondern auch in das Leben der Stadt tief einsteigen.” Es sei nur nebenbei erwähnt, dass das Spielen der Oboe eine präzise Atemtechnik erfordert und als eines der schwierigsten Musikinstrumente gilt.
Präzisionsarbeit leistet Meissner immer noch, nur widmet sie sich heutzutage der Politikanalyse und Strategieberatung. Sie ist Gründungsmitglied und Managing Partner bei Sinolytics, einem Beratungsunternehmen, das auch die Radar-Rubrik im China.Table erstellt. In ihrer langjährigen Tätigkeit in der unabhängigen Politikforschung beim Mercator Institute for China Studies und dem Global Public Policy Institute fiel ihr auf, dass maßgeschneiderte Analysen zum wirtschaftlichen und technologischen Geschehen in China für Unternehmen besonders nützlich sind.
Den Erfolg von Sinolytics führt Meissner unter anderem auf die rasante Entwicklung der chinesischen Marktregulierung zurück, die sich tagtäglich verändert: “Es ist mittlerweile unmöglich, das gewohnte Compliance Management aus anderen Ländern nach China zu übertragen.” Anpassungen sind aber nicht nur wegen des international viel beachteten Corporate Social Credit Systems nötig, denn auch andere Regulierungsinstrumente bergen Chancen und Risiken für internationale Unternehmen. Beachtung schenken müsse man auch den Blacklistings, die bei besonders harten Vergehen verhängt werden und dem frisch eingeführten Risk Score.
Zu gerne würde sie diese Prozesse auch in China begleiten, was ihr aufgrund der strikten Einreisebedingungen der vergangenen zwei Jahre nicht möglich war. Am meisten fehlt ihr, im normalen Leben und Alltag mitzuschwimmen. Dafür fand Sinolytics Gelegenheit, den Standort China weiter auszubauen, um den steigenden Bedarf an Informationen aus China zu decken. Den Überblick verliert sie also trotz der Flut an Reformen nicht – dafür findet sie die Geschehnisse persönlich auch einfach zu spannend. Julius Schwarzwälder
Mirjam Meissner ist Sprecherin auf der China.Table-Veranstaltung China-Strategie 2022 am kommenden Dienstag. Sie informiert dort über die Auswirkungen der gegenseitigen wirtschaftlichen Abkopplung.

Mit den vier rasch aufeinander folgenden Novellen der Außenwirtschaftsverordnung zwischen 2020 und 2021 wurde die staatliche Investitionsprüfung in der Bundesrepublik Deutschland stark ausgeweitet. Die Prüfung des Erwerbs inländischer Unternehmen durch ausländische Käufer durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) soll der Vermeidung von Sicherheitsgefahren dienen. Diese Reformen hängen nicht zuletzt mit dem als bedrohlich empfundenen Anstieg chinesischer Investitionen in deutsche Firmen zusammen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Investitionsprüfungen auf Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen sind noch nicht untersucht, aber nicht zu unterschätzen. Zudem besteht die Gefahr von Investitionshindernissen für deutsche Unternehmen im Ausland.
Weltweit sind ausländische Direktinvestitionen über die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich und stark gewachsen. Wurde in den vergangenen Jahrzehnten hauptsächlich über attraktive Bedingungen für Investoren diskutiert, so werden ausländische Investitionen in den letzten Jahren vermehrt aus dem Blickwinkel der öffentlichen Ordnung und nationalen Sicherheit betrachtet. Investitionen führen zu einer Veränderung der Besitzverhältnisse von inländischen Unternehmen und erlauben Investoren potenziellen Zugang zu sensiblen oder sicherheitsrelevanten Informationen und Technologien. Wie seit Jahrzehnten bekannt, birgt das finanzielle Engagement aus dem Ausland neben vielen wirtschaftlichen Vorteilen auch Risiken. Allerdings haben sich die Risiken von ausländischen Investitionen in der Wahrnehmung zahlreicher Staaten verändert. Diese neue Einschätzung der Gefahrenlage hängt unter anderem mit der Digitalisierung zusammen, welche den Zugriff und Transfer von sensiblen Informationen und Technologie vereinfacht.
Zudem haben einige Übernahmen von deutschen Unternehmen durch chinesische Investoren zu Diskussionen über die einseitigen Investitionsmöglichkeiten und dem non-reziproken Wissenstransfer zwischen China und Europa geführt. Diese Diskussionen dürften neben den tatsächlichen Sicherheitsbedenken und strategischen Überlegungen die Popularität von Investitionsprüfungen erhöht haben. Die Investitionen aus China in europäische Firmen sind von 2010 bis 2017 stark gewachsen, allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau. Eigene Berechnungen beruhend auf Daten des Bureau van Dijk zeigen, dass chinesische Investoren nur an 1,6 Prozent aller internationalen Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen (M&A) beteiligt waren, die in Europa zwischen 2007 und 2021 abgeschlossen wurden. Zudem waren Chinas Investitionen in Europa ab 2017 auch aufgrund innenpolitischer Faktoren bereits rückläufig.
Die OECD schätzt, dass bis zu 60 Prozent der weltweiten Direktinvestitionen einer Investitionsprüfung unterliegen. Dennoch wurden die Effekte der neuen Investitionsprüfungen auf die Anzahl von Firmenübernahmen oder die Übernahmepreise in Europa noch nicht systematisch untersucht. Die Investitionsprüfungen sollen zwar Zusammenschlüsse und Übernahmen von Firmen ohne Sicherheitsrisiken nicht behindern. Dennoch lässt die ökonomische Theorie erwarten, dass einige ausländische Investoren durch die Kosten für die Bereitstellung aller geforderten Unterlagen für die Behörden, die Zeitverzögerung aufgrund des Prüfprozesses sowie die Unsicherheit über das Resultat des Prozesses, die insbesondere in den ersten Jahren der Umsetzung und nach Reformen hoch sein dürfte, abgeschreckt werden. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 160 Übernahmen geprüft, wobei Sicherheitsrisiken in nahezu allen Fällen durch vertragliche Vereinbarungen reduziert werden konnten. Nur ein Projekt wurde verboten. Allerdings können Milliarden-Deals auch ohne Verbot an den langwierigen Prüfverfahren mit internationalen Dimensionen scheitern. Dies zeigt das aktuelle Beispiel der geplanten Übernahme des deutschen Chip-Herstellers Siltronic durch den taiwanischen Chip-Zulieferer GlobalWafers. Auch Start-ups können von Investitionsprüfungen betroffen sein.
Mit der 2021 in Kraft getretenen 17. Novelle der Außenwirtschaftsverordnung sind jetzt auch Unternehmen aus Zukunftsindustrien oder dem Gesundheitssektor ab einer Beteiligung von 20% meldepflichtig . Dabei begrüßt der Bund der Deutschen Industrie (BDI), dass die Bundesregierung die meldepflichtigen Teilbranchen künftig zyklisch überprüfen wird. Zudem sei zu bedenken, dass deutsche Unternehmen auf Investitionsmöglichkeiten im Ausland angewiesen sind und dass ausufernder Investitionsprotektionismus im Inland zu Investitionshemmnissen im Ausland führen kann.
Bei sektorübergreifendem Unternehmenserwerb gemäß der Paragrafen 55-59 der Außenwirtschaftsverordnung sind Mitgliedsstaaten der EU und des EFTA-Raums von der Meldepflicht ausgenommen . Diese Ausnahme gilt allerdings nicht für Investitionen in den zahlreichen sicherheitsrelevanten Sektoren. Es ist möglich, dass in den kommenden Jahren bi- und multilaterale Abkommen ausgehandelt werden, in denen Staaten mit vergleichbaren Werte- und Wirtschaftssystemen gegenseitig auf die Kontrolle von privaten Investitionen (in gewissen Sektoren) verzichten. Damit könnten in Zukunft Investitionen zwischen diesen Staaten wieder vereinfacht werden.
Die Bundesregierung sollte die Umsetzung der Investitionsprüfung und der Sektoren kontinuierlich auf ihre Verhältnismäßigkeit evaluieren. Zudem sollten Meldeprozesse vereinfacht und über Ausnahmen für gewisse Länder nachgedacht werden, damit es zu keiner Spirale des Protektionismus kommt.
Dr. Vera Eichenauer ist Ökonomin der ETH Zürich und forscht aktuell unter anderem zu Europas Umgang mit Chinas wirtschaftlicher Präsenz und Einfluss durch wirtschaftspolitische Maßnahmen. Sie moderiert die nächste Ausgabe des Onlineformates Global China Conversations (Online, Do., 17.2.22, 11-12h) des Kiel Instituts für Weltwirtschaft und seiner Partner zum Thema: Wie wirken sich Investitionsprüfungen auf (chinesische) Direktinvestitionen aus? China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.
Michael Kirsch wird neuer Präsident und CEO der Porsche Motors Ltd. in China. Er wird das Amt im Juni in Shanghai antreten. Kirsch, der seit 2019 als CEO für Porsche Japan zuständig war, löst Jens Puttfarcken ab. Puttfarcken wechselt ab dem 1. Juni ins Mutterhaus und übernimmt dort die Funktion Leiter Vertrieb Europa.
Luanne Lim wird CEO von HSBC Hongkong. Lim verfügt über mehr als 25 Jahre Bankerfahrung. Zuvor arbeitete sie unter anderem bei der Bank of Singapore in verschiedenen Führungspositionen mit Schwerpunkt Asien. Zuletzt war Lim als Chief Operating Officer (COO) von HSBC in Hongkong tätig.

Bei den Olympischen Spielen in China ist normales Laufpublikum wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Stimmung verbreiten sollen ausgewählte, durchgetestete Zuschauergruppen sowie angereiste Sportler, was bei den bisherigen Wettkämpfen mal mehr und mal weniger gut funktionierte. Mit gutem Beispiel voran gingen diese Fans, die das deutsche Eiskunstlauf-Team im Pekinger Hauptstadt-Hallenstadion mit einer aufblasbaren Brezel anfeuerten.

