in China begeht man Feiertage gerne “renao 热闹” – “warm und laut”. Mit etwas Glück bietet die Weihnachtszeit aber auch dort einige ruhige Stunden, die man zum Beispiel mit einem guten Buch verbringen kann. Ning Wang hat sich die wichtigsten und spannendsten Neuveröffentlichungen zu und aus China in diesem Winter angesehen. Von einem Rundumschlag über die jüngste Geschichte des Landes bis hin zu haarsträubenden Einblicken in die Vetternwirtschaft der Partei ist alles dabei.
Direkt hineinlesen können Sie sich in das Buch “Ein Volk verschwindet”, das sich mit dem Schicksal der Uiguren in Xinjiang beschäftigt. Der Autor und ehemalige China-Korrespondent Philipp Mattheis hat uns vorab zur Veröffentlichung im Januar 2022 ein Kapitel zur Verfügung gestellt. Darin fasst er die Lage im “gigantischen Freiluftgefängnis” der muslimisch geprägten Provinz zusammen. Mattheis erläutert, in welch ebenfalls gigantischem Ausmaß die chinesische Regierung mit Nebelkerzen wirft, um Lagerhaft und Zwangsarbeit zu verschleiern.
Nico Beckert bespricht ein Werk zu digitalen Welteroberungsstrategien von dem Politologen Jonathan Hillman – und gibt keine uneingeschränkte Kaufempfehlung ab. Unser Bücher-Special wird abgerundet von einem Portrait der Autorin und Kulturvermittlerin Françoise Hauser, die trotz geballter China-Expertise sagt: “Ich werde nie alles über China wissen, und das finde ich klasse.”
Natürlich informieren wir Sie in unserem Briefing auch wieder über die aktuelle Nachrichtenlage. Denn was aktuell in China und Hongkong passiert, könnte alleine wieder tausende Buchseiten füllen.

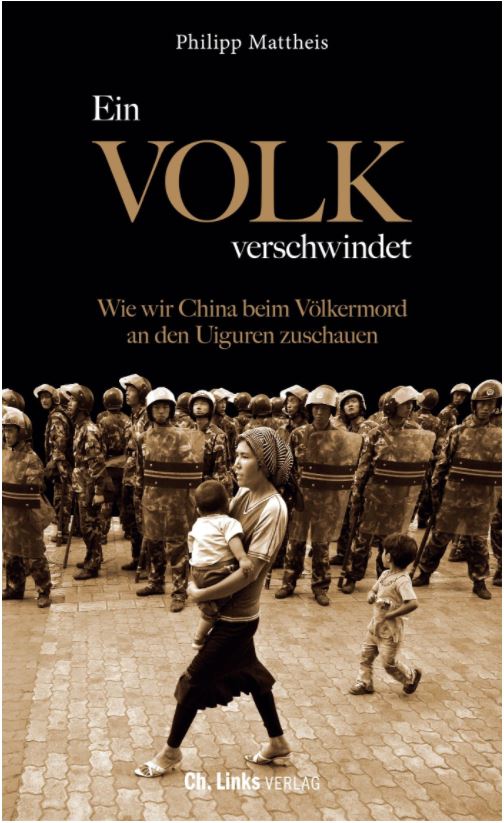
»Sie werden Baumwollfelder besichtigen und die Wahrheit und Fakten respektieren.«
Gao Feng, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, 2021
Bis vor kurzer Zeit hatten die meisten Menschen von dem Turkvolk im Westen Chinas noch nie etwas gehört. Xinjiang, die Stammheimat der rund 15 Millionen Uiguren, ist eine der ärmsten Provinzen Chinas. Während zum Jahreswechsel 2020/21 die Staatschefs mehrerer EU-Länder hinter verschlossenen Türen ein Handelsabkommen mit Peking aushandelten, schlugen Menschenrechtler Alarm. Peking hatte in der Region Xinjiang in den vergangenen Jahren eine digitale Dystopie errichtet. Die totale Überwachung ist – zumindest für die Minderheit der Uiguren – Wirklichkeit geworden. Bis zu zwei Millionen Menschen werden monatelang in »Umerziehungslagern« festgehalten. Folter, Zwangsarbeit und Gehirnwäsche sind dort an der Tagesordnung. Anfangs basierten die Meldungen noch auf Gerüchten und wenigen Berichten derer, die entkommen sind. Mittlerweile aber sind die Menschenrechtsverletzungen der kommunistischen Partei Chinas gut belegt.
Auf der einen Seite werden seit Jahren Milliarden in die Region investiert. Auf der anderen Seite schließen Pekings Beamte aber auch Moscheen, untersagen religiöse Feste und erlassen sogar Kleidervorschriften, um die Religion aus dem Alltag der Menschen zu verbannen. Uralte Oasenstädte wie Kashgar werden unter dem Vorwand der Modernisierung ihrer einzigartigen Architektur beraubt. Den Verlust der kulturellen Identität sollen Wirtschaftswachstum und Infrastruktur ausgleichen. Das ist das Rezept, mit dem die kommunistische Partei Chinas spätestens seit 1990 das Riesenland regiert.
Recherchen in Xinjiang sind nie einfach gewesen. Angst, Diskriminierung und Beamtenwillkür waren immer spürbar. Doch anders als zum Beispiel in Tibet, das seit Jahren für ausländische Journalisten komplett gesperrt ist, waren und sind Reisen nach Xinjiang noch immer erlaubt. Eine tiefergehende Berichterstattung aber ist kaum mehr möglich.
Vor etwa zehn Jahren mussten Journalisten sich zwar offiziell anmelden, wenn sie in Xinjiang recherchieren wollten, aber wie zu dieser Zeit noch oft in China waren die Vorschriften lax und folgten eher dem »Cha Bu Duo«-Prinzip, welches eine gewisse Larifari-Mentalität beschreibt und sich grob mit »passt schon« übersetzen lässt. Eine »Mann-Deckung«, also die direkte Verfolgung durch Beamte, gab es nur selten, und nahezu alle Städte und Landstriche Xinjiangs waren prinzipiell zugänglich, auch wenn man hin und wieder mit Behinderungen rechnen musste. Fernsehteams hatten es insgesamt schwerer, weil sie als Menschengruppe und durch ihr Equipment für mehr Aufmerksamkeit sorgten als ein einzelner Print-Journalist, der sich im Notfall immer als Tourist ausgeben konnte.
Aber das traf auf viele Teile Chinas zu, wenn man zu heiklen Themen recherchieren wollte. Vieles hing auch von der Willkür der zuständigen Beamten ab. Während manche Polizeichefs sich wenig Gedanken über Ausländer in der Region machten und Journalisten in Ruhe ließen, sobald diese versichert hatten, keine Fotos zu machen, waren andere übervorsichtig. Dennoch: In dieser Zeit waren Gespräche mit Uiguren möglich. Viele ließen sich zwar lieber anonym zitieren, aber ihnen war es ein Anliegen, dass die Welt etwas über die Situation in Xinjiang erfuhr. Die Angst vor den Konsequenzen war noch nicht so groß, dass sie mit niemandem sprechen wollten, wie es später der Fall war. Das änderte sich etwa um die Jahre 2016/2017, als das Lagersystem aufgebaut wurde.
Harald Maass, Journalist und ehemaliger China-Korrespondent der Frankfurter Rundschau, flog im Frühsommer 2018 in die kasachische Hauptstadt Almaty. Von dort aus bestieg er einen Bus, der ihn zur chinesischen Grenze brachte. Sein Plan: Mit eigenen Augen zu sehen, was in der Provinz Xinjiang vorging, die er zum ersten Mal in seinem Leben 1987 bereist hatte. Und um einem Verdacht nachzugehen: Ein kanadischer Student hatte über Google Maps und Satellitenaufnahmen Anlagen identifiziert, die wie Lager aussahen. Gerüchte darüber, dass es in Xinjiang Arbeits- oder Umerziehungslager gab, kursierten schon länger. Zu diesem Zeitpunkt aber stritt die chinesische Regierung deren Existenz noch rigoros ab.
Maass reiste mit einem Touristenvisum ein, das er zuvor in München beantragt hatte. »Mich wunderte es, dass es tatsächlich ausgestellt wurde. Heute wäre das völlig unmöglich«, erzählt er knapp drei Jahre später. Maass traf außerdem diverse Vorsichtsmaßnahmen. Er löschte jegliche Dateien von seinem Computer, die in den Augen der chinesischen Sicherheitsbeamten irgendwie verdächtig aussehen könnten. Die Fotos, die er auf seiner zweiwöchigen Reise durch die Provinz machte, lud er über ein Virtual Private Network (VPN) hoch und löschte sie anschließend wieder. Seine Notizen schrieb er in ein Heft, verklausulierte und chiffrierte sie als harmlose Tagebucheinträge, sodass auch sie keinen Verdacht erregen konnten. »Mir war bewusst, dass mir all das als Spionage ausgelegt werden könnte«, sagt der Journalist an einem sonnigen Junitag in München.
»Was ich dann aber tatsächlich sah, übertraf meine schlimmsten Befürchtungen.« Maass schildert die Provinz als ein gigantisches Freiluftgefängnis, in dem die Uiguren auf Schritt und Tritt überwacht, kontrolliert, gescannt, registriert und diskriminiert werden. Am schlimmsten sei die Situation im Süden der Provinz. Nachts glichen die Städte einer einzigen Polizeikontrolle: Überall Blaulicht, bewaffnete Soldaten, die herumbrüllten, Durchsuchungen. Maass selbst wurde in den zwei Wochen 57 Mal kontrolliert.
Sämtliche Interviews mit ehemaligen Insassen der Lager und Familienangehörigen von Inhaftierten führte er in Kasachstan. In Xinjiang selbst beschränkte er den Kontakt mit Uiguren auf ein absolutes Minimum. »Das Wichtigste für mich war, dass niemand durch meine Arbeit in Gefahr geraten würde. Wenn in Xinjiang jemand mit einem Ausländer gesehen wird, droht ihm sofort ein Verhör oder Lagerhaft.« Die Geschichte, die Maass dann schrieb, wurde im März 2019 im Magazin der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Sie gewann den renommierten Deutschen Reporterpreis und wurde für den Theodor-Wolff-Preis nominiert.
Etwas später ist auch der französische Fotograf Patrick Wack zum letzten Mal in Xinjiang gewesen. »2019 folgten mir ein oder zwei Männer mit etwas Entfernung. Es handelte sich dabei oft um Uiguren. Sie waren übrigens sehr freundlich, das führte manchmal zu absurden Situationen. Ich sagte meinen Aufpassern, ich führe morgen hier- oder dorthin, und sie freuten sich mitzukommen.« Das täuschte aber nicht über die Repressionen hinweg. Wack führte immer zwei Fotokarten mit sich. »Ich wurde im Schnitt alle zwei Tage von einem Polizisten aufgefordert, meine Fotos zu löschen. Deswegen hatte ich eine JPEG-Fotokarte bei mir, mit der ich demonstrierte, dass ich die Fotos gelöscht hatte, während die zweite Karte sicher war. Jeden Abend machte ich zudem mehrere Kopien auf meinem Laptop und lud die Fotos über Filesharing-Dienste hoch.«
Die plumpe »Mann-Deckung« ist inzwischen von einer smarten, digitalen Überwachung abgelöst worden. Im Juni 2021 war Christoph Giesen, langjähriger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, in Xinjiang und beschrieb, dass sich die Lage vordergründig entspannt habe. »Noch vor einem Jahr wurde man Schritt für Schritt von mindestens einem Mann mit Handy verfolgt. Fuhr man mit dem Auto, folgten einem Wagen ohne Nummernschilder. Mittlerweile aber ist das System ausgefeilter: Man hat die Städte, und eigentlich die ganze Provinz, in Zonen aufgeteilt. Überquert man eine Zonengrenze, wechselt automatisch auch das Personal, das einen verfolgt. Hinzu kommt, dass der Bewegungsradius durch Covid-Beschränkungen stark eingegrenzt ist. Da man nur in bestimmten Hotels übernachten darf, kann man maximal 200 Kilometer ins Land fahren«, erzählt er.
Gesprächspartner zu finden, die etwas über die tatsächliche Situation erzählen, ist dagegen noch schwieriger geworden. Es scheint, als hätten die massive Einschüchterung, Traumatisierung und Propaganda der Lager ihren Effekt gehabt: »Immer öfter bekommt man nichts als die Regierungspropaganda zu hören«, sagt Giesen.
Die kommunistische Partei versucht aber nicht nur, das Informationsmonopol innerhalb Xinjiangs zu kontrollieren. Ihr Einfluss auf das Narrativ macht sich auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets immer deutlicher bemerkbar. Was das bedeutet, erfuhr im Juli 2021 wieder der französische Fotograf Patrick Wack. Seine Bilder zeigen oft seltsam entrückte Landschaften und Menschen, die etwas von fremder Schönheit und tiefer Trauer erzählen. Sie fanden Eingang in den Fotoband »DUST«, der im Herbst 2021 erschien. Etwas vorher aber, im Juli 2021, landeten zehn von Wacks Xinjiang-Bildern im Instagram-Feed des Unternehmens Kodak, mit dem er eine Kooperation hatte. Eines davon zeigt eine junge Frau auf einer grünen Wiese in scheinbarer Einsamkeit. Darunter stand »Massenarbeitslager werden in der Region aufgebaut – ein Zeugnis für Xinjiangs abrupten Abstieg in eine Orwell’sche Dystopie«. Schnell sprangen nationalistische chinesische Internetuser darauf an und bombardierten sowohl Wack als auch Kodak mit Nachrichten. »Falls Du in China bist, solltest Du ausgewiesen werden. Ich werde Dich der Polizei melden«, schrieb ein User namens »chinese_united«, und das war noch einer der harmloseren Kommentare.
»Ich habe Hunderte von Hass-Nachrichten bekommen, die mich als CIA-Agenten beschimpfen, der westliche Propaganda betreibt, als Rassist und vieles mehr«, sagt Wack. »Manche riefen mich sogar an. Noch befremdlicher war es, dass sich auch Amerikaner und Europäer darunter befinden, also Leute, die nicht jeden Tag mit chinesischer Propaganda bestrahlt werden und es besser wissen müssten.«
Kodak knickte ein: Die Verantwortlichen löschten Wacks Foto, mit dem Hinweis, man wolle sich aus politischen Angelegenheiten heraushalten. »Die politischen Ansichten von Hr. Wack entsprechen nicht denen von Kodak, und Kodak befürwortet diese auch nicht. Wir bitten um Entschuldigung für die Missverständnisse und Verletzungen, die dieser Post verursacht haben könnte.«
Auch der nationalistischen chinesischen Zeitung Global Times war das einen eigenen Artikel wert. In dem gab man sich naiv und führte die Idylle, die Wack auf seinen Fotos oft zeigt, als Beweis dafür an, dass es keine Arbeitslager gebe. Dem Fotografen unterstellte man Gier nach Geld und Aufmerksamkeit.
Wack, der mehrere Jahre in Shanghai verbracht hat und mittlerweile in Berlin lebt, meint zum Vorgehen von Kodak: »Indem sie eingeknickt sind, haben sie nun alle verärgert. Es ist peinlich.« Der Fotograf wiederum erhielt zahlreiche Mails und Posts, die das Vorgehen von Kodak verurteilten und sich solidarisch mit Wack erklärten.
Teil der aktuellen Phase der Informationskontrolle über Xinjiang ist eine aktive, aggressivere PR-Kampagne, an der sich auch nicht-chinesische Blogger beteiligen, die scheinbar ahnungslos schöne Landschaften und gutes Essen schildern. Die KPCh organisiert Touren für ausländische Unternehmen, Touristen und Journalisten nach Xinjiang, um ihnen dort eine perfekte Welt vorspielen zu können: Anfang Juli 2021 verkündete das chinesische Wirtschaftsministerium, »in der nahen Zukunft werden ausländische Unternehmer die Region besuchen«. Gao Feng, der Sprecher des Ministeriums, sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua: »Sie werden Baumwollfelder und -anlagen besichtigen und die Wahrheit und Fakten respektieren.« Diese Potemkinschen Dörfer werden in den kommenden Jahren der Weltöffentlichkeit vorgespielt werden und so die Meinung prägen – wenn es nach den Plänen des Regimes geht.
Zu der perfekten Scheinwelt, die Peking dort aufgebaut hat, kommt, dass die Umerziehungskampagne langsam abgeschlossen wird. Nach und nach scheinen die Lager nun wieder verkleinert zu werden. »Die chinesische Strategie der kulturellen Auslöschung der Uiguren tritt in eine neue Phase ein«, sagt der Aktivist und Datenforscher Adrian Zenz, der mit seiner akribischen Arbeit einen wichtigen Teil zur Wahrheitsfindung geleistet hat. »Die ersten Lager werden geschlossen. Arbeitsmaßnahmen sollen die Folter und Gehirnwäsche ersetzen.«
Für Journalisten und damit auch für die Weltöffentlichkeit wird es in Zukunft noch schwerer werden, hinter die Fassade zu schauen. Peking will die Verbrechen der vergangenen Jahre möglichst schnell unter den Teppich kehren und sowohl dem eigenen Volk als auch der Weltöffentlichkeit alles als Erfolg verkaufen: Radikale Maßnahmen seien nötig gewesen, um terroristische Elemente zu eliminieren, und nun könne jeder nach dem Pekinger Modell zu Wohlstand gelangen.
Zum Glück wächst inzwischen die Solidarität mit dem Schicksal der Uiguren. Menschenrechtsorganisationen, engagierte Politiker und Kenner der Region weisen vermehrt auf die Missstände hin und fordern westliche Regierungen zum Handeln auf: Das Schicksal der Uiguren muss (ähnlich wie das der Tibeter) in den kommenden Jahren vermehrt auch unser Verhältnis zum Regime in Peking bestimmen. Sonst laufen wir Gefahr, unsere Werte für steigende Absatzzahlen von Automobilkonzernen zu opfern. Indem wir uns zu schweigenden Mitwissern der Verbrechen machen, werden wir dem Regime ähnlicher, als wir es wollen.
“Ein Volk verschwindet: Wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen” von Philipp Mattheis erscheint am 17. Januar 2022 im Ch. Links Verlag.
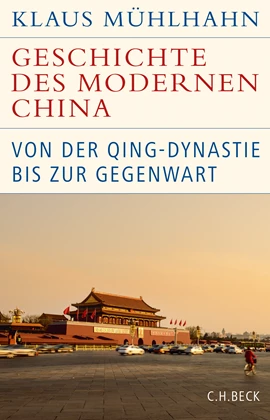
Klaus Mühlhahn hat acht Jahre daran gearbeitet, Chinas Entwicklung von der Qing-Dynastie bis hin zu Xi Jinping nachzuzeichnen. Er sei dabei vor allem solchen Organisationen und Regelwerken auf den Grund gegangen, die das Land geprägt haben, sagt der Sinologe und Kulturwissenschaftler. Wie haben diese Institutionen China verändert? Wie hat ihr Einfluss wiederum das Leben der Menschen im Land beeinflusst? Das sind die zentralen Fragestellungen, die sich als roter Faden durch das 760-seitige Mammutwerk ziehen.
Mühlhahn erzählt Chinas Geschichte auf dem neuesten Stand der Forschung. Dabei wird klar, dass es China nicht um eine Aufholjagd zum Westen geht – sondern darum, wie der Weg zu einer chinesischen Moderne geebnet und dabei immer wieder angepasst werden kann.
Geschichte des Modernen China
Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart
Klaus Mühlhahn
C.H.Beck
760 Seiten
ISBN:978-3-406-76506-3
39,99 Euro (gebunden), auch als E-Book erhältlich
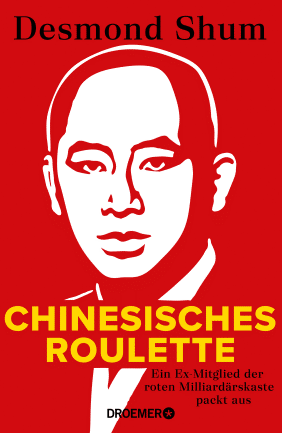
Kurz bevor sein Buch “Red Roulette” im Herbst veröffentlicht wurde, erhielt Desmond Shum zwei Anrufe von seiner bis dahin verschollen geglaubten Exfrau Whitney. Shum hatte vier Jahre nichts mehr von ihr gehört. Aus ihrem gut gesicherten, mit Marmor ausgeschmückten Pekinger Büro war sie am 5. September 2017 nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, erzählt Shum. Und nun flehte sie ihn plötzlich vom anderen Ende der Leitung an, die Veröffentlichung des Buches in letzter Minute abzusagen. Dabei hatte Shum das Buch auch geschrieben, um ihrem gemeinsamen Sohn zu erklären, wo seine Mutter sein könnte und wie es dazu kam, dass sie eines Tages plötzlich spurlos verschwunden war.
Whitney Duan (auch Duan Weihong) war als Geschäftsfrau in den höchsten Kreisen der Kommunistischen Partei über Jahre hinweg bestens verdrahtet. Die Frau des damaligen Ministerpräsidenten Wen Jiabao nannte sie einfach nur “Tante Zhang”.
Ein zentraler Aspekt in Shums Memoiren über die Geschäftsbeziehungen seiner Exfrau zur KP-Elite Zhongnanhais ist der Börsengang von Ping An, einem der größten Versicherer im Land, im Jahr 2004. So sollen Verwandte von Wen Jiabao vor dem IPO in Ping An investiert haben. Shum berichtet über die Korruption innerhalb der Partei dabei nicht als Außenstehender, sondern als einer, der die Geschäfte der “roten Aristokratie” begleitet und daran mitverdient hat. Sein Buch zeichnet ein spannendes Bild darüber, wie Chinas Elite in den Nullerjahren mit Geld, Macht und Willkür ihre Position immer mehr gefestigt und ausgebaut hat.
Red Roulette – Chinesisches Roulette
Desmond Shum
Droemer HC
312 Seiten, übersetzt von Stephan Gebauer
ISBN: 978-3-426-27878-9
22 €, deutsche Ausgabe erscheint am 1.Februar 2022
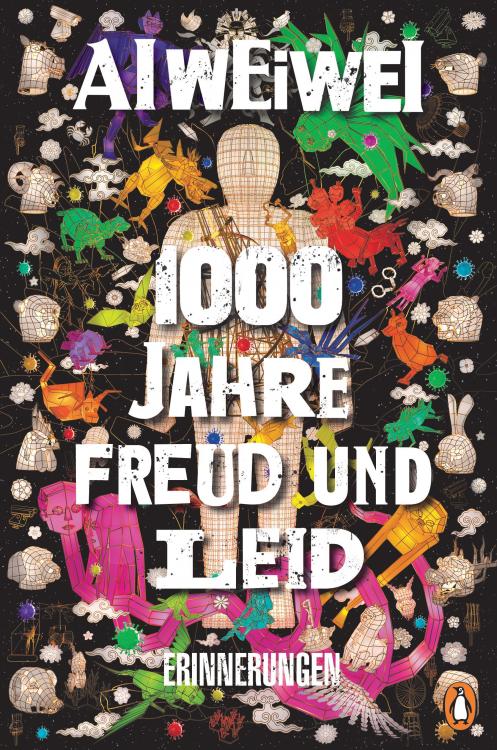
Ai Weiwei hat ein Buch für seinen Sohn geschrieben. Es soll einen Einblick in Ais Leben geben – wohl auch weil der Künstler selbst kaum jemals offen mit seinem eigenen Vater über dessen Vergangenheit sprechen konnte. So ist das Buch auch eine Hommage an Ai Weiweis Vater Ai Qing, der zu Lebzeiten ein bekannter Dichter in China war. Wenn Ai von seinem Vater erzählt, so tut er dies vor allem, indem er dessen Gedichte mit einfließen lässt und Fiktion und eigene Erinnerungen miteinander vermischt.
Als Zehnjähriger während der Kulturrevolution hatte Ai mit seinem Vater über ein Jahr in einer Erdhöhle in der Region Xinjiang gelebt. Für seine Kritik an Mao Zedong war Ai Qing aufs Land verschickt worden, wo er Toiletten putzen musste. Erst 1979 wurde er rehabilitiert und durfte wieder publizieren. Die Unerschütterlichkeit seines Vaters habe damals einen tiefen Eindruck in ihm hinterlassen, schreibt Ai Wei Wei, der selbst 81 Tage in Isolationshaft verbringen musste. Am 3. April 2011 hatten ihn Polizisten in Zivilkleidung am Flughafen von Peking festgenommen und an der Ausreise gehindert. Sein eigener Sohn war damals gerade zwei Jahre alt.
“Während meiner eigenen Zeit der erzwungenen Isolation verspürte ich das Bedürfnis, meine Beziehung zu meinem Vater zu überdenken, und ich beschloss, einen Bericht über sein und mein Leben zu schreiben und diesen meinem Sohn Ai Lao mitzuteilen”, erklärt Ai Weiwei seine Beweggründe, das Buch zu schreiben.
Parallel sind auch Ai Qings Poesien übersetzt und kommentiert von Susanne Hornfeck bei Penguin unter dem Titel “Schnee fällt auf Chinas Erde” erschienen.
1000 Jahre Freud und Leid: Erinnerungen
Ai Wei Wei
Penguin Verlag
416 Seiten, aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Elke Link
ISBN: 978-3-328-60231-6
38 €, auch als E-Book erhältlich
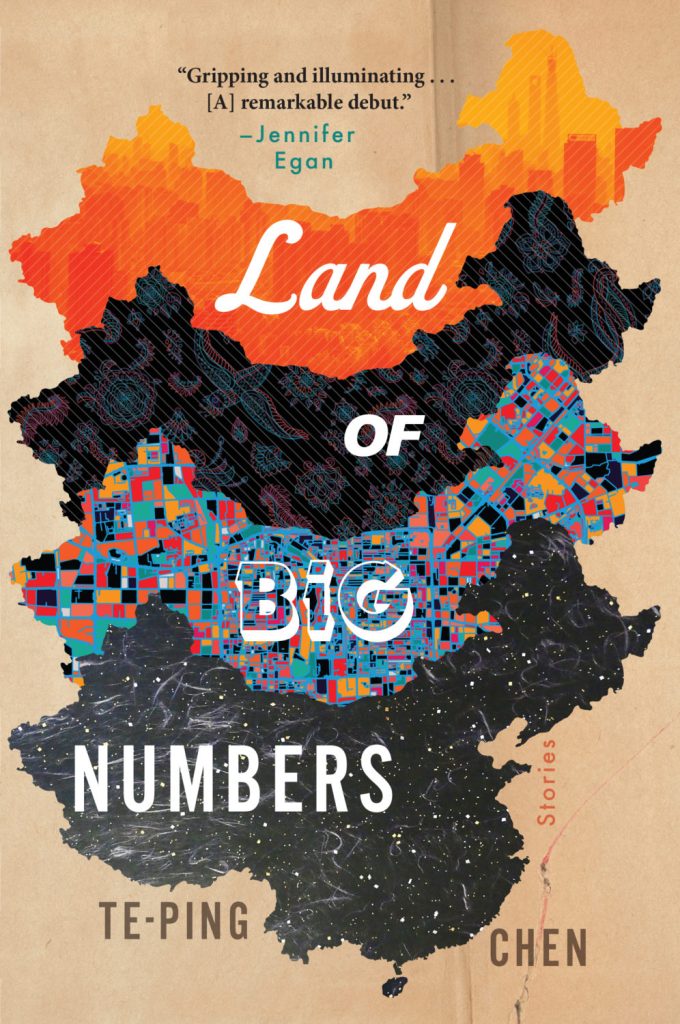
Dieses Buch ist entgegen des Titels keine Ansammlung von Statistiken und Daten zu China. Die amerikanische Journalistin Te-Ping Chen hat vielmehr Kurzgeschichten zusammengestellt, die von ihrer Arbeit als Korrespondentin für das Wall Street Journal in China inspiriert wurden.
Komplex und divers beschreibt Chen die Lebensumstände der Menschen in China, indem sie die Handlung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen verquickt. So ist das Internet eines der Schlüsselthemen in einer Erzählung über ein Zwillingsgeschwisterpaar. Während der Bruder durch das Internet zum Wohlstand aufsteigt, weil er Onlinevideospiele entwirft, wird es für seine Schwester immer mehr zur Bedrohung. Sie, die sich im Gegensatz zu ihrem Bruder in der Schule angestrengt hat und gute Noten mit nach Hause brachte, äußert sich kritisch in einem Online-Forum. Für ihre Meinung zu Ungerechtigkeiten landet sie schließlich im Gefängnis. Am Ende fragt sich der Vater der Zwillinge, wer der beiden richtig gehandelt hat und was im rasanten Wandel der Gesellschaft wirklich Sinn ergibt – Fragen, die auch die Leser im Westen beschäftigt.
Land of Big Numbers
Te-Ping Chen
Verlag Clarion Mariner
236 Seiten, ist auf Barack Obamas Reading List
ISBN-13/EAN: 9780358272557
$ 15,99, auch erhältlich als E- und Audio-Book
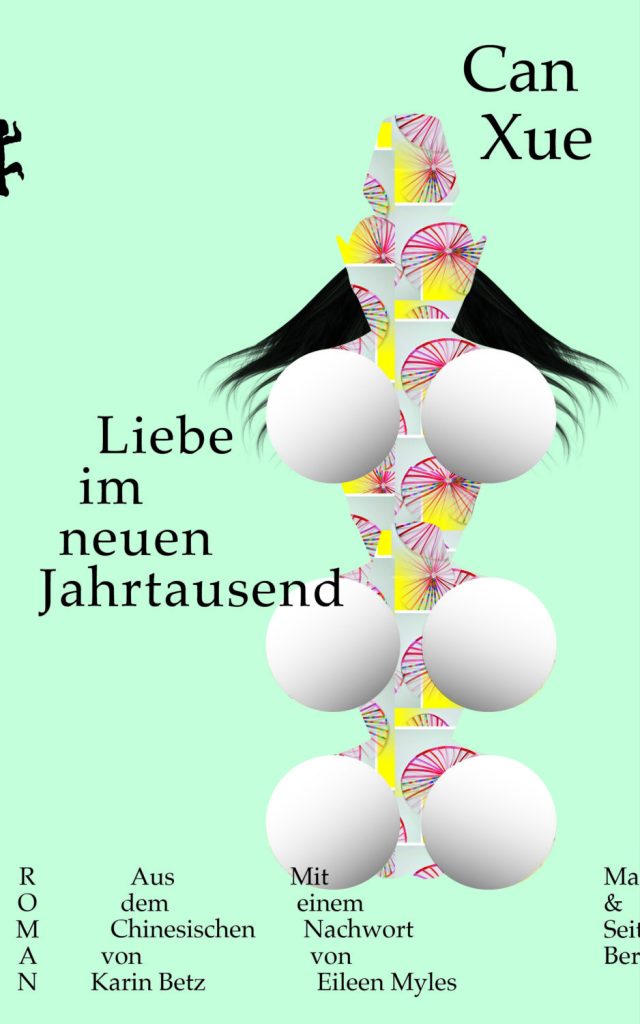
Paranoia und Misstrauen prägen Wei Bos Liebschaft zur Witwe Cuilan. Auch sie schwankt in ihren Gefühlen. Denn ihr Ideal von Liebe ist, dass sie so flüchtig sein soll wie der Morgentau.
Kennengelernt haben sich die beiden in einem Wellnesshotel, das auch noch ganz andere Dienstleistungen anbietet. Bo fragt sich, ob er sich von Cuilan trennen soll, weil er sich ihr so vertraut fühlt wie sonst nur seiner Frau. Ihre Beziehung befindet sich ständig in der Schwebe. Als sie ihm schließlich eine echte Chance geben will, muss er plötzlich ins Gefängnis.
Alle Facetten der Liebe durchleuchtend, beschreibt Can Xue das Leben von vier Frauen, die um den männlichen Protagonisten Wei Bo kreisen. Ihr Alltag ist geprägt von existentiellen Fragen und Ängsten. Alle stehen ständig unter (gegenseitiger) Beobachtung. Das Wellnesshotel wird dabei zum Ort der Zuflucht, um den zahlreichen Verschwörungen und dem gesellschaftlichen Druck zu entkommen. Auch traditionelle chinesische Heilpflanzen spielen in Can Xues Roman eine Rolle. Sie sollen den Weg zu einem neuen Selbst und zu echtem Glück weisen.
“Wenn es eine chinesische Kandidatin für den Nobelpreis gibt, dann ist es sicher Can Xue”, urteilte einst die Schriftstellerin Susan Sontag. Can Xue gilt als eine der wichtigsten Autorinnen der Gegenwart. 1953 in Changsha geboren, lebt sie seit zwanzig Jahren in Peking und hat es geschafft sich als eine der wenigen Frauen in der chinesischen Literatur- und Avantgardeszene auch international einen Namen zu machen.
Liebe im neuen Jahrtausend
新世纪爱情故事 (Chinesisch)
Can Xue
Matthes & Seitz Berlin
398 Seiten, übersetzt von Karin Betz mit einem Nachwort von Eileen Myles
ISBN: 978-3-7518-0054-9
26 €, auch als E-Book erhältlich
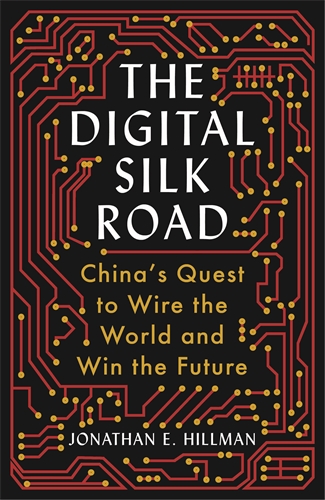
Ob 5G, Smart Cities oder die Great Firewall – China hat in den letzten Jahren auch im digitalen Raum für Aufsehen gesorgt. Digitale Infrastruktur und Tech-Produkte sind mittlerweile ähnliche Exportschlager wie Flughäfen, Straßen und Häfen. Doch baut China an einer digitalen Seidenstraße? Das neue Buch von Jonathan Hillman, Direktor am Reconnecting Asia Project der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies, erweckt im Titel (The Digital Silk Road – China’s Quest to Wire the World and Win the Future) diesen Eindruck. Nach den gut 350 Seiten kennt der Leser viele spannende Details des digitalen Aufstiegs Chinas. Doch sein Bild einer digitalen Seidenstraße und ihren Implikationen bleibt oft vage.
Dabei fängt Hillmans Buch sehr informativ an. Nach einer Einleitung über den (Irr)Glauben westlicher Staatenlenker, dass Informationstechnik die Freiheit auf der Welt vorantreiben werde, steigt der Autor direkt in die Materie ein. In zwei starken Kapiteln beschreibt er den Aufstieg Huaweis zum digitalen Weltkonzern und die allgegenwärtige Überwachung durch Kameras in Chinas Städten.
Hillman erläutert detailliert die Kombination aus Staatskapitalismus, Naivität westlicher Unternehmen und der Unverfrorenheit des Huawei-Managements, die zum Aufstieg des Konzerns beitrug. Es ist eine Kombination, die exemplarisch für den Aufstieg vieler Tech-Firmen Chinas steht. Westliche Unternehmen wiederum waren bereit, im Austausch für den Marktzugang nach China ihre Technologien mit Huawei zu teilen. Derweil schreckte Huawei laut Hillman nicht vor Industriespionage zurück und kopierte die Technik ausländischer Unternehmen. Das Kopieren sei so weit gegangen, dass sogar die Tippfehler in Bedienungsanleitungen für Cisco-Produkte übernommen wurden.
Doch Huawei bediente sich auch legaler Praktiken. Das Unternehmen wurde 17 Jahre von IBM beraten und erlernte dabei wichtige Management-Praktiken, die beim Aufstieg zum Weltkonzern halfen. Huawei und andere chinesische Tech-Firmen strebten in den letzten Jahren vor allem in Märkte, die von westlichen Konkurrenten fast komplett vernachlässigt wurden. Hillman zufolge hat Huawei auf diese Weise gut 70 Prozent des 4G-Netzes in afrikanischen Staaten aufgebaut.
Im folgenden Kapitel beschreibt Hillman das Ausmaß der technologischen Überwachung in China. Die Volksrepublik sei heute der größte Exporteur von Überwachungskameras. Doch Hillman bleibt bei seinen Ausführungen nüchtern und überzeichnet die Situation nicht. So weist er auf Unzulänglichkeiten im System hin. Zum Beispiel gebe es mittlerweile so viele Video-Aufzeichnungen aus Chinas Städten, dass sie kaum noch ausgewertet werden könnten. Künstliche Intelligenz sei dazu noch nicht in der Lage. Auch beim Export der Technik etwa für Smart Cities verspricht China laut Hillman mehr als es halten könnte.
Der Volksrepublik werde häufig vorgeworfen, mit den Überwachungskameras auch den “autoritären Führungsstil” zu exportieren. Doch diese Schlussfolgerung sei zu simpel, urteilt Hillman. Technologie sei nur ein Werkzeug. Es komme auf die lokalen Umstände an, wie sie eingesetzt wird und ob sie überhaupt zu dem Ausmaß an Überwachung fähig sind, wie die Hersteller bewerben.
Nach diesen beiden Kapiteln freut sich der Leser, eine Fortsetzung von Hillmans “The Emperor’s New Road” in den Händen zu halten. In diesem 2020 erschienen Buch beschreibt Hillman die Chinesische Seidenstraßen-Initiative: Mythen, die sich um das Infrastrukturprojekt ranken und Probleme, denen China und seine Partner beim Bau der vielen Infrastrukturprojekte gegenüberstehen.
Doch in den nächsten Kapiteln verliert sich der Autor von “The Digital Silk Road” leider zu sehr in Details und im Konjunktiv. Ihm gelingt es viel zu selten, den Bogen zu schlagen von den einzelnen Themen hin zur digitalen Seidenstraße.
Ein Beispiel ist Hillmans Beschreibung, wie China beim Bau von Unterseekabeln zur Vernetzung der Welt Fuß gefasst hat. Die Kabel “skizzieren ein auf China ausgerichtetes globales Netzwerk, das es vor einem Jahrzehnt noch nicht gab”, schreibt der Autor. China sei noch nicht gleichauf mit entwickelten Ländern. Allerdings erläutert Hillman dann nicht mehr, welche Probleme mit diesem Netzwerk einhergehen.
Im vorletzten Kapitel franst das Buch dann leider komplett aus. Hillman beschreibt, wie China Kommunikationssatelliten an andere Staaten verkauft, inklusive Start ins All. Häufig komme es dabei zur Erhöhung der Schuldenstände, ohne dass die Länder einen großen wirtschaftlichen Nutzen aus den Satelliten ziehen. Dann verliert sich Hillman jedoch in einer seitenlangen Beschreibung von sogenannten LEO-Satelliten (Low Earth Orbit), die auch von SpaceX angeboten werden. China sei hier noch nicht konkurrenzfähig, urteilt Hillman. Doch dann bleibt er sehr vage und verfällt ins Spekulieren: Die Volksrepublik könnte sich ja anschauen, welche Unternehmen mit welchen Dienstleistungen Erfolge feiern und diese kopieren.
Auch Chinas Bestreben, im Ausland vermehrt Datenzentren zu bauen, schildert Hillman nur sehr oberflächlich. Konkrete Gefahren, die damit einhergehen, benennt er nicht. Auch bleibt unklar, ob China zu den derzeitigen Cloud-Marktführern Amazon, Microsoft und Google aufschließen könne.
Und so bleibt “The Digital Silk Road” leider hinter seinem Vorgänger über die reale Neue Seidenstraße zurück. Mit “The Emperor’s New Road” erhielten Lesende einen guten Überblick über das Mammutprojekt – mit all seinen Problemen für die Partnerländer, aber auch für China selbst. Das neue Buch dagegen enthält zwar phasenweise viele interessante Detailinformationen. Doch es fehlen die größeren Zusammenhänge, Erläuterungen und ein roter Faden. Der Leser bekommt keinen Eindruck davon, ob die “Digitale Seidenstraße” wirklich existiert – oder ob sie lediglich ein cleverer Buchtitel ist.
The Digital Silk Road – China’s Quest to Wire the World and Win the Future
Jonathan E. Hillman
Profile Books
351 Seiten
ISBN: 9781788166850
19,99 Euro (gebunden)
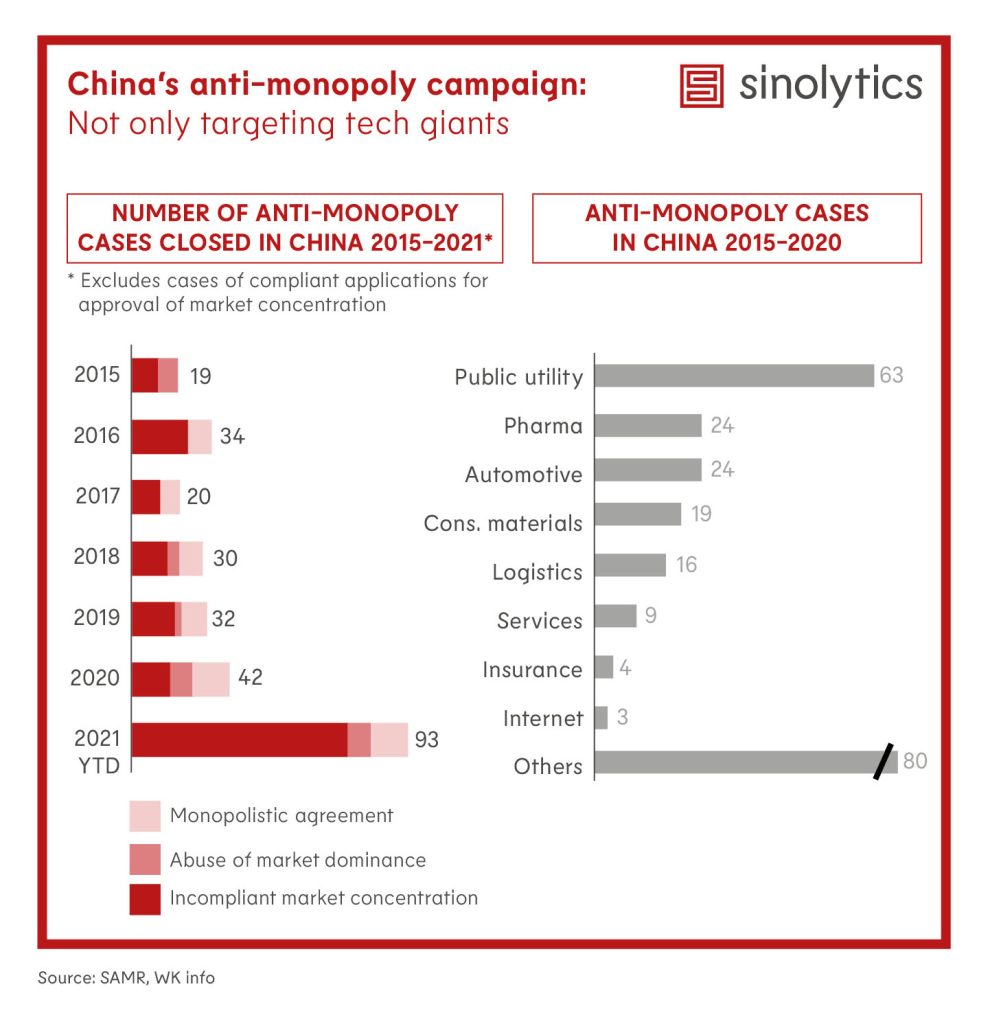
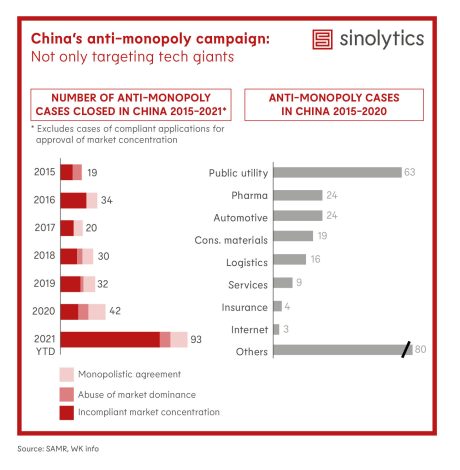
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.
Die Vetomächte China und Russland haben im UN-Sicherheitsrat “humanitäre Ausnahmen” auf Einzelfallbasis im Sanktionsregime gegen die radikalislamischen Taliban abgelehnt. Stein des Anstoßes für Peking und Moskau sei ein Absatz in dem von den USA eingebrachten Resolutionsentwurf gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Diplomaten. Dieser Absatz sollte es dem für die Afghanistan-Sanktionen verantwortlichen Komitee erlauben, bei konkretem Bedarf Ausnahmen von den Finanzsanktionen gegen die Taliban zu beschließen. China sei “grundsätzlich gegen Sanktionen” und damit auch gegen Mechanismen, die im Einzelfall Ausnahmeregelungen erlaubten, schreibt AFP.
Die USA legten bereits einen geänderten Entwurf vor, der am heutigen Dienstag beschlossen werden soll. Darin heißt es nun, dass humanitäre Hilfe für die Dauer eines Jahres grundsätzlich nicht als Verstoß gegen die Sanktionen gegen Afghanistan gewertet werde. Dieser Entwurf gilt als Übergangsregelung.
Seit 2015 gibt es die UN-Sanktionen gegen die Taliban. Diese erstrecken sich seit der Machtübernahme der Radikal-Islamisten im August auf ganz Afghanistan. Das Land steckt in einer schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise und ist in hohem Maße auf ausländische Hilfen angewiesen. Die Hilfslieferungen wurden aber seit August stark zurückgefahren. Die UNO hat daher wiederholt vor einer humanitären Katastrophe in dem Land gewarnt. ck
Wie schon länger erwartet, haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Chinas Präsident Xi Jinping miteinander telefoniert. Nach offiziellen Verlautbarungen plädierten beide bei dem Gespräch am Dienstag für eine Vertiefung der Zusammenarbeit. Xi sprach sich zudem laut einem Bericht des staatlichen chinesischen Senders CCTV dafür aus, dass regionale Probleme im Dialog gelöst und eine “Kalter-Krieg-Mentalität” entschieden abgelehnt werden sollten. Es ist der übliche Tenor, mit dem China um eine kooperative Haltung der EU und auch Deutschlands wirbt. Schon unmittelbar nach Amtsantritt der neuen Regierung hatte Peking für stabile Beziehungen geworben – gerade angesichts der kritischeren Haltung etwa der neuen Außenministerin Annalena Baerbock.
Die Bundesregierung gab nur eine sehr kurze Erklärung zu dem Telefonat ab. Regierungssprecher Steffen Hebestreit listete eine Auswahl der Themen auf: Neben der Vertiefung der bilateralen Partnerschaft und der Wirtschaftsbeziehungen sei es um die Entwicklung der EU-China-Beziehungen sowie “internationale Themen” gegangen. Das ist erst einmal nicht besonders vielsagend.
Xi plädierte derweil laut CCTV für Kooperationen bei neuen Energien und in der Digitalwirtschaft. Deutsche Firmen seien willkommen, die Möglichkeiten zu ergreifen, die sich aus der Öffnung Chinas ergäben. Umgekehrt äußerte Xi die Hoffnung, dass Deutschland ein faires Geschäftsumfeld für chinesische Unternehmen bieten werde, die in Deutschland investieren wollten. rtr/ck
China hat das erste Mal einen Atomreaktor der vierten Generation an das Stromnetz angeschlossen. Damit ist der gasgekühlte Hochtemperaturreaktor (HTGR) im Kernkraftwerk Shidaowan in der Provinz Shandong aktuell weltweit der einzige seiner Art im kommerziellen Betrieb. Der Reaktor wurde von den staatlichen Stromriesen China Huaneng Group und China National Nuclear Corporation (CNNC) gemeinsam mit der Pekinger Tsinghua-Universität entwickelt und gebaut. Er besteht aus zwei kleinen Turbinenblöcken mit einer Gesamtkapazität von 200 Megawatt (MW). Die zweite Einheit ist im Bau und soll nach Angaben der China Huaneng Group Mitte 2022 ans Netz gehen.
Der neue HTGR basiert nach Angaben von Huaneng auf deutscher Technologie, wurde aber komplett in China entwickelt. Der Lokalisierungsgrad liege bei 93,4 Prozent. Schon 2012 begann der Bau der beiden Turbinen. Die Fertigstellung verzögerte sich jedoch. HTGR-Reaktoren galten lange als sicherste Form der Atomkraft. Doch die einzigen vier jemals kommerziell genutzten Reaktoren dieser Art in den USA und Deutschland wurden aufgrund von Problemen beim Betrieb aufgegeben.
Als emissionsfreie Energieform spielt die Kernenergie bei Chinas Energiewende eine weit größere Rolle als in vielen westlichen Ländern. Daher arbeitet China mit Hochdruck an der Entwicklung eigener Reaktoren. Es ist erst gut ein Jahr her, dass im Kernkraftwerk Fuqing der erste Reaktor der dritten Generation ans Netz ging: ein Druckwasserreaktor namens Hualong One HPR-1000 mit 1.150 Megawatt Leistung (China.Table berichtete). Mehrere weitere Reaktoren dieser Art wurden seither installiert oder sind noch im Bau. Auch mit der Kernfusion experimentiert das Land.
China ist mit 51 Gigawatt (GW) installierter Leistung (Ende 2020) nach den USA und Frankreich der drittgrößte Produzent von Atomstrom. 18,5 weitere GW sind im Bau. In seinem Fünfjahresplan für 2021 bis 2025 sieht Peking die Förderung und Installation von Reaktoren der dritten Generation vor. Insgesamt soll die Kapazität bis Ende 2025 auf 70 GW steigen. Bislang trägt Atomkraft aber nur rund fünf Prozent zum Strommix bei. ck
Ehemalige Hongkonger Politiker interpretieren die geringe Beteiligung an der Parlamentswahl als klare Absage der Bürger:innen am wachsenden autoritären Einfluss der Volksrepublik China. Im Gespräch mit China.Table sagte der Aktivist Sunny Cheung, er halte das Fernbleiben vieler Wähler:innen für eine klare Botschaft, dass sie den Urnengang als reinen Schwindel bewerteten. Sie hätten diesem deshalb die Anerkennung verweigert. “Obwohl Peking die Wahlreform für Hongkong zum unvermeidbaren Mittel erklärt hat, um Stabilität und Wohlstand zu sichern, haben die Hongkonger am vergangenen Sonntag für die niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte gesorgt, um damit gegenüber der Welt ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen”, sagte Cheung. Er hatte selbst im Juni 2020 als Kandidat des pro-demokratischen Lagers für den Legislativrat kandidiert. Später im Jahr aber floh er, um einer Verhaftung in Hongkong zu entgehen. Die Wahl fand erst jetzt statt – unter komplett veränderten Bedingungen.
Die Wahlbeteiligung am Sonntag hatte auf dem historischen Tiefstand von rund 30 Prozent gelegen. Die Wahlrechtsform, die vom Nationalen Volkskongress in Peking im Frühjahr beschlossen worden war, hatte den Anteil frei wählbarer Parlamentarier drastisch reduziert. Nur 20 der 90 Abgeordneten im Legislativrat wurden nun noch direkt gewählt. 40 weitere wurden von einem pekingtreuen Wahlkomitee bestimmt. Der Rest kommt aus Interessengruppen, die der chinesischen Zentralregierung nahestehen. Alle 153 Kandidaten wurden zudem vor der Abstimmung auf ihren “Patriotismus” und ihre politische Loyalität gegenüber Peking überprüft (China.Table berichtete).
“Die Menschen in Hongkong waren sich darüber im Klaren, dass sie bei dieser Wahl nicht durch echte Demokraten vertreten sein würden. Deshalb haben sie sich geweigert, nach diesem Drehbuch mitzuspielen, nur um in Peking für gute Unterhaltung zu sorgen”, sagte Cheung. “In dieser falschen Legislative gibt es keine Autonomie und keine Legitimität.” Der 25-Jährige bezeichnet die Neubesetzung des Parlaments als Ansammlung politischer Marionetten und Jasagern. Schon seit den Regenschirm-Protesten 2014 war er in Hongkong politisch aktiv gewesen. Inzwischen lebt Cheung in den USA und tritt dort als Lobbyist für die Bewahrung freiheitlicher Bürgerrechte in Hongkong ein.
Auch der frühere Parlamentarier Ted Hui betonte im Gespräch mit China.Table die mangelnde Glaubwürdigkeit des künftigen Legislativrates. “Die geringe Wahlbeteiligung ist eine deutliche Botschaft der Menschen: Die Wahl ist in ihren Augen irrelevant und illegitim. Die Mehrheit lehnte es ab, diesem Parlament Geltung zu verschaffen.” Auch Hui ist aus Hongkong geflohen und lebt heute in Australien (China.Table berichtete). grz
Die Zahl der Apps in chinesischen App-Stores ist in den letzten drei Jahren um 38,5 Prozent geschrumpft. Das belegen Zahlen des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT). Demnach waren Ende 2018 noch rund 4,52 Millionen Anwendungen zum Download verfügbar. Im Oktober 2021 war die Zahl auf 2,78 Millionen zurückgegangen.
Der Rückgang wird von Marktbeobachtern auf eine Konsolidierung des App-Marktes und eine strengere Internetregulierung durch die Regierung zurückgeführt. Betroffen sind laut einem Bericht der South China Morning Post vor allem Videospiele. Im August hatte die Landesverwaltung für Presse und Publikationen eine neue Regel erlassen, die die Spielzeit für User unter 18 Jahren auf bestimmte Wochentage und Zeitfenster beschränkt. Seit Juli 2021 haben die chinesischen Aufsichtsbehörden zudem keine neuen Online-Spiele mehr zum Verkauf zugelassen. fpe

Als Françoise Hauser Mitte der 1990er-Jahre ihren Sinologie-Magister frisch in der Tasche hatte, wurde ihr bei einem Besuch auf dem Arbeitsamt gleich eine Umschulung vorgeschlagen. “Mit Chinesisch konnte man damals noch nicht viel anfangen”, sagt die 1967 in Mainz geborene Schriftstellerin. Nach einem kurzen, aber intensiven Intermezzo bei einer Computerfirma landete sie schließlich doch wieder bei China. Zum Glück: Ihre Kompetenz hat die weitgereiste Autorin und Journalistin seitdem in über 30 Bücher einfließen lassen. Gut ein Drittel dieser Werke handelt von China.
In einem davon räumt sie humorvoll mit “20 populären Irrtümern über China” auf, etwa der Vorstellung, dass Chinesen jeden Tag Reis oder sogar Hund und Katze essen. Im Reiseführer “Kulinarisch Chinesisch” erläutert sie wie man vor Ort eine chinesische Speisekarte “Wort für Wort” entziffert. In ihrer “Gebrauchsanweisung Chinesisch” vertieft Hauser ihre Einführung in “die meistgesprochene Sprache der Welt”. Dabei beantwortet sie grundlegende Fragen – angefangen bei: “Wie gelingt es wirklich, den Einstieg in die Sprache zu schaffen?” Bei Chinesisch-Lernenden steht das Buch bis heute hoch im Kurs: Der Band, der 2015 bei Reclam erschien, wurde schon mehrfach nachgedruckt.
Hauser selbst hat ihr Chinesisch-Studium unter anderem auf Taiwan und im ostchinesischen Nanjing absolviert. “Als ich 1989 in Nanjing studierte, gab es da gerade mal drei Hochhäuser”, erinnert sie sich. “Heute ist da wie fast überall eine Skyline.”
Wenn Hauser über China spricht, sprudelt sie über vor Anekdoten. Etwa jene, wie sie einmal shuǐjiǎo (水饺), chinesische Maultaschen, essen wollte. Der Taxifahrer kutschierte sie zu einem Hotel außerhalb der Stadt , weil er glaubte, dass sie eine Mütze Schlaf – shuìjiào (睡觉) – brauche. “Jeder, der Chinesisch lernt, kennt solche Erfahrungen: Wenn man als Ausländer die Töne nicht richtig trifft und etwas ganz anderes bekommt, als man wollte”, sagt sie.
Und natürlich sind da auch noch die vielen feinen kulturellen Unterschiede, die man im Umgang mit Chinesen immer wieder überbrücken muss. Hauser ist darin Vollprofi. Nach der Uni hatte sie sich bei einem chinesischen Reisebüro beworben. Der von Feng Shui besessene Chef wollte beim Bewerbungsgespräch nur eine einzige Frage beantwortet haben: “Was ist ihr chinesisches Sternzeichen?” “Ziege”, erwiderte Hauser und bekam den Job.
Einige ihrer Erlebnisse hat die Autorin im selbstironischen Buch “In 80 Fettnäpfchen um die Welt” verarbeitet, das 2014 bei National Geographic erschien. Seit einigen Jahren vermittelt sie ihr Wissen auch in interkulturellen Vorbereitungskursen, zum Beispiel an Universitäten und für Unternehmen. “Ich wollte bei den Menschen immer ein Interesse an China wecken, das über Wirtschaft und Politik hinausgeht”, sagt sie. “Bei uns wird immer viel an China kritisiert. Chinesische Kultur und die KP Chinas sind aber nicht deckungsgleich.” Das Land ließe sich schwer auf einfache Formeln eindampfen.
Andererseits könnten auch wir einiges von den Chinesen lernen, sagt Hauser. “Wir Deutschen reden zum Beispiel oft zuerst, und halten dann inne und gucken. Diese Reihenfolge ist in China oft umgekehrt: Zuerst gucken, Lage sondieren und dann sprechen. Das ist erfolgversprechender.” Obwohl sich die Buchautorin längst auch in anderen asiatischen Ländern wie Japan und Malaysia heimisch fühlt, hat China sie nie losgelassen. Vor Corona versuchte sie, mindestens einmal pro Jahr das Land zu bereisen.
Den Allgemeinplatz, dass “China anders ist”, unterschreibt Hauser trotz ihrer langjährigen Erfahrung noch immer. “Ich werde nie alles über China wissen und das finde ich klasse.” Von der Kaffeesatzleserei, zu der sich viele China-Experten bemüßigt fühlen, hält sie dementsprechend wenig: “Hätten sich all die Prophezeiungen erfüllt, wäre China schon drei Mal zusammengebrochen und hätte dreimal die Welt erobert”. Hauser geht mit einem Alternativprogramm an das Land heran: “Ich habe beschlossen, mich immer wieder aufs Neue überraschen zu lassen. Und es ist doch so: Auch Chinesen verstehen ihr eigenes Land nicht immer.” Fabian Peltsch
Uzra Zeya wird neue Tibet-Koordinatorin der USA. Die von US-Präsident Joe Biden ernannte Diplomatin mit indischen Wurzeln steht seit 27 Jahren im Dienst der US-Regierung. Auf ihrem neuen Posten möchte sich Zeya für die “Menschenrechte und fundamentalen Freiheiten” der Tibeter einsetzen und einen “substantiellen Dialog” zwischen dem Dalai Lama und Peking fördern. Der Posten des US-Tibet-Koordinators wurde 2002 ins Leben gerufen. Die chinesische Botschaft in Washington kritisierte die Ernennung Zeyas als “politische Manipulation” und einen Versuch, “Tibet zu destabilisieren”.
Pradeep Kumar Rawat wurde am Montag als neuer indischer Botschafter in China bestätigt. Der erfahrene Diplomat spricht fließend Mandarin. Zuletzt war Rawat Botschafter in den Niederlanden. Zwischen 2003 und 2007 war er stellvertretender Chef der indischen Botschaft in Peking, und von 2007 bis 2009 Direktor für China in der Abteilung Ostasien. Rawat folgt auf Vikram Misri, der das Amt im September 2018 angetreten hatte.
Li Henan wird neuer Leiter des Rohölhandels bei Chinaoil, dem Handelsarm des chinesischen Ölgiganten PetroChina in Singapur. Das Unternehmen kauft Rohöl für die dortige konzerneigene Raffinerie. Auch handelt es mit Rohölsorten aus dem Nahen Osten, Russland und dem asiatisch-pazifischen Raum. Li löst Zhang Yufeng in dieser Funktion ab.

“Ich bin ein Star, holt mich hier raus!”, scheint Meng Lan in die Kamera zu sagen. Der Riesenpanda war am 15. Dezember aus seinem Gehege im Pekinger Zoo entkommen und muss seitdem hinter einem extra hohen Sicherheitszaun ausharren. Es war bereits der zweite Ausbruchsversuch des sechsjährigen Tieres. Zoowärter hatten ihn mit Essen zurücklocken können.
in China begeht man Feiertage gerne “renao 热闹” – “warm und laut”. Mit etwas Glück bietet die Weihnachtszeit aber auch dort einige ruhige Stunden, die man zum Beispiel mit einem guten Buch verbringen kann. Ning Wang hat sich die wichtigsten und spannendsten Neuveröffentlichungen zu und aus China in diesem Winter angesehen. Von einem Rundumschlag über die jüngste Geschichte des Landes bis hin zu haarsträubenden Einblicken in die Vetternwirtschaft der Partei ist alles dabei.
Direkt hineinlesen können Sie sich in das Buch “Ein Volk verschwindet”, das sich mit dem Schicksal der Uiguren in Xinjiang beschäftigt. Der Autor und ehemalige China-Korrespondent Philipp Mattheis hat uns vorab zur Veröffentlichung im Januar 2022 ein Kapitel zur Verfügung gestellt. Darin fasst er die Lage im “gigantischen Freiluftgefängnis” der muslimisch geprägten Provinz zusammen. Mattheis erläutert, in welch ebenfalls gigantischem Ausmaß die chinesische Regierung mit Nebelkerzen wirft, um Lagerhaft und Zwangsarbeit zu verschleiern.
Nico Beckert bespricht ein Werk zu digitalen Welteroberungsstrategien von dem Politologen Jonathan Hillman – und gibt keine uneingeschränkte Kaufempfehlung ab. Unser Bücher-Special wird abgerundet von einem Portrait der Autorin und Kulturvermittlerin Françoise Hauser, die trotz geballter China-Expertise sagt: “Ich werde nie alles über China wissen, und das finde ich klasse.”
Natürlich informieren wir Sie in unserem Briefing auch wieder über die aktuelle Nachrichtenlage. Denn was aktuell in China und Hongkong passiert, könnte alleine wieder tausende Buchseiten füllen.

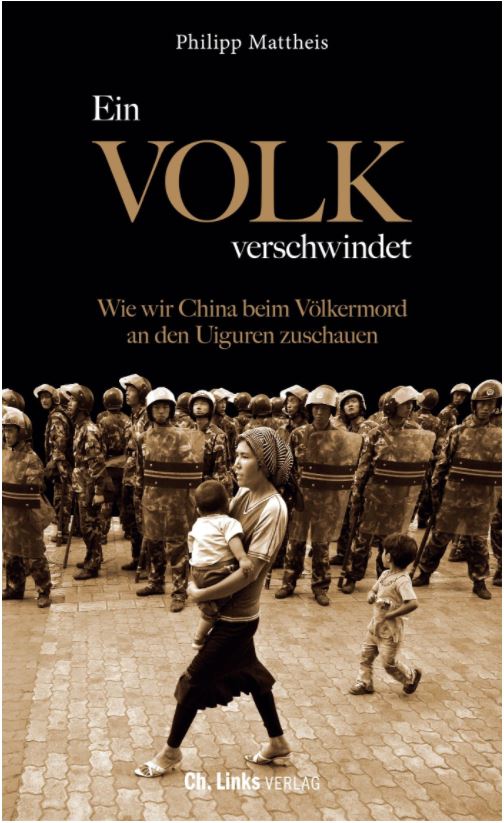
»Sie werden Baumwollfelder besichtigen und die Wahrheit und Fakten respektieren.«
Gao Feng, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, 2021
Bis vor kurzer Zeit hatten die meisten Menschen von dem Turkvolk im Westen Chinas noch nie etwas gehört. Xinjiang, die Stammheimat der rund 15 Millionen Uiguren, ist eine der ärmsten Provinzen Chinas. Während zum Jahreswechsel 2020/21 die Staatschefs mehrerer EU-Länder hinter verschlossenen Türen ein Handelsabkommen mit Peking aushandelten, schlugen Menschenrechtler Alarm. Peking hatte in der Region Xinjiang in den vergangenen Jahren eine digitale Dystopie errichtet. Die totale Überwachung ist – zumindest für die Minderheit der Uiguren – Wirklichkeit geworden. Bis zu zwei Millionen Menschen werden monatelang in »Umerziehungslagern« festgehalten. Folter, Zwangsarbeit und Gehirnwäsche sind dort an der Tagesordnung. Anfangs basierten die Meldungen noch auf Gerüchten und wenigen Berichten derer, die entkommen sind. Mittlerweile aber sind die Menschenrechtsverletzungen der kommunistischen Partei Chinas gut belegt.
Auf der einen Seite werden seit Jahren Milliarden in die Region investiert. Auf der anderen Seite schließen Pekings Beamte aber auch Moscheen, untersagen religiöse Feste und erlassen sogar Kleidervorschriften, um die Religion aus dem Alltag der Menschen zu verbannen. Uralte Oasenstädte wie Kashgar werden unter dem Vorwand der Modernisierung ihrer einzigartigen Architektur beraubt. Den Verlust der kulturellen Identität sollen Wirtschaftswachstum und Infrastruktur ausgleichen. Das ist das Rezept, mit dem die kommunistische Partei Chinas spätestens seit 1990 das Riesenland regiert.
Recherchen in Xinjiang sind nie einfach gewesen. Angst, Diskriminierung und Beamtenwillkür waren immer spürbar. Doch anders als zum Beispiel in Tibet, das seit Jahren für ausländische Journalisten komplett gesperrt ist, waren und sind Reisen nach Xinjiang noch immer erlaubt. Eine tiefergehende Berichterstattung aber ist kaum mehr möglich.
Vor etwa zehn Jahren mussten Journalisten sich zwar offiziell anmelden, wenn sie in Xinjiang recherchieren wollten, aber wie zu dieser Zeit noch oft in China waren die Vorschriften lax und folgten eher dem »Cha Bu Duo«-Prinzip, welches eine gewisse Larifari-Mentalität beschreibt und sich grob mit »passt schon« übersetzen lässt. Eine »Mann-Deckung«, also die direkte Verfolgung durch Beamte, gab es nur selten, und nahezu alle Städte und Landstriche Xinjiangs waren prinzipiell zugänglich, auch wenn man hin und wieder mit Behinderungen rechnen musste. Fernsehteams hatten es insgesamt schwerer, weil sie als Menschengruppe und durch ihr Equipment für mehr Aufmerksamkeit sorgten als ein einzelner Print-Journalist, der sich im Notfall immer als Tourist ausgeben konnte.
Aber das traf auf viele Teile Chinas zu, wenn man zu heiklen Themen recherchieren wollte. Vieles hing auch von der Willkür der zuständigen Beamten ab. Während manche Polizeichefs sich wenig Gedanken über Ausländer in der Region machten und Journalisten in Ruhe ließen, sobald diese versichert hatten, keine Fotos zu machen, waren andere übervorsichtig. Dennoch: In dieser Zeit waren Gespräche mit Uiguren möglich. Viele ließen sich zwar lieber anonym zitieren, aber ihnen war es ein Anliegen, dass die Welt etwas über die Situation in Xinjiang erfuhr. Die Angst vor den Konsequenzen war noch nicht so groß, dass sie mit niemandem sprechen wollten, wie es später der Fall war. Das änderte sich etwa um die Jahre 2016/2017, als das Lagersystem aufgebaut wurde.
Harald Maass, Journalist und ehemaliger China-Korrespondent der Frankfurter Rundschau, flog im Frühsommer 2018 in die kasachische Hauptstadt Almaty. Von dort aus bestieg er einen Bus, der ihn zur chinesischen Grenze brachte. Sein Plan: Mit eigenen Augen zu sehen, was in der Provinz Xinjiang vorging, die er zum ersten Mal in seinem Leben 1987 bereist hatte. Und um einem Verdacht nachzugehen: Ein kanadischer Student hatte über Google Maps und Satellitenaufnahmen Anlagen identifiziert, die wie Lager aussahen. Gerüchte darüber, dass es in Xinjiang Arbeits- oder Umerziehungslager gab, kursierten schon länger. Zu diesem Zeitpunkt aber stritt die chinesische Regierung deren Existenz noch rigoros ab.
Maass reiste mit einem Touristenvisum ein, das er zuvor in München beantragt hatte. »Mich wunderte es, dass es tatsächlich ausgestellt wurde. Heute wäre das völlig unmöglich«, erzählt er knapp drei Jahre später. Maass traf außerdem diverse Vorsichtsmaßnahmen. Er löschte jegliche Dateien von seinem Computer, die in den Augen der chinesischen Sicherheitsbeamten irgendwie verdächtig aussehen könnten. Die Fotos, die er auf seiner zweiwöchigen Reise durch die Provinz machte, lud er über ein Virtual Private Network (VPN) hoch und löschte sie anschließend wieder. Seine Notizen schrieb er in ein Heft, verklausulierte und chiffrierte sie als harmlose Tagebucheinträge, sodass auch sie keinen Verdacht erregen konnten. »Mir war bewusst, dass mir all das als Spionage ausgelegt werden könnte«, sagt der Journalist an einem sonnigen Junitag in München.
»Was ich dann aber tatsächlich sah, übertraf meine schlimmsten Befürchtungen.« Maass schildert die Provinz als ein gigantisches Freiluftgefängnis, in dem die Uiguren auf Schritt und Tritt überwacht, kontrolliert, gescannt, registriert und diskriminiert werden. Am schlimmsten sei die Situation im Süden der Provinz. Nachts glichen die Städte einer einzigen Polizeikontrolle: Überall Blaulicht, bewaffnete Soldaten, die herumbrüllten, Durchsuchungen. Maass selbst wurde in den zwei Wochen 57 Mal kontrolliert.
Sämtliche Interviews mit ehemaligen Insassen der Lager und Familienangehörigen von Inhaftierten führte er in Kasachstan. In Xinjiang selbst beschränkte er den Kontakt mit Uiguren auf ein absolutes Minimum. »Das Wichtigste für mich war, dass niemand durch meine Arbeit in Gefahr geraten würde. Wenn in Xinjiang jemand mit einem Ausländer gesehen wird, droht ihm sofort ein Verhör oder Lagerhaft.« Die Geschichte, die Maass dann schrieb, wurde im März 2019 im Magazin der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Sie gewann den renommierten Deutschen Reporterpreis und wurde für den Theodor-Wolff-Preis nominiert.
Etwas später ist auch der französische Fotograf Patrick Wack zum letzten Mal in Xinjiang gewesen. »2019 folgten mir ein oder zwei Männer mit etwas Entfernung. Es handelte sich dabei oft um Uiguren. Sie waren übrigens sehr freundlich, das führte manchmal zu absurden Situationen. Ich sagte meinen Aufpassern, ich führe morgen hier- oder dorthin, und sie freuten sich mitzukommen.« Das täuschte aber nicht über die Repressionen hinweg. Wack führte immer zwei Fotokarten mit sich. »Ich wurde im Schnitt alle zwei Tage von einem Polizisten aufgefordert, meine Fotos zu löschen. Deswegen hatte ich eine JPEG-Fotokarte bei mir, mit der ich demonstrierte, dass ich die Fotos gelöscht hatte, während die zweite Karte sicher war. Jeden Abend machte ich zudem mehrere Kopien auf meinem Laptop und lud die Fotos über Filesharing-Dienste hoch.«
Die plumpe »Mann-Deckung« ist inzwischen von einer smarten, digitalen Überwachung abgelöst worden. Im Juni 2021 war Christoph Giesen, langjähriger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, in Xinjiang und beschrieb, dass sich die Lage vordergründig entspannt habe. »Noch vor einem Jahr wurde man Schritt für Schritt von mindestens einem Mann mit Handy verfolgt. Fuhr man mit dem Auto, folgten einem Wagen ohne Nummernschilder. Mittlerweile aber ist das System ausgefeilter: Man hat die Städte, und eigentlich die ganze Provinz, in Zonen aufgeteilt. Überquert man eine Zonengrenze, wechselt automatisch auch das Personal, das einen verfolgt. Hinzu kommt, dass der Bewegungsradius durch Covid-Beschränkungen stark eingegrenzt ist. Da man nur in bestimmten Hotels übernachten darf, kann man maximal 200 Kilometer ins Land fahren«, erzählt er.
Gesprächspartner zu finden, die etwas über die tatsächliche Situation erzählen, ist dagegen noch schwieriger geworden. Es scheint, als hätten die massive Einschüchterung, Traumatisierung und Propaganda der Lager ihren Effekt gehabt: »Immer öfter bekommt man nichts als die Regierungspropaganda zu hören«, sagt Giesen.
Die kommunistische Partei versucht aber nicht nur, das Informationsmonopol innerhalb Xinjiangs zu kontrollieren. Ihr Einfluss auf das Narrativ macht sich auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets immer deutlicher bemerkbar. Was das bedeutet, erfuhr im Juli 2021 wieder der französische Fotograf Patrick Wack. Seine Bilder zeigen oft seltsam entrückte Landschaften und Menschen, die etwas von fremder Schönheit und tiefer Trauer erzählen. Sie fanden Eingang in den Fotoband »DUST«, der im Herbst 2021 erschien. Etwas vorher aber, im Juli 2021, landeten zehn von Wacks Xinjiang-Bildern im Instagram-Feed des Unternehmens Kodak, mit dem er eine Kooperation hatte. Eines davon zeigt eine junge Frau auf einer grünen Wiese in scheinbarer Einsamkeit. Darunter stand »Massenarbeitslager werden in der Region aufgebaut – ein Zeugnis für Xinjiangs abrupten Abstieg in eine Orwell’sche Dystopie«. Schnell sprangen nationalistische chinesische Internetuser darauf an und bombardierten sowohl Wack als auch Kodak mit Nachrichten. »Falls Du in China bist, solltest Du ausgewiesen werden. Ich werde Dich der Polizei melden«, schrieb ein User namens »chinese_united«, und das war noch einer der harmloseren Kommentare.
»Ich habe Hunderte von Hass-Nachrichten bekommen, die mich als CIA-Agenten beschimpfen, der westliche Propaganda betreibt, als Rassist und vieles mehr«, sagt Wack. »Manche riefen mich sogar an. Noch befremdlicher war es, dass sich auch Amerikaner und Europäer darunter befinden, also Leute, die nicht jeden Tag mit chinesischer Propaganda bestrahlt werden und es besser wissen müssten.«
Kodak knickte ein: Die Verantwortlichen löschten Wacks Foto, mit dem Hinweis, man wolle sich aus politischen Angelegenheiten heraushalten. »Die politischen Ansichten von Hr. Wack entsprechen nicht denen von Kodak, und Kodak befürwortet diese auch nicht. Wir bitten um Entschuldigung für die Missverständnisse und Verletzungen, die dieser Post verursacht haben könnte.«
Auch der nationalistischen chinesischen Zeitung Global Times war das einen eigenen Artikel wert. In dem gab man sich naiv und führte die Idylle, die Wack auf seinen Fotos oft zeigt, als Beweis dafür an, dass es keine Arbeitslager gebe. Dem Fotografen unterstellte man Gier nach Geld und Aufmerksamkeit.
Wack, der mehrere Jahre in Shanghai verbracht hat und mittlerweile in Berlin lebt, meint zum Vorgehen von Kodak: »Indem sie eingeknickt sind, haben sie nun alle verärgert. Es ist peinlich.« Der Fotograf wiederum erhielt zahlreiche Mails und Posts, die das Vorgehen von Kodak verurteilten und sich solidarisch mit Wack erklärten.
Teil der aktuellen Phase der Informationskontrolle über Xinjiang ist eine aktive, aggressivere PR-Kampagne, an der sich auch nicht-chinesische Blogger beteiligen, die scheinbar ahnungslos schöne Landschaften und gutes Essen schildern. Die KPCh organisiert Touren für ausländische Unternehmen, Touristen und Journalisten nach Xinjiang, um ihnen dort eine perfekte Welt vorspielen zu können: Anfang Juli 2021 verkündete das chinesische Wirtschaftsministerium, »in der nahen Zukunft werden ausländische Unternehmer die Region besuchen«. Gao Feng, der Sprecher des Ministeriums, sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua: »Sie werden Baumwollfelder und -anlagen besichtigen und die Wahrheit und Fakten respektieren.« Diese Potemkinschen Dörfer werden in den kommenden Jahren der Weltöffentlichkeit vorgespielt werden und so die Meinung prägen – wenn es nach den Plänen des Regimes geht.
Zu der perfekten Scheinwelt, die Peking dort aufgebaut hat, kommt, dass die Umerziehungskampagne langsam abgeschlossen wird. Nach und nach scheinen die Lager nun wieder verkleinert zu werden. »Die chinesische Strategie der kulturellen Auslöschung der Uiguren tritt in eine neue Phase ein«, sagt der Aktivist und Datenforscher Adrian Zenz, der mit seiner akribischen Arbeit einen wichtigen Teil zur Wahrheitsfindung geleistet hat. »Die ersten Lager werden geschlossen. Arbeitsmaßnahmen sollen die Folter und Gehirnwäsche ersetzen.«
Für Journalisten und damit auch für die Weltöffentlichkeit wird es in Zukunft noch schwerer werden, hinter die Fassade zu schauen. Peking will die Verbrechen der vergangenen Jahre möglichst schnell unter den Teppich kehren und sowohl dem eigenen Volk als auch der Weltöffentlichkeit alles als Erfolg verkaufen: Radikale Maßnahmen seien nötig gewesen, um terroristische Elemente zu eliminieren, und nun könne jeder nach dem Pekinger Modell zu Wohlstand gelangen.
Zum Glück wächst inzwischen die Solidarität mit dem Schicksal der Uiguren. Menschenrechtsorganisationen, engagierte Politiker und Kenner der Region weisen vermehrt auf die Missstände hin und fordern westliche Regierungen zum Handeln auf: Das Schicksal der Uiguren muss (ähnlich wie das der Tibeter) in den kommenden Jahren vermehrt auch unser Verhältnis zum Regime in Peking bestimmen. Sonst laufen wir Gefahr, unsere Werte für steigende Absatzzahlen von Automobilkonzernen zu opfern. Indem wir uns zu schweigenden Mitwissern der Verbrechen machen, werden wir dem Regime ähnlicher, als wir es wollen.
“Ein Volk verschwindet: Wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen” von Philipp Mattheis erscheint am 17. Januar 2022 im Ch. Links Verlag.
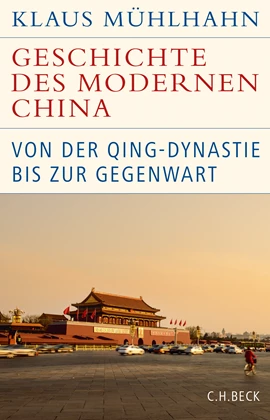
Klaus Mühlhahn hat acht Jahre daran gearbeitet, Chinas Entwicklung von der Qing-Dynastie bis hin zu Xi Jinping nachzuzeichnen. Er sei dabei vor allem solchen Organisationen und Regelwerken auf den Grund gegangen, die das Land geprägt haben, sagt der Sinologe und Kulturwissenschaftler. Wie haben diese Institutionen China verändert? Wie hat ihr Einfluss wiederum das Leben der Menschen im Land beeinflusst? Das sind die zentralen Fragestellungen, die sich als roter Faden durch das 760-seitige Mammutwerk ziehen.
Mühlhahn erzählt Chinas Geschichte auf dem neuesten Stand der Forschung. Dabei wird klar, dass es China nicht um eine Aufholjagd zum Westen geht – sondern darum, wie der Weg zu einer chinesischen Moderne geebnet und dabei immer wieder angepasst werden kann.
Geschichte des Modernen China
Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart
Klaus Mühlhahn
C.H.Beck
760 Seiten
ISBN:978-3-406-76506-3
39,99 Euro (gebunden), auch als E-Book erhältlich
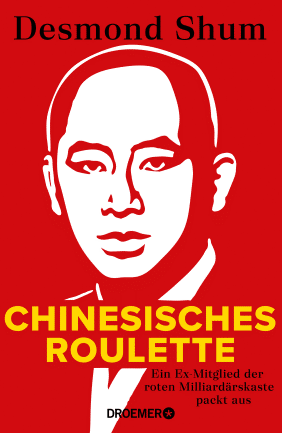
Kurz bevor sein Buch “Red Roulette” im Herbst veröffentlicht wurde, erhielt Desmond Shum zwei Anrufe von seiner bis dahin verschollen geglaubten Exfrau Whitney. Shum hatte vier Jahre nichts mehr von ihr gehört. Aus ihrem gut gesicherten, mit Marmor ausgeschmückten Pekinger Büro war sie am 5. September 2017 nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, erzählt Shum. Und nun flehte sie ihn plötzlich vom anderen Ende der Leitung an, die Veröffentlichung des Buches in letzter Minute abzusagen. Dabei hatte Shum das Buch auch geschrieben, um ihrem gemeinsamen Sohn zu erklären, wo seine Mutter sein könnte und wie es dazu kam, dass sie eines Tages plötzlich spurlos verschwunden war.
Whitney Duan (auch Duan Weihong) war als Geschäftsfrau in den höchsten Kreisen der Kommunistischen Partei über Jahre hinweg bestens verdrahtet. Die Frau des damaligen Ministerpräsidenten Wen Jiabao nannte sie einfach nur “Tante Zhang”.
Ein zentraler Aspekt in Shums Memoiren über die Geschäftsbeziehungen seiner Exfrau zur KP-Elite Zhongnanhais ist der Börsengang von Ping An, einem der größten Versicherer im Land, im Jahr 2004. So sollen Verwandte von Wen Jiabao vor dem IPO in Ping An investiert haben. Shum berichtet über die Korruption innerhalb der Partei dabei nicht als Außenstehender, sondern als einer, der die Geschäfte der “roten Aristokratie” begleitet und daran mitverdient hat. Sein Buch zeichnet ein spannendes Bild darüber, wie Chinas Elite in den Nullerjahren mit Geld, Macht und Willkür ihre Position immer mehr gefestigt und ausgebaut hat.
Red Roulette – Chinesisches Roulette
Desmond Shum
Droemer HC
312 Seiten, übersetzt von Stephan Gebauer
ISBN: 978-3-426-27878-9
22 €, deutsche Ausgabe erscheint am 1.Februar 2022
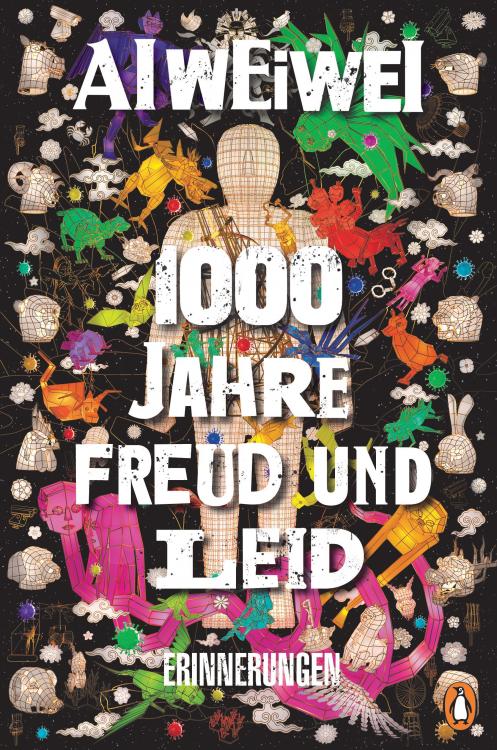
Ai Weiwei hat ein Buch für seinen Sohn geschrieben. Es soll einen Einblick in Ais Leben geben – wohl auch weil der Künstler selbst kaum jemals offen mit seinem eigenen Vater über dessen Vergangenheit sprechen konnte. So ist das Buch auch eine Hommage an Ai Weiweis Vater Ai Qing, der zu Lebzeiten ein bekannter Dichter in China war. Wenn Ai von seinem Vater erzählt, so tut er dies vor allem, indem er dessen Gedichte mit einfließen lässt und Fiktion und eigene Erinnerungen miteinander vermischt.
Als Zehnjähriger während der Kulturrevolution hatte Ai mit seinem Vater über ein Jahr in einer Erdhöhle in der Region Xinjiang gelebt. Für seine Kritik an Mao Zedong war Ai Qing aufs Land verschickt worden, wo er Toiletten putzen musste. Erst 1979 wurde er rehabilitiert und durfte wieder publizieren. Die Unerschütterlichkeit seines Vaters habe damals einen tiefen Eindruck in ihm hinterlassen, schreibt Ai Wei Wei, der selbst 81 Tage in Isolationshaft verbringen musste. Am 3. April 2011 hatten ihn Polizisten in Zivilkleidung am Flughafen von Peking festgenommen und an der Ausreise gehindert. Sein eigener Sohn war damals gerade zwei Jahre alt.
“Während meiner eigenen Zeit der erzwungenen Isolation verspürte ich das Bedürfnis, meine Beziehung zu meinem Vater zu überdenken, und ich beschloss, einen Bericht über sein und mein Leben zu schreiben und diesen meinem Sohn Ai Lao mitzuteilen”, erklärt Ai Weiwei seine Beweggründe, das Buch zu schreiben.
Parallel sind auch Ai Qings Poesien übersetzt und kommentiert von Susanne Hornfeck bei Penguin unter dem Titel “Schnee fällt auf Chinas Erde” erschienen.
1000 Jahre Freud und Leid: Erinnerungen
Ai Wei Wei
Penguin Verlag
416 Seiten, aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Elke Link
ISBN: 978-3-328-60231-6
38 €, auch als E-Book erhältlich
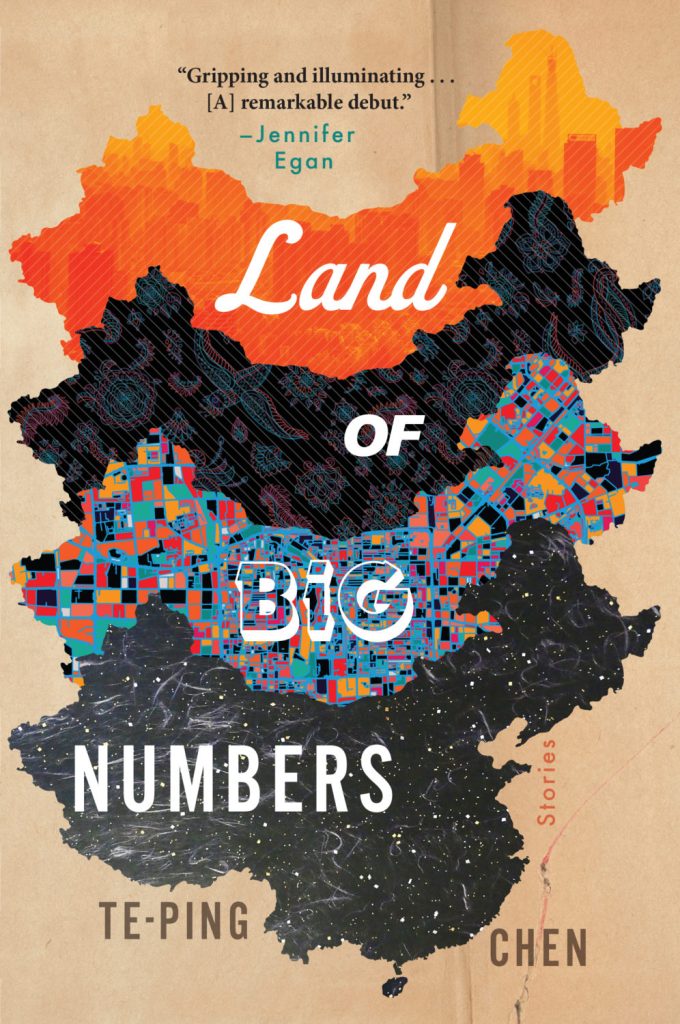
Dieses Buch ist entgegen des Titels keine Ansammlung von Statistiken und Daten zu China. Die amerikanische Journalistin Te-Ping Chen hat vielmehr Kurzgeschichten zusammengestellt, die von ihrer Arbeit als Korrespondentin für das Wall Street Journal in China inspiriert wurden.
Komplex und divers beschreibt Chen die Lebensumstände der Menschen in China, indem sie die Handlung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen verquickt. So ist das Internet eines der Schlüsselthemen in einer Erzählung über ein Zwillingsgeschwisterpaar. Während der Bruder durch das Internet zum Wohlstand aufsteigt, weil er Onlinevideospiele entwirft, wird es für seine Schwester immer mehr zur Bedrohung. Sie, die sich im Gegensatz zu ihrem Bruder in der Schule angestrengt hat und gute Noten mit nach Hause brachte, äußert sich kritisch in einem Online-Forum. Für ihre Meinung zu Ungerechtigkeiten landet sie schließlich im Gefängnis. Am Ende fragt sich der Vater der Zwillinge, wer der beiden richtig gehandelt hat und was im rasanten Wandel der Gesellschaft wirklich Sinn ergibt – Fragen, die auch die Leser im Westen beschäftigt.
Land of Big Numbers
Te-Ping Chen
Verlag Clarion Mariner
236 Seiten, ist auf Barack Obamas Reading List
ISBN-13/EAN: 9780358272557
$ 15,99, auch erhältlich als E- und Audio-Book
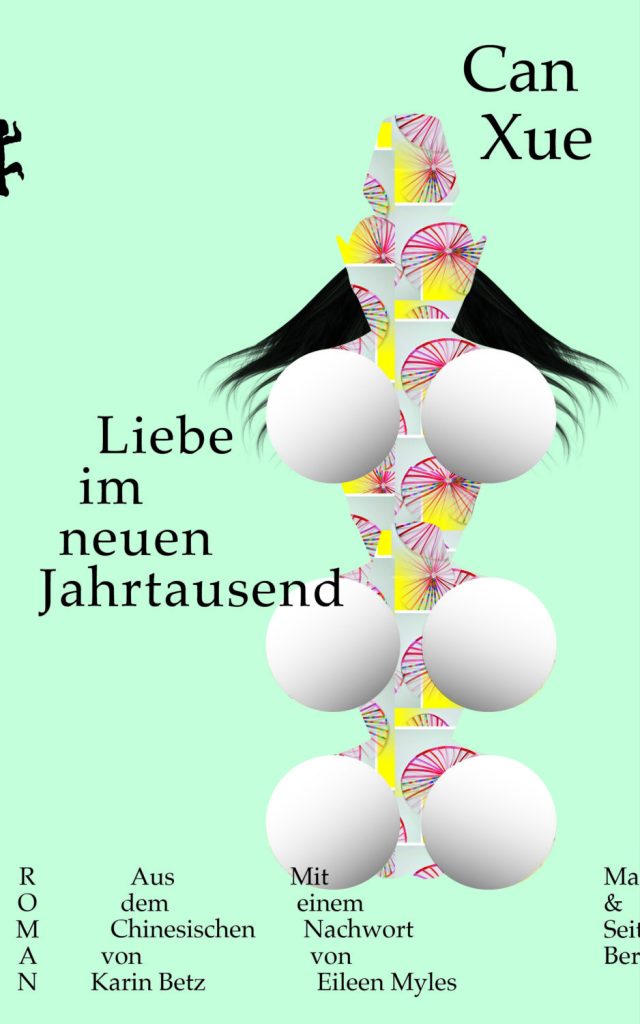
Paranoia und Misstrauen prägen Wei Bos Liebschaft zur Witwe Cuilan. Auch sie schwankt in ihren Gefühlen. Denn ihr Ideal von Liebe ist, dass sie so flüchtig sein soll wie der Morgentau.
Kennengelernt haben sich die beiden in einem Wellnesshotel, das auch noch ganz andere Dienstleistungen anbietet. Bo fragt sich, ob er sich von Cuilan trennen soll, weil er sich ihr so vertraut fühlt wie sonst nur seiner Frau. Ihre Beziehung befindet sich ständig in der Schwebe. Als sie ihm schließlich eine echte Chance geben will, muss er plötzlich ins Gefängnis.
Alle Facetten der Liebe durchleuchtend, beschreibt Can Xue das Leben von vier Frauen, die um den männlichen Protagonisten Wei Bo kreisen. Ihr Alltag ist geprägt von existentiellen Fragen und Ängsten. Alle stehen ständig unter (gegenseitiger) Beobachtung. Das Wellnesshotel wird dabei zum Ort der Zuflucht, um den zahlreichen Verschwörungen und dem gesellschaftlichen Druck zu entkommen. Auch traditionelle chinesische Heilpflanzen spielen in Can Xues Roman eine Rolle. Sie sollen den Weg zu einem neuen Selbst und zu echtem Glück weisen.
“Wenn es eine chinesische Kandidatin für den Nobelpreis gibt, dann ist es sicher Can Xue”, urteilte einst die Schriftstellerin Susan Sontag. Can Xue gilt als eine der wichtigsten Autorinnen der Gegenwart. 1953 in Changsha geboren, lebt sie seit zwanzig Jahren in Peking und hat es geschafft sich als eine der wenigen Frauen in der chinesischen Literatur- und Avantgardeszene auch international einen Namen zu machen.
Liebe im neuen Jahrtausend
新世纪爱情故事 (Chinesisch)
Can Xue
Matthes & Seitz Berlin
398 Seiten, übersetzt von Karin Betz mit einem Nachwort von Eileen Myles
ISBN: 978-3-7518-0054-9
26 €, auch als E-Book erhältlich
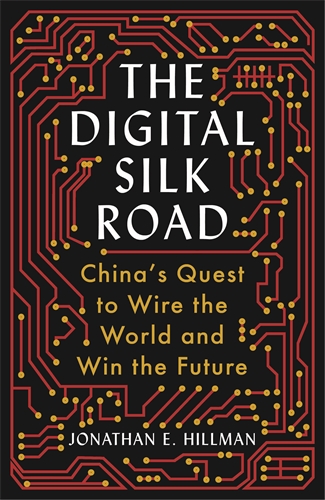
Ob 5G, Smart Cities oder die Great Firewall – China hat in den letzten Jahren auch im digitalen Raum für Aufsehen gesorgt. Digitale Infrastruktur und Tech-Produkte sind mittlerweile ähnliche Exportschlager wie Flughäfen, Straßen und Häfen. Doch baut China an einer digitalen Seidenstraße? Das neue Buch von Jonathan Hillman, Direktor am Reconnecting Asia Project der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies, erweckt im Titel (The Digital Silk Road – China’s Quest to Wire the World and Win the Future) diesen Eindruck. Nach den gut 350 Seiten kennt der Leser viele spannende Details des digitalen Aufstiegs Chinas. Doch sein Bild einer digitalen Seidenstraße und ihren Implikationen bleibt oft vage.
Dabei fängt Hillmans Buch sehr informativ an. Nach einer Einleitung über den (Irr)Glauben westlicher Staatenlenker, dass Informationstechnik die Freiheit auf der Welt vorantreiben werde, steigt der Autor direkt in die Materie ein. In zwei starken Kapiteln beschreibt er den Aufstieg Huaweis zum digitalen Weltkonzern und die allgegenwärtige Überwachung durch Kameras in Chinas Städten.
Hillman erläutert detailliert die Kombination aus Staatskapitalismus, Naivität westlicher Unternehmen und der Unverfrorenheit des Huawei-Managements, die zum Aufstieg des Konzerns beitrug. Es ist eine Kombination, die exemplarisch für den Aufstieg vieler Tech-Firmen Chinas steht. Westliche Unternehmen wiederum waren bereit, im Austausch für den Marktzugang nach China ihre Technologien mit Huawei zu teilen. Derweil schreckte Huawei laut Hillman nicht vor Industriespionage zurück und kopierte die Technik ausländischer Unternehmen. Das Kopieren sei so weit gegangen, dass sogar die Tippfehler in Bedienungsanleitungen für Cisco-Produkte übernommen wurden.
Doch Huawei bediente sich auch legaler Praktiken. Das Unternehmen wurde 17 Jahre von IBM beraten und erlernte dabei wichtige Management-Praktiken, die beim Aufstieg zum Weltkonzern halfen. Huawei und andere chinesische Tech-Firmen strebten in den letzten Jahren vor allem in Märkte, die von westlichen Konkurrenten fast komplett vernachlässigt wurden. Hillman zufolge hat Huawei auf diese Weise gut 70 Prozent des 4G-Netzes in afrikanischen Staaten aufgebaut.
Im folgenden Kapitel beschreibt Hillman das Ausmaß der technologischen Überwachung in China. Die Volksrepublik sei heute der größte Exporteur von Überwachungskameras. Doch Hillman bleibt bei seinen Ausführungen nüchtern und überzeichnet die Situation nicht. So weist er auf Unzulänglichkeiten im System hin. Zum Beispiel gebe es mittlerweile so viele Video-Aufzeichnungen aus Chinas Städten, dass sie kaum noch ausgewertet werden könnten. Künstliche Intelligenz sei dazu noch nicht in der Lage. Auch beim Export der Technik etwa für Smart Cities verspricht China laut Hillman mehr als es halten könnte.
Der Volksrepublik werde häufig vorgeworfen, mit den Überwachungskameras auch den “autoritären Führungsstil” zu exportieren. Doch diese Schlussfolgerung sei zu simpel, urteilt Hillman. Technologie sei nur ein Werkzeug. Es komme auf die lokalen Umstände an, wie sie eingesetzt wird und ob sie überhaupt zu dem Ausmaß an Überwachung fähig sind, wie die Hersteller bewerben.
Nach diesen beiden Kapiteln freut sich der Leser, eine Fortsetzung von Hillmans “The Emperor’s New Road” in den Händen zu halten. In diesem 2020 erschienen Buch beschreibt Hillman die Chinesische Seidenstraßen-Initiative: Mythen, die sich um das Infrastrukturprojekt ranken und Probleme, denen China und seine Partner beim Bau der vielen Infrastrukturprojekte gegenüberstehen.
Doch in den nächsten Kapiteln verliert sich der Autor von “The Digital Silk Road” leider zu sehr in Details und im Konjunktiv. Ihm gelingt es viel zu selten, den Bogen zu schlagen von den einzelnen Themen hin zur digitalen Seidenstraße.
Ein Beispiel ist Hillmans Beschreibung, wie China beim Bau von Unterseekabeln zur Vernetzung der Welt Fuß gefasst hat. Die Kabel “skizzieren ein auf China ausgerichtetes globales Netzwerk, das es vor einem Jahrzehnt noch nicht gab”, schreibt der Autor. China sei noch nicht gleichauf mit entwickelten Ländern. Allerdings erläutert Hillman dann nicht mehr, welche Probleme mit diesem Netzwerk einhergehen.
Im vorletzten Kapitel franst das Buch dann leider komplett aus. Hillman beschreibt, wie China Kommunikationssatelliten an andere Staaten verkauft, inklusive Start ins All. Häufig komme es dabei zur Erhöhung der Schuldenstände, ohne dass die Länder einen großen wirtschaftlichen Nutzen aus den Satelliten ziehen. Dann verliert sich Hillman jedoch in einer seitenlangen Beschreibung von sogenannten LEO-Satelliten (Low Earth Orbit), die auch von SpaceX angeboten werden. China sei hier noch nicht konkurrenzfähig, urteilt Hillman. Doch dann bleibt er sehr vage und verfällt ins Spekulieren: Die Volksrepublik könnte sich ja anschauen, welche Unternehmen mit welchen Dienstleistungen Erfolge feiern und diese kopieren.
Auch Chinas Bestreben, im Ausland vermehrt Datenzentren zu bauen, schildert Hillman nur sehr oberflächlich. Konkrete Gefahren, die damit einhergehen, benennt er nicht. Auch bleibt unklar, ob China zu den derzeitigen Cloud-Marktführern Amazon, Microsoft und Google aufschließen könne.
Und so bleibt “The Digital Silk Road” leider hinter seinem Vorgänger über die reale Neue Seidenstraße zurück. Mit “The Emperor’s New Road” erhielten Lesende einen guten Überblick über das Mammutprojekt – mit all seinen Problemen für die Partnerländer, aber auch für China selbst. Das neue Buch dagegen enthält zwar phasenweise viele interessante Detailinformationen. Doch es fehlen die größeren Zusammenhänge, Erläuterungen und ein roter Faden. Der Leser bekommt keinen Eindruck davon, ob die “Digitale Seidenstraße” wirklich existiert – oder ob sie lediglich ein cleverer Buchtitel ist.
The Digital Silk Road – China’s Quest to Wire the World and Win the Future
Jonathan E. Hillman
Profile Books
351 Seiten
ISBN: 9781788166850
19,99 Euro (gebunden)
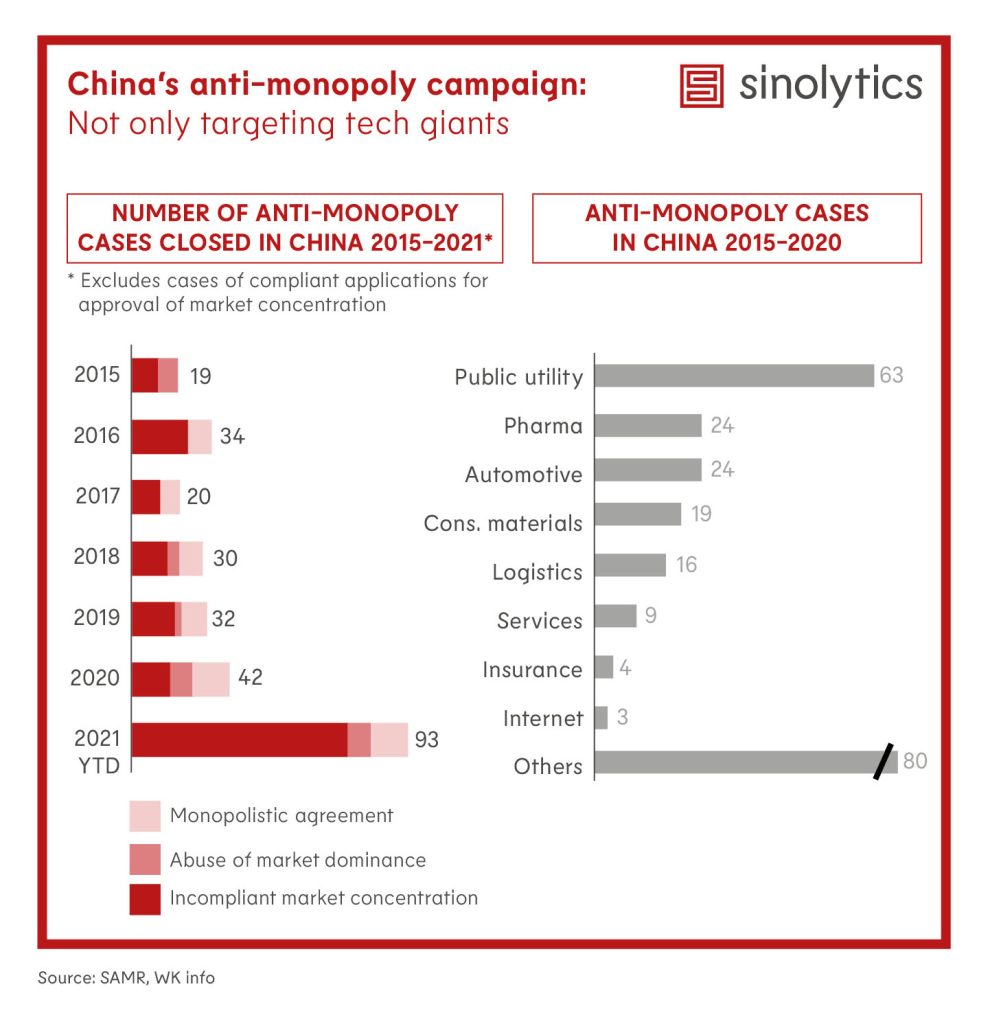
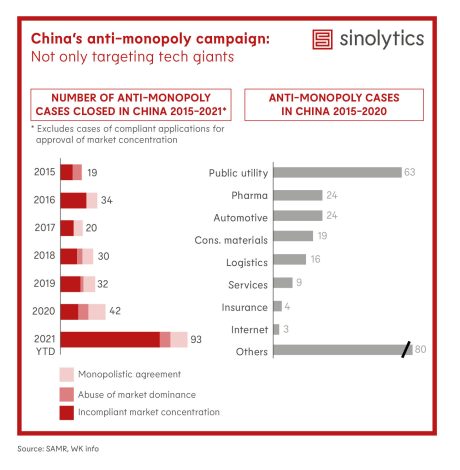
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.
Die Vetomächte China und Russland haben im UN-Sicherheitsrat “humanitäre Ausnahmen” auf Einzelfallbasis im Sanktionsregime gegen die radikalislamischen Taliban abgelehnt. Stein des Anstoßes für Peking und Moskau sei ein Absatz in dem von den USA eingebrachten Resolutionsentwurf gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Diplomaten. Dieser Absatz sollte es dem für die Afghanistan-Sanktionen verantwortlichen Komitee erlauben, bei konkretem Bedarf Ausnahmen von den Finanzsanktionen gegen die Taliban zu beschließen. China sei “grundsätzlich gegen Sanktionen” und damit auch gegen Mechanismen, die im Einzelfall Ausnahmeregelungen erlaubten, schreibt AFP.
Die USA legten bereits einen geänderten Entwurf vor, der am heutigen Dienstag beschlossen werden soll. Darin heißt es nun, dass humanitäre Hilfe für die Dauer eines Jahres grundsätzlich nicht als Verstoß gegen die Sanktionen gegen Afghanistan gewertet werde. Dieser Entwurf gilt als Übergangsregelung.
Seit 2015 gibt es die UN-Sanktionen gegen die Taliban. Diese erstrecken sich seit der Machtübernahme der Radikal-Islamisten im August auf ganz Afghanistan. Das Land steckt in einer schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise und ist in hohem Maße auf ausländische Hilfen angewiesen. Die Hilfslieferungen wurden aber seit August stark zurückgefahren. Die UNO hat daher wiederholt vor einer humanitären Katastrophe in dem Land gewarnt. ck
Wie schon länger erwartet, haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Chinas Präsident Xi Jinping miteinander telefoniert. Nach offiziellen Verlautbarungen plädierten beide bei dem Gespräch am Dienstag für eine Vertiefung der Zusammenarbeit. Xi sprach sich zudem laut einem Bericht des staatlichen chinesischen Senders CCTV dafür aus, dass regionale Probleme im Dialog gelöst und eine “Kalter-Krieg-Mentalität” entschieden abgelehnt werden sollten. Es ist der übliche Tenor, mit dem China um eine kooperative Haltung der EU und auch Deutschlands wirbt. Schon unmittelbar nach Amtsantritt der neuen Regierung hatte Peking für stabile Beziehungen geworben – gerade angesichts der kritischeren Haltung etwa der neuen Außenministerin Annalena Baerbock.
Die Bundesregierung gab nur eine sehr kurze Erklärung zu dem Telefonat ab. Regierungssprecher Steffen Hebestreit listete eine Auswahl der Themen auf: Neben der Vertiefung der bilateralen Partnerschaft und der Wirtschaftsbeziehungen sei es um die Entwicklung der EU-China-Beziehungen sowie “internationale Themen” gegangen. Das ist erst einmal nicht besonders vielsagend.
Xi plädierte derweil laut CCTV für Kooperationen bei neuen Energien und in der Digitalwirtschaft. Deutsche Firmen seien willkommen, die Möglichkeiten zu ergreifen, die sich aus der Öffnung Chinas ergäben. Umgekehrt äußerte Xi die Hoffnung, dass Deutschland ein faires Geschäftsumfeld für chinesische Unternehmen bieten werde, die in Deutschland investieren wollten. rtr/ck
China hat das erste Mal einen Atomreaktor der vierten Generation an das Stromnetz angeschlossen. Damit ist der gasgekühlte Hochtemperaturreaktor (HTGR) im Kernkraftwerk Shidaowan in der Provinz Shandong aktuell weltweit der einzige seiner Art im kommerziellen Betrieb. Der Reaktor wurde von den staatlichen Stromriesen China Huaneng Group und China National Nuclear Corporation (CNNC) gemeinsam mit der Pekinger Tsinghua-Universität entwickelt und gebaut. Er besteht aus zwei kleinen Turbinenblöcken mit einer Gesamtkapazität von 200 Megawatt (MW). Die zweite Einheit ist im Bau und soll nach Angaben der China Huaneng Group Mitte 2022 ans Netz gehen.
Der neue HTGR basiert nach Angaben von Huaneng auf deutscher Technologie, wurde aber komplett in China entwickelt. Der Lokalisierungsgrad liege bei 93,4 Prozent. Schon 2012 begann der Bau der beiden Turbinen. Die Fertigstellung verzögerte sich jedoch. HTGR-Reaktoren galten lange als sicherste Form der Atomkraft. Doch die einzigen vier jemals kommerziell genutzten Reaktoren dieser Art in den USA und Deutschland wurden aufgrund von Problemen beim Betrieb aufgegeben.
Als emissionsfreie Energieform spielt die Kernenergie bei Chinas Energiewende eine weit größere Rolle als in vielen westlichen Ländern. Daher arbeitet China mit Hochdruck an der Entwicklung eigener Reaktoren. Es ist erst gut ein Jahr her, dass im Kernkraftwerk Fuqing der erste Reaktor der dritten Generation ans Netz ging: ein Druckwasserreaktor namens Hualong One HPR-1000 mit 1.150 Megawatt Leistung (China.Table berichtete). Mehrere weitere Reaktoren dieser Art wurden seither installiert oder sind noch im Bau. Auch mit der Kernfusion experimentiert das Land.
China ist mit 51 Gigawatt (GW) installierter Leistung (Ende 2020) nach den USA und Frankreich der drittgrößte Produzent von Atomstrom. 18,5 weitere GW sind im Bau. In seinem Fünfjahresplan für 2021 bis 2025 sieht Peking die Förderung und Installation von Reaktoren der dritten Generation vor. Insgesamt soll die Kapazität bis Ende 2025 auf 70 GW steigen. Bislang trägt Atomkraft aber nur rund fünf Prozent zum Strommix bei. ck
Ehemalige Hongkonger Politiker interpretieren die geringe Beteiligung an der Parlamentswahl als klare Absage der Bürger:innen am wachsenden autoritären Einfluss der Volksrepublik China. Im Gespräch mit China.Table sagte der Aktivist Sunny Cheung, er halte das Fernbleiben vieler Wähler:innen für eine klare Botschaft, dass sie den Urnengang als reinen Schwindel bewerteten. Sie hätten diesem deshalb die Anerkennung verweigert. “Obwohl Peking die Wahlreform für Hongkong zum unvermeidbaren Mittel erklärt hat, um Stabilität und Wohlstand zu sichern, haben die Hongkonger am vergangenen Sonntag für die niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte gesorgt, um damit gegenüber der Welt ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen”, sagte Cheung. Er hatte selbst im Juni 2020 als Kandidat des pro-demokratischen Lagers für den Legislativrat kandidiert. Später im Jahr aber floh er, um einer Verhaftung in Hongkong zu entgehen. Die Wahl fand erst jetzt statt – unter komplett veränderten Bedingungen.
Die Wahlbeteiligung am Sonntag hatte auf dem historischen Tiefstand von rund 30 Prozent gelegen. Die Wahlrechtsform, die vom Nationalen Volkskongress in Peking im Frühjahr beschlossen worden war, hatte den Anteil frei wählbarer Parlamentarier drastisch reduziert. Nur 20 der 90 Abgeordneten im Legislativrat wurden nun noch direkt gewählt. 40 weitere wurden von einem pekingtreuen Wahlkomitee bestimmt. Der Rest kommt aus Interessengruppen, die der chinesischen Zentralregierung nahestehen. Alle 153 Kandidaten wurden zudem vor der Abstimmung auf ihren “Patriotismus” und ihre politische Loyalität gegenüber Peking überprüft (China.Table berichtete).
“Die Menschen in Hongkong waren sich darüber im Klaren, dass sie bei dieser Wahl nicht durch echte Demokraten vertreten sein würden. Deshalb haben sie sich geweigert, nach diesem Drehbuch mitzuspielen, nur um in Peking für gute Unterhaltung zu sorgen”, sagte Cheung. “In dieser falschen Legislative gibt es keine Autonomie und keine Legitimität.” Der 25-Jährige bezeichnet die Neubesetzung des Parlaments als Ansammlung politischer Marionetten und Jasagern. Schon seit den Regenschirm-Protesten 2014 war er in Hongkong politisch aktiv gewesen. Inzwischen lebt Cheung in den USA und tritt dort als Lobbyist für die Bewahrung freiheitlicher Bürgerrechte in Hongkong ein.
Auch der frühere Parlamentarier Ted Hui betonte im Gespräch mit China.Table die mangelnde Glaubwürdigkeit des künftigen Legislativrates. “Die geringe Wahlbeteiligung ist eine deutliche Botschaft der Menschen: Die Wahl ist in ihren Augen irrelevant und illegitim. Die Mehrheit lehnte es ab, diesem Parlament Geltung zu verschaffen.” Auch Hui ist aus Hongkong geflohen und lebt heute in Australien (China.Table berichtete). grz
Die Zahl der Apps in chinesischen App-Stores ist in den letzten drei Jahren um 38,5 Prozent geschrumpft. Das belegen Zahlen des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT). Demnach waren Ende 2018 noch rund 4,52 Millionen Anwendungen zum Download verfügbar. Im Oktober 2021 war die Zahl auf 2,78 Millionen zurückgegangen.
Der Rückgang wird von Marktbeobachtern auf eine Konsolidierung des App-Marktes und eine strengere Internetregulierung durch die Regierung zurückgeführt. Betroffen sind laut einem Bericht der South China Morning Post vor allem Videospiele. Im August hatte die Landesverwaltung für Presse und Publikationen eine neue Regel erlassen, die die Spielzeit für User unter 18 Jahren auf bestimmte Wochentage und Zeitfenster beschränkt. Seit Juli 2021 haben die chinesischen Aufsichtsbehörden zudem keine neuen Online-Spiele mehr zum Verkauf zugelassen. fpe

Als Françoise Hauser Mitte der 1990er-Jahre ihren Sinologie-Magister frisch in der Tasche hatte, wurde ihr bei einem Besuch auf dem Arbeitsamt gleich eine Umschulung vorgeschlagen. “Mit Chinesisch konnte man damals noch nicht viel anfangen”, sagt die 1967 in Mainz geborene Schriftstellerin. Nach einem kurzen, aber intensiven Intermezzo bei einer Computerfirma landete sie schließlich doch wieder bei China. Zum Glück: Ihre Kompetenz hat die weitgereiste Autorin und Journalistin seitdem in über 30 Bücher einfließen lassen. Gut ein Drittel dieser Werke handelt von China.
In einem davon räumt sie humorvoll mit “20 populären Irrtümern über China” auf, etwa der Vorstellung, dass Chinesen jeden Tag Reis oder sogar Hund und Katze essen. Im Reiseführer “Kulinarisch Chinesisch” erläutert sie wie man vor Ort eine chinesische Speisekarte “Wort für Wort” entziffert. In ihrer “Gebrauchsanweisung Chinesisch” vertieft Hauser ihre Einführung in “die meistgesprochene Sprache der Welt”. Dabei beantwortet sie grundlegende Fragen – angefangen bei: “Wie gelingt es wirklich, den Einstieg in die Sprache zu schaffen?” Bei Chinesisch-Lernenden steht das Buch bis heute hoch im Kurs: Der Band, der 2015 bei Reclam erschien, wurde schon mehrfach nachgedruckt.
Hauser selbst hat ihr Chinesisch-Studium unter anderem auf Taiwan und im ostchinesischen Nanjing absolviert. “Als ich 1989 in Nanjing studierte, gab es da gerade mal drei Hochhäuser”, erinnert sie sich. “Heute ist da wie fast überall eine Skyline.”
Wenn Hauser über China spricht, sprudelt sie über vor Anekdoten. Etwa jene, wie sie einmal shuǐjiǎo (水饺), chinesische Maultaschen, essen wollte. Der Taxifahrer kutschierte sie zu einem Hotel außerhalb der Stadt , weil er glaubte, dass sie eine Mütze Schlaf – shuìjiào (睡觉) – brauche. “Jeder, der Chinesisch lernt, kennt solche Erfahrungen: Wenn man als Ausländer die Töne nicht richtig trifft und etwas ganz anderes bekommt, als man wollte”, sagt sie.
Und natürlich sind da auch noch die vielen feinen kulturellen Unterschiede, die man im Umgang mit Chinesen immer wieder überbrücken muss. Hauser ist darin Vollprofi. Nach der Uni hatte sie sich bei einem chinesischen Reisebüro beworben. Der von Feng Shui besessene Chef wollte beim Bewerbungsgespräch nur eine einzige Frage beantwortet haben: “Was ist ihr chinesisches Sternzeichen?” “Ziege”, erwiderte Hauser und bekam den Job.
Einige ihrer Erlebnisse hat die Autorin im selbstironischen Buch “In 80 Fettnäpfchen um die Welt” verarbeitet, das 2014 bei National Geographic erschien. Seit einigen Jahren vermittelt sie ihr Wissen auch in interkulturellen Vorbereitungskursen, zum Beispiel an Universitäten und für Unternehmen. “Ich wollte bei den Menschen immer ein Interesse an China wecken, das über Wirtschaft und Politik hinausgeht”, sagt sie. “Bei uns wird immer viel an China kritisiert. Chinesische Kultur und die KP Chinas sind aber nicht deckungsgleich.” Das Land ließe sich schwer auf einfache Formeln eindampfen.
Andererseits könnten auch wir einiges von den Chinesen lernen, sagt Hauser. “Wir Deutschen reden zum Beispiel oft zuerst, und halten dann inne und gucken. Diese Reihenfolge ist in China oft umgekehrt: Zuerst gucken, Lage sondieren und dann sprechen. Das ist erfolgversprechender.” Obwohl sich die Buchautorin längst auch in anderen asiatischen Ländern wie Japan und Malaysia heimisch fühlt, hat China sie nie losgelassen. Vor Corona versuchte sie, mindestens einmal pro Jahr das Land zu bereisen.
Den Allgemeinplatz, dass “China anders ist”, unterschreibt Hauser trotz ihrer langjährigen Erfahrung noch immer. “Ich werde nie alles über China wissen und das finde ich klasse.” Von der Kaffeesatzleserei, zu der sich viele China-Experten bemüßigt fühlen, hält sie dementsprechend wenig: “Hätten sich all die Prophezeiungen erfüllt, wäre China schon drei Mal zusammengebrochen und hätte dreimal die Welt erobert”. Hauser geht mit einem Alternativprogramm an das Land heran: “Ich habe beschlossen, mich immer wieder aufs Neue überraschen zu lassen. Und es ist doch so: Auch Chinesen verstehen ihr eigenes Land nicht immer.” Fabian Peltsch
Uzra Zeya wird neue Tibet-Koordinatorin der USA. Die von US-Präsident Joe Biden ernannte Diplomatin mit indischen Wurzeln steht seit 27 Jahren im Dienst der US-Regierung. Auf ihrem neuen Posten möchte sich Zeya für die “Menschenrechte und fundamentalen Freiheiten” der Tibeter einsetzen und einen “substantiellen Dialog” zwischen dem Dalai Lama und Peking fördern. Der Posten des US-Tibet-Koordinators wurde 2002 ins Leben gerufen. Die chinesische Botschaft in Washington kritisierte die Ernennung Zeyas als “politische Manipulation” und einen Versuch, “Tibet zu destabilisieren”.
Pradeep Kumar Rawat wurde am Montag als neuer indischer Botschafter in China bestätigt. Der erfahrene Diplomat spricht fließend Mandarin. Zuletzt war Rawat Botschafter in den Niederlanden. Zwischen 2003 und 2007 war er stellvertretender Chef der indischen Botschaft in Peking, und von 2007 bis 2009 Direktor für China in der Abteilung Ostasien. Rawat folgt auf Vikram Misri, der das Amt im September 2018 angetreten hatte.
Li Henan wird neuer Leiter des Rohölhandels bei Chinaoil, dem Handelsarm des chinesischen Ölgiganten PetroChina in Singapur. Das Unternehmen kauft Rohöl für die dortige konzerneigene Raffinerie. Auch handelt es mit Rohölsorten aus dem Nahen Osten, Russland und dem asiatisch-pazifischen Raum. Li löst Zhang Yufeng in dieser Funktion ab.

“Ich bin ein Star, holt mich hier raus!”, scheint Meng Lan in die Kamera zu sagen. Der Riesenpanda war am 15. Dezember aus seinem Gehege im Pekinger Zoo entkommen und muss seitdem hinter einem extra hohen Sicherheitszaun ausharren. Es war bereits der zweite Ausbruchsversuch des sechsjährigen Tieres. Zoowärter hatten ihn mit Essen zurücklocken können.
