am Montag bat ich Sie hier um Selbstprüfung: Würden Sie sich mit einem chinesischen Impfstoff gegen Covid-19 impfen lassen? Sie würden es tun? Dann gehören Sie zu einer kleinen Minderheit. In einer aktuellen Umfrage fand das Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von T-Online heraus: Nur zwei Prozent der Deutschen würden Chinas Impfstoffen trauen.
Einmal im Jahr befragt die Außenhandelskammer deutsche Unternehmen, um die Investitionsbedingungen in China zu erfassen. Christiane Kühl analysiert die aktuellen Ergebnisse. Ihr Urteil: Die Geschäfte laufen besser als erwartet, deutsche Unternehmen profitieren vom Wirtschaftswachstum Chinas. Auch spüren sie im Alltag offenbar weniger Zugangsbeschränkungen zu den Märkten, als wir das aus der Entfernung beobachten.
Der Quantenphysiker Jianwei Pan hat bis 2008 in Heidelberg und davor in Wien gearbeitet und in Deutschland ein eigenes Forschungsteam aufgebaut, bevor er nach Hefei an die Universität wechselte. Jetzt hat Pan mit seinem Team den schnellsten Quantencomputer der Welt vorgestellt.
Für Chinakenner ist Hainan bisher der Inbegriff von Sonne und Erholung. Die chinesische Regierung sieht in der Region das Potenzial eines boomenden Hightech-Standortes. Frank Sieren klopft die hochfliegenden Pläne auf ihre Realitätstauglichkeit ab.
Dass man mit “grünen” Investments nicht nur das Klima retten, sondern auch satte Renditen erwirtschaften kann, hat bisher wohl keiner so medienwirksam gezeigt wie Elon Musk. Ich empfehle Ihnen einen Blick in Nico Beckerts Analyse des aktuellen Bloomberg-Rankings der grünen Milliardäre zu werfen.

Seit Wochenanfang ist die Liste der Industriesektoren öffentlich, die in der südchinesischen Insel-Provinz Hainan künftig nur noch 15 Prozent Einkommenssteuern zahlen müssen. Dazu gehören neben dem Tourismus und Teilen des Dienstleistungssektors auch High-Tech-Firmen. Allgemein sind Unternehmen berechtigt, die viel in Forschung, aber auch in den neuen Freihafen investieren, dessen Bau im Juni vergangenen Jahres verkündet wurde. Die Liste verdeutlicht, was die Provinzregierung von Hainan plant: Laut dem Regierungsplan soll die Inselprovinz bis 2050 zu einer Mischung aus Silicon Valley, Hawaii, Cape Canaveral und Rotterdam ausgebaut werden.
Der Aufbau von Hainan gilt als eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte in China und man spricht ihm eine ähnliche Bedeutung zu wie der Aufbau der südchinesischen Megacity Shenzhen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ bereits im Juni 2018 verkünden, dass er Hainan in die größte Freihandelszone Chinas verwandeln möchte.
Hainan soll zudem als eine Art südliches Drehkreuz für RCEP, der größten Freihandelszone der Welt fungieren, die im vergangenen Jahr gegründet wurde und weite Teile Asiens umfasst. Innerhalb von vier Flugstunden kann man von Hainan aus über 21 asiatische Länder erreichen.
Das Vorhaben der Regierung ist ambitioniert. Die tropische Insel im südchinesischen Meer mit Traumstränden ist so groß wie Baden-Württemberg. Dennoch wohnen dort nur rund zehn Millionen Menschen, die erst gut 68 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften. In Baden-Württemberg hingegen leben 11 Millionen Menschen, die es auf ein BIP von rund 528 Milliarden Euro bringen. Shenzhen kommt mit seinen knapp 20 Millionen Menschen auf rund 300 Milliarden Euro.
Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung spielt der Hafen Yang Pu im Norden der Insel. Bis 2025 entsteht hier ein mehr als 120 Quadratkilometer messender Hafenkomplex mit einer Kapazität von bis zu fünf Millionen Containern pro Jahr. Das ist etwa die Hälfte von dem, was der Hamburger Hafen im Jahr umschlägt. Seit dem ersten Juni haben sich bereits über 1.500 ausländische Firmen dort angesiedelt. Ein geplanter Tunnel zum Festland soll den Weitertransport der Container erleichtern.
Schon seit einigen Jahren ist die Insel der Startplatz für die neueste Generation von Weltraumraketen. Und Hainan ist der wichtigste südliche Hafen der chinesischen Marine, wo auch Atom U-Boote stationiert sind, die das Südchinesische Meer befahren.
Die Provinz soll ein High-Tech- und Medizinzentrum werden. In der “Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone” dürfen zur Behandlung schwerer Krankheiten auch Medikamente und Behandlungsmethoden eingesetzt werden, die bislang nicht in China zugelassen sind. Ärzte aus dem Ausland können mit Sondergenehmigungen bis zu drei Jahre praktizieren.
Immer mehr Techfirmen siedeln sich dort an. Seit vergangenem Frühjahr ist auch der KI-Spracherkennungsspezialist IFlytek vor Ort. “Um ehrlich zu sein, gibt es eine große Lücke zwischen Hainan und Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen”, erklärt IFytek-Geschäftsführer Zhang Shubin. Aber dafür sei der Spielraum hier größer und die Lebensqualität sehr hoch.
Momentan ist allerdings noch der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle der Insel. Nirgendwo in China ist die Dichte an 5-Sterne-Hotels so hoch. Alle großen internationalen Ketten haben sich bereits an den Stränden niedergelassen. Vor dem Coronavirus kamen bereits 80 Millionen Touristen jährlich nach Hainan. Bis 2030 könnten es 150 Millionen sein, prophezeit die Provinzregierung. Schon jetzt dürfen Ausländer aus 59 Ländern und Regionen ohne Visum nach Hainan einreisen und 30 Tage bleiben, während auf dem Festland weiterhin strenge Einreisebestimmungen gelten.
Auch was Korruption betrifft, greift die Zentralregierung in Hainan hart durch. Er erst vergangene Woche wurde mit Wang Yong ein weiterer Spitzenpolitiker aus Hainan verhaftet und aus der Partei ausgeschlossen. Dem ehemaligen Bürgermeister von Sanya wird Korruption vorgeworfen. Außerdem wurde im vergangenen Juni der ehemalige Parteisekretär der Hauptstadt Haikou zu lebenslanger Haft verurteilt, er soll umgerechnet gut 16 Millionen Euro an Schmiergeld angenommen haben. Die Prozesse sind allerdings nicht transparent. Die Betroffenen könnten auch das Opfer eines politischen Machtkampfes geworden sein. Alte undurchsichtige Konglomerate werden derzeit zerschlagen, wie die HNA Gruppe, der größte Konzern Hainans. Drei börsennotierte Unternehmen der Gruppe hatten am vergangenen Wochenende erklärt, dass “Anteilseigner und andere zugehörige Parteien” 61,5 Milliarden Yuan (rund 7,86 Milliarden Euro) “veruntreut” hätten, wie das Wirtschaftsmagazin “Caixin” berichtete. Zusätzlich seien Kreditgarantien in Höhe von gut 46 Milliarden (knapp sechs Milliarden Euro) auf “nicht legale Weise” vergeben worden.
Trotz Corona und der Korruptionserschütterungen ist Hainans Wirtschaft 2020 um 3,5 Prozent gewachsen. Immerhin 1,3 Prozent mehr als der Landesdurchschnitt. Die Investitionen sind sogar um acht Prozent gestiegen. Selbst die Einzelhandelsverkäufe wuchsen um 1,2 Prozent, obwohl 2020 wegen Corona über 20 Prozent weniger Touristen gekommen sind.
Während Deutschland bis 2030 an die Spitze in der Quantenforschung kommen will, hat China unlängst einen Quantencomputer vorgestellt, der “innerhalb von Minuten die Lösung für eine komplexe Aufgabe” liefern kann, so die Forscher. Mit dem bisher leistungsfähigsten Supercomputer Chinas, dem “Taihulight” – weltweit die Nummer vier unter den schnellsten Supercomputern – hätte es über zwei Milliarden Jahre gedauert die selbe Aufgabe zu lösen.
24 chinesische Wissenschaftler haben im Dezember im Fachmagazin Science den neuen, weltweit schnellsten Quantencomputer “Jiuzhang” – benannt nach den ältesten mathematischen Schriften Chinas – vorgestellt. Er steht in der Universität für Wissenschaft und Technologie (USTC) von Hefei. Dabei haben sich die Wissenschaftler um den Quantenphysiker Jianwei Pan vor allem mit dem Problem des “Gaussian Boson Sampling” befasst. Für den auf Photonen basierten Quantencomputer berechneten sie die Wege und Richtungen, die Photonenteilchen in einem Labyrinth aus Strahlteilern, Prismen und über 70 Spiegeln nehmen. Wenn zwei Photonen gleichzeitig auf denselben Strahlteiler stoßen, nehmen beide den gleichen Weg und machen das Problem, dass es zu berechnen gilt, immer komplexer.
Zwanzig Jahre hat Pan mit seinem Team gearbeitet, um ein System zu entwickeln, das eine geeignete und hochqualitative Photonenquelle hat. “Es ist zum Beispiel einfach für uns, jedes Mal einen Schluck Wasser zu trinken, aber es ist schwierig, jedes Mal nur ein Wassermolekül zu trinken. Eine hochwertige Photonenquelle muss jedes Mal nur ein Photon ‘freisetzen’, und jedes Photon muss genau gleich sein, was eine ziemliche Herausforderung darstellt”, so erklärt es Pan.
Die chinesischen Wissenschaftler haben im Falle Jiuzhangs mit Lichtpulsen und nicht mit Photonen experimentiert und so beweisen können, dass lichtbasierte Quantencomputer erheblich leistungsfähiger sind.
Internationale Forscher gratulierten Pan und seinen Kollegen zu dem Durchbruch: Ian Walmsley, Physiker vom Imperial College in London schrieb in dem Fachblatt “Nature”: “Dies ist eine echte Tour de Force und ein wichtiger Meilenstein”.
Ob Quanten-Internet, -Speicher oder -Satelliten, die Kompetenzen sollen in der Quantentechnologie breit aufgestellt sein. Schon im August 2016 meldete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, dass der erste Quantenkommunikationssatellit gestartet wurde, um ein Jahr später zu berichten, dass dieser den ersten abhörsicheren Code aus dem Weltall gesendet habe.
“China ist aber mittlerweile auch in anderen Technologien sehr gut aufgestellt und konnte in den letzten Jahren zur Weltspitze aufschließen”, sagt Stefan Filipp, Professor für Physik an der TU München.
Mit bis zu zehn Milliarden Dollar fördert die chinesische Regierung jährlich das nationale Quantenprogramm an der Universität in Hefei, der nun der Durchbruch mit Jiuzhang gelungen ist.
Während diese Zahl eine Schätzung von Experten ist, gibt es verlässliche Daten, die zeigen, dass die Zahl der Patente im Bereich Quantentechnologien seit 2012 stetig zunimmt und sich im Vergleich zu den Patenten in den USA in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt haben. China meldete im vergangenen Jahr 5.164 Patente an, viel mehr als die USA mit 1.990. Mit 797 liegt Europa (Deutschland hält davon 410) weit abgeschlagen hinten.
“China verfolgt nicht nur den Weg hin zu photonischen Quantencomputern, sondern auch andere Technologien, zum Beispiel Quantencomputing mit supraleitenden Qubits. Die Führungsrolle beim optischen Quantencomputing ist auf die Karriere von Jianwei Pan zurückzuführen, der bei Anton Zeilinger mit grundlegenden Experimenten zur Quantenkommunikation mit Photonen promovierte“, sagte Filipp dem China.Table.
Pan hatte bis 2008 in Heidelberg und davor in Wien gearbeitet und in Deutschland ein eigenes Forschungsteam aufgebaut, bevor er nach Hefei an die Universität zurückkehrte. 2020 erhielt der 1970 geborene Pan den Zeiss Research Award. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen auf dem Gebiet internationaler Forschung ausgezeichnet.
In Deutschland gibt es ehrgeizige Ziele. Allein Bayern wird in den kommenden drei Jahren 300 Millionen Euro in die Quantenforschung investieren. Wie Deutschland “im globalen Wettbewerb mit starken Mitbewerbern vor allem in Asien und den USA” eine technologische Souveränität bezüglich Qauntencomputing erreichen kann, zeigt eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission. In der Studie “Roadmap Quantencomputing” betonen die 16 Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, dass Deutschland in fünf bis zehn Jahren “ein international wettbewerbsfähiger Quantencomputer mit mindestens 100 individuell ansteuerbaren Qubits” als Meilenstein erreicht haben sollte, wobei das System auf mindestens 500 Qubits skalierbar sein sollte.
Ein Qubit kann in mehr als einem Zustand gleichzeitig auftreten und in Folge können die zu berechnenden Aufgaben nicht mehr linear wie bei Bits sein, sondern exponentiell ansteigen. So kann ein Quantencomputer mit bis zu 300 Qubits 2300 Operationen gleichzeitig ausführen.
Was ein wenig technisch daher kommt, ist die essenzielle Grundlage, für einen “führenden Technologiestandort” so die Studie. Ob es nun um die Entwicklung von Medikamenten geht oder schnellere Prozessoren beim autonomen Fahren: “Für unsere Hightech-Industrie kann der Zugang zu dieser Technologie existenziell sein”, so der Physiker Stefan Filipp von der TU München und der Cheftechnologen des Laserspezialisten Trumpf, Peter Leibinger, die für den Expertenrat sprechen.
“In Deutschland muss es uns gelingen, die hervorragende Grundlagenforschung in Innovationskraft und technologische Weiterentwicklung umzusetzen. Da der Weg zum universellen Quantencomputer noch lang ist, ist dieses Ziel aber mit genügend großer Fokussierung und durch eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie durchaus noch erreichbar”, sagt Filipp.
Deutschland müsse in fünf bis zehn Jahren “im Verbund mit den europäischen Partnern in der Lage sein, an der Spitze des internationalen Wettbewerbs einen anwendungstauglichen Quantencomputer zu bauen und zu betreiben”, heißt es in der Studie. Die von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) schon im vergangenen Jahr zugesicherten zwei Milliarden Euro für die Initiative für Quantentechnologie reichen laut Expertenrat jedoch nicht.
Es brauche mehr Mittel, so der Expertenrat da noch unklar sei, welche Technologieplattform sich durchsetzen werde. Unterschiedliche Ansätze der Quantenforschung wie supraleitende Schaltkreise, Ionenfallen, Gitter mit Neutral-Atomen sollten parallel verfolgt werden, bevor entschieden werden kann, wohin die Gelder schwerpunktmäßig fließen könnten.
Auch wenn so gut wie sicher ist, dass der chinesische Quantencomputer Jiuzhang sehr leistungsfähig ist, streiten sich die Experten noch darum, wer das leistungsfähigere System hat. Während Googles Quantencomputer Sycamore supraleitende Quantenbits zum Rechnen verwendet, nutzt Jiuzhang Laserpulse. So ist Jiuzhang eigentlich kein Quantencomputer, sondern ein Quantensimulator. Doch der Wissenschaftler Pan spielt eine führende Rolle im Wettlauf um die Quantenüberlegenheit, besonders in der Quantenkommunikation. Laut chinesischen Staatsmedien will Staatschef Xi Jinping über die Quantenkommunikation Chinas Technologieführerschaft sichern.
Wohlstand mit Klimainvestments: 23 der 26 reichsten Menschen aus den Bereichen Klima- und grüne Technologien stammen aus China, wie ein neues Ranking von Bloomberg zeigt. An der Spitze des Rankings steht unangefochten Elon Musk. Der Chef von Tesla hat im letzten Jahr von einem rasant gestiegenen Aktienkurs profitiert und ein “grünes Vermögen” von 180 Milliarden Dollar angehäuft. Weitere 20 Milliarden Dollar an Vermögen stammen aus anderen Geschäftsfeldern, wie der Weltraum- und Telekommunikationsfirma SpaceX.
Hinter Musk folgt eine lange Reihe Chinesen. Am stärksten vertreten sind Anteilseigner großer E-Auto- und Batteriehersteller. Auf Platz zwei des Bloomberg-Rankings stehen die vier größten Teilhaber des Batterie-Herstellers CATL, der unter anderem Tesla, Toyota, BMW und Volvo beliefert – Zeng Yuqun, Huang Shilin, Pei Zhenhua, Li Ping. Sie haben ein gemeinsames “grünes Vermögen” von 60 Milliarden Dollar. Auf Rang vier stehen die Anteilseigner des Auto- und Busherstellers BYD – Wang Chuanfu, Lv Xiangyang, Xia Zuoquan – mit einem gemeinsamen “grünen Vermögen” von 13 Milliarden Dollar. Es folgen die Teilhaber der Autohersteller XPeng, Nio, Li Auto und die beiden Gründer des E-Scooter-Herstellers Yadea.
Gleichzeitig lohnt ein differenzierter Blick. Zwar ist China der weltweit größte Markt für Elektromobilität. Und Firmen wie CATL als größter Batteriehersteller der Welt und BYD (zweitgrößter E-Autohersteller und in den Top Vier bei Batterien) sind etablierte Unternehmen. Doch XPeng, Nio oder Li Auto sind im globalen Maßstab eher kleine Wettbewerber – Li Auto hat 2020 32.000 Autos ausgeliefert, Nio und XPeng feierten im Dezember 2020 neue Firmen-Auslieferungs-Rekorde mit 7000 bzw. 5700 ausgelieferten Autos. Das hohe Vermögen ihrer Anteilseigner ist eher einer hohen Börsennotierung – also dem Zukunftsversprechen Elektromobilität – geschuldet statt hohen Umsätzen.
Auf den Plätzen 5 und 14 liegen die Teilhaber des chinesisches Herstellers von Stromspeichern Eve Energy und des Herstellers von Equipment für Lithium-Batterien, Wuxi Lead.
Neben den E-Auto- und Batteriensektoren, ist der Solar-Sektor stark im grünen Milliardärs-Ranking vertreten. Auf Rang 3 stehen die vier größten Anteilseigner des chinesischen Konzerns Longi. Der weltgrößte Hersteller von Wafern für Solarmodule beschert Li Zhenguo, Li Chunan, Li Xiyan, Zhong Baoshen ein gemeinsames “grünes Vermögen” von 16 Milliarden US$. Auf Platz 10 folgt der Teilhaber von Hangzhou First Applied Material – dem weltweit größten Hersteller von Beschichtungen für Solarpanelen. Auf Platz 12 und 15 folgen die Anteilseigner von Sungrow Power Supply und JA Solar Technology. Doch auch die Zahlen aus der Solar-Branche sind mit Vorsicht zu genießen. Die Solar-Industrie hat in ihrer kurzen Geschichte viele Booms und Krisen gesehen, schreibt Bloomberg. Beispielhaft dafür steht der Aktienkurs von Hangzhou First Applied Material, der sich 2020 verdoppelte.
Auch der Vergleich zur Vorjahreserhebung zeigt: Die Erhebung ist lediglich eine Momentaufnahme. Nicht alle Vertreter im aktuellen grünen Milliardärsranking werden dort auch noch in fünf Jahren stehen. Denn einige der Aktien der oben genannten Unternehmen dürften überbewertet sein. Und: Im Ranking des letzten Jahres waren lediglich vier chinesische Unternehmen vertreten: CATL, Longi, Hangzhou First Applied Material und BYD.
Die deutschen Unternehmen setzen in diesem schwierigen Corona-Jahr große Hoffnungen in den chinesischen Markt. 77 Prozent der deutschen Firmen erwarten laut einer Umfrage der deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, dass sich der Markt in der Volksrepublik deutlich positiver entwickelt als in anderen Volkswirtschaften. Dieser Optimismus gilt trotz aller Schwierigkeiten im Wirtschaftsumfeld, die von den Firmen benannt werden: Reisebeschränkungen, zunehmende Internet-Kontrollen, Marktzugangsbeschränkungen oder die gleichbleibend mühsame Bürokratie.
Klar ist, dass China weiterhin ein wichtiger Investitionsstandort deutscher Unternehmen bleibt. 96 Prozent der Befragten haben keinerlei Pläne, China zu verlassen; 72 Prozent planen weitere Investitionen im Land. 72 Prozent rechnen 2021 dort mit steigenden Umsätzen, 56 Prozent auch mit steigenden Gewinnen. “Die meisten erwarten keine zweite Covid-19-Welle in China” sagte Andreas Glunz, Managing Partner der KMPG, die mit der AHK die Umfrage organisierte und auswertete. Der Optimismus ist laut Glunz so groß wie zuletzt im Boomjahr 2018.
Ein paar Überraschungen hielt das Umfrageergebnis bereit, wie Stephan Wöllenstein, AHK-Vorsitzender für Nordchina, feststellte. So sagten zum Zeitpunkt der Umfrage im vergangenen November 70 Prozent, sie hätten keinerlei Probleme mit Marktzugangsbeschränkungen. “Das ist eine fundamentale Verschiebung”, so Wöllenstein, der auch Chef von VW in China ist. 2019 habe die Quote bei nur 37 Prozent gelegen. Ihn habe zudem erstaunt, dass 71 Prozent dem Anfang 2020 in Kraft getretenen Gesetz zu Ausländischen Direktinvestitionen lediglich neutral gegenüberstehen, sagte Wöllenstein. Dabei setze das Gesetz einen besseren regulatorischen Rahmen. Immerhin 21 Prozent begrüßten das Gesetz, das unter anderem die inländische Behandlung aller ausländischen Investments vorsieht, die nicht unter eine Negativliste fallen.
Ebenfalls überrascht zeigte sich Wöllenstein, dass nur 22 Prozent sich von dem neuen Investitionsabkommen der EU und China (CAI) Abhilfe bei erzwungenem Technologietransfer erhoffen. Dies scheint ein weniger drängendes Problem zu sein, als generell angenommen. Schlüsselthemen sind andere: 40 Prozent wünschen sich von CAI besseren Marktzugang und 39 Prozent ein Ende der Diskriminierung im Vergleich zu chinesischen Privatfirmen.
So weit, so gut. Doch natürlich haben die Firmen auch Sorgen in China. Konkret sind dies die Corona-Reisebeschränkungen sowie die zunehmenden Kontrollen des Internets. Für 74 Prozent – darunter vor allem kleinere Firmen – ist es ein großes Problem, dass es aktuell so schwer ist Visa für Mitarbeiter und deren Familienangehörige zu bekommen. Durch Corona haben viele Firmen zudem die Digitalisierung vorangetrieben, wodurch dem Internet eine immer größere Bedeutung im Geschäftsalltag zukommt. Die damit zusammenhängenden Probleme erreichten daher den “Pain Point”, die Schmerzgrenze, sagte Wöllenstein. 53 Prozent klagten etwa darüber, dass sie seit Erlassen des neuen Gesetzes zur Cybersicherheit Probleme mit dem Datentransfer ins Ausland haben; 40 Prozent beschwerten sich, dass sie nun mehr Daten mit den Aufsichtsbehörden teilen müssen. 34 Prozent nannten die Zugangsbeschränkungen im Netz durch die Zensur als Problem, 28 Prozent die lahme Ladegeschwindigkeit internationaler Websites in China.
Mit Unruhe schauen die Unternehmen zudem auf die drohende Entkopplung zwischen den Wirtschaften Chinas und der USA beziehungsweise dem Rest der Welt. Diese Entkopplungstendenzen beschleunigen laut der Umfrage den ohnehin starken Lokalisierungstrend. Deutsche Unternehmen in China reagieren darauf laut AHK mit zunehmender Lokalisierung von Forschung und Entwicklung (43 Prozent), Beschaffung (34 Prozent) und der Anpassung von Schlüsseltechnologien an verschiedene Standards (33 Prozent). All dies kostet Geld, weshalb 37 Prozent als durch die Entkopplung entstandenen Probleme vor allem steigende Kosten nannten. Christiane Kühl
Der China-erfahrene Audi-Manager Helmut Stettner wird ab Mai 2021 die Leitung des im letzten Jahr gegründeten Joint-Ventures von Audi und der China FAW Group übernehmen. Der neue CEO war bereits von 2011 bis 2015 für die Volkswagen-Gruppe in China tätig und leitet seither das Audi-Werk in Neckarsulm. Stettners Nachfolger in Neckarsulm soll Fred Schulze werden, seit 2018 Executive Vice President für Produktion und Produktmanagement bei SAIC Volkswagen in Shanghai.
Wie Audi mitteilte, soll das Joint Venture ab 2024 Elektroautos auf Basis der Plattform PPE in Changchun im Nordosten Chinas produzieren. Weiter im Board of Management: Hendrik Adrian Wanger und Thomas Niewelt von der Audi-Seite und Yu Qiutao und Gao Kun von chinesischer Seite.
Das neue Kooperationsunternehmen, an dem Audi 60 Prozent halten wird, befindet sich derzeit in der Gründungsphase. In Changchun, dem Unternehmenssitz, hat auch das bestehende Joint Venture FAW-Volkswagen seinen Hauptsitz. Für Audi handele es sich um das erste Joint Venture mit Mehrheitsbeteiligung in China, teilte das Unternehmen mit. asi
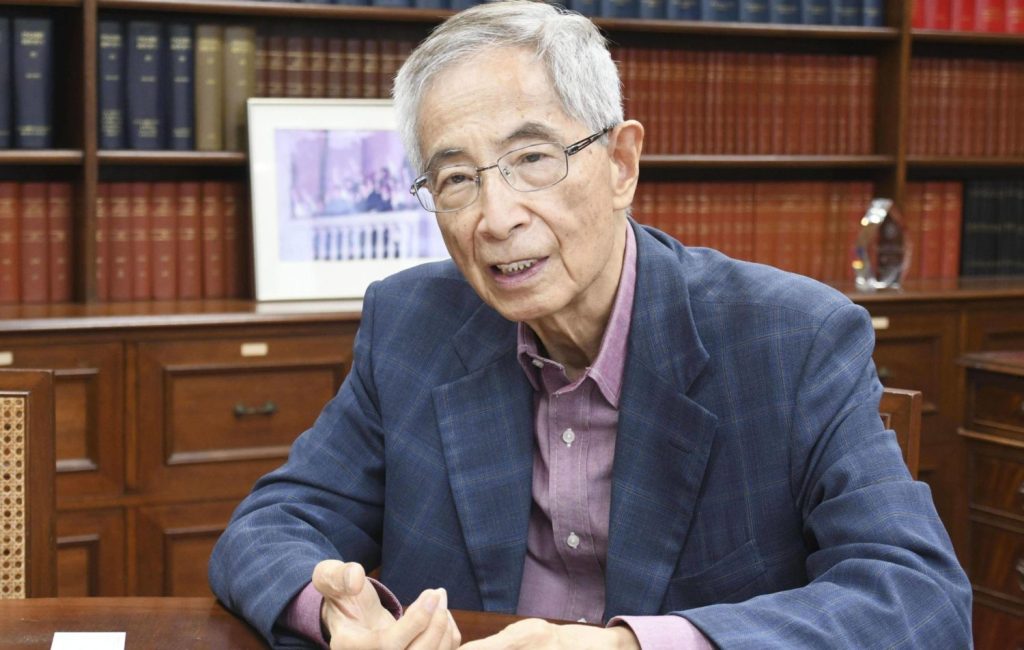
Als “Vater der Demokratie” wurde er zu einem der bekanntesten Politiker Hongkongs: Martin Lee gilt als pragmatischer Idealist in seinem Kampf für Menschenrechte und Demokratie. Zwei norwegische Abgeordnete, Mathilde Tybring-Gjedde und Peter Frølich von der konservativen Partei Høyre, haben den 82-Jährigen nun für den Friedensnobelpreis 2021 nominiert.
Zuletzt sah sich der Rechtsanwalt vermehrt Kritik jüngerer Hongkonger Aktivisten ausgesetzt – denn diesen ging er mit seinen Forderungen nicht weit genug. Als Lee jedoch in den 1980er-Jahren begann, sich dafür einzusetzen, dass die Einwohner Hongkongs ihre politische Führung selbst wählen können, galt er alles andere als moderat. Er provozierte Peking, indem er sich an der Spitze seiner Partei United Democrats of Hongkong (UDHK) für bürgerliche Freiheiten einsetzte, gleichzeitig blieb er ein angesehener Teil der politischen Elite Hongkongs.
1985 trat Martin Lee dem Redaktionskomitee für das Grundgesetz der Sonderverwaltungszone bei. Hier half er bei der Ausarbeitung einer Mini-Verfassung für die Stadt nach der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China. Lee wurde jedoch 1989 nach der gewaltsamen Niederschlagung des Protests auf dem Platz des Himmlischen Friedens aus dem Gremium ausgeschlossen, weil er die Rolle der Pekinger Regierung bei dem Vorfall verurteilte und die Studentenprotestierenden lautstark unterstützte.
Als die Regierung für eingeschränkte Wahlen 1991 nur zehn direkt gewählte Sitze im Legislativrat Hongkongs anbot, verbrannte Lee öffentlich einen Ausdruck des Vorschlags. Unter seiner Führung erlangte die UDHK bei den Direktwahlen 1991 eine Erdrutschsieg: 12 von 18 Ratssitzen gingen in der Direktwahl an die Partei. Parteikollegen kritisierten ihn damals als zu radikal, wie die Politikwissenschaftlerin Victoria Hui der New York Times sagte. Sie warfen ihm demnach vor, zu schnell zu viel zu wollen, so Hui.
Martin Lee gilt als überzeugter Verteidiger von “Ein Land, zwei Systeme”. Er wurde 1938 in Hongkong geboren und in Großbritannien ausgebildet, wechselt beim Sprechen mühelos zwischen Mandarin, Kantonesisch und Englisch. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Lees Vater war Generalleutnant der chinesischen Armee, bevor er vor der kommunistischen Machtübernahme 1949 nach Hongkong floh. Er hatte gemeinsam mit Chinas ersten Premier Zhou Enlai studiert – obwohl die beiden Männer stark unterschiedliche Ansichten gehabt hätten, sei ihr Verhältnis aber immer herzlich gewesen, sagte Martin Lee 1991 in einem Interview.
Kurz vor der Übergabe Hongkongs, im Juni 1997, musste Martin Lee sein Amt niederlegen – Peking schaffte die gewählten Vertretungen ab. 1998 konnte er seinen Sitz im Legislativrat aber zurückgewinnen. Im Dezember 2002 trat Lee als Vorsitzender der demokratischen Partei zurück, 2008 ging er aus dem Legislativrat in den Ruhestand. Seither setzt er sich weiterhin für die demokratische Sache auf lokaler und internationaler Ebene ein. Im vergangenen Frühjahr wurde Lee erstmals wegen einer Teilnahme an einer “nicht autorisierten Versammlung” verhaftet.
Viele jüngere Aktivisten kritisieren in, da er in der Debatte um das Nationale Sicherheitsgesetz einen Kompromiss mit Peking vorgeschlagen hatte. “Ich bin aus Chinas Sicht ein Staatsfeind. Und die Kinder mögen mich auch nicht, weil ich mit ihren Zielen nicht einverstanden bin”, sagte er Medienberichten zufolge. Popularität sei jedoch nicht das Ziel: “Das Ziel ist Demokratie für Hongkong.”
Die Nominierung für den Friedenspreis könne hoffentlich eine Inspirationsquelle für Freiheitskämpfer auf der ganzen Welt sein, schrieb die Norwegerin Tybring-Gjedde auf Twitter. Die Preisträger werden normalerweise im Oktober bekanntgegeben. Die – eigentlich geheime – Liste der Nominierten ist lang. Es sickern jedoch immer wieder Namen durch. Für 2021 sind Medienberichten zufolge auch erneut die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg und Ex-US-Präsident Donald Trump nominiert. Amelie Richter

am Montag bat ich Sie hier um Selbstprüfung: Würden Sie sich mit einem chinesischen Impfstoff gegen Covid-19 impfen lassen? Sie würden es tun? Dann gehören Sie zu einer kleinen Minderheit. In einer aktuellen Umfrage fand das Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von T-Online heraus: Nur zwei Prozent der Deutschen würden Chinas Impfstoffen trauen.
Einmal im Jahr befragt die Außenhandelskammer deutsche Unternehmen, um die Investitionsbedingungen in China zu erfassen. Christiane Kühl analysiert die aktuellen Ergebnisse. Ihr Urteil: Die Geschäfte laufen besser als erwartet, deutsche Unternehmen profitieren vom Wirtschaftswachstum Chinas. Auch spüren sie im Alltag offenbar weniger Zugangsbeschränkungen zu den Märkten, als wir das aus der Entfernung beobachten.
Der Quantenphysiker Jianwei Pan hat bis 2008 in Heidelberg und davor in Wien gearbeitet und in Deutschland ein eigenes Forschungsteam aufgebaut, bevor er nach Hefei an die Universität wechselte. Jetzt hat Pan mit seinem Team den schnellsten Quantencomputer der Welt vorgestellt.
Für Chinakenner ist Hainan bisher der Inbegriff von Sonne und Erholung. Die chinesische Regierung sieht in der Region das Potenzial eines boomenden Hightech-Standortes. Frank Sieren klopft die hochfliegenden Pläne auf ihre Realitätstauglichkeit ab.
Dass man mit “grünen” Investments nicht nur das Klima retten, sondern auch satte Renditen erwirtschaften kann, hat bisher wohl keiner so medienwirksam gezeigt wie Elon Musk. Ich empfehle Ihnen einen Blick in Nico Beckerts Analyse des aktuellen Bloomberg-Rankings der grünen Milliardäre zu werfen.

Seit Wochenanfang ist die Liste der Industriesektoren öffentlich, die in der südchinesischen Insel-Provinz Hainan künftig nur noch 15 Prozent Einkommenssteuern zahlen müssen. Dazu gehören neben dem Tourismus und Teilen des Dienstleistungssektors auch High-Tech-Firmen. Allgemein sind Unternehmen berechtigt, die viel in Forschung, aber auch in den neuen Freihafen investieren, dessen Bau im Juni vergangenen Jahres verkündet wurde. Die Liste verdeutlicht, was die Provinzregierung von Hainan plant: Laut dem Regierungsplan soll die Inselprovinz bis 2050 zu einer Mischung aus Silicon Valley, Hawaii, Cape Canaveral und Rotterdam ausgebaut werden.
Der Aufbau von Hainan gilt als eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte in China und man spricht ihm eine ähnliche Bedeutung zu wie der Aufbau der südchinesischen Megacity Shenzhen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ bereits im Juni 2018 verkünden, dass er Hainan in die größte Freihandelszone Chinas verwandeln möchte.
Hainan soll zudem als eine Art südliches Drehkreuz für RCEP, der größten Freihandelszone der Welt fungieren, die im vergangenen Jahr gegründet wurde und weite Teile Asiens umfasst. Innerhalb von vier Flugstunden kann man von Hainan aus über 21 asiatische Länder erreichen.
Das Vorhaben der Regierung ist ambitioniert. Die tropische Insel im südchinesischen Meer mit Traumstränden ist so groß wie Baden-Württemberg. Dennoch wohnen dort nur rund zehn Millionen Menschen, die erst gut 68 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften. In Baden-Württemberg hingegen leben 11 Millionen Menschen, die es auf ein BIP von rund 528 Milliarden Euro bringen. Shenzhen kommt mit seinen knapp 20 Millionen Menschen auf rund 300 Milliarden Euro.
Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung spielt der Hafen Yang Pu im Norden der Insel. Bis 2025 entsteht hier ein mehr als 120 Quadratkilometer messender Hafenkomplex mit einer Kapazität von bis zu fünf Millionen Containern pro Jahr. Das ist etwa die Hälfte von dem, was der Hamburger Hafen im Jahr umschlägt. Seit dem ersten Juni haben sich bereits über 1.500 ausländische Firmen dort angesiedelt. Ein geplanter Tunnel zum Festland soll den Weitertransport der Container erleichtern.
Schon seit einigen Jahren ist die Insel der Startplatz für die neueste Generation von Weltraumraketen. Und Hainan ist der wichtigste südliche Hafen der chinesischen Marine, wo auch Atom U-Boote stationiert sind, die das Südchinesische Meer befahren.
Die Provinz soll ein High-Tech- und Medizinzentrum werden. In der “Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone” dürfen zur Behandlung schwerer Krankheiten auch Medikamente und Behandlungsmethoden eingesetzt werden, die bislang nicht in China zugelassen sind. Ärzte aus dem Ausland können mit Sondergenehmigungen bis zu drei Jahre praktizieren.
Immer mehr Techfirmen siedeln sich dort an. Seit vergangenem Frühjahr ist auch der KI-Spracherkennungsspezialist IFlytek vor Ort. “Um ehrlich zu sein, gibt es eine große Lücke zwischen Hainan und Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen”, erklärt IFytek-Geschäftsführer Zhang Shubin. Aber dafür sei der Spielraum hier größer und die Lebensqualität sehr hoch.
Momentan ist allerdings noch der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle der Insel. Nirgendwo in China ist die Dichte an 5-Sterne-Hotels so hoch. Alle großen internationalen Ketten haben sich bereits an den Stränden niedergelassen. Vor dem Coronavirus kamen bereits 80 Millionen Touristen jährlich nach Hainan. Bis 2030 könnten es 150 Millionen sein, prophezeit die Provinzregierung. Schon jetzt dürfen Ausländer aus 59 Ländern und Regionen ohne Visum nach Hainan einreisen und 30 Tage bleiben, während auf dem Festland weiterhin strenge Einreisebestimmungen gelten.
Auch was Korruption betrifft, greift die Zentralregierung in Hainan hart durch. Er erst vergangene Woche wurde mit Wang Yong ein weiterer Spitzenpolitiker aus Hainan verhaftet und aus der Partei ausgeschlossen. Dem ehemaligen Bürgermeister von Sanya wird Korruption vorgeworfen. Außerdem wurde im vergangenen Juni der ehemalige Parteisekretär der Hauptstadt Haikou zu lebenslanger Haft verurteilt, er soll umgerechnet gut 16 Millionen Euro an Schmiergeld angenommen haben. Die Prozesse sind allerdings nicht transparent. Die Betroffenen könnten auch das Opfer eines politischen Machtkampfes geworden sein. Alte undurchsichtige Konglomerate werden derzeit zerschlagen, wie die HNA Gruppe, der größte Konzern Hainans. Drei börsennotierte Unternehmen der Gruppe hatten am vergangenen Wochenende erklärt, dass “Anteilseigner und andere zugehörige Parteien” 61,5 Milliarden Yuan (rund 7,86 Milliarden Euro) “veruntreut” hätten, wie das Wirtschaftsmagazin “Caixin” berichtete. Zusätzlich seien Kreditgarantien in Höhe von gut 46 Milliarden (knapp sechs Milliarden Euro) auf “nicht legale Weise” vergeben worden.
Trotz Corona und der Korruptionserschütterungen ist Hainans Wirtschaft 2020 um 3,5 Prozent gewachsen. Immerhin 1,3 Prozent mehr als der Landesdurchschnitt. Die Investitionen sind sogar um acht Prozent gestiegen. Selbst die Einzelhandelsverkäufe wuchsen um 1,2 Prozent, obwohl 2020 wegen Corona über 20 Prozent weniger Touristen gekommen sind.
Während Deutschland bis 2030 an die Spitze in der Quantenforschung kommen will, hat China unlängst einen Quantencomputer vorgestellt, der “innerhalb von Minuten die Lösung für eine komplexe Aufgabe” liefern kann, so die Forscher. Mit dem bisher leistungsfähigsten Supercomputer Chinas, dem “Taihulight” – weltweit die Nummer vier unter den schnellsten Supercomputern – hätte es über zwei Milliarden Jahre gedauert die selbe Aufgabe zu lösen.
24 chinesische Wissenschaftler haben im Dezember im Fachmagazin Science den neuen, weltweit schnellsten Quantencomputer “Jiuzhang” – benannt nach den ältesten mathematischen Schriften Chinas – vorgestellt. Er steht in der Universität für Wissenschaft und Technologie (USTC) von Hefei. Dabei haben sich die Wissenschaftler um den Quantenphysiker Jianwei Pan vor allem mit dem Problem des “Gaussian Boson Sampling” befasst. Für den auf Photonen basierten Quantencomputer berechneten sie die Wege und Richtungen, die Photonenteilchen in einem Labyrinth aus Strahlteilern, Prismen und über 70 Spiegeln nehmen. Wenn zwei Photonen gleichzeitig auf denselben Strahlteiler stoßen, nehmen beide den gleichen Weg und machen das Problem, dass es zu berechnen gilt, immer komplexer.
Zwanzig Jahre hat Pan mit seinem Team gearbeitet, um ein System zu entwickeln, das eine geeignete und hochqualitative Photonenquelle hat. “Es ist zum Beispiel einfach für uns, jedes Mal einen Schluck Wasser zu trinken, aber es ist schwierig, jedes Mal nur ein Wassermolekül zu trinken. Eine hochwertige Photonenquelle muss jedes Mal nur ein Photon ‘freisetzen’, und jedes Photon muss genau gleich sein, was eine ziemliche Herausforderung darstellt”, so erklärt es Pan.
Die chinesischen Wissenschaftler haben im Falle Jiuzhangs mit Lichtpulsen und nicht mit Photonen experimentiert und so beweisen können, dass lichtbasierte Quantencomputer erheblich leistungsfähiger sind.
Internationale Forscher gratulierten Pan und seinen Kollegen zu dem Durchbruch: Ian Walmsley, Physiker vom Imperial College in London schrieb in dem Fachblatt “Nature”: “Dies ist eine echte Tour de Force und ein wichtiger Meilenstein”.
Ob Quanten-Internet, -Speicher oder -Satelliten, die Kompetenzen sollen in der Quantentechnologie breit aufgestellt sein. Schon im August 2016 meldete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, dass der erste Quantenkommunikationssatellit gestartet wurde, um ein Jahr später zu berichten, dass dieser den ersten abhörsicheren Code aus dem Weltall gesendet habe.
“China ist aber mittlerweile auch in anderen Technologien sehr gut aufgestellt und konnte in den letzten Jahren zur Weltspitze aufschließen”, sagt Stefan Filipp, Professor für Physik an der TU München.
Mit bis zu zehn Milliarden Dollar fördert die chinesische Regierung jährlich das nationale Quantenprogramm an der Universität in Hefei, der nun der Durchbruch mit Jiuzhang gelungen ist.
Während diese Zahl eine Schätzung von Experten ist, gibt es verlässliche Daten, die zeigen, dass die Zahl der Patente im Bereich Quantentechnologien seit 2012 stetig zunimmt und sich im Vergleich zu den Patenten in den USA in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt haben. China meldete im vergangenen Jahr 5.164 Patente an, viel mehr als die USA mit 1.990. Mit 797 liegt Europa (Deutschland hält davon 410) weit abgeschlagen hinten.
“China verfolgt nicht nur den Weg hin zu photonischen Quantencomputern, sondern auch andere Technologien, zum Beispiel Quantencomputing mit supraleitenden Qubits. Die Führungsrolle beim optischen Quantencomputing ist auf die Karriere von Jianwei Pan zurückzuführen, der bei Anton Zeilinger mit grundlegenden Experimenten zur Quantenkommunikation mit Photonen promovierte“, sagte Filipp dem China.Table.
Pan hatte bis 2008 in Heidelberg und davor in Wien gearbeitet und in Deutschland ein eigenes Forschungsteam aufgebaut, bevor er nach Hefei an die Universität zurückkehrte. 2020 erhielt der 1970 geborene Pan den Zeiss Research Award. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen auf dem Gebiet internationaler Forschung ausgezeichnet.
In Deutschland gibt es ehrgeizige Ziele. Allein Bayern wird in den kommenden drei Jahren 300 Millionen Euro in die Quantenforschung investieren. Wie Deutschland “im globalen Wettbewerb mit starken Mitbewerbern vor allem in Asien und den USA” eine technologische Souveränität bezüglich Qauntencomputing erreichen kann, zeigt eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission. In der Studie “Roadmap Quantencomputing” betonen die 16 Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, dass Deutschland in fünf bis zehn Jahren “ein international wettbewerbsfähiger Quantencomputer mit mindestens 100 individuell ansteuerbaren Qubits” als Meilenstein erreicht haben sollte, wobei das System auf mindestens 500 Qubits skalierbar sein sollte.
Ein Qubit kann in mehr als einem Zustand gleichzeitig auftreten und in Folge können die zu berechnenden Aufgaben nicht mehr linear wie bei Bits sein, sondern exponentiell ansteigen. So kann ein Quantencomputer mit bis zu 300 Qubits 2300 Operationen gleichzeitig ausführen.
Was ein wenig technisch daher kommt, ist die essenzielle Grundlage, für einen “führenden Technologiestandort” so die Studie. Ob es nun um die Entwicklung von Medikamenten geht oder schnellere Prozessoren beim autonomen Fahren: “Für unsere Hightech-Industrie kann der Zugang zu dieser Technologie existenziell sein”, so der Physiker Stefan Filipp von der TU München und der Cheftechnologen des Laserspezialisten Trumpf, Peter Leibinger, die für den Expertenrat sprechen.
“In Deutschland muss es uns gelingen, die hervorragende Grundlagenforschung in Innovationskraft und technologische Weiterentwicklung umzusetzen. Da der Weg zum universellen Quantencomputer noch lang ist, ist dieses Ziel aber mit genügend großer Fokussierung und durch eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie durchaus noch erreichbar”, sagt Filipp.
Deutschland müsse in fünf bis zehn Jahren “im Verbund mit den europäischen Partnern in der Lage sein, an der Spitze des internationalen Wettbewerbs einen anwendungstauglichen Quantencomputer zu bauen und zu betreiben”, heißt es in der Studie. Die von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) schon im vergangenen Jahr zugesicherten zwei Milliarden Euro für die Initiative für Quantentechnologie reichen laut Expertenrat jedoch nicht.
Es brauche mehr Mittel, so der Expertenrat da noch unklar sei, welche Technologieplattform sich durchsetzen werde. Unterschiedliche Ansätze der Quantenforschung wie supraleitende Schaltkreise, Ionenfallen, Gitter mit Neutral-Atomen sollten parallel verfolgt werden, bevor entschieden werden kann, wohin die Gelder schwerpunktmäßig fließen könnten.
Auch wenn so gut wie sicher ist, dass der chinesische Quantencomputer Jiuzhang sehr leistungsfähig ist, streiten sich die Experten noch darum, wer das leistungsfähigere System hat. Während Googles Quantencomputer Sycamore supraleitende Quantenbits zum Rechnen verwendet, nutzt Jiuzhang Laserpulse. So ist Jiuzhang eigentlich kein Quantencomputer, sondern ein Quantensimulator. Doch der Wissenschaftler Pan spielt eine führende Rolle im Wettlauf um die Quantenüberlegenheit, besonders in der Quantenkommunikation. Laut chinesischen Staatsmedien will Staatschef Xi Jinping über die Quantenkommunikation Chinas Technologieführerschaft sichern.
Wohlstand mit Klimainvestments: 23 der 26 reichsten Menschen aus den Bereichen Klima- und grüne Technologien stammen aus China, wie ein neues Ranking von Bloomberg zeigt. An der Spitze des Rankings steht unangefochten Elon Musk. Der Chef von Tesla hat im letzten Jahr von einem rasant gestiegenen Aktienkurs profitiert und ein “grünes Vermögen” von 180 Milliarden Dollar angehäuft. Weitere 20 Milliarden Dollar an Vermögen stammen aus anderen Geschäftsfeldern, wie der Weltraum- und Telekommunikationsfirma SpaceX.
Hinter Musk folgt eine lange Reihe Chinesen. Am stärksten vertreten sind Anteilseigner großer E-Auto- und Batteriehersteller. Auf Platz zwei des Bloomberg-Rankings stehen die vier größten Teilhaber des Batterie-Herstellers CATL, der unter anderem Tesla, Toyota, BMW und Volvo beliefert – Zeng Yuqun, Huang Shilin, Pei Zhenhua, Li Ping. Sie haben ein gemeinsames “grünes Vermögen” von 60 Milliarden Dollar. Auf Rang vier stehen die Anteilseigner des Auto- und Busherstellers BYD – Wang Chuanfu, Lv Xiangyang, Xia Zuoquan – mit einem gemeinsamen “grünen Vermögen” von 13 Milliarden Dollar. Es folgen die Teilhaber der Autohersteller XPeng, Nio, Li Auto und die beiden Gründer des E-Scooter-Herstellers Yadea.
Gleichzeitig lohnt ein differenzierter Blick. Zwar ist China der weltweit größte Markt für Elektromobilität. Und Firmen wie CATL als größter Batteriehersteller der Welt und BYD (zweitgrößter E-Autohersteller und in den Top Vier bei Batterien) sind etablierte Unternehmen. Doch XPeng, Nio oder Li Auto sind im globalen Maßstab eher kleine Wettbewerber – Li Auto hat 2020 32.000 Autos ausgeliefert, Nio und XPeng feierten im Dezember 2020 neue Firmen-Auslieferungs-Rekorde mit 7000 bzw. 5700 ausgelieferten Autos. Das hohe Vermögen ihrer Anteilseigner ist eher einer hohen Börsennotierung – also dem Zukunftsversprechen Elektromobilität – geschuldet statt hohen Umsätzen.
Auf den Plätzen 5 und 14 liegen die Teilhaber des chinesisches Herstellers von Stromspeichern Eve Energy und des Herstellers von Equipment für Lithium-Batterien, Wuxi Lead.
Neben den E-Auto- und Batteriensektoren, ist der Solar-Sektor stark im grünen Milliardärs-Ranking vertreten. Auf Rang 3 stehen die vier größten Anteilseigner des chinesischen Konzerns Longi. Der weltgrößte Hersteller von Wafern für Solarmodule beschert Li Zhenguo, Li Chunan, Li Xiyan, Zhong Baoshen ein gemeinsames “grünes Vermögen” von 16 Milliarden US$. Auf Platz 10 folgt der Teilhaber von Hangzhou First Applied Material – dem weltweit größten Hersteller von Beschichtungen für Solarpanelen. Auf Platz 12 und 15 folgen die Anteilseigner von Sungrow Power Supply und JA Solar Technology. Doch auch die Zahlen aus der Solar-Branche sind mit Vorsicht zu genießen. Die Solar-Industrie hat in ihrer kurzen Geschichte viele Booms und Krisen gesehen, schreibt Bloomberg. Beispielhaft dafür steht der Aktienkurs von Hangzhou First Applied Material, der sich 2020 verdoppelte.
Auch der Vergleich zur Vorjahreserhebung zeigt: Die Erhebung ist lediglich eine Momentaufnahme. Nicht alle Vertreter im aktuellen grünen Milliardärsranking werden dort auch noch in fünf Jahren stehen. Denn einige der Aktien der oben genannten Unternehmen dürften überbewertet sein. Und: Im Ranking des letzten Jahres waren lediglich vier chinesische Unternehmen vertreten: CATL, Longi, Hangzhou First Applied Material und BYD.
Die deutschen Unternehmen setzen in diesem schwierigen Corona-Jahr große Hoffnungen in den chinesischen Markt. 77 Prozent der deutschen Firmen erwarten laut einer Umfrage der deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, dass sich der Markt in der Volksrepublik deutlich positiver entwickelt als in anderen Volkswirtschaften. Dieser Optimismus gilt trotz aller Schwierigkeiten im Wirtschaftsumfeld, die von den Firmen benannt werden: Reisebeschränkungen, zunehmende Internet-Kontrollen, Marktzugangsbeschränkungen oder die gleichbleibend mühsame Bürokratie.
Klar ist, dass China weiterhin ein wichtiger Investitionsstandort deutscher Unternehmen bleibt. 96 Prozent der Befragten haben keinerlei Pläne, China zu verlassen; 72 Prozent planen weitere Investitionen im Land. 72 Prozent rechnen 2021 dort mit steigenden Umsätzen, 56 Prozent auch mit steigenden Gewinnen. “Die meisten erwarten keine zweite Covid-19-Welle in China” sagte Andreas Glunz, Managing Partner der KMPG, die mit der AHK die Umfrage organisierte und auswertete. Der Optimismus ist laut Glunz so groß wie zuletzt im Boomjahr 2018.
Ein paar Überraschungen hielt das Umfrageergebnis bereit, wie Stephan Wöllenstein, AHK-Vorsitzender für Nordchina, feststellte. So sagten zum Zeitpunkt der Umfrage im vergangenen November 70 Prozent, sie hätten keinerlei Probleme mit Marktzugangsbeschränkungen. “Das ist eine fundamentale Verschiebung”, so Wöllenstein, der auch Chef von VW in China ist. 2019 habe die Quote bei nur 37 Prozent gelegen. Ihn habe zudem erstaunt, dass 71 Prozent dem Anfang 2020 in Kraft getretenen Gesetz zu Ausländischen Direktinvestitionen lediglich neutral gegenüberstehen, sagte Wöllenstein. Dabei setze das Gesetz einen besseren regulatorischen Rahmen. Immerhin 21 Prozent begrüßten das Gesetz, das unter anderem die inländische Behandlung aller ausländischen Investments vorsieht, die nicht unter eine Negativliste fallen.
Ebenfalls überrascht zeigte sich Wöllenstein, dass nur 22 Prozent sich von dem neuen Investitionsabkommen der EU und China (CAI) Abhilfe bei erzwungenem Technologietransfer erhoffen. Dies scheint ein weniger drängendes Problem zu sein, als generell angenommen. Schlüsselthemen sind andere: 40 Prozent wünschen sich von CAI besseren Marktzugang und 39 Prozent ein Ende der Diskriminierung im Vergleich zu chinesischen Privatfirmen.
So weit, so gut. Doch natürlich haben die Firmen auch Sorgen in China. Konkret sind dies die Corona-Reisebeschränkungen sowie die zunehmenden Kontrollen des Internets. Für 74 Prozent – darunter vor allem kleinere Firmen – ist es ein großes Problem, dass es aktuell so schwer ist Visa für Mitarbeiter und deren Familienangehörige zu bekommen. Durch Corona haben viele Firmen zudem die Digitalisierung vorangetrieben, wodurch dem Internet eine immer größere Bedeutung im Geschäftsalltag zukommt. Die damit zusammenhängenden Probleme erreichten daher den “Pain Point”, die Schmerzgrenze, sagte Wöllenstein. 53 Prozent klagten etwa darüber, dass sie seit Erlassen des neuen Gesetzes zur Cybersicherheit Probleme mit dem Datentransfer ins Ausland haben; 40 Prozent beschwerten sich, dass sie nun mehr Daten mit den Aufsichtsbehörden teilen müssen. 34 Prozent nannten die Zugangsbeschränkungen im Netz durch die Zensur als Problem, 28 Prozent die lahme Ladegeschwindigkeit internationaler Websites in China.
Mit Unruhe schauen die Unternehmen zudem auf die drohende Entkopplung zwischen den Wirtschaften Chinas und der USA beziehungsweise dem Rest der Welt. Diese Entkopplungstendenzen beschleunigen laut der Umfrage den ohnehin starken Lokalisierungstrend. Deutsche Unternehmen in China reagieren darauf laut AHK mit zunehmender Lokalisierung von Forschung und Entwicklung (43 Prozent), Beschaffung (34 Prozent) und der Anpassung von Schlüsseltechnologien an verschiedene Standards (33 Prozent). All dies kostet Geld, weshalb 37 Prozent als durch die Entkopplung entstandenen Probleme vor allem steigende Kosten nannten. Christiane Kühl
Der China-erfahrene Audi-Manager Helmut Stettner wird ab Mai 2021 die Leitung des im letzten Jahr gegründeten Joint-Ventures von Audi und der China FAW Group übernehmen. Der neue CEO war bereits von 2011 bis 2015 für die Volkswagen-Gruppe in China tätig und leitet seither das Audi-Werk in Neckarsulm. Stettners Nachfolger in Neckarsulm soll Fred Schulze werden, seit 2018 Executive Vice President für Produktion und Produktmanagement bei SAIC Volkswagen in Shanghai.
Wie Audi mitteilte, soll das Joint Venture ab 2024 Elektroautos auf Basis der Plattform PPE in Changchun im Nordosten Chinas produzieren. Weiter im Board of Management: Hendrik Adrian Wanger und Thomas Niewelt von der Audi-Seite und Yu Qiutao und Gao Kun von chinesischer Seite.
Das neue Kooperationsunternehmen, an dem Audi 60 Prozent halten wird, befindet sich derzeit in der Gründungsphase. In Changchun, dem Unternehmenssitz, hat auch das bestehende Joint Venture FAW-Volkswagen seinen Hauptsitz. Für Audi handele es sich um das erste Joint Venture mit Mehrheitsbeteiligung in China, teilte das Unternehmen mit. asi
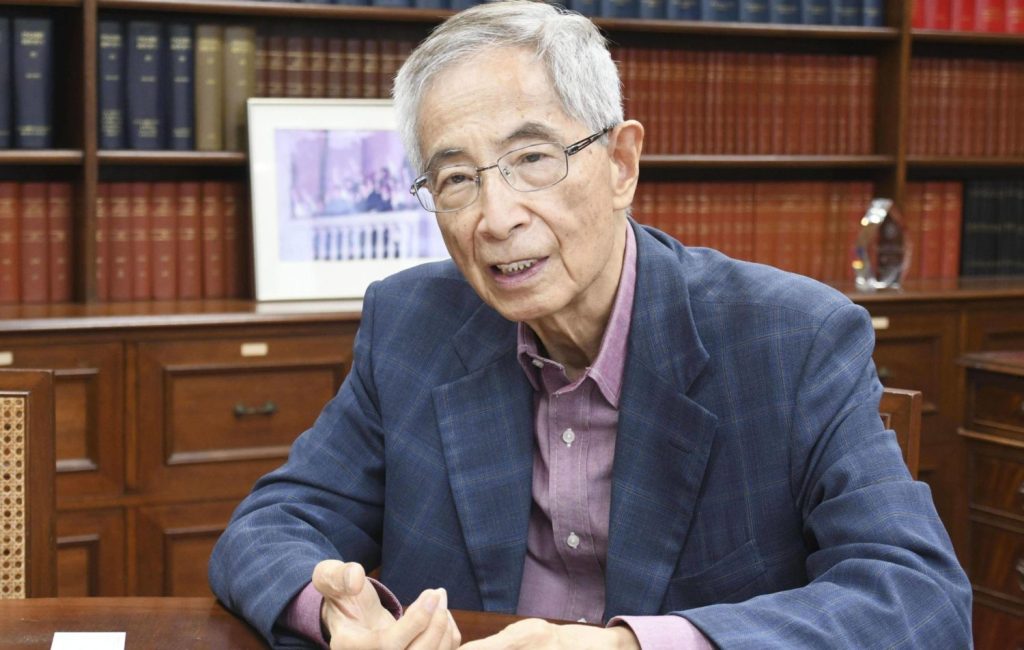
Als “Vater der Demokratie” wurde er zu einem der bekanntesten Politiker Hongkongs: Martin Lee gilt als pragmatischer Idealist in seinem Kampf für Menschenrechte und Demokratie. Zwei norwegische Abgeordnete, Mathilde Tybring-Gjedde und Peter Frølich von der konservativen Partei Høyre, haben den 82-Jährigen nun für den Friedensnobelpreis 2021 nominiert.
Zuletzt sah sich der Rechtsanwalt vermehrt Kritik jüngerer Hongkonger Aktivisten ausgesetzt – denn diesen ging er mit seinen Forderungen nicht weit genug. Als Lee jedoch in den 1980er-Jahren begann, sich dafür einzusetzen, dass die Einwohner Hongkongs ihre politische Führung selbst wählen können, galt er alles andere als moderat. Er provozierte Peking, indem er sich an der Spitze seiner Partei United Democrats of Hongkong (UDHK) für bürgerliche Freiheiten einsetzte, gleichzeitig blieb er ein angesehener Teil der politischen Elite Hongkongs.
1985 trat Martin Lee dem Redaktionskomitee für das Grundgesetz der Sonderverwaltungszone bei. Hier half er bei der Ausarbeitung einer Mini-Verfassung für die Stadt nach der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China. Lee wurde jedoch 1989 nach der gewaltsamen Niederschlagung des Protests auf dem Platz des Himmlischen Friedens aus dem Gremium ausgeschlossen, weil er die Rolle der Pekinger Regierung bei dem Vorfall verurteilte und die Studentenprotestierenden lautstark unterstützte.
Als die Regierung für eingeschränkte Wahlen 1991 nur zehn direkt gewählte Sitze im Legislativrat Hongkongs anbot, verbrannte Lee öffentlich einen Ausdruck des Vorschlags. Unter seiner Führung erlangte die UDHK bei den Direktwahlen 1991 eine Erdrutschsieg: 12 von 18 Ratssitzen gingen in der Direktwahl an die Partei. Parteikollegen kritisierten ihn damals als zu radikal, wie die Politikwissenschaftlerin Victoria Hui der New York Times sagte. Sie warfen ihm demnach vor, zu schnell zu viel zu wollen, so Hui.
Martin Lee gilt als überzeugter Verteidiger von “Ein Land, zwei Systeme”. Er wurde 1938 in Hongkong geboren und in Großbritannien ausgebildet, wechselt beim Sprechen mühelos zwischen Mandarin, Kantonesisch und Englisch. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Lees Vater war Generalleutnant der chinesischen Armee, bevor er vor der kommunistischen Machtübernahme 1949 nach Hongkong floh. Er hatte gemeinsam mit Chinas ersten Premier Zhou Enlai studiert – obwohl die beiden Männer stark unterschiedliche Ansichten gehabt hätten, sei ihr Verhältnis aber immer herzlich gewesen, sagte Martin Lee 1991 in einem Interview.
Kurz vor der Übergabe Hongkongs, im Juni 1997, musste Martin Lee sein Amt niederlegen – Peking schaffte die gewählten Vertretungen ab. 1998 konnte er seinen Sitz im Legislativrat aber zurückgewinnen. Im Dezember 2002 trat Lee als Vorsitzender der demokratischen Partei zurück, 2008 ging er aus dem Legislativrat in den Ruhestand. Seither setzt er sich weiterhin für die demokratische Sache auf lokaler und internationaler Ebene ein. Im vergangenen Frühjahr wurde Lee erstmals wegen einer Teilnahme an einer “nicht autorisierten Versammlung” verhaftet.
Viele jüngere Aktivisten kritisieren in, da er in der Debatte um das Nationale Sicherheitsgesetz einen Kompromiss mit Peking vorgeschlagen hatte. “Ich bin aus Chinas Sicht ein Staatsfeind. Und die Kinder mögen mich auch nicht, weil ich mit ihren Zielen nicht einverstanden bin”, sagte er Medienberichten zufolge. Popularität sei jedoch nicht das Ziel: “Das Ziel ist Demokratie für Hongkong.”
Die Nominierung für den Friedenspreis könne hoffentlich eine Inspirationsquelle für Freiheitskämpfer auf der ganzen Welt sein, schrieb die Norwegerin Tybring-Gjedde auf Twitter. Die Preisträger werden normalerweise im Oktober bekanntgegeben. Die – eigentlich geheime – Liste der Nominierten ist lang. Es sickern jedoch immer wieder Namen durch. Für 2021 sind Medienberichten zufolge auch erneut die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg und Ex-US-Präsident Donald Trump nominiert. Amelie Richter

