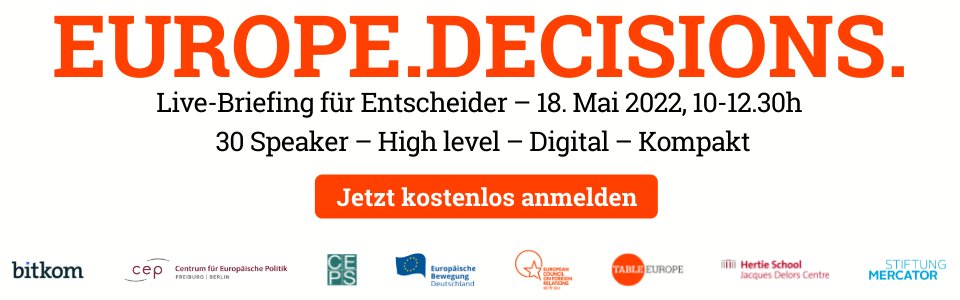es ist noch nicht allzu lange her, dass der bayerische Kultusminister Michael Piazolo, die Leistungen seines Bundeslandes bei der Digitalisierung der Schulen im Interview mit Bildung.Table lobte – und unter anderem auf die Initiative “Zukunft Digitale Schule” verwies. Deren Ziel: In einem Pilotprojekt an 250 Schulen im Land die Lernenden mit digitalen Geräten zu versorgen. Nun ist Christian Füller dem Projekt nachgegangen. Und es stellt sich heraus: Das Landesprogramm ist so kompliziert gefasst, dass es bei Schulleitern und Eltern zu Kopfschütteln führt.
Wie erfolgreich sind Bund und Länder eigentlich mit der Umsetzung ihres Digitalpaktes und der Digital-Strategien? Die GEW hat versucht, die Umsetzung zu monitoren und den Erfolg zu bewerten. Das Ergebnis: An einer Untersuchung haben sich nicht einmal die Hälfte der Bundesländer beteiligt. Und die Ergebnisse der Restbefragung lassen befürchten, dass der Digitalpakt zur Verschärfung der Bildungsungerechtigkeit an Schulen beiträgt.
Ihr Augenmerk möchte ich außerdem auf die Ergebnisse der Untersuchung der Zeppelin Universität in Friedrichshafen lenken. Dort hat ein Team um Professor Richard Münch die Ergebnisse der zahlreichen Schulreformen der letzten Jahre in einigen europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland, untersucht. Münchs Gastbeitrag in Bildung.Table sollte Pflichtlektüre für Schulreformer sein.
Zuletzt gestatten Sie mir bitte einige Worte in eigener Sache. Seit einem Jahr blickt das Redaktionsteam von Bildung.Table wöchentlich auf politische Prozesse rund um die digitale Bildung in Deutschland, informiert Sie, unsere Leserinnen und Leser, über aktuelle Entwicklungen, wichtige Akteure und innovative digitale Methoden und Tools. Zum Team von Bildung.Table ist nun der Journalist Moritz Baumann gestoßen. Moritz wird das Briefing gemeinsam mit Niklas Prenzel, den Sie bereits kennen, als Teamleiter führen und thematisch erweitern. Christian Füller, der Ihnen als ausgewiesener Experte im digitalen Bildungsbereich bekannt ist, wird seine Kompetenz und Erfahrung als Reporter für digitale Transformation einbringen.
Eine erkenntnisreiche und spannende Lektüre wünscht Ihnen

Die FDP hat in Nordrhein-Westfalen (NRW) offenbar versucht, unabhängige Elternvereine zu beeinflussen – oder gar zu übernehmen. In einem Elternverband führte dies zur Entlassung der Geschäftsführerin. Die Übernahme und die Gründung eines eigenen Elternverbandes für Realschulen scheiterten indes. Der Staatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen für Schule, Mathias Richter (FDP), habe mit einer der Akteurinnen der Übernahme eine Reihe von Gesprächen geführt, erfuhr Bildung.Table. Richter bestätigte Treffen mit dem FDP-Mitglied im Zuge von Parteitreffen. Er dementiert allerdings, dass er sich dabei für die Gründung eines FDP-freundlichen oder gar liberal geführten Elternvereins eingesetzt habe. Kommende Woche wählt Nordrhein-Westfalen, und die Regierungspartei FDP liegt in den Umfragen nur noch bei acht Prozent.
Das Besondere an den Landeselternvertretungen in Nordrhein-Westfalen ist, dass Eltern sie fern der Politik gründen und führen. Mischt sich die Politik direkt in deren Belange ein, ist diese Unabhängigkeit perdu. Vor allem der heftige Streit um die Corona-Politik an Schulen hat vielfältige Einflussversuche ausgelöst. In NRW fanden regelrechte Erdbeben in zwei Elternvereinen statt, dem für Realschulen und dem für Gesamtschulen.
In der Landeselternvertretung der integrierten Schulen (LEiS) in Nordrhein-Westfalen führte dies mindestens indirekt zu einer Entlassung. Auslöser dafür dürfte ein Brief der FDP-Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag, Franziska Müller-Rech, gewesen sein. Die beschwerte sich über das Verhalten von Sava Stomporowski. Die Mutter ist sowohl gewähltes Vorstandsmitglied als auch Mitarbeiterin des Elternvereins der Gesamtschulen. Stomporowski schlägt in den sozialen Medien eine scharfe Klinge – gerne auch gegen die FDP. “Leider ist Ihre Geschäftsführerin nicht einsichtig”, schrieb die FDP-Abgeordnete dem unabhängigen Elternverein daraufhin. In dem Schreiben drohte die Parlamentarierin, dass “sie nicht mehr bereit ist, an Terminen teilzunehmen, bei denen auch Frau Stomporowski anwesend ist.”
Sava Stomporowski wurde später tatsächlich entlassen. Auf Druck der FDP? Der Landeselternverband der integrierten Schulen in NRW gilt als der kritischste in NRW – eigentlich. Für Stomporowski ist klar, was ihre Entlassung bedeutet: “Das ist eine unrechtmäßige Einmischung in innere Angelegenheiten einer unabhängigen Elternschaft und Ausübung von Druck seitens gewählter Politikerinnen.” Ein schwerer Vorwurf.
Der Vorsitzende des Verbandes, Ralf Radke, legt größten Wert darauf, dass die Entlassung der Geschäftsführerin nichts mit der Intervention der FDP-Politikerin zu tun habe. Im Gespräch mit Bildung.Table monierte er unter anderem, dass Stomporowski kein Kind mehr in einer integrierten Schule habe. Allerdings gilt das auch für Ralf Radke: das Kind des Vorsitzenden geht nicht mehr zur Schule. Als sich die kritische Stomporowski für den LEiS Vorstand bewarb, um ihr Schicksal in die Hände einer demokratischen Versammlung zu legen, wurde es schmutzig. Ihre Vorstands-Kollegen schlossen sie kurzerhand aus dem Verein aus – offenkundig, um ihre mögliche Wahl zu hintertreiben.
Das Schreiben zum Ausschluss aus dem Elternverband schmiss jemand der Kandidatin eigenhändig in den Briefkasten – am Tag der Neuwahlen. Die Einwahldaten für die Online-Wahl enthielten Radke und seine Vorständler der Kollegin vor. “Ich war in voller Isolation von der Mitgliedschaft und ohne Kommunikationsmöglichkeit zu den Mitgliedern – wie in einer Diktatur“, sagt Stomporowski dazu. Sie ist heute noch sauer. Dass sie zu provokativen Auftritten neigt, streitet sie nicht ab. Aber, ob das die Mitglieder genauso sehen, hätten diese in einer demokratischen Wahl entscheiden können. Das verhinderte der Vorstand. Im Ausschlussverfahren führte er als ersten Grund das an, was angeblich keine Rolle spielt: Stomporowskis Verhalten “gegen die schulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion“.
Bis heute ist nicht geklärt, ob der Ausschluss von Sava Stomporowski juristisch korrekt war. Und vor den Wahlen in NRW wird das auch nicht mehr gelingen.
Bis an die Spitze des Ministeriums scheint der zweite Fall politischer Intervention zu führen. Im Mittelpunkt steht dabei die Mutter und Aktivistin Sina Mind. Das FDP-Mitglied aus Gladbeck bemühte sich schon im April 2020 darum, den inaktiven Elternverein für Realschulen in NRW zu übernehmen. “Mir war es wichtig, die einseitige Pro-Maske-Politik der Elternverbände für die einzelnen Schulformen in NRW zu verändern”, sagte Mind zu Bildung.Table. Sie habe “Gespräche mit dem damaligen Vorsitzenden des Landeselternverbandes der Realschulen geführt”. Johannes Papst – inzwischen in seinen 70ern, keine Schulkinder mehr – firmiert in sozialen Medien heute noch als Vorstand der Elternvertretung.
Sina Mind sagte Bildung.Table, sie habe sich auch immer wieder mit dem Staatssekretär im Bildungsministerium NRW ausgetauscht, dem FDP-Mann Mathias Richter. Er leitet den benachbarten Ortsverband Recklinghausen. Richter widersprach. Er sei Mind nur im Rahmen von Parteitreffen begegnet. “Ich habe mich nie für ihre persönlichen Ambitionen eingesetzt”, sagte Richter zu Bildung.Table “und war daher sicherlich nicht besonders hilfreich für die Pläne dieser möglicherweise überengagierten Frau”.
Mind nannte als Grund für die gescheiterte Übernahme die Konkurrenz von Kölner Eltern. “Ich habe keine Chance mehr gesehen, den Landeselternverband der Realschulen zu übernehmen, als die Kölner Gruppe sich auch dafür interessierte”, sagte Sina Mind, die ein Kind in der Realschule hat. Sie wäre dort nur ein kleiner Fisch im Haifischbecken gewesen. Sie habe danach versucht, eine konkurrierende Elterninitiative für Realschulen auf Landesebene zu gründen. “Ich hatte ein starkes Team von Eltern zusammen, um nicht mehr nur Schatten-Familien zu Wort kommen zu lassen.” Dieses Team stammte aus dem Umfeld der neuen, Corona-kritischen Familienverbände wie “Familien in der Krise“, der heute “Initiative Familien” heißt. Der Plan sei gewesen, so FDP-Frau Mind, den neuen Elternverein Realschule zu gründen und dann einen eigenen Antrag auf Mitwirkung in NRW zu stellen. Mind bezeichnet sich als Herz-Liberale.
Um den Elternverband für Gymnasien gab es übrigens keinen Streit. Der Vorsitzende dieser Landeselternvertretung in NRW ist bereits in der FDP.
In einer ersten Version des Textes hatte es geheißen, Ralf Radke habe mehrere Kinder. Das wurde korrigiert.
Der große Schulversuch in Bayern über das digitale Lernen der Zukunft ist mit Eltern gestartet. Er wird kleiner als erwartet – und wirft viele komplizierte Fragen auf. Die Stärke des Schulversuchs nämlich entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als seine Schwachstelle. Bei der 1:1-Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten sollen nämlich die Eltern mit an Bord. Sind die Eltern Eigentümer der Tablets, Laptops oder Convertibles, geraten viele pädagogische Anwendungen leichter, als wenn es die oft restriktiven Schulträger sind. Allerdings entpuppt sich die Beteiligung der Eltern als eine kommunikative Herausforderung für die Schulleiter. Bis jetzt haben sich 200 Schulen um den Eltern-Zuschuss für Endgeräte beworben. Das teilte das bayerische Kultusministerium Bildung.Table auf Anfrage mit.
Ursprünglich hatte es geheißen, dass an bis zu 250 Schulen alle Schüler digitale Endgeräte bekommen sollten. Die Einrichtungen könnten so die “Digitale Schule der Zukunft” explorieren. Es gehe um “ein vernetztes Lernen in einer vernetzten Welt“, schwärmte Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) anfänglich. Das Projekt ist immer noch ambitioniert, gerät zunächst aber kleiner als angekündigt. In den einzelnen Schulen erhalten nicht etwa alle Schüler:innen Endgeräte. Nur zwei Jahrgangsstufen je Schule sollen Tablets oder Laptops oder Convertibles bekommen. “Was sagen eigentlich meine Fünftklässler und deren Eltern, wenn die Sechst- und Siebtklässler ein digitales Endgerät bekommen – sie aber nicht?” So beschrieb ein Schulleiter eine der heiklen Fragen. Wie berichtet, werden die Eltern im Schulversuch in Bayern miteinbezogen: Sie bekommen einen Zuschuss von 300 Euro für die Endgeräte ihrer Kinder.
Bildung.Table hat mit einer Reihe von Schulleiter:innen über die Ausschreibung und die Möglichkeiten des Schulversuchs gesprochen. So wollten sich allesamt wegen des noch laufenden Bewerbungsverfahrens nicht namentlich äußern. Ein Schulleiter meinte, der Vorteil der Beteiligung der Eltern bei dem Schulversuch liege darin, dass die Geräte dann freier für pädagogische Zwecke genutzt werden könnten – und die Schule dabei den Hut aufhabe. Im Leihgeräte-Programm, das Teil des Digitalpakts war, seien die Schulträger die Eigentümer der Geräte. Diese hätten oft strengere Maßstäbe an die Nutzung der Endgeräte angelegt. Auf diese Weise seien oft schulferne Vorschriften zum Tragen gekommen. “Es geht aber darum, die technischen und juristischen Hürden für die Nutzung solcher Geräte wegzuräumen, damit die Lehrer sich auf die pädagogische Nutzung konzentrieren können“, sagte der Schulleiter.
Ein anderer Schulleiter sagte, er werde sich an diesem Projekt gar nicht beteiligen. Denn das könne geradezu schädliche Auswirkungen auf die Schule haben. “Für eine Schule, die noch wenig Erfahrung hat, kann die Teilnahme kontraproduktiv sein – weil sie allen Erkenntnissen von Schulentwicklung widerspricht.” Er sei Chef von Leuten, die zwar alle das Gleiche studiert hätten. Aber er müsse gut begründen können, “warum wir die Dinge tun, die ich von Ihnen verlange.” Wenn eine Schule mit zwei Jahrgängen in diesen Versuch starten wolle, müsste ein Großteil der Lehrerschaft seinen Workflow ändern. “In meinen Augen geht damit eine Überforderung der Lehrer einher – gerade jetzt, wo wir nach zwei Jahren Pandemie erst mal konsolidieren müssen.”
Aber es geht nicht nur um die Frage, wie ein Kollegium den Schulversuch bewältigen kann. Auch die Einbeziehung der Eltern ist komplex. Dabei geht es um das Management der Beschaffung – und um soziale Fragen. “Man hat uns geraten, Eltern, die nicht genug Geld haben, mit einem Leihgerät zu versorgen”, berichtet ein Schulleiter. Das aber sei gar nicht so einfach. Man solle den Eltern besser nicht vorher sagen, dass es beim Schulversuch in Bayern günstigere Leihgeräte gibt. Sonst gefährde man die Zustimmung der Eltern insgesamt. Die müsse eigentlich gleich zweimal eingeholt werden. Zunächst als genereller Beschluss des Elternbeirats. Und dann als konkretes Ja der Eltern, dass sie sich an dem Schulversuch mit eigenem Geld beteiligen. Das Ministerium versicherte, auszuschließen, “dass einzelne Schüler ‘aus der Klasse fliegen’, weil sich ihre Eltern kein Endgerät leisten können oder wollen.”
Der Eigenanteil der Eltern liege wahrscheinlich bei 150 Euro plus. Ein handelsübliches Tablet für den Schulgebrauch etwa koste mit Hülle und Stift etwa 450 Euro. Nach oben sind dann wenig Grenzen gesetzt, wenn die Eltern nicht nur eine Speicherkapazität von 32 Gigabyte (GB), sondern eventuell von 256 GB für ihre Kinder wollten. Welche praktischen Folgen das für den sozialen Alltag in der Schule habe, müsse man abwarten.
Betrachtet man den Ausschreibungstext genau, geht es in Wahrheit um zwei Schulversuche: Zum einen den geradezu futuristischen Ansatz einer neuen digitalen Schule der Zukunft, bei der grundlegende Erkenntnisse über Schulentwicklungsprozesse gewonnen werden sollen. Zum anderen um die Frage, wie eine Schulbürokratie über den Umweg der Eltern die Finanzen besser kontrolliert – und das Geräte-Management vereinfacht. Im Deutsch der bayerischen Schulbehörde liest sich das so: “Ziel ist die Gewinnung von Erkenntnissen für einen pädagogischen Gesamtansatz einschließlich der Erprobung von Beschaffungsverfahren.” An diesen Beschaffungsverfahren, das muss man wissen, droht der große bundesweite Digitalpakt gerade zu scheitern.

Ein Gastbeitrag von Richard Münch
Seit drei Jahrzehnten stehen Schulreformen weltweit auf der Tagesordnung. Sie sollen Bildungsleistung verbessern, Leistungsunterschiede abbauen und Auswirkungen des familiären Hintergrunds auf die Leistung verringern. Diese Reformen haben einen gemeinsamen Kern, der den Schwerpunkt auf Schulautonomie, freie Schulwahl, Wettbewerb zwischen Schulen, starkes Schulmanagement, hohe Lehrerqualität und testbasierte Rechenschaftspflicht von Schulen legt.
Allerorts wurden Bildungssysteme in diesem Sinne umgebaut. Doch klafft eine Forschungslücke: Wir wissen nicht ausreichend, inwieweit die Anwendung von Steuerungsinstrumenten im Rahmen der globalen Reformagenda einen Unterschied macht. Daher haben wir statistische Analysen durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen den Reformen und den individuellen Schülerleistungen sowie Leistungsunterschieden aufgrund des familiären Hintergrunds zu untersuchen. Dazu haben wir PISA-Ergebnisse aus dem Vereinigten Königreich (ohne Schottland), Deutschland, Schweden und Finnland aus den Testwellen 2000, 2009 und 2015 herangezogen. Haben sich die Leistungen im Laufe der Zeit, mit den fortschreitenden Reformen, verbessert und die Leistungsungleichheiten verringert?
Im Vereinigten Königreich wurden seit den 1980er Jahren umfangreiche Reformen durchgeführt, von denen die konsequentesten in England die freie Schulwahl auf einem Bildungsmarkt, eine größere Autonomie der Schulen und im Gegenzug eine verstärkte Leistungskontrolle beinhalteten. Das ursprünglich gegliederte Schulsystem wurde bis auf 163 Gymnasien zugunsten eines Gesamtschulsystems abgebaut. In Deutschland wurde nach dem “PISA-Schock” von 2000 das Monitoring der Schulen ausgeweitet und in einigen Bundesländern wie z. B. Niedersachsen die Autonomie der Schulen bei gleichzeitiger Betonung der Selbstkontrolle und Rechenschaftspflicht gestärkt. Bildungsmärkte wie im Vereinigten Königreich wurden jedoch nicht eingerichtet, und das gegliederte Schulsystem mit dem Gymnasium an der Spitze wurde beibehalten.
Schweden hat seit Anfang der 1990er Jahre umfassende marktorientierte und auf verstärkte Rechenschaftspflicht ausgerichtete Reformen vollzogen. Finnland hat sich seither ebenfalls an der globalen Reformagenda orientiert, allerdings in gemäßigterer Form. Der Schwerpunkt lag auf Dezentralisierung, Verantwortung der Gemeinden, Diversifizierung der Lehrpläne und Erleichterung der Schul- oder Lehrplanwahl durch die Eltern. Auf strenge Maßnahmen der Rechenschaftspflicht verzichtete man. Die Treuhänderschaft der Lehrer blieb weiterhin im Vordergrund.
Betrachtet man die Ergebnisse für das Vereinigte Königreich, so belegen die von uns konsultierten empirischen Studien, dass die forcierte Förderung der freien Schulwahl auf Bildungsmärkten nicht mit einer Steigerung der Bildungsleistungen einherging. Vielmehr reproduzierten oder verstärkten sich sogar Bildungsungleichheiten. Die größere Autonomie der Schulen, gepaart mit verschärfter Leistungskontrolle, hat die Dokumentationsarbeit von Schulleitungen und Lehrern massiv erhöht und den Unterricht auf zentrale Fächer und Testvorbereitung verengt.
Für Deutschland gibt es im Gegensatz zum Vereinigten Königreich weniger empirische Studien zu den Wirkungen der Reformmaßnahmen. Die Bildungsberichterstattung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) belegt jedoch eindeutig, dass es keine signifikanten Leistungsverbesserungen gegeben hat und dass nach wie vor große Leistungsunterschiede aufgrund des familiären Hintergrunds bestehen.
Weder im Vereinigten Königreich noch in Deutschland: Unsere statistische Analyse der PISA-Daten hat keine Belege dafür erbracht, dass die marktorientierten oder bürokratisch-professionellen Reformstrategien, die auf eine umfassende Überwachung der Schulen abzielen, mit sichtbaren Leistungssteigerungen und einer signifikanten Verringerung der Leistungsunterschiede nach sozialer Herkunft verbunden gewesen wären. Der sozioökonomische Status der besuchten Schule im Schülerdurchschnitt und des einzelnen Schülers sowie in weit geringerem Maße die Schuldisziplin sind von entscheidender Bedeutung. In Deutschland zeigt sich dies nach wie vor in einem in Leistungsklassen gegliederten Schulsystem, inzwischen aber auch in einer zunehmenden Leistungsdifferenzierung im Gymnasium.
Im Gesamtschulsystem des Vereinigten Königreichs sehen wir eine etwas geringere Leistungsdifferenzierung zwischen den Schulen nach dem durchschnittlichen sozioökonomischen Status ihrer Schüler und eine etwas stärkere Leistungsdifferenzierung innerhalb der Schulen nach dem sozioökonomischen Status des einzelnen Schülers als in Deutschland. Allerdings wird der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Leistungen der Schüler im Vereinigten Königreich dadurch etwas unterschätzt, dass dort im internationalen Vergleich ein sehr niedriger Prozentsatz der Fünfzehnjährigen am PISA-Test teilgenommen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die leistungsschwächeren Schüler im Test unterrepräsentiert waren, ist sehr hoch.
Was Schweden und Finnland betrifft, so haben unsere Literaturrecherche und statistischen Analysen der PISA-Daten keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass marktbasierte Reformen in Schweden und Dezentralisierungsreformen in Finnland zu sichtbaren Erfolgen geführt hätten. Die Reformstrategien ändern nichts an der überragenden Wirkung struktureller Faktoren und ihrer institutionellen Verankerung im Schulsystem. Anders als von der globalen Reformbewegung postuliert, haben sich die Steuerungsinstrumente weder in Schweden noch in Finnland als wirksam erwiesen.
Der durchschnittliche sozioökonomische Status der Schüler einer besuchten Schule und des einzelnen Schülers ist entscheidend. Vor dem Hintergrund größerer sozialer Ungleichheit und stärkerer Differenzierung durch Wettbewerb im Schulsystem ist dies in Schweden mehr und früher der Fall gewesen als in Finnland. Aber auch Finnland hat sich in diese Richtung entwickelt. Die Verringerung der Chancengleichheit in Finnland ist auf das Zusammentreffen dreier Veränderungen zurückzuführen: die verstärkte Nutzung der Schul- oder Lehrplanwahl durch die besser gestellten Eltern im Vergleich zu den schlechter gestellten, die zunehmende Heterogenität der Bevölkerung durch Zuwanderung und die geringere Unterordnung unter die Autorität der Lehrer als das in der Vergangenheit der Fall war. Da es keine Belege für den Erfolg der globalen Reformbewegung gibt, ist unsere Schlussfolgerung für die Politik, diese Agenda zu überdenken.
Richard Münch ist Seniorprofessor für Gesellschaftstheorie und komparative Makrosoziologie an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Der hier veröffentlichte Beitrag resultiert aus einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt über “Effektive Schulsteuerung”.
Eine 50-köpfige Jury aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Bildungsverwaltung hat die Schulen für die nächste Runde des Deutschen Schulpreises ausgewählt. Bis Juli besuchen Juryteams die 20 Nominierten und wählen bis zu 15 Schulen für die finale Runde aus. Schulen aus zehn verschiedenen Bundesländern sind unter den TOP 20. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit sechs ausgewählten Schulen (Liste der Nominierten). 81 Bildungseinrichtungen aus 14 Bundesländern haben an dem Wettbewerb, der dieses Jahr unter dem Motto “Unterricht besser machen” steht, teilgenommen. Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung gemeinsam mit der Heidehof Stiftung verliehen und ist mit 100.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 28. September in Berlin statt. npr
Der Digitalpakt sorgt für mehr Ungleichheit, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). “Die aktuelle Umsetzungspraxis des Digitalpakts gefährdet die Chancengleichheit in den Schulen und erinnert an einen Flickenteppich“, sagte Anja Bensinger-Stolze, die Schul-Sprecherin des Hauptvorstands der GEW ist. “Die Bildung der Kinder darf weder von der Finanzlage einzelner Kommunen noch von einer zufälligen Digitalisierungsaffinität einzelner Lehrkräfte abhängig sein.” Die Studie lief von August 2020 bis März dieses Jahres, ihr Autor ist der Forscher Michael Wrase.
Mit den Ergebnissen können Länder und Bund nicht zufrieden sein. Die KMK etwa verfehlt ihr selbst gestecktes Ziel aus dem Jahr 2016. Die Kultusminister:innen wollten damals erreichen, “dass möglichst bis 2021 jede Schülerin und jeder Schüler jederzeit, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen können sollte.” Das allerdings ist nicht gelungen. Obendrein wisse der Bund so wenig wie die Länder, wie eine realistische Sicht auf den Digitalpakt aussieht. Eigentlich hätten sich, heißt es in dem Papier, Bund und Länder “dazu verpflichtet, ‘jährlich’ einen zusammenfassenden Fortschrittsbericht mit allen gesammelten Informationen zu veröffentlichen.” Auch das aber ist nicht geschehen – wie auch der Bundesrechnungshof in einer kritischen Stellungnahme festgestellt hat.
Laut Studie verschärfte der Digitalpakt bestehende Ungleichheiten im Bildungssystem. Schulkinder an Gymnasien hätten ein “deutlich höheres Niveau” in “computerbezogenen Kompetenzen” als solche von nicht-gymnasialen Einrichtungen. Die Ungleichheit in digitaler Kompetenz ließe sich entlang der Herkunft aus sozialen Klassen nachweisen, was an den schulformbezogenen Unterschieden der Digitalisierung liegt und für ein zutiefst ungerechtes Bildungssystem spricht. Es hänge oft zu sehr von einzelnen Lehrkräften ab, ob Kinder digitale Kompetenzen erwerben oder nicht.
Probleme erkannte die Studie vor allem beim Zusammenspiel der vier “Ebenen” des Digitalpakts: dem Bund als Mittelgeber, den Ländern als Förderträger, Städten und Kommunen als Schulträgern und den Einzelschulen. Für eine “gelingende schulische Digitalisierung” definiert die Studie vier zentrale Faktoren: Sicherstellung “leistungsfähiger Basisinfrastruktur” wie Endgeräten, der Gewährleistung von Administration und Support, Weiterbildung von Personal und der Initiierung nachhaltiger digitaler Schulentwicklungsprozesse.
Allerdings hat die Studie auch einen gewaltigen Nachteil: Die ursprüngliche Idee, alle 16 Bundesländer nach ihren Vorstellungen und Plänen zu fragen, musste ad acta gelegt werden. Es antworteten nur fünf Länder. Die anderen schwiegen, weil es ihnen an “personellen Ressourcen” für die Beantwortung derartiger Anfragen mangele. Mit anderen Worten: Die Länder machen kein eigenes Monitoring des Digitalpakts – und sie lassen auch kein externes zu. Robert Saar
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) führt gegenwärtig eine internationale Umfrage durch. In Deutschland befragt dafür das WeQ Institute Lehrerinnen und Lehrer zu “Digitalisierung in der Bildung und deren Bedeutung für Lehrkräfte”. Die gemeinnützige WeQ GmbH unter Zukunftsforscher Peter Spiegel sucht nun nach Teilnehmenden aus den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Teilnehmen können Lehrkräfte, Schulleitungen und Expert:innen im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Den Fragebogen können Interessierte unter office@weq.institute anfordern. Die gegenwärtige Lehrer-Umfrage wird von verschiedenen Organisationen in Europa und Afrika durchgeführt. Die IAO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie soll unter anderem Menschen- und Arbeiterrechte fördern und veröffentlicht entsprechend Studien und Berichte – auch zum Bildungssektor. Enno Eidens

Wie genau funktioniert das mit dem Schwangerwerden? Warum wissen wir so wenig darüber, wie sich sexuelle Krankheiten übertragen? Mit solchen Fragen begann die Geschäftsidee der Gründerinnen Carolin Strehmel und Vanessa Meyer, aus der die Knowbody-App entstand. Die steht nun kurz vor dem Launch. Mit Knowbody möchten die beiden an den Schulen über Sexualität, Gefühle und Körper aufklären.
Die erste Umfrage von Strehmel und Meyer unter Kommiliton:innen in der Uni-Mensa hatte ein wenig überraschendes Ergebnis. Kaum jemand hatte gute Erinnerungen an seinen oder ihren Sexualkunde-Unterricht – wenn sie sich überhaupt erinnern konnten. “Wir waren fassungslos”, sagt Carolin Strehmel. Und da sie und ihre Freundin gerade für die Masterarbeiten Online-Umfragen konzipierten, erstellten sie noch eine weitere für Lehrkräfte. Sie wollten herausfinden, wie präsent das Thema sexuelle Aufklärung im Biologie-Lehramtsstudium heute ist. Das Ergebnis ihrer Umfrage: 70 Prozent der Lehrkräfte waren gar nicht ausgebildet. Trotzdem waren sie die Einzigen, die an ihren Schulen zu Sexualität unterrichten.
“Das ist der Zustand in einer aufgeklärten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und gleichzeitig hängen gut sichtbar auf den Straßen halbnackte Körper, die für Unterwäsche werben“, sagt Carolin Strehmel. Das Thema ließ sie und ihre Kommilitonin Vanessa Meyer nicht mehr los. Und irgendwann entstand die Idee, eine App zu entwickeln, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Also scharrten die Beiden ein kleines Team um sich. Es bestand aus Sexualpädagoginnen, Lehramtsstudierenden, zwei Designern und einem Programmierer. So bewarben sie sich um ein Gründerstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen.
Eine erste Hürde für das Start-up war die Beschaffung der Informationen. Obwohl das Internet Unmengen an Wissen bereitstellt, scheint der neueste Stand der Wissenschaft sich eher selten in Publikationen wiederzufinden. Viele Lehrbücher, die heute noch in Schulen Verwendung finden, stammen aus den 1990ern. Sie beinhalten veraltete Bilder und behandeln das Thema Sexualität und Fortpflanzung mit Fingerspitzen. Wenn Lehrkräfte zeitgemäßen Sexualunterricht abhalten wollen, müssen sie besonders umfangreich recherchieren. Die App von Carolin Strehmel und Vanessa Meyer soll sie dabei unterstützen.
In der App gibt es Informationen zu acht Gebieten: “Beziehungen”, “Sexualität”, “Geschlecht”, “sexuelle Selbstbestimmung”, “Familie und Familienplanung”, “Sexualität und Medien”, “Vielfalt und Gesellschaft” sowie einen Bereich über “Körper”. Bei letzterem wird der Menstruationszyklus mit Abbildungen und Text erklärt und die Unterschiede zwischen Tampons, Binden und Cups herausgearbeitet. Unter “Geschlecht” geht es um verschiedene Identitäten, Stereotype oder toxische Männlichkeit. Es ist ein Mix aus Informationen, weiterführenden Links und von eigens für die App designten Abbildungen, die die Unterschiedlichkeit aller menschlichen Körper versuchen einzufangen.
Die Idee ist, dass Lehrer:innen die Knowbody-App ohne viel Vorbereitung nahtlos in ihren Unterricht integrieren können. Dafür hat das Team um Carolin Strehmel Handouts für Lehrkräfte konzipiert, die sie auf die jeweiligen Module vorbereiten und trotzdem genug Raum lassen für eigene Impulse.
Die App richtet sich an alle Schulformen der weiterführenden Schulen: Förderschulen, Realschulen, Gymnasien, Haupt- oder Gesamtschulen von der sechsten bis zur zehnten Klasse. Zurzeit wird sie an verschiedenen Schulen getestet. Mehr als 100 Registrierungen von Lehrkräften aus fast allen Bundesländern, die Knowbody in ihren Klassen einsetzen, gebe es bereits, sagt Carolin Strehmel.
Die Lehrkräfte und Schüler:innen füllen Fragebögen aus, damit die Testversion der App erweitert oder präzisiert werden kann. Für manche Tests setzt sich Carolin Strehmel auch in den Klassenraum in die letzte Reihe und beobachtet im Feld, wie die App im Unterricht funktioniert.
Besonders viel diskutieren Schüler über das Thema Heteronormativität. Also eine Weltsicht, die vorgibt, das Normale sei Sex ausschließlich zwischen Männern und Frauen und dass jeder Mensch sich auch dem Geschlecht zugehörig fühlt, das ihm bei der Geburt zugeschrieben wurde. Knowobody will ein breiteres Bild vermitteln: Es gibt nicht nur weiblich und männlich, es gibt auch Trans-Identitäten oder Menschen, die sich gar nicht auf ein Geschlecht festlegen wollen. Und Sex ist viel mehr, als die Penetration einer Frau durch einen Mann.
Im Juni endet die Testphase, im September soll das Endprodukt auf den Markt kommen, dann endet die Anschubfinanzierung des Bundeswirtschaftsministeriums. Für vier Euro soll die App dann pro Nutzer:in im App-Store erhältlich sein. Sie soll nicht nur an Kommunen, Schulen und Klassen verkauft werden, sondern auch für jeden einzelnen verfügbar sein.
06. Mai 2022, 15:00 bis 17:00 Uhr
Fachgespräch (Online): Neue Lernkultur für alle Schulen!
Die Heinrich-Böll-Stiftung lädt zur digitalen Gesprächsrunde ein: Wie können Kinder und Jugendliche die Kompetenzen, Haltungen und Werte erwerben, die sie für ein selbstbestimmtes Leben brauchen? Im Fokus des Fachgesprächs steht ein Impulspapier, in dem ein Kreis von Autoren Vorschläge und Ideen für eine neue Lernkultur an den Schulen skizziert. Infos & Anmeldung
04. Mai bis 06. Juli 2022, jeweils 16:00 Uhr
Vortragsreihe: Unterricht reflektieren – Kompetenzen von Lehrkräften stärken
Mit einer mehrteiligen Vortragsreihe wollen die Goethe-Universität Frankfurt, die Akademie für Bildungsforschung und Lehrkräftebildung und das IDeA-Zentrum Tipps und Empfehlungen geben, wie Lehrkräfte den eigenen Unterricht stetig reflektieren und verbessern können. Wie wähle ich meine Inhalte aus? Wie spreche ich meine Schüler an? Wie gelingt eine echte Feedbackkultur im Klassenzimmer? Infos & Anmeldung
09. bis 19. Mai 2022
Online-Kurs: Learning Experience Design
Spannend für Schulentwickler und Personaler: Die time4you GmbH bietet Kurse und Veranstaltungen an, in denen das Handwerkszeug vermittelt wird, um in der eigenen Organisationen eine Lernplattform oder Online-Akademie aufzubauen oder mehrere Teams – in der Schule oder im Unternehmen – miteinander zu vernetzen. Dabei wird auch über Stolpersteine wie die DSGVO und fehlende IT-Kenntnisse gesprochen. Infos & Anmeldung
13. bis 14. Mai 2022, jeweils 09:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltung: Berufsinformationsmesse
Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, der richtigen Weiterbildung oder Impulsen für die eigene berufliche Zukunft? Die Berufsinfomesse (BIM) in Offenburg bietet über 2000 Events, Stände und viele Informationen zu Aus- und Weiterbildung, Berufsfeldern, Studiengängen und Praktika im In- und Ausland. Infos & Anmeldung
es ist noch nicht allzu lange her, dass der bayerische Kultusminister Michael Piazolo, die Leistungen seines Bundeslandes bei der Digitalisierung der Schulen im Interview mit Bildung.Table lobte – und unter anderem auf die Initiative “Zukunft Digitale Schule” verwies. Deren Ziel: In einem Pilotprojekt an 250 Schulen im Land die Lernenden mit digitalen Geräten zu versorgen. Nun ist Christian Füller dem Projekt nachgegangen. Und es stellt sich heraus: Das Landesprogramm ist so kompliziert gefasst, dass es bei Schulleitern und Eltern zu Kopfschütteln führt.
Wie erfolgreich sind Bund und Länder eigentlich mit der Umsetzung ihres Digitalpaktes und der Digital-Strategien? Die GEW hat versucht, die Umsetzung zu monitoren und den Erfolg zu bewerten. Das Ergebnis: An einer Untersuchung haben sich nicht einmal die Hälfte der Bundesländer beteiligt. Und die Ergebnisse der Restbefragung lassen befürchten, dass der Digitalpakt zur Verschärfung der Bildungsungerechtigkeit an Schulen beiträgt.
Ihr Augenmerk möchte ich außerdem auf die Ergebnisse der Untersuchung der Zeppelin Universität in Friedrichshafen lenken. Dort hat ein Team um Professor Richard Münch die Ergebnisse der zahlreichen Schulreformen der letzten Jahre in einigen europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland, untersucht. Münchs Gastbeitrag in Bildung.Table sollte Pflichtlektüre für Schulreformer sein.
Zuletzt gestatten Sie mir bitte einige Worte in eigener Sache. Seit einem Jahr blickt das Redaktionsteam von Bildung.Table wöchentlich auf politische Prozesse rund um die digitale Bildung in Deutschland, informiert Sie, unsere Leserinnen und Leser, über aktuelle Entwicklungen, wichtige Akteure und innovative digitale Methoden und Tools. Zum Team von Bildung.Table ist nun der Journalist Moritz Baumann gestoßen. Moritz wird das Briefing gemeinsam mit Niklas Prenzel, den Sie bereits kennen, als Teamleiter führen und thematisch erweitern. Christian Füller, der Ihnen als ausgewiesener Experte im digitalen Bildungsbereich bekannt ist, wird seine Kompetenz und Erfahrung als Reporter für digitale Transformation einbringen.
Eine erkenntnisreiche und spannende Lektüre wünscht Ihnen

Die FDP hat in Nordrhein-Westfalen (NRW) offenbar versucht, unabhängige Elternvereine zu beeinflussen – oder gar zu übernehmen. In einem Elternverband führte dies zur Entlassung der Geschäftsführerin. Die Übernahme und die Gründung eines eigenen Elternverbandes für Realschulen scheiterten indes. Der Staatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen für Schule, Mathias Richter (FDP), habe mit einer der Akteurinnen der Übernahme eine Reihe von Gesprächen geführt, erfuhr Bildung.Table. Richter bestätigte Treffen mit dem FDP-Mitglied im Zuge von Parteitreffen. Er dementiert allerdings, dass er sich dabei für die Gründung eines FDP-freundlichen oder gar liberal geführten Elternvereins eingesetzt habe. Kommende Woche wählt Nordrhein-Westfalen, und die Regierungspartei FDP liegt in den Umfragen nur noch bei acht Prozent.
Das Besondere an den Landeselternvertretungen in Nordrhein-Westfalen ist, dass Eltern sie fern der Politik gründen und führen. Mischt sich die Politik direkt in deren Belange ein, ist diese Unabhängigkeit perdu. Vor allem der heftige Streit um die Corona-Politik an Schulen hat vielfältige Einflussversuche ausgelöst. In NRW fanden regelrechte Erdbeben in zwei Elternvereinen statt, dem für Realschulen und dem für Gesamtschulen.
In der Landeselternvertretung der integrierten Schulen (LEiS) in Nordrhein-Westfalen führte dies mindestens indirekt zu einer Entlassung. Auslöser dafür dürfte ein Brief der FDP-Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag, Franziska Müller-Rech, gewesen sein. Die beschwerte sich über das Verhalten von Sava Stomporowski. Die Mutter ist sowohl gewähltes Vorstandsmitglied als auch Mitarbeiterin des Elternvereins der Gesamtschulen. Stomporowski schlägt in den sozialen Medien eine scharfe Klinge – gerne auch gegen die FDP. “Leider ist Ihre Geschäftsführerin nicht einsichtig”, schrieb die FDP-Abgeordnete dem unabhängigen Elternverein daraufhin. In dem Schreiben drohte die Parlamentarierin, dass “sie nicht mehr bereit ist, an Terminen teilzunehmen, bei denen auch Frau Stomporowski anwesend ist.”
Sava Stomporowski wurde später tatsächlich entlassen. Auf Druck der FDP? Der Landeselternverband der integrierten Schulen in NRW gilt als der kritischste in NRW – eigentlich. Für Stomporowski ist klar, was ihre Entlassung bedeutet: “Das ist eine unrechtmäßige Einmischung in innere Angelegenheiten einer unabhängigen Elternschaft und Ausübung von Druck seitens gewählter Politikerinnen.” Ein schwerer Vorwurf.
Der Vorsitzende des Verbandes, Ralf Radke, legt größten Wert darauf, dass die Entlassung der Geschäftsführerin nichts mit der Intervention der FDP-Politikerin zu tun habe. Im Gespräch mit Bildung.Table monierte er unter anderem, dass Stomporowski kein Kind mehr in einer integrierten Schule habe. Allerdings gilt das auch für Ralf Radke: das Kind des Vorsitzenden geht nicht mehr zur Schule. Als sich die kritische Stomporowski für den LEiS Vorstand bewarb, um ihr Schicksal in die Hände einer demokratischen Versammlung zu legen, wurde es schmutzig. Ihre Vorstands-Kollegen schlossen sie kurzerhand aus dem Verein aus – offenkundig, um ihre mögliche Wahl zu hintertreiben.
Das Schreiben zum Ausschluss aus dem Elternverband schmiss jemand der Kandidatin eigenhändig in den Briefkasten – am Tag der Neuwahlen. Die Einwahldaten für die Online-Wahl enthielten Radke und seine Vorständler der Kollegin vor. “Ich war in voller Isolation von der Mitgliedschaft und ohne Kommunikationsmöglichkeit zu den Mitgliedern – wie in einer Diktatur“, sagt Stomporowski dazu. Sie ist heute noch sauer. Dass sie zu provokativen Auftritten neigt, streitet sie nicht ab. Aber, ob das die Mitglieder genauso sehen, hätten diese in einer demokratischen Wahl entscheiden können. Das verhinderte der Vorstand. Im Ausschlussverfahren führte er als ersten Grund das an, was angeblich keine Rolle spielt: Stomporowskis Verhalten “gegen die schulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion“.
Bis heute ist nicht geklärt, ob der Ausschluss von Sava Stomporowski juristisch korrekt war. Und vor den Wahlen in NRW wird das auch nicht mehr gelingen.
Bis an die Spitze des Ministeriums scheint der zweite Fall politischer Intervention zu führen. Im Mittelpunkt steht dabei die Mutter und Aktivistin Sina Mind. Das FDP-Mitglied aus Gladbeck bemühte sich schon im April 2020 darum, den inaktiven Elternverein für Realschulen in NRW zu übernehmen. “Mir war es wichtig, die einseitige Pro-Maske-Politik der Elternverbände für die einzelnen Schulformen in NRW zu verändern”, sagte Mind zu Bildung.Table. Sie habe “Gespräche mit dem damaligen Vorsitzenden des Landeselternverbandes der Realschulen geführt”. Johannes Papst – inzwischen in seinen 70ern, keine Schulkinder mehr – firmiert in sozialen Medien heute noch als Vorstand der Elternvertretung.
Sina Mind sagte Bildung.Table, sie habe sich auch immer wieder mit dem Staatssekretär im Bildungsministerium NRW ausgetauscht, dem FDP-Mann Mathias Richter. Er leitet den benachbarten Ortsverband Recklinghausen. Richter widersprach. Er sei Mind nur im Rahmen von Parteitreffen begegnet. “Ich habe mich nie für ihre persönlichen Ambitionen eingesetzt”, sagte Richter zu Bildung.Table “und war daher sicherlich nicht besonders hilfreich für die Pläne dieser möglicherweise überengagierten Frau”.
Mind nannte als Grund für die gescheiterte Übernahme die Konkurrenz von Kölner Eltern. “Ich habe keine Chance mehr gesehen, den Landeselternverband der Realschulen zu übernehmen, als die Kölner Gruppe sich auch dafür interessierte”, sagte Sina Mind, die ein Kind in der Realschule hat. Sie wäre dort nur ein kleiner Fisch im Haifischbecken gewesen. Sie habe danach versucht, eine konkurrierende Elterninitiative für Realschulen auf Landesebene zu gründen. “Ich hatte ein starkes Team von Eltern zusammen, um nicht mehr nur Schatten-Familien zu Wort kommen zu lassen.” Dieses Team stammte aus dem Umfeld der neuen, Corona-kritischen Familienverbände wie “Familien in der Krise“, der heute “Initiative Familien” heißt. Der Plan sei gewesen, so FDP-Frau Mind, den neuen Elternverein Realschule zu gründen und dann einen eigenen Antrag auf Mitwirkung in NRW zu stellen. Mind bezeichnet sich als Herz-Liberale.
Um den Elternverband für Gymnasien gab es übrigens keinen Streit. Der Vorsitzende dieser Landeselternvertretung in NRW ist bereits in der FDP.
In einer ersten Version des Textes hatte es geheißen, Ralf Radke habe mehrere Kinder. Das wurde korrigiert.
Der große Schulversuch in Bayern über das digitale Lernen der Zukunft ist mit Eltern gestartet. Er wird kleiner als erwartet – und wirft viele komplizierte Fragen auf. Die Stärke des Schulversuchs nämlich entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als seine Schwachstelle. Bei der 1:1-Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten sollen nämlich die Eltern mit an Bord. Sind die Eltern Eigentümer der Tablets, Laptops oder Convertibles, geraten viele pädagogische Anwendungen leichter, als wenn es die oft restriktiven Schulträger sind. Allerdings entpuppt sich die Beteiligung der Eltern als eine kommunikative Herausforderung für die Schulleiter. Bis jetzt haben sich 200 Schulen um den Eltern-Zuschuss für Endgeräte beworben. Das teilte das bayerische Kultusministerium Bildung.Table auf Anfrage mit.
Ursprünglich hatte es geheißen, dass an bis zu 250 Schulen alle Schüler digitale Endgeräte bekommen sollten. Die Einrichtungen könnten so die “Digitale Schule der Zukunft” explorieren. Es gehe um “ein vernetztes Lernen in einer vernetzten Welt“, schwärmte Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) anfänglich. Das Projekt ist immer noch ambitioniert, gerät zunächst aber kleiner als angekündigt. In den einzelnen Schulen erhalten nicht etwa alle Schüler:innen Endgeräte. Nur zwei Jahrgangsstufen je Schule sollen Tablets oder Laptops oder Convertibles bekommen. “Was sagen eigentlich meine Fünftklässler und deren Eltern, wenn die Sechst- und Siebtklässler ein digitales Endgerät bekommen – sie aber nicht?” So beschrieb ein Schulleiter eine der heiklen Fragen. Wie berichtet, werden die Eltern im Schulversuch in Bayern miteinbezogen: Sie bekommen einen Zuschuss von 300 Euro für die Endgeräte ihrer Kinder.
Bildung.Table hat mit einer Reihe von Schulleiter:innen über die Ausschreibung und die Möglichkeiten des Schulversuchs gesprochen. So wollten sich allesamt wegen des noch laufenden Bewerbungsverfahrens nicht namentlich äußern. Ein Schulleiter meinte, der Vorteil der Beteiligung der Eltern bei dem Schulversuch liege darin, dass die Geräte dann freier für pädagogische Zwecke genutzt werden könnten – und die Schule dabei den Hut aufhabe. Im Leihgeräte-Programm, das Teil des Digitalpakts war, seien die Schulträger die Eigentümer der Geräte. Diese hätten oft strengere Maßstäbe an die Nutzung der Endgeräte angelegt. Auf diese Weise seien oft schulferne Vorschriften zum Tragen gekommen. “Es geht aber darum, die technischen und juristischen Hürden für die Nutzung solcher Geräte wegzuräumen, damit die Lehrer sich auf die pädagogische Nutzung konzentrieren können“, sagte der Schulleiter.
Ein anderer Schulleiter sagte, er werde sich an diesem Projekt gar nicht beteiligen. Denn das könne geradezu schädliche Auswirkungen auf die Schule haben. “Für eine Schule, die noch wenig Erfahrung hat, kann die Teilnahme kontraproduktiv sein – weil sie allen Erkenntnissen von Schulentwicklung widerspricht.” Er sei Chef von Leuten, die zwar alle das Gleiche studiert hätten. Aber er müsse gut begründen können, “warum wir die Dinge tun, die ich von Ihnen verlange.” Wenn eine Schule mit zwei Jahrgängen in diesen Versuch starten wolle, müsste ein Großteil der Lehrerschaft seinen Workflow ändern. “In meinen Augen geht damit eine Überforderung der Lehrer einher – gerade jetzt, wo wir nach zwei Jahren Pandemie erst mal konsolidieren müssen.”
Aber es geht nicht nur um die Frage, wie ein Kollegium den Schulversuch bewältigen kann. Auch die Einbeziehung der Eltern ist komplex. Dabei geht es um das Management der Beschaffung – und um soziale Fragen. “Man hat uns geraten, Eltern, die nicht genug Geld haben, mit einem Leihgerät zu versorgen”, berichtet ein Schulleiter. Das aber sei gar nicht so einfach. Man solle den Eltern besser nicht vorher sagen, dass es beim Schulversuch in Bayern günstigere Leihgeräte gibt. Sonst gefährde man die Zustimmung der Eltern insgesamt. Die müsse eigentlich gleich zweimal eingeholt werden. Zunächst als genereller Beschluss des Elternbeirats. Und dann als konkretes Ja der Eltern, dass sie sich an dem Schulversuch mit eigenem Geld beteiligen. Das Ministerium versicherte, auszuschließen, “dass einzelne Schüler ‘aus der Klasse fliegen’, weil sich ihre Eltern kein Endgerät leisten können oder wollen.”
Der Eigenanteil der Eltern liege wahrscheinlich bei 150 Euro plus. Ein handelsübliches Tablet für den Schulgebrauch etwa koste mit Hülle und Stift etwa 450 Euro. Nach oben sind dann wenig Grenzen gesetzt, wenn die Eltern nicht nur eine Speicherkapazität von 32 Gigabyte (GB), sondern eventuell von 256 GB für ihre Kinder wollten. Welche praktischen Folgen das für den sozialen Alltag in der Schule habe, müsse man abwarten.
Betrachtet man den Ausschreibungstext genau, geht es in Wahrheit um zwei Schulversuche: Zum einen den geradezu futuristischen Ansatz einer neuen digitalen Schule der Zukunft, bei der grundlegende Erkenntnisse über Schulentwicklungsprozesse gewonnen werden sollen. Zum anderen um die Frage, wie eine Schulbürokratie über den Umweg der Eltern die Finanzen besser kontrolliert – und das Geräte-Management vereinfacht. Im Deutsch der bayerischen Schulbehörde liest sich das so: “Ziel ist die Gewinnung von Erkenntnissen für einen pädagogischen Gesamtansatz einschließlich der Erprobung von Beschaffungsverfahren.” An diesen Beschaffungsverfahren, das muss man wissen, droht der große bundesweite Digitalpakt gerade zu scheitern.

Ein Gastbeitrag von Richard Münch
Seit drei Jahrzehnten stehen Schulreformen weltweit auf der Tagesordnung. Sie sollen Bildungsleistung verbessern, Leistungsunterschiede abbauen und Auswirkungen des familiären Hintergrunds auf die Leistung verringern. Diese Reformen haben einen gemeinsamen Kern, der den Schwerpunkt auf Schulautonomie, freie Schulwahl, Wettbewerb zwischen Schulen, starkes Schulmanagement, hohe Lehrerqualität und testbasierte Rechenschaftspflicht von Schulen legt.
Allerorts wurden Bildungssysteme in diesem Sinne umgebaut. Doch klafft eine Forschungslücke: Wir wissen nicht ausreichend, inwieweit die Anwendung von Steuerungsinstrumenten im Rahmen der globalen Reformagenda einen Unterschied macht. Daher haben wir statistische Analysen durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen den Reformen und den individuellen Schülerleistungen sowie Leistungsunterschieden aufgrund des familiären Hintergrunds zu untersuchen. Dazu haben wir PISA-Ergebnisse aus dem Vereinigten Königreich (ohne Schottland), Deutschland, Schweden und Finnland aus den Testwellen 2000, 2009 und 2015 herangezogen. Haben sich die Leistungen im Laufe der Zeit, mit den fortschreitenden Reformen, verbessert und die Leistungsungleichheiten verringert?
Im Vereinigten Königreich wurden seit den 1980er Jahren umfangreiche Reformen durchgeführt, von denen die konsequentesten in England die freie Schulwahl auf einem Bildungsmarkt, eine größere Autonomie der Schulen und im Gegenzug eine verstärkte Leistungskontrolle beinhalteten. Das ursprünglich gegliederte Schulsystem wurde bis auf 163 Gymnasien zugunsten eines Gesamtschulsystems abgebaut. In Deutschland wurde nach dem “PISA-Schock” von 2000 das Monitoring der Schulen ausgeweitet und in einigen Bundesländern wie z. B. Niedersachsen die Autonomie der Schulen bei gleichzeitiger Betonung der Selbstkontrolle und Rechenschaftspflicht gestärkt. Bildungsmärkte wie im Vereinigten Königreich wurden jedoch nicht eingerichtet, und das gegliederte Schulsystem mit dem Gymnasium an der Spitze wurde beibehalten.
Schweden hat seit Anfang der 1990er Jahre umfassende marktorientierte und auf verstärkte Rechenschaftspflicht ausgerichtete Reformen vollzogen. Finnland hat sich seither ebenfalls an der globalen Reformagenda orientiert, allerdings in gemäßigterer Form. Der Schwerpunkt lag auf Dezentralisierung, Verantwortung der Gemeinden, Diversifizierung der Lehrpläne und Erleichterung der Schul- oder Lehrplanwahl durch die Eltern. Auf strenge Maßnahmen der Rechenschaftspflicht verzichtete man. Die Treuhänderschaft der Lehrer blieb weiterhin im Vordergrund.
Betrachtet man die Ergebnisse für das Vereinigte Königreich, so belegen die von uns konsultierten empirischen Studien, dass die forcierte Förderung der freien Schulwahl auf Bildungsmärkten nicht mit einer Steigerung der Bildungsleistungen einherging. Vielmehr reproduzierten oder verstärkten sich sogar Bildungsungleichheiten. Die größere Autonomie der Schulen, gepaart mit verschärfter Leistungskontrolle, hat die Dokumentationsarbeit von Schulleitungen und Lehrern massiv erhöht und den Unterricht auf zentrale Fächer und Testvorbereitung verengt.
Für Deutschland gibt es im Gegensatz zum Vereinigten Königreich weniger empirische Studien zu den Wirkungen der Reformmaßnahmen. Die Bildungsberichterstattung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) belegt jedoch eindeutig, dass es keine signifikanten Leistungsverbesserungen gegeben hat und dass nach wie vor große Leistungsunterschiede aufgrund des familiären Hintergrunds bestehen.
Weder im Vereinigten Königreich noch in Deutschland: Unsere statistische Analyse der PISA-Daten hat keine Belege dafür erbracht, dass die marktorientierten oder bürokratisch-professionellen Reformstrategien, die auf eine umfassende Überwachung der Schulen abzielen, mit sichtbaren Leistungssteigerungen und einer signifikanten Verringerung der Leistungsunterschiede nach sozialer Herkunft verbunden gewesen wären. Der sozioökonomische Status der besuchten Schule im Schülerdurchschnitt und des einzelnen Schülers sowie in weit geringerem Maße die Schuldisziplin sind von entscheidender Bedeutung. In Deutschland zeigt sich dies nach wie vor in einem in Leistungsklassen gegliederten Schulsystem, inzwischen aber auch in einer zunehmenden Leistungsdifferenzierung im Gymnasium.
Im Gesamtschulsystem des Vereinigten Königreichs sehen wir eine etwas geringere Leistungsdifferenzierung zwischen den Schulen nach dem durchschnittlichen sozioökonomischen Status ihrer Schüler und eine etwas stärkere Leistungsdifferenzierung innerhalb der Schulen nach dem sozioökonomischen Status des einzelnen Schülers als in Deutschland. Allerdings wird der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Leistungen der Schüler im Vereinigten Königreich dadurch etwas unterschätzt, dass dort im internationalen Vergleich ein sehr niedriger Prozentsatz der Fünfzehnjährigen am PISA-Test teilgenommen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die leistungsschwächeren Schüler im Test unterrepräsentiert waren, ist sehr hoch.
Was Schweden und Finnland betrifft, so haben unsere Literaturrecherche und statistischen Analysen der PISA-Daten keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass marktbasierte Reformen in Schweden und Dezentralisierungsreformen in Finnland zu sichtbaren Erfolgen geführt hätten. Die Reformstrategien ändern nichts an der überragenden Wirkung struktureller Faktoren und ihrer institutionellen Verankerung im Schulsystem. Anders als von der globalen Reformbewegung postuliert, haben sich die Steuerungsinstrumente weder in Schweden noch in Finnland als wirksam erwiesen.
Der durchschnittliche sozioökonomische Status der Schüler einer besuchten Schule und des einzelnen Schülers ist entscheidend. Vor dem Hintergrund größerer sozialer Ungleichheit und stärkerer Differenzierung durch Wettbewerb im Schulsystem ist dies in Schweden mehr und früher der Fall gewesen als in Finnland. Aber auch Finnland hat sich in diese Richtung entwickelt. Die Verringerung der Chancengleichheit in Finnland ist auf das Zusammentreffen dreier Veränderungen zurückzuführen: die verstärkte Nutzung der Schul- oder Lehrplanwahl durch die besser gestellten Eltern im Vergleich zu den schlechter gestellten, die zunehmende Heterogenität der Bevölkerung durch Zuwanderung und die geringere Unterordnung unter die Autorität der Lehrer als das in der Vergangenheit der Fall war. Da es keine Belege für den Erfolg der globalen Reformbewegung gibt, ist unsere Schlussfolgerung für die Politik, diese Agenda zu überdenken.
Richard Münch ist Seniorprofessor für Gesellschaftstheorie und komparative Makrosoziologie an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Der hier veröffentlichte Beitrag resultiert aus einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt über “Effektive Schulsteuerung”.
Eine 50-köpfige Jury aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Bildungsverwaltung hat die Schulen für die nächste Runde des Deutschen Schulpreises ausgewählt. Bis Juli besuchen Juryteams die 20 Nominierten und wählen bis zu 15 Schulen für die finale Runde aus. Schulen aus zehn verschiedenen Bundesländern sind unter den TOP 20. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit sechs ausgewählten Schulen (Liste der Nominierten). 81 Bildungseinrichtungen aus 14 Bundesländern haben an dem Wettbewerb, der dieses Jahr unter dem Motto “Unterricht besser machen” steht, teilgenommen. Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung gemeinsam mit der Heidehof Stiftung verliehen und ist mit 100.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 28. September in Berlin statt. npr
Der Digitalpakt sorgt für mehr Ungleichheit, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). “Die aktuelle Umsetzungspraxis des Digitalpakts gefährdet die Chancengleichheit in den Schulen und erinnert an einen Flickenteppich“, sagte Anja Bensinger-Stolze, die Schul-Sprecherin des Hauptvorstands der GEW ist. “Die Bildung der Kinder darf weder von der Finanzlage einzelner Kommunen noch von einer zufälligen Digitalisierungsaffinität einzelner Lehrkräfte abhängig sein.” Die Studie lief von August 2020 bis März dieses Jahres, ihr Autor ist der Forscher Michael Wrase.
Mit den Ergebnissen können Länder und Bund nicht zufrieden sein. Die KMK etwa verfehlt ihr selbst gestecktes Ziel aus dem Jahr 2016. Die Kultusminister:innen wollten damals erreichen, “dass möglichst bis 2021 jede Schülerin und jeder Schüler jederzeit, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen können sollte.” Das allerdings ist nicht gelungen. Obendrein wisse der Bund so wenig wie die Länder, wie eine realistische Sicht auf den Digitalpakt aussieht. Eigentlich hätten sich, heißt es in dem Papier, Bund und Länder “dazu verpflichtet, ‘jährlich’ einen zusammenfassenden Fortschrittsbericht mit allen gesammelten Informationen zu veröffentlichen.” Auch das aber ist nicht geschehen – wie auch der Bundesrechnungshof in einer kritischen Stellungnahme festgestellt hat.
Laut Studie verschärfte der Digitalpakt bestehende Ungleichheiten im Bildungssystem. Schulkinder an Gymnasien hätten ein “deutlich höheres Niveau” in “computerbezogenen Kompetenzen” als solche von nicht-gymnasialen Einrichtungen. Die Ungleichheit in digitaler Kompetenz ließe sich entlang der Herkunft aus sozialen Klassen nachweisen, was an den schulformbezogenen Unterschieden der Digitalisierung liegt und für ein zutiefst ungerechtes Bildungssystem spricht. Es hänge oft zu sehr von einzelnen Lehrkräften ab, ob Kinder digitale Kompetenzen erwerben oder nicht.
Probleme erkannte die Studie vor allem beim Zusammenspiel der vier “Ebenen” des Digitalpakts: dem Bund als Mittelgeber, den Ländern als Förderträger, Städten und Kommunen als Schulträgern und den Einzelschulen. Für eine “gelingende schulische Digitalisierung” definiert die Studie vier zentrale Faktoren: Sicherstellung “leistungsfähiger Basisinfrastruktur” wie Endgeräten, der Gewährleistung von Administration und Support, Weiterbildung von Personal und der Initiierung nachhaltiger digitaler Schulentwicklungsprozesse.
Allerdings hat die Studie auch einen gewaltigen Nachteil: Die ursprüngliche Idee, alle 16 Bundesländer nach ihren Vorstellungen und Plänen zu fragen, musste ad acta gelegt werden. Es antworteten nur fünf Länder. Die anderen schwiegen, weil es ihnen an “personellen Ressourcen” für die Beantwortung derartiger Anfragen mangele. Mit anderen Worten: Die Länder machen kein eigenes Monitoring des Digitalpakts – und sie lassen auch kein externes zu. Robert Saar
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) führt gegenwärtig eine internationale Umfrage durch. In Deutschland befragt dafür das WeQ Institute Lehrerinnen und Lehrer zu “Digitalisierung in der Bildung und deren Bedeutung für Lehrkräfte”. Die gemeinnützige WeQ GmbH unter Zukunftsforscher Peter Spiegel sucht nun nach Teilnehmenden aus den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Teilnehmen können Lehrkräfte, Schulleitungen und Expert:innen im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Den Fragebogen können Interessierte unter office@weq.institute anfordern. Die gegenwärtige Lehrer-Umfrage wird von verschiedenen Organisationen in Europa und Afrika durchgeführt. Die IAO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie soll unter anderem Menschen- und Arbeiterrechte fördern und veröffentlicht entsprechend Studien und Berichte – auch zum Bildungssektor. Enno Eidens

Wie genau funktioniert das mit dem Schwangerwerden? Warum wissen wir so wenig darüber, wie sich sexuelle Krankheiten übertragen? Mit solchen Fragen begann die Geschäftsidee der Gründerinnen Carolin Strehmel und Vanessa Meyer, aus der die Knowbody-App entstand. Die steht nun kurz vor dem Launch. Mit Knowbody möchten die beiden an den Schulen über Sexualität, Gefühle und Körper aufklären.
Die erste Umfrage von Strehmel und Meyer unter Kommiliton:innen in der Uni-Mensa hatte ein wenig überraschendes Ergebnis. Kaum jemand hatte gute Erinnerungen an seinen oder ihren Sexualkunde-Unterricht – wenn sie sich überhaupt erinnern konnten. “Wir waren fassungslos”, sagt Carolin Strehmel. Und da sie und ihre Freundin gerade für die Masterarbeiten Online-Umfragen konzipierten, erstellten sie noch eine weitere für Lehrkräfte. Sie wollten herausfinden, wie präsent das Thema sexuelle Aufklärung im Biologie-Lehramtsstudium heute ist. Das Ergebnis ihrer Umfrage: 70 Prozent der Lehrkräfte waren gar nicht ausgebildet. Trotzdem waren sie die Einzigen, die an ihren Schulen zu Sexualität unterrichten.
“Das ist der Zustand in einer aufgeklärten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und gleichzeitig hängen gut sichtbar auf den Straßen halbnackte Körper, die für Unterwäsche werben“, sagt Carolin Strehmel. Das Thema ließ sie und ihre Kommilitonin Vanessa Meyer nicht mehr los. Und irgendwann entstand die Idee, eine App zu entwickeln, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Also scharrten die Beiden ein kleines Team um sich. Es bestand aus Sexualpädagoginnen, Lehramtsstudierenden, zwei Designern und einem Programmierer. So bewarben sie sich um ein Gründerstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen.
Eine erste Hürde für das Start-up war die Beschaffung der Informationen. Obwohl das Internet Unmengen an Wissen bereitstellt, scheint der neueste Stand der Wissenschaft sich eher selten in Publikationen wiederzufinden. Viele Lehrbücher, die heute noch in Schulen Verwendung finden, stammen aus den 1990ern. Sie beinhalten veraltete Bilder und behandeln das Thema Sexualität und Fortpflanzung mit Fingerspitzen. Wenn Lehrkräfte zeitgemäßen Sexualunterricht abhalten wollen, müssen sie besonders umfangreich recherchieren. Die App von Carolin Strehmel und Vanessa Meyer soll sie dabei unterstützen.
In der App gibt es Informationen zu acht Gebieten: “Beziehungen”, “Sexualität”, “Geschlecht”, “sexuelle Selbstbestimmung”, “Familie und Familienplanung”, “Sexualität und Medien”, “Vielfalt und Gesellschaft” sowie einen Bereich über “Körper”. Bei letzterem wird der Menstruationszyklus mit Abbildungen und Text erklärt und die Unterschiede zwischen Tampons, Binden und Cups herausgearbeitet. Unter “Geschlecht” geht es um verschiedene Identitäten, Stereotype oder toxische Männlichkeit. Es ist ein Mix aus Informationen, weiterführenden Links und von eigens für die App designten Abbildungen, die die Unterschiedlichkeit aller menschlichen Körper versuchen einzufangen.
Die Idee ist, dass Lehrer:innen die Knowbody-App ohne viel Vorbereitung nahtlos in ihren Unterricht integrieren können. Dafür hat das Team um Carolin Strehmel Handouts für Lehrkräfte konzipiert, die sie auf die jeweiligen Module vorbereiten und trotzdem genug Raum lassen für eigene Impulse.
Die App richtet sich an alle Schulformen der weiterführenden Schulen: Förderschulen, Realschulen, Gymnasien, Haupt- oder Gesamtschulen von der sechsten bis zur zehnten Klasse. Zurzeit wird sie an verschiedenen Schulen getestet. Mehr als 100 Registrierungen von Lehrkräften aus fast allen Bundesländern, die Knowbody in ihren Klassen einsetzen, gebe es bereits, sagt Carolin Strehmel.
Die Lehrkräfte und Schüler:innen füllen Fragebögen aus, damit die Testversion der App erweitert oder präzisiert werden kann. Für manche Tests setzt sich Carolin Strehmel auch in den Klassenraum in die letzte Reihe und beobachtet im Feld, wie die App im Unterricht funktioniert.
Besonders viel diskutieren Schüler über das Thema Heteronormativität. Also eine Weltsicht, die vorgibt, das Normale sei Sex ausschließlich zwischen Männern und Frauen und dass jeder Mensch sich auch dem Geschlecht zugehörig fühlt, das ihm bei der Geburt zugeschrieben wurde. Knowobody will ein breiteres Bild vermitteln: Es gibt nicht nur weiblich und männlich, es gibt auch Trans-Identitäten oder Menschen, die sich gar nicht auf ein Geschlecht festlegen wollen. Und Sex ist viel mehr, als die Penetration einer Frau durch einen Mann.
Im Juni endet die Testphase, im September soll das Endprodukt auf den Markt kommen, dann endet die Anschubfinanzierung des Bundeswirtschaftsministeriums. Für vier Euro soll die App dann pro Nutzer:in im App-Store erhältlich sein. Sie soll nicht nur an Kommunen, Schulen und Klassen verkauft werden, sondern auch für jeden einzelnen verfügbar sein.
06. Mai 2022, 15:00 bis 17:00 Uhr
Fachgespräch (Online): Neue Lernkultur für alle Schulen!
Die Heinrich-Böll-Stiftung lädt zur digitalen Gesprächsrunde ein: Wie können Kinder und Jugendliche die Kompetenzen, Haltungen und Werte erwerben, die sie für ein selbstbestimmtes Leben brauchen? Im Fokus des Fachgesprächs steht ein Impulspapier, in dem ein Kreis von Autoren Vorschläge und Ideen für eine neue Lernkultur an den Schulen skizziert. Infos & Anmeldung
04. Mai bis 06. Juli 2022, jeweils 16:00 Uhr
Vortragsreihe: Unterricht reflektieren – Kompetenzen von Lehrkräften stärken
Mit einer mehrteiligen Vortragsreihe wollen die Goethe-Universität Frankfurt, die Akademie für Bildungsforschung und Lehrkräftebildung und das IDeA-Zentrum Tipps und Empfehlungen geben, wie Lehrkräfte den eigenen Unterricht stetig reflektieren und verbessern können. Wie wähle ich meine Inhalte aus? Wie spreche ich meine Schüler an? Wie gelingt eine echte Feedbackkultur im Klassenzimmer? Infos & Anmeldung
09. bis 19. Mai 2022
Online-Kurs: Learning Experience Design
Spannend für Schulentwickler und Personaler: Die time4you GmbH bietet Kurse und Veranstaltungen an, in denen das Handwerkszeug vermittelt wird, um in der eigenen Organisationen eine Lernplattform oder Online-Akademie aufzubauen oder mehrere Teams – in der Schule oder im Unternehmen – miteinander zu vernetzen. Dabei wird auch über Stolpersteine wie die DSGVO und fehlende IT-Kenntnisse gesprochen. Infos & Anmeldung
13. bis 14. Mai 2022, jeweils 09:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltung: Berufsinformationsmesse
Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, der richtigen Weiterbildung oder Impulsen für die eigene berufliche Zukunft? Die Berufsinfomesse (BIM) in Offenburg bietet über 2000 Events, Stände und viele Informationen zu Aus- und Weiterbildung, Berufsfeldern, Studiengängen und Praktika im In- und Ausland. Infos & Anmeldung